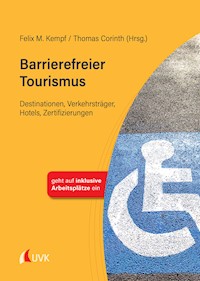
Barrierefreier Tourismus E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: UVK
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Reisen ohne Hindernisse - für alle! Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Dieser Artikel des Grundgesetzes gilt auch im Tourismus. Felix M. Kempf und Thomas Corinth zeigen deswegen die Besonderheiten des barrierefreien Tourismus auf - mithilfe zahlreicher Expert:innen. Sie beleuchten die ökonomische Bedeutung und zeigen, worauf das Destinationsmanagement, die Verkehrsträger und die Hotels achten müssen. Das Handbuch richtet sich an Studierende der Tourismuswissenschaften und an Praktiker:innen im Tourismus.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 338
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Felix M. Kempf / Thomas Corinth (Hrsg.)
Barrierefreier Tourismus
Destinationen, Verkehrsträger, Hotels, Zertifizierungen
unter Mitarbeit von Matthias Johannes Bauer, Josephine Bütefisch, Alexandra Carl, Nele Dugrillon, Sophia Hentschel, Valeria Sophia Hufnagel, Laura Jäger, Anika Klotz, Nico-Arthur Lange, Angela Lindfeld, Julia Niggemann, Maria Opitz, Sarah-Louise Philippi, Magdalena Reiß, Joel Sauber, Sven Schmalz, Sonja Wischmann
UVK Verlag · München
Prof. Dr. Felix M. Kempf (rechts) ist Studiengangsleiter Tourismusmanagement an der IST-Hochschule für Management in Düsseldorf. Er ist zudem Dekan des Fachbereichs Tourismus & Hospitality.
Thomas Corinth (links) ist Studiengangsleiter Hotelmanagement an der IST-Hochschule für Management in Düsseldorf. Er verfügt über mehr als 25 Jahre Berufserfahrung in der internationalen Hotellerie.
Umschlagabbildung: © FooTToo · iStockphoto
Autorenfoto: © IST-Hochschule
DOI: https://doi.org/10.24053/9783739882208
© UVK Verlag 2023— ein Unternehmen der Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KGDischingerweg 5 • D-72070 Tübingen
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetztes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Alle Informationen in diesem Buch wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Fehler können dennoch nicht völlig ausgeschlossen werden. Weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen übernehmen deshalb eine Gewährleistung für die Korrektheit des Inhaltes und haften nicht für fehlerhafte Angaben und deren Folgen. Diese Publikation enthält gegebenenfalls Links zu externen Inhalten Dritter, auf die weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen Einfluss haben. Für die Inhalte der verlinkten Seiten sind stets die jeweiligen Anbieter oder Betreibenden der Seiten verantwortlich.
Internet: www.narr.deeMail: [email protected]
ISBN 978-3-7398-3220-3 (Print)
ISBN 978-3-7398-0617-4 (ePub)
Inhalt
„Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.“
Artikel 3, Satz 3
Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland
1Willkommen zum barrierefreien Reisen!
Der Tourismus ist im Wandel begriffen. Die Coronapandemie und ihre Begleiterscheinungen machen ein erhöhtes Qualitätsniveau erforderlich. Nachhaltiges Denken prägt die Gesellschaft. Es entstehen angepasste Angebote in vielen Branchen; so auch im Tourismus. Zumeist wird ein Hauptaugenmerk auf die ökologische Nachhaltigkeit gelegt. Die soziale Nachhaltigkeit findet häufig im Gewand einer Diskussion um Overtourism Erwähnung, also um die veränderten Umfeldbedingungen der Bereisten.
Gleichzeitig verändert sich die Gesellschaft – und damit Kund:innen – durch den demografischen Wandel. Das bedeutet, dass alle Menschen im Durchschnitt älter werden. Im breiten Spektrum des Begriffs verbirgt sich somit auch, dass insgesamt die Gebrechen der Bevölkerung zunehmen. Die Mitglieder der Gesellschaft werden daher in Zukunft noch mehr Ansprüche an ihr Umfeld stellen, um ihren Alltag zu meistern. Für den Tourismus bedeutet das, dass die Angebote entsprechend gestaltet werden müssen.
Die Beratung für Reisen ins Ausland (Outgoing) wird dadurch komplexer. Aber auch im Inland (Domestic und Incoming) müssen die Weichen gestellt werden, um den Ansprüchen der Kund:innen gerecht zu werden. Derzeit gibt es in Deutschland noch keine flächendenkende Verbreitung von barrierefreien touristischen Angeboten (Liem 2019, 7). Es ist zum einen eine politische Aufgabe, dass angemessene Bedingungen für eine Feriengestaltung geschaffen werden (Wilken 2002, 27). Aber zum anderen muss auch die Privatwirtschaft ihren Teil dazu beitragen. Die Mitarbeiter:innen im Tourismus sind häufig schlecht vorbereitet, wenn sie sich um behinderte bzw. eingeschränkte Kund:innen oder auch Menschen mit besonderen Bedürfnissen kümmern müssen (Daniels, Rodgers und Wiggins 2005, 919). Verkaufspersonal ist noch nicht darin geschult, behinderte Menschen zu bedienen. Und das, obwohl sie die gleichen Bedürfnisse wie alle anderen haben (Felizardo, Troccoli und Scatulino 2018, 75).
An der IST-Hochschule in Düsseldorf haben wir Studiengangsleiter (und Herausgeber dieses Buchs) des Fachbereichs Tourismus & Hospitality uns vor einigen Jahren den Forschungsschwerpunkt des barrierefreien Reisens gesetzt. Mittlerweile haben wir es um das Thema des inklusiven Arbeitens im Tourismus stringent ergänzt. In den Vorlesungen binden wir das Thema immer ein und sensibilisieren die nächste Generation dafür. Besonders erfüllt uns mit Stolz, dass viele junge Menschen sich gerne dem Thema zuwenden. Viele Bachelor- und Hausarbeiten drehen sich um das Thema.
Es war nun an der Zeit, die Ergebnisse strukturiert zusammenzufassen und nach außen zu tragen. Zunächst erfolgt eine Hinführung zum Thema (→ Kapitel 2–6). Diese beinhaltet Begriffseinordnungen und einige grundsätzliche Gedanken (→ Kapitel 2–3). Die ökonomische und rechtliche Einordnung findet statt (→ Kapitel 4–5). Reisende mit Beeinträchtigung werden beleuchtet (→ Kapitel 6). Danach werden tourismusspezifische Themen behandelt: Destinationsmanagement (→ Kapitel 7) und Zertifizierungen (→ Kapitel 8). Dann wird entlang der touristischen Servicekette vorgegangen: Verkehrsträger mit Airlines, Bahn, Kreuzfahrt und Hotels (→ Kapitel 8–12). Es folgen Überlegungen zu barrierefreien Webauftritten (→ Kapitel 13). Danach werden die unterschiedlichen Herangehensweisen in unseren Nachbarländern Frankreich, Italien und Luxembourg betrachtet (→ Kapitel 14). Das Buch schließt mit dem Forschungsfeld des inklusiven Arbeitens im Tourismus (→ Kapitel 15).
Unser besonderer Dank gilt allen Autor:innen, die mit ihren Kapiteln zum Gelingen dieses Buches beigetragen haben: Prof. Dr. Matthias Johannes Bauer, Josephine Bütefisch, Alexandra Carl, Nele Dugrillon, Sophia Hentschel, Valeria Sophia Hufnagel, Laura Jäger, Anika Klotz, Nico-Arthur Lange, Prof. Dr. Angela Lindfeld, Julia Niggemann, Maria Opitz, Sarah-Louise Philippi, Magadalena Reiß, Joel Sauber, Sven Schmalz und Sonja Wischmann.
In diesem Buch fallen Begriffe wie Menschen mit Behinderung, Menschen mit Einschränkung etc. Alle diese Begriffe können tief differenziert werden. Das mag im Einzelfall notwendig sein. Dem Gesamtbild ist es aber hinderlich. In diesem Buch wird versucht, das Thema an sich pragmatisch und zielorientiert aufzuarbeiten. Und die meisten Betroffenen, so die Erfahrung der Herausgeber, begrüßen diesen Weg.
Düsseldorf und Mettmann, im März 2023
Prof. Dr. Felix M. Kempf und Thomas Corinth
2Einordnung des Begriffs BehinderungBehinderung
BehinderungBehinderung als Begriff markiert eine von Kriterien abhängige Differenzierung. Sie zeigt eine Relation an, die an verschiedene Kontexte gebunden ist (Dederich 2009, 15). Dabei ist sie als ein soziales Konstruktsoziales Konstrukt kulturbezogen und kann mit der Zeit einer Veränderung unterliegen (Darcy und Buhalis 2011, 21). Nach der chinesischen Philosophie des Yin und Yang setzt jede Existenz auch die Existenz eines anderen voraus (Zhao 2020). Für den Tourismus würde das bedeuten: Reisende ohne Beeinträchtigung kann es nur geben, wenn es auch Reisende mit Beeinträchtigung gibt (Kempf, Lindfeld und Corinth 2021, 173).
Allein das Wort ‚Behinderung‘ zeigt schon, wie schwer sich die deutsche Sprache damit tut. Es kann nämlich aktivisch und passivisch ausgelegt werden. Der Sprachgebrauch erlaubt zu sagen, dass jemand behindert ist und wird. Beide Ausprägungen werden immer wieder gemeinsam eingesetzt, um die wahrhafte Situation zu beschreiben.
International ist der Begriff der Behinderung durch die WHO geprägt und auch dort einem Wandel unterworfen. Eine intensive globale Auseinandersetzung mit und um behinderte Menschen im politischen Rahmen findet seit den 1980er-Jahren statt. In einer ersten Annäherung wurde damals eine dreistufige Definition entwickelt, die International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps (ICIDH)International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps (ICIDH) (→ Tabelle 1).
Impairment | Schädigung
Funktionsstörung des Körpers bzw. Schädigung auf der organischen Ebene
medizinisches Problem
Disability | Behinderung, Einschränkung
Aktivitäts- und Leistungsstörungen auf der individuellen und personalen Ebene aufgrund der Schädigung
psychologisches Problem
Handicap | Benachteiligung, Beeinträchtigung
Störungen bzw. Konsequenzen auf der sozialen Ebene aufgrund der Schädigung und der Behinderung
soziales/sozialpolitisches Problem
ICIDH-Erstentwurf von Formen der Behinderung nach WHO in den 1980er-Jahren (WHO 1980, 14)
Die eigentliche Behinderung ist dort nur ein Teil des Ganzen. Zunächst liegt eine Schädigung vor. Das bedeutet eine Funktionsstörung des Körpers. Beispielsweise können die Beine nicht bewegt werden und infolgedessen benötigt eine Person eine Gehhilfe. Es können aber auch organische Schäden hinzugezählt werden. So könnte jemand beeinträchtigt sein, weil er eine Hirnschädigung aufgrund eines Unfalls hat. Insgesamt handelt es sich um ein medizinisches Problem, dass ggf. sogar geheilt werden kann. So können beispielsweise Krebspatient:innen in Deutschland für die Dauer ihrer Erkrankung (zur Schaffung eines Nachteilsausgleiches) einen Antrag auf Schwerbehinderung stellen.
Aus der Schädigung ergibt sich dann die Behinderung. Sie beschreibt somit ein psychologisches Problem, denn es kommt zu Aktivitäts- und Leistungsstörungen auf der individuellen Ebene. Sollte also die körperliche Schädigung eine Einschränkung der Funktionsfähigkeit der Beine sein, könnte die Behinderung als Schwierigkeiten beim Laufen beschrieben werden. Die Behinderung könnte personenbezogen durch Therapien behandelt oder umfeldbezogen z. B. durch einen Aufzug gemindert werden.
Die Benachteiligung entsteht dann in der Teilhabe an der Gesellschaft. Eine Person mit Laufeinschränkungen kann nicht im üblichen Tempo Dinge verrichten und daher ggf. nicht oder nur schwerlich an einer Veranstaltung teilnehmen, die in einem großen räumlichen Umfeld stattfindet. Sie hat ein soziales Problem.
Wissen | BehinderungBehinderung und HandicapHandicap
Die beiden Begriffe werden im Deutschen und im Englischen unterschiedlich eingesetzt. Das gilt vor allem, da in der deutschen Umgangssprache und der Wissenschaft der Begriff ‚Behinderung‘ seit einigen Jahrzehnten sehr unterschiedlich verwendet wird. Das liegt im Wesentlichen daran, dass es ein medizinischer, psychologischer, pädagogischer, soziologischer oder bildungs- und sozialpolitischer Terminus sein kann, der in den verschiedenen Kontexten seine Anwendung findet (Dederich 2009, 15). Behinderung ist im Deutschen eher der gemeingebrauchte Universalbegriff für Impairment, Disability und Handicap. Außerdem ist die korrekte Übersetzung von „Behinderung“ ins Englische „HandicapHandicap“. Es sollte also immer hinterfragt werden, welche Begrifflichkeit genau gemeint ist.
Die ICIDH ist in ihrer Struktur ein Krankheitsfolgemodell. In den folgenden Jahren wurde es überarbeitet und ab 2001 durch die International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF)International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF), ein bio-psycho-soziales Modell der Komponenten von Gesundheit, ersetzt. In Deutschland bildet es die Grundlage des Neunten Buchs des SozialgesetzbuchSozialgesetzbuch (SGB)es (SGB IX). Wesentliche Aspekte sind dort unter Berücksichtigung der historisch gewachsenen und anerkannten Besonderheiten aufgenommen (WHO 2005, 4). Das ICF ist in drei individuelle Dimensionen und zwei Kontextfaktoren unterteilt. Beide haben Einfluss darauf, wie ein Mensch sich entwickelt.
Die drei Dimensionen zur Charakterisierung der individuellen Situation sind (WHO 2005, 17 ff.):
„ImpairmentImpairment“ sind die Funktionen und Strukturen des Körpers, die beeinträchtigt sein können (d. h., dass beispielsweise Organe oder Gliedmaßen nicht vollständig vorhanden sind und/oder ihre zugedachten Aufgaben vorübergehend oder dauerhaft nicht ausführen können).
„ActivityActivity“ meint Aktivitäten als Durchführung einer Aufgabe oder Handlung durch einen Menschen. Es zeigt das Maß der persönlichen Verwirklichung an.
„ParticipationParticipation“ bedeutet, dass ein Mensch in eine Lebenssituation einbezogen ist. Er hat damit teil am Leben in der Gesellschaft und ihren Angeboten.
Die zwei Kontextfaktoren des Modells lauten (WHO 2005, 22 f.):
„UmweltfaktorenUmweltfaktoren“ bilden die materielle, soziale und einstellungsbezogene Umwelt, in der die Menschen leben und ihr eigenes Leben gestalten. Sie liegen außerhalb des Einflussbereiches des Individuums und können den Menschen in seiner Leistungsfähigkeit positiv und negativ beeinflussen.
„Personenbezogene Faktorenpersonenbezogene Faktoren“ zeigen den speziellen Hintergrund des Lebens und der Lebensführung eines Menschen. Sie umfassen die Faktoren, die nicht Teil des Gesundheitsproblems oder seines Zustandes sind. Beispielsweise sind das Geschlecht, ethnische Zugehörigkeit, Alter, Lebensstil, Erziehung, Bildung und Ausbildung u. v. a. m.
Bildlich werden sie von der WHO folgendermaßen in Bezug gesetzt (→ Abbildung 1):
Klassifikation nach WHO 2005, 25
Das ICF hat den Vorteil, dass es die Lebenswirklichkeit von Betroffenen besser abbildet (WHO 2005, 4) als die ICIDH aus den 1980er-Jahren. Es rückt die unterschiedlichen Kontexte und Rahmenbedingungen stärker in den Fokus und das Individuum wird als Mitgestaltende:r der individuellen Situation begriffen. Das neue Modell ist nicht unwidersprochen, aber es scheint derzeit zumindest einen Minimalkonsens darzustellen (Dederich 2009, 16).
Im touristischen Sinne wird häufig auf vier Gruppen reduziert: Hören, Sehen, Mobilität sowie geistige und psychologische Einschränkungen (Yau, McKercher und Packer 2004, 947). Andere einschränkende Faktoren, wie Allergien oder religiöse Essensregeln, rücken erst langsam ins Bewusstsein von touristischen Anbietern. Das ICF-Modell in seiner Komplexität scheint noch nicht beachtet zu werden.
3TeilhabeTeilhabe an der Gesellschaft
Die Teilhabe von Menschen mit Behinderung an der Gesellschaft ist dauerhafter Natur. Daher ist es wichtig, eine geschichtliche Einordnung vorzunehmen und den Status quo vorzustellen. Begriffe wie Integration, Inklusion und Barrierefreiheit werden zusätzlich abgegrenzt, um eine Diskussionsbasis zu schaffen.
3.1Kurzer geschichtlichergeschichtlicher Abriss Abriss zu Behinderungen in der Gesellschaft
Die Teilhabe von behinderten Menschen an der Gesellschaft ist keine Selbstverständlichkeit. Sie basiert auf dem Verständnis des gegenseitigen Miteinanders in einer jeweiligen Kultur. Daher ist sie auch weltweit bzw. regional verschieden. In der Forschung galt die Geschichte des Umgangs von Menschen mit Behinderung zu Beginn des neuen Jahrtausends als eine neue geschichtlich-wissenschaftliche Teildisziplin. Sie ist unter dem Schlagwort „Disability History“ zu finden (Bösl, Klein und Waldschmidt 2010, 9).
Wissen | Der Ursprung des europäischen Verständniseuropäisches Verständnisses von BehinderungBehinderung
Kulturhistorisch liegen die Anfänge des europäischen Verständnisses von behinderten Menschen im antiken Griechenland und im Judentum. Beide eint, dass Behinderungen von Hören und Sprechen bedeutsam sind. Im antiken GriechenlandGriechenland, antikes dienten diese Sinne der möglichen Teilnahme an der Diskussion, in der jüdischen Gemeinschaft der Teilnahme am gläubigen Hören und Beten. Der Umgang mit Behinderung ist jedoch unterschiedlich. Im antiken Griechenland war nicht die Tötung geborener Kinder, sondern die Abtreibung das Mittel der Wahl. In Richtung einer Teilhabe an der Gesellschaft wurde nicht gedacht. Anders im JudentumJudentum, in dem Menschenopfer – und damit auch Kindstötungen – kategorisch ausgeschlossen werden. Dieser gedankliche Ansatz fließt auch in die christliche Religion ein (Brumlik 2013, 31 f.).
Es zeigt sich: Der Umgang mit Behinderung im europäischen MittelalterMittelalter wird als kontrovers beschrieben. Es gab auf der einen Seite eine bewusste Fürsorge, die auf der christlichen Nächstenliebe basierte. Sie galt wohl denen, die ihre Behinderung im Laufe des Lebens erworben haben. Demgegenüber stand eine Dämonenfurcht bei Neugeborenen, die zu Kindstötungen führte („Das Kind ist vom TeufelTeufel besessen“). Leitkriterium des Verhaltens schien also gewesen zu sein, ob die Behinderung von Geburt an bestand oder im Laufe des Lebens erworben wurde (Brumlik 2013, 32 f.).
Eine weitere Ausprägung war die Degradierung von körperlich oder kognitiv Behinderten zu Objekten von Komik und Lachen. Es gab die sogenannten „natürlichen Narren“, „Hofzwerge“, Menschen mit Kropf, Kretinismus und blinde oder gehörlose Menschen. Sie wurden zu Hofe gebracht und sollten dort die Herrschenden zerstreuen, unterhalten und zum Lachen bringen. Eine kritische Betrachtung dieses Umgangs mit Behinderung ist wohl nur durch den KlerusKlerus erfolgt. Thomas von Aquin lehnte ein Lachen über menschliche Andersheiten als Ausdruck von Fleischlichkeit, Überlegenheit und Sünde ab. Seine moralische Kritik sollte aber erst im 18. Jahrhundert in der übrigen Gesellschaft wirksam werden. Im Zuge der Aufklärung galt das Lachen über Andersartigkeit nicht mehr als unterhaltsam und kurzweilig, sondern wurde für abstoßend und höhnisch empfunden (Gottwald 2010, 236, 241).
Ab dem ausgehenden Mittelalter gab es vereinzelt die ersten Einrichtungen für geistig behinderte Menschen (Mattner 2000, 24). Dabei wurde bis zum Ende des 18. Jahrhunderts nicht zwischen den Erkrankungen der Insass:innen unterschieden und Menschen mit geistiger oder physischer Behinderung kamen zusammen, teils sogar mit Strafgefangenen. Es waren Orte, die als Narren-, Toll- oder Arbeitshäuser verstanden wurden (Häßler und Häßler 2005, 43). Ab dem 19. Jahrhundert kann von einer Etablierung von Einrichtungen für Behinderte gesprochen werden (Mattner 2000, 24). Der aufkommende HumanismusHumanismus, bei dem es um die Einschätzung der Fähigkeiten des Menschen ging, förderte in seiner Art auch ein Interesse an der Erforschung von behinderten Menschen (Häßler und Häßler 2005, 43). Im 19. Jahrhundert wurden die Volksschulen in Deutschland zur Alphabetisierung der Gesellschaft eingeführt. Das geschah auch für das Militär, denn die Gesundheit der Kinder, die durch Kinderarbeit zurückging, musste gesichert werden. Parallel dazu entstanden Einrichtungen für Kinder (und Erwachsene), die nicht in das Konzept passten. Sie waren hauptsächlich christlich initiiert. Begriffe wie „Idiotenanstalten“ stammen aus dieser Zeit (Droste 1999, 18).
Das prägendste Ereignis des 20. Jahrhunderts war wohl der Zweite Weltkrieg. Die Gräueltaten des NS-Regimes sind eng mit Begriff des HolocaustHolocausts verbunden. Auf gleicher Ebene ist auch der Umgang des NS-Regimes mit behinderten Menschen zu sehen. Sie wurden als nicht lebenswert – und in Kriegszeiten als „nutzlose Esser“ – dargestellt. Durch die Aktion „T4“ (benannt nach der Koordinationsstelle, die in der Berliner Tiergartenstraße 4 ansässig war) wurden 1939–1945 ca. 200.000 Menschen unter dem beschönigenden Begriff der Euthanasie systematisch ermordet (Aly 2021, 9 ff.). Ein dunkler Fleck menschlicher Geschichte, mit dem eine Auseinandersetzung schwer emotional möglich erscheint. Er hat lange nachgewirkt. Ein Bänker erzählte dem Herausgeber die Geschichte, dass er in den Anfängen seiner Tätigkeit in den 1970er-Jahren eine Behindertenwerkstatt aus beruflichen Gründen besuchte. Ihm fiel auf, dass dort keine alten behinderten Menschen arbeiteten. Er fragte dazu den Geschäftsführer und der erklärte ihm, dass es eben aufgrund der Geschichte in Deutschland keine gäbe. Vielleicht ist das auch ein Grund, dass die gesamte Diskussion in Deutschland im Vergleich zu vielen anderen Ländern mit einer zeitlichen Verzögerung von etwa 20 Jahren erfolgt, denn die Betroffenenverbände etc. konnten sich aufgrund der Situation erst mit Verzögerung ausbilden.
Stark vereinfacht kann die Geschichte des Umgangs mit Behinderten in der Gesellschaft auch über die Grenzen Deutschlands hinweg so dargestellt werden, dass sie versteckt wurden und keine Chance hatten, am normalen Leben teilzunehmen (Smith, Amorin und Umbelino 2013, 7 f.). Geholfen wurde Behinderten und ihren Familien von Gesundheitsorganisationen, die im jeweiligen Land vertreten waren, oder durch Freiwilligenorganisationen (Oliver, Sapey und Thomas 2012).
3.2TeilhabeTeilhabe heute
Eine Person erkrankt. Sie kann nicht mehr wie üblich am sozialen Leben teilnehmen. Sie geht zum Arzt, wird geheilt und kehrt in ihr normales, vorheriges Leben zurück. So einfach und wünschenswert kann ein Prozess um Gesundheit beschrieben werden.
Wissen | Der Unterschied zwischen dem medizinischen und dem sozialen Modell
Für Behinderungen könnte das gleiche Vorgehen gelten. Sie ist ein persönliches Problem, das zu Einschränkungen führt. Eine medizinische Unterstützung kann helfen, um die Behinderung zu lindern oder gar zu heilen. Danach ist wieder eine Teilhabe am sozialen Leben möglich. Diese Betrachtungsweise wird medizinisches Modellmedizinisches Modell genannt (Darcy und Buhalis 2011, 4 f.). Es ist gut geeignet, um die Situation bei kurzfristigen, temporären Behinderungen zu beschreiben. Aber wenn das Problem länger anhält oder unheilbar ist, zeigen sich seine Limite auf.
Ein Gegenkonstrukt bildet das soziale Modellsoziales Modell. Dort ist der Grund, warum ein Mensch mit Behinderung nicht am sozialen Leben teilhaben kann, (s)eine Umwelt, die nicht für ihn geschaffen ist. Die Intervention setzt folglich nicht beim Menschen an, sondern bei der Umwelt. Sie muss so gestaltet werden, dass alle daran teilhaben können. Dieser Ansatz ist nicht medizinisch, sondern sozial, politisch, wirtschaftlich, ideologisch und die Einstellungen der Menschen betreffend (Darcy und Buhalis 2011, 4 f.).
Beide Modelle sollten dabei nicht als sich gegenseitig ausschließend verstanden werden. Sie bilden die Pole eines Kontinuums. Behinderung ist zum einen der pathogene Zustand (von gewisser Dauerhaftigkeit) und zum anderen der soziale Bewertungsprozess (Zepf 2000, 368).
Waldschmidt (2005) möchte die beiden Modelle noch um ein drittes ergänzen. Dabei soll die kulturwissenschaftlichen Perspektive eingenommen werden. Behinderung ist dann kein individuelles Schicksal mehr (medizinisches Modell) oder eine diskriminierte Randgruppenposition (soziales Modell). Vielmehr wird in Form einer Dekonstruktion das Gegenteil, die Normalität, hinterfragt. Es gibt dann nicht mehr, wie im sozialen Modell, zwei binäre, strikt getrennte Gruppen (behindert – nicht behindert). Es werden vielmehr die Ausgrenzungsprozesse hervorgehoben und das kulturelle Deuten von „eigen“ und „fremd“ erlangt Bedeutung. Sie nennt es das kulturelle ModellModell, kulturelles (Waldschmidt 2005, 24–27).
So spannt sich ein Dreieck auf (→ Abbildung 2), das an jedem seiner Eckpunkte wohlbegründet ist. Jedes Modell ist für sich richtig, aber nur im Dreiklang kann ein Konsens erreicht werden, der die Situation von Menschen mit besonderen Bedürfnissen beschreibt.
Drei Verständnisansätze zum Umgang mit Menschen mit besonderen BedürfnissenMenschen mit besonderen Bedürfnissen (Quelle: eigene Darstellung)
Es ist kein Modell zu priorisieren, denn alle drei bauen jeweils auf einer veränderlichen Basis auf. Der Begriff ‚Behinderung‘ ist daher nicht als statisch anzusehen, er ist vielmehr dynamisch und entwickelt sich ständig weiter (Höglinger 2010, 17). Auf die drei Modelle bezogen bedeutet das: Die Medizin macht Fortschritte. Heilungen, die heute noch undenkbar sind, können schon morgen möglich sein. Die Umwelt kann in Zukunft andere Herausforderungen an den Menschen und seine Sinne stellen. So wird das Überqueren einer Straße, auf der nur leise Elektroautos verkehren, die Aufmerksamkeit von Ohr, Auge und Nase anders fordern, als wenn dort nur Autos mit Verbrennungsmotoren fahren, die schon von Weitem gehört, gesehen und gerochen werden können. Letztlich wird die Frage einer Aufhebung der bewertenden Pole behindert/nicht behindert niemals abschließend geschehen können. Denn auch in der Akzeptanz, dass es „normal ist, verschieden zu sein“ (von Weizäcker 1993), wohnt immer die Möglichkeit einer Abgrenzung inne.
Heute gilt im Umgang mit Behinderung der Grundgedanke der InklusionInklusion. In den Jahren 2018 und 2019 gab es in Deutschland Themen, die immer wieder in der Tagespresse auftauchten und die auch Eingang in die Politik gefunden haben:
Es wurde um den Begriff ‚Behinderung‘ im Rahmen von SchwerbehindertenausweisenSchwerbehindertenausweis gerungen. Die Diskussion kam in Gang, weil sich ein behindertes Kind am Begriff selbst störte und einen „Schwer-in-Ordnung-Ausweis“ beantragte. Als politischer Ausläufer davon beantragten die Freien Demokraten (FDP) eine Umbenennung des Schwerbehindertenausweises in „TeilhabeausweisTeilhabeausweis“ (Müller 2019). Ein anderes Thema ist die Inklusion an Schulen. Es wurde debattiert, wie ein gemeinsames Lernen funktionieren soll (z. B. Schmoll 2018).
Schlussendlich gab es eine ethische Debatte um die Möglichkeiten der PränataldiagnostikPränataldiagnostik, die durch einen risikolosen Test auf Trisomie 21Trisomie 21 angestoßen wurde. Durch diese neue Form von Tests können mehr und mehr Behinderungen vor Geburt ohne Gefahr für das ungeborene Leben aufgedeckt werden (Massetti 2016). Was das bedeutet, hat Bundespräsident von Weizäcker bereits 1993 bei seiner Ansprache auf der Eröffnungsveranstaltung der Tagung der Bundesarbeitsgemeinschaft Hilfe für Behinderte in einfache Worte gefasst und eine zugehörige, nicht beantwortbare Frage aufgeworfen.
Wissen | Der ethische Konflikt der PränataldiagnostikPränataldiagnostik
„[D]ie pränatale Diagnostik wird unser Leben nicht einfacher machen, sondern schwieriger. Denn sie wird uns nur Fakten mitteilen, nicht mehr. Wer sie hören will, begibt sich in eine Entscheidungssituation, die moralisch und ethisch höchste Anforderungen stellt. Besitzen wir immer schon die notwendige Reife, uns denen entgegenzustellen, die diese Wissenschaft dazu missbrauchen, um Normvorstellungen zu entwickeln, Normvorstellungen, nach denen bestimmte körperliche oder geistige Beeinträchtigungen schlechthin als menschlich unzumutbar bezeichnet werden?“ (von Weizäcker 1993)
Die derzeitige Entwicklung der Gesellschaft in ihrer Beantwortung der Frage erscheint bedenklich. Das Verständnis von Normalität und die Definition der Grundsätze für die Bewertung eines gelungenen Lebens hat sich verschoben. Die Analyseverfahren haben keinerlei therapeutische Funktion, sondern bedienen ein rein selektives Interesse (Lob-Hüdepohl 2021 in Rühle). Es scheint sich der Trend zu entwickeln, dass sich werdende Eltern, die sich trotz Trisomiediagnose für ihr Kind entscheiden, in ein gesellschaftliches Spannungsfeld begeben: Sie müssen erklären, warum sie sich „besseren Wissens“ für ein behindertes Kind – ihr Kind – entschieden haben. In Dänemark werden Eltern sogar zur Pränataldiagnostik aufgefordert. Bei einem positiven Befund auf Trisomie 21 herrscht dann die Tendenz vor, eine Abtreibung zu empfehlen (Massetti 2016). Das Beispiel zeigt deutlich das Bild einer Gesellschaft, in der alles planbar und richtig ablaufen muss.
Der Umgang mit Behinderungen im Alltag erscheint also noch nicht einer inklusiven gesellschaftlichen Norm zu folgen. Dabei müssen Behinderte nach den Maßen menschlicher Normalität behandelt werden. Diese Forderung ist noch immer unerfüllt. Das liegt daran, dass Behinderte – sobald sie optisch als solche erkennbar werden – leicht zu Störfaktoren werden, weil das Zusammenleben mit ihnen Hilfen und Rücksichten erforderlich macht (Pöggeler 2002, 45). Es zeichnet sich derzeit eine unentschlossene, offene gesellschaftliche Situation ab. Das sollte aber nicht sofort negativ gedeutet sein. Denn wenn RousseauRousseau, Jean-Jacques recht hat, und der Mensch von Natur aus gut ist, dann darf es durchaus als Chance verstanden werden, dass immer noch eine positive Prägung erfolgen kann.
Vergessen wird von der derzeitigen Gesellschaft, dass Behinderungen kein Schwarz-Weiß-Denken erfordern; sie sind Teil eines Kontinuums, auf dem sich menschliche Schicksale befinden. Dabei entstehen Behinderungen typischerweise erst im Laufe des Lebens1 und nicht von Geburt an: Eingeschränkte Mobilität und verminderte Seh- und Hörfähigkeit sind altersbedingte Behinderungen, die durch den demografischen Wandel und somit eine alternde Gesellschaft vermehrt auftreten werden. Sie sind es, mit denen touristische Leistungsträger aller Facetten in den nächsten Jahren vermehrt konfrontiert werden. Diese gesellschaftsbiologische Veränderung sollte die touristischen Anbieter nicht unvorbereitet treffen – vielmehr sollten sie Lösungen dafür parat haben.
3.3ExklusionExklusion, IntegrationIntegration und InklusionInklusion
Das gesellschaftliche Verhalten ist in zwei Pole ausgeprägt, wenn es um behinderte Menschen geht: zum einen gibt es einen offiziellen, akzeptierten und gewollten Weg der Förderung und Integration. Dem tritt zum anderen aber ein inoffizielles Verhalten gegenüber, das vielleicht sogar häufiger vorkommt. Es ist die Ausgrenzung und Diskriminierung (Zepf 2000, 368). Das liegt daran, dass in jeder Gesellschaft alle an der dominierenden NormalitätNormalität gemessen werden. Abweichungen fallen auf und werden schon von klein auf gelernt oder unbewusst erkannt. Wahrscheinlich hat jede:r schon einmal ein Kind auf der Straße zu seinen (dann zumeist maßregelnden) Eltern sagen hören: „Guck mal der Dicke da“. Das Kind hat erkannt, dass jemand von der Normalität abweicht. Diese ist dabei ein Begriff im beständigen Wandel. So waren in Hollywoodfilmen aus der Mitte des 20. Jahrhunderts kaum Menschen verschiedener Hautfarben zu sehen und behinderte Menschen überhaupt nicht. Das hat sich gewandelt und eine neue Normalität wird abgebildet. Im Jahr 2019 kam sogar der erste Film mit einem Trisomie-21-Darsteller in der Hauptrolle in die Kinos („The peanut butter falcon“). Nichtsdestotrotz kann Achingers (1979, 24) Gesellschaftskritik, dass die Anteilnahme zumeist auf finanzielle Hilfeleistungen, wie z. B. Rente, Sozialhilfe etc., limitiert ist, noch wiederholt werden. Eine soziale FürsorgepflichtFürsorgepflicht gerät zumeist in Vergessenheit.
Drei Begriffe prägen die Gruppenfindung von Menschen: ExklusionExklusion, IntegrationIntegration und InklusionInklusion. Eine Abbildung, die von der Aktion Mensch publiziert wird, erläutert die Abgrenzung mit einfachen Punktkreisdiagrammen (→ Abbildung 3). Sie erinnern an Tupfenmalerei, bei der für jeden Tupfen ein Mensch stehen soll:
Infografik Exklusion – Integration – Inklusion (Quelle: Aktion Mensch, inklusion.de)
Werden Menschen aufgrund einer Normabweichung als Teil einer Gesellschaft ausgeschlossen, dann wird von ExklusionExklusion gesprochen. Bei der IntegrationIntegration wird davon ausgegangen, dass die Gesellschaft aus einer relativ homogenen Mehrheitsgruppe besteht, die um eine Gruppe von Außenseiter:innen ergänzt wird; wobei die Mehrheit dabei nicht zahlenmäßig sein muss, sondern auch gesellschaftliche Machtverhältnisse widerspiegeln kann (Kolbe 2019). Die Unterschiede der Menschen werden dabei bewusst wahrgenommen. Es herrscht gewissermaßen eine Koexistenz. Gleichzeitig gibt es das Verlangen, dass der Einzelne versucht, sich anzupassen, um vollwertiges Mitglied der Gesellschaft zu werden. Dieser Denkansatz wird bei der InklusionInklusion durchbrochen und es erfolgt eine Abkehr von der Zweigruppentheorie. Jeder wird Mensch wird grundsätzlich als gleichberechtigtes, unabhängiges Individuum angesehen, das mit eigenen Merkmalen ausgestattet ist. Die Basis der Gesellschaft ist ein Selbstverständnis der Vielfalt und Heterogenität. Dabei müssen die Rahmenbedingungen so ausgestaltet sein, dass allen die Teilhabe ermöglich wird (Schöb 2013). Ein weiter Inklusionsbegriff, der nicht nur Menschen mit Behinderung meint, ist dabei relevant für eine funktionierende, aufgeklärte Gesellschaft (Kolbe 2019).
Es ist deutlich zu erkennen, dass im Begriffswandel von Integration zu Inklusion eine neue inhaltliche Aufladung stattgefunden hat und dass es sich nicht „bloß um einen aufmerksamkeitsheischenden Etikettenwechsel oder um die Anpassung an modische, politisch-korrekte Semantik“ handelt (Ebers 2012, 71). ExklusionExklusion und InklusionInklusion bilden im Wortstamm ein Begriffspaar und Integration erscheint nur als ein Zwischenschritt (Werner, Kempf und Corinth 2019, 79).
Wissen | Verständnis InklusionInklusion
Inklusion ist kein gesellschaftliches Ziel, sondern es steht als wertneutraler Begriff für die Teilhabe aller in einer modernen Gesellschaft (Wansing 2005, 39 f.). Sie beschreibt das Idealbild einer Gesellschaft, in der jede:r teilhaben kann (Zaynel 2017, 77).
Die Verwandlung hin zur InklusionInklusion ist einer Gesellschaft nicht vorzuschreiben. Das soziale Verhalten der nicht behinderten Bevölkerung kann nicht durch ein Gesetz eingefordert werden. Der Gesetzgeber kann aber dafür sorgen, dass ein barrierefreies Umfeld, also z. B. Gebäude oder Verkehrsmittel, entsteht. Im Resultat bewegen sich dann mehr behinderte Menschen im Alltag und vorurteilsbezogene dissoziale Barrieren können leichter minimiert werden (Wilken 2002, 23). Wird die Umwelt den Bedürfnissen aller angepasst, dann haben alle Menschen die gleichen Chancen an der Gesellschaft teilzuhaben und auch Beiträge beizusteuern (Werner, Kempf und Corinth 2019, 79 f.). Die Intervention setzt daher nicht beim Menschen an, sondern es wird eine Anpassung der Umwelt vorgeschlagen. Es ist also ein sozialer, politischer, wirtschaftlicher, ideologischer und ein die Einstellung der Menschen betreffender Vorschlag (Darcy und Buhalis 2011, 4 f.). In seiner Umsetzung entsteht eine neue Normalität in den Köpfen der Menschen.
3.4BarrierefreiheitBarrierefreiheit
Im Zusammenhang mit BedürfnisbefriedigungBedürfnisbefriedigung bei Menschen mit Einschränkungen wird zumeist von Barrieren gesprochen, die sie dafür zu überwinden haben. Im gleichen Gedankengang wird dann erklärt, dass die Barrieren zuerst identifiziert und nachfolgend abgebaut werden müssten. Es scheint der Konsens zu bestehen, dass, erst wenn BarrierefreiheitBarrierefreiheit herrsche, eine inklusive GesellschaftGesellschaft, inklusive funktionsfähig sei.
Der Begriff ‚BarrierefreiheitBarrierefreiheit‘ weckt bei vielen Menschen zunächst Assoziationen in Richtung von Menschen mit Mobilitätseinschränkungen. Im Behindertengleichstellungsgesetz findet sich in § 4 eine Definition:
„Barrierefrei sind bauliche und sonstige Anlagen, Verkehrsmittel, technische Gebrauchsgegenstände, Systeme der Informationsverarbeitung, akustische und visuelle Informationsquellen und Kommunikationseinrichtungen sowie andere gestaltete Lebensbereiche, wenn sie für Menschen mit Behinderungen in der allgemein üblichen Weise, ohne besondere Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe auffindbar, zugänglich und nutzbar sind. Hierbei ist die Nutzung behinderungsbedingt notwendiger Hilfsmittel zulässig.“
Es ist dabei gut zu erkennen, dass der Begriff Barrierefreiheit nicht nur auf einen eng gefassten Personenkreis der Mobilitätseingeschränkten limitiert werden darf. Auch Menschen mit allen anderen Arten von Behinderungen bzw. Bedürfnissen oder auch z. B. Familien mit Kinderwägen sind damit gemeint.
Zusätzlich zeigt die Definition auf, dass nicht nur an bauliche BarrierenBarrieren, bauliche gedacht werden darf – auch wenn sie den meisten (nicht betroffenen) Betrachtern zuerst in den Sinn kommen. BarrierefreiheitBarrierefreiheit bedeutet, so Dusel, Beauftragter der Bundesregierung (2009), einen umfassenden Zugang und somit uneingeschränkte Nutzungschancen in Bezug auf alle zu gestaltenden Lebensbereiche. Als anschauliche Beispiele führt er Automaten, Handys oder Internetseiten an (→ Kapitel 13).
Ein Zitat zum Thema Barrierefreiheit findet sich im Tourismus an unzähligen Stellen immer wieder, so z. B. den Websites der Landes- oder Städtemarketinggesellschaften. Es erschien wohl erstmalig in einem Bericht des BMWi (2003) zu den ökonomischen Impulsen eines barrierefreien Tourismus, für dessen Projekt Neumann und Reuber verantwortlichen zeichneten. Es wird dort flapsig behauptet:
Wissen | Wem hilft BarrierefreiheitBarrierefreiheit?
„So ist bekannt, dass eine barrierefrei zugängliche Umwelt für etwa 10 % der Bevölkerung zwingend erforderlich, für etwa 30 bis 40 % notwendig und für 100 % komfortabel ist.“ (BMWi 2003, 3)
In einer Veröffentlichung im Folgenjahr taucht dieser durchaus griffige Satz nochmals in einer Aufbereitung auf (Neumann und Reuber 2004, 13) und es wird erklärt, dass der Inhalt aus einer spanischen Veröffentlichung (bei Alonso Lopéz 2002, 31 f.) übernommen wurde. Auf Nachfrage der Herausgeber dieses Buches erklärte der Autor, Dr. Fernando Alonso Lopéz, dass die Prozentzahlen aus spanischen Statistiken zum Jahr 1999 stammen. Damals wurde erhoben, dass 8,8 % der Spanier:innen eine Behinderung haben. Sie, und weitere Personengruppen (aufsummiert zu 39,1 %), wurden im Alltag auf die ein oder andere Weise mit einer Barriere konfrontiert. Er bestätigt somit die in Deutschland kursierende Aussage, kritisiert aber ihre Genauigkeit.
Als ein gutes operatives Beispiel für die Umsetzung von Barrierefreiheit soll das nachfolgende Aufzugsbedienelement dienen, das in den Niederlanden in einem Parkhaus verwendet wird (→ Abbildung 4):
Aufzugsbedienelement in Roermond in den Niederlanden (Quelle: eigene Aufnahme von Felix M. Kempf)
Das Beispiel ist dienlich, um die mit Barrierefreiheit einhergehende Komplexität zu verdeutlichen. Es gibt eine BarrierefreiheitBarrierefreiheit für bestimmte Gruppen und eine Barrierefreiheit für alle. Sie ist wesentlich umfassender umzusetzen. Es wäre zu überlegen, von ‚multipler BarrierefreiheitBarrierefreiheit, multiple‘ zu sprechen, um darzustellen, dass es sich um eine umfassende Barrierefreiheit handelt.
In Bezug auf die Entwicklung von BarrierefreiheitBarrierefreiheit ist kritisch anzumerken, dass in allen Definitionen eine Fokussierung auf physische Barrieren besteht. Barrieren im Kopf der Menschen werden nicht berücksichtigt. In einer Analyse für barrierefreies Reisen wurde aber genau dieser Aspekt als bedeutsam herausgearbeitet. Die Bevölkerung und vor allem die Mitarbeiter von touristischen Leistungsträgern brauchen ein grundsätzliches Verständnis von einer inklusiven Gesellschaft und müssen Trainings erhalten, um den Situationen gerecht zu werden.
4Ökonomische Bedeutung des barrierefreien Tourismusbarrierefreier Tourismus
Die ökonomische Bedeutung des barrierefreien Tourismus wird in den Veröffentlichungen zum Thema als bedeutsam, aber bislang unterschätzt dargestellt. Die Zahl der Behinderten wächst aufgrund der höheren LebenserwartungLebenserwartung an. Das liegt auch daran, dass durch die höhere Lebenserwartung – dank eines verbesserten Gesundheitswesens bzw. besserer medizinischer Versorgung – andere, eigentlich die Zahl der Behinderungen minimierenden Faktoren überstrahlt werden (Yau, McKercher und Packer 2004, 947).
Das Reiseverhalten von Menschen mit Einschränkungen wird für Leistungsträger positiv dargestellt. Dazu wird es beschrieben (Göttel und Koch 2017, 60) als:
häufiger im Inland,
auch in der Nebensaison (àSaisonverlängerung),
Multiplikatoreffekt, da Begleitperson(en),
häufig mehr Geld pro Reisetag,
höhere Zielgebietstreue bzw. StammkundschaftStammkundschaft, da erschwerte Reisebedingungen.
Die Argumentation beginnt zumeist durch das Aufzeigen des prozentualen Anteils der Schwerbehinderten an der Bevölkerung (z. B. Wilken 2002, 17). In Deutschland lag er in der letzten Dekade (2007–2017) bei ca. 9–9,5 %, (Statista Dossier Schwerbehinderung 2019, F. 19). Im „World Report on Disability“ der WHO wird ein weltweiter Anstieg der Menschen mit Behinderungen von 10 % seit den 1970er-Jahren bis auf heute 15 % beschrieben. Begründet wird er durch die alternde Bevölkerung und den Anstieg von chronischen Erkrankungen wie z. B. Diabetes oder Herzerkrankungen (Word Report on Disability 2011, 7 f.). Natürlich sind die Zahlen aus Deutschland und der Welt nicht direkt miteinander vergleichbar. Aber es zeigt sich, dass das Segment für den touristischen Blickwinkel nicht nur als nationales Phänomen zu betrachten ist, sondern, dass es auch für den Zielmarkt Deutschland als Thema des Incoming-TourismusIncoming-Tourismus gedacht werden kann.
Eine Berechnung des ökonomischen Werts des barrierefreien Tourismus in Deutschland stellen Neumann und Reuber (2004, 52 ff.) auf. Nach eigenen Angaben war es die erste Berechnung, die aufzeigt, welche Umsätze durch schwerbehinderte Reisende im Deutschlandtourismus erzeugt werden. Das Betrachtungsjahr war 2001. Ausgeklammert sind dabei Tages-, Geschäfts- und Kongressreisen (→ Tabelle 2).
2001
2006
2017
schwerbehinderte Personen
6,71 Millionen
6,84 Millionen2
7,7 Millionen5
Reiseintensität
54,3 %
60,9 %1
60,9 %6
Reisehäufigkeit
1,3 Reisen p.a.
1,41
1,46
Deutschlandanteil
41,2 %
42,9 %1
42,9 %6
Reisedauer
13,9 Tage
13,51
13,56
Tagesausgaben
65,23 Euro
70 Euro3
80 Euro7
MwSt. (durchschnittlich)
11,5 %
11,5 %4
11,5 %6
Nettoumsatz ca.
1,57 Milliarden Euro
2,09 Milliarden Euro
2,69 Milliarden Euro
Nettoumsatz für Urlaub durch deutsche Schwerbehinderte 2001 in Deutschland
(Zahlen 2001: Neumann und Reuber 2004, 53 / Zahlen 2006: 1Neumann und Reuber 2008, 57–60, 2gemittelte Zahl aus Statista Dossier 2019, F. 3, 3angenommen aus den Zahlen 2001 und den Tagesausgaben 2014, Neumann 2014, 3, 4übernommen / Zahlen 2017: 5Statista Dossier 2019, F. 3, 6übernommen, 7Zahl 2014 aus Neumann 2014, 3)
Die Tabelle wurde um die Jahre 2006 und 2017 ergänzt. Dazu gab es teilweise Material aus Quellen, teilweise mussten Annahmen gemacht werden. Die Zahlen zeigen, dass insgesamt mit steigenden Ausgaben im Deutschlandtourismus zu rechnen ist. Dafür gibt es zwei Treiber: Die Zahl der Schwerbehinderten steigt an und die Tagesausgaben gehen nach oben. Welche Auswirkungen die Coronakrise auf dieses Segment hat, war bei Drucklegung (2023) nicht seriös zu prognostizieren.
Für das Jahr 2001 haben Neumann und Reuber (2004) zusätzlich entlang des obigen Schemas noch die Umsätze für Kurzurlaube berechnet. Durch sie lässt sich sehen, dass nochmals ca. 1 Milliarde Nettoumsätze, also in etwa 2/3, zusätzlich generiert werden. Insgesamt ist also von ca. 2,5 Milliarden auszugehen (→ Tabelle 3).
2001
schwerbehinderte Personen
6,71 Millionen
Reiseintensität
32,3 %
Reisehäufigkeit
2,18 Reisen p.a.
Deutschlandanteil
86,4 %
Reisedauer
3,39 Tage
Tagesausgaben
67,41 Euro
MwSt. (durchschnittlich)
11,5 %
Nettoumsatz ca.
930 Millionen Euro
Nettoumsatz für Kurzurlaub durch Schwerbehinderte 2001 (Quelle: Neumann und Reuber 2004, 53)
Sollte das Verhältnis von Urlauben und Tagestourismus konstant sein, dann lassen sich die Nettoumsätze für Kurzurlaub 2006 auf ca. 1,39 Milliarden und für 2017 auf ca. 1,79 Milliarden berechnen. Die Gesamtumsätze sind in der nachfolgenden Tabelle nochmals zusammengestellt (→ Tabelle 4):
Jahr
2001
2006
2017
Urlaub
1,57
2,09
2,69
Kurzurlaub (geschätzt)
0,93
1,39
1,79
Gesamt (ungefähr)
2,5
3,48
4,48
Nettoumsatz für Reisen gesamt 2001–2017 (Quelle: eigene Darstellung)
Diese Zahlen, die teilweise nur extrapoliert wurden, finden ihre Bestätigung auch an anderer Stelle. Vonseiten des Bundeswirtschaftsministeriums wird geschätzt, dass bei Schaffung von passenden Angeboten ein Nettoumsatz von 4,8 Milliarden Euro erzielt werden kann (Liem 2019, 7).
Wissen | Umsätze durch barrierefreien Tourismusbarrierefreier Tourismus
Vor der Coronapandemie war ein jährlicher Umsatz durch barrierefreien Tourismus in Deutschland von etwa 5 Milliarden Euro eine realistische Annahme.
Im Rahmen von ökonomischen Betrachtungen ist auch die ReisedauerReisedauer





























