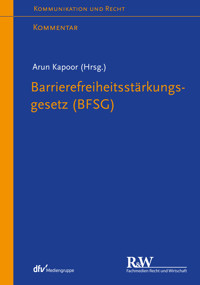
Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG) E-Book
109,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Fachmedien Recht und Wirtschaft
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Kommunikation & Recht
- Sprache: Deutsch
Ab dem 28. Juni 2025 gilt in Deutschland das neue Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG). Unternehmen sind dann verpflichtet, ihre digitalen Angebote barrierefrei zu gestalten. Dies gilt für die vom Gesetz erfassten digitalen Produkte, aber auch für eine Vielzahl digitaler Dienstleistungen wie etwa Webshops, deren Angebot an Produkten und Dienstleistungen sich an Verbraucher richtet. Verstöße gegen die neuen Barrierefreiheitsanforderungen können u.a. zu behördlich angeordneten Vertriebsverboten, Produktrückrufen sowie zur Verhängung von Bußgeldern führen. Mit dem BFSG hat der deutsche Gesetzgeber die europäische Richtlinie (EU) 2019/882, den sog. European Accessibility Act (EAA), in deutsches Recht überführt. Der EAA vereinheitlicht europaweit die national unterschiedlich ausgestalteten Barrierefreiheitsanforderungen und sorgt so für einen funktionierenden Binnenmarkt mit Blick auf die barrierefreie Gestaltung digitaler Produkte und Dienstleistungen. Die Vorgaben des neuen Barrierefreiheitsrechts richten sich an die Hersteller, Einführer und Händler betroffener Produkte sowie an die Erbringer der vom Gesetz erfassten Dienstleistungen. Die Anforderungen an die Barrierefreiheit werden in der zugehörigen Verordnung zum Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSGV) konkretisiert. Die Kommentierung beleuchtet die neuen Vorgaben an die Barrierefreiheit von Produkten und Dienstleistungen für die betroffenen Industrien und Rechtsanwender. Dabei werden nicht nur die einzelnen Vorschriften des BFSG und der BFSGV kommentiert. Die Regelungen werden gleichzeitig im Gesamtkontext des sog. New Legislative Framework erläutert. Dabei handelt es sich um das aktuelle "Strickmuster" der europäischen Produktregulierung, auf dem das BFSG beruht. Unter Mitwirkung von Dr. Fernanda Bremenkamp | Laura Griese | Melanie Lorenz | Dr. Julian von Lucius, LL.M.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 893
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Kommentar Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG)
Anforderungen an die Barrierefreiheit von Produkten und Dienstleistungen
Herausgegeben von Dr. Arun Kapoor
Bearbeitet von
Dr. Arun Kapoor, Dr. Fernanda Bremenkamp, LL.M., Laura Griese, Melanie Lorenz, Dr. Julian von Lucius, LL.M.
Fachmedien Recht und Wirtschaft | dfv Mediengruppe | Frankfurt am Main
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der DeutschenNationalbibliografie;detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.de abrufbar.
ISBN 978–3–8005–1976–7
© 2025 Deutscher Fachverlag GmbH, Fachmedien Recht und Wirtschaft, Mainzer Landstr. 251, 60326 Frankfurt am Main, [email protected]
www.ruw.de
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Druck: Beltz Grafische Betriebe GmbH, 99947 Bad Langensalza Printed in Germany
Vorwort
Mit dem Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG) überführt der deutsche Gesetzgeber die unionsrechtlichen Vorgaben der Richtlinie (EU) 2019/882, des sog. European Accessibility Act (EAA) in nationales Recht. Erstmals werden damit im Interesse der Teilhabe behinderter Menschen am gesellschaftlichen Leben verbindliche Anforderungen an die Barrierefreiheit von Produkten und Dienstleistungen im Binnenmarkt harmonisiert geregelt. Und dies mit erheblichen Auswirkungen auf Hersteller und Händler digitaler Produkte sowie auf Anbieter digitaler Dienstleistungen, die die neuen Anforderungen umzusetzen haben.
Das vorliegende Werk leistet einen praxisnahen Beitrag zur juristischen Durchdringung des neuen Regelwerks. Es versteht sich als systematische Kommentierung der einzelnen Vorschriften des BFSG und soll den Leserinnen und Lesern – insbesondere Juristinnen und Juristen in Beratung, Verwaltung und Justiz sowie Compliance-Verantwortlichen in Unternehmen – eine verlässliche Orientierung bieten. Neben der Analyse des Gesetzestextes werden auch die unionsrechtlichen Grundlagen, die Regelungsintentionen des Gesetzgebers sowie die praktischen Herausforderungen bei der Umsetzung beleuchtet.
Das BFSG tritt am 28.06.2025 in Kraft. Ab dann sind die betroffenen Wirtschaftsakteure an die Vorgaben des neuen Barrierefreiheitsrechts gebunden und müssen die Vorgaben des Gesetzes grundsätzlich ohne weitere Übergansfrist anwenden. Für viele Unternehmen wird dies herausfordernd sein, zumal sich dem BFSG nur wenige konkret handhabbare Vorgaben für die barrierefreie Gestaltung von Produkten und Dienstleistungen entnehmen lassen. Das vorliegende Werk kommentiert deshalb nicht nur die Regelungen des BFSG selbst, sondern nimmt im Interesse der Rechtsanwender, auch die Regelungen der Verordnung zum Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSGV) in den Fokus, die die gesetzlichen Anforderungen weiter konkretisiert.
Neben allen Kolleginnen und Kollegen, die durch fachliche Diskussionen, Hinweise und Anregungen zum Entstehen dieses Kommentars beigetragen haben, gilt mein Dank in erster Linie dem äußerst engagierten Autoren-Team, das sich aus den Bereichen Produktregulierung und Digital Business der internationalen Kanzlei NOERR zusammensetzt. Im Namen des gesamten Autorenteams möchte ich mich außerdem bei unserem wissenschaftlichen Mitarbeiter Maximilian Biehringer bedanken, ohne dessen tatkräftige Unterstützung wir das Manuskript wohl nicht bis zum Anwendungsstichtag hätten vorlegen können.
München, Juni 2025
Dr. Arun Kapoor
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Abkürzungsverzeichnis
Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG)
§ 1 BFSG Zweck und Anwendungsbereich
§ 2 BFSG Begriffsbestimmungen
§ 3 BFSG Barrierefreiheit, Verordnungsermächtigung
§ 4 BFSG Konformitätsvermutung auf der Grundlage harmonisierter Normen
§ 5 BFSG Konformitätsvermutung auf der Grundlage technischer Spezifikationen
§ 6 BFSG Pflichten des Herstellers
§ 7 BFSG Besondere Kennzeichnungs- und Informationspflichten des Herstellers
§ 8 BFSG Bevollmächtigter des Herstellers
§ 9 BFSG Allgemeine Pflichten des Einführers
§ 10 BFSG Besondere Kennzeichnungs- und Informationspflichten des Einführers
§ 11 BFSG Pflichten des Händlers
§ 12 BFSG Einführer oder Händler als Hersteller
§ 13 BFSG Angabe der Wirtschaftsakteure, Verordnungsermächtigung
§ 14 BFSG Pflichten des Dienstleistungserbringers
§ 15 BFSG Beratungsangebot der Bundesfachstelle für Barrierefreiheit
§ 16 BFSG Grundlegende Veränderungen
§ 17 BFSG Unverhältnismäßige Belastungen, Verordnungsermächtigung
§ 18 BFSG EU-Konformitätserklärung für Produkte
§ 19 BFSG CE-Kennzeichnung
§ 20 BFSG Aufgaben der Marktüberwachungsbehörden
§ 21 BFSG Marktüberwachungsmaßnahmen
§ 22 BFSG Maßnahmen der Marktüberwachung bei Produkten, die die Barrierefreiheitsanforderungen nicht erfüllen
§ 23 BFSG Maßnahmen bei formaler Nichtkonformität von Produkten
§ 24 BFSG Pflichten der Marktüberwachungsbehörde und der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin bei Nichtkonformität von Produkten, die sich nicht auf das deutsche Hoheitsgebiet beschränken
§ 25 BFSG Unterstützungsverpflichtung
§ 26 BFSG Pflichten der Marktüberwachungsbehörde bei Maßnahmen anderer Mitgliedstaaten, bei Produkten, die gegen Barrierefreiheitsanforderungen verstoßen
§ 27 BFSG Aufgaben der zentralen Verbindungsstelle
§ 28 BFSG Marktüberwachung von Dienstleistungen
§ 29 BFSG Maßnahmen der Marktüberwachung bei Dienstleistungen, die die Barrierefreiheitsanforderungen nicht erfüllen
§ 30 BFSG Maßnahmen bei formaler Nichtkonformität von Dienstleistungen
§ 31 BFSG Veröffentlichung von Information
§ 32 BFSG Rechte von Verbrauchern, anerkannten Verbänden und qualifizierten Einrichtungen im Verwaltungsverfahren
§ 33 BFSG Rechtsbehelfe
§ 34 BFSG Schlichtung
§ 35 BFSG Auskunftspflichten der Wirtschaftsakteure
§ 36 BFSG Berichterstattung an die europäische Kommission
§ 37 BFSG Bußgeldvorschriften
§ 38 BFSG Übergangsbestimmungen
Verordnung zum Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSGV)
§ 1 BFSGV Anwendungsbereich
§ 2 BFSGV Begriffsbestimmungen
§ 3 BFSGV Stand der Technik
§ 4 BFSGV Anforderungen an die Bereitstellung von Informationen für Produkte
§ 5 BFSGV Anforderungen an Produktverpackungen und Anleitungen
§ 6 BFSGV Anforderungen an Gestaltung von Benutzerschnittstelle und Funktionalität von Produkten
§ 7 BFSGV Zusätzliche branchenspezifische Anforderungen an Selbstbedienungsterminals
§ 8 BFSGV Zusätzliche branchenspezifische Anforderungen an E-Book-Lesegeräte
§ 9 BFSGV Zusätzliche branchenspezifische Anforderungen an Verbraucherendgeräte mit interaktivem Leistungsumfang, die zur Bereitstellung von Telekommunikationsdiensten eingesetzt werden
§ 10 BFSGV Zusätzliche branchenspezifische Anforderungen an Verbraucherendgeräte mit interaktivem Leistungsumfang, die für den Zugang zu audiovisuellen Mediendiensten verwendet werden
§ 11 BFSGV Unterstützungsdienste
§ 12 BFSGV Allgemeine Anforderungen für Dienstleistungen
§ 13 BFSGV Zusätzliche Anforderungen an bestimmte Dienstleistungen
§ 14 BFSGV Zusätzliche Anforderungen an Telekommunikationsdienste
§ 15 BFSGV Zusätzliche Anforderungen an Personenbeförderungsdienste
§ 16 BFSGV Zusätzliche Anforderungen an Stadt-, Vorort- und Regionalverkehrsdienste
§ 17 BFSGV Zusätzliche Anforderungen an Bankdienstleistungen für Verbraucher
§ 18 BFSGV Zusätzliche Anforderungen an E-Books
§ 19 BFSGV Zusätzliche Anforderungen an Dienstleistungen im elektronischen Geschäftsverkehr
§ 20 BFSGV Anwendung von funktionalen Leistungskriterien
§ 21 BFSGV Funktionale Leistungskriterien
§ 22 BFSGV Inkrafttreten
Medienstaatsvertrag (MStV)
§ 99a MStV Barrierefreiheitsanforderungen, grundlegende Veränderungen und unverhältnismäßige Belastungen
§ 99b MStV Konformitätsvermutung, Mitteilungspflichten
§ 99c MStV Informationspflichten
§ 99d MStV Verbraucherschutz
§ 99e MStV Satzungen und Richtlinien, Berichtspflichten
§ 121a MStV Übergangsbestimmung für Dienste, die den Zugang zu audiovisuellen Mediendiensten ermöglichen
Literaturverzeichnis
Stichwortverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Beschluss 768/2008/EG
Beschluss Nr. 768/2008/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. Juli 2008 über einen gemeinsamen Rechtsrahmen für die Vermarktung von Produkten und zur Aufhebung des Beschlusses 93/465/EWG des Rates
BFSG
Barrierefreiheitsstärkungsgesetz
BFSGV
Verordnung über die Barrierefreiheitsanforderungen für Produkte und Dienstleistungen nach dem Barrierefreiheitsstärkungsgesetz
BGG
Behindertengleichstellungsgesetz
BITV
Barrierefreiheits-Informationstechnik-Verordnung
Digital Services Act
Verordnung (EU) 2022/2065 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Oktober 2022 über einen Binnenmarkt für digitale Dienste und zur Änderung der Richtlinie 2000/31/EG
GG
Grundgesetz
GPSR
Verordnung (EU) 2023/988 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 10. Mai 2023 über die allgemeine Produktsicherheit, zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates und der Richtlinie (EU) 2020/1828 des Europäischen Parlaments und des Rates sowie zur Aufhebung der Richtlinie 2001/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und der Richtlinie 87/357/EWG des Rates
ICSMS
Information and Communication System for Market Surveillance
ProdSG
Produktsicherheitsgesetz
MLBF
Marktüberwachungsstelle der Länder für die Barrierefreiheit von Produkten und Dienstleistungen
MStV
Medienstaatsvertrag (MStV) in der Fassung des Fünften Staatsvertrags zur Änderung medienrechtlicher Staatsverträge
MÜ-VO
Verordnung (EU) 2019/1020 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 über Marktüberwachung und die Konformität von Produkten sowie zur Änderung der Richtlinie 2004/42/EG und der Verordnungen (EG) Nr. 765/2008 und (EU) Nr. 305/2011
RL 85/374/EWG
Richtlinie 85/374/EWG des Rates vom 25. Juli 1985 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Haftung für fehlerhafte Produkte
RL 2001/95/EG
Richtlinie 2001/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 3. Dezember 2001 über die allgemeine Produktsicherheit
RL 2006/42/EG
Richtlinie 2006/42/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Mai 2006 über Maschinen und zur Änderung der Richtlinie 95/16/EG
RL 2010/13/EU
Richtlinie 2010/13/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 10. März 2010 zur Koordinierung bestimmter Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung audiovisueller Mediendienste
RL 2016/882/EU
Richtlinie (EU) 2016/2102 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Oktober 2016 über den barrierefreien Zugang zu den Websites und mobilen Anwendungen öffentlicher Stellen
RL 2017/1564/EU
Richtlinie (EU) 2017/1564 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. September 2017 über bestimmte zulässige Formen der Nutzung bestimmter urheberrechtlich oder durch verwandte Schutzrechte geschützter Werke und sonstiger Schutzgegenstände zugunsten blinder, sehbehinderter oder anderweitig lesebehinderter Personen und zur Änderung der Richtlinie 2001/29/EG zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft
RL 2019/882/EU
Richtlinie (EU) 2019/882 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. April 2019 über die Barrierefreiheitsanforderungen für Produkte und Dienstleistungen
RL 2024/2853/EU
Richtlinie (EU) 2024/2853 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2024 über die Haftung für fehlerhafte Produkte und zur Aufhebung der Richtlinie 85/374/EWG des Rates
UN-BRK
UN-Behindertenrechtskonvention
UrhG
Urheberrechtsgesetz
Verordnung (EG) Nr. 765/2008
Verordnung (EG) Nr. 765/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. Juli 2008 über die Vorschriften für die Akkreditierung und Marktüberwachung im Zusammenhang mit der Vermarktung von Produkten und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 339/93 des Rates
UWG
Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb
Verordnung (EU) 1025/2012
Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2012 zur europäischen Normung, zur Änderung der Richtlinien 89/686/EWG und 93/15/EWG des Rates sowie der Richtlinien 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG und 2009/105/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung des Beschlusses 87/95/EWG des Rates und des Beschlusses Nr. 1673/2006/EG des Europäischen Parlaments und des Rates Text von Bedeutung für den EWR
Verordnung (EU) 2017/1563
Verordnung (EU) 2017/1563 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. September 2017 über den grenzüberschreitenden Austausch von Vervielfältigungsstücken bestimmter urheberrechtlich oder durch verwandte Schutzrechte geschützter Werke und sonstiger Schutzgegenstände in einem barrierefreien Format zwischen der Union und Drittländern zugunsten blinder, sehbehinderter oder anderweitig lesebehinderter Personen
Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG)
§ 1 BFSG Zweck und Anwendungsbereich
(1) Zweck dieses Gesetzes ist es, im Interesse der Verbraucher und Nutzer die Barrierefreiheit von Produkten und Dienstleistungen nach Maßgabe der folgenden Vorschriften zu gewährleisten. Dadurch wird für Menschen mit Behinderungen ihr Recht auf Teilhabe am Leben in der Gesellschaft gestärkt und der Harmonisierung des Binnenmarktes Rechnung getragen.
(2) Dieses Gesetz gilt für folgende Produkte, die nach dem 28. Juni 2025 in den Verkehr gebracht werden:
1. Hardwaresysteme für Universalrechner für Verbraucher einschließlich der für diese Hardwaresysteme bestimmte Betriebssysteme;
2. die folgenden Selbstbedienungsterminals:
a) Zahlungsterminals und zu diesen gehörige Hardware und Software;
b) die folgenden Selbstbedienungsterminals, die zur Erbringung der unter dieses Gesetz fallenden Dienstleistungen bestimmt sind:
aa) Geldautomaten;
bb) Fahrausweisautomaten;
cc) Check-in-Automaten;
dd) interaktive Selbstbedienungsterminals zur Bereitstellung von Informationen, mit Ausnahme von Terminals, die als integrierte Bestandteile von Fahrzeugen, Luftfahrzeugen, Schiffen oder Schienenfahrzeugen eingebaut sind;
3. Verbraucherendgeräte mit interaktivem Leistungsumfang, die für Telekommunikationsdienste verwendet werden;
4. Verbraucherendgeräte mit interaktivem Leistungsumfang, die für den Zugang zu audiovisuellen Mediendiensten verwendet werden, und
5. E-Book-Lesegeräte.
(3) Dieses Gesetz gilt für folgende Dienstleistungen, die für Verbraucher nach dem 28. Juni 2025 erbracht werden:
1. Telekommunikationsdienste mit Ausnahme von Übertragungsdiensten zur Bereitstellung von Diensten der Maschine-Maschine-Kommunikation;
2. folgende Elemente von Personenbeförderungsdiensten im Luft-, Bus-, Schienen- und Schiffsverkehr mit Ausnahme von Stadt-, Vorort- und Regionalverkehrsdiensten, für die nur die Elemente unter Buchstabe e gelten:
a) Webseiten;
b) auf Mobilgeräten angebotene Dienstleistungen, einschließlich mobiler Anwendungen;
c) elektronische Tickets und elektronische Ticketdienste;
d) die Bereitstellung von Informationen in Bezug auf den Verkehrsdienst, einschließlich Reiseinformationen in Echtzeit, bei Informationsbildschirmen allerdings nur dann, wenn es sich um interaktive Bildschirme im Hoheitsgebiet der Europäischen Union handelt, und
e) interaktive Selbstbedienungsterminals im Hoheitsgebiet der Europäischen Union, mit Ausnahme der Terminals, die als integrierte Bestandteile von Fahrzeugen, Luftfahrzeugen, Schiffen und Schienenfahrzeugen eingebaut sind und für die Erbringung von solchen Personenbeförderungsdiensten verwendet werden;
3. Bankdienstleistungen für Verbraucher;
4. E-Books und hierfür bestimmte Software und
5. Dienstleistungen im elektronischen Geschäftsverkehr.
(4) Dieses Gesetz gilt nicht für den folgenden Inhalt von Webseiten und mobilen Anwendungen:
1. aufgezeichnete zeitbasierte Medien, die vor dem 28. Juni 2025 veröffentlicht wurden;
2. Dateiformate von Büro-Anwendungen, die vor dem 28. Juni 2025 veröffentlicht wurden;
3. Online-Karten und Kartendienste, sofern bei Karten für Navigationszwecke wesentliche Informationen barrierefrei zugänglich in digitaler Form bereitgestellt werden;
4. Inhalte von Dritten, die von dem betreffenden Wirtschaftsakteur weder finanziert noch entwickelt werden noch dessen Kontrolle unterliegen;
5. Inhalte von Webseiten und mobilen Anwendungen, die als Archive gelten, da ihre Inhalte nach dem 28. Juni 2025 weder aktualisiert noch überarbeitet werden.
(5) Die §§ 45a bis 45d und 95a bis 96 des Urheberrechtsgesetzes und die Verordnung (EU) 2017/1563 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
13. September 2017 über den grenzüberschreitenden Austausch von Vervielfältigungsstücken bestimmter urheberrechtlich oder durch verwandte Schutzrechte geschützter Werke und sonstiger Schutzgegenstände in einem barrierefreien Format zwischen der Europäischen Union und Drittländern zugunsten blinder, sehbehinderter oder anderweitig lesebehinderter Personen (ABl. L 242 vom 20.9.2017, S. 1) bleiben von diesem Gesetz unberührt.
A. Einführung 1
I. Behinderung und Barrierefreiheit als gesellschaftliches Phänomen 1
II. Rechtshistorie 3
1. Behindertengleichstellungsgesetz (BGG) 3
2. UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) 4
a) Rechtscharakter der UN-Behindertenrechtskonvention 5
b) Inhalt und Umsetzung 6
3. BGG-Novelle 2016 7
4. EU-Richtlinie 2016/2102 8
5. Weitere BGG-Novellen 2018 und 2021 9
III. Entstehungsgeschichte 10
B. Regelungsgehalt 12
I. Zwecke (Abs. 1) 12
1. Schutz von Verbraucherinteressen und Teilhabe als Gemeinschaftsgut 13
2. Harmonisierung des Binnenmarktes 14
a) Abbau von Handelshemmnissen 14
b) Erschließen von Menschen mit Behinderungen als Absatzmarkt 15
c) Stärkung des Wettbewerbs unter den Anbietern von barrierefreien Angeboten 16
II. Erfasste Produktkategorien (Abs. 2) 17
1. Hardwaresysteme für Universalrechner für Verbraucher (Nr. 1) 17
a) Grundlage 18
b) Keine Erstreckung auf in Verbraucherelektronik integrierte Spezialcomputer 19
c) Gesamteinbaukonstellationen 23
d) Insbesondere: In Fahrzeugen verbaute Tablets 26
2. Selbstbedienungsterminals (Nr. 2) 28
a) Zahlungsterminals (§ 1 Abs. 2 Nr. 2 lit. a BFSG) 29
b) Geldautomaten (§ 1 Abs. 2 Nr. 2 lit. b aa) BFSG) 31
c) Fahrausweisautomaten (§ 1 Abs. 2 Nr. 2 lit. b bb) BFSG) 32
d) Check-in-Automaten (§ 1 Abs. 2 Nr. 2 lit. b cc) BFSG) 33
e) Interaktive Selbstbedienungsterminals zur Bereitstellung von Informationen (§ 1 Abs. 2 Nr. 2 lit. b dd) BFSG) 34
3. Verbraucherendgeräte mit interaktivem Leistungsumfang, die für Telekommunikationsdienste verwendet werden (Nr. 3) 37
4. Verbraucherendgeräte mit interaktivem Leistungsumfang, die für den Zugang zu audiovisuellen Mediendiensten verwendet werden (Nr. 4) 39
5. E-Book-Lesegeräte (Nr. 5) 42
III. Anwendung auf Dienstleistungen (Abs. 3) 43
IV. Ausnahmen vom Anwendungsbereich für bestimmte Inhalte (Abs. 4) 44
V. Abgrenzung zu den Bestimmungen des Urheberrechts (Abs. 5) 50
A. Einführung
I. Behinderung und Barrierefreiheit als gesellschaftliches Phänomen
1
Barrierefreiheit bezeichnet die Gestaltung von physischen und digitalen Umgebungen, Produkten und Dienstleistungen, sodass sie für alle Menschen – unabhängig von ihren körperlichen, geistigen oder sensorischen Einschränkungen – zugänglich, nutzbar und verständlich sind. Das Ziel von Barrierefreiheit ist es, die vollständige Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen und Diskriminierungen aufgrund von Behinderungen zu vermeiden. Dabei bezieht sich die physische Barrierefreiheit auf bauliche Maßnahmen, wie etwa stufenfreie Zugänge, breite Türen, rollstuhlgerechte Toiletten oder barrierefreie Verkehrsmittel, die es Menschen mit Mobilitätseinschränkungen ermöglichen, sich uneingeschränkt in öffentlichen und privaten Räumen zu bewegen. Der Begriff der digitalen Barrierefreiheit, eine Materie, deren Regulierung sich das BFSG schwerpunktmäßig widmet, hat demgegenüber Webseiten, Apps und digitale Medien zum Gegenstand, die so gestaltet sind, dass sie von allen Menschen, einschließlich solchen mit Seh-, Hör- oder kognitiven Einschränkungen, genutzt werden können. Dazu gehört beispielsweise die Nutzung von Screenreadern, Untertitelungen für Videos oder eine einfache und klare Benutzeroberfläche. Kommunikative Barrierefreiheit beschreibt den Zugang zu Informationen, wie etwa durch Gebärdensprache, Übersetzungsdienste, Texte in leichter Sprache oder Audiodeskriptionen für Menschen mit Hör- oder Sehbehinderungen. In Deutschland leben gegenwärtig 7,9 Millionen schwerbehinderte Menschen, was einem Anteil von etwa 9,3% der Bevölkerung entspricht.1 Dabei sind allein 2,5 Millionen Menschen auf einen Rollstuhl angewiesen oder haben eine andere Mobilitätseinschränkung. Rund 21% der deutschen Bevölkerung sind hörbeeinträchtigt.2 8% aller Männer und 0,4% aller Frauen besitzen eine Farbsinnstörung.3 Barrierefreiheit ist daher keinesfalls ein Randgruppenphänomen, sondern für die Teilhabe breiter Bevölkerungsschichten absolut notwendig.
2
Mit der steigenden Verlagerung des Austauschs von Waren, Dienstleistungen und Informationen in den digitalen Raum kommt dabei insbesondere der digitalen Barrierefreiheit entscheidende Bedeutung zu. Hierbei stieß der europäische Gesetzgeber auf besonders große Defizite. So sind nach Maßgabe einer Studie der Aktion Mensch e.V. nur 21% der beliebtesten Onlineshops barrierefrei nutzbar.4 Mangelnde Tastaturbedienbarkeit ist dabei die häufigste Barriere. Auch im privaten Fernsehen bestehen erhebliche Defizite auf dem Gebiet der Barrierefreiheit: Die Untertitelungsquote der beiden größten privaten Sendergruppen betrug 2024 lediglich 37% bzw. 23%.5 Mit Audiodeskriptionen angebotene Formate bleiben die Ausnahme: Bei einem exemplarisch hervorgehobenen großen deutschen Privatsender entsprachen sie 2024 einem Anteil von 2% am Gesamtangebot.6
II. Rechtshistorie
1. Behindertengleichstellungsgesetz (BGG)
3
Den Anfang legislativer Bestrebungen auf dem Gebiet der Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen setzte das zum 01. Mai 2002 in Kraft getretene Behindertengleichstellungsgesetz (BGG).7 Herzstück des BGG ist ein Benachteiligungsverbot für Träger öffentlicher Gewalt (§ 7 BGG) und eine korrespondierende Verpflichtung, zivile Neu-, Um- und Erweiterungsbauten des Bundes in baulicher Hinsicht barrierefrei zu gestalten (§ 8 BGG). Hinzu treten Vorschriften über die barrierefreie Behördenkommunikation (§§ 9,10 BGG) und Pflichten zur barrierefreien Gestaltung von Internetauftritten des Bundes (§ 11 BGG). Das BGG enthält dabei nicht nur objektiv-rechtliche Vorgaben, sondern subjektive Rechte des Einzelnen,8 die durch ein Verbandsklagerecht anerkannter Verbände (§ 13 BGG) abgesichert ist. Das BGG wird durch die Barrierefreiheits-Informationstechnik-Verordnung (BITV 2.0) konkretisiert.9 Auch die BITV 2.0 verweist in ihrem § 3 Abs. 2 auf die Norm EN 301 540 in der jeweils aktuell harmonisierten Version als Mindeststandard und stellt eine Konformitätsvermutung auf.10
2. UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK)
4
Der nächste Schritt in der Rechtsentwicklung wurde mit dem Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (sog. UN-Behindertenrechtskonvention) gesetzt, die am 13.12.2006 von der Generalversammlung der Vereinten Nationen angenommen wurde.
a) Rechtscharakter der UN-Behindertenrechtskonvention
5
Die allgemeinen Grundsätze des Völkerrechts sind nach Art. 25 Satz 1 GG Bestandteil des Bundesrechts und gehen Bundesgesetzen im Rang vor. Bei den allgemeinen Regeln des Völkerrechts handelt es sich um Regeln des universell geltenden Völkergewohnheitsrechts, ergänzt durch aus den nationalen Rechtsordnungen tradierte allgemeine Rechtsgrundsätze. Das Bestehen von Völkergewohnheitsrecht setzt wiederum eine gefestigte Praxis zahlreicher Staaten voraus, die in der Überzeugung geübt wird, hierzu aus Gründen des Völkerrechts verpflichtet zu sein. Bei dem Inhalt der UN-Behindertenrechtskonvention handelt es sich gleichwohl nicht um allgemeine Grundsätze des Völkerrechts.11 Um eine gefestigte Praxis handelt es sich hier gerade nicht, vielmehr sollen behinderten Menschen Rechte eingeräumt werden, die sie zuvor durch gefestigte Praxis noch nicht hatten. Innerstaatliche Geltung und Rechtsverbindlichkeit erlangt die UN-Behindertenkonvention daher erst durch das nach Art. 59 Abs. 2 GG vorgeschriebene innerstaatliche Zustimmungsgesetz. Die Umsetzung in nationales Recht ist dabei für die Bundesrepublik durch Zustimmungsgesetz vom 21.12.200812 erfolgt.
b) Inhalt und Umsetzung
6
Die Vorgaben der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) wurden maßgeblich durch die erste große Novelle des BGG im Jahre 201613 in das BGG überführt. Der Bundesgesetzgeber war insoweit der Auffassung, dass die Regeln des BGG zwar auch bereits zuvor im Sinne der UN-BRK ausgelegt werden konnten, die UN-BRK aber in der Praxis den Normadressaten zu wenig präsent war.14 Durch die BGG-Novelle 2016 wurde dabei insbesondere der Behindertenbegriff an den Wortlaut der UN-BRK angeglichen und die Versagung angemessener Vorkehrungen für Menschen mit Behinderungen ausdrücklich als Bestandteil des Diskriminierungsbegriffs aufgenommen.
3. BGG-Novelle 2016
7
Neben der Anpassung des BGG an die UN-BRK brachte die große BGG-Novelle von 2016 weitere zahlreiche Neuerungen im barrierefreiheitsrechtlichen Regelungssystem. Mit der Errichtung der Bundesfachstelle für Barrierefreiheit (§ 13 BGG), der Überwachungsstelle des Bundes für Barrierefreiheit für Informationstechnik (§ 13 Abs. 3 BGG) und der Einrichtung einer Schlichtungsstelle beim Beauftragten der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen (§§ 16, 17 BGG) wurden weitere verfahrensrechtliche und institutionelle Vorkehrungen getroffen, um eine möglichst weitgehende regulatorische Durchdringung auf dem Gebiet der Behindertengleichstellung und Barrierefreiheit zu gewährleisten. An die mit der BGG-Novelle 2016 geschaffene Bundesfachstelle für Barrierefreiheit knüpft auch das BFSG an, das ihr in § 15 BFSG Beratungs- und Informationsaufgaben zuweist (→ § 15 Rn. 1).
4. EU-Richtlinie 2016/2102
8
Mit der Richtlinie (EU) 2016/2102 über den barrierefreien Zugang zu den Webseiten und mobilen Anwendungen öffentlicher Stellen wurde 2016 zum ersten Mal auch der europäische Gesetzgeber auf dem Gebiet der Barrierefreiheit tätig. Wie bereits das BGG nahm auch die Richtlinie (EU) 2016/2102 dabei allein den behördlichen Sektor in den Blick, lieferte aber trotzdem wertvolle Vorarbeiten, insbesondere auch auf dem Gebiet der Normung. Mit der harmonisierten Norm EN 301 549 wurde ein Regelwerk geschaffen, an das der European Accessibility Act unmittelbar anknüpft.
5. Weitere BGG-Novellen 2018 und 2021
9
In geringerem Umfang weiterentwickelt wurde das BGG durch die Novellen 2018 und 2021. Eingefügt wurden Vorschriften über Assistenzhunde.15
III. Entstehungsgeschichte
10
Das BFSG geht auf den European Accessibility Act (EAA), die RL 2019/882/EU, zurück und ist daher unionsrechtlich überformt. Erstmals konkret auf die Agenda der Kommission trat der barrierefreiheitsrechtliche Regelungskomplex mit der Kommissionsmitteilung „Europäische Strategie zugunsten von Menschen mit Behinderungen 2010–2020: Erneuertes Engagement für ein barrierefreies Europa“ vom 15. November 2010.16 Die Kommission knüpften dabei unmittelbar an die Tradition der UN-Behindertenrechtskonvention an.17 Der Rechtsakt selbst lässt sich auf Initiativen zurückführen, die bis ins Jahr 2011 zurückreichen. Als Pendant zur Richtlinie (EU) 2016/2102 für den privaten Sektor konzipiert, wurde der Rechtsakt, der ursprünglich bereits 2012 verabschiedet werden sollte, mehrmals wegen Bedenken in Industrie und Handel verschoben. Nach einem umfassenden Gesetzgebungsverfahren stimmte im März 2019 das Europäische Parlament, im April 2019 der Rat dem Rechtsakt zu, der daraufhin am 7. Juni 2019 im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht wurde.
11
Die RL 2019/882/EU bleibt nach gegenwärtigem Stand der Rechtsentwicklung auch unter dem von der EU-Kommission vorgeschlagenen Omnibus-Deregulierungspaket 2025 erhalten.
B. Regelungsgehalt
I. Zwecke (Abs. 1)
12
Wie bereits aus anderen harmonisierten Rechtsakten bekannt, stellt § 1 Abs. 1 BFSG dem Gesetz seine Regelungszwecke voran.
1. Schutz von Verbraucherinteressen und Teilhabe als Gemeinschaftsgut
13
Regelungsziel des BFSG ist es nach Maßgabe des § 1 Abs. 1 Satz 1 BFSG, im Interesse von Verbrauchern und Nutzern die Barrierefreiheit von Produkten und Dienstleistungen zu gewährleisten. Das BFSG dient daher primär den Interessen von Menschen mit Behinderungen, Produkte und Dienstleistungen nutzen zu können. Diese individualschutzrechtliche Komponente wird auch dadurch unterstrichen, dass Verbraucher nach Maßgabe des § 34 BFSG die Einleitung marktüberwachungsrechtlicher Maßnahmen anstoßen können. Das BFSG dient jedoch nicht nur den Individualinteressen von Menschen mit Behinderungen an der Nutzung der erfassten Produktkategorien und Dienstleistungen, sondern richtigerweise auch dem gesamtgesellschaftlichen Interesse an Teilhabe, das über die individualschutzrechtliche Komponente hinausgeht.
2. Harmonisierung des Binnenmarktes
a) Abbau von Handelshemmnissen
14
Durch die Angleichung der Vorschriften der Mitgliedstaaten über die Barrierefreiheitseigenschaften vertriebener Produkte und Dienstleistungen soll auch maßgebend die reibungslose Realisierung des Binnenmarkts gestärkt werden (§ 1 Abs. 1 Var. 2 BFSG). Durch die Harmonisierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Barrierefreiheitsanforderungen für bestimmte Produkte und Dienstleistungen werden insbesondere durch unterschiedliche Barrierefreiheitsanforderungen in den Mitgliedstaaten bedingte Hindernisse für den freien Verkehr bestimmter barrierefreier Produkte und Dienstleistungen beseitigt bzw. die Errichtung derartiger Hindernisse verhindert wird.18 Hierdurch soll sich die Verfügbarkeit barrierefreier Produkte und Dienstleistungen auf dem Binnenmarkt erhöhen und die Barrierefreiheit von einschlägigen Informationen verbessern. So soll die Zersplitterung des Markts für barrierefreie Produkte und Dienstleistungen überwunden, Skaleneffekte erzielt, der grenzüberschreitende Handel und die grenzüberschreitende Mobilität erleichtert und die Wirtschaftsakteure dabei unterstützt werden, Ressourcen für Innovationen statt für die Deckung der Kosten einzusetzen, die durch die innerhalb der Union uneinheitlichen Rechtsvorschriften bedingt sind.19 Ob die Auffassung des europäischen Gesetzgebers, dass insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) durch den Abbau dieser Handelshemmnisse von den neu erschlossenen Absatzmärkten profitieren werden20 und bisher durch die Unterschiede zwischen den nationalen Barrierefreiheitsregelungen vom grenzüberschreitenden Vertrieb abgehalten wurden,21 zutrifft, bleibt abzuwarten.
b) Erschließen von Menschen mit Behinderungen als Absatzmarkt
15
Ebenfalls erhofft sich der europäische Gesetzgeber durch die Umsetzung der RL 2019/882/EU, Menschen mit Behinderungen weitergehend als bisher als Konsumentengruppe und Absatzmarkt zu erschließen.22
c) Stärkung des Wettbewerbs unter den Anbietern von barrierefreien Angeboten
16
Von der Harmonisierung der Barrierefreiheitsanforderungen für Dienstleistungen und Produkte erhofft sich die Union ebenfalls eine Stärkung des Wettbewerbs unter den Anbietern assistiver Technologien.23 Von den Verbrauchern würden für barrierefreie Produkte und Dienstleistungen sowie für assistive Technologien hohe Preise verlangt, da der Wettbewerb unter den Anbietern begrenzt sei. Dazu mindere die Vielzahl nationaler Regelungen den potenziellen Nutzen eines Erfahrungsaustauschs auf internationaler Ebene über die Frage, wie auf gesellschaftliche und technologische Entwicklungen zu reagieren ist.
II. Erfasste Produktkategorien (Abs. 2)
1. Hardwaresysteme für Universalrechner für Verbraucher (Nr. 1)
17
Nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 BFSG erstreckt sich der Anwendungsbereich des Gesetzes auf Hardwaresysteme für Universalrechner für Verbraucher (→ § 2 Nr. 35 BFSG) einschließlich der für diese Hardwaresysteme bestimmten Betriebssysteme (→ § 2 Nr. 34 BFSG).
a) Grundlage
18
Die unter dem Begriff erfassten Computerhardwaresysteme zeichnen sich durch ihren Mehrzweckcharakter und ihre Fähigkeit aus, mit der geeigneten Software die vom Verbraucher geforderten üblichen Computeraufgaben durchzuführen und sind dazu bestimmt, von Verbrauchern bedient zu werden.24 Klassisches Beispiel sind Personal Computer, wie Desktops, Notebooks, Smartphones und Tablets. Nicht erfasst sind demgegenüber einzelne Universalcomputerkomponenten mit spezifischen Funktionen wie etwa Hauptplatinen oder Speicherchips, die in einem solchen System verwendet werden oder verwendet werden könnten.25 Der Tatbestand des § 1 Abs. 2 Nr. 1 BFSG möchte daher nur Endprodukte erfassen, die als voll funktionsfähiger Universalcomputer auf dem Markt vertrieben werden. Dies ergibt sich aus dem Telos der Beschränkung des Anwendungsbereichs des Gesetzes auf ganz bestimmte, spezifische Produktkategorien: Das wesentliche Motiv des Gesetzgebers für die Aufnahme eines Produkts in den Katalog des § 1 Abs. 2 BFSG liegt, wie sich aus der Entstehungsgeschichte des Rechtsakts und insbesondere auch der Market Impact Analysis ergibt, in der Bedeutung, die ein Produkt im Alltag von Menschen mit Behinderungen einnimmt, und dem daraus folgenden Maß der Verbesserung an Teilhabe, die durch eine Regulierung erzielt werden kann. Mit dieser Zielsetzung wäre es von vornherein unvereinbar, dem Rechtsakt auch bloße Vor- und Teilprodukte zu unterwerfen, die den Endverbraucher typischerweise ohnehin nicht erreichen. Eine solche Regulierung wäre auch weitgehend überflüssig: Zwar mag es vereinzelt Fälle geben, in denen Menschen mit Behinderung speziell Universalcomputerkomponenten (etwa Grafikkarte, Prozessor) erwerben, etwa um diese in Eigenregie zu einem individuell zusammengesetzten Universalcomputer zusammenzubauen, wie es etwa in der Gaming-Szene praktiziert wird. Der Regelfall ist dies jedoch nicht.
b) Keine Erstreckung auf in Verbraucherelektronik integrierte Spezialcomputer
19
Ausweislich der Gesetzesbegründung und des Erwägungsgrundes 25 der RL 2019/882/EU erstreckt sich die Reichweite des § 1 Abs. 2 Nr. 1 BFSG nicht auf in Verbraucherelektronik eingebetteten Spezialcomputer.26 Dies ergibt sich auchstrenggenommen bereits aus dem Wortlaut der Norm, denn ein Spezialcomputer ist eben bereits begrifflich kein Universalcomputer, der durch seinen Mehrzweckcharakter geprägt wird. Um von § 1 Abs. 2 Nr. 1 BFSG nicht erfasste Spezialcomputer handelt es sich daher bei Computern, die durch eine eingeschränkte Funktionalität geprägt und dazu gedacht sind, nur ganz bestimmte Aufgaben auszuführen. Beispiele für solche in Verbraucherelektronik eingebettete Spezialcomputer sind etwa solche, die in Smart-TVs verbaut sind: Diese sind speziell dafür ausgelegt, Multimedia-Inhalte zu streamen, Apps auszuführen und Internetverbindungen bereitzustellen und weisen daher eingeschränkte Funktionalität auf. Es handelt sich nicht um Universalrechner, sondern Spezialcomputer, die auf Unterhaltung und Multimedia ausgelegt sind. Spezialcomputer sind auch die in digitaler Kameratechnik, tragbaren Bildverarbeitungsgeräten oder Camcordern verbauten Prozessoren, die für die Verarbeitung von Bildern und Videos zuständig sind. Ebenfalls keine Universalcomputer sind elektronische Musikinstrumente wie Keyboards, Synthesizer oder Drum Machines. Gleiches gilt für die in digitalen Spielekonsolen wie PlayStation, Xbox oder Nintendo Switch enthaltenen spezialisierten Rechenelemente, die auf das Spielen von Videospielen ausgerichtet sind und keinen Mehrzweckcharakter besitzen. Ein weites Feld, das dem Anwendungsbereich des § 1 Abs. 2 Nr. 1 BFSG entzogen ist, sind auch sog. Smart Home Geräte: Geräte wie intelligente Thermostate, Türschlösser, Smart-Glühbirnen, Küchengeräte mit eingebetteter Steuerung wie Smart-Kühlschränke, Mikrowellen, Kaffeemaschinen oder Herdplatten, die mit speziellen Computern ausgestattet sind, um bestimmte Funktionen zu steuern und zu überwachen. Ebenso nicht erfasst sind in Sicherheitskameras enthaltene spezialisierte Computer, die Aufgaben im Smart Home übernehmen, aber eine im Sinne der gefundenen Definition eingeschränkte Funktionalität aufweisen.
20
In Verbraucherelektronik eingebettete Spezialcomputer finden sich außerdem in Roboter-Staubsaugern, GPS-Navigationsgeräten, Stand-alone-Videokonferenzsystemen, Feature-Phones, Fitness Trackern wie Fitbit oder Garmin, Wearables wie smarten Ringen, Brillen oder Kleidung mit eingebauten Sensoren, die spezifische Funktionalität auf dem Anwendungsfeld der Gesundheitsüberwachung oder Augmented Reality (AR) bieten.
21
Einen durch die fortschreitende technologische Entwicklung bedingten Grenzfall bilden sog. Smart Watches. Hier wird man im Einzelfall darauf abstellen müssen, ob das Gerät eine so weitgehende Funktionalität aufweist, dass es ein Mehrzwecksystem darstellt und dementsprechend als Universalcomputer eingeordnet werden kann, oder ob die Funktionen auf ganz bestimmte Anwendungskonstellationen (Überwachung von Gesundheitsdaten, Fitness und Kommunikation) beschränkt bleiben. Das ist eine Tatfrage, die im Einzelfall für das streitgegenständliche Modell beantwortet werden muss.
22
Zu beachten bleibt, dass derartige in Verbraucherelektronik eingebettete Spezialcomputersysteme selbstverständlich über einen anderen Tatbestand des § 1 Abs. 2 Nr. 1–5 BFSG vom Regelungssystem des BFSG erfasst werden können. Derartiges gilt etwa für Zahlungsterminals (§ 1 Abs. 2 Nr. 2a BFSG), Selbstbedienungsterminals (§ 1 Abs. 2 Nr. 2b BFSG), Verbraucherendgeräte mit interaktivem Leistungsumfang, die für Telekommunikationsdienste oder den Zugang zu audiovisuellen Mediendiensten verwendet werden (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 u. 4 BFSG) und E-Book-Lesegeräte (§ 1 Abs. 2 Nr. 5 BFSG), die allesamt in Verbraucherelektronik eingebettete Spezialcomputersysteme darstellen.
c) Gesamteinbaukonstellationen
23
Probleme wirft der Tatbestand des § 1 Abs. 2 Nr. 1 BFSG dort auf, wo ein Gerät, das für sich genommen evident als Universalcomputer in den Anwendungsbereich des § 1 Abs. 2 Nr. 1 BFSG fällt (etwa ein Notebook oder ein Tablet), in ein anderes Verbraucherprodukt eingebaut wird (Gesamteinbaukonstellation). Man denke etwa an Tablets, die als Touchscreen-Panels in Wände eingebaut sind, um Smart Home Funktionen wahrzunehmen. Auch im Medizinsektor werden Tablets oder Laptops häufig als Steuer- und Anzeigegeräte in komplexen medizinischen Geräten verwendet, z.B. in bildgebenden Systemen (wie Ultraschallgeräten), Diagnosegeräten oder zur Führung von elektronischen Patientenakten mittels EPK-Systemen. Weitere Anwendungsfelder sind die Verwendung von Tablets in Unterhaltungselektronik in Fahr- oder Flugzeugen, Informationssysteme im öffentlichen Bereich (Flughäfen, Einkaufszentren oder Museen), die es den Nutzern ermöglichen, mit digitalen Inhalten zu interagieren, Tickets zu kaufen oder Wegbeschreibungen abzurufen, oder als Bestandteil von Fitnessgeräten, wo sie Benutzerdaten erfassen, Trainingsprogramme anzeigen oder mit Fitness-Apps synchronisieren. Ob derartige Gesamteinbaukonstellationen in den Anwendungsbereich des BFSG fallen, ist richtigerweise zweistufig aufzulösen:
24
Zunächst ist zu prüfen, ob der Universalcomputer, wie es regelmäßig der Fall sein wird, durch den Einbau eine eingeschränkte Funktionalität erlangt und daher seinen Mehrzweckcharakter verliert. Für diese Beurteilung kommt es richtigerweise nicht auf die theoretisch realisierbare Funktionalität, sondern auf die subjektive Zweckbestimmung an. Mag es daher theoretisch möglich sein, auf das an einem Ultraschallgerät eingebettete Tablet Software aufzuspielen, die diesem Tablet zu Mehrzweckcharakter verhilft, so ändert dies nicht daran, dass das Produkt in der betreffenden Anwendung nur einen ganz bestimmten Zweck erfüllen soll und kann. In Gesamteinbaukonstellationen wird daher regelmäßig die Eigenschaft als Universalcomputer i.S.d. § 1 Abs. 2 Nr. 1 BFSG zu verneinen sein.
25
Ist dies ausnahmsweise einmal anders, so stellt sich die Frage, ob ein Universalcomputer allein dadurch, dass er in ein anderes Produkt fest integriert ist, aus dem Anwendungsbereich der RL 2019/882/EU auszuscheiden ist. Das ist richtigerweise nicht der Fall.
d) Insbesondere: In Fahrzeugen verbaute Tablets
26
In diesem Kontext stellt sich auch die Frage nach der rechtlichen Bewertung von Gesamteinbaukonstellationen bei Fahrzeugen. So existieren insbesondere im Automobilsektor zahlreiche Automobilmodelle, die wesentliche Steuerungsfunktionen oder Multimediaunterhaltung über ein integriertes und fest verbautes Tablet realisieren.
27
Erstens sind Fahrzeuge und damit auch Automobile ausweislich der eindeutigen Verlautbarung des europäischen Gesetzgebers in ErwG. 27 der RL 2019/882/EU nicht vom Anwendungsbereich des Rechtsaktes erfasst.27 Diese Überlegung wird auch durch einen Blick auf die Entstehungsgeschichte der Richtlinie bestätigt: Der europäische Gesetzgeber folgte bei der Konzeption des Rechtsaktes und der Auswahl erfasster Produktkategorien einem sektorbasierten Ansatz. Auf Grundlage der Konsultation mit betroffenen Kreisen wurden aus verschiedenen Sektoren (information and communication, built environment, transport, other areas) bestimmte Produkte mit breiter Auswirkung zuungunsten weniger relevanter Produktgruppen priorisiert. Aus dem Transportsektor hat sich der europäische Gesetzgeber daher wegen den potenziellen Auswirkungen auf größere Bevölkerungsschichten für eine Regulierung im Umfeld von Transportmitteln entschieden, die entweder dem grenzüberschreitenden Verkehr oder dem öffentlichen Nahverkehr dienen.28 Eine Regulierung des Automobilsektors hat der europäische Gesetzgeber dagegen nicht beabsichtigt. Dies wird auch dadurch deutlich, dass in der Market Impact Analysis zum EAA in Automobilen verbaute Informationssysteme (in-car information devices) mit genau diesen Erwägungen aus der Impact Analysis ausgeschieden werden. Speziell in dem Fall, dass das im Computer verbaute Tablet gerade Steuerungs- oder Anzeigefunktionen wahrnimmt, wird es sich außerdem nicht mehr um einen Universal-, sondern eben einen Spezialcomputer handeln, der nicht mehr durch einen Mehrzweckcharakter geprägt wird. Und zuletzt spricht auch eine Übertragung des Gedankens aus § 1 Abs. 2 Nr. 2 lit. b dd) BFSG für das gefundene Ergebnis: Ist dem europäischen Gesetzgeber erkennbar daran gelegen, in Fahrzeugen verbaute interaktive Selbstbedienungsterminals zur Bereitstellung von Informationen aus dem Anwendungsbereich des Gesetzes auszuscheiden, eben weil der Gesetzgeber die Regulierung dieser Produktgruppen nicht beabsichtigt (ErwG. 27), so kann für andere festverbaute Tablets und Computer nichts anderes gelten. In Fahrzeugen verbaute Tablets oder Computerelemente, die Steuerungs-, Informations- oder Unterhaltungsfunktionen erfüllen, sind daher nicht vom Anwendungsbereich des BFSG erfasst.
2. Selbstbedienungsterminals (Nr. 2)
28
Nach § 1 Abs. 2 Nr. 2 BFSG erstreckt sich der Anwendungsbereich des Gesetzes auch auf ausgewählte Selbstbedienungsterminals.
a) Zahlungsterminals (§ 1 Abs. 2 Nr. 2 lit. a BFSG)
29
Vom BFSG erfasst sind nach § 1 Abs. 2 Nr. 2 lit. a BFSG insbesondere Zahlungsterminals (→ § 2 Nr. 25 BFSG), einschließlich der zu diesen gehörigen Hardware und Software. Zahlungsterminals sind ausweislich der Legaldefinition des § 2 Nr. 25 BFSG Geräte, deren Hauptzweck es ist, Zahlungen mithilfe von Zahlungsinstrumenten im Sinne des § 1 Absatz 20 des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes an einer physischen Verkaufsstelle vorzunehmen, nicht jedoch in einer virtuellen Umgebung;
30
Der Tatbestand des § 1 Abs. 2 Nr. 2 lit. a BFSG erfasst daher unter anderem Kartenlesegeräte (POS-Terminals), die häufig in Einzelhandelsgeschäften, Supermärkten, Restaurants und anderen Dienstleistungsunternehmen verwendet werden, um Zahlungen mit Kredit- oder Debitkarten zu verarbeiten, Mobile Zahlungsterminals (M-POS) und Automatische Kassen (Self-Checkout-Kassen), die Kartenzahlungen und kontaktlose Zahlungen ermöglichen. Zahlungsterminals i.S.d. § 1 Abs. 2 Nr. 2 lit. a BFSG enthalten regelmäßig auch Automaten für den Warenverkauf, Mautstationen auf Autobahnen und Parkautomaten. Der Sache nach enthalten die von § 1 Abs. 2 Nr. 2 lit. b bb) BFSG erfassten Fahrausweisautomaten ebenfalls regelmäßig ein Zahlungsterminal, insoweit geht der Tatbestand des § 1 Abs. 2 Nr. 2 lit. b bb) BFSG als lex specialis vor.
b) Geldautomaten (§ 1 Abs. 2 Nr. 2 lit. b aa) BFSG)
31
Vom Regelungssystem des Gesetzes erfasst werden ausweislich § 1 Abs. 2 Nr. 2 lit. b aa) BFSG auch Geldautomaten. Der Begriff des Geldautomaten ist weder im Gesetz selbst noch in der Gesetzesbegründung oder den Erwägungsgründen des European Accessibility Acts (RL 2019/882/EU) definiert. Ein Geldautomat ist ein elektronisches, automatisiertes Gerät, das es Bankkunden ermöglicht, Finanztransaktionen ohne die Notwendigkeit eines Bankmitarbeiters durchzuführen. Zu den typischen, aber jedenfalls nicht kumulativ erforderlichen Funktionen eines Geldautomaten gehören das Abheben von Bargeld, das Einzahlen von Geld, das Überprüfen von Kontoständen sowie das Überweisen von Geldern zwischen Konten. Geldautomaten sind in der Regel mit einer Sicherheitsmechanismus ausgestattet, wie etwa einer PIN-Eingabe, und verwenden Bankkarten (z.B. Debit- oder Kreditkarten), um Transaktionen zu authentifizieren.
c) Fahrausweisautomaten (§ 1 Abs. 2 Nr. 2 lit. b bb) BFSG)
32
Dem Rechtsakt unterworfen sind nach Maßgabe des § 1 Abs. 2 Nr. 2 lit. b bb) BFSG auch Fahrausweisautomaten. Auch der Fahrausweisautomat ist im Rechtsakt selbst nicht ausdrücklich definiert. Ein Fahrausweisautomat ist ein selbstbedienbares, automatisiertes Gerät, das es Nutzern ermöglicht, Fahrkarten für öffentliche Verkehrsmittel zu kaufen oder zu entwerten. Diese Automaten bieten in der Regel die Möglichkeit, Tickets für Busse, Bahnen, U-Bahnen oder andere Verkehrsmittel zu erwerben. Sie akzeptieren verschiedene Zahlungsmethoden, wie Bargeld, Kredit- oder Debitkarten oder sogar kontaktlose Zahlungen. Neben klassischen Fahrausweisautomaten erfasst der Tatbestand daher auch Automaten für die Ticketentwertung und Ticketautomaten mit erweiterten Funktionen (Anzeige von Fahrplänen, Informationen zu Routen und Preisen, die Auswahl von Ticketarten). Erfasst sind Ticketautomaten auch dann, wenn sie sich in einem Fahrzeug des öffentlichen Nahverkehrs (etwa in einem Bus oder in einem Zug) befinden. Dies ergibt sich aus einem systematischen Vergleich mit § 1 Abs. 2 Nr. 2 lit. b dd) BFSG, der interaktive Selbstbedienungsterminals zur Bereitstellung von Informationen dann aus dem Anwendungsbereich des Gesetzes ausscheidet, wenn sie als integrierte Bestandteile von Fahrzeugen, Luftfahrzeugen, Schiffen oder Schienenfahrzeugen eingebaut sind.
d) Check-in-Automaten (§ 1 Abs. 2 Nr. 2 lit. b cc) BFSG)
33
Auch den Begriff des vom Gesetz erfassten Check-in-Automaten (§ 1 Abs. 2 Nr. 2 lit. c cc) BFSG) definiert das Gesetz nicht. Check-in-Automaten sind automatisierte Selbstbedienungsgeräte, die es Nutzern ermöglichen, sich schnell und unabhängig für Dienstleistungen, insbesondere im Reise- oder Verkehrskontext, einzuchecken. Diese Automaten werden vor allem im Luftverkehr, aber auch in anderen Bereichen wie dem Hotelgewerbe oder öffentlichen Verkehrssystemen eingesetzt. Sie bieten eine effiziente Möglichkeit, den Check-in-Prozess zu beschleunigen und lange Warteschlangen zu vermeiden. Der European Accessibility Act nennt als Anwendungsfall Wartenummern-Automaten in Banken.29 Ob dieser Fallgruppe in der Praxis entscheidende Bedeutung zukommt, darf bezweifelt werden.
e) Interaktive Selbstbedienungsterminals zur Bereitstellung von Informationen (§ 1 Abs. 2 Nr. 2 lit. b dd) BFSG)
34
Das BFSG erstreckt sich ausweislich § 1 Abs. 2 Nr. 2 lit. b dd) BFSG auch auf interaktive Selbstbedienungsterminals zur Bereitstellung von Informationen. Erfasst sind etwa interaktive Anzeigebildschirme.30
35
Auch der Begriff des interaktives Selbstbedienungsterminals zur Bereitstellung von Informationen ist im Gesetz nicht definiert. Ein interaktives Selbstbedienungsterminal zur Bereitstellung von Informationen ist ein automatisiertes Gerät, das es Nutzern ermöglicht, selbstständig auf eine Vielzahl von Informationen zuzugreifen und mit der Benutzeroberfläche zu interagieren. Diese Terminals sind in der Regel mit einem Touchscreen, Tastaturen oder anderen Eingabemethoden ausgestattet und bieten Funktionen wie die Anzeige von Text, Bildern, Karten, Videos und interaktiven Inhalten. Sie ermöglichen es Nutzern, nach bestimmten Informationen zu suchen, Routen zu planen, Dienstleistungen zu buchen oder Produktinformationen zu erhalten, oft ohne die Notwendigkeit einer direkten Interaktion mit einem Mitarbeiter.
36
Nicht erfasst sind kraft des Ausschlusstatbestands am Ende des § 1 Abs. 2 Nr. 2 lit. b dd) BFSG Terminals, die als integrierte Bestandteile von Fahrzeugen, Luftfahrzeugen, Schiffen oder Schienenfahrzeugen eingebaut sind. Grund für diesen Ausschluss ist der begrenzte Regelungswille des Gesetzgebers: Da Fahrzeuge dem Rechtsakt nicht unterliegen (vgl. auch ErwG. 27), sollen sie einer indirekten Einbeziehung insoweit entzogen werden, als in sie Gegenstände eingebettet werden, die an sich durch das BFSG reguliert werden.
3. Verbraucherendgeräte mit interaktivem Leistungsumfang, die für Telekommunikationsdienste verwendet werden (Nr. 3)
37
Nach § 1 Abs. 2 Nr. 3 BFSG gilt das BFSG auch für Verbraucherendgeräte mit interaktivem Leistungsumfang (→ § 2 Nr. 36 BFSG), die für Telekommunikationsdienste (→ § 2 Nr. 7 BFSG) verwendet werden. Telekommunikationsdienste sind ausweislich der Legaldefinition des § 2 Nr. 7 BFSG Telekommunikationsdienste im Sinne des Art. 2 Nr. 4 der Richtlinie (EU) 2018/1972, d.h. gewöhnlich gegen Entgelt über elektronische Kommunikationsnetze erbrachte Dienste, Internetzugangsdienste, interpersonelle Kommunikationsdienste und Dienste, die ganz oder überwiegend in der Übertragung von Signalen bestehen, wie Übertragungsdienste, die für die Maschine-Maschine-Kommunikation und für den Rundfunk genutzt werden, umfassen.
38
Neben Mobiltelefonen und Tablets fallen hierunter auch Produkte, die als Teil der Konfiguration für den Zugang zu Telekommunikationsdiensten genutzt werden, wie zum Beispiel Router oder Modems.31 Ebenfalls erfasst sind Videotelefone, Smart Home-Geräte mit Telefonie-Integration und Notrufsysteme (z.B. für Senioren).
4. Verbraucherendgeräte mit interaktivem Leistungsumfang, die für den Zugang zu audiovisuellen Mediendiensten verwendet werden (Nr. 4)
39
Das BFSG erfasst ausweislich § 1 Abs. 2 Nr. 4 BFSG auch Verbraucherendgeräte mit interaktivem Leistungsumfang, die für den Zugang zu audiovisuellen Mediendiensten verwendet werden (→ § 2 Nr. 6 BFSG). Hierunter versteht der Gesetzgeber ausweislich der Legaldefinition in § 2 Nr. 6 BFSG Geräte für Verbraucher mit interaktivem Leistungsumfang (→ § 2 Nr. 36 BFSG), deren Hauptzweck es ist, Zugang zu audiovisuellen Mediendiensten (→ § 2 Nr. 5 BFSG) zu bieten.
40
Zentral ist hierbei der Begriff des audiovisuellen Mediendienstes, den das Gesetz in § 2 Nr. 5 BFSG unter Verweis auf Art. 1 Abs. 1 lit. a RL 2010/13/EU definiert. Danach ist ein audiovisueller Mediendienst eine Dienstleistung (…), für die ein Mediendiensteanbieter die redaktionelle Verantwortung trägt und deren Hauptzweck die Bereitstellung von Sendungen zur Information, Unterhaltung oder Bildung der allgemeinen Öffentlichkeit über elektronische Kommunikationsnetze (…) ist. Bei diesen audiovisuellen Mediendiensten handelt es sich entweder um Fernsehprogramme oder um audiovisuelle Mediendienste auf Abruf.
41
Erfasst werden damit neben herkömmlichen Fernsehgeräten auch Smart-TV-Geräte, die interaktive Funktionen wie den Zugang zu Streaming-Diensten (Netflix, Amazon Prime, YouTube), Apps, Internet-Browsing und anderen digitalen Medien eröffnen. Ebenfalls unter den Tatbestand fallen Set-Top-Boxen (z.B. für Kabel- oder Satellitenfernsehen) und Streaming-Geräte (z.B. Amazon Fire TV Stick32, Google Chromecast Streaming Stick, Roku TV-Stick). Daneben erfasst der Tatbestand auch Blu-ray/DVD-Player mit Smart-Funktionen oder interaktive Medienabspielgeräte (z.B. für E-Learning oder digitale Bildung). Erfasst werden außerdem Spielekonsolen33 und Systeme der virtuellen und erweiterten Realität (VR/AR). Einen Grenzfall stellen sicher sprachgesteuerte Assistenten wie Amazon Alexa dar, die den Zugriff auf audiovisuelle Inhalte von verschiedenen Medienplattformen über Sprachbefehle und interaktive Steuerung ermöglichen. Ob es gerade der Hauptzweck (vgl. § 2 Nr. 6 BFSG) solcher Geräte ist, den Zugang zu audiovisuellen Medieninhalten zu eröffnen, kann durchaus hinterfragt werden. EinWirtschaftsakteur ist angesichts der noch weitgehend ungeklärten Rechtslage trotzdem dennoch gut beraten, im Zweifel von einem weiten Anwendungsbereich des Tatbestands auszugehen.
5. E-Book-Lesegeräte (Nr. 5)
42
Zugriff, Lektüre und Nutzung von E-Book-Dateien muss ausschließlicher oder jedenfalls primärer Zweck des Geräts sein (sog. Schwerpunktbetrachtung). Unter den Begriff des E-Book-Lesegeräts (→ § 2 Nr. 38 BFSG) fallen daher solche Geräte nicht, die, wie etwa ein bereits von § 1 Abs. 2 Nr. 1 BFSG erfasstes Tablet (→ Rn. 18), ggf. unter Installation und Nutzung einer E-Book-Reader-App wie Kindle, Apple Books, Adobe Digital Editions oder auch spezielle Apps für ePub-Dateien zum Lesen von E-Books nutzbar gemacht werden können. In diesen Fällen handelt es sich nicht um ein „spezielles“ Gerät, das für Zugriff, Navigation, Lektüre und Nutzung von E-Book-Dateien verwendet wird. Dieses Ergebnis wird dadurch abgesichert, dass solche Geräte wegen des in der Nutzbarmachung zum Ausdruck kommenden Mehrzweckcharakters in aller Regel Universalcomputer darstellen und daher bereits über § 1 Abs. 2 Nr. 1 BFSG vom Anwendungsbereich des Gesetzes erfasst werden. Dem europäischen Gesetzgeber ging es bei der Aufnahme des E-Book-Lesegeräts in den Anwendungsbereich des BFSG erkennbar darum, solche Produkte zu erfassen, die wegen des fehlenden Mehrzweckcharakters nicht unter den Begriff des Universalcomputers fallen.
III. Anwendung auf Dienstleistungen (Abs. 3)
43
§ 1 Abs. 3 BFSG zählt in Umsetzung von Art. 2 Abs. 2 RL 2019/882/EU diejenigen Dienstleistungen auf, auf die das BFSG Anwendung findet. Für die Bestimmung dieses persönlichen Anwendungsbereichs im Einzelnen wird auf die Kommentierung zu den Begriffsbestimmungen (siehe unter § 2 BFSG Rn. 4ff.) und den jeweiligen Vorschriften der BFSGV verwiesen.
IV. Ausnahmen vom Anwendungsbereich für bestimmte Inhalte (Abs. 4)
44
Die Vorschrift des § 1 Abs. 4 BFSG setzt Art. 2 Abs. 4 RL 2019/882/EU um und nimmt bestimmte Inhalte von Webseiten von den Barrierefreiheitsanforderungen aus. Die Ausnahmen entsprechen denjenigen in § 2 Abs. 2 Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung (BITV 2.0), sind mit diesen aber nicht deckungsgleich. Daher ist fraglich, ob die gesetzgeberische Absicht öffentliche Stellen und private Dienstleistungsanbieter im Hinblick auf die Barrierefreiheit gleichzustellen,34 tatsächlich realisiert wurde.
45
Gemäß Nummer 1 sind aufgezeichnete, zeitbasierte Medien, die vor dem 28.06.2025 veröffentlicht wurden, von dem Anwendungsbereich ausgenommen. Dabei handeltes sich um Medien, die unabhängig vom Raum der wiederholten Vorführung zugänglich sind, zum Beispiel Videos, Filme oder Tonaufzeichnungen.
46
Nummer 2 nimmt Dateiformate von Büro-Anwendungen, die vor dem 28.06.2025 veröffentlicht wurden, vom Anwendungsbereich aus. Büro-Anwendungen sind Programme für Schriftverkehr und Präsentation (Office-Software). Ein Dateiformat ist die festgelegte Anordnung, beziehungsweise zugrundeliegende Struktur, nach der die in einer Datei enthaltenen Daten abgespeichert sind.
47
Nummer 3 nimmt – ohne Stichtagsregelung – Online-Karten und Kartendienste vom Anwendungsbereich aus, sofern bei Karten für Navigationszwecke wesentliche Informationen barrierefrei zugänglich in digitaler Form bereitgestellt werden. Kartendienste umfassen dabei sowohl Online-Kartendienste, als auch solche, die offline zum Beispiel über eine Anwendung auf einem Mobiltelefon abgerufen werden können.
48
Nach Nummer 4 fallen solche Inhalte nicht unter das BFSG, die von Dritten stammen und von dem betreffenden Wirtschaftsakteur weder finanziert oder entwickelt werden noch dessen Kontrolle unterliegen.
49
Nach Nummer 5 sind alle Online-Archive von den Anforderungen ausgenommen: Inhalte von Webseiten und mobilen Anwendungen, die nach dem 28.06.2025 nicht mehr aktualisiert oder überarbeitet werden.
V. Abgrenzung zu den Bestimmungen des Urheberrechts (Abs. 5)
50
Ausweislich Art. 2 Abs. 5 RL 2019/882/EU bleiben durch die Bestimmungen der Richtline die sog. Marrakesch-Richtlinie (EU) 2017/1564 sowie die Marrakesch-Verordnung (EU) 2017/1563 unberührt. Die Bestimmung des § 1 Abs. 5 BFSG stellt deshalb klar, dass die im Urheberrecht geregelten Befugnisse zugunsten von Menschen mit Behinderungen weiterhin Anwendung finden.35 Dies gilt sowohl für die Nutzungsbefugnisse von Menschen mit einer Seh- und Lesebehinderung nach den §§ 45b bis 45d UrhG als auch für die sonstigen Nutzungsbefugnisse von Menschen mit Behinderungen gemäß § 45a UrhG. Auch die §§ 95a–96 UrhG bleiben unberührt. Daher sind die urheberrechtlichen Maßgaben für technische Schutzmaßnahmen auch im Anwendungsbereich des BFSG zu beachten. Wenn also ein Rechtsinhaber eine technische Schutzmaßnahme einsetzt, die der Barrierefreiheit entgegensteht, darf dieser technische Schutz nicht im Wege der Selbsthilfe umgangen werden. Die von den Wirtschaftsakteuren im Abschnitt 3 (§§ 6ff. BFSG, insbesondere § 14 Abs. 4 BFSG) geforderten Korrekturmaßnahmen beschränken sich in diesem Falle darauf, vom Rechtsinhaber (zum Beispiel dem Verlag) zu verlangen, die Dienstleistung in barrierefreier Form bereitzustellen (zum Beispiel in einem barrierefreien E-Book-Format).
1https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Gesundheit/Behinderte-Menschen/_inhalt.html, zuletzt abgerufen am 15.04.2025.
2https://www.schwerhoerigen-netz.de/statistiken/, zuletzt abgerufen am 15.04.2025.
3https://gesund.bund.de/farbenblindheit#behandlung, zuletzt abgerufen am 15.04.2025.
4https://www.aktion-mensch.de/inklusion/barrierefreiheit/barrierefreie-website/test-barrierefreie-webshops, zuletzt abgerufen am 15.04.2025.
5https://www.die-medienanstalten.de/fileadmin/user_upload/die_medienanstalten/Aufgaben/Aufsicht/Barrierefreiheit/ua_2024_Elfter_Monitoringbericht_Barrierefreiheit.pdf, zuletzt abgerufen am 15.04.2025.
6https://www.die-medienanstalten.de/fileadmin/user_upload/die_medienanstalten/Aufgaben/Aufsicht/Barrierefreiheit/ua_2024_Elfter_Monitoringbericht_Barrierefreiheit.pdf, zuletzt abgerufen am 15.04.2025.
7Gesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen und zur Änderung anderer Gesetze vom 27.04.2002, BGBl. I 2002 S. 1467, 1468ff.
8Ritz, in: Kossens/von der Heide/Maaß, SGB IX mit BGG, Vor. § 1 BGG Rn. 17.
9Billing/Bremenkamp, ZVertriebsR 2025, 9, 12.
10Billing/Bremenkamp, ZVertriebsR 2025, 9, 12.
11BSG, Urt. v. 06.03.2012 – B 1 KR 10/11 R, BSGE 110, 194; LSG Bayern, Urt. v. 30.09.2015 – L 2 P 22/13, BeckRS 2015, 73258.
12Gesetz zu dem Einkommen der Vereinten Nationen vom 13.12.2006 über die Rechte von Menschen mit Behinderungen sowie zu dem Fakultativprotokoll vom 13.12.2006 zum Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen, vom 21.12.2008, BGBl. II 2008, S. 1419.
13Gesetz zur Weiterentwicklung des Behindertengleichstellungsrechts vom 19.07.2016, BGBl. I 2016, S. 1757.
14BT-Drs. 18/16, S. 1.
15Ritz, in: Kossens/von der Heide/Maaß, SGB IX mit BGG, Vor. § 1 BGG Rn. 1.
16ErwG. 17 RL 2019/882/EU.
17ErwG. 17 RL 2019/882/EU.
18ErwG. 1 RL 2019/882/EU.
19ErwG. 8 RL 2019/882/EU.
20ErwG. 5 RL 2019/882/EU.
21ErwG. 6 RL 2019/882/EU.
22BT-Drs. 19/28653, S. 3.
23ErwG. 7 RL 2019/882/EU.
24ErwG. 25 RL 2019/882/EU, BT-Drs. 19/28653, S. 63.
25ErwG. 25 RL 2019/882/EU, BT-Drs. 19/28653, S. 63.
26ErwG. 25 RL 2019/882/EU, BT-Drs. 19/28653, S. 63.
27ErwG. 27: „However, certain interactive self-service terminals providing information installed as integrated parts of vehicles, aircrafts, ships or rolling stock should be excluded from the scope of this Directive, since these form part of those vehicles, aircrafts, ships or rolling stock which arenotcoveredbythisDirective.“
28Vgl. Europäische Kommission (Hrsg.), Market Impact Analysis, S. 20.
29ErwG. 26.
30ErwG. 26.
31BT-Drs. 19/28653, S. 64.
32BT-Drs. 19/28653, S. 64.
33BT-Drs. 19/28653, S. 64.
34BT-Drs. 19/28653, S. 66.
35BT-Drs. 19/28653, S. 66.
§ 2 BFSG Begriffsbestimmungen
Im Sinne dieses Gesetzes ist oder sind
1. „Menschen mit Behinderungen“ Menschen, die langfristige körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, welche sie in Wechselwirkung mit einstellungs- und umweltbedingten Barrieren an der gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft hindern können; als langfristig gilt ein Zeitraum, der mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate andauert;
2. „Produkt“ ein Stoff, eine Zubereitung oder eine Ware, der oder die durch einen Fertigungsprozess hergestellt worden ist, mit Ausnahme von Lebensmitteln, Futtermitteln, lebenden Pflanzen und Tieren, Erzeugnissen menschlichen Ursprungs und Erzeugnissen von Pflanzen und Tieren, die unmittelbar mit ihrer künftigen Reproduktion zusammenhängen;
3. „Dienstleistung“ eine Dienstleistung im Sinne des Artikels 4 Nr. 1 der Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über Dienstleistungen im Binnenmarkt (ABl. L 376 vom 27.12.2006, S. 36);
4. „Dienstleistungserbringer“ jede natürliche oder juristische Person oder rechtsfähige Personengesellschaft, die auf dem Unionsmarkt eine Dienstleistung für Verbraucher erbringt oder anbietet, eine solche Dienstleistung zu erbringen;
5. „audiovisuelle Mediendienste“ Dienste im Sinne des Artikels 1 Abs. 1 Lit. a der Richtlinie 2010/13/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom10. März 2010 zur Koordinierung bestimmter Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung audiovisueller Mediendienste (ABl. L 95 vom 15.4.2010, S. 1; L 263 vom 6.10.2010, S. 15), die durch die Richtlinie (EU) 2018/1808 des Europäischen Parlaments und des Rates vom14. November 2018 (ABl. L 303 vom 28.11.2018, S. 69) geändert worden ist;
6. „Verbraucherendgeräte mit interaktivem Leistungsumfang, die für den Zugang zu audiovisuellen Mediendiensten verwendet werden“ Geräte für Verbraucher mit interaktivem Leistungsumfang, deren Hauptzweck es ist, Zugang zu audiovisuellen Mediendiensten zu bieten;
7. „Telekommunikationsdienste“ ein Telekommunikationsdienst im Sinne des Artikels 2 Nr. 4 der Richtlinie (EU) 2018/1972 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2018 über den europäischen Kodex für die elektronische Kommunikation (ABl. L 321 vom 17.12.2018, S. 36; L 334 vom 27.12.2019, S. 164);
8. „Text in Echtzeit“ eine Form der textbasierten Kommunikation in Punkt-zu-Punkt-Verbindungen oder bei Mehrpunktverbindungen, wobei der eingegebene Text so versendet wird, dass die Kommunikation vom Nutzer Zeichen für Zeichen als kontinuierlich wahrgenommen wird;
9. „Bereitstellung auf dem Markt“ jede entgeltliche oder unentgeltliche Abgabe eines Produkts zum Vertrieb, zum Gebrauch oder zum Verbrauch auf dem Unionsmarkt im Rahmen einer Geschäftstätigkeit;
10. „Inverkehrbringen“ die erstmalige Bereitstellung eines Produkts auf dem Unionsmarkt;
11. „Hersteller“ jede natürliche oder juristische Person oder rechtsfähige Personengesellschaft, die ein Produkt herstellt oder entwickeln oder herstellen lässt und dieses Produkt unter ihrem eigenen Namen oder ihrer eigenen Marke vermarktet;
12. „Bevollmächtigter“ jede in der Europäischen Union ansässige natürliche oder juristische Person oder rechtsfähige Personengesellschaft, die von einem Hersteller schriftlich beauftragt wurde, in seinem Namen bestimmte Aufgaben wahrzunehmen;
13. „Einführer“ jede in der Europäischen Union ansässige natürliche oder juristische Person oder rechtsfähige Personengesellschaft, die ein Produkt aus einem Drittstaat auf dem Unionsmarkt in den Verkehr bringt;
14. „Händler“ jede natürliche oder juristische Person oder rechtsfähige Personengesellschaft in der Lieferkette, die ein Produkt auf dem Markt bereitstellt, mit Ausnahme des Herstellers oder des Einführers;
15. „Wirtschaftsakteur“ ein Hersteller, Bevollmächtigter, Einführer, Händler oder Dienstleistungserbringer;
16. „Verbraucher“ jede natürliche Person, die ein unter dieses Gesetz fallendes Produkt oder eine unter dieses Gesetz fallende Dienstleistung zu Zwecken kauft oder empfängt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können;
17. „Kleinstunternehmen“ ein Unternehmen, das weniger als zehn Personen beschäftigt und das entweder einen Jahresumsatz von höchstens 2 Millionen Euro erzielt oder dessen Jahresbilanzsumme sich auf höchstens 2 Millionen Euro beläuft;
18. „kleine und mittlere Unternehmen“ Unternehmen, die weniger als 250 Personen beschäftigen und die entweder einen Jahresumsatz von höchstens 50 Millionen Euro erzielen oder deren Jahresbilanzsumme sich auf höchstens 43 Millionen Euro beläuft, mit Ausnahme von Kleinstunternehmen;
19. „harmonisierte Norm“ eine harmonisierte Norm im Sinne des Artikels 2 Nr. 1 Lit. c der Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2012 zur europäischen Normung, zur Änderung der Richtlinien 89/686/EWG und 93/15/EWG des Rates sowie der Richtlinien 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG und 2009/105/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung des Beschlusses 87/95/EWG des Rates und des Beschlusses Nr. 1673/2006/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 316 vom 14.11.2012, S. 12);
20. „technische Spezifikation“ eine technische Spezifikation im Sinne des Artikels 2 Nr. 4 der Verordnung (EU) Nr. 1025/2012, die ein Mittel zur Erfüllung der für ein Produkt oder eine Dienstleistung geltenden Barrierefreiheitsanforderungen darstellt;
21. „CE-Kennzeichnung“ die Kennzeichnung, durch die der Hersteller erklärt, dass das Produkt den geltenden Anforderungen genügt, die in den Harmonisierungsrechtsvorschriften der Europäischen Union, die ihre Anbringung vorschreiben, festgelegt sind;
22. „Marktüberwachungsbehörde“ jede Behörde, die nach Landesrecht für die Durchführung der Marktüberwachung zuständig ist;
23. „Rücknahme“ jede Maßnahme, mit der verhindert werden soll, dass ein Produkt, das sich in der Lieferkette befindet, auf dem Markt bereitgestellt wird, oder bewirkt werden soll, dass ein auf dem Markt bereitgestelltes Produkt dem Markt wieder entzogen wird;
24. „Bankdienstleistungen für Verbraucher“ die Bereitstellung der folgenden Bank- und Finanzdienstleistungen für Verbraucher:
a) Kreditverträge im Sinne der Richtlinie 2008/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2008 über Verbraucherkreditverträge und zur Aufhebung der Richtlinie 87/102/EWG des Rates (ABl. L 133 vom 22.5.2008, S. 66), mit der Maßgabe, dass die Höchstgrenze gemäß Artikel 2 Abs. 2 Lit. c der Richtlinie 2008/48/EG keine Anwendung findet, oder Kreditverträge im Sinne der Richtlinie 2014/17/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Februar 2014 über Wohnimmobilienkreditverträge für Verbraucher und zur Änderung der Richtlinien 2008/48/EG und 2013/36/EU und der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 (ABl. L 60 vom 28.2.2014, S. 34);
b) Dienste gemäß Anhang I Abschnitt A Nr. 1, 2, 4 und 5 und Abschnitt B Nr. 1, 2, 4 und 5 der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 über Märkte für Finanzinstrumente sowie zur Änderung der Richtlinien 2002/92/EG und 2011/61/EU (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 349; L 74 vom 18.3.2015, S. 38; L 188 vom 13.7.2016, S. 28; L 273 vom 8.10.2016, S. 35; L 64 vom 10.3.2017, S. 116; L 278 vom 27.10.2017, S. 56), die zuletzt durch die Verordnung (EU) 2019/2115 (ABl. L 30 vom 11.12.2019, S. 1) geändert worden ist;
c) Zahlungsdienste gemäß § 1 Abs. 1 Satz 2 des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes vom 17. Juli 2017 (BGBl. I S. 2446), das zuletzt durch Artikel 9 Abs. 8 des Gesetzes vom 9. Dezember 2020 (BGBl. I S. 2773) geändert worden ist;
d) mit einem Zahlungskonto verbundene Dienste gemäß § 2 Abs. 2 des Zahlungskontengesetzes vom 11. April 2016 (BGBl. I S. 720), das zuletzt durch Artikel 9 Abs. 7 des Gesetzes vom 9. Dezember 2020 (BGBl. I S. 2773) geändert worden ist und
e) E-Geld gemäß § 1 Abs. 2 Satz 3 des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes;
25. „Zahlungsterminal“ ein Gerät, dessen Hauptzweck es ist, Zahlungen mithilfe von Zahlungsinstrumenten im Sinne des § 1 Abs. 20 des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes an einer physischen Verkaufsstelle vorzunehmen, nicht jedoch in einer virtuellen Umgebung;
26. „Dienstleistungen im elektronischen Geschäftsverkehr“ Dienstleistungen der Telemedien, die über Webseiten und über Anwendungen auf Mobilgeräten angeboten werden und elektronisch und auf individuelle Anfrage eines Verbrauchers im Hinblick auf den Abschluss eines Verbrauchervertrags erbracht werden;
27. „Personenbeförderungsdienste im Luftverkehr“ gewerbliche Passagierflugdienste gemäß Artikel 2 Lit. l der Verordnung (EG) Nr. 1107/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juli 2006 über die Rechte von behinderten Flugreisenden und Flugreisenden mit eingeschränkter Mobilität (ABl. L 204 vom 26.7.2006, S. 1; ABl. R 026 vom 26.01.2013, S. 34), wenn von einem Flughafen, der im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats liegt, abgeflogen, auf einem solchen angekommen oder ein solcher im Transit benutzt wird; einschließlich Flügen ab einem in einem Drittland gelegenen Flughafen zu einem im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats gelegenen Flughafen, wenn diese Dienste von einem Luftfahrtunternehmen aus der Europäischen Union betrieben werden;
28. „Personenbeförderungsdienste im Busverkehr“ Dienstleistungen, die Gegenstand von Artikel 2 Abs. 1 und 2 der Verordnung (EU) Nr. 181/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Februar 2011 über die Fahrgastrechte im Kraftomnibusverkehr und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 (ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 1) sind;
29. „Personenbeförderungsdienste im Schienenverkehr“ alle Eisenbahnfahrten und -dienstleistungen im Sinne von Artikel 2 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 1371/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2007 über die Rechte und Pflichten der Fahrgäste im Eisenbahnverkehr (ABl. L 315 vom 3.12.2007, S. 14) mit Ausnahme der in Artikel 2 Abs. 2 der genannten Verordnung genannten Dienstleistungen;
30. „Personenbeförderungsdienste im Schiffsverkehr“ alle Dienstleistungen für Fahrgäste im Sinne von Artikel 2 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 1177/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2010 über die Fahrgastrechte im See- und Binnenschiffsverkehr und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 (ABl. L 334 vom 17.12.2010, S. 1) mit Ausnahme der in Artikel 2 Abs. 2 der genannten Verordnung genannten Dienstleistungen;
31. „Stadt- und Vorortverkehrsdienste“ Verkehrsdienste mit den Verkehrsmitteln Eisenbahn, Bus, U-Bahn, Straßenbahn und Oberleitungsomnibus, deren Hauptzweck es ist, die Verkehrsbedürfnisse eines Stadtgebietes oder eines, auch grenzüberschreitenden, Ballungsraumes sowie die Verkehrsbedürfnisse zwischen einem Stadtgebiet oder Ballungsraum und dem Umland abzudecken;
32. „Regionalverkehrsdienste“ Verkehrsdienste mit den Verkehrsmitteln Eisenbahn, Bus, U-Bahn, Straßenbahn und Oberleitungsomnibus, deren Hauptzweck es ist, die Verkehrsbedürfnisse einer, auch grenzüberschreitenden, Region abzudecken;
33. „assistive Technologien“ jedes Element, Gerät oder Produktsystem, einschließlich Software,
a) das genutzt wird, um die funktionellen Fähigkeiten von Menschen mit Behinderungen zu erhöhen, aufrechtzuerhalten, zu ersetzen oder zu verbessern, oder
b) das der Linderung und dem Ausgleich von Behinderungen, Beeinträchtigungen der Aktivität oder Beeinträchtigungen der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen dient;
34. „Betriebssystem“ die Software, die unter anderem die Schnittstelle zur peripheren Hardware steuert, Aufgaben plant, Speicherplatz zuweist und dem Verbraucher eine Standardschnittstelle anzeigt, wenn kein Anwenderprogramm läuft, einschließlich einer grafischen Nutzerschnittstelle, unabhängig davon, ob diese Software integraler Bestandteil der Hardware für Universalrechner für Verbraucher ist oder als externe Software zur Ausführung auf der Hardware für Universalrechner für Verbraucher bestimmt ist; ausgeschlossen sind Lader eines Betriebssystems, ein BIOS oder eine andere Firmware, die beim Hochfahren oder beim Installieren des Betriebssystems erforderlich ist;
35. „Hardwaresystem für Universalrechner für Verbraucher“ die Kombination von Hardware,
a) die einen vollständigen Computer bildet und durch ihren Mehrzweckcharakter und ihre Fähigkeit gekennzeichnet ist, mit der geeigneten Software die vom Verbraucher geforderten üblichen Computeraufgaben durchzuführen, und
b) dazu bestimmt ist, von Verbrauchern bedient zu werden; einschließlich Personal Computer, insbesondere Desktops, Notebooks, Smartphones und Tablets;
36. „interaktiver Leistungsumfang“ die Funktionalität zur Unterstützung der Interaktion zwischen Mensch und Gerät, um die Verarbeitung und Übertragung von Daten, Sprache oder Video oder einer beliebigen Kombination daraus zu ermöglichen;
37. „E-Book und hierfür bestimmte Software“
a) einen Dienst, der in der Bereitstellung digitaler Dateien besteht, die eine elektronische Fassung eines Buches übermitteln und Zugriff, Blättern, Lektüre und Nutzung ermöglichen, und
b) die Software, die speziell auf Zugriff, Navigieren, Lektüre und Nutzung der betreffenden digitalen Dateien ausgelegt ist, einschließlich Dienstleistungen und mobiler Anwendungen, die auf Mobilgeräten angeboten werden und ausgenommen Software für E-Book-Lesegeräte nach Nr. 38;
38. „E-Book-Lesegerät“ ein spezielles Gerät, einschließlich Hardware und Software, das für Zugriff, Navigieren, Lektüre und Nutzung von E-Book-Dateien verwendet wird;
39. „elektronische Tickets“ Systeme, in denen eine Fahrberechtigung in Form eines Fahrscheins für eine einfache Fahrt oder mehrere Fahrten, eines Abonnements oder eines Fahrguthabens nicht auf Papier gedruckt wird, sondern elektronisch auf einem physischen Fahrausweis oder einem anderen Gerät gespeichert wird;
40. „elektronische Ticketdienste“ Systeme, in denen Fahrberechtigungen mithilfe eines Geräts mit interaktivem Leistungsumfang unter anderem online erworben und dem Käufer elektronisch übermittelt werden, damit sie in Papierform ausgedruckt oder mithilfe eines Geräts mit interaktivem Leistungsumfang während der Fahrt angezeigt werden können;
41. „Ingebrauchnahme“ die erstmalige Eröffnung der Nutzungsmöglichkeit eines Selbstbedienungsterminals.
A. Einführung 1
B. Regelungsgehalt 4
I. Menschen mit Behinderungen 4
II. Produkt 6
III. Dienstleistung 8
IV. Dienstleistungserbringer 12
V. Audiovisuelle Mediendienste 13
VI. Verbraucherendgeräte mit interaktivem Leistungsumfang, die für den Zugang zu audiovisuellen Mediendiensten verwendet werden 14
VII. Telekommunikationsdienste 15
VIII. Text in Echtzeit 16
IX. Bereitstellung auf dem Markt 18
X. Inverkehrbringen 19
XI. Hersteller 20
XII. Bevollmächtigter 21
XIII. Einführer 22
XIV. Händler 23
XV. Wirtschaftsakteur 24
XVI. Verbraucher 25
XVII. Kleinstunternehmen 26
XVIII. Kleine und mittlere Unternehmen 27
XIX. Harmonisierte Norm 28
XX. Technische Spezifikation 29
XXI. CE-Kennzeichnung 30
XXII. Marktüberwachungsbehörde 31
XXIII. Rücknahme 32
XXIV. Bankdienstleistungen für Verbraucher 33
1. Kreditverträge 34
2. Dienste 35
3. Zahlungsdienste 36
4. Mit einem Zahlungskonto verbundene Dienste 37
5. E-Geld 38
XXV. Zahlungsterminal 39
XXVI. Dienstleistungen im elektronischen Geschäftsverkehr 40
XXVII. Personenbeförderungsdienste im Luftverkehr 43
XXVIII. Personenbeförderungsdienste im Busverkehr 44
XXIX. Personenbeförderungsdienste im Schienenverkehr 45
XXX. Personenbeförderungsdienste im Schiffsverkehr 46
XXXI. Stadt- und Vorortverkehrsdienste 47
XXXII. Regionalverkehrsdienste 48
XXXIII. Assistive Technologien 49
XXXIV. Betriebssystem 50
XXXV. Hardwaresystem für Universalrechner für Verbraucher 51
XXXVI. Interaktiver Leistungsumfang 52
XXXVII. E-Book und hierfür bestimmte Software 53
XXXVIII. E-Book-Lesegerät 54
XXXIX. Elektronische Tickets 55
XL. Elektronische Ticketdienste 56
XLI. Ingebrauchnahme 57
A. Einführung
1
Größenteils hat der deutsche Gesetzgeber die Begriffsbestimmungen aus der RL 2019/882/EU übernommen. Die Begriffe sind zum Teil schon öfter in Verordnungen oder Richtlinien aufgetaucht und weichen nur vereinzelt von den Bestimmungen anderer Vorschriften ab. Die Vielzahl von Regulierungen von Produkten und Dienstleistungen in den letzten Jahren führen dazu, dass sich die Begriffe entsprechend überschneiden. Eine solche Vorgehensweise ist zu begrüßen und erleichtert die Anwendung regulatorischer Vorgaben.
2





























