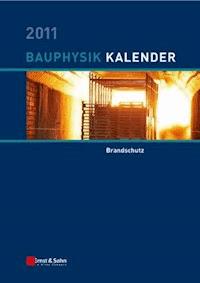
Bauphysik-Kalender 2011 E-Book
70,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Wiley-VCH
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Der Brandschutz im Bauwesen verlangt von allen Beteiligten an Entwurf und Planung von Bauwerken, von Bauproduktherstellern, Materialprüfungsämtern und Bauaufsichtsbehörden ein hohes Maß an Fachkenntnis über den aktuellen Stand aller relevanten Bereiche. Nur durch eine interdisziplinäre Zusammenarbeit untereinander können sichere und optimierte Brandschutzkonzepte entwickelt und realisiert werden. Der neue Bauphysik-Kalender 2011 mit dem Schwerpunktthema Brandschutz bietet eine verläßliche Arbeitshilfe für die Planung in Neubau und Bestand, und zwar sowohl für den konstruktiven Brandschutz nach den Eurocodes bei allen Bauweisen als auch für die ingenieurmäßigen Brandschutzkonzepte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1263
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Inhaltsübersicht
A Allgemeines und Regelwerke
A1 Brandschutz im Bauordnungsrecht
1 Bauordnungsrecht der Länder, Musterbauordnung der ARGEBAU
2 Bauordnungsrechtliche Brandschutzvorschriften
3 Brandschutzkonzepte der MBO
4 Bauaufsichtliche Verfahren, Abweichungen
5 Struktur der Anforderungen an Baustoffe und Bauteile
6 Struktur der Anforderungen an Rettungswege
A2 Europäische Harmonisierung im Brandschutz
1 Allgemeines
2 Bauproduktenrichtlinie und Grundlagendokument
3 Prüfung und Klassifizierung im Brandschutz
4 Klassifizierung ohne Prüfung
5 Ingenieurmethoden des Brandschutzes
6 Brandschutzbemessung nach den Eurocodes
7 Europäische Klassifizierung im bauaufsichtlichen Verfahren
8 Europäische Klassifizierung in der Praxis
9 Zusammenfassung
10 Literatur
A3 Bauaufsichtliche Regelungen zum Verwendbarkeitsnachweis
1 Vorbemerkung
2 Grundlagen
3 Erfordernis bauaufsichtlicher Verwendbarkeitsnachweise
4 Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung, allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis, Zustimmung im Einzelfall
5 Schlussbemerkung
6 Literatur – Fundstellen
A4 Leistungsbild und Honorierung im Brandschutz
1 Einführung
2 Prüfingenieure und Prüfsachverständige für Brandschutz
3 Erstellung von Brandschutznachweisen, Brandschutzkonzepten
4 Visualisierung und Brandschutzpläne
5 Fachbauleitung Brandschutz
6 Leistungsbild für Brandschutz
7 Honorartafel
8 Einbindung in die HOAI
9 Literatur
B Materialtechnische Grundlagen
B1 Kunststoffe und Brandschutz
1 Anwendungsbereiche für Kunststoffe
2 Wichtige Brandphasen und Kriterien, um die Sicherheit im Brandfall zu gewährleisten
3 Beurteilung von brennbaren Bauprodukten hinsichtlich ihres Brandverhaltens
4 Prüfverfahren in Deutschland
5 Prüfung und Klassifizierung von Baustoffen in Europa
6 Europäische Klassifizierungen im deutschen Baurecht
7 Prüfung von Kunststoffen nach den europäischen Normen
8 Brandsicheres Bauen mit Kunststoffen am Beispiel von Wärmedämm-Verbundsystemen für Fassaden mit Polystyrol-Hartschaum als Dämmstoff
9 Brandsichere Auslegung von Dächern
10 Weitere Beispiele für brandsicheres Bauen mit Kunststoffen
11 Zusammenfassung
12 Literatur
B2 Brandschutzbekleidungen und -beschichtungen
1 Baulicher Brandschutz
2 Brandschutzbeschichtungen zur Verbesserung des Brandverhaltens
3 Brandschutzbekleidungen und-beschichtungen zur Verbesserung des Feuerwiderstandes
4 Literatur
C Bauphysikalische Planungs- und Nachweisverfahren
C1 Ingenieurmethoden im Brandschutz
1 Einleitung
2 Grundlagen der rechnerischen Modellierung von Bränden
3 Grundlagen der Modellierung von Bränden mit Mehrraum-Zonenmodellen
4 Grundlagen der Modellierung von Bränden mit CFD-Modellen
5 Brandszenarien für die Anwendung von Ingenieurmethoden
6 Literatur
C2 Numerische Simulation im Brandschutz
1 Einführung
2 Entstehung eines CFD-Programms
3 Einführung in die CFD-Grundlagen
4 Technische Aspekte
6 Praktische Anwendung
7 Anhang
8 Literatur
C3 Perspektiven der Evakuierungsberechnung
1 Einführung
2 Szenarien
3 Praxis und Maßnahmen
4 Simulation mit Zellularautomaten
5 Zusammenfassung und Ausblick
6 Literatur
C4 Brandschutz im Industriebau
1 Einleitung
2 Inhalte und Erläuterung der DIN 18230-1
3 Beispiele – Brandbekämpfungsabschnitte mit mehreren Ebenen nach DIN 18230-1
4 DIN 18230-4: Ermittlung der äquivalenten Branddauer und des Wärmeabzugs durch Brandsimulation
5 Sicherheitskonzept der DIN 18230
6 Literatur
C5 Grundlagen nach Eurocode 1
1 Allgemeines zu den Eurocodes
2 Tragwerkseinwirkungen für den Brandfall
3 Alternativen zur Festlegung der Brandwirkungen
4 Beispiel 1: Vollentwickelter Raumbrand
5 Beispiel 2: Lokaler Brand
6 Literatur
C6 Brandschutzbemessung von Betonbauteilen nach Eurocode 2
1 Einleitung
2 Tabellarische Daten
3 Vereinfachtes Rechenverfahren
4 Allgemeine Rechenverfahren
5 Anwendungsbeispiele
6 Zusammenfassung
7 Literatur
C7 Brandschutztechnische Bemessung im Stahl- und Stahlverbundbau nach Eurocode 3 und 4
1 Einleitung
2 Einwirkungen
3 Materialeigenschaften
4 Bemessungsverfahren nach EC 3
5 Bemessungsverfahren nach EC 4
6 Berechnungsbeispiele
7 Software
8 Zusammenfassung und Ausblick
9 Literatur
C8 Brandschutzbemessung von Holzbauteilen nach Eurocode 5
1 Allgemeines
2 Brandverhalten von Holzbauteilen
3 Brandschutztechnischer Nachweis
4 Vereinfachte Rechenverfahren
5 Bemessung anfangs geschützter Bauteile
6 Bemessung von Holzverbindungen
7 Literatur
C9 Sicherheitskonzept zur Brandschutzbemessung –Erprobung und Validierung im Stahl- und Stahlverbundbau
1 Einleitung
2 Methoden
3 Gebäudebeschreibung
4 Berechnungen und Ergebnisse
5 Automatisierte Berechnung der Teilsicherheitsbeiwerte
6 Zusammenfassung und Ausblick
7 Literatur
D Konstruktive Ausbildung von Bauteilen und Bauwerken
D1 Brandschutz in Hochhäusern - Kommentar zur Muster-Hochhaus-Richtlinie - MHHR
I Allgemeiner Überblick
1 Einleitung
2 Zur Entwicklungsgeschichte der Hochhaus-Richtlinie
3 Systematik der Sonderbauten
4 Definition des Hochhauses
5 Systematik der Muster-Hochhaus-Richtlinie 2008
II Die Regelungen der MHHR 2008 im Einzelnen
1 Anwendungsbereich
2 Zufahrten, Durchfahrten, Bewegungsflächen und Eingänge für die Feuerwehr
3 Bauteile
4 Rettungswege
5 Räume mit erhöhter Brandgefahr
6 Sicherheitstechnische Gebäudeausrüstung
7 Technische Gebäudeausrüstung
8 Erleichterungen für Hochhäuser mit nicht mehr als 60 m Höhe in Zellenbauweise
9 Betriebsvorschriften
III Schlussbemerkung
D2 Brandschutz für Schulen und Kindergärten – Bestand und Sanierung
1 Einleitung
2 Brandschutzaufgaben bei der Sanierung von Schulen und Kindergärten
3 Entscheidungsgrundlagen
4 Gefahrenfeststellung in Schulen und Kindergärten
5 Grundsätze bei der Gefahrenbeseitigung in Schulen und Kindergärten
6 Beispiele
7 Literatur
D3 Brandschutz im Krankenhaus
1 Einleitung
2 Rechtliche Grundlagen
3 Vorbeugender Brandschutz
4 Anlagentechnischer Brandschutz
5 Organisatorischer Brandschutz
6 Abwehrender Brandschutz und Löschwasserversorgung
7 Brandschutzkonzept
8 Zusammenfassung und Schlussbemerkung
9 Literatur
D4 Brandschutz bei hölzernen Bauteilen nach den nationalen Regeln / Brandschutzkonzepte bei hölzernen Bauwerken
1 Einleitung
2 Brandschutztechnisch wirksame Bekleidung
3 Rauchdichtigkeit von raumabschließenden Holztafelbauteilen
4 Installationen
5 Verwendbarkeitsnachweise
6 Weiterentwicklung der Muster-Holzbaurichtlinie
7 Projektbeispiel: Brandschutzkonzept für einen siebengeschossigen Sonderbau in Holzbauweise
8 Zusammenfassung
9 Literatur
D5 Brandschutz im Bestand
1 Einleitung
2 Brandschutzanforderungen an bestehende Gebäude
3 Brandrisiken in bestehenden Gebäuden
4 Bauwerksanalyse
5 Brandschutzkonzepte für bestehende Gebäude
6 Umsetzung der Konzepte-Ausschreibung und Ausführung
7 Schlussbetrachtungen
8 Literatur
E Materialtechnische Tabellen
E1 Materialtechnische Tabellen für den Brandschutz
1 Einleitung
2 Stoffdaten
3 Literatur
E2 Materialtechnische Tabellen
1 Vorbemerkungen
2 Wärmeund feuchtetechnische Kennwerte
3 Schallschutztechnische und akustische Kennwerte
4 Literatur
Stichwortverzeichnis
2011 BAUPHYSIK KALENDER
Herausgegeben vonUniv. Prof. Dr.-Ing. Nabil A. Fouad
11. Jahrgang
Titelbild: Brandversuch im MaBstab 1: 1 in einem Versuchstunnel zur Abnahme des SAFE-Konzeptes fur den Eurotunnel (Spanien, 2010).Bibliografische Information der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.
©2011 Wilhelm Ernst & Sohn,Verlag fur Architektur und technische Wissenschaften GmbH & Co. KG,RotherstraBe 21, 10245 Berlin, Germany
Alle Rechte, insbesondere die der Übersetzung in andere Sprachen, vorbehalten. Kein Teil dieses Buches darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlages in irgendeiner Form – durch Fotokopie, Mikrofilm oder irgendein anderes Verfahren – reproduziert oder in eine von Maschinen, insbesondere von Datenverarbeitungsmaschinen, verwend-bare Sprache übertragen oder übersetzt werden.
All rights reserved (including this of translation into other languages). No part of this book may be reproduced in any form – by photoprint, microfilm, or any other means – nor transmitted or translated into a machine language without written permission from the publisher.
Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen oder sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragenen Warenzeichen oder sonstige gesetzlich geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche markiert sind.
ISBN: 978-3-433-02965-7ISSN: 01617-2205
Electronic version available, o-book ISBN 978-3-433-60081-8
Vorwort
Dem Brandschutz kommt im Bauordnungsrecht eine große Bedeutung zu. Das Ziel ist der Schutz der offent-lichen Sicherheit und ördnung, insbesondere der Schutz von Leben und Gesundheit sowie der natürlichen Le-bensgrundlagen. Die ganzheitliche Betrachtung des vorbeugenden Brandschutzes, in der eine Gesamt-bewertung der baulichen, anlagentechnischen und orga-nisatorischen Maßnahmen unter Berücksichtigung der nutzungsbedingten Gefährdungspotenziale sowie Schutzziele erfolgt, spielt bei der Planung und Errich-tung von Bauwerken somit eine wesentliche Rolle.
Die Belange des vorbeugenden Brandschutzes erfor-dern von allen an Entwurf, Planung und Ausführung von Bauwerken Beteiligten sowie von den Bauprodukt-herstellern, Materialprüfanstalten und Bauaufsichts-behörden ein hohes Maß an Fachkenntnis sowie den Überblick über den aktuellen Stand der Technik aller relevanten Bereiche. Nur durch eine interdisziplinäre Zusammenarbeit künnen sichere und optimierte Brand-schutzkonzepte entwickelt und realisiert werden.
Schwerpunktthema des Bauphysik-Kalenders 2011 ist der vorbeugende bauliche Brandschutz. Folgende In-halte werden vermittelt:
– Kommentierung/Erläuterung aktueller Bauordnun-gen, wichtiger Verordnungen, Richtlinien und Normen;
– Beiträge über das Brandverhalten gebräuchlicher und innovativer Baustoffe sowie -konstruktionen;
– Vorstellung der neuesten Entwicklungen auf dem Gebiet der Ingenieurmethoden im Brandschutz sowie müglicher Nachweisverfahren und Rechen-werkzeuge;
– Vorstellung und Erläuterung der neuen Eurocodes zur brandschutztechnischen Bemessung von Bau-teilen;
– ausgewählte Beiträge zu aktuellen Fragestellungen und Problemen auf dem Gebiet des vorbeugenden Brandschutzes.
In Abschnitt A wird zu Beginn ein Überblick über den Aufßau der Bauordnungen und die Rolle, die der Brandschutz im Bauordnungsrecht spielt, gegeben. AnschlieBend folgen Ausführungen zur europaischen Harmonisierung im Brandschutz. Hier werden u. a. das europäische Klassifizierungssystem und die Ein-fuhrung der europäischen Klassen in das deutsche Baurecht erläutert. Der dritte Beitrag stellt das bauauf-sichtliche Regelungsinstrumentarium und seine Grund-lagen vor, mit dem die technischen Regeln fär Bau-produkte und Bauarten um das in ihnen nicht Geregel-te ergänzt werden. Am Ende des Abschnitts A werden der aktuelle Stand hinsichtlich des Leistungsbildes und der Honorierung für den Brandschutz dargestellt sowie zukünftige Tendenzen aufgezeigt. Das Leistungsbild für den Brandschutz stellt inzwischen eine eigenstän-dige Planungs- bzw. Beratungsaufgabe für Ingenieure und Architekten dar.
Abschnitt B enthält materialtechnische Betrachtungen im Brandschutz, dazu gehören das Brandverhalten von Kunststoffen sowie Beschichtungs- und Verkleidungs-systeme, die als Lösungen für brandschutztechnische ErtuchtigungsmaBnahmen für Bauteile eingesetzt wer-den konnen.
Zu den Nachweisverfahren im Brandschutz wird im Abschnitt C in den ersten beiden Beiträgen auf die In-genieurmethoden im Brandschutz ausführlich einge-gangen. Die praktische Anwendung derartiger Berech-nungsverfahren ist aufgrund der rasanten Entwicklung der technischen Voraussetzungen in den letzten Jahren möglich geworden. Auf Grundlage dieser Nachweis-methoden können u. a. die erforderlichen Brandschutz-maßnahmen, insbesondere bei Ingenieurbauwerken objektiv bestimmt und bewertet werden. In einem wei-teren Beitrag zur Evakuierungsproblematik werden die Einsatzmöglichkeiten von Simulationen zur Analyse und Optimierung von Verkehrsströmen auf mikrosko-pischer Ebene in ausgedehnten Systemen vorgestellt. Der vierte Beitrag des Abschnittes C behandelt die Nachweisverfahren im Industriebau auf Grundlage der DIN 18230 und der Muster-Industriebaurichtlinie, die inzwischen in nahezu allen Bundesländern eingefuhrt worden ist. Darin wird auch auf die Neufassung der DIN 18230-1: „Baulicher Brandschutz im Industriebau – Teil 1: Rechnerisch erforderliche Feuerwiderstands-dauer“, die im September 2010 erschienen ist, einge-gangen. Weiterhin wird der neue Entwurf DIN 18230-4: „Baulicher Brandschutz im Industriebau – Teil 4: Er-mittlung der äquivalenten Branddauer und des Warme-abzugs durch Brandsimulation“ in der Fassung vom Oktober 2010 ausfuhrlich kommentiert und erläutert.
Die Heißbemessung als brandschutztechnischer Nach-weis von Bauteilen und Tragwerken auf Grundlage der aktuellen Teile 1-2 der Eurocodes 1 bis 5 ist Thema von vier Beiträgen in Abschnitt C. Im Dezember 2010 wur-den die Nationalen Anhänge zusammen mit den neusten Fassungen der Eurocodes als WeiBdrucke veröffent-licht. Die jeweiligen Eurocodeteile 1-2 sind der brand-schutztechnischen Bemessung von Bauteilen und Trag-werken gewidmet und sollen mit ihren Nationalen An-hängen 2011 in die Musterliste der Technischen Bau-bestimmungen aufgenommen und anschließend in den Bundesländern bauaufsichtlich eingeführt werden. So-mit besteht erstmals die Müglichkeit, die HeiBbemes-sung von Bauteilen und Tragwerken ohne besondere Genehmigung in Deutschland anzuwenden.
Der letzte Beitrag in diesem Abschnitt widmet sich ei-nem Sicherheitskonzept zur Brandschutzbemessung im Stahl- und Stahlverbundbau unter Zugrundelegung von realitätsnahen Brandszenarien.
Im Abschnitt D werden aktuelle Fragestellungen und Entwicklungen aus Forschung und Praxis im Bereich des Brandschutzes behandelt.
Äußerst aktuelle Themen stellen die Problematiken des Brandschutzes bei Hochhäusern, Schulen, Kitas, Kran-kenhäusern und Bauwerken in Holzbauweise dar. Es werden neue Erkenntnisse und Forschungsergebnisse vorgestellt sowie Beispiellösungen erläutert, ü;ber Er-fahrungen der Feuerwehr bei Einsätzen an Sonderbau-ten berichtet und Problemfelder aufgezeigt.
Ausfuhrungen zum „Brandschutz im Bestand“ schlie-ßen den Abschnitt D ab.
Der letzte Abschnitt E des Bauphysik-Kalenders 2011 beinhaltet neben den jährlich aktualisierten bauphysikalischen Materialkennwerten einen Beitrag mit material-technischen Tabellen für den Brandschutz. Hier werden Kennwerte angegeben, die vor allem für die zunehmend eingesetzten Ingenieurmethoden und für die Brandsi-mulation relevant sind.
Mit seinen vielfaltigen Beiträgen stellt der Bauphysik-Kalender 2011 eine solide Arbeitsgrundlage sowie ein aktuelles Nachschlagewerk nicht nur für die Praxis, sondern auch für Lehre und Forschung dar. Für kritische Anmerkungen sind die Autoren, der Herausgeber und der Verlag dankbar.
Der Herausgeber möchte an dieser Stelle allen Autoren für ihre Mitarbeit und dem Verlag für die angenehme Zusammenarbeit herzlich danken.
Hannover, im Dezember 2010N. A. Fouad
AAllgemeines und Regelwerke
A 1
Brandschutz im Bauordnungsrecht
Gabriele Famers
Inhaltsverzeichnis
1 Bauordnungsrecht der Länder, Musterbauordnung der ARGEBAU
2 Bauordnungsrechtliche Brandschutzvorschriften
2.1 Gesetz
2.2 Verordnungen, Richtlinien
2.3 Technische Regeln
2.3.1 Eingeführte Technische Baubestimmungen
2.3.2 Allgemein anerkannte Regeln der Technik
2.4 Brandschutz außerhalb des Bauordnungsrechts
3 Brandschutzkonzepte der MBO
3.1 Brandschutzkonzepte für fünf Gebäudeklassen
3.2 Besondere Anforderungen an Sonderbauten
4 Bauaufsichtliche Verfahren, Abweichungen
4.1 Bauaufsichtliche Mitwirkung
4.2 Brandschutznachweis und Prüfung
4.3 Abweichungen
5 Struktur der Anforderungen an Baustoffe und Bauteile
5.1 Brandverhalten von Baustoffen
5.2 Feuerwiderstandsfähigkeit von Bauteilen
5.3 Verknüpfung von Baustoff- und Bauteilanforderung
5.4 Schutzziel und Konkretisierung, Beispiel tragende Wände und Decken
6 Struktur der Anforderungen an Rettungswege
6.1 Zwei Rettungswege, Rettungswegführung
6.2 Bemessung der Rettungswege
6.3 Schutz der Rettungswege
1 Bauordnungsrecht der Länder, Musterbauordnung der ARGEBAU
Brandschutz ist seit jeher ein wesentlicher Bestandteil des Bauordnungsrechts. Nicht selten waren Anforderungen an Gebäude zum Schutz vor Feuer Auslöser für die Entwicklung von Bauvorschriften überhaupt. Weil durch verheerende Stadtbrände ein Großteil der Bevölkerung Haus und Hof verlor und ein erheblicher Teil der Wirtschaftsgrundlage der Gemeinschaft vernichtet war, hat die jeweilige Obrigkeit für die Bauausführung beim Wiederaufbau besondere Regeln erlassen, die eine Wiederholung solcher Katastrophen im öffentlichen Interesse verhindern sollten. So entstanden Bauvorschriften mit mehr oder weniger örtlich begrenzter Geltung. Einige alte Stadtbilder verdanken ihr typisches Erscheinungsbild einer solchen örtlichen Brandschutzvorschrift, wie zum Beispiel die Städte an Inn und Donau mit ihren Grabendächern und den hohen Vorschussmauern ohne Dachüberstände.
Auch heute nimmt der Brandschutz im Bauordnungsrecht einen großen Raum ein. Das Schutzziel ist nach wie vor die öffentliche Sicherheit und Ordnung, insbesondere der Schutz von Leben und Gesundheit, später hinzugekommen auch der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen (§ 3 Abs. 1 MBO).
Das Bauordnungsrecht ist Ländersache. Die Länder haben 1955 eine Musterbauordnungskommission gegründet, um einer zu unterschiedlichen Ausformung des Bauordnungsrechts entgegenzuwirken. In dieser Kommission waren alle für die Bauaufsicht zuständigen Länderministerien sowie das Bundesministerium für Wohnen vertreten. Sie erarbeitete eine Musterbauordnung (MBO), die erstmals 1959 den Ländern als Orientierungswert für die eigene Landesgesetzgebung zur Verfügung stand. Nachfolgerin der Musterbauordnungskommission ist heute die Fachkommission Bauaufsicht der Bauministerkonferenz (Arbeitsgemeinschaft der für Städtebau, Bau- und Wohnungswesen zuständigen Minister und Senatoren der 16 Länder der Bundesrepublik Deutschland – ARGEBAU). Die Musterbauordnung wurde und wird von der Fachkommission Bauaufsicht ständig weiterentwickelt und liegt seit 2002 in einer novellierten Fassung vor. In den nachfolgenden Ausführungen wird von der Musterbauordnung MBO und den zugehörigen Muster-Vorschriften ausgegangen. Rechtsverbindlich für ein Bauvorhaben sind aber nur die Gesetze, Verordnungen, Richtlinien und TB-Listen, die das jeweilige Land erlassen hat.
2 Bauordnungsrechtliche Brandschutzvorschriften
2.1 Gesetz
Die MBO verlangt in ihrer Generalklausel (§ 3 Abs. 1 MBO), dass bauliche Anlagen so angeordnet, errichtet, geändert und instand gehalten werden, dass die öffentliche Sicherheit und Ordnung, insbesondere Leben und Gesundheit und die natürlichen Lebensgrundlagen, nicht gefährdet werden. Übertragen auf den Brandschutz konkretisiert § 14 MBO: „Bauliche Anlagen sind so anzuordnen, zu errichten, zu ändern und instand zu halten, dass der Entstehung eines Brandes und der Ausbreitung von Feuer und Rauch (Brandausbreitung) vorgebeugt wird und bei einem Brand die Rettung von Menschen und Tieren sowie wirksame Löscharbeiten möglich sind“. Welche Regelungen zur Erreichung dieser allgemeinen Anforderung beachtet werden müssen, findet sich im dritten Teil des Gesetzes (insbesondere in den §§ 26 bis 47 MBO).
Die Bauordnung regelt nicht die Aufgaben der Feuerwehr: diese ergeben sich aus den Feuerwehrgesetzen der Länder. Erfasst wird nur die bauliche und technische Beschaffenheit eines Gebäudes: es muss die Arbeit der Feuerwehr ermöglichen. Bei Gebäuden, für die als zweiter Rettungsweg eine „anleiterbare Stelle“ genügt (s. Abschn. 6.1), stellt die Feuerwehr diesen zweiten Rettungsweg mit ihrer Leiter her. In den anderen Fällen sind mindestens zwei Rettungswege baulich vorzusehen, die der Personenrettung und auch dem Feuerwehreinsatz dienen. Zugunsten wirksamer Löscharbeiten verlangt die Bauordnung insbesondere, dass die Gebäude von der öffentlichen Verkehrsfläche aus erreichbar sind, sie im Brandfall für eine bestimmte Zeit standsicher bleiben und Brände auf bestimmte Bereiche (z. B. Nutzungseinheiten, Geschosse, Brandabschnitte) beschränkt bleiben.
2.2 Verordnungen, Richtlinien
Brandschutzvorschriften im Rang unterhalb des Gesetzes enthalten die auf der Rechtsgrundlage der Bauordnung (§ 85 MBO) erlassenen Verordnungen. Sie befassen sich mit Anforderungen an Sonderbauten (z. B. Muster-Versammlungsstättenverordnung – MVStättV, Muster-Verkaufsstättenverordnung – MVkV, Muster-Beherbergungsstättenverordnung – MBeVO) oder an Garagen und Feuerungsanlagen (Muster-Garagenverordnung – MGarVO, Muster-Feuerungsverordnung – MFeuV). Als Rechtsnorm entfalten diese Verordnungen Außenwirkung.
Brandschutzanforderungen an Sonderbauten werden auch in der Form von bauaufsichtlichen Richtlinien gestellt (z.B. Muster-Hochhaus-Richtlinie – MHHR und Muster-Schulbau-Richtlinie – MSchulbauR). Diese Richtlinien sind Verwaltungsvorschriften und binden die Verwaltung. Sie sind von den Bauaufsichtsbehörden im bauaufsichtlichen Verfahren zur Beurteilung heranzuziehen (s. Abschn. 3.2, 4.1). Die Muster-Industriebau-Richtlinie – MIndbauRL und die Muster-Kunststofflager-Richtlinie – MKLR sind dagegen (im Grunde systemwidrig) in der Liste der eingeführten Technischen Baubestimmungen enthalten mit der Folge, dass sie von allen am Bau Beteiligten zu beachten sind (s. Abschn. 2.3.1).
2.3 Technische Regeln
2.3.1 Eingeführte Technische Baubestimmungen
Mit § 3 Abs. 3 Satz 1 MBO verknüpft die Bauordnung bestimmte technische Regeln mit dem Gesetz: „Die von der obersten Bauaufsichtsbehörde durch öffentliche Bekanntmachung als Technische Baubestimmungen eingeführten technischen Regeln sind zu beachten.“ Durch die Forderung „sind zu beachten“ erübrigt sich die für den Anwender oft schwierige Beurteilung der rechtlichen Verbindlichkeit von technischen Regeln. Auf der Basis der Muster-TB-Liste, die von der Fachkommission Bautechnik der ARGEBAU erarbeitet und jährlich aktualisiert wird, veröffentlicht die jeweilige oberste Bauaufsichtsbehörde eines Landes in ihrem Amtsblatt die „Liste der als Technische Baubestimmungen eingeführten technischen Regeln“ (TB-Liste). Die technischen Regeln in der TB-Liste enthalten insbesondere Planungs-, Bemessungs- und Konstruktionsregeln und in den Teilen II und III auch Anwendungsregeln für bestimmte europäisch geregelte Bauprodukte und Bausätze.
Für den Brandschutz relevant sind insbesondere die Regeln in Teil I Abschnitt 3 der TB-Liste. Neben den Eurocodes 2 bis 5 für die Tragwerksbemessung im Brandfall und die nationalen Anwendungsdokumente dazu, sind hier z. B. die Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie – MLAR, Muster-Lüftungsanlagen-Richtlinie – MLüAR, Muster-Systemböden-Richtlinie – MSysBöR, und die Muster-HFH-Holzbauweise-Richtlinie enthalten. Als Planungsgrundlage bedeutsam sind die DIN 18065 und die Muster-Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr (Teil I Abschnitt 7 TB-Liste).
Unbedingt zu beachten ist, dass auch die Anlagen zu der jeweiligen technischen Regel rechtsverbindlich sind und dass diese länderspezifische Regelungen beinhalten können!
Für Bauprodukte und Bauarten ist die Bauregelliste zu beachten, die nach § 17 Abs. 2 MBO vom Deutschen Institut für Bautechnik im Einvernehmen mit den obersten Bauaufsichtsbehörden der Länder bekannt gemacht wird. Die Bauregelliste A enthält technische Regeln für Bauprodukte, die zur Erfüllung der in der MBO und in Vorschriften aufgrund der MBO an bauliche Anlagen gestellten Anforderungen erforderlich sind. Diese technischen Regeln gelten als Technische Baubestimmungen im Sinne des § 3 Abs. 3 Satz 1 MBO (s. o.).
Von erheblicher Bedeutung für die bautechnische Umsetzung der bauaufsichtlichen Brandschutzvorschriften ist die in der Bauregelliste A Teil 1 Anlagen 0.1 ff. und 0.2 ff. vorgenommene amtliche Zuordnung der bauaufsichtlichen Anforderungen zu den Klassen für Bauteile und Baustoffe, die sich aus den Prüfungen nach deutschen und europäisch harmonisierten Prüfnormen ergeben (s. Abschn. 5.1, 5.2).
2.3.2 Allgemein anerkannte Regeln der Technik
Soweit es keine konkreten bauordnungsrechtliche Regelungen und keine eingeführten Technischen Baubestimmungen für eine allgemein formulierte Brandschutzanforderung des Gesetzes gibt, müssen zur technischen Umsetzung andere technische Regeln benutzt oder Einzelnachweise geführt werden. Die Bayerische Bauordnung stellt hierzu klar, dass die bauaufsichtlichen Anforderungen der BayBO und der aufgrund der BayBO erlassenen Vorschriften als eingehalten gelten, wenn die allgemein anerkannten Regeln der Technik und Baukunst beachtet werden (Art. 3 Abs. 3 Satz 4 BayBO); einige Landesbauordnungen binden die allgemein anerkannten Regeln der Technik auf ähnliche oder andere Weise ein. Die MBO enthält keine vergleichbare Regelung. Im Ergebnis kann aber wohl davon ausgegangen werden, dass die bauordnungsrechtliche Anforderung als erfüllt angenommen werden darf, wenn die relevante allgemein anerkannte Regel der Technik eingehalten wird. Für technische Regeln unterhalb dieser Bekanntheits- und Akzeptanzschwelle ist das offen. Der Bauherr ist verpflichtet, die Einhaltung nachzuweisen.
2.4 Brandschutz außerhalb des Bauordnungsrechts
Neben den bauordnungsrechtlichen Brandschutzvorschriften sind insbesondere aus dem Betriebssicherheitsrecht Brandschutzregeln zu beachten, die arbeitsund produktionsprozessbezogen sind. Sie können zusätzliche Maßnahmen zum Schutz der Arbeitnehmer verlangen, die sich auf betriebliche aber auch auf bauliche Vorkehrungen beziehen (vgl. Arbeitsstättenverordnung des Bundes, Technische Regeln für Arbeitsstätten – ASR dazu). Gegebenenfalls kann weitergehender Brandschutz privatrechtlich vertraglich vereinbart oder aus anderen Gründen erforderlich sein (z. B. Sachschutz, Denkmalschutz).
3 Brandschutzkonzepte der MBO
3.1 Brandschutzkonzepte für fünf Gebäudeklassen
Die in der MBO 2002 enthaltenen quantifizierten Brandschutzanforderungen sind nach fünf Gebäudeklassen (s. Tabelle 1) differenziert, ohne Rücksicht auf die Nutzungsart (abgesehen von einzelnen Ausnahmen). Die sich so ergebenden fünf Standard-Brandschutzkonzepte beschränken sich auf bauliche Anforderungen, wie z. B. Regeln für Gebäudeabstände, Brandabschnitte, Rettungswege, Bauteile und Baustoffe. Die Bauordnung selbst verlangt keine Maßnahmen des anlagentechnischen Brandschutzes (Sprinkleranlagen, Rauchmelder, Brandmeldeanlagen, Rauchabzugsanlagen usw.) oder betriebliche Vorkehrungen (wie Rauchverbot, Anwesenheitspflicht für bestimmte Personen). Solche Maßnahmen sind der Kompensation spezifischer Risiken von Sonderbauten Vorbehalten oder rechtfertigen ggf. eine Abweichung von einem an sich verlangten baulichen Brandschutz (Beispiel: Vergrößerung eines Brandabschnitts, weil eine automatische Löschanlage eingebaut wird).
Anknüpfungspunkt für die gestaffelten Brandschutzanforderungen sind fünf Gebäudeklassen, die in § 2 Abs. 3 MBO definiert sind. Für deren Differenzierung wird neben der Höhenentwicklung der Gebäude auch die Zahl und Größe von Nutzungseinheiten betrachtet. Nutzungseinheiten sind selbstständig nutzbare räumliche Einheiten wie z. B. Wohnungen, Praxen, selbstständige Betriebsstätten. Sie haben jeweils ein eigenes Rettungswegsystem und sind gegen andere Nutzungseinheiten oder fremde Räume brandschutztechnisch qualifiziert (Trennwände nach § 29 MBO) abgetrennt. Gebäude mit bis zu zwei Nutzungseinheiten und insgesamt nicht mehr als 400 m2 Fläche sowie Gebäude mit sogenannter Zellenbauweise, auch Kompartment-Bauweise genannt (keine Nutzungseinheit größer als 400 m2 Fläche), stellen für die Brandausbreitung und die Brandbekämpfung durch die Feuerwehr ein geringeres Risiko dar, als Gebäude mit vergleichbarer Höhe mit größeren Nutzungseinheiten, sodass bis zu einer bestimmten Höhe geringere Brandschutzanforderungen für vertretbar gehalten werden. Die Differenzierung in Gebäudeklassen ist nutzungsneutral (Ausnahme Zuordnung landwirtschaftlicher Betriebsgebäude zu Gebäudeklasse 1).
Da (nur) für Sonderbauten (s. Abschn. 3.2) weitergehende Anforderungen in Betracht kommen, ergibt sich im Gegenschluss, dass die im Gesetz enthaltenen Brandschutzanforderungen zunächst auf Bauaufgaben abstellen, die keine Sonderbauten sind, also Wohngebäude, Verwaltungs- und Bürogebäude, kleine Betriebsstätten, Lokale, Läden usw. unterhalb der Sonder-bauten-Schwelle.
Tabelle 1. Übersicht Gebäudeklassen
3.2 Besondere Anforderungen an Sonderbauten
Als Sonderbauten bezeichnet § 2 Abs. 4 MBO bauliche Anlagen und Räume besonderer Art (z. B. sehr hoch, sehr groß, zerlegbar) oder besonderer Nutzung (z.B. viele Nutzer, hilfsbedürftige Personen, Umgang mit brandgefährlichen Stoffen), die dort zum Teil mit konkreten Einstiegsschwellen (z. B. Höhe von mehr als 22 m, Nutzung durch mehr als 100 Personen) in einer Liste aufgezählt sind. Für sie ist im Einzelfall zu prüfen, ob das gebäudeklassenabhängige Brandschutzkonzept einer ggf. zu erwartenden spezifischen Risikolage gerecht wird. § 51 Abs. 1 MBO ermächtigt die Bauaufsichtsbehörde, im Einzelfall über die Brandschutzvorschriften der MBO hinaus weitergehende oder andere Anforderungen zu stellen, um das gesetzlich verankerte Schutzziel und Sicherheitsniveau zu verwirklichen. Auch Erleichterungen sind nach § 51 Abs. 1 MBO möglich, wenn es wegen der Eigenart des Bauvorhabens oder der o. g. weitergehenden oder anderen Anforderungen der Einhaltung einer Vorschrift nicht bedarf. Für typisierbare Sonderbauten ist diese bauaufsichtliche Betrachtung in Sonderbaurichtlinien oder in Sonderbauverordnungen bereits geleistet (s. Abschn. 2.2).
4 Bauaufsichtliche Verfahren, Abweichungen
4.1 Bauaufsichtliche Mitwirkung
Die Ausgestaltung der materiell-rechtlichen Brandschutzanforderungen im Gesetzestext der MBO trägt der Tatsache Rechnung, dass in allen Ländern bauaufsichtliche Genehmigungsverfahren abgebaut und die Prüfprogramme der noch verbleibenden Genehmigungsverfahren auch hinsichtlich des Brandschutzes mehr oder weniger eingeschränkt werden. Die Brandschutzvorschriften sind daher, unter Berücksichtigung der ggf. zu beachtenden Verordnungen (z. B. Garagenverordnung, Feuerungsverordnung) und Technischen Baubestimmungen (z.B. Leitungsanlagen-Richtlinie, Lüftungsanlagen-Richtlinie) vollständig und abschließend, sodass eine Mitwirkung der Bauaufsichtsbehörde (sieht man von reinen Kontrollaufgaben ab) nicht erforderlich ist. Für Sonderbauten ist dagegen eine Mitwirkung erforderlich, wenn nach § 51 MBO über weitergehende oder geringere Anforderungen im Einzelfall bauaufsichtlich zu entscheiden ist. Ebenso bedürfen Abweichungen (s. Abschn. 4.3) von bauaufsichtlichen Vorschriften einer behördlichen Gestattung.
4.2 Brandschutznachweis und Prüfung
§ 66 MBO stellt heraus, dass die Einhaltung der Anforderungen an den Brandschutz nachzuweisen ist (Brandschutznachweis) und regelt die Anforderungen an die Qualifikation des Nachweiserstellers. Für Brandschutznachweise von Sonderbauten, Mittel-und Großgaragen und Gebäuden der Gebäudeklasse 5 verlangt § 66 Abs. 3 MBO eine bauaufsichtliche Prüfung; alternativ kann der Brandschutznachweis von einem Prüfsachverständigen bzw. Prüfingenieur für Brandschutz bescheinigt werden. Hier eröffnete die MBO 2002 erstmals die Übertragung der Prüftätigkeit im Brandschutz auf Personen außerhalb der Behörde nach der Maßgabe der Muster-Prüfingenieur- und Prüfsachverständigen-Verordnung – MPPVO. Die Länder greifen diese Möglichkeit zunehmend auf; es gibt aber noch deutliche Unterschiede in der Ausgestaltung des Aufgabenbereichs der Prüfsachverständigen bzw. Prüfingenieure für Brandschutz und ihrer Einbindung in das bauaufsichtliche Verfahren.
4.3 Abweichungen
Will ein Bauherr von Brandschutzvorschriften der MBO oder der zugehörigen Verordnungen abweichen, muss er diese Abweichung bauaufsichtlich gestatten lassen. Nach § 67 MBO kann die Bauaufsichtsbehörde Abweichungen von den Anforderungen des Gesetzes und der zugehörigen Vorschriften gestatten, wenn sie unter Berücksichtigung des Zwecks der jeweiligen Anforderung und unter Würdigung der öffentlich-rechtlich geschützten nachbarlichen Belange mit den öffentlichen Belangen, insbesondere den Anforderungen des § 3 Abs. 1 MBO vereinbar sind. Über dieses Instrument sind einzelne Abweichungen, aber auch die Realisierung eines ganz anderen Brandschutzkonzeptes möglich – Maßstab ist, ob der Zweck der einzelnen Vorschrift oder insgesamt das Schutzniveau des vorgegebenen Brandschutzkonzepts erreicht wird, was darzulegen ist, ggf. auch mithilfe von Nachweisen des Brandschutzingenieurwesens.
5 Struktur der Anforderungen an Baustoffe und Bauteile
5.1 Brandverhalten von Baustoffen
Das Gesetz stellt Anforderungen an das Brandverhalten von Baustoffen, um deren Beitrag zur Brandentstehung, zur Brandfortleitung oder zur Erhöhung der Brandlast auszuschließen bzw. einzuschränken. Es unterscheidet die Baustoffe in „nichtbrennbar“, „schwerentflammbar“ und „normalentflammbar“ (§ 26 Abs. 1 MBO). Die amtliche Zuordnung dieser bauaufsichtlichen Anforderungen zu den Baustoffklassen auf der Grundlage von Normprüfungen nach DIN 4102-1 oder DIN EN 13501-1 ergibt sich aus den Anlagen 0.2ff. der Bauregelliste A Teil 1 (s. Abschn. 2.3.1). Baustoffe, die die Normprüfungen nicht bestehen, gelten als leichtentflammbar; ihre Verwendung ist grundsätzlich verboten. Baustoffanforderungen finden sich – neben der unten näher beschriebenen allgemeinen Verknüpfung mit den Bauteilanforderungen – z. B. in den Einzelvorschriften für Außenwände (§ 28 MBO) und für Rettungswege (§§ 35, 36 MBO) sowie in den Sonderbauvorschriften und in den Richtlinien.
5.2 Feuerwiderstandsfähigkeit von Bauteilen
Das Gesetz unterscheidet tragende und raumabschließende Bauteile; es verlangt, dass sie im Brandfall die jeweilige Funktion für eine bestimmte Zeit aufrechterhalten. Diese Feuerwiderstandsfähigkeit bezieht sich bei tragenden und aussteifenden Teilen auf deren Standsicherheit, bei raumabschließenden Bauteilen auf deren Widerstand gegen die Brandausbreitung (§ 26 Abs. 2 Satz 1 MBO). Zwischen den Anforderungen „feuerhemmend“ (F 30 nach DIN 4102-2) und „feuerbeständig“ (F 90 nach DIN 4102-2) hat die MBO 2002 eine Zwischenstufe eingefügt mit der Bezeichnung „hochfeuerhemmend“, die einer Feuerwiderstandsfähigkeit für die Dauer von 60 Prüfminuten entspricht. Die amtliche Zuordnung der Anforderungen zu den Feuerwiderstandsklassen auf der Grundlage von Normprüfungen nach DIN 4102-2 oder DIN EN 13501-2 enthalten die Anlagen 0.1 ff der Bauregelliste A Teil 1.
5.3 Verknüpfung von Baustoff- und Bauteilanforderung
Die zunehmende Verwendung von Systembauweisen mit einer Trennung in tragende, aussteifende, raumabschließende, bekleidende (usw.) Bestandteile hat dazu geführt, dass die Baustoffe der Bauteile, die hochfeuerhemmend oder feuerbeständig sein müssen, differenzierter betrachtet wurden. Gleichzeitig hat die MBO 2002 die Rahmenbedingungen für die konstruktive Holzverwendung erweitert. Unterschieden werden seitdem vier Typen der Baustoffkombinationen (§ 26 Absatz 2 Satz 2 MBO). Neben den Bauteilen, die ganz aus nichtbrennbaren Baustoffen oder in beliebiger Weise aus brennbaren Baustoffen bestehen, sind zwei Bauteilarten beschrieben, die sich in bestimmter Weise aus brennbaren und nichtbrennbaren Komponenten zusammensetzen. Das Gesetz nimmt eine Standardverknüpfung der Baustoffverwendung mit den Anforderungen „feuerbeständig „ und „hochfeuerhemmend“ vor (s. Tabelle 2), die für alle bauordnungsrechtlichen Vorschriften gilt, soweit nicht etwas anderes geregelt ist.
Für feuerbeständige Bauteile ist die auch früher schon zulässige Kombination aufgegriffen worden: „Bauteile, deren tragende und aussteifende Teile aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen und die bei raumabschließenden Bauteilen zusätzlich eine in Bauteilebene durchgehende Schicht aus nichtbrennbaren Baustoffen haben“ (Kurzbezeichnung AB nach DIN 4102 Teil 2). Für hochfeuerhemmende Bauteile ist eine weitere zulässige Kombination beschrieben, die die konstruktive Verwendung von Holz ermöglicht. „Bauteile, deren tragende und aussteifende Teile aus brennbaren Baustoffen bestehen und die allseitig eine brandschutztechnisch wirksame Bekleidung (Brandschutzbekleidung) aus nichtbrennbaren Baustoffen und Dämmstoffe aus nichtbrennbaren Baustoffen haben“. Diese Bauteile dürfen tragende und aussteifende Teile aus brennbaren Baustoffen haben (z.B. Holzstützen, Holzrahmen o. Ä.), wenn sie allseitig mit einer brandschutztechnisch wirksamen Bekleidung aus nichtbrennbaren Baustoffen umgeben sind. Die Brandschutzbekleidung muss die brennbare Tragstruktur so schützen (brandschutztechnisch wirksam), dass sie im Brandfall während der geforderten Feuerwiderstandsfähigkeit des Bauteils nicht entzündet werden kann. Für raumabschließende Bauteile stellt die Brandschutzbekleidung zudem den Raumabschluss sicher. Um auch das Hohlraumrisiko (Brandausbreitung innerhalb des Bauteils) auszuschließen, werden außerdem Dämmstoffe aus nichtbrennbaren Baustoffen gefordert. Für die technische Konkretisierung ist die Muster-Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an hochfeuerhemmende Bauteile in Holzbauweise zu beachten (Nr. 3.9 der Muster-TB-Liste).
Tabelle 2. Übersicht über die zulässigen Baustoffe für feuerwiderstandsfähige Bauteile
Für feuerhemmende Bauteile ist die Verwendung brennbarer Baustoffe uneingeschränkt zulässig (mit Ausnahme der generell verbotenen leichtentflammbaren Baustoffe), soweit nicht in einer Einzelvorschrift eine Einschränkung erfolgt.
Tabelle 2 zeigt die Zulässigkeit der Verwendung brennbarer Baustoffe für Bauteile mit erforderlicher Feuerwiderstandsfähigkeit, wie sie sich aus der gesetzlichen Verknüpfung in § 26 Abs. 2 Satz 3 MBO ergibt.
5.4 Schutzziel und Konkretisierung, Beispiel tragende Wände und Decken
Den Einzelvorschriften in den §§ 27 bis 42 MBO ist in der Regel eine allgemein formulierte Schutzzielbeschreibung vorangestellt. Sie lautet z. B.: „Tragende und aussteifende Wände müssen im Brandfall ausreichend lang standsicher sein“ (§ 27). „Decken müssen als tragende und raumabschließende Bauteile zwischen Geschossen im Brandfall ausreichend lang standsicher und widerstandsfähig gegen die Brandausbreitung sein“ (§ 31). Diese Beschreibung der im Brandfall verlangten Funktion erleichtert die Zuordnung zu den europäischen Feuerwiderstands-Klassen, die entsprechend differenziert sind. Sie gibt auch das zu erreichende Ziel im Fall einer Abweichung oder eines Sonderbaus vor, der im Einzelfall zu beurteilen ist. Dem Schutzziel folgt die Konkretisierung: gestaffelt nach den fünf Gebäudeklassen werden quantifizierte Anforderungen (s. Abschn. 5.2) genannt, mit denen das genannte Schutzziel im Standardfall erreicht wird. Beispiel: „Sie müssen in Gebäuden der Gebäudeklasse 5 feuerbeständig, in Gebäuden der Gebäudeklasse 4 hochfeuerhemmend, in Gebäuden der Gebäudeklassen 2 und 3 feuerhemmend sein.“ Die fehlende Aufzählung der Gebäudeklasse 1 bedeutet hier, dass keine Anforderung gestellt wird. Einige Landesbauordnungen enthalten im Gesetzestext nur die Schutzziele und die jeweilige Konkretisierung in einer Durchführungsverordnung.
6 Struktur der Anforderungen an Rettungswege
6.1 Zwei Rettungswege, Rettungswegführung
Das bauordnungsrechtliche System der Rettungswege (§ 33 MBO) verlangt für jede Nutzungseinheit aus jedem Geschoss mit Aufenthaltsräumen grundsätzlich zwei Rettungswege (erster und zweiter Rettungsweg). Diese Rettungswege müssen ins Freie führen und voneinander so unabhängig sein, dass eine alternative Rettungsmöglichkeit besteht, wenn im Brandfall einer der Wege unbenutzbar wird. Hingenommen wird ein Risiko in der Geschossebene, dort dürfen beide Wege über denselben Flur führen.
Das duale Rettungswegsystem knüpft an das Vorhandensein von Aufenthaltsräumen (Legaldefinition für Aufenthaltsräume in § 47 MBO) an. Für Geschosse ohne Aufenthaltsräume ist kein zweiter Rettungswege verlangt; sie müssen, jedoch – soweit sie nicht zu ebener Erde liegen – über die „notwendige Treppe“ erreichbar sein, die grundsätzlich in einem Zug zu allen angeschlossenen Geschossen eines Gebäudes führen muss (§ 34 MBO). Aus Geschossen mit Aufenthaltsräumen, die nicht zu ebener Erde liegen, ist der erste Rettungsweg diese notwendige Treppe. Der zweite Rettungsweg ist eine weitere Treppe, die auch wie eine notwendige Treppe zu behandeln ist. Liegt die notwendige Treppe in einem Sicherheitstreppenraum, in den „Feuer und Rauch nicht eindringen können“, erübrigt sich der zweite Rettungsweg.
Das Standard-Brandschutzkonzept der MBO lässt alternativ zur zweiten notwendigen Treppe auch eine mit Rettungsgeräten der Feuerwehr erreichbare Stelle der Nutzungseinheit zu. In diesem Fall ist gesetzlich akzeptiert, dass – sollte die notwendige Treppe als erster Rettungsweg nicht mehr benutzbar sein – eine Rettung der Personen erst nach Eintreffen der Feuerwehr mit deren Hilfe über die Feuerwehrleiter möglich ist. Dabei geht die MBO davon aus, dass jede öffentliche Feuerwehr über Rettungsgeräte verfügt, mit denen Brüstungsoberkanten in einer Höhe von bis zu 8 m über der Geländeoberfläche erreicht werden können. Liegt die Oberkante der Brüstung einer zum Anleitern bestimmten Stelle eines Gebäudes mehr als 8 m über der Geländeoberfläche, darf das Gebäude nur errichtet werden, wenn die örtliche Feuerwehr über die hierfür erforderlichen Rettungsgeräte (wie Hubrettungsfahrzeuge) verfügt.
Für Sonderbauten (s. Abschn. 3.2) ist die anleiterbare Stelle als Nachweis des zweiten Rettungswegs nur zulässig, wenn keine Bedenken wegen der Personenrettung bestehen. Bedenken bestehen regelmäßig bei einer zu großen Zahl von Personen in einer Nutzungseinheit oder bei einer erhöhten Hilfsbedürftigkeit der zu rettenden Personen.
6.2 Bemessung der Rettungswege
Für die Breite der Rettungswege (Breite der notwendigen Flure, Breite der Treppenläufe notwendiger Treppen) enthält das Gesetz nur die allgemein formulierte Forderung „ausreichend breit“, die für Treppen in Standardbauten z. B. durch die als Technische Baubestimmung eingeführte DIN 18065 – Gebäudetreppen – ausreichend konkretisiert wird. Für die Länge des ersten Rettungswegs innerhalb der Geschossebene gibt § 35 MBO maximal 35 m von jeder Stelle eines Aufenthaltsraums bis zu dem Ausgang in einen notwendigen Treppenraum oder ins Freie vor.
Für Verkaufsstätten und Versammlungsstätten als Sonderbauten mit großen Personenzahlen, die gleichzeitig auf die Benutzung der Rettungswege angewiesen sind, ist die Bemessung der Rettungswege in den jeweiligen Sonderbauverordnungen spezifisch geregelt. Für Fluchtwege (Selbstrettung) aus Arbeitsstätten enthält das Arbeitsstättenrecht spezifische Regeln (ASR A 2.3 – 2007).
In Sonderbauten mit großen Nutzerzahlen, für die es keine Verordnung gibt, können im Einzelfall die Rettungswege in Anlehnung an die o. g. Sonderbauverordnungen bemessen werden, soweit vergleichbare Nutzungsstrukturen vorliegen. In baulichen Anlagen für sehr hohe Personenzahlen sind ggf. Evakuierungsberechnungen sinnvoll. Zu bedenken ist immer, dass das bauordnungsrechtliche Rettungswegsystem sowohl der Eigenrettung (Flucht, Evakuierung) als auch dem Feuerwehreinsatz dient. Auch müssen die Rettungswege für die Gebäudeevakuierung aus anderen Gründen als dem Brandfall uneingeschränkt zur Verfügung stehen, was der Berücksichtigung brandschutztechnischer Anlagen bei ihrer Bemessung Grenzen setzt.
6.3 Schutz der Rettungswege
Notwendige Treppen, werden durch die Lage in einem eigenen Treppenraum (notwendiger Treppenraum) besonders geschützt. Durch Anforderungen u. a. an die Position des notwendigen Treppenraums im Gebäude und an seine raumabschließenden Bauteile einschließlich der Abschlüsse von Öffnungen soll der Eintritt von Feuer und Rauch behindert werden und eine Nutzbarkeit der notwendigen Treppe auch im Brandfall möglichst lang erhalten bleiben. Das gilt – der Rolle im Rettungswegsystem entsprechend abgemindert – auch für die notwendigen Flure, über die der Weg vom Aufenthaltsraum bis zum Ausgang in einen notwendigen Treppenraum oder ins Freie führt. Die Anforderungen an die Bauteile der notwendigen Treppenräume sind nach Gebäudeklassen differenziert. Soweit in Treppenräumen Entrauchungsöffnungen verlangt werden, dienen sie der möglichen Rauchableitung, die in der Regel durch die Feuerwehr durchgeführt wird. Für den Sicherheitstreppenraum (s. Abschn. 6.1) ist dagegen eine Rauchfreihaltung erforderlich, die entweder durch eine spezifische Grundrisslage oder anlagentechnisch mithilfe von Überdruck hergestellt werden kann (vgl. Muster-Hochhaus-Richtlinie).
(Die Texte der Musterbauordnung, der Musterverordnungen und der Muster-Richtlinien der ARGEBAU sind im Informationssystem der ARGEBAU erhältlich: www.is-argebau.de)
A 2
Europäische Harmonisierung im Brandschutz
Irene Herzog, Peter Proschek
Inhaltsverzeichnis
1 Allgemeines
2 Bauproduktenrichtlinie und Grundlagendokument 2
2.1 Bauproduktenrichtlinie
2.2 Grundlagendokument – Wesentliche Anforderung Nr. 2 „Brandschutz“
3 Prüfung und Klassifizierung im Brandschutz
3.1 Brandverhalten
3.1.1 Europäische Normen für das Brandverhalten
3.1.2 Unterschiede zur bisherigen Klassifizierung
3.1.3 Zurzeit in Diskussion
3.2 Feuerwiderstand
3.2.1 Unterschiede zur bisherigen Klassifizierung
3.2.2 Zurzeit noch in Diskussion
3.2.3 Europäische Normen für den Feuerwiderstand
3.3 Verhalten von Bedachungen bei einem Brand von außen
3.3.1 Klassifizierung und Prüfverfahren
3.3.2 Europäische Normen für Bedachungen
4 Klassifizierung ohne Prüfung
5 Ingenieurmethoden des Brandschutzes
6 Brandschutzbemessung nach den Eurocodes
7 Europäische Klassifizierung im bauaufsichtlichen Verfahren
7.1 Brandverhalten
7.2 Feuerwiderstand
7.3 Bedachungen
7.4 Anwendung der Brandschutzteile nach den Eurocodes
8 Europäische Klassifizierung in der Praxis
9 Zusammenfassung
10 Literatur
1 Allgemeines
Anforderungen hinsichtlich des Brandschutzes werden in den bauaufsichtlichen Vorschriften an Gebäude gestellt in Abhängigkeit von ihrer Nutzung, der Ausbildung der Grundrisse und der Höhe von Gebäuden sowie ihrer Lage und Stellung auf den Grundstücken. Entsprechend dem jeweils erforderlichen Sicherheitsniveau sind die Anforderungen an die Feuerwiderstandsfähigkeit der Bauteile an zusätzliche Anforderungen an Baustoffe geknüpft.
Die in den Bauordnungen verwendeten Brandschutzbegriffe werden entweder durch Prüfungen und Klassifizierungen nach der DIN 4102 – Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen – oder nach dem neuen europäischen Klassifizierungskonzept für den Brandschutz auf der Grundlage der DIN EN 13501 konkretisiert.
Im Folgenden werden die Grundlagen des europäischen Klassifizierungssystems und die Einführung der europäischen Klassen in das deutsche Baurecht erläutert und über den aktuellen Stand der europäischen Harmonisierung im Brandschutz informiert.
2 Bauproduktenrichtlinie und Grundlagendokument
2.1 Bauproduktenrichtlinie
Seit vielen Jahren wird im Rahmen der europäischen Harmonisierung an einem europäischen Klassifizierungssystem für den Brandschutz gearbeitet. Bereits am 21. Dezember 1988 hat der Rat der Europäischen Gemeinschaften die Bauproduktenrichtlinie [1] zur Harmonisierung technischer Regeln und zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Bauprodukte erlassen. Mit der Bauproduktenrichtlinie sollen technische Hemmnisse beim Warenverkehr mit Bauprodukten innerhalb der EU abgebaut werden. Sie regelt sowohl das Inverkehrbringen und den freien Warenverkehr als auch die Verwendung der Bauprodukte. Die Brauchbarkeit der Bauprodukte wird in Abhängigkeit von ihrer Verwendung in dem Bauwerk definiert. In der Bauproduktenrichtlinie sind die wesentlichen Anforderungen (Essential Requirements – ER 1-6) an das Bauwerk festgelegt:
In ihrem Anhang E definiert die Bauproduktenrichtlinie die wesentliche Anforderung „Brandschutz“, die auf Bauwerke anwendbar ist, wenn und wo sie Regelungen mit einer solchen Anforderung unterliegen, wie folgt:
„Das Bauwerk muss derart entworfen und ausgeführt sein, dass bei einem Brand
Die nähere Konkretisierung der technischen Anforderungen für die einzelnen Bauprodukte erfolgt mithilfe von europäischen Produktspezifikationen, den sogenannten harmonisierten Normen, die im Auftrag der EU erstellt wurden, und europäischen technischen Zulassungen sowie den unterstützenden Prüf- und Klassifizierungsnormen. Bei der Erarbeitung harmonisierter Produktnormen müssen die wesentlichen Anforderungen der Bauproduktenrichtlinie beachtet werden, wobei das in den einzelnen Mitgliedstaaten bereits bestehende und begründete Schutzniveau nicht verringert werden darf.
Durch eine entsprechende Anpassung der Landesbauordnungen und durch den Erlass des Bauproduktengesetzes [2] wurde die Bauproduktenrichtlinie in Deutschland umgesetzt.
2.2 Grundlagendokument – Wesentliche Anforderung Nr. 2 „Brandschutz“
Das Grundlagendokument 2 (GD 2) wurde auf der Grundlage der Bauproduktenrichtlinie erarbeitet und stellt im Prinzip die Harmonisierung des grundlegenden technischen Konzeptes und der erforderlichen Terminologie für den europäischen Brandschutz dar. Es wurde 1994 im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften veröffentlicht [3]. Das GD 2 befasst sich mit den Aspekten von Bauwerken, die sich auf den Brandschutz beziehen können, und führt Produkte oder Produktfamilien und Merkmale an, die für eine befriedigende Erfüllung der geforderten Leistungsfähigkeit relevant sind. Die wesentliche Anforderung „Brandschutz“ wird erläutert und die Grundlagen für ihren Nachweis werden festgelegt. Die Strategie im Brandschutz und die Brandschutzziele sind hier definiert. Die Beziehungen zwischen Stufen und Klassen für die verschiedenen Anforderungsniveaus der Mitgliedstaaten und den damit in Bezug stehenden Produktleistungen werden geklärt. Auf die Anwendung von Ingenieurmethoden auf dem Gebiet der Brandsicherheit als Ansatz zur ingenieurmäßigen Bewertung des erforderlichen Brandsicherheitsniveaus und zur Bemessung und Berechnung der notwendigen Schutzmaßnahmen wird besonders eingegangen. In den einzelnen Abschnitten werden die Bauwerke oder Bauwerksteile im Hinblick auf die Beurteilungsmethoden, auf die zu bewertenden Funktionen der betroffenen Bauwerksteile sowie die Bestimmungen für die Produkte und Produktmerkmale, die für die wesentliche Anforderung „Brandschutz“ bedeutsam sein können, behandelt.
Das GD 2 ist damit Grundlage für die Erstellung der Mandate für Normen und für Leitlinien für europäische technische Zulassungen und enthält wichtige Vorgaben. Es ist aber auch ein wichtiges Dokument für das grundsätzliche Verständnis des europäischen Sicherheitskonzeptes, das hinter den europäischen Klassen und Leistungsstufen steht.
3 Prüfung und Klassifizierung im Brandschutz
Die Brandprüfverfahren, die in den europäischen Mitgliedstaaten in der Vergangenheit angewendet wurden, führten, da nicht miteinander vergleichbar, zu nicht kompatiblen Brandschutzklassen und stellten ein großes Handelshemmnis im grenzüberschreitenden Warenverkehr mit Bauprodukten dar. In den vergangenen Jahren wurde deshalb ein einheitliches europäisches Konzept für den Brandschutz erarbeitet, das inzwischen weitgehend fertiggestellt ist. Hierzu hat die Europäische Kommission eine Reihe von Entscheidungen über die Klassifizierung im Hinblick auf den Brandschutz getroffen, die künftig eine einheitliche Bewertung und Beurteilung des Verhaltens von Bauprodukten im Falle eines Brandes erlauben.
3.1 Brandverhalten
Die Europäische Kommission hat mit der Entscheidung 2000/147/EC vom 8. Februar 2000 über die Klassifizierung des Brandverhaltens von Bauprodukten entschieden [4] und die Klasseneinteilung, die Kriterien und Grenzwerte sowie die Prüfverfahren als eine wesentliche Voraussetzung für die Harmonisierung des Brandschutzes festgelegt. Auf der Grundlage der Entscheidung sind die Prüf- und Klassifizierungsnormen bearbeitet worden, die im Wesentlichen vorliegen und angewendet werden können.
Neben den Hauptklassifizierungskriterien der Entzündbarkeit, der Flammenausbreitung und der frei werdenden Wärme werden nach dem europäischen Konzept zusätzlich die Brandparallelerscheinungen der Rauchentwicklung und des brennenden Abfallens/Abtropfens von Baustoffen festgestellt und in mehreren Stufen klassifiziert. Dies ermöglicht den Mitgliedstaaten, die als notwendig erachteten Klassen und Stufen zur Sicherstellung ihres jeweiligen Schutzniveaus fordern. Die in der Entscheidung 2000/147/EC vorgesehenen Klassen sind in Tabelle 1 zusammengestellt (auf Grenzwerte wird hier nicht näher eingegangen).
Für Bodenbeläge, lineare Rohrdämmstoffe und Kabel sind Sonderregelungen erfolgt. Das Brandverhalten dieser Produktgruppen kann durch die festgelegten Prüfverfahren nicht angemessen beurteilt werden, da sie die Beanspruchung nicht risikogerecht darstellen oder weil das Referenzszenarium, das Grundlage für die Entwicklung des Laborprüfverfahrens war, nicht geeignet ist. So hat die Europäische Kommission mit den Entscheidungen 2003/632/EG [5] und 2006/751/EG [6] ihre Entscheidung aus dem Jahre 2000 ergänzt und für lineare Wärmedämmstoffe für Rohre und Kabel weitere eigenständige Tabellen für die Klassifizierung beschlossen.
Tabelle 1. Europäische Klassifizierung des Brandverhaltens (ohne Bodenbeläge)
Tabelle 2. Europäische Prüf- und Klassifizierungsnormen für das Brandverhalten
Norm
Titel
Ausgabe/Bearbeitungsstand
DIN EN ISO 1182
Nichtbrennbarkeitsprüfung
2010–10
DIN EN ISO 1716
Bestimmung der Verbrennungswärme
2010–11
DIN EN 13823
Thermische Beanspruchung durch einen einzelnen brennenden Gegenstand für Bauprodukte mit Ausnahme von Bodenbelägen (SBI-Test)
2010–01
DIN EN ISO 11925–2
Entzündbarkeit bei direkter Flammeneinwirkung
2002–07
DIN EN ISO 9239–1
Bodenbeläge: Bestimmung des Brandverhaltens bei Beanspruchung mit einem Wärmestrahler
2010–11
DIN EN 13238
Konditionierungsverfahren und allgemeine Regeln für die Auswahl von Trägerplatten
2010–06
DIN EN 13501–1
Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Prüfungen zum Brandverhalten von Bauprodukten
2010–01
Bodenbeläge werden in einer separaten Tabelle mit eigenen Prüfverfahren klassifiziert, auf die hier nicht besonders eingegangen wird. Die Klassen für das Brandverhalten von Bodenbelägen A1 bis F erhalten den zusätzlichen Index FL (A1FL, A2FL, BFL usw.), um sie von den anderen Brandverhaltensklassen unterscheidbar zu machen.
Für lineare Wärmedämmstoffe für Rohre sind die Prüfverfahren unverändert, für die Klassen sind aber andere Grenzwerte festgelegt. Die Klassen für das Brandverhalten A1 bis F erhalten den zusätzlichen Index L (A1L, A2L, BL usw.)
Für Kabel wurden vollständig neue Prüfverfahren und Klassengrenzen erarbeitet. Die Klassen für das Brandverhalten A1 bis F erhalten den zusätzlichen Index ca (A1ca, A2ca, Bca usw.). Neben den Zusatzklassifizierungen für die Rauchentwicklung (s) und brennendes Abfallen/Abtropfen (d) wird eine weitere für den Säuregehalt (a) hinzugefügt.
3.1.1 Europäische Normen für das Brandverhalten
Die europäischen Prüfverfahren und die Verfahren zur Klassifizierung durch die europäische Normungsorganisation CEN wurden genormt, damit europaweit nach einheitlichen Regeln geprüft und klassifiziert wird. Den europäischen Prüfverfahren, wie im Übrigen auch den bisherigen deutschen Prüfverfahren nach DIN 4102-1, liegen drei Beanspruchungsstufen zugrunde:
Die Prüfung von Bodenbelägen stellt modellhaft die aus einer Türöffnung schlagenden Flammen dar und berücksichtigt die dabei entstehende Strahlungsintensität. Das Normenpaket für die Prüfung und Klassifizierung des Brandverhaltens liegt nun nahezu vollständig vor (Tabelle 2).
3.1.2 Unterschiede zur bisherigen Klassifizierung
Insgesamt kann vermutet werden, dass die bisherigen Schutzniveaus auch mit dem europäischen Klassifizierungssystem ausreichend sichergestellt sind. Das europäische Klassifizierungssystem stellt allerdings gegenüber dem bisherigen Klassensystem nach DIN 4102-1 eine Vielzahl von Klassen zur Verfügung. Die Brandparallelerscheinungen „Rauchentwicklung“ und „brennendes Abfallen/Abtropfen“ werden zusätzlich klassifiziert und als Bestandteil der Klasse immer mit angegeben (außer bei der Klasse E, wenn kein brennendes Abfallen/Abtropfen auftritt). Daraus ergibt sich eine große Variationsbreite in der Klassifizierung.
Bei der Anwendung der Klassifizierung ist deshalb besonders darauf zu achten, dass die Mindestniveaus nach den bauaufsichtlichen Vorgaben eingehalten werden und dass es für bestimmte Produktfamilien (z. B. Bodenbeläge, lineare Rohrdämmstoffe) eigenständige Klassen gibt.
3.1.3 Zurzeit in Diskussion
Die europäischen Prüfverfahren erlauben zurzeit keine Beurteilung, ob Baustoffe zu fortgesetztem Glimmen neigen. In Deutschland wird für nichtbrennbare Baustoffe und für schwerentflammbare Baustoffe im Rahmen der Prüfungen festgestellt, ob der Baustoff zum Glimmen neigt und ob dieses Glimmen innerhalb bestimmter Grenzen zum Stillstand kommt. Im Extremfall kann ein Baustoff weiterglimmen, bis er vollständig zersetzt ist. Ein solches andauerndes Glimmen kann jedoch bei Baustoffen, von denen ein besseres Brand-verhalten erwartet wird, nicht akzeptiert werden und eine Klassifizierung des Baustoffs als A1/A2 oder B1 nach DIN 4102-1 ist dann ausgeschlossen. Auf einen entsprechenden Antrag Deutschlands hat deshalb die Europäische Kommission beschlossen, dass Glimmen als eine Brandnebenerscheinung behandelt und klassifiziert werden muss und Baustoffe, die zum Glimmen neigen, künftig entsprechend geprüft werden müssen. Die Normungsorganisation CEN ist beauftragt, in den Produktnormen der betroffenen Produkte dieses Risiko zu behandeln. Nach deutschen Vorstellungen sollte das Glimmen möglichst im Rahmen der vorhandenen europäischen Brandverhaltensprüfungen mitgeprüft werden, insbesondere unter Anwendung des SBI-Prüfverfahrens. Davon wurde allerdings inzwischen in der CEN Arbeitsgruppe Abstand genommen.
Tabelle 3. Klassifizierung des Feuerwiderstands von tragenden Bauteile mit raumabschließender Funktion (Wände)
Des Weiteren besteht in einigen Mitgliedstaaten, so auch in Deutschland, die Auffassung, dass das gegenwärtige Klassifizierungssystem für die Beurteilung des Brandverhaltens von Außenwandbekleidungen nicht geeignet ist, da die bei einem Brand zu erwartenden Risiken nicht erfasst werden. Im Brandfall werden Außenwandbekleidungen durch Flammen, die aus Wandöffnungen schlagen, beansprucht, was sich in der SBI-Prüfung aber nicht simulieren lässt. So kann beispielsweise bei hinterlüfteten Außenwandbekleidungen die bei einem Brand entstehende Sogwirkung im Hinterlüftungsspalt nicht überprüft werden. Die Europäische Kommission hat hierzu ein Mandat an EOTA (European Organization for Technical Approvals) zur Erarbeitung eines harmonisierten Referenzszenariums erteilt.
3.2 Feuerwiderstand
Die Europäische Kommission hat mit der Entscheidung 2000/367/EG vom 3. Mai 2000 [6] die Klassifizierung des Feuerwiderstands von Bauprodukten, Bauwerken und Teilen davon festgelegt. Die Entscheidung enthält in einer Reihe von Tabellen die Klassen für die verschiedenen Bauteile und Produkte und die Begriffs-bestimmungen, Prüfungen und Leistungskriterien, auf denen die Klassifizierungen beruhen. Jeder Mitgliedstaat legt auf der Basis dieser Entscheidung die Klassen fest, die zur Einhaltung des jeweiligen nationalen Sicherheitsniveaus einzuhalten sind.
In Tabelle 3 sind beispielhaft die Klassen, die von der Europäischen Kommission für tragende Bauteile mit raumabschließender Funktion (Wände) festgelegt wurden, zusammengestellt.
Die Hauptkriterien für die europäische Klassifizierung des Feuerwiderstands sind die Tragfähigkeit (R), der Raumabschluss (E) und die Wärmedämmung (I). Weitere Indexe für Leistungskriterien werden den Feuerwiderstandsklassen angefügt wie beispielsweise S für die Rauchdurchlässigkeit bei Lüftungsleitungen oder C für das Selbstschließvermögen von Feuerschutzabschlüssen (siehe Tabelle 5). Die Feuerwiderstandsfähigkeit wird in Minuten ausgedrückt.
Erst mit der späteren Entscheidung 2003/629/EG vom 27. August 2003 [8] hat die Europäische Kommission die Prüfverfahren und die Feuerwiderstandsklassen für Produkte für Rauch- und Wärmeabzugsanlagen festgelegt und zwar für
Tabelle 4 zeigt beispielhaft die Klassen feuerwiderstandsfähiger Entrauchungsanlagen für mehrere Brandabschnitte.
In Abhängigkeit von den zusätzlich festgestellten Parametern kann also eine feuerwiderstandsfähige Entrauchungsanlage für mehrere Brandabschnitte die Klasse EI 90 multi veho S-1500 haben. Dieses Beispiel macht deutlich, dass die europäische Klassifizierung von Produkten für Rauch- und Wärmeabzugsanlagen künftig komplizierter ist, weil sie mehr Informationen über das Bauprodukt enthält als bisher. Ob dies allerdings nachteilig ist, wird die Anwendung der Klassifizierung zeigen. Eine vollständige Übersicht über die Klassen für die verschiedenen Produktbereiche kann der Veröffentlichung der Entscheidung [7] entnommen werden.
Die bei der europäischen Klassifizierung des Feuerwiderstands verwendeten Buchstaben für die einzelnen Kriterien und die zusätzlichen Angaben zur Klassifizierung sind in Tabelle 5 erläutert.
Tabelle 4. Klassifizierung des Feuerwiderstands von Produkten für Rauch- und Wärmeabzugsanlagen
Tabelle 5. Leistungskriterien
3.2.1 Unterschiede zur bisherigen Klassifizierung
Die Besonderheit der europäischen Klassifizierung besteht darin, dass, anders als bei der bisherigen Klassifizierung nach DIN 4102-2, die bei der Prüfung erzielten unterschiedlichen Zeiten für jedes einzelne Versagenskriterium angegeben werden. Bei der Klassifizierung nach DIN 4102-2 wurden alle Kriterien in einer Gesamtbeurteilung erfasst und mit einem gemeinsamen Kennbuchstaben ausgedrückt. Die Klasse F 30 bedeutet also, dass alle Kriterien mindestens 30 Minuten lang erfüllt sind. Nach dem europäischen Klassifizierungs-system kann eine tragende, raumabschließende Wand die Klasse REI 30/REW 60/RE 90 erhalten, wenn während der Brandprüfung das Versagen in Bezug auf die Einzelkriterien zu unterschiedlichen Zeiten auftritt.
3.2.2 Zurzeit noch in Diskussion
Derzeit werden zahlreiche Normen bearbeitet, die eine erweiterte Anwendung von Prüfergebnissen ermöglichen und so den Prüfumfang reduzieren sollen.
3.2.3 Europäische Normen für den Feuerwiderstand
Tabelle 6 gibt eine Übersicht über die verfügbaren und über die in Arbeit befindlichen Normen für den Feuer-widerstand.
Tabelle 6. Europäische Prüf- und Klassifizierungsnormen für den Feuerwiderstand
3.3 Verhalten von Bedachungen bei einem Brand von außen
3.3.1 Klassifizierung und Prüfverfahren
Die Klassifizierung des Verhaltens von Bedachungen hat die Europäische Kommission in der Entscheidung 2001/671/EG vom 21. August 2001 [9] festgelegt; Tabelle 7 zeigt Klassen und Prüfverfahren. Diese Entscheidung kann nur als eine mittelfristige Lösung angesehen werden, denn bis heute konnte man sich noch nicht auf ein einheitliches Prüfverfahren einigen. So enthält die geänderte Entscheidung vier verschiedene Prüfverfahren, die nicht miteinander kompatibel sind. Die Klassen stehen ohne Rangordnung nebeneinander. Die Klasse BROOF (t3) kann somit die Klasse BROOF (t1) nicht ersetzen, da sie auf verschiedenen Prüfungen beruhen, die nicht vergleichbar sind.
Die europäischen Prüfverfahren Test 1, 2,3 und 4 nach ENV 1187 wurden nahezu unverändert aus den nationalen Prüfverfahren übernommen, wobei das Prüfverfahren 1 dem bisherigen deutschen Prüfverfahren nach DIN 4102-7 im Wesentlichen entspricht. Allerdings wurden die Beurteilungskriterien für Test 1 verändert, was eine unmittelbare Vergleichbarkeit mit alten Prüfergebnissen erschwert. Langfristig wird ein einheitliches europäisches Prüfverfahren zu entwickeln sein, um eine tatsächliche Harmonisierung der Beurteilung für Bedachungen zu erreichen. Die Klassifizierung von Bedachungen hinsichtlich ihres Verhaltens bei einem Brand von außen erfolgt nach EN 13501-5. Nach Veröffentlichung dieser Norm können auch Bedachungen hinsichtlich ihres Verhaltens bei einem Brand von außen europäisch klassifiziert werden.
Auch nach den europäischen Prüfverfahren wird – wie bisher auch – stets ein System, d.h. der gesamte Dachaufbau, geprüft. Deshalb ist darauf zu achten, dass nur das geprüfte Bedachungssystem klassifiziert werden kann und nicht das einzelne in einer Bedachung verwendete Produkt, da es allein die Anforderungen i. d. R. nicht erfüllen kann.
3.3.2 Europäische Normen für Bedachungen
Tabelle 8 gibt eine Übersicht über die verfügbaren und über die in Arbeit befindlichen Normen für die Prüfung und Klassifizierung von Bedachungen.
Tabelle 7. Europäische Klassifizierung für das Verhalten von Bedachungen bei einem Brand von außen
Tabelle 8. Europäische Prüf- und Klassifizierungsnormen für Bedachungen
Norm
Titel
Ausgabe/Bearbeitungsstand
DIN V ENV 1187
Prüfverfahren zur Beanspruchung von Bedachungen durch Feuer von außen
2006-10 Vornorm
DIN EN 13501-5
Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten; Teil 5: Klassifizierung mit den Ergebnissen aus Prüfungen von Bedachungen bei einer Beanspruchung durch Feuer von außen
2010-02
4 Klassifizierung ohne Prüfung
In Deutschland können Baustoffe und Bauteile durch Anwendung der Norm DIN 4102-4 ohne weitere Prüfung hinsichtlich ihres Brandverhaltens und Feuerwiderstands klassifiziert werden. Auf europäischer Ebene steht eine solch umfassende Übersicht noch nicht zur Verfügung. Allerdings ist man auch hier der Auffassung, dass auf Prüfungen soweit als möglich verzichtet werden sollte.
Mit der Entscheidung 96/603/EG [10] zur Festlegung eines Verzeichnisses von Produkten, die in die Kategorie A1 bzw. A1FL „Kein Beitrag zum Brand“ einzuordnen sind, hat die Europäische Kommission bereits 1996 erstmalig die Möglichkeit der Klassifizierung des Brandverhaltens ohne Prüfung geschaffen. Die in Tabelle 9 aufgeführten Produkte können, sofern sie nach europäisch harmonisierten Spezifikationen hergestellt werden und die Voraussetzungen eingehalten sind (d.h. brennbare Bestandteile die geforderten Grenzwerte nicht überschreiten), ohne Prüfung in die europäische Brandverhaltensklasse A1 bzw. A1FL eingestuft werden.
Inzwischen hat die Europäische Kommission weitere Entscheidungen für einzelne Baustoffe getroffen, die einer europäisch harmonisierten Produktnorm entsprechen und deren Brandverhalten unter bestimmten Rand-bedingungen ohne weitere Prüfung klassifiziert werdenkann. Produkte, für die eine Klassifizierung ohne
Tabelle 9. Materialien, die ohne Prüfung in die Brandverhaltensklasse A1 und A1FL einzustufen sind
Prüfung (CWFT-Produkte, classified without further testing) beabsichtigt ist, müssen die Anforderungen sicher erfüllen und mit hinreichender Genauigkeit, z.B. in der Produktnorm beschrieben sein. Es werden also nur Bauprodukte infrage kommen, die ein bekanntes und stabiles Brandverhalten haben. Die Europäische Kommission hat u. a. für die folgenden Produkte über eine Klassifizierung des Brandverhaltens ohne Prüfung entschieden und die Bedingungen festgelegt:
Eine vollständige Sammlung der CWFT-Entscheidungen ist zu finden unter www.dibt.de/Europa/EuropäischeUnion/Kommission/Brandschutz.
Von Herstellern und Anwendern dieser Produkte ist bei einer Klassifizierung ohne Prüfung insbesondere darauf zu achten, dass die Erleichterungen nur für die besonders benannten Produkte gelten und keinesfalls für den gesamten Anwendungsbereich der jeweiligen Norm. Es sollte also sorgfältig überprüft werden, ob die Anwendungsbedingungen tatsächlich zutreffen und eine Klassifizierung ohne Prüfung gerechtfertigt ist.
Weitere Anträge auf Klassifizierung ohne Prüfung werden bei der Europäischen Kommission bearbeitet.
Die Möglichkeit der Klassifizierung ohne Prüfung besteht grundsätzlich für alle Klassifizierungen, also auch für die Klassifizierung des Feuerwiderstands. Bisher wurden entsprechende Anträge bei der Europäischen Kommission jedoch noch nicht gestellt.
Außerdem hat die Europäische Kommission eine Liste von europäisch harmonisierten Dachdeckungsprodukten zusammengestellt, von denen ohne Prüfung angenommen werden kann, dass sie den Anforderungen für das Verhalten bei einem Brand von außen entsprechen, sofern die Bedingungen der Entscheidung und die jeweiligen einzelstaatlichen Vorschriften für Entwurf und Ausführung von Bauwerken beachtet werden [13].
5 Ingenieurmethoden des Brandschutzes
Die Anwendung von Ingenieurmethoden des Brandschutzes zur Beurteilung und Bewertung von Schutzmaßnahmen und das durch sie gewährleistete Sicherheitsniveau wird von der Europäischen Kommission unterstützt. Bereits im Grundlagendokument „Brandschutz“ ist durch allgemeine Aussagen ein Weg aufgezeigt, der fort von Einzelanforderungen an Baustoffe und Bauteile hin zu allgemeinen Vorschriften führen soll. Danach können Ingenieurmethoden in verschiedener Weise angewandt werden:
Mittlerweile sind schon umfangreiche Teile der Ingenieurmethoden für den Brandschutz entwickelt. Konsolidierte Teile liegen hierfür vor. Für einen ingenieurmäßigen Ansatz ist erforderlich, dass die maßgebenden Produktmerkmale zur Verfügung stehen und Rechen-und Bemessungsverfahren auf abgestimmter und harmonisierter Basis anerkannt sind.
In den internationalen Normungsgremien von ISO werden Normen zu diesem Themenbereich erstellt. Bei CEN sind in diesem Normungsbereich verschiedene Aktivitäten ergriffen worden.
In einer umfassenden Studie, die von der Europäischen Kommission in Auftrag gegeben war, wurden die gegenwärtige Praxis und die Erfahrungen mit der Anwendung von Ingenieurmethoden in den einzelnen Mitgliedstaaten untersucht. Langfristig sollen nach den Vorstellungen der Europäischen Kommission die einzelstaatlichen Sicherheitsniveaus und gesetzlichen Regeln europäisch harmonisiert werden. Eine solche Arbeit geht aber über den Bereich der Bauproduktenricht-linie hinaus, sodass sie nur mit Unterstützung aller Mitgliedstaaten zu einem Erfolg führen dürfte.
Bis europäisch abgestimmte Grundlagen für eine Anwendung von Ingenieurmethoden im Brandschutz vorliegen, ist ein solches Vorgehen in Deutschland vorerst nur im Einzelfall mit Zustimmung der Bauaufsichtsbehörde möglich.
6 Brandschutzbemessung nach den Eurocodes
Die Möglichkeit rechnerischer Nachweise ist im Grundlagendokument 2 vorgesehen und wird von der Europäischen Kommission unterstützt. Für einen ingenieurmäßigen Ansatz müssen die maßgebenden Produktmerkmale zur Verfügung stehen und die Rechen- und Bemessungsverfahren auf abgestimmter und harmonisierter Basis anerkannt sein. Im Auftrag der Europäischen Kommission wurden die Eurocodes 1 bis 9 von CEN erarbeitet, die technische Regeln für den Entwurf, die Berechnung und Bemessung von kompletten Tragwerken und Bauteilen auf der Basis von Rechenverfahren enthalten.
Die Brandschutzteile der Eurocodes 1 bis 6 und der Eurocode 9 (siehe Tabelle 10) legen die Regeln für die Bemessung und Konstruktion von Bauteilen und Bauwerken mittels rechnerischer Nachweisverfahren im Hinblick auf eine ausreichende Tragfähigkeit, den Raumabschlusses und die Wärmedämmung unter Brandbeanspruchung fest. Grundsätzlich sind Nachweisverfahren für jeden der genannten Baustoffe auf drei Stufen vorgesehen, wobei der Aufwand von Stufe zu Stufe zunimmt:
Stufe 1: Tabellarische Daten.
Stufe 2: Vereinfachte Rechenverfahren.
Stufe 3: Allgemeine (genaue) Rechenverfahren.
Tabelle 10. Zusammenstellung der Brandschutzteile der Eurocodes und der Nationalen Anhänge (NA)
Norm
Kurztitel
Ausgabe/Bearbeitungs stand
DIN EN 1990
Grundlagen
2010-12
DIN EN 1990/NA
2010-12
DIN EN 1991-1-2
Brandeinwirkungen
2010-12
DIN EN 1991-1-2/NA
2010-12
DIN EN 1992-1-2
Betonbau Brandschutz
2010-12
DIN EN 1992-1-2/NA
2010-12
DIN EN 1993-1-2
Stahlbau Brandschutz
2010-12
DIN EN 1993-1-2/NA
2010-12
DIN EN 1994-1-2
Verbundbau Brandschutz
2010-12
DIN EN 1994-1-2/NA
2010-12
DIN EN 1995-1-2
Holzbau Brandschutz
2010-12
DIN EN 1995-1-2/NA
2010-12
DIN EN 1996-1-2
Mauerwerksbau Brandschutz
2011-01
DIN EN 1996-1-2/NA
-
DIN EN 1999-1-2
Aluminiumbau Brandschutz
2010-12
DIN EN 1999-1-2/NA
2010-12
Grundlage für die Ermittlung der möglichen Beanspruchungen sind u. a. die jeweiligen charakteristischen Baustoffkennwerte in den baustoffbezogenen Eurocodes, die weitestgehend vorhanden sind.
Weiterhin müssen die Mitgliedstaaten entscheiden, welche Zahlenwerte und/oder Klassen, welche landesspezifischen, geographischen und klimatischen Daten, welche Vorgehensweise bei den Rechenverfahren für die Gewährleistung ihres Sicherheitsniveaus gelten.
In Tabelle 10 sind die Eurocodes und die in Deutschland geltenden Anwendungsdokumente zusammengestellt (siehe auch Abschnitt 7.4).
7 Europäische Klassifizierung im bauaufsichtlichen Verfahren
7.1 Brandverhalten
Baustoffe werden nach den bauaufsichtlichen Anforderungen an ihr Brandverhalten in nichtbrennbare, schwerentflammbare und normalentflammbare unterschieden. Baustoffe, die nicht mindestens normalentflammbar, also leichtentflammbar sind, dürfen nicht verwendet werden, es sei denn, sie verlieren in Verbindung mit anderen Baustoffen ihre Leichtentflammbar-keit. In bestimmten Anwendungen dürfen Baustoffe nur eine geringe Rauchentwicklung haben und/oder dürfen nicht brennend abtropfen oder abfallen.
Die Konkretisierung der in den Bauordnungen verwendeten Begriffe wurde bisher durch die Klasseneinteilung nach DIN 4102-1 – Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen – vorgenommen. Inzwischen stehen als weitere Möglichkeit die Klassen nach der DIN EN 13501-1 zur Verfügung. In der Bauregelliste A Teil 1 Anlage 0.2 [14] sind die Klassen den jeweiligen Anforderungsniveaus verbindlich zugeordnet. Hier kann der Anwender sich darüber informieren, welche europäischen Klassen für eine bestimmte Anforderung akzeptiert werden bzw. mindestens erforderlich sind. Im Unterschied zur bisherigen Klassifizierung nach DIN 4102-1 stellt das europäische System eine größere Vielfalt von Klassen und Klassenkombinationen zur Verfügung.
Die Klassen nach DIN 4102-1 und DIN EN 13501-1 sind alternativ anwendbar. Baustoffe, die nach europäisch harmonisierten Produktnormen oder nach europäischen technischen Zulassungen hergestellt werden, dürfen ausschließlich nach den europäischen Prüfnormen geprüft und nach DIN EN 13501-1 klassifiziert werden. In dem Bauproduktenbereich, der europäisch nicht geregelt ist, darf die europäische Klassifizierung nach der Maßgabe der Bauregelliste alternativ verwendet werden. Für den Nachweis der europäischen Klassen Cs3, d2 und besser ist allerdings die Erteilung einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung durch das Deutsche Institut für Bautechnik erforderlich, da insbesondere bei den neu entwickelten europäischen Prüfverfahren noch keine Regelungen hinsichtlich der Prüfbedingungen vorliegen und deshalb für das jeweilige Produkt im Rahmen des Zulassungsverfahrens festgelegt werden müssen.
Eine Vergleichbarkeit der Klassen nach DIN 4102-1 mit den europäischen Klassen besteht nicht. Deshalb können alte Prüfergebnisse nicht mit den neuen europäischen Klassen verwendet werden.
7.2 Feuerwiderstand
Bauteile werden nach den bauaufsichtlichen Anforderungen an ihre Feuerwiderstandsfähigkeit in feuerbeständige, hochfeuerhemmende und feuerhemmende Bauteile unterschieden. Die Feuerwiderstandsfähigkeit bezieht sich bei tragenden und aussteifenden Bauteilen auf deren Standsicherheit im Brandfall, bei raumabschließenden Bauteilen auf deren Widerstand gegen die Brandausbreitung. Bauteile werden zusätzlich nach dem Brandverhalten ihrer Baustoffe unterschieden.
Bisher wurde der Feuerwiderstand von Bauteilen und Bauarten aufgrund von Brandprüfungen nach der DIN 4102 klassifiziert. Die europäische Klassifizierung erfolgt nach den verschiedenen, für die jeweiligen Bauteile relevanten Teilen der DIN EN 13501.
In den Tabellen der Anlage 0.1.2 zur Bauregelliste A Teil 1 [14] wird durch Zuordnung der europäischen Klassen zu den bauaufsichtlichen Begriffen „feuerhemmend, hochfeuerhemmend und feuerbeständig“ für Deutschland verbindlich festgelegt, für welche Bauteilarten oder Sonderbauteile welche Feuerwiderstandsklassen zur Gewährleistung der bauaufsichtlichen Anforderungen mindestens einzuhalten sind.
Für den Nachweis des Feuerwiderstands gilt gleichermaßen, dass die Klassifizierungen nach DIN 4102 und nach DIN EN 13501 alternativ anwendbar sind. Bauteile, die nach europäisch harmonisierten Produktnormen oder nach europäischen technischen Zulassungen hergestellt werden, dürfen ausschließlich nach den europäischen Prüfnormen geprüft und nach DIN EN 13501 klassifiziert werden.
7.3 Bedachungen
Bedachungen müssen entsprechend den bauaufsicht-lichen Anforderungen gegen eine Brandbeanspruchung von außen durch Flugfeuer und strahlende Wärme ausreichend lang widerstandsfähig sein (harte Bedachung). Gegen Flugfeuer und strahlende Wärme widerstandsfähige Bedachungen müssen die Ausbreitung des Feuers auf dem Dach und eine Brandübertragung vom Dach in das Innere des Gebäudes bei der von außen auf die Bedachung einwirkenden Beanspruchung verhindern.
Die Anforderung der harten Bedachung wurde bisher durch Prüfung nach der DIN 4102-7 nachgewiesen. Alternativ können Bedachungen auch nach europäischen Prüfverfahren geprüft und klassifiziert werden, mit Ausnahme der europäisch geregelten Bedachungen, für die es harmonisierte Normen oder europäische technische Zulassungen gibt.
In der Bauregelliste A Teil 1 Anlage 0.1.3 [14] ist die in Deutschland akzeptierte europäische Klasse der bauauf- sichtlichen Anforderung „harte Bedachung“ zugeordnet.





























