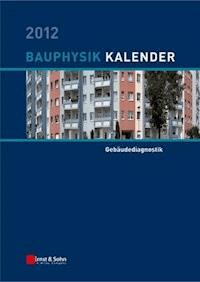
Bauphysik-Kalender 2012 E-Book
70,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Wiley-VCH
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Die Gebäudediagnostik hat sich zum Schlüsselthema der Bauphysik entwickelt - und zwar sowohl für die Bestandsaufnahme und -bewertung als auch für die Inbetriebnahme und das Einfahren von Neubauten und deren planmäßiges langfristiges Monitoring zur Überwachung der Funktionsfähigkeit. Die gewachsenen technischen Möglichkeiten der Gebäudediagnostik mit einer Vielzahl von Mess- und Prüftechniken ermöglichen eine komplexe, ganzheitliche Analyse und Planung und sind somit wesentliche Grundlage für nachhaltiges Bauen. Im neuen Bauphysik-Kalender 2012 mit dem Schwerpunktthema "Gebäudediagnostik" werden zerstörende und zerstörungsfreie Prüfverfahren zur Bestimmung von Materialeigenschaften und ihre Anwendung auf alle Bauarten zur Tragwerksdiagnose und Bestimmung der Tragsicherheit praxisgerecht erläutert. Weiterhin werden die Mess- und Analysemethoden zur Untersuchung der Gebrauchseigenschaften und des energetischen Verhaltens (Performance) von Gebäuden, wie z. B. Raumluftqualität, Wärmegewinne und -verluste und Schadstoffemission, aufgeführt. Die praxisgerechten Erläuterungen schließen Beispiele verschiedenster Gebäudetypen bis hin zur Dauerüberwachung denkmalgeschützter Bauwerke ein. Auf aktuellem Stand sind wie immer die Materialtechnischen Tabellen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1391
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Titelbild: Wohnpark Elsteraue, Halle/Saale
Foto: Caparol Farben Lacke Bautenschutz/Martin Duckek
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© 2012 Wilhelm Ernst & Sohn,
Verlag für Architektur und technische Wissenschaften GmbH & Co. KG,
Rotherstraße 21, 10245 Berlin, Germany
Alle Rechte, insbesondere die der Übersetzung in andere Sprachen, vorbehalten. Kein Teil dieses Buches darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlages in irgendeiner Form – durch Fotokopie, Mikrofilm oder irgendein anderes Verfahren – reproduziert oder in eine von Maschinen, insbesondere von Datenverarbeitungsmaschinen, verwendbare Sprache übertragen oder übersetzt werden.
All rights reserved (including this of translation into other languages). No part of this book may be reproduced in any form – by photoprint, microfilm, or any other means – nor transmitted or translated into a machine language without written permission from the publisher.
Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen oder sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige gesetzlich geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche markiert sind.
ISBN 978-3-433-02986-2
ISSN 01617-2205
O-book ISBN 978-3-433-60123-5
Vorwort
Die Bauwerks- bzw. Gebäudediagnostik hat sich zum Schwerpunktthema der Bauphysik entwickelt – und zwar sowohl für die Bestandsaufnahme und -bewertung im Alt- und Neubau als auch für die Inbetriebnahme von Neubauten sowie deren planmäßiges langfristiges Monitoring zur Überwachung der Funktionsfähigkeit. Die heutigen technischen Möglichkeiten der Gebäudediagnostik mit einer Vielzahl von Mess- und Prüfmethoden ermöglichen eine komplexe, ganzheitliche Analyse und Planung und sind somit wesentliche Grundlage für das nachhaltige Bauen.
Der Bauphysik-Kalender 2012 widmet sich diesem Schwerpunktthema der „Gebäudediagnostik“, indem zerstörende und zerstörungsfreie Untersuchungs- bzw. Prüfverfahren zur Bestimmung von bauphysikalischen und mechanischen Materialeigenschaften und Konstruktionsdetails für nahezu alle Bauarten praxisgerecht dargestellt und erläutert werden. Er verfolgt die sich in seiner Gliederung widerspiegelnden Ziele:
In der ersten Rubrik „Allgemeines und Regelwerke“ wird nach einem einführenden Beitrag zur Bauwerksdiagnostik und ihrer Stellung im Bauwesen die Bedeutung der Gebäudediagnostik als Bestandteil ganzheitlicher energetischer Modernisierungskonzepte aufgezeigt. Ein weiterer Beitrag stellt die aktuellen Regelwerke der Bauwerksdiagnostik vor.
Die zweite Rubrik „Materialtechnische Grundlagen“ beinhaltet Beiträge zu Prüfverfahren der In-situ-Bestimmung und Bewertung von mechanischen sowie bauphysikalischen Eigenschaften von Tragwerken aus Holz, Beton und Mauerwerk, insbesondere aus historischem Mauerwerk. Weiterhin werden die Mess- und Analysemethoden zur Untersuchung der Gebrauchseigenschaften und des energetischen Verhaltens von Gebäuden, wie z.B. der Raumluftqualität und Schadstoffemission oder auch der thermischen Qualität der Gebäudehülle aufgeführt.
Zu den ausgewählten bauphysikalischen Nachweisverfahren gehören in den ersten drei Beiträgen der nächsten Rubrik die Grundlagen der Infrarot-Thermografie, der Schallmessung am Bau sowie der Feuchtediagnostik in Gebäuden. Ein weiterer Beitrag widmet sich der Problematik der Luftdichtheit und deren messtechnischer Bestimmung bei Gebäudehüllen.
In der vierten Rubrik „Konstruktive Ausbildung von Bauteilen und Bauwerken“ werden u. a. praxisgerechte Erläuterungen zu verschiedenen Prüf- und Monitoringkonzepten anhand beispielhafter Bauwerke bzw. Gebäude verschiedenster Typen gegeben. Folgende Themengebiete werden behandelt:
Die letzte Rubrik enthält den jährlich aktualisierten Beitrag zu den materialtechnischen Tabellen.
Mit seinen vielfältigen Beiträgen stellt der BauphysikKalender 2012 eine solide Arbeitsgrundlage sowie ein aktuelles Nachschlagewerk nicht nur für die Praxis, sondern auch für Lehre und Forschung dar. Für kritische Anmerkungen sind die Autoren, der Herausgeber und der Verlag dankbar.
Der Herausgeber möchte an dieser Stelle allen Autoren für ihre Mitarbeit und dem Verlag für die angenehme Zusammenarbeit herzlichst danken.
Hannover, im Januar 2012
Nabil A. Fouad
Inhaltsübersicht
A Allgemeines und Regelwerke
A1 Bauwerkdiagnostik und ihre Bedeutung im Bauwesen
A2 Gebäudediagnostik als Bestandteil ganzheitlicher Modernisierungskonzepte – Ganzheitliche energetische Modernisierung am Beispiel der denkmalgeschützten Hohenzollern-Höfe in Ludwigshafen
A3 Aktuelle Regelwerke der Bauwerksdiagnostik
B Materialtechnische Grundlagen
B1 Prüfverfahren zur Begutachtung der Materialeigenschaften von Holztragwerken
B2 Zerstörungsfreie Prüfverfahren zur Bestimmung von Materialparametern im Stahl- und Spannbetonbau
B3 Altes Mauerwerk zerstörungsarm mit Radar und Ultraschall erkunden und bewerten
B4 Differenzierungsmethoden zur Schadstoffermittlung in Gebäuden
B5 In-situ-Bestimmung thermischer Eigenschaften von Baukonstruktionen – Herrn Univ.-Prof. DI DDr. Jürgen Dreyer zum 70. Geburtstag gewidmet
C Bauphysikalische Planungs- und Nachweisverfahren
C1 Infrarot-Thermografie in der Praxis
C2 Schallmessungen am Bau
C3 Feuchtediagnostik in Gebäuden
C4 Luftdichtheit in Planung, Ausführung und Messung
D Konstruktive Ausbildung von Bauteilen und Bauwerken
D1 Terrestrisches 3-D-Laserscanning – Messmethodik und Einsatzmöglichkeiten zur Objekterfassung im Bauwesen
D2 Diagnose der thermischen Gebrauchstauglichkeit – Grundlagen, Einführung, Hinweise
D3 Schadensdiagnostik und Bewertung in historischen Gebäuden
D4 Methoden der Dauerüberwachung von Gebäuden des kulturellen Erbes im Rahmen der Denkmalkonservierung
D5 Ziele, Durchführung und Erfahrungen beim bauphysikalisch-energetischen Monitoring an verschiedenen Objekten
D6 Minderung elektromagnetischer Felder in Gebäuden durch optimale Auswahl von Baumaterialien / Bestimmung der elektromagnetischen Schirmdämpfung von Baumaterialien
D7 Geodätische Überwachung von Bauwerken
E Materialtechnische Tabellen
E Materialtechnische Tabellen
Stichwortverzeichnis
Hinweis des Verlages
Die Recherche zum Bauphysik-Kalender ab Jahrgang 2001 steht im Internet zur Verfügung unter www.ernst-und-sohn.de
AAllgemeines und Regelwerke
A1Bauwerkdiagnostik und ihre Bedeutung im Bauwesen
Bernd Hillemeier
Inhaltsverzeichnis
1 Die gebaute Infrastruktur
2 Fortschritt durch Fehler
3 Messen, messen, messen
4 Prüfen und Messen waren zweitrangig
5 Qualitätssicherung
6 Hightech-Baukonstruktionen
6.1 Baustoffe
6.2 Neue Baustoffe
6.3 Selbstverdichtender Beton
6.4 Resistenter Beton
7 Klassische Messprobleme
8 Verfahren zur In-situ-Messung von Zustandsgrößen
9 Innovationen in der Bauwerkdiagnostik
9.1 Impact-Echo
9.2 Betondruckfestigkeit
9.3 Schall
9.4 Ultraschall
9.5 Radar – Probability of Detection (POD)
9.6 Thermografie
9.7 Belastungsversuche
10 Schlussfolgerung
11 Literatur
1 Die gebaute Infrastruktur
Das Zusammenleben der Menschen erfordert eine Vielzahl gebauter Infrastrukturen. Die Lebensqualität und die Wirtschaftskraft eines Ballungsraums werden stark durch die Güte seiner gebauten Infrastrukturen beeinflusst. Die Erhaltung und der Ausbau von Infrastrukturen zählen zu den technisch und finanziell aufwendigsten Aktivitäten einer Gemeinschaft. Setzt man den Schwerpunkt auf Infrastrukturen von Ballungsräumen, befasst man sich zwangsläufig mit einem wesentlichen Aspekt der Gestaltung des menschlichen Lebens.
Die Anzahl der Infrastrukturen im Bauwesen ist groß. Beispiele sind
Exportnationen müssen Produkte und Dienstleistungen anbieten, um auf den Weltmärkten konkurrenzfähig zu bleiben. Der globale Wettbewerb ist ein Innovationswettbewerb. Deutschland ist eine Exportnation und profitiert von seinen Innovationen. Für den Bausektor zählen dazu die Spannbetonbauweise, der Tunnelbau, der Trans-Rapid, dessen Schienenstrang ein deutsches Bauunternehmen in China gebaut hat, die deutschen Kernkraftwerke als die sichersten der Welt, der Freivorbau bei Brücken oder der säureresistente Beton in Abwasseranlagen und Kühltürmen.
Die rasanten Urbanisierungsprozesse in Entwicklungsländern, aber auch die Schrumpfungsauswirkungen in den europäischen Ländern erfordern neue Ansätze in der Planung und der technischen und wirtschaftlichen Gestaltung von Infrastruktureinrichtungen. Infrastrukturen müssen dabei vor ihrer Ertüchtigung hinsichtlich ihres Nutzungspotenzials statisch-konstruktiv und messtechnisch begutachtet werden. Dabei stoßen Planungs- und Ausbaustrategien an Umwelt- und Finanzierungsgrenzen.
2 Fortschritt durch Fehler
Die Fahrbahnen von Hängebrücken wurden nach den Erfolgen der George Washington Bridge in New York und der Golden Gate Bridge in San Francisco immer dünner, Bauingenieure sagen: schlanker, bis der Wind die Torsionsschwingungen einer Brücke so anfachte und aufschaukelte, dass sie brach. Dieser Einsturz der Tacoma-Hängebrücke 1940 ist ein klassischer Fall, bei dem neue Phänomene wegen Überschreitens von Erfahrungsbereichen auftraten [1].
Bei der Kongress-Halle, die die Berliner „Schwangere Auster“ nennen, hängen die Bögen des Dachs an einem Aussteifungsring. Nach 23 Jahren brach im Mai 1980 der Südbogen ab. Die Spanndrähte in der 7 cm dicken Dachhaut, mit denen der Bogen rückverankert war, brachen. Die Relativverformungen aus Temperatur hatten die Dachabdichtung eingerissen. Die Spanndrähte begannen zu rosten. Bildgebend für das Rosten der Spanndrähte waren die Rostabläufer auf dem hellen Beton am Fußpunkt der Bögen. Die Halle war Veranstaltungsort der Betontage des Deutschen Beton-Vereins und die Rostabläufer Diskussionsthema für die Tagungsteilnehmer. Über die Dramatik der Ursache machte sich niemand Gedanken. Im Laufe der Jahre rissen nacheinander so viele Drähte, bis sich der Bogen reißverschlussartig vom Dach trennte, abstürzte und zwei Menschen erschlug. Es handelte sich um einen typischen Mehrfach-Kausalschaden, der bei einem funktionierenden Qualitätssicherungs-System vermieden worden wäre.
Die Stahlbrücke über den Rhein bei Koblenz wurde im Freivorbau hergestellt. Die zu hebenden Teilstücke an der Vorbauspitze waren 17 m lang und etwa 220 Tonnen schwer. Im November 1971 war der Kragarm 104 m weit vorgebaut. Als das letzte Segment gehoben wurde, knickte der Kragarm ein und stürzte in den Rhein. Bauarbeiter starben. Ursache waren zu lange Aussparungen wegen der Schweißnähte in Versteifungsprofilen. Die verbliebenen Flansche knickten aus. Auf ähnliche Ursachen werden die Einstürze 1970 der Westgate-Brücke bei Melbourne, die Milford Hafenbrücke in England und 1969 die Wiener Donaubrücke zurückgeführt. Diese Fälle initiierten internationale experimentelle und theoretische Forschungen. Die Fälle zeigen, dass erst aus dem Machen neues Wissen folgt, freilich mit dem hohen Preis des Schadensfalls. Mit Dehnungsmessstreifen als Überlastsicherung, wie sie bei Hebekränen zum Stand der Technik gehören, hätten diese Brückenschäden, die während der Bauphase auftraten, vermieden werden können.
Wir glauben, aber wir prüfen nicht. Wir messen zu wenig und vertrauen zu viel. Messen zum Nachweis, dass gebaut wurde, wie geplant worden ist, muss zum Prinzip erhoben werden. Bild 3 zeigt am Qualitätskreis, wann in den Phasen Planung, Umsetzung und Nutzung Dokumentenprüfungen und physikalische Prüfungen durchzuführen sind.
3 Messen, messen, messen
Galileo Galilei (1564–1642), der toskanische Naturwissenschaftler, Mathematiker und Philosoph, der als Begründer der modernen Astronomie und der klassischen Physik gilt, befand, Kern aller Wissenschaft sei es, das zu messen, was messbar sei und das, was noch nicht messbar sei, messbar zu machen.
Daniel Kehlmann zitiert in seinem Roman „Die Vermessung der Welt“, wie Humboldt sich auf seine Weltreise messtechnisch vorbereitete: „Humboldt reiste nach Salzburg weiter, wo er sich das teuerste Arsenal von Messgeräten zulegte, das je ein Mensch besessen hatte. Zwei Barometer für den Luftdruck, ein Hypsometer zur Messung des Wassersiedepunkts, ein Theodolit für die Landvermessung, ein Spiegelsextant mit künstlichem Horizont, ein faltbarer Taschensextant, ein Inklinatorium, um die Stärke des Erdmagnetismus zu bestimmen, ein Haarhygrometer für die Luftfeuchtigkeit, ein Eudiometer zur Messung des Sauerstoffgehalts der Luft, eine Leydener Flasche zur Speicherung elektrischer Ladungen und ein Cyanometer zur Messung der Himmelsbläue. Dazu zwei jener unbezahlbar teuren Uhren, welche man seit kurzem in Paris anfertigte. Sie brauchten kein Pendel mehr, sondern schlugen die Sekunden unsichtbar, mit regelmäßig schwingenden Federn, in ihrem Inneren“.
Nur was man misst, kann man wirklich verbessern. Der Bauingenieur bemisst seine Konstruktionen und geht dabei Risiken ein. Er entscheidet unter Bedingungen der Ungewissheit. Um die Risiken zu mindern, schafft er sich Hilfsmittel, die ihm Auskunft über das zukünftige Tragverhalten geben. Ein wichtiges Hilfsmittel ist die statische Berechnung zum Vergleich der inneren Kräfte mit den Eigenschaften der vorgesehenen Baustoffe.
In den praktischen Berechnungen wird mit deterministischen Theorien und festen Größen gerechnet. Demgegenüber hat die Realität einen stochastischen Charakter. Die Eigenschaften der Baumaterialien eines Tragwerks streuen mehr oder weniger um ihren Mittelwert. Das Verhalten von Betonstahl auf Zug oder die Druckfestigkeitsprüfung des Betons zählen zu den standardisierten Verfahren der klassischen zerstörend messenden Baustoffprüfung.
Die auf das Tragwerk einwirkenden äußeren Belastungen sind Zufallsfunktionen der Zeit. Sie realitätsnah zu erfassen, ist Gegenstand des Bauwerkmonitorings (Abschn. 7). Sensorik zum Korrosionsmonitoring und zur Deformationsmessung an Bauwerken sowie das Klimamonitoring zum Schutz historischer Innenräume behandelt dieser Bauphysik-Kalender.
Kontrolle und Überwachung sind bei den meisten Bauwerken auf die Phasen der Planung und Bauausführung beschränkt. Nur exponierte Bauwerke, wie z. B. Eisenbahnbrücken, Staudämme oder Kernkraftwerke, werden während der Phase der Nutzung kontrolliert. Die Mehrzahl der Bauwerke bleibt nach der Fertigstellung heute noch sich selbst überlassen und oft ist der Nutzer gar nicht über die zulässigen Lasten informiert.
Alle Baumaterialien sind Prozessen der Alterung, Ermüdung, Nacherhärtung, Korrosion oder des Kriechens unterworfen, die die Tragfähigkeit verändern. Viele geprüfte Einzelwerte, z. B. Festigkeitswerte eines geprüften Betons, ergeben die Dichtefunktion des geprüften Merkmals, hier der Festigkeit.
Mit einer speziellen Dichtefunktion sind wir besonders vertraut, mit der Gauß’schen Normalverteilung. Als ordentlicher Professor der Mathematik und Astronomie an der Universität Göttingen erhielt Carl Friedrich Gauß den Auftrag seines Landesherrn, das Königreich Hannover zu vermessen. Mit dieser Aufgabe hat er sich 25 Jahre lang immer wieder beschäftigt. Dabei machte ihm die Ungenauigkeit seiner Geräte zu schaffen. Um die Folgen dieser Ungenauigkeiten in den Griff zu bekommen, begann er, über die zufälligen Abweichungen seiner Messwerte von ihrem Mittelwert nachzudenken. Er entwickelte dabei die Methode der kleinsten Quadrate und die Normalverteilung, die sogenannte Gauß’sche Glockenkurve. So reagiert ein Genie auf nicht zu behebende Unzulänglichkeiten seiner Ausrüstung. Mehr über Gauß, seine Arbeit, über Opfer und Moral der Wissenschaft, liest man wiederum bei Daniel Kehlmann in „Die Vermessung der Welt“.
Zerstörende Prüfungen an bestehenden Bauwerken verbieten sich in aller Regel. Aber auch für diese Bauwerke müssen mit zunehmender Lebensdauer Zuverlässigkeits- und Sicherheitsaussagen gemacht werden. Deshalb hat sich das anspruchsvolle Gebiet der zerstörungsfreien Bauwerkprüfung in den vergangenen Jahren dynamisch weiterentwickelt. Prüf- und Messergebnisse sind Informationen. Damit gliedert sich die zerstörungsfreie Prüfung (zfP) in das große Gebiet der Information und Kommunikation ein.
4 Prüfen und Messen waren zweitrangig
In der ersten Wiederaufbauphase nach 1945 kam es darauf an, ein Dach über den Kopf zu bekommen. Bauphysik und Schallschutz waren Fremdwörter. Stahlbeton wurde der Baustoff für Geschossdecken und Kellerwände, Ziegel aller Art bildeten das Mauerwerk. Bei Verkehrsbauten begannen der Stahl- und Spannbeton ihren Siegeszug. Der Stahlbau kämpfte zunehmend mit dem Rücken an der Wand, der Holzbau beschränkte sich auf Behelfsbauten und Dachstühle [2].
Gallus Rehm, Direktor des Otto Graf Instituts und Gründungsdirektor des IEMB [2] schreibt in der Festschrift für Professor Hilsdorf: „Der ungeheuere Nachholbedarf verhalf vielen oft minderwertigen Baustoffen und -systemen zu einem zumindest befristeten Erfolg. Die Zahl der Baustoffvarianten und Produktgruppen stieg ins Gigantische, ins Unüberschaubare. Mischbinder, Ziegel, Deckensysteme, Wandbauarten, Fertigmörtel und Putze, Kaminputztüren, Formsteine, Kunststeine usw. kamen in verwirrender Vielfalt auf den Markt. Und damit war der Grundstein für solche Schäden gelegt, die sich a.) aus der Nichtabstimmung des Bauentwurfes mit der letztendlich gewählten Ausführung und b.) dem Mangel an Erfahrung mit den neuen Stoffen und Bauarten bei Planern und Ausführenden ergaben. (Statistische Erhebungen zeigen, dass in 50 bis 80% der Fälle mangelndes Wissen Schaden verursachend war.)“
Natürlich war mangelndes Wissen schuld, dass für die klar umrissene Aufgabe ungeeignete Baustoffe bzw. -systeme gewählt wurden, oder bei der Ausführung Fehler unterliefen, weil neue Systeme nach altem Muster eingesetzt wurden. Das Kernproblem war und ist aber wohl, dass eine zu breite Palette „ausgefeilter“ Systeme auf den Markt drängte, die jeden durchschnittlich ausgebildeten Architekten und Ingenieur über-forderten. Nur wenige Fachkräfte hatten und haben den Mut bzw. das Selbstbewusstsein, eine partielle oder auch eine breitere Unwissenheit einzugestehen und sich an „Fachleute“ zu wenden. Man fühlte sich dem „Fortschritt“ verpflichtet, baute leicht und flach in Sichtbeton oder in Spannbeton mit kaum messbarer Betondeckung der Stahleinlagen, mit überzüchteten nicht ausgereiften Spannstählen.
Bild 1.Matousek und Schneider haben die Ursachen von Fehlern im Bauprozess in der Schweiz analysiert [3]
Der geradezu fanatische Glaube an die universellen und einmaligen Eigenschaften des Zementbetons als optisch befriedigend zu gestaltende Oberfläche, als Korrosionsschutz für die Stahlbewehrung und als uneingeschränkt dauerhafter Baustoff, der in jede beliebige Form gegossen werden konnte, der keiner Nachbehandlung oder gar Pflege bedurfte, schraubte die Erwartungen bei den Bauherren so hoch, dass die Enttäuschung vorprogrammiert war und nicht ausbleiben konnte. Das Dilemma war und ist, dass Beton tatsächlich ein geradezu idealer Baustoff ist, wenn er den Gegebenheiten angepasst eingebracht, verdichtet und so nachbehandelt wird, dass er seine guten Eigenschaften auch zur Entfaltung bringen kann. Eine vorgegebene Betondeckung ist nur dann als Korrosionsschutz ausreichend, wenn sie auf der Baustelle eingehalten wird (Bild 2). Wenn aber Abstandhalter – wenn überhaupt – in zu großen Abständen oder aus Kunststoff angeordnet, oder Bügel bei Balken und Stützen mit Toleranzen gebogen wurden, die größer als die Betondeckung waren, halfen die schönsten Regelwerke nichts.
Aber nicht nur Betonbauwerke gaben Anlass zu Sorge. Wände aus Ziegel zeigten klaffende Risse, der Putz fiel quadratmeterweise von der Decke, Dachziegel und Vormauerziegel verwitterten schneller als befürchtet und nicht jede geschweißte Stahl- oder im Freien stehende Holzkonstruktion hielt was von ihr erwartet wurde. Von den wenig tauglichen Abdichtungsvarianten für Brückenfahrbahnen und Flachdecken ganz zu schweigen.
Eine unkritische, in ihrem Verhalten weitgehend von den Medien beeinflusste Gesellschaft freute sich zunächst über die Blamage „der Bauindustrie“, fühlte sich dann aber als unmittelbar Betroffener oder als Steuerzahler angesprochen, ja geradezu verpflichtet mit dafür Sorge zu tragen, dass das offenbar verlorengegangene Qualitätsbewusstsein wiederhergestellt und durch möglichst hohe Anforderungen an die Bauenden auch durchgesetzt wurde. Politiker machten ihren Einfluss geltend, bauende Verwaltungen erarbeiteten zusätzliche technische Vorschriften, schränkten die Ausführungsvarianten z. B. für Brücken ein.
Gallus Rehm fährt fort: „um es nicht zu vergessen: Alles wäre ganz einfach, wenn es nicht diese (verdammten) Chloride auch noch gäbe. Damit kann zwar, fast glaubhaft, eine Sachverständigendiskussion über Jahrzehnte am Leben erhalten werden und selbst die fadenscheinigsten Hypothesen über Korrosionsmechanismen sind belegbar und werden deshalb leidenschaftlich diskutiert“. Aber es war damals auch die profitable Meisterleistung von Gallus Rehm, eines der größten Forschungsprojekte über die Gefährlichkeit oder Ungefährlichkeit von Chloriden im Stahlbetonbau an die Universität Stuttgart zu holen.
Als Resümee nach Rehm könnte man festhalten: Die Anwendung von „fortschrittlichen“ (Hightech-)Baustoffen, Verfahren oder Systemen ist keine Gewähr dafür, dass das Endprodukt Bauwerk ebenfalls in die höchste Qualitätsstufe eingeordnet werden kann. Die Gefahr, dass Fehler gemacht und mit Mängeln behaftete Leistungen erbracht werden, steigt in dem Maße, wie die Erfahrung im Umgang mit neuen Produkten abnimmt. Die Bauaufsicht kann hier regulierend wirken. Die Möglichkeit der ausreichend sicheren baupraktischen Anwendung, die Qualifikation der am Bau Tätigen, das Fehlerrisiko und andere die Anwendungssicherheit beeinflussende Faktoren müssen wesentliche Entscheidungskriterien für „Zulassungen“ sein. Der Verzicht auf die extensive Nutzung aller Vorzüge neuer Baustoffe oder Bauarten zum Vorteil der Anwendungsund Gebrauchssicherheit ist sowohl aus technischer als auch aus wirtschaftlicher Sicht die bessere Lösung. Bauwerke lassen sich nur mit wachsender, nicht aber mit sinkender Erfahrung dauerhaft und sicher gestalten.
Bild 2. Eine vorgegebene Betondeckung ist nur dann als Korrosionsschutz ausreichend, wenn sie auf der Baustelle eingehalten wird. Kunststoff-Abstandhalter sollten verboten sein
Bild 3. Qualitätskreis für Leistungen im Rahmen der Bauwerk-erhaltung – die Randstreifen markieren, wann physikalische Prüfungen durchzuführen sind
5 Qualitätssicherung
Ohne fundierte Kenntnisse in Bauphysik, Bauchemie und Baustoffkunde ist eine fehlerfreie Planung und schadensfreie Bauausführung nicht möglich.
Um Qualität zu erreichen, ist neben den organisatorischen und verfahrensbezogenen Elementen der Qualitätssicherung vor allem immer wieder die Person des Mitarbeiters von Bedeutung. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, geeignetes Personal mit besonderer Sorgfalt auszuwählen und die eingestellten Mitarbeiter in speziellem Maße zu schulen und zu betreuen, ihnen Lernfortschritte und Erfolgserlebnisse zu vermitteln, um ihre Leistungsfreude zu erhalten.
Qualitätssicherung ist eine Denkweise. Sie muss das ganze Unternehmen durchdringen. Sie erfordert Konsequenz in der Planung und Kompromisslosigkeit in der Durchführung.
6 Hightech-Baukonstruktionen
Der Begriff „Hightech“ beschreibt das Resultat Technischen Fortschritts. „Technischer Fortschritt“ hat neben quantitativen und qualitativen Aspekten eine wertende Komponente. Der jüngste Zustand der Technik wird als der bessere angesehen. In unserer Gesellschaft ist die Vorstellung unbewusst wirksam, dass altgewohnte Techniken. z. B. Webstuhl, Pflug und Windrad, human, neue Techniken, z. B. Atomtechnik und Raumfahrt, nicht human sind. Dieser Vorstellung ist zu widersprechen. Entscheidend ist nicht die Vollkommenheit der Technik, sondern die Vernunft ihres Gebrauchs (Karl Steinbuch) [24].
Die Technik ist in allen Gesellschaften das Ergebnis menschlichen Handelns, das die eine oder andere Wirkung herbeiführen will. Die Auswahl technischer Aktivitäten und ihre Weiterführung oder Beendigung ist die Folge menschlichen Verhaltens.
Das Negative, das in der Öffentlichkeit oftmals „der Technik“ zur Last gelegt wird, ist vorwiegend durch das versäumte Nachdenken der Verantwortlichen über die Folgen der Technik begründet.
Die Planung, der Bau und die Nutzung der gebauten Infrastrukturen sind hochkomplexe Prozesse, an denen zahlreiche Menschen mit unterschiedlichen Berufen zusammenwirken. Zwischen den verschiedenen Infrastrukturen bestehen wichtige Wechselwirkungen.
Die Infrastrukturen fördern
6.1 Baustoffe
Werkstoffe nehmen eine Schlüsselposition in der Technologie des Bauens ein. Sie bestimmen Wirtschaftlichkeit, Bauzeit, Dauerhaftigkeit und Qualität von Bauwerken. Strategische Zielrichtung im Bauwesen ist deshalb die Forschung und die Weiterentwicklung der Baustoffe (Bild 5).
Bild 4. Hightech-Bauwerke sind die Bauten am Potsdamer Platz in Berlin
Bild 5. Historiker klassifizieren traditionell die Zeitalter der Menschheit nach den Materialien ihrer Zeit. Sieben Zeitalter, drei klassische und vier moderne, lassen sich demnach erkennen. In der Jetztzeit ist Zement das am meisten verwendete Material
Die immer kürzer werdenden Zyklen zwischen den neuen Technologien bergen die Gefahr, dass nicht genügend Zeit für ihre Erprobung zur Verfügung steht. Mit Bauen assoziierten wir immer Sicherheit und Beständigkeit. Das Bauwesen erfüllte diese Forderung, indem es bewährte Konstruktionsprinzipien beibehielt und die Qualitätsforderungen an den Werkstoff dem Stand der wissenschaftlichen Erkenntnis und praktischen Erfahrung anpasste. Die Bauordnungen verankern dieses Prinzip.
Innovationen in einem Wissensgebiet rufen häufig Innovationen in einem anderen Wissenschaftsgebiet hervor. Die Elektronen-Raster-Mikroskopie in den 1930er-Jahren verhalf den Werkstoffwissenschaften, die Struktur der organischen Polymere zu erkennen und damit die Entwicklung der Kunststoffe zu ermöglichen. Neues verdankt meist Vieles dem Vater des Gedanken.
Die rapide Evolution in der zerstörungsfreien Prüftechnik in Deutschland hat auch solch einen visionären Pionier. Gerald Schickert. Er hat an der technischen Universität Berlin mit der Arbeit „Schwellenwerte in der Betondruckfestigkeit“ promoviert und begann seine berufliche Karriere 1965 in der Bundesanstalt für Materialforschung und Prüfung (BAM). Er wurde Leiter des Labors für Prüfung und Spezialanwendungen von Konstruktionsmaterialien, wurde Oberregierungsrat Regierungsdirektor und Professor, erhielt 1986 das Bundesverdienstkreuz und wurde – und das ist das Besondere – in der Gründungssitzung des Arbeitsausschusses Zerstörungsfreie Prüfverfahren in Hannover im Jahr 1987 einstimmig zum Vorsitzenden gewählt. Eine seiner ersten Amtshandlungen war, die fortlaufende Nummerierung aller Dokumente anzuordnen. Auch damit war er seiner Zeit weit voraus, denn diese Maßnahme wurde erst Stand der Technik mit der Einführung der DIN ISO 9000 Qualitätsmanagement.
Das erste ZfPBau-Symposium fand im Oktober 1985 in der BAM in Berlin statt und die besondere Wertschätzung dieses jungen Forschungs- und Entwicklungsgebiets dokumentierte sich nicht zuletzt darin, dass der Fachausschuss Bau des Deutschen Bundestags im November 1987 die BAM besuchte (Bild 6). Langsam wurde allen, auch Nichtfachleuten, bewusst, dass die Bauingenieure zusammen mit den Naturwissenschaftlern eine Stufe erreicht hatten, die es ermöglichte, in Bauteile hinein und durch sie hindurch zu sehen. Das geschah zwar sehr zum Leidwesen der normalen Baufacharbeiter, die nach dem Betonieren immer froh waren, dass der Beton mögliche Unregelmäßigkeiten unsichtbar umschlossen hatte. Die Entwicklung der Induktions-Thermografie zur Detektion der Stahlbetonbewehrung beim Bau des Kernkraftwerks Gundremmingen 1977 stieß deshalb nicht bei jedem auf Wohlwollen [6, 7].
Bild 6. Der Fachausschuss Bau des Deutschen Bundestages besucht im November 1987 die BAM, mit Franz Müntefering, 2. v. l., der von 1998 bis 1999 Bundesminister für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen war
6.2 Neue Baustoffe
Verbundbaustoffe vereinigen in sich in idealer Weise die Vorzugseigenschaften verschiedener Baustoffe. So entstehen Baustoffe, die gleichzeitig steif und duktil, wasserdicht und wärmedämmend oder hochfest und leicht sind.
Hochgezüchtete „intelligente“ Werkstoffe leiten neue revolutionäre Entwicklungen ein. Schier unendliche Werkstoffvariationen werden denkbar, wenn man Nanopartikel aus Metallen oder nichtmetallisch-anorganischen Stoffen erzeugt und sie in andere Materialien einbettet. Dann entstehen Nanokomposite. Die Grenzen zwischen den klassischen Werkstoffen Glas und Keramik, Kunststoff und Metall zerfließen. Bereits anwendungsreife, hauchdünne, unsichtbare Beschichtungen machen empfindliche Aluminiumoberflächen korrosions- und kratzfest. Damit veredelte Glas- oder Kunststoffscheiben beschlagen nicht mehr.
Smart materials, adaptive Materialien, haben keine festen Eigenschaften mehr, sondern variieren diese selbsttätig aufgrund äußerer Einflüsse. Die sich selbst abdunkelnden Gläser sind ein Beispiel dafür.
6.3 Selbstverdichtender Beton
Der Einbau von Beton mit großen Betonierkolonnen ist Vergangenheit. Die chemische Industrie hat den Fließbeton ermöglicht. Beim Messeturm in Frankfurt liefen 17.000 m3 Fließbeton in drei Tagen und drei Nächten in einem Zug in das mächtige Fundament.
Neue Superverflüssiger (Polycarboxylatether), und spezielle Zusatzstoffe (Nanosilica, Polysaccharide) führten in Japan zu leisem Beton (Selbst-Verdichtender-Beton – SVB). Superverflüssiger und ein im Trichterversuch oder im L-Box-Versuch optimierter Wasser/Pulver-Wert führen zu den Vorteilen des SVB (international: SCC: „self compacting concrete“):
Messen, den Bauablauf zu einem beherrschten Prozess machen – wer das vernachlässigt, den bestrafen diese Hochleistungsbaustoffe. Die idealen Eigenschaften des Baustoffs SVB sollten vermuten lassen, dass er weit verbreitet sei in der Anwendung. Das Gegenteil ist der Fall. Das Hightech-Produkt verlangt eine Hightech-Mannschaft, eine Hightech-Planung und eine Hightech-Baustelle.
6.4 Resistenter Beton
Forschung und Entwicklung ermöglichten immer schlankere Beton- und Stahlbetonkonstruktionen bei gesteigerter Sicherheit. Ein besonderes Beispiel dafür sind Naturzugkühltürme (Bild 8). Ihre Wanddicke beträgt bei Höhen von bis zu 165 m im Mittel nur etwa 16 cm. Ein Naturzugkühlturm ist damit vergleichsweise nicht dicker als die Schale eines Eis.
Die Beanspruchung der dünnen Schalen der Naturzug-kühltürme ist durch ihre große spezifische Oberfläche gegenüber anderen Stahlbetonbauwerken besonders hoch. Zu den allgemeinen Belastungen aus der Atmosphäre kommen die Einflüsse aus Kühlturmschwaden mit ihren geringen Härtegraden, aus Algenbewuchs und Mikroorganismen, aus stark schwankenden Temperaturen, Frosteinwirkung und besonderer Windbelastung.
Bild 7. Das Phaeno-Science-Center der irakischen Architektin Zaha Hadid aus SVB-Beton in Wolfsburg. „Ein extrem dickleibiges zyklopisches Betongebilde, anmutend wie eine urzeitlich schwerfällige Monade oder Molluske, zeigt es näher betrachtet und begangen mitreißende Dynamik“ (Dieter Bartetzko, FAZ)
Bild 8. Kühlturm Neurath aus säurewiderstandsfähigem Beton
Zu den normalen Beanspruchungen kommen weitere hinzu: In Kohlekraftwerken werden die Rauchgase in Wäschern weitgehend gereinigt und dann über Kühltürme abgeleitet. Für den damit verbundenen sauren Angriff muss Beton widerstandsfähig gemacht werden. Die Betontechnologie ermöglicht das. Wo sorglos gearbeitet wurde, kann Beton mit Kunstharzbeschichtungen in geeigneter Weise nachträglich geschützt werden. Ziel ist aber – wie bei Bauwerken des Umweltschutzes – ein von Natur aus dichter und widerstandsfähiger Beton.
Die neueste Entwicklung ist der säurewiderstandsfähige Beton (SWB). Er nutzt konsequent die dichteste Packung sowohl für den Zuschlag nach der Sieblinie von Fuller und Thompson als auch für das Bindemittel aus Zement, Flugasche und Mikrosilika. Ein extrem niedriger Zementgehalt (etwa 220 kg/m3) führt zu Festigkeiten von 100 N/mm2. Mit dem SRB 85/35 wurde der höchste Kühlturm der Welt in Niederaußem westlich von Köln gebaut, 200 m hoch, ohne Innenbeschichtung und säureresistent [23]. Für den bauaufsichtlichen Sicherheitsnachweis der Kühlturmschale und des Betons waren die Mess- und Prüfergebnisse die bestimmenden Regelgrößen. Um die Streuung der Qualitätseigenschaften zu minimieren, wurde eine eigene Mischanlage nur für den Kühlturmbeton auf der Baustelle aufgestellt.
Die schnelle Umsetzung von Forschungsergebnissen in neue Produkte und Verfahren ist Voraussetzung für die Wettbewerbsfähigkeit innovativer Unternehmen.
Ein Unglücksfall, der Einsturz der Eissporthalle in Bad Reichenhall, führte zu der Verpflichtung zu mehr Eigenverantwortung von Gebäudeeigentümern. Den Bedarf des Einsatzes zerstörungsfreier Prüfverfahren steigern die von der Bauministerkonferenz (BMK) der Länder 2006 verabschiedeten „Hinweise für die Überprüfung der Standsicherheit von baulichen Anlagen durch den Eigentümer/Verfügungsberechtigten“. Danach sind die zu überprüfenden Bauwerke Versammlungsstätten für mehr als 5000 Personen, bauliche Anlagen mit über 60 m Höhe, Gebäude mit Stützweiten über 12 m und Auskragungen über 6 m sowie großflächige Überdachungen oder exponierte Bauteile von Gebäuden mit besonderem Gefährdungspotenzial, wie Fernsehtürme, Hochhäuser, Hallenbäder, Einkaufsmärkte, Mehrzweckhallen, Kinos, Theater und Schulen.
7 Klassische Messprobleme
Monitoring ist die kontinuierliche und automatisierte Erfassung, Speicherung, Weiterleitung von Informationen über Einwirkungen, Beanspruchungen und den Zustand einer Bauwerksstruktur mit dem Ziel, insbesondere schädigende oder gefährdende Einflüsse und Entwicklungen in ihrer zeitlichen Entwicklung zu erkennen und ggf. zu informieren, um daraus Aussagen zur Tragfähigkeit und ggf. weitere Maßnahmen abzuleiten [10].
Zuverlässigkeitstheoretische Berechnungen stellen hohe Anforderungen an die Eingangsdaten, die als Zufallsgrößen oder Zufallsfunktionen auftreten. Späthe gibt in [5] Informationen für Verteilungstypen und statistische Parameter für die wichtigsten Baumaterialien und Lasten, über ihre Größenordnungen der Streuungen und Verteilungstypen. Das ersetzt aber keinesfalls die eigenen Bemühungen zur Datenbeschaffung als Grundlage für zuverlässigkeitstheoretische Untersuchungen. Manchmal existiert für ein zu untersuchendes Objekt nicht einmal mehr eine statische Entwurfsberechnung. Das läuft dann auf die Erstellung einer neuen statischen Berechnung hinaus.
In der Ingenieurpraxis ist es nicht unüblich, Sicherheitsaussagen von geschädigten Tragwerken allein aus Computersimulationen oder probabilistischen Abschätzungen zu gewinnen, ohne Kontrollabgleiche eines Monitorings oder von am Bauwerk ermittelten relevanten Messwerten [8]. Den berechneten Aussagen fehlt die Vertrauens-Verknüpfung mit dem wirklichen Tragwerk.
Bild 9. Messaufgaben für die zerstörungsfreie Prüfung im Stahlbeton- und Spannbetonbau [4]
Harte, Krätzig und Laermann [9] ist zuzustimmen, dass sich ein Sicherheitsmanagement, allein auf das Bauwerksmonitoring bezogen, nicht verwirklichen lässt. Den Messwerten fehlt der Bezug zur Tragwerkssicherheit. Ohne beide Komponenten, Computersimulationund Zustandsmonitoring, d. h. ohne den Abgleich zwischen Modell und Realität, lässt sich eine von Sicherheitsbeurteilungen erwartete Genauigkeit nicht erreichen.
Neben den mechanischen und elektrischen Messverfahren setzen sich optische Verfahren stärker durch, besonders Lichtwellenleiter. Bei den faseroptischen Verfahren wird der in der Nachrichtentechnik unerwünschte Einfluss mechanischer Beanspruchungen auf die Signalübertragung in Lichtwellenleitern (LWL) als Sensoreffekt genutzt.
Ein vielseitig einsetzbares faseroptisches Verfahren für Dehnungsmessungen basiert auf Fiber-Bragg-Gratings [11, 12]. In eine Faser sind äquidistant Gitter eingeprägt, die abgestimmt sind auf Wellenlängen des Laserlichts, auf die Periode der Gitterlinien und auf den Brechungsindex des Fasermaterials. Wird Licht aus einer Breitbandquelle in die Bragg-Gitter-Faser eingeleitet, so wird durch jedes einzelne Gitter eine Schmalband-Komponente reflektiert, die der eingestellten Wellenlänge des jeweiligen Gitters entspricht. Dehnungen der Faser ändern die Abstände der Gitterlinien. Damit verschiebt sich die Wellenlänge des reflektierten Lichts in Abhängigkeit von der an der Stelle induzierten mechanischen Dehnung. Ein Rechner fragt die einzelnen Gitter ab. Damit können statische und dynamische Wirkungen auf die Dehnungen erfasst werden.
Für Schwingungsmessungen setzt sich das laserbasierte, berührungslos arbeitende optische Verfahren der Laser-Vibrometrie wegen seiner breiten Einsatzmöglichkeiten auch in der Tragwerksüberwachung immer stärker durch.
8 Verfahren zur In-situ-Messung von Zustandsgrößen
Mit Methoden der Messtechnik sowie zugehörigen Messgeräten und Messsystemen lassen sich Überwachungssysteme zur Beobachtung des Verformungsverhaltens auch komplexer Tragwerke für die beschriebenen Aufgaben installieren. Die Verfahren beruhen auf unterschiedlichen physikalischen Messprinzipien und sind in diesem Bauphysik-Kalender beschrieben.
Zur Konzipierung eines integrierten Sicherheitsmanagements kommen Kombinationen verschiedener Messverfahren und Sensoren in Betracht. Deren Wahl hängt von vielen Faktoren ab, von der Art des Tragwerks, ob Neubau oder Bestand, vom Grad der Schädigung, von der Kontrolle der Ertüchtigungsmaßnahmen und von den Umgebungs- und Überwachungsbedingungen.
Des Konstrukteurs Albtraum bleibt: Habe ich richtig gerechnet? Habe ich richtig bemessen? Des Konstrukteurs Traum bleibt: Kann ich das, was ich gerechnet habe, messen? Kann ich den Spannungszustand auf besonders einfache Art erfassen, am besten nur durch Betrachten der Oberfläche. Der Arzt hat dem Konstrukteur hier einiges voraus: Ein erfahrener Arzt sieht dem Patienten an, was ihm fehlt. Ein Blick ins Auge, ein Blick auf die Haut, manches Phänomen verrät, welche Ursache im Inneren verantwortlich ist.
Auch Bauwerke, Bauteile oder Bauelemente spiegeln an ihrer Oberfläche wider, was sie in ihrem Inneren stresst. Einer Erkennung sich hartnäckig widersetzend sind die Eigenspannungen: Verharren in Schreckstarre, unentdeckt bleiben, das beobachtet man bei manchen Tierarten und auch Menschen.
Bei Spannungsänderungen sieht die Sache einfacher aus. Leicht zu erfassen sind hier die Phänomene trotzdem nicht. Die Betrachtungen am Riss mithilfe der Bruchmechanik beweisen das. Im Inneren eines Körpers herrscht ein ebener Dehnungszustand. Das bedeutet, orthogonal zu der Ausbreitungsrichtung eines Risses treten Spannungen auf. Um die Spitze eines Risses an der Oberfläche eines Bauteils herrscht dagegen ein ebener Spannungszustand vor. Das bedeutet, orthogonal zu der Oberfläche sind die Spannungen null. Deshalb ist hier bei ebenem Spannungszustand der Dehnungszustand uneben. Auch wenn kein Riss vorliegt, sind die Ausbeulungen in der Oberfläche durch die unterschiedlichen Spannungen in den verschiedenen Richtungen unterschiedlich deutlich ausgeprägt. Das müsste mit den empfindlichen heute zur Verfügung stehenden Messmethoden messbar sein.
Wenn man das Kristallgitter eines Metalls vermessen könnte – theoretisch ist das möglich – ließe sich aus dem Verzerrungszustand der Atome aufdie Eigenspannungen im Material schließen.
Wenn man die Oberfläche eines Bauteils betrachtet, so liegen hier spannungsabhängig Erhebungen und Senken vor. Wenn man sehr genau hinschauen könnte, im Nanometerbereich, im fast atomaren Bereich, müsste man mit dem Laservibrometer bei Aufsicht auf die Oberfläche diese Verformungen sehen können.
Durch ein Material hindurchlaufende Wellen verformen das Material wellenförmig, ebenso wie Wasserwellen die Oberfläche eines Wasserspiegels wellenförmig verformen. Mechanische Wellen, durch Hammerschlag erzeugt, oder akustische Wellen, durch Ultraschall erzeugt, laufen wellenförmig durch ein Material hindurch. Auch an den Oberflächen des Materials bilden sie sich in einer charakteristischen Art aus. Oberflächenwellen kann man erzeugen und hinsichtlich ihrer Laufgeschwindigkeit und ihrer Amplitude messen [13]. Kann man deshalb auch von außen, auf seiner Oberfläche, die Spannung in einem Bauteil sehen? Man kann es, wie es in einer Forschungsarbeit an geschosshohen Betonscheiben mit der Laservibrometer-technik und der Ultraschalltechnik gezeigt wurde. Die Spannungssensitivität kann in Abhängigkeit von Wellenart, Mess- und Polarisationsrichtung optimiert werden. Die spannungsabhängigen Effekte der Ausbreitungsgeschwindigkeit elastischer Wellen können dargestellt und interpretiert werden. Die lineare Theorie der Verformungen, der akustoelastische Effekt und der Einfluss von Mikrorissen sind die Grundlagen und die Einflüsse, die für die Interpretation der Versuchsergebnisse benötigt werden.
Es scheint nicht ausgeschlossen, dass in Zukunft Bauteile ihre Überlastbereiche, wenn man sie durch eine „Laservibrometer-Brille“ betrachtet, zu erkennen geben.
9 Innovationen in der Bauwerkdiagnostik
9.1 Impact-Echo
Das Impact-Echo-Verfahren (IE-Verfahren) gehört zu den aktiven Ultraschallverfahren, Dabei wird akustische Energie über einen Impact, einen mechanischen Puls, einen Schlag mit einer kleinen Metallkugel, in das Bauteil eingetragen. Im Gegensatz zu den Durchschallungsverfahren, bei denen sich Sender und Empfänger auf gegenüberliegenden Seiten befinden, ist hier ein Zugang zu beiden Bauteilseiten nicht erforderlich.
Die durch den akustischen Impuls erzeugte Schallwelle breitet sich im Beton aus und wird an Grenzflächen, z. B einem Hohlraum oder einer Rückwand, reflektiert. Im Bauteil entstehen dadurch Mehrfachreflexionen niederfrequenter transienter Wellenfelder, die zu stehenden Wellen führen. Die Auswertung erfolgt anschließend im Frequenzbereich und nicht wie beim Impuls-Echo-Verfahren im Zeitbereich. Messungen mit dem Impact-Echo-Verfahren sind vergleichsweise schnell durchführbar und weisen anderen Verfahren gegenüber eine sehr gute Reproduzier- und Wiederholbarkeit auf. Das Impact-Echo-Verfahren wurde Mitte der 80er-Jah-re in den USA von Carino und Sansalone entwickelt. Sansalone und Street betrachteten den wissenschaftlichen Teil der Arbeiten Ende der 90er-Jahre als mehr oder weniger abgeschlossen, was sie in einem Artikel mit dem Titel „lmpact-Echo – the complete story“ im Jahr 1997 besiegelten. Viele Wissenschaftler teilten diese Meinung nicht, sie forschten weiter [21].
Bei der zerstörungsfreien Prüfung von Betonbauteilen mit dem Impact-Echo-Verfahren bietet das Ausbreitungsverhalten der akustischen Wellen Anlass zur Diskussion und weiterer Erforschung. Grund dafür ist die inhomogene Struktur des Betons und die Tatsache, dass die Wellenausbreitung im Bauteilinneren nicht direkt zu beobachten ist, sondern dass lediglich indirekt anhand der Ankünfte an der Oberfläche auf sie zurückgeschlossen werden kann.
Nur 7% der durch die Erregung in das Bauteil eingetragenen Energie breiten sich als Longitudinalwelle aus, 26% propagieren als Transversalwelle. Der größte Teil, 67%, breitet sich in Form von R-Wellen aus, welche für die ungewollten Geometrieeffekte verantwortlich sind. Aufgrund dieses Verhältnisses ist Geometrieeffekten bei IE-Messungen an kompakten Bauteilen eine hohe Bedeutung beizumessen, da sie den Nutzen der Methode limitieren. Geometrieeffekte zu verringern oder zu eliminieren bleibt daher ein elementarer Bestandteil für die Optimierung des Verfahrens.
Bei einfachen Anwendungen, z. B. der Dickenmessung einseitig zugänglicher Betonplatten ist Impact-Echo mit hoher Zuverlässigkeit anwendbar.
Die Kombination der „Empirical Mode Decomposition“ (EMD) mit der anschließenden Hilbert-Transformation ermöglicht aber eine neue Art der Datenauswertung. Die EMD kann auch bei sehr verrauschten bzw. von Störgerä uschenüberlagerten Signalen noch eine wertvolle Auswertung zulassen [14].
Aufgrund der inhomogenen Struktur des Betons ist die Dämpfung der akustischen Wellen beträchtlich. Die Longitudinalwellen, auf deren Nutzung das Verfahren basiert, tragen bei der Impulsanregung die geringste Energie bei.
Die Amplitude der nutzbaren Longitudinalwellen nimmt im Volumen stärker ab als die der Rayleighwellen, welche sich nur an der Bauteileoberfläche ausbreiten und betragsmäßig wie angegeben den höchsten Energieanteil besitzen. Das hat zur Folge, dass das aus Longitudinalwellen-Reflexionen gewonnene periodische Nutzsignal mit zunehmender Signallänge durch das Störsignal der Rayleighwellen überlagert wird. Die resultierenden Impact-Echo-Signale sind damit transient.
Bild 10. Visualisierung von Impact-Echo-Daten. Impact-Echogramm als Schnitt durch das Bauteil über die Tiefe in Grauwertdarstellung; die zeilenförmige Anordnung der Messlinien ermöglicht auch die Erstellung von Tiefenschnitten (rechts) [14]
Beton enthält eine Vielzahl kleiner Diskontinuitäten, wie beispielsweise Luftporen und Mikrorisse. Schallwellen mit Wellenlängen von etwa 2 cm – entsprechend Frequenzen von 200 kHz oder größer – werden an den natürlichen Inhomogenitäten des Betons gestreut und besitzen somit kaum die Fähigkeit, ihn zu durchdringen. Hingegen durchdringen niedrige Frequenzen den Beton praktisch wie ein homogenes Material.
Von entscheidender Bedeutung für die Dickenbestimmung bzw. Fehlstellenlokalisation ist das Verhalten der Schallwellen an Grenzflächen. Die hierbei relevante Größe ist der Unterschied in den akustischen Impedanzen (Schallwellenwiderstände) der angrenzenden Materialien, den Produkten aus der Dichte p und den Wellengeschwindigkeiten cp.
Durch den Einsatz eines scannenden Laservibrometers konnte eine zweidimensionale Visualisierung der Wellenausbreitung durch das Bauteil erzeugt werden. Es werden die durch die mechanische Anregung erzeugten Wellenarten – Longitudinalwellen, Transversalwellen und Oberflächenwellen – experimentell erkannt. Dabei sind die Rayleighwellen dominant, was im Allgemeinen zu einer massiven Überlagerung der periodischen Lon-gitudinalwellenreflexionen durch Geometrieeffekte führt. Durch die Autokorrelation werden periodische Anteile des Signals verstärkt und nichtperiodische gedämpft. Durch die Anwendung dieser Auswertungsmethode gelingt es, den Einfluss von Geometrieeffekten zu reduzieren und das Signal-Rausch-Verhältnis zu verbessern. Die Anwendung der Hilbert-Huang-Transformation ermöglicht die Identifikation auch kurzzeitiger Nutzsignale, die bei einer herkömmlichen FFT-Auswertung verborgen bleiben. Sie stellt eine moderne Form der kombinierten Zeit-Frequenz-Analyse dar [14].
9.2 Betondruckfestigkeit
Es interessiert die Frage, ob und um wie vieles besser eine Kombination zerstörungsfreier Prüfverfahren eine verbesserte In-situ-Abschätzung der Betondruckfestigkeit am Bauwerk ermöglicht. Dazu fand eine systematische Untersuchung an über 400 Betonprobewürfeln statt. Es wurden sowohl die Standardverfahren der Druckfestigkeitsprüfung als auch in der Betonpraxis weniger übliche Methoden, wie z. B. das Mikrohärte-prüfverfahren, eingesetzt. Die Zusammenhänge der Materialeigenschaften des Werkstoffs Beton wurden mithilfe von multivariaten statistischen Methoden analysiert und die Relevanz der Prüfparameter bezüglich der untersuchten Zielgröße, der Betondruckfestigkeit, untersucht. Im Mittelpunkt der statistischen Analyse stand die multivariate Betrachtung der komplexen Zusammenhänge im Beton. Die statistische Methode der Faktorenanalyse wurde benutzt, um die innere Struktur der im Feldversuch ermittelten Messwerte zu analysieren und die unterliegenden Faktoren bzw. Dimensionen zu extrahieren. Die Ergebnisse der über 400 zerstörungsfrei und zerstörend geprüften Würfel an Würfelserien der Güteüberwachung von BII-Baustellen haben gezeigt, dass für eine sinnvolle Kombination von Einzelverfahren ein grundlegendes Verständnis über die Zusammenhänge und Abhängigkeiten der Verfahren untereinander notwendig ist. Die Faktorenanalyse stellt ein statistisches Werkzeug dar, das diese Zusammenhänge aufzeigen und quantitativ erfassen kann. In den Messdaten konnten drei Faktoren identifiziert werden. Es wurde gezeigt, dass die Kombination der drei mit dem jeweiligen Faktor am stärksten assoziierten Prüfmethoden jedem Einzelverfahren überlegen war. Weiterhin ermöglichte der Einblick in die Abhängigkeiten der einzelnen Verfahren untereinander die zielgerichtete Kombination von Einzelverfahren zur Maximierung der Aussagegenauigkeit bezüglich der Betondruckfestigkeit. Für die Auswertung wurden künstliche neuronale Netze genutzt.
Motiviert durch die Erkenntnisse der Neurobiologie und kognitiven Wissenschaften der vergangenen Jahre, haben künstliche neuronale Netze Anwendung in den verschiedensten Bereichen, wie in der Qualitätskontrolle von Natursteinplatten, der Sekundärstrukturprognose von Proteinen oder der Steuerung von autonomen Fahrzeugen gefunden. Das Forschungsgebiet der neuronalen Netze kann auf eine vergleichsweise lange Tradition zurückblicken. Erste Arbeiten und wesentliche Grundlagen wurden bereits in den vierziger Jahren geschaffen. Es folgte eine frühe Hochphase mit der Entwicklung des sogenannten Perzeptrons und dessen erfolgreichem Einsatz in der Mustererkennung. Im Jahr 1969 erlitt das Forschungsgebiet jedoch einen Rückschlag durch die Erkenntnis, dass das Perzeptron als Basiselement neuronaler Strukturen für eine Reihe einfacher Probleme nicht geeignet ist. Nach diesem zunächst enttäuschenden Ergebnis erlebten die neuronalen Netze 1986 mit der Entdeckung des Backpropagation Lern-Algorithmus eine Renaissance. Dieser Lern-Algorithmus wurde auch für die Bestimmung der Betondruckfestigkeit angewendet [15].
Die mit den neuronalen Netzen erzielten Ergebnisse zeigen, dass eine wesentliche Verbesserung in der Abschätzung der Druckfestigkeit gegenüber den linearen Kombinationen bei der Abschätzung der Betondruckfestigkeit möglich ist.
Um eine weitere Verbesserung der Aussagegenauigkeit und die damit verbundene Verringerung des Restfehlers von Kombinationsverfahren zu erreichen, bieten sich zwei Möglichkeiten:
Insbesondere das erste Optimierungspotenzial verspricht die Steigerung der Aussagegenauigkeit, indem die heute gebräuchlichen zerstörungsfreien Prüfverfahren weiterentwickelt und durch neue Methoden ergänzt werden. Obwohl es gelungen ist, mit dem Mikrohärte-verfahren eine neue Prüfmethode einzuführen, besteht nach wie vor Bedarf, weitere praxisgerechte und zuverlässige Einzelverfahren zu entwickeln. Dabei ist es unwahrscheinlich, dass es nicht ein einzelnes Prüfverfahren gibt, das die Variabilität der gebräuchlichen Betone über den gesamten Festigkeitsbereich gleichermaßen abdecken kann. Die Entwicklungsbemühungen sollten darum nicht auf Einzelverfahren beschränkt sein, sondern auf Verfahren, die eine differenzierte Prüfung der wichtigen und im Sinne eines Kombinationsverfahrens signifikanten Materialeigenschaften ermöglichen [15].
9.3 Schall
Pfähle tragen Bauwerke. Wie sicher tragen Pfähle Bauwerke? In situ gebohrt und betoniert oder als Fertigpfahl gerammt – was weiß man nach dem Setzen über die Funktionsqualität des im Boden verborgenen Pfahls? Eine Probebelastung bringt Aufschluss, ist aufwendig und wird selten angewandt. In Malaysia, nicht in Deutschland, ist es Vorschrift, jeden Pfahl auf seine Integrität zu prüfen.
Die Zustandsuntersuchung entspricht einer Integritätsprüfung. Zerstörungsfreie Prüfungen sind es, die zur Schadensdiagnose und Bauwerksanalyse eingesetzt werden und einen entscheidenden Beitrag zur Qualitätssicherung im Bauwesen leisten.
In Abhängigkeit von der Geometrie des durchschallten Körpers entstehen unterschiedliche Wellenarten, die sich mit verschiedenen Geschwindigkeiten fortpflanzen. Die Methoden der Auswertung basieren auf der Theorie der eindimensionalen Wellenausbreitung und setzen die Kenntnis der Eigenschaften des Pfahlbaustoffs und des Baugrunds voraus.
Bei dem Auftreffen von Wellenfronten auf Grenzflächen oder Inhomogenitäten werden die Eigenschaften des Wellenzugs verändert. Bei lmpedanzwechseln erfahren Wellen Reflexion, Transmission und Refraktion. Aus Gleichgewichtsgründen entstehen dadurch neue Wellenanteile, die sich nicht nur in Längsrichtung ausbreiten. Außerdem sind die Wellenfronten nicht eben.
Zur Analyse der Wellenausbreitung ist eine dreidimensionale Abbildung des Pfahl-Boden-Systems notwendig. Das setzt jedoch eine entsprechende Modellbildung und die genaue Kenntnis der Pfahl- und Bodeneigenschaften voraus.
Angewandt werden das Low-Strain-Verfahren (Hammerschlagmethode) und das High-Strain-Verfahren der dynamischen Pfahlprüfung. Grundelemente des Messsystems sind in Betonpfähle einbaubare faseroptische Sensoren.
Für faseroptische Sensoren stellt diese Messaufgabe eine neuartige Anwendung dar, sodass zunächst gesicherte Erkenntnisse zum Dehnungs-Übertragungs-Verhalten erarbeitet werden müssen.
Die Auswertungen der Feldversuche zeigen, dass extrinsische Fabry-Pérot-Interferometer (EFPI-Sensoren) auch unter realen Baustellenbedingungen geeignet sind, Pfahlverformungen bei den Wellenausbreitungsvorgängen dynamischer Pfahlprüfung, aber auch bei statischer Belastung zu erfassen. Die Funktionalität der Sensoren konnte in einer Forschungsarbeit auch bei der hohen Beanspruchung bei der Pfahlrammung nachgewiesen werden. Die geringen beim Low-Strain-Verfahren auftretenden Verformungen konnten bis in große Tiefe einwandfrei gemessen und interpretiert werden.
Ergänzend zu den Erkenntnissen aus den Modellpfahlversuchen folgt aus der Bestimmung der Wellengeschwindigkeit einzelner Pfahlabschnitte, dass bei Anwendung des Low-Strain-Verfahrens Pfahlfußreflexionen, die aus dem Geschwindigkeits-Zeitverlauf vom Pfahlkopf nicht zuverlässig hervorgehen, erst durch die Auswertung der Messungen im Pfahlinneren eindeutig bestimmt werden können [16].
9.4 Ultraschall
Dem „Pull“ aus der Praxis, der Forderung schneller, besser, tiefer, begegnet der „Push“ aus Forschung und Entwicklung mit der sich kontinuierlich steigernden Leistungsfähigkeit der zerstörungsfreien Prüftechnik.
Ein besonders leistungsfähiges ZfP-Verfahren in der Qualitätssicherung im Bauwesen, in der Medizintechnik und bei der Zustandsuntersuchung bestehender Bausubstanz ist das Ultraschallverfahren. Nachteilig bei seiner Anwendung ist die erforderliche Ankopplung des Schallkopfs an die zu untersuchende Bauteiloberfläche. Das energetisch verhältnismäßig schwache Impulssignal sollte möglichst verlustfrei in den zu durchschallenden Prüfkörper eingetragen werden. Die Kopplungsmedien Wasser oder Vaseline beschränken sich auf spezielle Anwendungsfälle, sie hinterlassen auf den Bauteiloberflächen unschöne Flecken. Die Spitzentaster sind ein willkommener mechanischer Kompromiss.
In der Umsetzung befindet sich die Idee, luftgekoppelte Ultraschallprüfköpfe einzusetzen, die genügend Schalldruck für die Anwendung bei Beton liefern, wenn sie in der Transmissionsmessung eingesetzt werden [18]. Baupraktisch interessanter ist aber die Echo-Messung. Für ein luftgekoppeltes Ultraschallechoverfahren an Beton liegen vielversprechende Ergebnisse aus grundlegenden Untersuchungen zur Machbarkeit des luftgekoppelten Ultraschall-Echoverfahrens vor.
Das Longitudinalwellen-Rückwandecho bei einem Einfallswinkel von 0,5° und einem Abstand des Schalleintritts zum Schallaustrittspunkt auf der Grenzfläche Luft/Beton von 128 mm erwies sich als optimale Konfiguration der „Tandem-Schallköpfe“. Die Rayleighwelle ist bei diesem Einfallswinkel vorteilhaft nur schwach ausgeprägt. Das Transversalwellen-Rückwandecho erwies sich bei Beton als nicht geeignet. 2/3 der durch die Erregung in das Bauteil eingetragenen Energie breitete sich als R-Welle aus, 1/4 als Transversalwelle und nur etwa 10% als Longitudinalwelle.
Bild 11. Ultraschallmessungen aus der Pionierzeit [17]
Noch sind dem Verfahren wegen des hohen Brechungsindex der Grenzfläche Luft/Beton, der Anfälligkeit des Systems bei Änderungen der Luftwegstrecke und der Beschaffenheit der Körperoberfläche Grenzen gesetzt [18].
9.5 Radar – Probability of Detection (POD)
Die Leistungsfähigkeit des elektromagnetischen Radarverfahrens wird im Bauphysik-Kalender bei den ZfP-Verfahren ausführlich behandelt. Techniken auf der Basis von akustischen oder elektromagnetischen Wellen senden ein charakteristisches Signal aus, das als reflektiertes Signal empfangen und hinsichtlich seiner Aussage analysiert wird. Ultraschall und Radar sind die am häufigsten im Bauwesen angewandten ZfP-Verfahren. Für beide gilt, dass sie nie einen tatsächlichen Wert, sondern nur einen relevanten Wert in Abhängigkeit der Verfahrensparameter angeben. Weil die Verfahren indirekt messen, können die Messsignale durch fremde Einflüsse verfälscht werden. Es stellt sich deshalb die Frage nach der Aussagesicherheit. Bei der Lagebestimmung einer Stahlbetonbewehrung kommt es auf millimetergenaue Angaben an. Neben der Anzahl und der Anordnung der Bewehrungsstäbe interessieren besonders ihr Durchmesser und die Betondeckung. Die Betondeckung ist für die Bestimmung des inneren Hebelarms zur Aufnahme der Momente wichtig. Das Radarverfahren eignet sich für die Überprüfung der Stahlbetonbewehrung besonders gut. Einer der Gründe ist totale Reflektion des Radarsignals an einer metallischen Oberfläche. Welchen Einfluss die Tiefe, der Durchmesser und der Abstand der einzelnen Bewehrungsstäbe untereinander haben, wurde für die Radartechnik mit der POD-Methode (Probability of Detection) untersucht [19].
Die POD sollte eine objektive Aussage über die Anwendungsgrenzen des Impulsradars treffen. Die Ergebnisse sind derart präzise, dass die qualitativen Unterschiede der acht in einem Forschungsprojekt miteinander verglichenen Radarverfahren deutlich werden. Konsequenzen wie bei Produktprüfungen durch die Stiftung Warentest sind nicht auszuschließen.
Vier Kriterien müssen bei einer POD erfüllt sein: Zwischen den Prüfsystemantworten und der Reflektortiefe muss ein physikalischer Zusammenhang vorliegen, der auch nichtlinear sein darf. Der physikalische Zusammenhang zwischen der Reflektortiefe und der Prüfsystemantwort muss jedoch mathematisch in eine lineare Beziehung überführt werden können. Kriterium 2 fordert für jede Reflektortiefe, dass die zugehörigen Prüfsystemantworten einer normalverteilten Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion entsprechen. Kriterium 3 stellt Forderungen an die Korrelation der Prüfsystemantworten. Schließlich müssen die Varianzen der Prüfsystemantworten in unterschiedlichen Reflektortiefen über den gesamten Messbereich nahezu homogen sein. Die Bedingung ist notwendig, weil die Varianzen der Prüfsystemantworten die Grundlage für die Varianzabschätzung der normalverteilten Wahrscheinlichkeitsverteilungsfunktion der POD-Kurve bilden.
Eine POD auf statistischer Basis erfordert für jedes zu validierende Verfahren spezielle Prüfkonfigurationen. Sie ist zeitintensiv, verlangt höchste Präzision, aber sie ist aussagestark.
9.6 Thermografie
Die Thermografie entwickelte sich beim Bauen im Bestand und bei der Sanierung von Betonbauwerken zu einem etablierten Prüfverfahren. Sie erkennt Temperaturunterschiede auf Oberflächen in einer Auflösung unter 0,1 K. Die Temperaturunterschiede können sich auf natürliche Art einstellen, oder man kann sie erzwingen. Bei der passiven Thermografie nutzt man die natürliche Temperaturverteilung aus der Sonneneinstrahlung, der Änderung des Klimas oder aufgrund einer Auskühlung während der Nachtstunden. Die Temperatur auf der Oberfläche steht dabei in Wechselwirkung mit dem Inneren eines Bauteils.
Besonders aussagekräftige Thermografieergebnisse werden mit einem instationären Temperaturverlauf erzeugt, wenn künstlich Wärme zu- oder abgeführt wird. Bei der Impulsthermografie wird ein Wärmeimpuls in die Oberfläche des Betonbauteils eingeprägt. Ab dem Moment der Aufheizung verteilt sich die Wärme vor allem durch Konduktion. Die Thermografie erkennt anhand der Temperaturverteilung auf der Oberfläche, ob der theoretisch vorausgesehene Wärmefluss gestört oder ungestört verläuft. Aus den Anomalien erkennt man, welche Fehler sich unter der Oberfläche im Bauteil befinden.
Allen aktiven Verfahren ist gemeinsam, dass zunächst ein Temperaturgradient erzeugt und der nachfolgende Ausgleichsprozess über einen relevant langen bzw. kurzen Zeitraum beobachtet wird. Es gilt die Fourier’sche Differenzialgleichung für den instationären Temperaturverlauf.
Die Lock-in-Thermografie weist quantitativ für die Amplituden die thermische Eindringtiefe einer Wärmewelle nach.
Frequenzanalysen von Wärmewellen konnten erfolgreich zur Ortung von Mauerwerk und Stahl hinter Putz, Ablösungen von Natursteinplatten, Asphalt, Epoxidharz auf Beton sowie Anschlüssen in Holz in der Qualitätssicherung und der Strukturuntersuchung insbesondere an historischen Kulturgütern durchgeführt werden. Auswertbare Tiefenlagen liegen zwischen 3 und 10 cm, Erwärmungszeiten zwischen 5 und 30 Minuten und Beobachtungszeiten bei 120 Minuten [20].
Die Induktions-Thermografie erzeugt durch elektromagnetische Induktion einen Wärmefluss im Beton von innen nach außen. Berührungslos werden dazu metallische Körper induktiv erwärmt [6, 7].
Die Magnet- und Radartechnik haben das geräteaufwendige Verfahren der Induktions-Thermografie abgelöst. Für eine Hohlstellen-Kartierung einer 22.000 m2 großen Hallenfläche war die aktive Infrarotmethode (Bild 13), die prinzipiell ähnlich bewegungsaktiv wie die in Bild 12 dargestellte Betondeckungsmessung war, hingegen unschlagbar schnell und preiswert. Die Erwärmung wurde durch Wärmestrahler hervorgerufen. Mit etwas Mathematik sind der Phantasie keine Grenzen gesetzt. Es steht nun die ganze Palette der Stoffgrößen für Interpretationen zur Verfügung, die in der wunderbaren Fourier’schen Differenzialgleichung der instationären Wärmeleitung miteinander gekoppelt sind, die Temperatur, die Zeit, die Wärmeleitfähigkeit, die Rohdichte, die spezifische Wärme und die Tiefe.
Bild 12. Die Nutzung der instationären Wärmeleitung für eine schnelle großflächige Messung der Betondeckung. Der Induktor wird mit einer Geschwindigkeit von 4 cm/s von oben nach unten über die Betonoberfläche geführt. Im Wärmebild (unten links) tauchte die Bewehrung erst hinter (oberhalb) dem 1 m langen schwarzen Meterstab auf. Damit liegt sie tiefer als 13 mm gemäß dem ersten Quadranten in der Grafik [17]
Bild 13. Hohlstellen-Kartierung einer 22.000 m2 großen Hallenfläche mit der aktiven Infrarotthermografie
9.7 Belastungsversuche
Im Rahmen der baulichen Veränderung von bestehenden Gebäuden ist bei Aufhebung des Bestandsschutzes eine ausreichende Standsicherheit der verbleibenden Konstruktionen nachzuweisen. Das gilt z. B. für Geschossdecken bei einer Nutzungsänderung mit erhöhten Verkehrslasten oder für Außenwände bei einer energetischen Modernisierung. Voraussetzung für die Durchführung eines Bemessungsverfahrens ist die detaillierte Kenntnis der baukonstruktiven Gegebenheiten, jedoch sind bei älteren Gebäuden die hierfür notwendigen Informationen häufig in nur unzureichendem Umfang vorhanden. Auch mit einer stichpunktartig ergänzenden Bausubstanzanalyse kann das Tragverhalten in vielen Fällen nicht ausreichend wirklichkeitsnah modelliert werden, sodass eine Bemessung mit erheblichen Unsicherheiten behaftet wäre.
Eine Alternative ist in dem komplex prüfenden Verfahren einer Durchführung eines nicht zerstörenden Belastungsversuchs zu sehen. Die Durchführung von Belastungsversuchen ist durch die Richtlinie „Belastungsversuche an Betonbauwerken“ des Deutschen Ausschusses für Stahlbeton (DAfStb) geregelt. Die Vorbereitung, Durchführung und Auswertung ist Prüfstellen mit der notwendigen technischen Ausstattung vorbehalten und darf nur durch entsprechend qualifiziertes und erfahrenes Fachpersonal ausgeführt werden.
Die Tragfähigkeit ist nachgewiesen, wenn in dem Belastungsversuch die Versuchsziellast die Versuchsgrenzlast nicht überschreitet:
Die Versuchsziellast ist „die beim Belastungsversuch vorgesehene maximale Belastung, die sich aus den Zielen des Belastungsversuchs ergibt“ und wird aus den Einwirkungen unter Ansatz der sicherheitskonzeptionellen Vorgaben der DIN 1055-100 ermittelt.
Die Versuchsgrenzlast ist „die Belastung, bei der im Belastungsversuch gerade noch keine Schädigung auftritt, welche die Tragfähigkeit und Gebrauchstauglichkeit des Bauwerks im künftigen Nutzungszeitraum beeinträchtigt“.
Für die Durchführung der Belastungsversuche stehen mobile Versuchseinrichtungen zur Verfügung, die aus Lastrahmen und Lastverteilungsträgern bestehen. Die Lasten werden mit ölhydraulischen Druckzylindern aufgebracht. Die Reaktionskräfte der Lastrahmen werden in ausreichend belastbare Bauteile außerhalb der Prüffelder geleitet (Bild 14) [22]. Der besondere sicherheitstechnische Vorteil des Verfahrens liegt in der augenblicklich zurücknehmbaren Prüflast.
Bild 14. Versuchseinrichtung mit drei Lastrahmen (grün) und einer entkoppelten Messbasis (gelb) auf einer Stahlsteindecke. Die Lastrahmen ermöglichen bei statisch bestimmter Lagerung und jeweils acht weitgehend variablen Lasteinleitungspunkten eine sehr gleichmäßige Belastung der Prüffelder. Die Durchbiegungen werden mit induktiven Wegaufnehmern und die Lasten mit Kraftmessdosen aufgenommen
10 Schlussfolgerung
Werkstoffe des Bauwesens, Baukonstruktionen und zerstörungsfreie Prüfverfahren bilden eine Einheit. Diese Einheit gewährleistet den hohen Sicherheitsstandard für die gebaute Infrastruktur. „Wer baut, der glaubt an morgen – wer nicht baut, hat keine Zukunft“. Die Bauaufgaben für eine wachsende Weltbevölkerung nehmen kontinuierlich zu. Städte wie Tokio werden innerhalb von 30 Jahren einmal komplett neu gebaut. Jeder Eingriff in die Bausubstanz ist heute bereits von einem Einblick in die Tiefe mithilfe zerstörungsfreier Prüfverfahren begleitet. Der Bauingenieur steht zu seinem Bauwerk wie der Arzt zu seinem Patienten. Die Einschätzung des Gesundheitszustands sollte so schmerzlos wie möglich, so gründlich wie möglich und so berührungslos wie möglich durchgeführt werden können. Und weil in unserer Zeit Informationen auch einen geldwerten Vorteil bedeuten, wird sich das Gebiet der zerstörungsfreien Prüftechnik nicht zuletzt wegen des ständig steigenden Sicherheitsbedürfnisses der Menschen weiterentwickeln und dadurch auch dem Bauwesen immer neue Chancen eröffnen. Bauen und Prüfen wurden zu unzertrennlichen Zwillingen.
11 Literatur
[1] Duddeck, H.: Aus Schaden wird man klug? Wie Technik Wissen gewinnt. In: acatech diskutiert, Technologisches Wissen, Klaus Kornwachs (Hrsg.). Springer Verlag, Berlin 2010.
[2] Rehm, G.: Der technische „Fortschritt“ – eine Ursache für Bauschäden? Festschrift „Vom Werkstoff zur Konstruktion“ für Prof. Dr. -Ing. Hubert K. Hilsdorf zum sechzigsten Geburtstag. Hrsg. Dr. -Ing. Jörg Kropp. Ernst & Sohn, Berlin, Mai 1990.
[3] Matousek, M., Schneider, J.: Maßnahmen gegen Fehler im Bauprozess. Schweizer Ingenieur und Architekt, 1988.
[4] Schießl, P., Volkwein, A.: Aufgaben für die Zerstörungsfreie Prüfung im Stahlbeton- und Spannbetonbau. DGZfP-Berichtsband der Fachtagung Bauwerksdiagnose. Praktische Anwendungen Zerstörungsfreier Prüfungen, 21.–22. Januar 1999, München.
[5] Späthe, G.: Die Sicherheit tragender Baukonstruktionen. Springer Verlag, Wien 1992.
[6] Hillemeier, B., Müller-Run, U.: Bewehrungssuche mit der Thermographie. Beton- und Stahlbetonbau (1980), Heft 4, S. 83–85.
[7] Hillemeier, B.: Induktionsthermographie zur Ortung von Bewehrungsstählen. In: Zerstörungsfreie Prüfung im Bauwesen. Tagungsbericht ZfPBau-Symposium 2. und 3. Oktober 1985, Berlin. Hrsg.: G. Schickert, D. Schnitger, BAM, DGZfP, Berlin 1986, S. 178–192.
[8] Hillemeier, B.,: Zustandsanalyse von Spanngliedern in Spannbetonbauwerken. Fachtagung Bauwerksdiagnose, Deutsche Gesellschaft für zerstörungsfreie Prüfung E. V., Berlin, Februar 2012.
[9] Harte, R., Krätzig, W., Laermann, K-H.: Integriertes Sicherheitsmanagement alternder Bauwerke durch Computersimulation und Zustandsmonitoring. VDI Bautechnik Jahrbuch 2006/2007, S. 13–29.
[10] Roloff, J., Kohlbrei, U.: Monitoring als Grundlage für effektive Instandhaltung – Neue Wege bei der Bauwerkserhaltung. VDI Bautechnik Jahrbuch 2006/2007, S. 66–77.
[11] Habel, W.: Neue Möglichkeiten der Zustandsüberwachung durch strukturintegrierte faseroptische Sensoren. VDI Bautechnik Jahrbuch 2006/2007, S. 51–65.
[12] Schuler, S., Hillemeier, B., Fuhrland, M. et al.: Untersuchung betontechnologischer Fragestellungen mit Hilfe eingebetteter flexibler faseroptischer Fabry-Pérot-Interferometer. TM Technisches Messen 76 (2009), Heft 11, S. 517–526.
[13] Zoega, A.: Spannungsabhängigkeit von Eigenschaften elastischer Wellen im Beton. Dissertation, Technische Universität Berlin und BAM Berlin, 2011.
[14] Algernon, D.: Impact-Echo: Analyse akustischer Wellen in Beton. Dissertation, Technische Universität Berlin und BAM Berlin, 2006.
[15] Rösch, A.: Die zerstörungsfreie In-Situ-Bestimmung der Betondruckfestigkeit. Dissertation, Technische Universität Berlin, 1999.
[16] Schallert, M.: Adaption faseroptischer Mikrodehnungs-aufnehmer für die Bewertung der Struktur von Betonpfählen und der Pfahl-Boden-Interaktion. Dissertation, Technische Universität Braunschweig und BAM Berlin, 2009.
[17] Schickert, G.: Bauwerksdiagnose. ZfPBau-Fachtagung, BAM Berlin, 18. Februar 2010.
[18] Gräfe, B.: Luftgekoppeltes Ultraschallecho-Verfahren für Betonbauteile. Dissertation, Technische Universität Berlin und BAM Berlin, 2008.
[19] Feistkorn, S.: Gütebewertung qualitativer Prüfaufgaben in der zerstörungsfreien Prüfung im Bauwesen. Dissertation, Technische Universität Berlin und BAM Berlin, 2012.
[20] Arndt, R.: Adaption der Puls-Phasen-Thermografie für die qualitative und quantitative zerstörungsfreie Prüfung oberflächennaher Strukturen im Bauwesen. Dissertation, Technische Universität Berlin und BAM Berlin, 2007.
[21] Große, C., Wiggenhauser, H., Algernon, D. et al.: Impact-Echo, Stand der Technik und Anwendungen des Verfahrens. Fachtagung des DAfStb mit der BAM, Zerstörungsfreie Prüfverfahren und Bauwerksdiagnose im Betonbau, Berlin, 2005.
[22] Vogdt, F.-U., Schober, M.: Belastungsversuche zum Nachweis der Tragfähigkeit von Decken- und Außenwandkonstruktionen. Die Bauphysik (2012), (in Vorbereitung).
[23] Hillemeier, B., Hüttl, R.: Hochleistungsbeton – Beispiel Säureresistenz, Betonwerk und Fertigteil-Technik (2000), Heft 1, S. 52–60.
[24] Steinbuch, K.: Der Technische Fortschritt. In: Programm 2000, Deutsche Verlags-Anstalt Stuttgart, 1970
A 2Gebäudediagnostik als Bestandteil ganzheitlicher Modernisierungskonzepte
Ganzheitliche energetische Modernisierung am Beispiel der denkmalgeschützten Hohenzollern-Höfe in Ludwigshafen
Werner Dorß, Ulrich Baum, Antonio Wehnl, Peter Hildenbrand
Inhaltsverzeichnis
1 Ausgangslage
1.1 Einleitung
1.2 Denkmalschutz und erhaltenswerte Bausubstanz – Bedeutung im deutschen Immobilienbestand
1.3 Energiepreisentwicklung als Motor der energetischen Sanierung
1.4 Denkmalschutz zwischen Wirtschaftlichkeitsgebot und den Anforderungen der Gegenwart
1.5 Anforderungen des Denkmalschutzes und des Energieeinsparrechts
1.6 Denkmalschutz im Spannungsfeld zwischen Gestaltungswert, Substanzwert, Energieeffizienz und der Verwendung erneuerbarer Energien
1.7 Der neue Fachverband Innendämmung (FVID) e. V. – eine Interessengemeinschaft für Qualitätsstandards und Gütesicherung
2 Methoden zur ganzheitlichen und nachhaltigen Modernisierung
2.1 Definition von Ganzheitlichkeit/Nachhaltigkeit
2.2 Systematik einer ganzheitlichen Methodologie für energieeffiziente Modernisierungen
2.2.1 Analysemethoden einer ganzheitlichen Immobilienentwicklung
2.2.1.1 Umfeldanalyse
2.2.1.2 Immobilien-Portfolioanalyse
2.2.1.3 Machbarkeitsstudie für Ermittlung der optimalen energetischen Modernisierung
2.2.1.4 Ergänzende Nutzwertanalyse zur finalen Entscheidungsfindung
2.2.2 Projektbegleitung als eine zwingende Maßnahme der Qualitätssicherung bei der Planung und Umsetzung
2.2.3 Qualitätssichernde Maßnahmen nach Umsetzungsbeendigung
3 Projektbeispiel Hohenzollern-Höfe in Ludwigshafen
3.1 Geschichte der Hohenzollern-Höfe
3.2 Konzept – Architektur – Zukunft
3.3 Ganzheitliche Bestandsaufnahme / Bauphysikalische Entscheidungskriterien
3.4 Gebäudebewertungen vor und nach der Modernisierung
3.5 Ausgangssituation / Entscheidungsvorbereitungen
3.6 Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen / Kaufkraft der Mieter im Quartier
3.7 Gebäudehülle mit Innen- und Außendämmung
3.7.1 EnEV und Denkmalschutz
3.7.2 EEWärmeG und Denkmalschutz
3.7.3 Denkmalschutz und Steuergesetzgebung
3.7.4 Förderung von Maßnahmen zur Steigerung der Gebäudeenergieeffizienz bei Baudenkmälern und erhaltenswerter Bausubstanz durch Fördermittel der öffentlichen Hand
3.7.5 Überblick über relevante Normen, Regelwerke und technische Anleitungen (Auszug)
3.8 Kommunikation/Partizipation
4 Fazit
1 Ausgangslage
1.1 Einleitung
Mit diesem Beitrag soll am Beispiel der Sanierung der denkmalgeschützten Hohenzollern-Höfe in Ludwigshafen das ganzheitliche Vorgehen einer Modernisierung von den Methoden des klassischen Städtebaus bis hin zur bauphysikalischen Bewertung von Dämmmaßnahmen der Gebäudehülle aufzeigt werden. Dies geschieht aus der Sicht eines integralen Planungsteams, bestehend aus einem Juristen, einem Bauingenieur, einem Kaufmann und einem Architekten, die jeweils in ihrer Fachdisziplin Experten- und Praxiswissen eingebracht und zu einer gesamthaften Methodologie verknüpft haben. Diese kann als genereller Leitfaden für ganzheitliche Modernisierungen und Neubauprojekte verwendet werden. Im Rahmen der ganzheitlichen Methode soll insbesondere aufgezeigt werden, wie wichtig eine exakte bauphysikalische Bewertung der Gebäudehülle im Rahmen einer energetischen Bestandsaufnahme ist, da eine möglichst genaue frühzeitige Einschätzung des Gesamtenergiebedarfs eine sehr wichtige Grundlage für die folgende energetische Konzeption und die Ausarbeitung eines geeigneten Finanzierungs- bzw. Investitionskonzeptes ist. Die Modernisierungskonzepte zur Definition von Maßnahmen am Einzelgebäude sollten im Rahmen einer Ganzheitlichkeit sowohl immer im Einklang mit den städtebaulichen Konzepten im Quartier als auch mit der bauphysikalischen Beschaffenheit der Gebäudehülle stehen.
Auf der Basis der Kaufkraft der Bewohner im Quartier, den möglichen Einsparpotenzialen durch eine energetische Modernisierung, dem Einbinden von Fördermitteln und steuerlichen Abschreibungen in ein Finanzierungskonzept folgt der optimierte Einsatz des Eigenkapitals durch den Immobilieneigentümer.





























