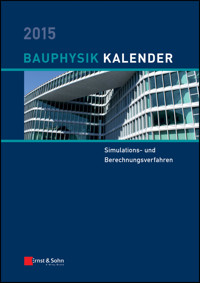
Bauphysik-Kalender 2015 E-Book
79,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Wiley-VCH
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Die technische Komplexität von Gebäuden hat massiv zuggenommen. Fast alle Bereiche der Gebäudetechnik sind heute zumindest teilweise automatisiert, um z. B. das Raumklima zu optimieren, den Energieverbrauch zu senken, Brand- und Rauchentwicklung frühzeitig zu erkennen und zu unterbinden und im Ganzen eine kostengünstigere Bewirtschaftung zu ermöglichen. Numerische Simulationsverfahren sind daher aus der Gebäudeplanung und im Bestand nicht mehr wegzudenken und werden auf allen Gebieten der Bauphysik eingesetzt. Ihre Anwendung erfordert Hintergrundwissen zu den verwendeten Berechnungsverfahren, um sie wirtschaftlich einzusetzen und Fehler zu vermeiden. Auch die Modellgenauigkeit spielt für die Interpretation von Simulationsergebnissen eine bedeutende Rolle und wird häufig unterschätzt, ihre Verifikation muss nachvollziehbar sein. Außerdem sind aufgrund von Vereinfachungen manche Ergebnisse nur für bestimmte Parameter brauchbar. Nicht zuletzt erfordert die Anwendung und Interpretation von Simulationen auch die Berücksichtigung von eventuellen Ungenauigkeiten der Eingabeparameter. Der Bauphysik-Kalender 2015 gibt wertvolle Praxishinweise zur Softwareanwendung anhand von Beispielen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1234
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Inhaltsübersicht
Cover
Titel
Urheberrecht
Vorwort
A: Allgemeines und Regelwerke
A 1: Die neue Energieeinsparverordnung – EnEV 2014
1 Einleitung
2 Politische Vorgaben
3 Novellierung der Energieeinsparverordnung
4 Energieausweise
5 Vollzug der EnEV
B: Materialtechnische Grundlagen
B 1: Dämmstoffe im Bauwesen
1 Physikalische Grundlagen
2 Dämmstoffe im Bauwesen
3 Beschreibung von Dämmstoffen
4 Literatur
C: Bauphysikalische Planungs-und Nachweisverfahren
C 1: Nachweisverfahren der Energieeinsparverordnung
1 Einleitung
2 Energieeinsparverordnung EnEVim Überblick
3 Primärenergiebilanz Wohngebäude
4 Primärenergiebilanz Nichtwohngebäude
5 Sommerlicher Wärmeschutz
6 Literatur
C 2: Feuchteschutzbeurteilung durch hygrothermische Bauteilsimulation
1 Einleitung
2 Feuchteprobleme bei Baukonstruktionen
3 Instationäre Feuchte- und Temperaturbeanspruchung von Außenwänden
4 Grundlagen des instationären Wärmeund Feuchtetransports
5 Normen und Richtlinien zur rechnerischen Feuchteschutzbeurteilung
6 Fazit
7 Literatur
C 3: Anwendung hygrothermischer Gebäudesimulation
1 Einleitung
2 Auswirkungen von Wärme und Feuchte im Gebäude und in Bauteilen
3 Grundlagen des instationären Wärme- und Feuchtehaushalts eines Gebäudes
4 Durchführung einer hygrothermischen Gebäudesimulation
5 Anwendungsbeispiele
6 Fazit
7 Literatur
C 4: Grundlagen der Brandsimulation Einführung in die übergeordneten Zusammenhänge
1 Einführung
2 Entstehung eines CFD-Programms
3 Einführung in die CFD-Grundlagen
4 Numerische Grundlagen
Anhang
Literatur
C 5: Absicherung von CFD-Simulationen im Brandschutz
1 Einleitung
2 Grundsätzliches zur Brandsimulation
3 Zonen- und Feldmodelle
4 Bisherige Vorgehensweise zur Prüfung von Software
5 Konzeption einer umfassenden Eignungsüberprüfung
6 Konzeption einer Plausibilitätsprüfung
7 Beispiele für Testfälle
8 Zusammenfassung
Literatur
C 6: Anwendung von Brandsimulationsmodellen für die Berechnung der thermischen Einwirkungen im Brandfall und der Rauchableitung
1 Einführung
2 Brandszenarien und Bemessungsbrände
3 Modelle
4 Validierung
5 Anwendungsbeispiele
6 Literatur
C 7: Personenstromsimulationen und Evakuierungsberechnungen
1 Einleitung
2 Berechnung von Räumungszeiten
3 Personenstrommodelle
4 Integration relevanter Verhaltensaspekte
5 Bewertungskriterien
6 Analyse von Verkehrsströmen
7 Anwendung und Modellvergleich
8 Nachweis eines sicheren Räumungsverlaufs
9 Literatur
C 8: Das dynamische Gebäude- und Anlagensimulationsprogramm TRNSYS
1 Allgemeines zu TRNSYS
2 Komponenten in TRNSYS
3 Gebäudesimulation mit TRNSYS
4 Beschreibung des Mehrzonen-Gebäudemodells (TYPE 56)
5 Aktuelle Entwicklungen
6 Anwendungsbeispiele
7 Literatur
C 9: Simulationsbasierte Bewertung sommerlicher Bedingungen in Gebäuden
1 Thermische Behaglichkeit
2 Normen, Nachweise und Richtlinien – Beschreibung, Vor- und Nachteile, Grenzen
3 Simulationstechnologien im Überblick
4 Gesetzliche Vorgaben und normative Aspekte
5 Mindestwärmeschutz versus Behaglichkeit – ein Spannungsfeld
6 Planung, Nachweispflicht und Kreativität – integrale Konzepte
7 Resümee
8 Literatur
D: Konstruktive Ausbildung
D 1: Aktuelle Ansätze zur Schallenergieverteilung in Bauteilen
1 Einführung
2 FiniteElementeAnalyse
3 Einzelne Bauteilkomponenten
4 Bauteilstöße und Bauteilverbindungen
5 Flankenenergieübertragung über BauteilStoßstellen
6 Literaturverzeichnis
D 2: Simulation zur Abbildung des thermischen Verhaltens von Oberflächen am Beispiel einer beheizten Freifläche zur Schnee- und Eisfreihaltung
1 Einführung und Problemstellung
2 Ermittlung von Temperaturfeldern
3 Klimatische Einwirkungen auf Freiflächen
4 Versuchstechnische Untersuchung
5 Entwicklung eines FE-Modells
6 Zusammenfassung
7 Literatur
D 3: Neue Anforderungen an Planungswerkzeuge für Energie
⊕
-Siedlungen und -Quartiere
1 Einleitung
2 Bilanzierung und Bewertung von Versorgungskonzepten für Energie
⊕
-Siedlungen und -Quartiere
3 Praxistauglichkeit der Planungswerkzeuge
4 Forschungsinitiative EnTool
5 Zusammenfassung und Ausblick
6 Literaturverzeichnis
E: Materialtechnische Tabellen
E 1: Materialtechnische Tabellen für den Brandschutz
1 Einleitung
2 Stoffdaten
3 Literatur
E 2: Materialtechnische Tabellen
1 Vorbemerkungen
2 Wärme- und feuchtetechnische Kennwerte
3 Schallschutztechnische und akustische Kennwerte
4 Literatur
Stichwortverzeichnis
Wiley End User License Agreement
List of Tables
A 1: Die neue Energieeinsparverordnung – EnEV 2014
Tabelle 1. Abgrenzung von Gebäuden nach EnEV 2014 [11]
Tabelle 2. Primärenergiefaktoren nach EnEV 2014, DIN 4701–10, DIN 18599 [2, 4, 11]
Tabelle 3. Referenzausführung für Wohngebäude nach EnEV 2014 [11]
Tabelle 4. Abweichende Randbedingungen für die Bilanzierung der Referenz im Falle einer rein elektrischen Warmwasserbereitung nach EnEV 2014 [11]
Tabelle 5. Weitere Bilanz-Randbedingungen für das Referenz- und das Ist-Gebäude nach EnEV 2014 [11]
Tabelle 6. Höchstwerte des Transmissionswärmeverlusts für Wohngebäude nach EnEV 2014 [11]
Tabelle 7. Referenzausführung der Außenbauteile für Nichtwohngebäude nach EnEV 2014 [11]
Tabelle 8. Referenzausführung der Wärmebrücken, der Luftdichtheit und der Beleuchtung für Nichtwohngebäude nach EnEV 2014 [11]
Tabelle 9. Referenzausführung der Heizung und Warmwasserbereitung für Nichtwohngebäude nach EnEV 2014 [11]
Tabelle 10. Referenzausführung der Raumlufttechnik für Nichtwohngebäude nach EnEV 2014 [11]
Tabelle 11. Bilanzrandbedingung für die Referenz und das Ist-Gebäude nach EnEV 2014 [11]
Tabelle 12. Vereinfachte Bilanzierungsregeln nach EnEV 2014 [11]
Tabelle 13. Höchstwerte der Wärmedurchgangskoeffizienten für Nichtwohngebäude nach EnEV 2014 [11]
Tabelle 14. Für das vereinfachte Verfahren zugelassene Nutzungstypen nach EnEV 2014 [11]
Tabelle 15. Mindestanforderungen an Bauteile von Bestandsgebäuden (Anlage 3, [11])
B 1: Dämmstoffe im Bauwesen
Tabelle 1. Mindestwerte der Wärmedurchlasswiderstände R wärmeübertragender Massivbauteile mit einer flächenbezogenen Gesamtmasse von mehr als 100 kg/m
2
. Vergleich der Anforderungen nach DIN 4108-2 [17] und DIN 4108-2:1981-08
Tabelle 2. Anhaltswerte der spezifischen Wärmekapazität c unterschiedlicher Baustoffe nach Herstellerangaben
Tabelle 3. Anhaltswerte der Temperaturleitzahlen a unterschiedlicher Baustoffe (siehe auch [102])
Tabelle 4. Wasserdampf-Diffusionswiderstandzahlen µ unterschiedlicher Baustoffe (siehe auch [83] und [102])
Tabelle 5. Werte der Bezugskurve zur Bestimmung des bewerteten Schallabsorptionsgrades αw nach DIN EN ISO 11654 [109]
Tabelle 6. Längenbezogene Strömungswiderstände r unterschiedlicher Dämmstoffe nach [52]
Tabelle 7. Dynamische Elastizitätsmoduln unterschiedlicher Baustoffe
Tabelle 8. Baustoffklassen und ihre Benennungen nach DIN 4102-1 [16]
Tabelle 9. Zusammenstellung der zur Klassifizierung von Baustoffen erforderlichen Prüfungen nach DIN 4102-1 [16]
Tabelle 10. Klassifizierung des Zusatzkriteriums „Rauchentwicklung“
Tabelle 11. Klassifizierung des Zusatzkriteriums „Brennendes Abtropfen/Abfallen“
Tabelle 12. Europäische Klassen des Brandverhaltens von Baustoffen (außer Bodenbelägen) und ihre bauaufsichtlichen Zuordnungen
Tabelle 13. Entwicklung der Marktanteile ausgewählter Dämmstoffe in Deutschland [59]
Tabelle 14. Verfügbare Anwendungstypen und Baustoffklassen verschiedener Dämmstoffe
Tabelle 15. Anwendungstypen und zuzuordnende Einsatzgebiete
Tabelle 16. Anwendungsgebiete und zugeordnete Kurzzeichen nach DIN V 4108-10 [19] (Fortsetzung)
Tabelle 17. Produkteigenschaften und zugeordnete Kurzzeichen nach DIN V 4108–10 [19]
Tabelle 18. Globales Erwärmungspotential (global warming potential GWP) verschiedener Treibhausgase
Tabelle 19. Vergleichende bewertete Übersicht über die drei wichtigsten Folientypen nach [68], [81]. Bewertung von sehr günstig (+++) bis sehr ungünstig (– – –)
C 1: Nachweisverfahren der Energieeinsparverordnung
Tabelle 1. Hauptanforderungen und Nachweismethodik für Wohn- und Nichtwohngebäude
Tabelle 2. Gegenüberstellung der Berechnungsverfahren für Wohngebäude
Tabelle 3. Berechnungsvarianten für das Einfamilienhaus bei unterschiedlichen baulichen und anlagentechnischen Randbedingungen
Tabelle 4. Berechnungsvarianten für das Mehrfamilienhaus bei unterschiedlichen baulichen und anlagentechnischen Randbedingungen
Tabelle 5. Gegenüberstellung der Berechnungsergebnisse aus den beiden Bilanznormen für das Einfamilienhaus
Tabelle 6. Gegenüberstellung der Berechnungsergebnisse aus den beiden Bilanznormen für das Mehrfamilienhaus
Tabelle 7. Kennzeichnung der energetischen Qualität eines Gebäudes gemäß EnEV 2014 – Zuordnung von Kosten unterschiedlicher Energieträger
Tabelle 8. Randbedingungen für das vereinfachte Verfahren für die Berechnungen des Jahres-Primärenergiebedarfs gemäß EnEV 2014
Tabelle 9. Netto-Grundflächen und prozentuale Anteile der Netto-Grundflächen der einzelnen Zonen für das Bürogebäude
Tabelle 10. Jahres-Primärenergiebedarf für die Fälle detaillierte Zonierung und Verwendung des Ein-Zonen-Modells mit unterschiedlichen Ansätzen für das Bürogebäude
Tabelle 11. Zulässige Werte des auf die Grundfläche bezogenen Fensterflächenanteils, unterhalb dessen auf einen sommerlichen Wärmeschutznachweis verzichtet werden kann
Tabelle 12. Anhaltswerte für Abminderungsfaktoren FC von fest installierten Sonnenschutzvorrichtungen in Abhängigkeit von der Glasart nach DIN 4108-2:2013-02
Tabelle 13. Anteilige Sonneneintragskennwerte zur Bestimmung zulässigen Sonneneintragskennwertes nach DIN 4108-2:2013-02
Tabelle 14. Eigenschaften der Bauteile zur Berechnung von C
wirk
Tabelle 15. Zugrunde gelegte Bezugswerte der Innentemperaturen für die Sommer-Klimaregionen und Übertemperaturgradstunden-Anforderungswerte
Tabelle 16. Aktivierungszeiten des Sonnenschutzes in Abhängigkeit von der Grenzbestrahlungsstärke. Auswertung für die TRY-Regionen 2 (Rostock), 4 (Potsdam) und 12 (Mannheim) bei Ost-Orientierung des Fensters
Tabelle 17. Erforderliche FC-Werte zur Einhaltung der normativen Übertemperaturgradstunden-Anforderungswerte für Normal-TRYs und Zukunfts-Normal-TRYs
C 2: Feuchteschutzbeurteilung durch hygrothermische Bauteilsimulation
Tabelle 1. Zusammenstellung der feuchtebedingten prozentualen Zunahme der Wärmeleitfähigkeit verschiedener Baustoffe, bezogen auf den Wassergehalt in M.-% aus [20]
Tabelle 2. Zusammenstellung der für hygrothermische Simulationen mithilfe von WUFI
®
erforderlichen Eingabedaten
C 3: Anwendung hygrothermischer Gebäudesimulation
Tabelle 1. Anwendung Hygiene: Zonenaufteilung der Wohnung im Mehrfamilienhaus
Tabelle 2. Resultierende mittlere Lufttemperatur und Luftfeuchtigkeit in den Wintermonaten
Tabelle 3. Parametrisierung der Durchströmungseigenschaften sämtlicher Gebäudebauteile
Tabelle 4. Parametervariationen der Randbedingungen
C 4: Grundlagen der Brandsimulation Einführung in die übergeordneten Zusammenhänge
Tabelle 1. Gleitkommadarstellung: Beispiel für Intel-Typ Maschine (limits.h, float.h)
C 6: Anwendung von Brandsimulationsmodellen für die Berechnung der thermischen Einwirkungen im Brandfall und der Rauchableitung
Tabelle 1. Zuordnung der Brandentwicklung zu unterschiedlichen Nutzungsarten und Stoffgruppen
Tabelle 2. Standardwerte für α(Drysdale [22]) und tα (NFPA 92 B [17])
Tabelle 3. Unterscheidung von Brandregimen
Tabelle 4. Konstanten in den Plume-Gleichungen von McCaffrey
Tabelle 5. Weighted Combined Expanded Uncertainty, UCW
Tabelle 6. Poolgröße und Luftwechselrate während der PRISME-DOOR Versuche PRS_D3, PRS_D4 und PRS_D5
Tabelle 7. Durchgeführte Simulationen
Tabelle 8. Ausgewertete Messgrößen und angenommene Unsicherheiten für PRISME DOOR, Ucw, PRS, Anzahl ausgewerteter Größen
Tabelle 9. Zuluftöffnungsflächen und Rauchableitungsflächen des Bürogebäudes mit Atrium
Tabelle 10. Eingangswerte für Bemessungsbrand „Personensicherheit“
Tabelle 11. Eingangswerte für Bemessungsbrand „Standsicherheit im Brandfall“
Tabelle 12. Maßgebliche Parameter für den Brandverlauf
Tabelle 13. Untersuchte Varianten
C 7: Personenstromsimulationen und Evakuierungsberechnungen
Tabelle 1. Personenbelegung für ausgewählte Nutzungsarten [1]
Tabelle 2. Festlegung von Reaktionszeiten [1,4]
Tabelle 3. Berechnungsgrößen
Tabelle 4. Berechnungsparameter für eine Kapazitätsanalyse [1, 5]
Tabelle 5. Maxima der Bewegungsintensität q
max
[12]
Tabelle 6. Übersicht der verwendeten Modelle
Tabelle 7. Kapazitätsanalyse – Eigenschaften der zu passierenden Wegelemente bei Räumung des Hörsaals. Bewegungsparameter für „moderate Auslastung“
Tabelle 8. P&M, 1. RW – Parameter der Wegelemente für „Normalbedingungen“ bei einer Projektionsfläche von 0,113 m
2
/P
Tabelle 9. P&M, 2. RW – Parameter der Wegelemente für „Normalbedingungen“ bei einer Projektionsfläche von 0,113 m
2
/P
Tabelle 10. PedGo – Eingabeparameter. Eine Zelle ist 0,4 m lang
Tabelle 11. PedGo – Zusammenfassung der Ergebnisse für 1. und 2. RW; Seed ist der Initialisierungswert des Zufallszahlengenerators
Tabelle 12. ASERI – Fluchtzeiten für die Szenarien 1. und 2. RW
Tabelle 13. Vergleich der Fluchtzeiten und der Lage der Stauungen aus den verschiedenen Modellen. Falls an mehr als einem Wegelement Stauungen auftreten, sind die Elemente kursiv und in Klammern aufgeführt
C 8: Das dynamische Gebäude- und Anlagensimulationsprogramm TRNSYS
Tabelle 1. Zeitabhängige Eingabegrößen TYPE 56
C 9: Simulationsbasierte Bewertung sommerlicher Bedingungen in Gebäuden
Tabelle 1. Anforderungen Übertemperaturgradstunden gemäß DIN 4108-2 [4]
Tabelle 2. Prognostizierte Übertemperaturgradstunden der verschiedenen Modelle
Tabelle 3. Variantenbezogene Angabe der Übertemperaturgradtagstunden entsprechend DIN 4108 2:2013 02 [4] und der operativen Innentemperaturbewertung Außenlufttemperaturen unter 32°C betragen die Raumlufttemperaturen über 26°C.
D 1: Aktuelle Ansätze zur Schallenergieverteilung in Bauteilen
Tabelle 1. Ermittelte Gesamtverlustfaktoren des einzelnen Ziegelsteins
D 2: Simulation zur Abbildung des thermischen Verhaltens von Oberflächen am Beispiel einer beheizten Freifläche zur Schnee- und Eisfreihaltung
Tabelle 1. Monatliche gemessene Mittelwerte der Windgeschwindigkeit und Lufttemperatur für die an der Wetterstation Messdach Hannover-Herrenhausen 2007
Tabelle 2. Einteilung der Bewölkung und deren anschauliche Bezeichnung
Tabelle 3. Untersuchung des Schattenwurfes auf die Versuchsplatte 1 (blaue Fläche) am 28.07.2008 (mitte: Screenshots aus dem Programm Sombrero, rechts: Bilder der Webcam)
Tabelle 4. Einstrahlzahlen für beliebig orientierte Flächen
Tabelle 5. Beispielwerte für langwellige Emissionsgrade ε
Tabelle 6. Auswertung des mittleren maximales Wasseräquivalent der Schneedecke [mm] mit Regioneneinteilung nach dem Testreferenzjahr DWD [7]
Tabelle 7. Beispielwerte für Schneerohdichten, Werte aus Maniak [35] und Stoffel [47]
Tabelle 8. Berechnung der latenten Wärmeströme für verschiedenen Lufttemperaturen nach Gleichung (41), Wärmeübergangskoeffizient nach (43) für Windgeschwindigkeit in 2 m Höhe: v
2m
=4 m/sec
Tabelle 9. Messbereiche, Genauigkeit und Auflösung der eingesetzten Messfühler, aus Thies [15]
Tabelle 10. Bezeichnungen und Lage der Temperaturfühler, siehe Bild 44 und Bild 45
Tabelle 11. Zusammenstellung der bei den Berechnungen angesetzten Stoffeigenschaften
Tabelle 12. Vergleich der Berechnungsergebnisse nach Gläck [23], DIN EN 1264 [9] und den mit Ansys ermittelten Werten
Tabelle 13. Schneefallereignisse, energetische Bilanzierungen und Restschneehöhen während des Versuches am 18.03.2008
E 1: Materialtechnische Tabellen für den Brandschutz
Tabelle 1. Ausgewählte Materialdaten und deren Prüfnormen (Auszug)
Tabelle 2. Umrechnung von technischen Einheiten
Tabelle 3. Zündtemperaturen Feststoffe (ohne Kunststoffe)
Tabelle 4. Zündtemperaturen Kunststoffe
Tabelle 5. Zündtemperaturen Flüssigkeiten
Tabelle 6. Entzündungskriterien für brennbare Stoffe mit/ohne Pilotflamme [20]
Tabelle 7. Abbrandgeschwindigkeiten für feste Stoffe (ohne Kunststoffe) nach [15, 22]
Tabelle 8. Abbrandgeschwindigkeiten von Kunststoffen nach [15, 17, 23]
Tabelle 9. Abbrandgeschwindigkeiten für brennbare Flüssigkeiten nach [15, 17, 22]
Tabelle 10. Brandausbreitungsgeschwindigkeit bei festen Stoffen nach [22]
Tabelle 11. Brandausbreitungsgeschwindigkeit für brennbare Gase (räumlicher Verbrennung), nach [22]
Tabelle 12. Brandausbreitungsgeschwindigkeit von brennbaren Flüssigkeiten nach [22]
Tabelle 13. Heizwert von Feststoffen (ohne Kunststoffe)
Tabelle 14. Heizwert von Kunststoffen
Tabelle 15. Heizwert von Flüssigkeiten
Tabelle 16. Heizwert von brennbaren Gase nach [20]
Tabelle 17. m-Faktor von Feststoffen (ohne Kunststoffe) nach [6]
Tabelle 18. m-Faktor von Kunststoffe nach [6]
Tabelle 19. m-Faktor von Flüssigkeiten nach [6]
Tabelle 20. Luftbedarf fester Stoffe (ohne Kunststoffe) nach [20]
Tabelle 21. Luftbedarf von Kunststoffen nach [20]
Tabelle 22. Luftbedarf von brennbaren Flüssigkeiten nach [20]
Tabelle 23. Luftbedarf von brennbaren Gase nach [20]
Tabelle 24. Verbrennungseffektivität und Verbrennungsanteile (Yield) von Holz, nach [44]
Tabelle 25. Verbrennungseffektivität und Verbrennungsanteile (Yield) von Kunststoffen, nach [44]
Tabelle 26. Verbrennungseffektivität und Verbrennungsanteile (Yield) von Flüssigkeiten, nach [44]
Tabelle 27. Verbrennungseffektivität und Verbrennungsanteile (Yield) von Gasen, nach [44]
Tabelle 28. Verbrennungseffektivität und Verbrennungsanteile (Yield) von Chemikalien und Lösungsmitteln, nach [44]
Tabelle 29. Verbrennungseffektivität und Verbrennungsanteile (Yield) von Pestiziden, nach [44]
Tabelle 30. Zersetzungstemperatur, Kohlenstoff Yield und Sauerstoffindex von Kunststoffen, nach [43]
Tabelle 31. Unterer Heizwert und andere Eigenschaften von Polymeren nach [18]
Tabelle 32. Flächenbezogene Brandleistung von Feststoffen (ohne Kunststoffe), nach [6]
Tabelle 33. Flächenbezogene Brandleistung von Kunststoffen, nach [6]
Tabelle 34. Flächenbezogene Brandleistung von brennbaren Flüssigkeiten in Wannen oder offenen Blechbehälter unterhalb der Siedetemperatur, nach [6]
Tabelle 35. Brandentwicklung und spezifische Brandleistung für ausgewählte Lagerstoffe und Waren, aus Versuchen im Maßstab 1 : 1 ermittelt
Tabelle 36.Brandentwicklung und spezifischer Brandleistung von einzelnen Möbeln; Ergebnisse von Brandversuchen im Maßstab 1 : 1 nach [14], [31], [26], [37], [38] und [39]
Tabelle 37. Maximale spezifische Brandleistung (kW/m Breite) von Holz und Kunststoffen, Einfluss der Lagerungshöhe, nach [14], [26]
Tabelle 38.Brandentwicklung und Brandleistung für ausgewählte Nutzungseinheiten, aus Versuchen im Maßstab 1:1
E 2: Materialtechnische Tabellen
Tabelle 1. Bemessungswerte der Wärmeleitfähigkeit und Richtwerte der Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahlen (DIN 4108-4, Tabelle 1) [6]
Tabelle 2. Zeile 5 von DIN 4108-4, Tabelle 1 für Wärmedämmstoffe nach harmonisierten europäischen Normen (DIN 4108-4, Tabelle 2) [6]
Tabelle 3. Wärmedämmstoffe nach nationalen Normen (DIN 4108-4, Tabelle 3) [6]
Tabelle 4. Wärmeschutztechnische Bemessungswerte für Baustoffe, die gewöhnlich bei Gebäuden zur Anwendung kommen (DIN EN ISO 10456, Tabelle 3) [13]
Tabelle 5. Wärmedurchlasswiderstand R von Decken (DIN 4108-4, Tabelle 7) [6]
Tabelle 6. Wärmedurchlasswiderstand, in (m
2
· K)/W, von ruhenden Luftschichten – Oberflächen mit hohem Emissionsgrad (DIN EN ISO 6946, Tabelle 2) [10]
2)
Tabelle 7. Wärmedurchlasswiderstand R
u
von Dachräumen (DIN EN ISO 6946, Tabelle 3) [10]
Tabelle 8. Wärmeübergangswiderstände in (m2 · K)/W (DIN EN ISO 6946, Tabelle 1) [10]
Tabelle 9. Werte für den äußeren Wärmeübergangswiderstand Rse für unterschiedliche Windgeschwindigkeiten (DIN EN ISO 6946, Tabelle A.2) [10]
1)
Tabelle 10. Wärmetechnische Eigenschaften des Erdreichs (DIN EN ISO 13370, Tabelle 1) [16]
Tabelle 11. Wärmeleitfähigkeit des Erdreichs (DIN EN ISO 13370, Tabelle G.1) [16]
Tabelle 12. Bemessungswerte des Wärmedurchgangkoeffizienten UD,BW von Toren in Abhängigkeit der konstruktiven Merkmale (DIN V 4108-4, Tabelle 14) [6]
Tabelle 13. Bemessungswerte des Wärmedurchgangskoeffizienten UD,BW von Türen in Abhängigkeit der konstruktiven Merkmale (DIN 4108-4, Tabelle 8) [6]
Tabelle 14. Korrekturwerte ΔU
g
zur Berechnung der Bemessungswerte U
g,Bw
(DIN 4108-4, Tabelle 10) [6]
Tabelle 15. Gesamtenergiedurchlassgrad und Lichttransmissionsgrad in Abhängigkeit der Konstruktionsmerkmale des Ug Wertes und des Wärmedurchgangskoeffizienten (DIN 4108-4:2013-02, Tabelle 11) [6]
Tabelle 16. Anhaltswerte für Abminderungsfaktoren FC von fest installierten Sonnenschutzvorrichtungen in Abhängigkeit vom Glaserzeugnis (DIN 4108-2:2013-02, Tabelle 7) [4]
Tabelle 17. Korrekturfaktoren c für den Gesamtenergiedurchlassgrad (DIN 4108-4, Tabelle 12) [6]
Tabelle 18. Anhaltswerte für Lichttransmissionsgrade τ
D65
, U- und g-Werte von Lichtkuppeln und Lichtbänder (DIN 4108-4:2013-02, Tabelle 13) [6]
Tabelle 19. Physikalische Kenngrößen für H
2
O (Wasser, Wasserdampf und Eis) (aus [27])
Tabelle 20. Sättigungsdampfkonzentration für Wasserdampf in Luft über flüssigem Wasser bzw. über Eis in Abhängigkeit von der Temperatur (DIN 4108-3:2014-11, Tabelle C.2) [5]
Tabelle 21. Sättigungsdampfdruck für Wasserdampf in Luft über flüssigem Wasser bzw. über Eis in Abhängigkeit von der Temperatur (DIN 4108-3:2014-11, Tabelle C.1) [5]
Tabelle 22. Taupunkttemperatur für Wasserdampf in Luft in Abhängigkeit von der Temperatur und der relativen Luftfeuchte (DIN 4108-3:2014-11, Tabelle C.3) [5]
Tabelle 23. Emissionsfaktoren, Absorptionsfaktoren und Strahlungskonstanten einiger Stoffe [23]
Tabelle 24. Richtwerte für den Strahlungsabsorptionsgrad verschiedener Oberflächen im energetisch wirksamen Spektrum des Sonnenlichts (DIN V 4108-6, Tabelle 8) [7]
Tabelle 25. Wärmeausdehnungskoeffizient α
T
verschiedener Baustoffe
Tabelle 26. Spezifische und volumenbezogene Wärmekapazität weiterer Stoffe [23]
Tabelle 27. Feuchte- und wärmetechnische Kenngrößen [20]
Tabelle 28. Feuchtebereichabhängige Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahlen einiger Baustoffe
Tabelle 29. Feuchteschutztechnische Eigenschaften und spezifische Wärmekapazität von Wärmedämm- und Mauerwerksstoffen (DIN EN ISO 10456, Tabelle 4) [13]
Tabelle 30. Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke von Folien (DIN EN ISO 10456, Tabelle 5) [13]
Tabelle 31. Ausgleichsfeuchtegehalte von Baustoffen (DIN 4108-4, Tabelle 4) [6]
Tabelle 32. Bewertetes Schalldämm-Maß R′
w,R
1), 2)
von einschaligen, biegesteifen Wänden und Decken (Rechenwerte), (DIN 4109, Beiblatt 1, Tabelle 1) [8]
Tabelle 33. Abminderungen für DIN 4109, Beiblatt 1, Tabelle 1 (DIN 4109, Beiblatt 1, Tabelle 2) [8]
Tabelle 34. Wandrohdichten einschaliger, biegesteifer Wände aus Steinen und Platten (Rechenwerte) (DIN 4109, Beiblatt 1, Tabelle 3) [8]
Tabelle 35. Flächenbezogene Masse von Wandputz (DIN 4109, Beiblatt 1, Tabelle 4) [8]
Tabelle 36. Bewertetes Schalldämm-Maß R′
w,R
von einschaligem, in Normalmörtel gemauertem Mauerwerk (Ausführungsbeispiele, Rechenwerte), (DIN 4109, Beiblatt 1, Tabelle 5) [8]
Tabelle 37. Eingruppierung von biegeweichen Vorsatzschalen von einschaligen, biegesteifen Wänden nach ihrem schalltechnischen Verhalten (Maße in mm), (DIN 4109, Beiblatt 1, Tabelle 7) [8]
Tabelle 38. Bewertetes Schalldämm-Maß R′
w,R
von einschaligen, biegesteifen Wänden mit einer biegeweichen Vorsatzschale nach DIN 4109, Beiblatt 1, Tabelle 7 (Rechenwerte), (DIN 4109, Beiblatt 1, Tabelle 8) [8]
Tabelle 39. Bewertetes Schalldämm-Maß R′
w,R
von zweischaligen Wänden aus zwei biegeweichen Schalen aus Gipskartonplatten oder Spanplatten (Rechenwerte) (Maße in mm), (DIN 4109, Beiblatt 1, Tabelle 9) [8]
Tabelle 40. Bewertetes Schalldämm-Maß R′
w,R
von zweischaligen Wänden aus biegeweichen Schalen aus verputzten Holzwolle-Leichtbauplatten (HWL) nach DIN 1101 (Rechenwerte) (Maße in mm), (DIN 4109, Beiblatt 1, Tabelle 10) [8]
Tabelle 41. Bewertete Schalldämm-Maße R
w,R
für Montagewände aus Gipskartonplatten in Ständerbauart nach DIN 18183 mit umlaufend dichten Anschlüssen an Wänden und Decken (Rechenwerte) (Maße in mm), (DIN 4109, Bbl. 1/A1, Tabelle 23) [9]
Tabelle 42. Bewertete Schalldämm-Maße R
w,R
von Trennwänden in Holzbauart unter Verwendung von biegeweichen Schalen aus Gipskartonplatten
1)
oder Spanplatten 1) oder verputzten Holzwolle-Leichtbauplatten
2)
(Rechenwerte) (Maße in mm), (DIN 4109, Bbl. 1, Tabelle 24) [8]
Tabelle 43. Massivdecken, deren Luft- und Trittschalldämmung in DIN 4109, Beiblatt 1, Tabelle 12 und 16 angegeben ist (Maße in mm), (DIN 4109, Beiblatt 1, Tabelle 11) [8]
Tabelle 44. Bewertetes Schalldämm-Maß R′
w,R
1)
von Massivdecken (Rechenwerte) (DIN 4109, Beiblatt 1, Tabelle 12) [8]
Tabelle 45. Korrekturwerte K
L,1
für das bewertete Schalldämm-Maß R′
w,R
von biegesteifen Wänden und Decken als trennende Bauteile nach DIN 4109, Beiblatt 1, Tabellen 1, 5, 8 und 12 bei flankierenden Bauteilen mit der mittleren flächenbezogenen Masse m′
L,mittel
(DIN 4109, Beiblatt 1, Tabelle 13) [8]
Tabelle 46. Korrekturwerte K
L,1
für das bewertete Schalldämm-Maß R′
w,R
von zweischaligen Wänden aus biegeweichen Schalen nach DIN 4109, Beiblatt 1, Tabelle 9 und 10 und von Holzbalkendecken nach DIN 4109, Beiblatt 1, Tabelle 19 als trennende Bauteile bei flankierenden Bauteilen mit der mittleren flächenbezogenen Masse m′L,mittel (DIN 4109, Beiblatt 1 Tabelle 14) [8]
Tabelle 47. Korrekturfaktor K
L,2
für das bewertete Schalldämm-Maß R′
w,R
von trennenden Bauteilen mit biegeweichen Vorsatzschalen, schwimmendem Estrich/Holzfußboden oder biegeweichen Schalen (DIN 4109, Beiblatt 1, Tabelle 15) [8]
Tabelle 48. Äquivalenter bewerteter Norm-Trittschallpegel L
n,w,eq,R
von Massivdecken in Gebäuden in Massivbauart ohne/mit biegeweicher Unterdecke (Rechenwerte), (DIN 4109, Beiblatt 1, Tabelle 16) [8]
Tabelle 49. Äquivalenter bewerteter Norm-Trittschallpegel L
n,w,eq,R
und bewerteter Norm-Trittschallpegel L′
n,w,R
für verschiedene Ausführungen von massiven Treppenläufen und Treppenpodesten unter Berücksichtigung der Ausbildung der Treppenraumwand (Rechenwert) (DIN 4109, Beiblatt 1, Tabelle 20) [8]
Tabelle 50. Trittschallverbesserungsmaß ∆L
w,R
von schwimmenden Estrichen
1)
und schwimmend verlegten Holzfußböden auf Massivdecken (Rechenwerte) (DIN 4109, Beiblatt 1, Tabelle 17) [8]
Tabelle 51. Trittschallverbesserungsmaß ∆L
w,R
von weichfedernden Bodenbelägen für Massivdecken (Rechenwerte) (DIN 4109, Beiblatt 1, Tabelle 18) [8]
Tabelle 52. Schallabsorptionsgrade verschiedener Baustoffe, Materialien und Gegenstände
Tabelle 53. Beispiele für den praktischen Schallabsorptionsgrad α
s
und Angaben zum bewerteten Schallabsorptionsgrad α
w
nach DIN EN ISO 11654 [12], DIN E 18041, Anhang B, Tabelle B.2 [14]
Tabelle 54. Beispiele für die frequenzabhängige äquivalente Schallabsorptionsfläche A von Personen und Gestühl nach DIN E 18041, Anhang B, Tabelle B.2 [15]
Tabelle 55. Beispiele für den Schallabsorptionsgrad α
s
für eine frequenzabhängige Dimensionierung nach DIN 18041 Tabelle B.1 [15]
Tabelle 56. Schallwellenwiderstand Z
1)
für verschiedene Stoffe [23]
Tabelle 57. Dynamischer Elastizitätsmodul, Dehnwellengeschwindigkeit, Verlustfaktor verschiedener Materialien
Guide
Cover
Table of Contents
Begin Reading
Pages
cover
contents
i
ii
iii
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
13
15
16
17
18
19
20
21
22
24
23
25
26
27
28
29
30
31
32
33
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
269
270
271
272
273
274
275
276





























