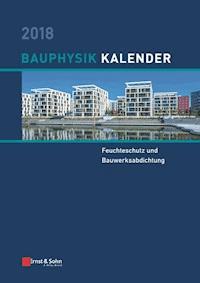
Bauphysik-Kalender 2018 E-Book
79,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Wiley-VCH
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Der neue Bauphysik-Kalender 2018 mit den Schwerpunkten Feuchteschutz und Bauwerksabdichtung bietet eine solide Arbeitsgrundlage und ein topaktuelles und verlässliches Nachschlagewerk für die Planung dauerhafter Bauwerksabdichtungen. Feuchte in Baukonstruktionen ist eine der häufigsten Schadensursachen an Gebäuden und Bauwerken. Nicht selten stehen mangelhafte oder fehlerhafte Bauwerksabdichtungen am Beginn der Schädigung. Die Vielzahl von Baukonstruktionen und Materialkombinationen erfordern fundiertes Wissen über den Wärme- und Feuchtedurchgang, über die Funktionsweisen von Abdichtungen und die geeigneten baulichen Maßnahmen, um fehlerhafte Planung als Schadensursache auszuschließen. Dabei geht es um den Schutz der Baukonstruktion selbst, um die Aufrechterhaltung der Standsicherheit und der Gebrauchstauglichkeit, wie z. B. Wärmeschutz oder WU-Betonkonstruktionen, und um die Abwehr von Gefahren. Viele Bauwerksabdichtungen können nicht nachgebessert werden, so dass sie für die gesamte Lebensdauer funktionsfähig sein müssen. Seit Juli 2017 liegen nun alle Teile der neuen Normenreihe DIN 18531 bis 18535 für die Abdichtung von Dächern und Balkonen, von befahrbaren Verkehrsflächen aus Beton, von erdberührten Bauteilen, von Innenräumen, von Behältern und Becken vor. Hinzu kommt DIN 18195 mit der alten, wohlbekannten Nummer, in welcher Begriffe sowie Abkürzungen und Bezeichnungen definiert sind. Der Bauphysik-Kalender 2018 gibt einen Überblick über die neue Normenstruktur und wichtige Änderungen. Außerdem umfasst das Buch praxisgerechte Hinweise und Hintergrunderläuterungen aus erster Hand zu allen Normenteilen. Insbesondere den Dächern, den erdberührten Bauteilen und den WU-Konstruktionen sind mehrere Kapitel gewidmet. Für die richtige Beurteilung von Feuchtelasten und Wasserbeanspruchungen werden wertvolle Hinweise gegeben. Im Bestand können Feuchte- und Salzschäden auftreten. Dann ist für eine wirtschaftliche und dauerhafte Sanierung die richtige Analyse eine unabdingbare Voraussetzung. Auch Monitoring, z. B. bei Flachdächern, kann größere, sanierungsbedürftige Schäden vermeiden. Verschiedene Methoden werden in diesem Buch vorgestellt und anhand von Beispielen erläutert. Auf aktuellem Stand sind auch in diesem Jahrgang die Materialtechnischen und die Brandschutztechnischen Tabellen. Der Bauphysik-Kalender ist ein Kompendium für die richtige Umsetzung bauphysikalischer Schutzfunktionen mit Normenüberblick und -kommentierung, Materialdaten, Berechnung und Nachweisführung sowie praxisgerechten konstruktiven Lösungen auf den Gebieten Wärme- und Feuchteschutz, Schallschutz sowie Brandschutz.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1135
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Cover
Vorwort
A Allgemeines und Normung
A 1 Neue Normen für die Bauwerksabdichtung: Wichtige Änderungen bei Dachabdichtungen sowie bei Abdichtungen erdberührter Bauteile
1 Neugliederung der Abdichtungsnormen
2 Flachdachabdichtungen
3 Erdberührte Bauteile
4 Dränmaßnahmen
5 Literatur
A 2 Bauordnungsrechtliche Regelungen zur Verwendung von Bauprodukten
1 Vorbemerkung
2 Anforderungen der Landesbauordnungen
3 Regelungen zur Verwendung von nicht harmonisierten Bauprodukten und Bauarten
4 Regelungen zur Verwendung von harmonisierten europäischen Bauprodukten
5 Weiterführende Informationen
6 Literatur
A 3 Bauaufsichtliche Regelungen für Bauwerksund Dachabdichtungen
1 Einleitung
2 Aktuelle Rechtsgrundlagen
3 Verwendung
4 Übersicht über die bauaufsichtlichen Regelungen für Produkte zur Bauwerks- und Dachabdichtung
5 Europäische Produktregeln gemäß EU-BauPVO
6 Konstruktionsnormen
7 Zusammenfassung
8 Literatur
A 4 Bemessungswasserstand – Festlegung, Einflussgrößen, Fehlerquellen, Konsequenzen und Gefahren für Planer und Architekten
1 Zusammenfassung
2 Einleitung
3 Zuständigkeiten – Rechtliche Grundlagen
4 Bemessungswasserstand, Nutzung – Neuland?
5 Handlungsbedarf
6 Anerkannte Regeln der Technik – Bestehende Regelwerke
7 Bemessungswasserstand
8 Häufige Fehlerquellen bei der Ermittlung des Bemessungswasserstandes
9 Kennzeichnung des Bemessungswasserstandes
10 Beispielermittlung des Bemessungswasserstandes
11 Resümee
12 Literatur
B Bauphysikalische Planungsund Nachweisverfahren
B 1 Abdichtung von Flachdächern nach DIN 18531
1 Allgemeines
2 Nicht genutzte Flachdächer
3 Genutzte Dächer inklusive Balkone, Loggien und Laubengänge
4 Begrünte Flachdächer
5 Flachdächer mit Solartechnik
B 2 Abdichtung von befahrbaren Verkehrsflächen aus Beton (neue DIN 18532)
1 Einleitung
2 Anwendungsbereich DIN 18532
3 Begriffe
4 Struktur der DIN 18532
5 Anforderungen
6 Einwirkungen
7 Bauliche Erfordernisse
8 Abdichtungsstoffe und Hilfsstoffe
9 Abdichtungsbauweisen
10 Abdichtungsbauarten
11 Allgemeingültige Regeln für die Abdichtungsbauarten
12 Detailausbildung
13 Zusammenfassung
14 Literatur
B 3 Reduzierung der Wasserbeanspruchung durch Dränanlagen
1 Einleitung
2 Hydrogeologische Grundlagen und Erkundung
3 Konstruktive Ausbildung der Elemente einer Dränanlage
4 Bemessung von Dränanlagen
5 Literatur
B 4 Abdichtung gegen von innen drückendes Wasser
1 Einleitung
2 Grundlegendes zur Planung
3 Anforderungen an den Abdichtungsstoff
4 Flüssige Abdichtungsstoffe
5 Verbundabdichtung
6 Verlegung von Fliesen und Platten
7 Abdichtung mit bahnenförmigen Abdichtungsstoffen
8 Durchdringungen
9 Schwimmbäder
10 Ausblick
11 Literatur
B 5 Beurteilung der Feuchteproduktion durch Klimamessungen in natürlich belüfteten Wohnräumen
1 Einleitung
2 Anforderungen an den Mindestwärmeschutz zur Vermeidung kritischer Oberflächenfeuchten
3 Feuchteproduktion in Wohngebäuden
4 Modellannahmen für hygrothermische Berechnungen
5 Raumklimamessungen in Wohngebäuden
6 Auswertung und Diskussion der Messergebnisse
7 Zusammenfassung
8 Ausblick
9 Literatur
C Konstruktive Ausbildung von Bauteilen und Bauwerken
C 1 Einbau von WU-Betonkonstruktionen im Bestand
1 Einleitung
2 Umsetzung einer WU-Beton-konstruktion im Bestand
3 Bauausführung
4 Erstellung der WU-Betonkonstruktion
5 Praxisbeispiel
6 Zusammenfassung
7 Literatur
C 2 Fugen und Durchdringungen bei wasserundurchlässigen Bauwerken aus Beton und deren Abdichtung
1 Einleitung
2 Fugenarten
3 Planung und Bauausführung von Fugen und Fugenabdichtungen
4 Fugenabdichtungssysteme im Detail
5 Durchdringungen
6 Besonderheiten bei der Abdichtung von Elementwänden
7 Fazit
8 Literatur
C 3 WU-Konstruktionen mit Frischbetonverbundsystemen
1 Einleitung
2 Grundlagen
3 Planung
4 Ausbildung des Frischbetonverbundsystems
5 Rahmenbedingungen und Ausführung
6 Zusammenfassung
7 Anhang
8 Literatur
C 4 Verpressen von Rissen bei WU-Betonkonstruktionen
1 Einleitung
2 Aktuelle Regelwerke zum Füllen von Rissen
3 Analyse und Planung
4 Bewerten von Rissen
5 Prinzipien und Füllziele
6 Rissfüllstoffe
7 Füllarten zum Füllen von Rissen und Hohlräumen
8 Injektionsverfahren zum Füllen von Rissen
9 Abdichten durch Rissinjektion (Rissverpressung)
10 Zusammenfassung
11 Literatur
C 5 Das dichte Flachdach
1 Einleitung
2 Begriffsbestimmung
3 Prüfung nach Schaden
4 Vorbeugende Prüfung
5 Nachwort
C 6 Feuchtediagnostik als zwingende Planungsgrundlage bei Baumaßnahmen im Bestand
1 Einleitung
2 Regelwerke
3 Grundlagen
4 Hinweise und Empfehlungen zur notwendigen Bestandsanalyse
5 Feuchtediagnostik
6 Fazit
7 Literatur
C 7 Mauerwerkstrockenlegung
1 Allgemeines
2 Physikalische Grundlagen der Feuchtigkeit im Mauerwerk
3 Planung der Trockenlegung von feuchtem Mauerwerk
4 Horizontalabdichtungsverfahren gegen kapillar aufsteigende Feuchtigkeit
5 Flankierende Maßnahmen zur Mauerwerkstrockenlegung
6 Literatur
C 8 Untersuchungen zur Vermeidung von Schadstofffreisetzungen aus Fußbodenkonstruktionen insbesondere im Zuge von technischen Trocknungen von Wasserschäden
1 Ausgangssituation
2 Mögliche Schadstoff- und Gefahrenbelastung
2)
3 Sanierungsplanung
4 Technische Trocknung von Fußbodenkonstruktionen
5 Trocknungsverfahren
6 Randfugenabdichtung
7 In-Situ-Messungen
8 Vor-Ort-Versuche
9 Vermeidung von Straßenbildungen
10 Lösungsansatz zur Vermeidung von Straßenbildungen des Trocknungsluftstroms
11 Ausblick
12 Literatur
C 9 Instandsetzungsplanung bei feuchte- und salzgeschädigtem Mauerwerk
1 Einleitung
2 Von der Feuchtediagnostik zum Instandsetzungskonzept
3 Bestandteile der Instandsetzungsplanung
4 Literatur
C 10 Grundinstandsetzung der Staatsoper Unter den Linden in Berlin
1 Vorbemerkung
2 Das Opernhaus im Wandel der Zeit
3 Die Unterbühne und Bestandsabdichtung vor der Sanierung
4 Die Planung der neuen Abdichtung
5 Die Bauausführung der neuen Abdichtung
6 Zusammenfassung
7 Literatur
C 11 Wärmedämmung im Erdreich
1 Einführung
2 Wärmeverluste durch erdberührte Bauteile
3 Wärmebrücken erdberührter Bauteile
4 Anforderungen an den Wärmeschutz erdberührter Bauteile
5 Beanspruchungen
6 Wärmedämmstoffe im Perimeterbereich
7 Anwendungsbereiche und Ausführungen
8 Praktische Erfahrungsberichte zur Dauerhaftigkeit
9 Neuere Entwicklungen
10 Literatur
D Materialtechnische Tabellen
D 1 Materialtechnische Tabellen für den Brandschutz
1 Einleitung
2 Stoffdaten
3 Literatur
D 2 Materialtechnische Tabellen
1 Vorbemerkungen
2 Wärme- und feuchtetechnische Kennwerte
3 Schallschutztechnische und akustische Kennwerte
4 Literatur
Stichwortverzeichnis
Endbenutzer-Lizenzvereinbarung
Tabellenverzeichnis
A 1 Neue Normen für die Bauwerksabdichtung: Wichtige Änderungen bei Dachabdichtungen sowie bei Abdichtungen erdberührter Bauteile
Tabelle 1. Wassereinwirkung nach Entstehungsart
Tabelle 2. Tatsächliche Einwirkungen an Bodenplatten
A 2 Bauordnungsrechtliche Regelungen zur Verwendung von Bauprodukten
Tabelle 1. Überführung der bisherigen Regelungen in das neue Konzept der MBO
Tabelle 2. Übereinstimmungsnachweise nach den Landesbauordnungen
Tabelle 3. Systematik der bauaufsichtlichen Verwendbarkeits- und Anwendbarkeitsnachweise nach den Landesbauordnungen bzw. nach novellierter MBO [5] – Nachweis für nicht harmonisierte Bauprodukte und Bauarten
Tabelle 4. Systematik der bauaufsichtlichen Verwendbarkeits- und Anwendbarkeitsnachweise nach den Landesbauordnungen bzw. nach novellierter MBO [5] – Nachweis für harmonisierte europäische Bauprodukte
Tabelle 5. Beispiel für den Inhalt der Leistungserklärung gemäß EU-BauPVO Anhang III [14]
Tabelle 6. Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit nach EU-BauPVO
Tabelle 7. Linkliste zu weiterführenden Informationen
A 3 Bauaufsichtliche Regelungen für Bauwerksund Dachabdichtungen
Tabelle 1. Begriffe der EU-BauPVO
Tabelle 2. Nachweise im Überblick
Tabelle 3. B 2.2.5 Bauteile zur Abdichtung von baulichen Anlagen
Tabelle 4. MVV TB, C 2.10 Bauprodukte für die Bauwerksabdichtung und Dachabdichtung
Tabelle 5. C 3 Bauprodukte, die nur eines allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses nach § 19 Absatz 1 Satz 2 MBO bedürfen (Auszug)
Tabelle 6. Auszug MVV TB, Abschnitt D 2.2 hinsichtlich Bauwerks- und Dachabdichtung
Tabelle 7. Beispiele von Abweichungen zwischen Konstruktionsnormen und bauaufsichtlichen Anforderungen
A 4 Bemessungswasserstand – Festlegung, Einflussgrößen, Fehlerquellen, Konsequenzen und Gefahren für Planer und Architekten
Tabelle 1. Übersicht relevanter Lastfalleinschätzungen gemäß DIN 18195 [12]
Tabelle 2. Abdichtungsintention erdberührter Bauteile gemäß DIN 18195 [12]
Tabelle 3. Übersicht über Ansprüche an ein Nachweisverfahren zur Ermittlung des Bemessungswasserstandes
Tabelle 4. Checkliste der Minimalangaben zum Bemessungswasserstand
B 1 Abdichtung von Flachdächern nach DIN 18531
Tabelle 1. Einwirkungsklassen für Abdichtungen gemäß DIN 18531-1
Tabelle 2. Nach Flachdachrichtlinie für Dächer mit Trapezprofilen als Trageschale empfohlene Mindestdicken der Wärmedämmschicht
B 2 Abdichtung von befahrbaren Verkehrsflächen aus Beton (neue DIN 18532)
Tabelle 1. Wesentliche Begriffe nach DIN 18195
Tabelle 2. Nutzungsklassen nach DIN 18532-1, Tab. 1
Tabelle 3. Anwendung der Abdichtungsstoffe für die Abdichtung befahrbarer Verkehrsflächen aus Beton
Tabelle 4. Fügeverfahren für Kunststoff- und Elastomerbahnen nach DIN 18532-1, Tabelle 1
Tabelle 5. Anforderungen an Wärmedämmstoffe für befahrbare Verkehrsflächen nach DIN 4108-10 (nach DIN 18532-1, Tab. 4)
Tabelle 6. Stoffe für Nutzschichten bei Abdichtungen von befahrbaren Verkehrsflächen aus Beton nach DIN 18532
Tabelle 7. Zuordnung der Abdichtungsbauarten zu Nutzungsklassen, Verkehrsflächen und Abdichtungsbauweisen (nach DIN 18532-1, Tab. 5)
B 3 Reduzierung der Wasserbeanspruchung durch Dränanlagen
Tabelle 1. Kriterien für das Vorliegen eines Regelfalls gemäß DIN 4095
Tabelle 2. Durchlässigkeitsbereiche abhängig vom Wasserdurchlässigkeitsbeiwert und zugehörige typische Bodenarten
Tabelle 3. Abflussspenden für die Regelfallbemessung nichtmineralischer Dränelemente gemäß DIN 4095
Tabelle 4. Abflussspenden für die Bemessung flächiger Dränelemente gemäß DIN 4095
B 4 Abdichtung gegen von innen drückendes Wasser
Tabelle 1. Rissklassen für Abdichtungsstoffe [6]
Tabelle 2. Wassereinwirkungsklasse und Füllhöhe nach DIN 18535 [6]
Tabelle 3. Standorte von Behältern [6]
Tabelle 4. Abdichtungsbauarten von Behältern mit Bahnen [6]
Tabelle 5. Abdichtungsbauarten von Behältern mit Flüssigabdichtungen
Tabelle 6. Mindestalter von Betonbauwerken [8]
Tabelle 7. Mindesttrockenschichtdicken für Flüssigabdichtungen [8]
Tabelle 8. Anforderungen an Verbundabdichtungen nach DIN EN 14891 [33]
Tabelle 9. Wählbare Merkmale nach DIN EN 14891 [33]
Tabelle 10. Abdichtungsbauarten von Behältern: Verbundabdichtung [8]
Tabelle 11. Abdichtungsbauarten mit bahnenförmigen Abdichtungsstoffen [7]
Tabelle 12. Mindestüberlappung an den Längs- und Quernähten bei loser Verlegung [7]
B 5 Beurteilung der Feuchteproduktion durch Klimamessungen in natürlich belüfteten Wohnräumen
Tabelle 1. Mindestwerte des Wärmedurchlasswiderstands für Außenwände beheizter Räume, modifiziert nach [3]
Tabelle 2. Raumseitiger Wärmeübergangswiderstand für die Beurteilung der Tauwasserbildung im Bauteilinneren bzw. die Tauwasserbildung an Oberflächen von Fenstern und Türen nach DIN EN ISO 13788 [4]
Tabelle 3. Raumseitige Wärmeübergangswiderstände für die Berechnung des Mindestwärmeschutzes [1]
Tabelle 4. Randbedingungen für das stationäre Nachweisverfahren zur Bestimmung minimaler raumseitiger Oberflächentemperaturen nach [1]
Tabelle 5. Feuchteproduktion für verschiedene Feuchtequellen in Wohnungen nach [9, 10]
Tabelle 6. Feuchteproduktion und freigesetzte Wasserdampfmenge typischer Feuchtequellen in Wohnungen nach DIN 4108-8 [11]
Tabelle 7. Kalkulationsbeispiel der stündlichen und täglichen Wasserdampfproduktion für einen 4-Personen-Haushalt nach [12]
Tabelle 8. Vergleich der Beispielszenarien zur Feuchteproduktion aus der Literatur [12] und DIN 4108-8 [11]
Tabelle 9. Feuchteabgabe von Personen für unterschiedliche Umgebungstemperaturen nach VDI 2078
Tabelle 10. Modellkurven nach DIN EN ISO 13788 und DIN EN 15026 für die Raumlufttemperatur und die relative Raumluftfeuchte in Abhängigkeit von der Außenlufttemperatur sowie die daraus berechneten absoluten Feuchten und Taupunkttemperaturen
Tabelle 11. Klassen der raumseitigen Luftfeuchte für maritime Klimate nach [4]
Tabelle 12. Parameter für das Raumklimamodell nach [29]
Tabelle 13. Eigenschaften der untersuchten Wohnräume für die Nutzergruppen Senioren und Familie mit Kindern
Tabelle 14. Aus den Messwerten berechnete Mittelwerte der Außenlufttemperatur θ
e
, der Außenluftfeuchte ϕ
e
, der absoluten Feuchte außen, ν
e
und der Taupunkttemperatur außen θ
d,e
für die Quartale und Halbjahre des Messzeitraums inkl. der zweifachen Standardabweichung auf Basis des Standortaußenklimas
Tabelle 15. Aus den Messwerten berechnete Mittelwerte der Außenlufttemperatur θ
e
, der Außenluftfeuchte ϕ
e
, der absoluten Feuchte außen, ν
e
und der Taupunkttemperatur außen θ
d,e
für die Quartale und Halbjahre des Messzeitraumes inkl. der zweifachen Standardabweichung auf Basis der Raumklimamessdaten
Tabelle 16. Vergleich der Parameter der ermittelten Ausgleichskurven für die einzelnen Räume über die gesamte Messperiode
Tabelle 17. Parameter mit Standardfehler von einem Sigma für die außentemperaturabhängige Ausgleichsfunktion für die Raumlufttemperatur und die relative Raumluftfeuchte als Mittelwert für die Jahre 2012 und 2015 nach Bild 23
Tabelle 18. Parameter mit Standardfehler von einem Sigma für die außentemperaturabhängige Ausgleichsfunktion für die Feuchtelast nach Bild 25
C 1 Einbau von WU-Betonkonstruktionen im Bestand
Tabelle 1. Mögliche Ausführungsvarianten einer nachträglichen WU-Betonkonstruktion zur Sicherung des Auftriebs und Sicherung der Abdichtung. (Grafik Prof. Dr.-Ing.
Rainer Hohmann
, „Nachträglicher Einbau einer weissen Wanne“ in Beton-Information 2011-4)
Tabelle 2. Anforderungen an Beton mit hohem Wassereindringwiderstand bei Bauteildicken d ≤ 40 cm
C 2 Fugen und Durchdringungen bei wasserundurchlässigen Bauwerken aus Beton und deren Abdichtung
Tabelle 1. Fugenarten
Tabelle 2. Beispiele von Fugenabdichtungssystemen für Arbeitsfugen
Tabelle 3. Werkstoff, Form und Bezeichnungen bei Fugenbändern
Tabelle 4. Thermoplastische Dehn- und Arbeitsfugenbänder nach DIN 18541-1 (nach [6])
Tabelle 5. Elastomer-Dehn- und Arbeitsfugenbänder nach DIN 7865-1 (nach [6])
Tabelle 6. Mindestbiegeradien für die verschiedenen Fugenbandtypen (nach [6])
Tabelle 7. Einsatzbereiche, Abmessungen und Material von unbeschichteten Fugenblechen (nach [2])
Tabelle 8. Klemmkonstruktionen und Einsatzbereiche
Tabelle 9. Rohrdurchführungen für WU-Konstruktionen (Beispiele)
C 3 WU-Konstruktionen mit Frischbetonverbundsystemen
Tabelle 1. Checkliste für die Baustelle
C 4 Verpressen von Rissen bei WU-Betonkonstruktionen
Tabelle 1. Einwirkungen aus dem Betonuntergrund gemäß [18]
Tabelle 2. Überblick über die Verwendung von Rissfüllstoffen in Abhängigkeit von Füllzielen, Verfahren, Füllarten und Feuchtezustand im Riss
C 5 Das dichte Flachdach
Tabelle 1. Einschätzung des Elektroimpulsverfahrens (EFVM)
Tabelle 2. Einschätzung Saugglocke
Tabelle 3. Einschätzung des Rauchgasverfahrens
Tabelle 4. Einschätzung der Hochvoltmessung
Tabelle 5. Einschätzung der Absperrblase
Tabelle 6. Einschätzung der Thermografie
Tabelle 7. Einschätzung der Mikrowellen-Rasterfeuchtemessung
Tabelle 8. Einschätzung der Troxlersonde
Tabelle 9. Einschätzung visuelle Prüfung mit Prüfnadel und Schältest
Tabelle 10. Einschätzung Elektroimpulsverfahren mit elektrisch leitender Schicht
Tabelle 11. Einschätzung der Wasserdruckdichtheitsprobe
Tabelle 12. Einschätzung der Kontrollschächte
Tabelle 13. Einschätzung der RFID-Sensoren mit elektrischer Durchgangsmessung
C 6 Feuchtediagnostik als zwingende Planungsgrundlage bei Baumaßnahmen im Bestand
Tabelle 1. Übersicht der maßgeblichen bauschädlichen Salze aus [8]
Tabelle 2. Bewertungstabelle entsprechend der Ö-Norm B3355-1 [6]
Tabelle 3. Bewertungstabelle entsprechend WTA-Merkblatt 4-5-99/D [1]
C 7 Mauerwerkstrockenlegung
Tabelle 1. Kristallisationsdrücke bauschädlicher Salze [2]
C 9 Instandsetzungsplanung bei feuchte- und salzgeschädigtem Mauerwerk
Tabelle 1. Stoffe für die Abdichtung erdberührter Wände nach DIN 18533 (Auswahl)
Tabelle 2. Mindesttrockenschichtdicken und Arbeitsgänge bei Dichtungsschlämmen [1]
Tabelle 3. Beispiele für Raumnutzungen und Anforderungen an die Trockenheit der Raumluft, Raumnutzungsklassen nach DIN 18533
Tabelle 4. Einsatzgebiete für Injektionsmaterialien (nach WTA-Merkblatt 4-6-05)
Tabelle 5. Abdichtungsmaßnahmen und Regelwerke von Injektionen zur nachträglichen Abdichtung außerhalb von [1, Abschnitt 6]
Tabelle 6. Übersicht über mechanische Verfahren zur nachträglichen Querschnittsabdichtung in Mauerwerkswänden
Tabelle 7. Injektionsmittel und ihre Wirkprinzipien, Besonderheiten hinsichtlich der Ausführung [9]
C 10 Grundinstandsetzung der Staatsoper Unter den Linden in Berlin
Tabelle 1. Darstellung der vorgesehenen Abdichtungsverfahren in den unterschiedlichen Bereichen des Gesamtbauvorhabens [2]
C 11 Wärmedämmung im Erdreich
Tabelle 1. Wärmeleitfähigkeitsbereiche für verschiedene Arten von Erdreich nach [1]
Tabelle 2. Technische und physikalische Größen zur Berechnung der Wärmedurchgangskoeffizienten durch erdberührte Bauteile eines beheizten Kellers nach Abschnitt 9 in [1]
Tabelle 3. Temperatur-Korrekturfaktoren für Bauteile des beheizten Kellers nach [8]
Tabelle 4. Anordnung der Schnittebenen im Erdreich zum Zwecke der Berechnung der Oberflächentemperaturen nach [4]
Tabelle 5. Anordnung der Schnittebenen im Erdreich zum Zwecke der Berechnung der Wärmeströme nach [4]
Tabelle 6. Mindestanforderungen an erdberührte Bauteile nach DIN 4108-2 [12]
Tabelle 7. Anforderungen an die Ausführung der Abdichtung für erdberührte Wände und Bodenplatten nach Art der Einwirkung
Tabelle 8. Beständigkeit von Dämmstoffen aus Polystyrol nach [15]
Tabelle 9. Eigenschaften nach den harmonisierten Europäischen Produktnormen
Tabelle 10. Mindestanforderungen an XPS-Dämmstoffe nach DIN EN 13164 für die Perimeterdämmung (Auszug aus Tabelle 5 in DIN 4108-10 [36])
Tabelle 11. Mindestanforderungen an Schaumglas-Dämmstoffe für die Perimeterdämmung (Auszug aus Tabelle 8 in DIN 4108-10 [36])
Tabelle 12. Anforderungen und Bemessungswerte der Wärmeleitfähigkeit für Perimeter-Dämmstoffe aus EPS
Tabelle 13. Anforderungen, maximale Eintauchtiefe und Bemessungswerte der Wärmeleitfähigkeit an Wärmedämmstoffen im drückenden Wasser
Tabelle 14. Anwendung von Wärmedämmstoffen als lastabtragende Wärmedämmung unter Gründungsplatten
D 1 Materialtechnische Tabellen für den Brandschutz
Tabelle 1. Ausgewählte Materialdaten und deren Prüfnormen (Auszug)
Tabelle 2. Umrechnung von technischen Einheiten
Tabelle 3. Zündtemperaturen Feststoffe (ohne Kunststoffe)
Tabelle 4. Zündtemperaturen Kunststoffe
Tabelle 5. Zündtemperaturen Flüssigkeiten
Tabelle 6. Entzündungskriterien für brennbare Stoffe mit/ohne Pilotflamme [20]
Tabelle 7. Abbrandgeschwindigkeiten für feste Stoffe (ohne Kunststoffe) nach [15, 22]
Tabelle 8. Abbrandgeschwindigkeiten von Kunststoffen nach [15, 17, 23]
Tabelle 9. Abbrandgeschwindigkeiten für brennbare Flüssigkeiten nach [15, 17, 22]
Tabelle 10. Brandausbreitungsgeschwindigkeit bei festen Stoffen nach [22]
Tabelle 11. Brandausbreitungsgeschwindigkeit für brennbare Gase (räumlicher Verbrennung), nach [22]
Tabelle 12. Brandausbreitungsgeschwindigkeit von brennbaren Flüssigkeiten nach [22]
Tabelle 13. Heizwert von Feststoffen (ohne Kunststoffe)
Tabelle 14. Heizwert von Kunststoffen
Tabelle 15. Heizwert von Flüssigkeiten
Tabelle 16. Heizwert von brennbaren Gase nach [20]
Tabelle 17. m-Faktor von Feststoffen (ohne Kunststoffe) nach [6]
Tabelle 18. m-Faktor von Kunststoffen nach [6]
Tabelle 19. m-Faktor von Flüssigkeiten nach [6]
Tabelle 20. Luftbedarf fester Stoffe (ohne Kunststoffe) nach [20]
Tabelle 21. Luftbedarf von Kunststoffen nach [20]
Tabelle 22. Luftbedarf von brennbaren Flüssigkeiten nach [20]
Tabelle 23. Luftbedarf von brennbaren Gasen nach [20]
Tabelle 24. Verbrennungseffektivität und Verbrennungsanteile (Yield) von Holz, nach [44]
Tabelle 25. Verbrennungseffektivität und Verbrennungsanteile (Yield) von Kunststoffen, nach [44]
Tabelle 26. Verbrennungseffektivität und Verbrennungsanteile (Yield) von Flüssigkeiten, nach [44]
Tabelle 27. Verbrennungseffektivität und Verbrennungsanteile (Yield) von Gasen, nach [44]
Tabelle 28. Verbrennungseffektivität und Verbrennungsanteile (Yield) von Chemikalien und Lösungsmitteln, nach [44]
Tabelle 29. Verbrennungseffektivität und Verbrennungsanteile (Yield) von Pestiziden, nach [44]
Tabelle 30. Zersetzungstemperatur, Kohlenstoff Yield und Sauerstoffindex von Kunststoffen, nach [43]
Tabelle 31. Unterer Heizwert und andere Eigenschaften von Polymeren nach [18]
Tabelle 32. Flächenbezogene Brandleistung von Feststoffen (ohne Kunststoffe), nach [6]
Tabelle 33. Flächenbezogene Brandleistung von Kunststoffen, nach [6]
Tabelle 34. Flächenbezogene Brandleistung von brennbaren Flüssigkeiten in Wannen oder offenen Blechbehälter unterhalb der Siedetemperatur, nach [6]
Tabelle 35. Brandentwicklung und spezifische Brandleistung für ausgewählte Lagerstoffe und Waren, aus Versuchen im Maßstab 1 : 1 ermittelt
Tabelle 36. Brandentwicklung und spezifische Brandleistung von einzelnen Möbeln; Ergebnisse von Brandversuchen im Maßstab 1 : 1 nach [14], [31], [26], [37–39]
Tabelle 37. Maximale spezifische Brandleistung (kW/m Breite) von Holz und Kunststoffen, Einfluss der Lagerungshöhe, nach [26]
Tabelle 38. Brandentwicklung und Brandleistung für ausgewählte Nutzungseinheiten, aus Versuchen im Maßstab 1:1
Tabelle 39. Maximale spezifische Brandleitung für Materialien in Personenzügen [45]
D 2 Materialtechnische Tabellen
Tabelle 1. Bemessungswerte der Wärmeleitfähigkeit und Richtwerte der Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahlen (DIN 4108-4, Tabelle 1) [6]
Tabelle 2. Zeile 5 von DIN 4108-4, Tabelle 1 für Wärmedämmstoffe nach harmonisierten europäischen Normen (DIN 4108-4, Tabelle 2) [6]
Tabelle 3. Wärmeschutztechnische Bemessungswerte für Baustoffe, die gewöhnlich bei Gebäuden zur Anwendung kommen (DIN EN ISO 10456, Tabelle 3) [12]
Tabelle 4. Wärmedurchlasswiderstand R von Decken (DIN 4108-4, Tabelle 6) [6]
Tabelle 5. Wärmedurchlasswiderstand, in (m
2
⋅K)/W, von ruhenden Luftschichten – Oberflächen mit hohem Emissionsgrad (DIN EN ISO 6946, Tabelle 2) [8]
Tabelle 6. Wärmedurchlasswiderstand R
u
von Dachräumen (DIN EN ISO 6946, Tabelle 3) [8]
Tabelle 7. Wärmeübergangswiderstände in (m
2
⋅K)/W (DIN EN ISO 6946, Tabelle 1) [8]
Tabelle 8. Werte für den äußeren Wärmeübergangswiderstand R
se
für unterschiedliche Windgeschwindigkeiten (DIN EN ISO 6946, Tabelle A.2) [8]
1)
Tabelle 9. Wärmetechnische Eigenschaften des Erdreichs (DIN EN ISO 13370, Tabelle 1) [15]
Tabelle 10. Wärmeleitfähigkeit des Erdreichs (DIN EN ISO 13370, Tabelle G.1) [15]
Tabelle 11. Bemessungswerte des Wärmedurchgangskoeffizienten U
D,BW
von Toren in Abhängigkeit der konstruktiven Merkmale (DIN V 4108-4, Tabelle 13) [6]
Tabelle 12. Bemessungswerte des Wärmedurchgangskoeffizienten U
D,BW
von Türen in Abhängigkeit der konstruktiven Merkmale (DIN 4108-4, Tabelle 8) [6]
Tabelle 13. Korrekturwerte ΔU
g
zur Berechnung der Bemessungswerte U
g,Bw
(DIN 4108-4, Tabelle 9) [6]
Tabelle 14. Gesamtenergiedurchlassgrad und Lichttransmissionsgrad in Abhängigkeit der Konstruktionsmerkmale des U
g
Wertes und des Wärmedurchgangskoeffizienten (DIN 4108-4, Tabelle 10) [6]
Tabelle 15. Anhaltswerte für Abminderungsfaktoren F
C
von fest installierten Sonnenschutzvorrichtungen in Abhängigkeit vom Glaserzeugnis (DIN 4108-2, Tabelle 7) [4]
Tabelle 16. Korrekturfaktoren c für den Gesamtenergiedurchlassgrad (DIN 4108-4, Tabelle 11) [6]
Tabelle 17. Anhaltswerte für Lichttransmissionsgrade τ
D65
, U- und g-Werte von Lichtkuppeln und Lichtbänder (DIN 4108-4, Tabelle 12) [6]
Tabelle 18. Physikalische Kenngrößen für H
2
O (Wasser, Wasserdampf und Eis) (aus [26])
Tabelle 19. Sättigungsdampfkonzentration für Wasserdampf in Luft über flüssigem Wasser bzw. über Eis in Abhängigkeit von der Temperatur (DIN 4108-3, Tabelle C.2) [5]
Tabelle 20. Sättigungsdampfdruck für Wasserdampf in Luft über flüssigem Wasser bzw. über Eis in Abhängigkeit von der Temperatur (DIN 4108-3, Tabelle C.1) [5]
Tabelle 21. Taupunkttemperatur für Wasserdampf in Luft in Abhängigkeit von der Temperatur und der relativen Luftfeuchte (DIN 4108-3, Tabelle C.3) [5]
Tabelle 22. Emissionsfaktoren, Absorptionsfaktoren und Strahlungskonstanten einiger Stoffe [22]
Tabelle 23. Richtwerte für den Strahlungsabsorptionsgrad verschiedener Oberflächen im energetisch wirksamen Spektrum des Sonnenlichts (DIN V 4108-6, Tabelle 8) [7]
Tabelle 24. Wärmeausdehnungskoeffizient α
T
verschiedener Baustoffe
Tabelle 25. Spezifische und volumenbezogene Wärmekapazität weiterer Stoffe [22]
Tabelle 26. Feuchte- und wärmetechnische Kenngrößen [19]
Tabelle 27. Feuchtebereichabhängige Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahlen einiger Baustoffe
Tabelle 28. Feuchteschutztechnische Eigenschaften und spezifische Wärmekapazität von Wärmedämm- und Mauerwerksstoffen (DIN EN ISO 10456, Tabelle 4) [12]
Tabelle 29. Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke von Folien (DIN EN ISO 10456, Tabelle 5) [12]
Tabelle 30. Ausgleichsfeuchtegehalte von Baustoffen (DIN 4108-4, Tabelle 3) [6]
Tabelle 31. Schallabsorptionsgrade verschiedener Baustoffe, Materialien und Gegenstände
Tabelle 32. Beispiele für den praktischen Schallabsorptionsgrad α
s
und Angaben zum bewerteten Schallabsorptionsgrad α
w
nach DIN EN ISO 11654 [10, 11], DIN E 18041, Anhang B, Tabelle B.2 [13, 14]
Tabelle 33. Beispiele für die Schallabsorptionsfläche A in m
2
für eine frequenzabhängige Dimensionierung (DIN 18041, Tabelle G.2 [14])
Tabelle 34. Beispiele für den Schallabsorptionsgrad α für eine frequenzabhängige Dimensionierung nach DIN 18041 Tabelle G.1 [14]
Tabelle 35. Schallwellenwiderstand Z
1)
für verschiedene Stoffe [22]
Tabelle 36. Dynamischer Elastizitätsmodul, Dehnwellengeschwindigkeit, Verlustfaktor verschiedener Materialien
Illustrationsverzeichnis
A 1 Neue Normen für die Bauwerksabdichtung: Wichtige Änderungen bei Dachabdichtungen sowie bei Abdichtungen erdberührter Bauteile
Bild 1. Wasserlachen auf einer Abdichtung einer Dachterrasse
Bild 2. Problemkreis Hinter-/Unterläufigkeit: Bei einzelnen Fehlstellen in jeweils mehreren Lagen, die in Verbindung stehen, kann eine Abtropfstelle im Innenraum aufgrund der inneren Sickerwege und nicht einer verursachenden Stelle in der Abdichtung zugeordnet werden.
Bild 3. Funktionsprinzip von mehrlagig ausgeführten und vollflächig miteinander verbundenen Dichtungsschichten. Fehlstellen in einzelnen Schichten führen zur Wasserdurchlässigkeit der Abdichtung (a) und bleiben ohne Auswirkung, solange kein Wasser zwischen den Abdichtungsschichten fließen kann (b).
Bild 4. Fehlstellen in der Abdichtung bleiben ohne Auswirkung, solange kein Wasser zwischen dieser und einem wasserundurchlässigen Untergrund sickern kann.
Bild 5. Verlegung von Bitumenbahnen im Gießverfahren, hier auf einer Stahlbetondecke
Bild 6. Links auf diesem Foto ist die Oberfläche einer Stahlbetondecke mit Zementleimschicht (Betonschlämme) zu sehen, durch die Wasser sickern kann. Im rechten Bildteil ist diese (durch Strahlen) entfernt, das Korngerüst des Betons ist freigelegt.
Bild 7. Klebemasse haftet nur auf den Kuppen, füllt aber nicht die (mikrofeinen) Täler der Oberfläche des Untergrunds (a). Die niedrig-viskose und damit flüssigere Grundierung füllt die Täler (b), sodass die flüssig aufzubringende Abdichtung eine deutlich größere Verbindungsfläche zum Untergrund aufweist, damit der Haftverbund größer und die Gefahr der Unterläufigkeit kleiner wird (c).
Bild 8. Blick von oben in einen Wasserfangkasten, der zur Fassade nicht wasserdicht ausgebildet ist. Wenn Wasser sich im Kasten staut und ggf. überläuft, dringt es in das Wärmedämmverbundsystem ein. Daher sollen die Seiten zur Fassade einschließlich einer Aufkantung über dem Kasten abgedichtet werden.
Bild 9. Die Abläufe sind höher als die Dachterrassentürschwelle angeordnet.
Bild 10. Nach einem Windereignis mit Luftgeschwindigkeiten von 150 km/h wurde diese Dachabdichtung schwer beschädigt. Allerdings war der Dachaufbau fehlerhaft verklebt worden.
Bild 11. Im linken Bildbereich wurde der Dachaufbau mechanisch befestigt und blieb unbeschädigt, während die Abdichtung im Bereich der Verklebung weggerissen worden war (rechts).
Bild 12. Auf die Dampfsperre war eine ausreichende Menge von Kleber aufgetragen worden. Allerdings hatten die EPS Dämmplatten nur zu einem sehr kleinen Anteil Kontakt zum Kleber. Zu einem Anteil von ca. 90 % blieb beim Verlegen der Platte ein Spalt zwischen deren Unterseite und der Kleberoberfläche.
Bild 13. Falten der Dachbahnen am Rand (a) und breite Spalte zwischen Dämmung und Dachrand (b)
Bild 14. Ursachenprinzip dieses Schadensbilds: Durch die Überlagerung der besseren Verklebung in der oberen Ebene und unzureichenden in den darunterliegenden Grenzflächen, addieren sich die Schrumpfkräfte der Dämmplatten auf, die zu geringe untere Verklebung versagt, wodurch am Rand breite Spalten entstehen und die Lagesicherung in diesen Bereichen ganz entfällt.
Bild 15. Bei einer Neigung der Geländeoberfläche zum Gebäude besteht das Risiko von Überflutung der Sockelzone und Wasserschäden durch über Türschwellen eindringendes Oberflächenwasser.
Bild 16. Gefälle zum Gebäude ist möglichst zu vermeiden. Auf Bergseiten kann ein Gegengefälle, gegebenenfalls mit Seitenneigung, von der Bergseite kommendes Wasser um das Gebäude umleiten.
A 4 Bemessungswasserstand – Festlegung, Einflussgrößen, Fehlerquellen, Konsequenzen und Gefahren für Planer und Architekten
Bild 1. Tragfähigkeit der Böden in kN/m
2
Bild 2. Feuchtebedingter Schaden, Ursache: Fehleinschätzung des Lastfalls drückendes Wasser
Bild 3. Feuchtebedingter Schaden, Ursache: Fehleinschätzung des Lastfalls drückendes Wasser
Bild 4. Wohnanlage Marina Olderhuuske, Roermond, NL – schwimmende Häuser
Bild 5. Auszug der Ausführungsplanung der Erstellung des Neubaus eines amtsgerichtlichen Geschäfts- und Gefängnisgebäudes in Emmerich vom 19.02.1914
Bild 6. DIN gemäßer Abstandsbereich von 300 mm über bindigen Bodenschichten
Bild 7. Feuchtebedingter Schaden, Ursache: Nichteinhaltung des kapillarbrechenden Abstandbereichs von 300 mm
Bild 8. Baugrube mit sichtbaren Torfschichten, teilweise abgedeckt
Bild 9. Baugrube mit sichtbarem, aktuellem Grundwasserstand
Bild 10. Baugrubenschurf zur Ermittlung des Bemessungswasserstandes
Bild 11. Ungeplante Wasserhaltung
Bild 12. Übersicht über den Zusammenhang von Wurzeltiefen und flurfernen Grundwasserständen bei Kulturpflanzen [16]
Bild 13. Übersicht über Bereiche zwischen Bodenoberfläche und Grundwasserstauer, aus [16]
Bild 14. Grafische Darstellung der Entwicklung von schädlicher Nässe durch Änderung der Kulturlandschaft, a) Vorflutänderung – vorher, b) Vorflutänderung – nachher
Bild 15. Grafische Darstellung der Auswirkung auf Gebäude durch Veränderung der Kulturlandschaft bedingten Vorflut
Bild 16. Titelseite „Erneuertes Edict“, wegen zu verschaffender Vorfluth und Räumung der Graben und Bäche
Bild 17. Grafische Darstellung der zur Beurteilung der Planungsgrundlagen benötigten Bezugspunkte
Bild 18. Grafische Darstellung des Ermittlungsziels Bemessungswasserstand
Bild 19. Darstellung präferenzielle Fliesswege [24]
B 1 Abdichtung von Flachdächern nach DIN 18531
Bild 1. Übersicht über die wesentlichen Konstruktionsmöglichkeiten eines nichtbelüfteten Flachdaches; a) Sparrenbauweise, b) Brettstapelbauweise, c) Stahlleichtbauweise, d) Massivbauweise
Bild 2. Übersicht über die wesentlichen Konstruktionsvarianten eines Flachdaches am Beispiel der Massivbauweise, a) Umkehrdach, b) Duodach, c) belüftetes Flachdach
Bild 3. Beispiele für Regelquerschnitte eines nicht genutzten Flachdaches in Massivbauweise, a) Bituminöse Abdichtung und Kiesauflage, b) Folienabdichtung und mechanische Befestigungsmittel; Innenputz, Stahlbetonplatte, Voranstrich, Ausgleichsschicht, Dampfsperre, Gefälledämmung, Dampfdruckausgleichsschicht (je nach Wärmedämmstoff), Dachabdichtung (2-lagig), Oberflächenschutz, Trennlage, Dachabdichtung, Nahtverbindung nach Herstellerangabe
Bild 4. Beispiele für Regelquerschnitte eines nicht genutzten Flachdaches in Holzbauweise, a) Bauweise mit Wärmedämmung in der Sparrenebene (Zwischensparrendämmung), b) Bauweise mit Aufsparrendämmung; Schalung, Dampfsperre/Luftdichtheitsschicht, Wärmedämmung, Dachabdichtung nach Flachdachrichtlinie, Gipskartonbauplatte, ggf. mit oberseitiger Bedämpfung, Federbügel
Bild 5. Beispiele für Regelquerschnitte eines nicht genutzten Flachdaches in Stahlleichtbauweise (üblicherweise als Industriedach eingesetzt), a) Stahl-Polyurethan-Sandwichelemente (auch: Thermoelement), b) Trapezprofil mit Wärmedämmung und bituminöser Dachabdichtung, c) Trapezprofil mit Wärmedämmung und trapezprofilierter Oberschale auf Distanzprofil („zweischaliges Industriedach“); Sandwichelement, Trapezprofil als Unterschale, Dampfsperre/Luftdichtheitsschicht, Wärmedämmung, Wärmedämmung mit zwischenliegendem Distanzprofil, Schutzbahn, Dachabdichtung, Trapezprofil als Oberschale (Wetterschutz)
Bild 6. Beispielhafte Darstellung einer in ein Flachdach in Holzbauweise mit Wärmedämmung in der Sparrenebene (Zwischensparrendämmung) einbindenden Innenwand mit unterschiedlichen Qualitäten des Anschlusses der Dampfsperre
Bild 7. Beispielhafte Darstellung des Diffusionsstromes in den Innenraum g
aus
bei Vorhandensein einer feuchteadaptiven Dampfsperre und günstigen sommerlichen Randbedingungen
Bild 8. Beispielhafte Darstellung des Diffusionsstromes in den Innenraum g
aus
bei Vorhandensein einer feuchteadaptiven Dampfsperre und ungünstigen klimatischen und/oder örtlichen Randbedingungen
Bild 9. Anschluss eines nichtbelüfteten Daches in Holzbauweise mit Zwischensparrendämmung an aufgehende zweischalige Wand; Wärmedämmung des Wandkopfes und Hohlraumbedämpfung, Weiche Faserdämmung mit schallschutztechnischer Spezifikation nach DIN 4109-2, Abdeckprofil der hinterliegenden Sockeldämmung aus geschlossenzelligem Dämmstoff, z. B. extrudiertem Polystyrol (XPS) oder Schaumglas. (Anmerkung: Bei Verwendung eines offenzelligen Dämmstoffes ist die Dachabdichtung entsprechend den Flachdachrichtlinien
vor
der Wärmedämmung hochzuführen und dann am Untergrund zu befestigen).
Bild 10. Anschluss eines belüfteten Daches in Massivbauweise an aufgehende einschalige Wand mit Wärmedämm-Verbundsystem; Abdeckprofil der hinterliegenden Sockeldämmung aus geschlossenzelligem Dämmstoff, z. B. extrudiertem Polystyrol (XPS) oder Schaumglas. (Anmerkung: Bei Verwendung eines offenzelligen Dämmstoffes ist die Dachabdichtung entsprechend den Flachdachrichtlinien
vor
der Wärmedämmung hochzuführen und dann am Untergrund zu befestigen) Weiche Faserdämmung mit schallschutztechnischer Spezifikation nach DIN 4109-2
Bild 11. Anschluss eines zweischaligen Industriedaches (Trapezprofil mit Wärmedämmung und trapezprofilierter Oberschale auf Distanzprofil) an eine aufgehende einschalige Wand aus Porenbeton; Anschlussprofil Wandanschlussschiene mit dauerelastischer Abdichtung Zahnblech Dichtschraube Profilfüller Randwinkel Dampfsperre/Luftdichtheitsschicht thermischer Trennstreifen Blindniet lastabtragende Innenschale als Trapezprofil
Bild 12. Attikaabschluss in Massivbauweise; Dämmkeil Attika-Verblendschalenanker
Bild 13. Dachrandabschluss eines massiven Daches mit Abschlussprofil, thermischem Trennelement und Überstand (Anschluss an eine einschalige Außenwand mit Wärmedämm-Verbundsystem); Thermisches Trennelement Konstruktionsholz (Bohlen) Nut als Tropfkante
Bild 14. Dachrandabschluss eines massiven belüfteten Daches mit Abschlussprofil und Überstand (Anschluss an eine einschalige Außenwand mit Wärmedämm-Verbundsystem); Abhängung für den Belüftungskasten Verschalung der Belüftungsöffnungen mit zusätzlichem Insektenschutzgitter Wetterschutz
Bild 15. Dachrandabschluss eines Industriedaches aus Stahl-PUR-Sandwichelementen mit vorgehängter Rinne (Anschluss an eine Stahl-PUR-Sandwichwand); gekantetes Abdeckprofil PUR-Dichtband Abschlussprofil gekantetes Anschlussprofil PUR-Dichtband Wärmedämmstoffstreifen thermischer Trennschnitt (d ≥ 3 mm)
Bild 16. Dachrandabschluss eines zweischaligen Industriedaches mit Attika und Kastenrinne (Anschluss an eine Kassettenwand mit Mineralwoll-Dämmung und vertikal verlegten Trapezprofil); Rinneneinlaufblech Trapezprofil als Außenschale Kondensat-Schutzfolie Konstruktionsholz Randwinkel Randprofil Attikakappe Haltewinkel Blindniet Kastenrinne Kantprofil Blindniet Setzbolzen Dichtband Bohrschraube thermischer Trennstreifen
Bild 17. Regelquerschnitte eines genutzten Daches; Innenputz, Tragkonstruktion, Trennschicht, Dampfsperre, Wärmedämmung als Gefälledämmung, Dampfdruckausgleichsschicht, Dachabdichtung, Trennlage (z. B. Vliese, Kunststoff- oder Elastomerbahnen),
Bild 18. Anschluss an aufgehende Wand mit Wärmedämmverbundsystem; Dämmkeil Dampfbremse Mechanische Befestigung der Abdichtung Randeinfassung Wärmedämmverbundsystem Nutzschicht: Plattenbelag auf Stelzlagern
Bild 19. Anschluss an aufgehende monolithische Wand; Dämmkeil Dampfsperre Mechanische Befestigung der Randeinfassung Randeinfassung
Bild 20. Anschluss an eine Terrassentür; Dämmkeil Dampfsperre Mechanische Befestigung der Abdichtung Randeinfassung
Bild 21. Niveaugleiche Schwelle mit Klemmschiene; Terrassentür, Edelstahl-Kastenrinne mit eingesetztem Gitterrost, Dämmkeil, Gefälledämmung, Vakuumdämmelement, Schutzvlies
Bild 22. Attika, thermisch getrennt; Dämmkeil Dampfbremse Mechanische Befestigung der Abdichtung Randeinfassung Nutzschicht: Platten auf Mörtel in Verbindung mit einer Dränschicht
Bild 23. Attika, mit aufstehendem Geländer; Dämmkeil Dampfbremse Haltekonstruktion des Geländers Randeinfassung Nutzschicht: Plattenbelag auf Stelzlagern Attikablech mit Antidröhnbeschichtung auf formstabiler Unterkonstruktion
Bild 24. Brüstung mit vorgesetzter Dachrinne; Unterkonstruktion des Dachrandes auf Haltekonstruktion aus Holzbohlen und druckfester Dämmung Geländerkonstruktion mit Rinnenhalter und Sichtschutz Geschlitztes Traufprofil Nutzschicht: Plattenbelag auf Stelzlagern
Bild 25. Durchdringung; Mechanische Befestigung (Rohrschelle) Manschette Kiesstreifen Platten auf Mörtel in Verbindung mit einer Dränschicht
Bild 26. Innenliegende Entwässerung; Wärmedämmung zur Vermeidung von Tauwasserbildung auf der Innenoberfläche Dampfdichte Bekleidung des Entwässerungsrohres Unterer Klebeflansch Dichtungsring Oberer Klebeflansch Mörtel in Verbindung mit einer Dränschicht Nutzschicht: Platten
Bild 27. Regelquerschnitt eines begehbaren Flachdaches; Innenputz, Tragkonstruktion, Trennschicht, Dampfbremse, Wärmedämmung, Dampfdruckausgleichsschicht, Dachabdichtung, Wurzelschutzfolie, Schutzvlies/Grabschutz, Drainageelemente, Filtervlies, ggf. Verankerungseinlage für Haltesicherung, Granulatschicht, Oberfläche, Gehbelag, Bewuchs, Abschottung
Bild 28. Anschluss an aufgehende zweischalige Wand; Dampfbremse Dämmkeil Randeinfassung Mechanische Befestigung der Abdichtung Entwässerungsrinne Kiesstreifen 16/32
Bild 29. Anschluss an aufgehende Wand mit hinterlüfteter Bekleidung; Dämmkeil Dampfbremse Mechanische Befestigung der Abdichtung Randeinfassung Dauerhaft dichter Anschluss zwischen Randeinfassung und Fassadensystem Entwässerungsrinne Kiesstreifen 16/32
Bild 30. Attika, thermisch getrennt; Dämmkeil Dampfbremse Mechanische Befestigung der Abdichtung Randeinfassung Kiesstreifen 16/32
Bild 31. Attika, mit aufstehendem Geländer; Dämmkeil Dampfbremse Haltekonstruktion des Geländers Randeinfassung Kiesstreifen 16/32 Attikablech mit Antidröhnbeschichtung auf formstabiler Unterkonstruktion
Bild 32. Brüstung mit vorgesetzter Dachrinne; Unterkonstruktion des Dachrandes auf Haltekonstruktion aus Holzbohlen und druckfester Dämmung Geländerkonstruktion mit Rinnenhalter und Sichtschutz Geschlitztes Traufprofil Kiesstreifen 16/32
Bild 33. Brandwand; Dämmkeil Dampfbremse Mechanische Befestigung der Abdichtung Randeinfassung Kiesstreifen 16/32 Blechabdeckung auf Haften und nicht entflammbarer Unterkonstruktion Dämmung des Brandwandkopfes mit nicht brennbarem Material
Bild 34. Durchdringung; Mechanische Befestigung (Rohrschelle), Manschette, Kiesstreifen 16/32, Kiesstreifenbegrenzung
Bild 35. Innenliegende Entwässerung; Wärmedämmung zur Vermeidung von Tauwasserbildung auf der Innenoberfläche, Dampfdichte Bekleidung des Entwässerungsrohres, Unterer Klebeflansch, Dichtungsring, Oberer Klebeflansch, Kiesstreifen 16/32, Kiesstreifenbegrenzung
Bild 36. Lichtkuppel (Beispiel: Velux CFP); Dämmkeil, Mechanische Befestigung der Abdichtung, Kiesstreifen 16/32, Kiesstreifenbegrenzung
Bild 37. Dehnungsfuge; Dehnungsfuge, dämmstoffgefüllt, Schlaufenförmig verlegte Dampfsperrschicht, Aufkantung aus Dämmstoff, Rundschnur, Kiesstreifen 16/32, Kiesstreifenbegrenzung
Bild 38. Dachaufständerungen von Solaranlagen bei Flachdächern; Tragkonstruktion Dampfsperre Wärmedämmung Dachabdichtung Schutzschicht Kies Wanne Unterkonstruktion Energiegewinnungsfläche
B 2 Abdichtung von befahrbaren Verkehrsflächen aus Beton (neue DIN 18532)
Bild 1. Übersicht zu den Anwendungsbereichen der Einzelnormen für die Abdichtung von Bauwerken
Bild 2. Anwendungsbereich der DIN 18532
Bild 3. Struktur der DIN 18532 – Abdichtung von befahrbaren Verkehrsflächen aus Beton
Bild 4. Einwirkungen aus Fahrzeugverkehr
Bild 5. Direkte und indirekte Einwirkungen
Bild 6. Nutzungsklassen für ein Parkhaus mit Verkehr durch PKW (Fahrzeuge bis 30 kN)
Bild 7. Bauweisen ohne Wärmedämmung – Bauweise 1a: Abdichtung auf Konstruktionsbeton unter Schutz-/Nutzschicht; Bauweise 1b: Abdichtung auf Konstruktionsbeton, direkt befahren
Bild 8. Bauweisen mit Wärmedämmung – Bauweise 2a: Abdichtung auf dem Konstruktionsbeton unter der Wärmedämmung (Prinzip „Umkehrdach“); Bauweise 2b: Abdichtung auf der Wärmedämmschicht unter der Nutzschicht (Prinzip „Warmdach“)
Bild 9. Abdichtungsbauart aus einer Lage Polymerbitumenbahn und einer Lage Gussasphalt; hier: Bauweise 1a, Nutzungsklasse N2-V
Bild 10. Allgemeine Vorgehensweise bei der Wahl der Abdichtungsbauart
Bild 11. Vorgehensweise bei der Wahl der Abdichtungsbauart; exemplarisch für die Nutzungsklasse N2-V
Bild 12. Starrer Anschluss einer Abdichtung an ein aufgehendes Bauteil bei Bauweise 1a (in Anlehnung an DIN 18532-1, Bild 6)
Bild 13. Blech zum Schutz des Anschlusses
Bild 14. Beweglicher Anschluss einer Abdichtung bei Bauweise 1a (in Anlehnung an DIN 18532-1, Bild 10)
Bild 15. Abdichtung einer Bewegungsfuge bei Bauweise 1a (in Anlehnung an DIN 18532-1, Bild 15)
Bild 16. Anschluss der Abdichtung an einen Bodenablauf bei Bauweise 1a (in Anlehnung an DIN 18532-1, Bild 19)
B 3 Reduzierung der Wasserbeanspruchung durch Dränanlagen
Bild 1. Alternative Abdichtungsmöglichkeiten bei möglicher Stauwasserbeanspruchung
Bild 2. Elemente einer Dränanlage
Bild 3. Zur Erfordernis einer Dränanlage bei Abdichtung des Bauwerks gegen nichtdrückendes Wassers
Bild 4. Erscheinungsformen des Wassers im Boden
Bild 5. Beispiel für eine Grundwasserganglinie (Stadtgebiet Hannover)
Bild 6. Abschätzung des Wasserdurchlässigkeitsbeiwertes aus der Körnungslinie
Bild 7. Ausführungsformen von Wanddränschichten
Bild 8. Körnungslinien für Filter- und Sickerschichten gemäß DIN 4095 geeigneter Bodenmaterialien
Bild 9. Dränanlage unter einer Bodenplatte mit einer Fläche > 200 m
2
(nach
Cziesielski
[1])
Bild 10. Beispiele für die Ausbildung von Dränschichten auf Decken
Bild 11. Beispiele für die Ausbildung von Sickerschichten um Dränrohre
Bild 12. Versickerungsanlagen
Bild 13. Regelfallausführungen der Elemente von Dränanlagen gemäß DIN 4095
Bild 14. Bemessungsdiagramm für Dränleitungen mit runder Querschnittsform (aus DIN 4095)
B 4 Abdichtung gegen von innen drückendes Wasser
Bild 1. Wasseranalyse einer Sole
Bild 2. Therapiebecken werden oft mit Salzwasser betrieben
Bild 3. Lose Bestandteile und Trennschichten sind zu entfernen
Bild 4. Hier stört eine Trennschicht den Verbund
Bild 5. Bei der Sanierung ist keine Schwindung mehr zu erwarten
Bild 6. Beim Neubau müssen Wartezeiten einkalkuliert werden
Bild 7. Flüssige Abdichtungsstoffe können a) gespachtelt oder b) gespritzt werden
Bild 8. Ein öffentlicher Brunnen für eine Heilsole
Bild 9. Jauche- und Güllebecken unterliegen der Anlagenverordnung
Bild 10. Mosaik ermöglicht anspruchsvolle optische Gestaltung
Bild 11. Ein Kennwert für Fliesenkleber ist der Haftzug
Bild 12. Außenbecken ohne Gebäudeanbindung
Bild 13. Für Innenbecken wird ein abP benötigt
Bild 14. Buttering-Floating-Verfahren
Bild 15. Ein ungeeigneter Abdichtungsstoff sickert aus den Fugen
Bild 16. Fehler bei Durchdringungen werden bei Wasserdruck sichtbar
Bild 17. Durchdringungen sind ordnungsgemäß einzudichten
Bild 18. Ausblühungen in einem Schwimmbecken ohne Verbundabdichtung
Bild 19. Beckenkonstruktion ohne Abdichtung gegen das Erdreich
Bild 20. Der Beckenumgang ist separat abzudichten
Bild 21. Im Schwimmbecken sollten KSW geprüfte Produkte verwendet werden
Bild 22. Einige Harzfugen können bereits die KTW und KSW Anforderungen erfüllen
Bild 23. Für Trinkwasserspeicher dürfen nur geprüfte Produkte verwendet werden
B 5 Beurteilung der Feuchteproduktion durch Klimamessungen in natürlich belüfteten Wohnräumen
Bild 1. In hohem Maße vom Raumklima beeinflusste Bereiche in der Bauphysik
Bild 2. Schematische Darstellung typischer Einflüsse auf den Feuchtehaushalt in einem Gebäude infolge Feuchteproduktion und Luftaustausch, bedingt durch Fensterlüftung und Infiltrationsluftwechsel
Bild 3. Vergleich der stündlichen Feuchteproduktion von Personen in Abhängigkeit von der Tätigkeit, modifiziert nach [19]
Bild 4. In den Wäschestücken enthaltene Wassermenge pro Waschladung nach Beendigung des Waschvorgangs für unterschiedliche Schleudergänge [19]
Bild 5. Trocknungsverlauf einer Wäscheladung nach dem Schleudergang mit 800 rpm nach [19]
Bild 6. Vergleich der stündlichen Feuchteproduktion von Zimmerpflanzen in Abhängigkeit ihrer Größe in der Literatur, ergänzt nach [19]
Bild 7. Tagesmittel a) der Raumlufttemperatur und b) der raumseitigen Feuchte in Wohnungsund Bürogebäuden in Abhängigkeit von der Tagesmitteltemperatur der Außenluft [4, 27]
Bild 8. Aus den Modellkurven [4,27] berechnete Kurven der Abhängigkeit; a) der absoluten Luftfeuchte und b) der Taupunkttemperatur von der Außenlufttemperatur
Bild 9. Abhängigkeit der Feuchtelast von der monatlichen mittleren Außentemperatur a) nach DIN EN ISO 13788 [4] und b) nach IBP Holzkirchen [29, 30]
Bild 10. Kurven der Tagesmittelwerte der a) Raumlufttemperatur und b) -feuchte von Wohnräumen in Abhängigkeit vom Tagesmittelwert der Außenlufttemperatur [31]
Bild 11. Jahresgänge a) der raumseitigen Lufttemperatur und b) der relativen Raumluftfeuchte nach [29]
Bild 12. Aus Test-Referenz-Jahren (TRY) nach [24] ermittelte Approximation von a) Temperatur und b) relativer Luftfeuchte der Außenluft für die Klimaregionen in den alten Bundesländern, aus [30, 34]
Bild 13. Jahresverlauf a) der Außenluft- und der Raumlufttemperaturen sowie b) der relativen Außen- und Raumluftfeuchte; aus 10-Minuten-Messwerten berechnete Stunden- und Tagesmittelwerte für ein Wohnzimmer der Gruppe 1, Senioren, aus dem Jahr 2012
Bild 14. Jahresverlauf a) der Außenluft- und der Raumlufttemperaturen sowie b) der relativen Außen- und Raumluftfeuchte; aus 10-Minuten-Messwerten berechnete Stunden- und Tagesmittelwerte für ein Wohnzimmer der Gruppe 1, Senioren, aus dem Jahr 2015
Bild 15. Stundenmittelwerte; Tagesmittelwerte; Monatsmittelwerte mit zweifacher Standardabweichung (2σ), Ausgleichsfunktion mit 95 % Prognoseintervall für die Raumlufttemperatur des Jahres 2012 im a) Wohnzimmer Gruppe 1 und b) Schlafzimmer Gruppe 1
Bild 16. Stundenmittelwerte; Tagesmittelwerte; Monatsmittelwerte mit zweifacher Standardabweichung (2σ), Ausgleichsfunktion mit 95 % Prognoseintervall für die Taupunkttemperatur des Jahres 2012 im a) Wohnzimmer Gruppe 1 und b) Schlafzimmer Gruppe 1
Bild 17. Stundenmittelwerte; Tagesmittelwerte; Monatsmittelwerte mit zweifacher Standardabweichung (2σ), Ausgleichsfunktion mit 95 % Prognoseintervall für die absolute Feuchte des Jahres 2012 im a) Wohnzimmer Gruppe 1 und b) Schlafzimmer Gruppe 1
Bild 18. Vergleich der Ausgleichsfunktionen aus den Jahren 2012 und 2015 für die a) Raumlufttemperatur, b) absolute Feuchte, c) Taupunkttemperatur und d) Feuchtelast für Wohn- und Schlafzimmer der Gruppe 1
Bild 19. Vergleich der Ausgleichsfunktionen aus den Jahren 2012 und 2015 für die a) Raumlufttemperatur, b) absolute Feuchte, c) Taupunkttemperatur und d) Feuchtelast für Wohn- und Schlafzimmer der Nutzergruppen 1 und 2, Vergleich mit dem Raumklimamodell nach [13]
Bild 20. Abhängigkeit der Stunden-, Tages- und Monatsmittelwerte der Raumlufttemperatur von der Außentemperatur; Vergleich mit dem Modell nach DIN EN ISO 13788 [4] und DIN EN 15026 [27] für die Gruppe 1 im Jahr 2012; a) Wohnzimmer und b) Schlafzimmer
Bild 21. Abhängigkeit der Stunden-, Tages- und Monatsmittelwerte der relativen Raumluftfeuchte von der Außentemperatur; Vergleich mit dem Modell nach DIN EN ISO 13788 [4] und DIN EN 15026 [27] für die Gruppe 1 im Jahr 2012; a) Wohnzimmer und b) Schlafzimmer
Bild 22. Abhängigkeit der Stunden-, Tages- und Monatsmittelwerte der Taupunkttemperatur der Raumluft von der Außentemperatur; Vergleich mit dem Modell nach DIN EN ISO 13788 [4] und DIN EN 15026 [27] für die Gruppe 1 im Jahr 2012; a) Wohnzimmer und b) Schlafzimmer
Bild 23. Abhängigkeit der Tagesmittelwerte a) der Raumlufttemperatur und b) der relativen Raumluftfeuchte von der Außenlufttemperatur; Gruppe 1 und Gruppe 2 für den Messzeitraum getrennt in Wohnzimmer und Schlafzimmer; Vergleich mit DIN EN ISO 13788 und DIN EN 15026
Bild 24. Abhängigkeit der Feuchtelast von der Außentemperatur; Vergleich der Luftfeuchteklassen nach DIN EN ISO 13788 [4]; mit Stunden-, Tages- und Monatsmittelwerte der Gruppe 1 für a) Wohnzimmer und b) Schlafzimmer des Jahres 2012
Bild 25. Abhängigkeit der Feuchtelast von der Außentemperatur; Vergleich der Luftfeuchteklassen a) nach DIN EN ISO 13788 [14] und b) nach IBP Holzkirchen [29] mit den Ausgleichskurven der Messwerte der Gruppe 1 und Gruppe 2 für den Messzeitraum jeweils für Wohn- und Schlafzimmer
C 1 Einbau von WU-Betonkonstruktionen im Bestand
Bild 1. Beispiel einer erfolgreich eingebauten WU-Betonkonstruktion im Bestand, a) Hobby- und Bürokeller, b) Keller- und Treppenflur
Bild 2. Grundwassertiefhaltung mittels Pumpen
Bild 3. Hohlraumbildung durch unsachgemäße Grundwassertiefhaltung
Bild 4. Rückbau und Öltankzwischenlagerung
Bild 5. Zugang für Materialfluss
Bild 6. Materiallagerplatz
Bild 7. Beispiel von Rückbaumaßnahmen
Bild 8. Schwimmende Häuser Marina Oolderhuuske, Roermond
Bild 9. Beispiel einer staubdichten Absperrung
Bild 10. Rückbau Heizung und Kamin zur Vorbereitung für das Bewehren und Betonieren der Bodenplatte
Bild 11. Abschnittsweise Unterfangung tragender Wände und Wandschlitze zur Durchführung der Betonwand
Bild 12. Aufgeständerte Wände zur Verstärkung der Bodenplatte zur Auftriebssicherung
Bild 13. Fugenbleche für die Umfassung einer Stütze
Bild 14. Einhäuptige Schalung
Bild 15. Betonanlieferung mit Betonpumpe
Bild 16. Einbringen des Betons
Bild 17. Fließbeton mit hohem Wassereindringwiderstand
Bild 18. Kraftschlüssige Untermauerung und erfolgter Lückenschluss
Bild 19. Wieder hergestellte Kellernutzung
Bild 20. Wieder hergestellte Nutzung, a) zeitgemäßer Kellerflur, b) Installationsraum und Lagerkeller
C 2 Fugen und Durchdringungen bei wasserundurchlässigen Bauwerken aus Beton und deren Abdichtung
Bild 1. Beispiele für wasserundurchlässige Bauwerke aus Beton
Bild 2. Fugenabdichtungssysteme für Bewegungsfugen; a) innenliegendes Dehnfugenband, b) außenliegendes Dehnfugenband, c) streifenförmige vollflächig aufgeklebte Fugenabdichtungsband (Abklebe- oder Adhäsionsdichtungen), d) Klemmkonstruktion
Bild 3. Beispiele für die Fugenabdichtung von Pressfugen: a) Fugenabdichtung einer Pressfuge in der Wand eines Tunnels in offener Bauweise mit einem Dehnfugenband (wenn eine Scherbeanspruchung ausgeschlossen ist); b) Fugenabdichtung einer Pressfuge in der Wand eines Tunnels in offener Bauweise mit einem Elastomer-Fugenband mit Mittelschlauchummantelung und Injektionsmöglichkeit (wenn eine Scherbeanspruchung auftreten kann)
Bild 4. Ausbildung und Abdichtung von Sollrissquerschnitten in Wänden mit einem Dichtrohr
Bild 5. Ausbildung und Abdichtung von Sollrissquerschnitten in Elementwänden mit einer Sollrissfugenschiene; a) Sollrissfugenschiene, die an einer der Fertigteilplatten befestigt werden muss, b) Sollrissfugenschiene, die „selbsttragend“ ist und am Wandkopf mit speziellen Bügeln fixiert wird
Bild 6. Sollrissquerschnitt in einer Bodenplatte
Bild 7. Typische Beispiele, bei denen eine Abdichtung mit streifenförmigen vollflächig aufgeklebten Fugenabdichtungsbändern nicht möglich ist
Bild 8. Innenliegendes Dehnfugenband aus Elastomer mit seitlichen Stahllaschen (Typ FMS) in der Blockfuge eines Troges
Bild 9. a) Innenliegendes thermoplastisches Dehnfugenband (Typ D) in einer WU-Konstruktion und b) außenliegendes thermoplastisches Dehnfugenband (Typ DA) auf der Sauberkeitsschicht
Bild 10. Form und Bezeichnungen bei innenliegenden Dehnfugenbändern
Bild 11. Form und Bezeichnungen bei innenliegenden Dehnfugenbändern mit seitlichen Stahllaschen nach DIN 7865 [7] (Form: FMS)
Bild 12. Form und Bezeichnungen bei außenliegenden Dehnfugenbändern
Bild 13. Form und Bezeichnungen bei Fugenabschlussbändern
Bild 14. Herstellung eines Baustellenstoßes eines Elastomerfugenbandes mit einem Vulkanisiergerätes (Tricosal Bauabdichtungs-GmbH)
Bild 15. Herstellung eines Baustellenstoßes eines thermoplastischen außenliegenden Dehnfugenbandes mit einem Schweißgerät
Bild 16. Beispiel für werkseitig vorgefertigte Formteile, die Anordnung von Werks- und Baustellenstößen, Benennung der verschiedenen Formteile (Fotos: KRASO GmbH & Co. KG)
Bild 17. Verformungsrichtungen beim Fugenband
Bild 18. Auswahldiagramm für innenliegende thermoplastische Dehnfugenbänder nach DIN 18541 (Typ D) [6]
Bild 19. Auswahldiagramm für innenliegende Dehnfugenbänder aus Elastomer nach DIN 7865 (Typ FM) [6]
Bild 20. Auswahldiagramm für innenliegende Dehnfugenbänder aus Elastomer mit seitlichen Stahllaschen nach DIN 7865 (Typ FMS) [6]
Bild 21. Auswahldiagramm für außenliegende Dehnfugenbänder aus Elastomer nach DIN 7865 (Typ AM) [6]
Bild 22. Auswahldiagramm für außenliegende thermoplastische Dehnfugenbänder nach DIN 18541 (Typ DA) [5]
Bild 23. Auswahldiagramm für thermoplastische Fugenabschlussbänder nach DIN 18541 (Typ FA) [6]
Bild 24. Auswahldiagramm für Fugenabschlussbänder aus Elastomer nach DIN 7865 (Typ FAE) [6]
Bild 25. Fugenbandauswahl eines innenliegenden Dehnfugenbandes aus Elastomer Typ FM (a), eines innenliegenden thermoplastischen Dehnfugenbandes Typ D (b) und eines außenliegenden thermoplastischen Dehnfugenbandes Typ DA (c) (Beispiel 1)
Bild 26. Fugenbandauswahl eines innenliegenden Dehnfugenbandes aus Elastomer (Typ FM) (Beispiel 2)
Bild 27. Fugenbandauswahl eines innenliegenden Dehnfugenbandes aus Elastomer (Typ FM) (Beispiel 3)
Bild 28. Fugenbandauswahl eines innenliegenden Dehnfugenbandes aus Thermoplast (Typ D) (Beispiel 3)
Bild 29. Fugenbandauswahl eines innenliegenden Dehnfugenbandes aus Elastomer (Typ FM) (Beispiel 4)
Bild 30. Fugenband mit angeformter Mittelschlauchummantelung z. B. FMS … HS
Bild 31. Eingebautes Arbeitsfugenband mit unterbrochener oberer Bewehrungslage, Befestigung mit Fugenbandklammern (Tricosal Bauabdichtungs-GmbH)
Bild 32. Erforderlicher lichter Abstand zwischen Bewehrung und Fugenband
Bild 33. v-förmiges Verlegen von innenliegenden Fugenbändern in horizontalen und leicht geneigten Bauteilen
Bild 34. Abstände eines innenliegenden Arbeitsfugenbandes zur Anschlussbewehrung am Beispiel eines Sohle-Wand-Anschlusses mit Aufkantung
Bild 35. Falsche und richtige Eckausführung bei außenliegenden Fugenbändern; a) Verwerfungen der Sperranker bei Verlegung mit zu kleinem Radius, b) im Herstellerwerk gefertigte Ecke
Bild 36. Fachgerechte (a) und nicht fachgerechte (b) Verwahrung des Fugenbandes bis zum Betonieren des nächsten Betonierabschnittes
Bild 37. Stark verschmutztes außenliegendes Fugenband in der Bodenplatte
Bild 38. Unbeschichtetes Fugenblech in der Arbeitsfuge zwischen Bodenplatte und Wand mit Betonaufkantung
Bild 39. Geschweißter Stoß bei unbeschichteten Fugenblechen
Bild 40. Beispiel für einen nicht zulässigen Überlappungsstoß unbeschichteter Fugenbleche
Bild 41. Anschlussmöglichkeiten eines unbeschichteten Fugenblechs an ein FMS-Fugenband; links: Anschweißen des unbeschichteten Fugenblechs an die Stahllaschen des FMS-Fugenbandes; rechts: Anschweißen des unbeschichteten Fugenblechs an einen werkseitig an die Stahllasche des FMS-Fugenbandes angefügten Blechanschluss
Bild 42. Beschichtetes Fugenblech (mit Polymerbitumenbeschichtung) in der Arbeitsfuge zwischen Bodenplatte und Wand
Bild 43. Kombi-Arbeitsfugenband in der Arbeitsfuge zwischen Bodenplatte und Wand
Bild 44. Arbeitsfugenband Duo-Fix 150 Plus
Bild 45. Stoßausbildung beim Arbeitsfugenband Duo-Fix 150 Plus durch Klemmen mit bituminöser Zwischenlage und Stoßsicherung mit einem Befestigungsbügel
Bild 46. Arbeitsfugenband AF 15 M
Bild 47. Injektionsschlauchsystem in einer Arbeitsfuge; a) als Primärabdichtung, b) als Sekundärabdichtung
Bild 48. Mindestabstände beim Einbau von Injektionsschlauchsystemen
Bild 49. Quellfähige Fugeneinlage in der Arbeitsfuge
Bild 50. Mindestbetondeckung von quellfähigen Fugeneinlagen
Bild 51. Beispiele außenliegende Fugenabdichtungssysteme; a) Streifenförmiges vollflächig aufgeklebtes Fugenabdichtungsband – starre Verklebung (Sika Deutschland GmbH); b) Streifenförmiges vollflächig aufgeklebtes Fugenabdichtungsband – flexible Verklebung (TPH Bausysteme GmbH); c) Streifenförmige, mit Flüssigkunststoff aufgebrachte Dichtfolie (Adicon Nord Gesellschaft für Sanierungs- und Abdichtungstechnik mbH & Co. KG)
Bild 52. Dichtrohr zur Abdichtung von Sollrissquerschnitten
Bild 53. Ausbildung des Fußpunktes beim Einbau von Dichtrohren
Bild 54. Fußpunkt beim Dichtrohr; a) fachgerecht ausgeführt, b) falsch ausgeführt
Bild 55. Sollrissfugenschiene; a) in einer Elementwand bzw. b) einer Ortbetonwand
Bild 56. Fachgerechter Anschluss von Sollrissfugenschienen an das beschichtete Fugenblech in der Bodenplatte
Bild 57. Beispiel einer einseitigen Klemmkonstruktion
Bild 58. Beispiel einer beidseitigen Klemmkonstruktion (Tricosal Bauabdichtungs-GmbH)
Bild 59. Aufbau einer Klemmung
Bild 60. Beispiel für eine einseitige Klemmkonstruktion zur Abdichtung einer Anschlussfuge zwischen einer bestehenden Wand und einer neuen WU-Bodenplatte mit einem Klemmfugenband; a) einseitige Klemmkonstruktion mit einem innenliegenden thermoplastischen Fugenband D 320 K bzw. mit einem Elastomerfugenband FM 350 K, b) einseitige Klemmkonstruktion mit einem außenliegenden thermoplastischen Fugenband DA 320 KI bzw. mit einem Elastomerfugenband AM 350 KI
Bild 61. Anschluss an ein Bestandsgebäude mit einer Wandvorlage und a) einem innenliegenden Dehnfugenband, b) einem außenliegenden Dehnfugenband
Bild 62. Rohrdurchführung mit a) Vierstegdichtung und b) mittels Dichtkragen
Bild 63. Rohrdurchführung mit a) rauer Oberfläche und einem um das Rohr aufgeklebten Quellband und b) mit Dichtlippe und Polymerbitumenbeschichtung
Bild 64. Futterrohre zur nachträglichen Rohr- oder Kabeldurchführung und Abdichtung mittels Dichteinsatz/Ringraumdichtungen (Beispiele); a) Futterrohr aus Faserzement mit umlaufender Außenrillung; b) Futterrohr aus Kunststoff (vollwandig) mit umlaufender Vierstegdichtung; c) Futterrohr aus Kunststoff (geschäumt) mit umlaufender Gummidichtlippe und Polymerbitumenbeschichtung
Bild 65. Beispiele für Ringraumdichtungen zur Abdichtung von Rohr- und Kabeldurchführungen durch Futterrohre oder Kernbohrungen
Bild 66. Wassersperre bei der Durchdringung von Ringerdern, um einen Wasserdurchtritt zu verhindern; a) Dichtkragen für Ringerder, b) werkseitig in eine Elementwand eingebaute Durchdringung eines Ringerders mit einer zusätzlichen Wassersperre
Bild 67. Spannstelle aus Kunststoff mit a) Dichtkragen und b) Schalungsspreize mit aufgeschweißter Wassersperre
Bild 68. Kombi-Arbeitsfugenband a) mit nicht ausreichendem Abstand zur Bewehrung und b) der späteren raumseitigen Elementwandplatte
C 3 WU-Konstruktionen mit Frischbetonverbundsystemen
Bild 1. Entwicklung des Marktes für Frischbetonverbundsysteme in Deutschland
Bild 2. Schematische Darstellung der Wirkung von FBV-Systemen mit mechanischem Verbund (links) oder adhäsivem Klebeverbund (rechts). Unmaßstäbliche Darstellung [8]
Bild 3. Betonage einer mit FBV-Bahn und Bewehrung vorbereiteten Fläche
Bild 4. Hinterlaufschutz von FBV-Systemen
Bild 5. Systemaufbau eines nachträglichen Verbundsystems
Bild 6. Vollflächiger Verbund durch Kontaktverklebung mit Systemprimer
Bild 7. Bei der ASTM-Prüfung wird die Hinterlaufsicherheit mit gefärbtem Wasser über einen Zeitraum von 14 Tagen mit einer Druckstufe von 7 bar nachgewiesen
Bild 8. Mit einer Druckstufe von 5 bar erfolgt über eine Prüfdauer von 28 Tagen die Funktionsprüfung eines Überlappungsstoßes mit kreuzender Arbeits-/Sollrissfuge, inklusive eines Kontrollfensters zum Nachweis der Hinterlaufsicherheit und freiem Rand
Bild 9. Zusammenarbeit der Beteiligten bei Planung und Ausführung [10]
Bild 10. Lösungsmöglichkeiten hochwertiger WU-Konstruktionen [10]
Bild 11. Arbeitsmodell des Feuchtetransports in Betonbauteilen [2]
Bild 12. Verlegung eines Frischbetonverbundsystems im Bodenplattenbereich
Bild 13. Die verschiedenen Stoßausbildungen bei der Verlegung der Fläche
Bild 14. Einige Produkte sind längsseitig mit einer Verlegemarkierung zur Sicherstellung der vorgegebenen Überlappungsbreite ausgestattet
Bild 15. Ausbildung eines Querstoßes
Bild 16. Ausbildung der Randaufkantung
Bild 17. Verlegung der Bahnen im zweihäuptig geschalten Wandbereich
Bild 18. Aufhängen der Frischbetonverbundbahnen an Klemmschienen oder Nagelleisten
Bild 19. Ausbildung eines Rücksprungs im 45
◦
-Winkel im Bereich einer einhäuptig ausgebildeten Wand
Bild 20. Ausbildung einer Aufzugsunterfahrt mit verschiedenen Eckformteilen
Bild 21. Das FBV-System muss im Anschlussbereich über die längste Anschlussbewehrung hinaus vorgestreckt werden, um für den weiterführenden Takt eine fachgerechte Ausbildung des Anschlussstoßes zu ermöglichen
Bild 22. Faserzementleisten als Unterlaufschutz sind eine planerische und ausführungstechnische Lösung zur Vermeidung von auslaufendem Beton und der Verschmutzung der Anschlussbereiche
Bild 23. Fachgerechte Arbeitsfuge mit Unterlaufschutz nach Betonage
Bild 24. Abklebung der Arbeitsfuge Sohle-Wand – mit Bodenplattenüberstand
Bild 25. Durchgelegte FBV-Bahn mit Schutzmaßnahmen zur Vermeidung von Beschädigungen und Verschmutzungen
Bild 26. Ausbildung der Gebäudetrennfuge beim Anschluss an Bestandsbauwerke mit aufklebbaren Fugenbandprofilen
Bild 27. Beispiel einer Rohrdurchführung mit Anschluss an die angrenzende FBV-Fläche
Bild 28. Lagerung der FBV-Bahnen in der Originalverpackung
Bild 29. Bodenplatte mit Perimeterdämmung
Bild 30. Verlegung auf einer Magerbetonsauberkeitsschicht
Bild 31. FBV-Bahnen auf System-Wandschalung
Bild 32. Einhäuptig ausgebildeter Wandbereich mit Perimeterdämmung
Bild 33. Große Temperaturschwankungen können zu Wellenbildung führen, was in der Regel jedoch keine Beeinträchtigung des Gesamtsystems darstellt
Bild 34. Lagerung von Bewehrungsstahl auf fertig verlegter Fläche
Bild 35. Lageversetzt angeordnete Abstandhalter aus Faserzement
Bild 36. Bei Betonage des FBV-Systems sind die erforderliche Betongüte, Konsistenzklasse und der fachgerechte Einbau zu beachten
Bild 37. Vollflächige Verklebung der Perimeterdämmung auf einer Konstruktion mit FBV-System
C 4 Verpressen von Rissen bei WU-Betonkonstruktionen
Bild 1. Wasserführender Riss mit Spuren von ausgetretenem Calciumcarbonat und Eisenoxid
Bild 2. Feuchtstellen auf der Betonoberfläche (rot markierte Bereiche) und Wasserperlen (rechts)
Bild 3. Um Gesteinskörnung und Bewehrung verschwenkter Rissverlauf, Anzeichen einer Frührissbildung
Bild 4. Linienmaßstab zur Messung der Rissbreite w
Bild 5. Induktiver Wegaufnehmer zur Messung von hochfrequenten Rissbreitenänderungen Δw
Bild 6. Setzdehungsmessung – über den Riss gesetzte Messmarken und Messuhr zur Messung von Rissbreitenänderungen Δw
Bild 7. Rissbreitenänderungen, Bauteil- und Lufttemperaturen an einem freibewitterten Parkdeck [24]
Bild 8. Selbstheilungsprozess an undichten, zuvor mit Zementleim injizierten Rissen
Bild 9. Überblick über Instandsetzungsziele, Prinzipien und Füllziele im Hinblick auf das Instandsetzungsverfahren Füllen von Rissen und Hohlräumen nach [18, 19, 21]
Bild 10. Vollständige Ablösung eines wasserunverträglichen Epoxidharzes von den Betonflanken, Feuchtebedingung während der Injektion: wasserführend
Bild 11. Mikroskopaufnahme eines von der Betonflanke abgelösten Polyurethans
Bild 12. Stahlbetonbalken – dehnungsabhängige Dichtheit. Rissbreiten w
u
zum Zeitpunkt des Undichtwerdens in Abhängigkeit von der Injektionsrissbreite w
0
bei PUR [35]
Bild 13. Rissinjektion über Klebepacker am verdämmten Riss
Bild 14. Temperaturabhängige Viskositätsänderungen der Einzelkomponenten A und B eines Polyurethans [46]
Bild 15. Mehrkomponentengerät zur Injektion von Acrylatgelen
Bild 16. Setzen von Klebepackern a) und Verdämmen von Rissen b)
Bild 17. Einfüllstutzen a) Klebepacker, b) Klebepacker mit Selbstinjektor, c) Bohrpacker, d) Schlagpacker
Bild 18. Abstandsregeln zum Setzen von Einfüllstutzen (Packern) [11]
Bild 19. Rasterinjektion
Bild 20. Klebepacker mit Absperrhahn für die Injektion mit zementgebundenen Rissfüllstoffen
Bild 21. Aufgeklappter Bohrkern, Korrosionsabtrag von der Bewehrung a) und Bewehrungsrestquerschnitt b), entnommen aus einem unter Wasserdruck mit Acrylatgel gefüllten Riss, Rissverlauf parallel zur Bewehrung mit Rissbreitenänderungen Δw > 0,1 w
Bild 22. Einfluss von Risszuständen und Einwirkungen auf die Bedingungen während der Injektion, der Erhärtungsphase und im Gebrauchszustand
C 5 Das dichte Flachdach
Bild 1. Maßnahmen des Dachdichtheitsmanagements
Bild 2. Messgeräte für das Elektroimpulsverfahren (EFVM)
Bild 3. Geschlossener Stromkreis beim Elektroimpulsverfahren
Bild 4. Fließrichtung des Stroms auf der Abdichtung
Bild 5. Messtechniker bei der Detektion von Fehlstellen in der Abdichtung
Bild 6. Einsatz der Saugglocke zur Prüfung einer Naht
Bild 7. Einsatz der Rauchgasmethode
Bild 8. Einsatz der Tracergasmethode
Bild 9. Messgerät für das Hochvoltverfahren
Bild 10. Messtechniker bei der Detektion von mechanischen Defekten
Bild 11. Absperrblase
Bild 12. Überprüfen eines Gullys mittels Absperrblase und Wasseranstau
Bild 13. Messbild eines Flachdachs mit 3 Leckagen
Bild 14. Messgeräte des Mikrowellen-Raster-feuchtemesssystems
Bild 15. Messtechniker beim Ermitteln der Indexwerte
Bild 16. Die inhomogenen Schichten der Auflast werden an den Messpunkten entfernt
Bild 17. Grafische Darstellung der Feuchteverteilung
Bild 18. Messtechniker beim Ermitteln der Indexwerte
Bild 19. Grafische Darstellung der Feuchteverteilung
Bild 20. Prüfnadel
Bild 21. Nahtprüfung mit Prüfnadel
Bild 22. Schlecht verschweißter T-Stoß, offene Naht
Bild 23. Hätten Sie die Beschädigung erkannt?
Bild 24. Ohne elektrisch leitfähige Schicht ist die elektrische Leitfähigkeit nicht zwingend gegeben
Bild 25. Dachaufbau mit elektrisch leitfähigem Glasvlies
Bild 26. Dachaufbau mit Edelstahlgitter
Bild 27. Stromfluss bei Einsatz einer elektrisch leitenden Schicht
Bild 28. Absperrblase zum Verschluss der Speier
Bild 29. Das Dach wird geflutet
Bild 30. Prinzipskizze Kontrollschacht
Bild 31. Handscanner
Bild 32. Prinzipskizze eines RFID-Sensors
Bild 33. Prinzipskizze Messung des Wasserstands
Bild 34. Prinzipskizze – Messung unterhalb der Abdichtung
Bild 35. Prinzipskizze – Messung auf der Dampfsperre
Bild 36. Prinzipskizze – Messung der relativen Luftfeuchte
C 6 Feuchtediagnostik als zwingende Planungsgrundlage bei Baumaßnahmen im Bestand
Bild 1. Feuchte- und Salzschäden in Form von Putzablösungen und Salzkristallisation im Bereich einer erdberührten Außenwand
Bild 2. Feuchtetransport und Wasseraufnahmemechanismen von einer erdberührten Kelleraußenwand
Bild 3. Zusammenhang zwischen Feuchtigkeitsprofilen und Feuchtigkeitsursachen gemäß [7]
Bild 4. Putzablösungen
Bild 5. Mörtelfugenaussandungen
Bild 6. Ziegelzerstörungen
Bild 7. Salzkristallbildungen
Bild 8. Feuchtesäume
Bild 9. Grundwasserganglinie der Messstelle 799 in Berlin-Rudow
Bild 10. Beschädigung der Abdichtung infolge von Bauschuttresten und fehlender Schutzschicht
Bild 11. Mangelhafter Anschluss der Abdichtung an eine Rohrdurchdringung
Bild 12. Unter- bzw. Hinterläufigkeit der Vertikalabdichtung im Übergangsbereich zu einer WU-Beton-Bodenplatte
Bild 13. CM-Gerät
Bild 14. Mikrowellenmessgerät mit Tiefensonde
Bild 15. Untersuchungsergebnis – Darstellung im Rahmen einer komplexen Feuchtediagnostik
C 7 Mauerwerkstrockenlegung
Bild 1. Hygroskopische Feuchtigkeitsaufnahme von Ziegeln [2]
Bild 2. Typische Schadensbilder bei durchfeuchtetem Mauerwerk [2]
Bild 3. Von der Zustandserhebung zum Sanierungskonzept [2]
Bild 4. Messprofile und Entnahmeorte, Durchfeuchtungsgrad, Sulfate [2]
Bild 5. Probenentnahme durch Ausstemmen [2]
Bild 6. Probenentnahme mittels Spiralbohrer [2]
Bild 7. Probenentnahme mittels Kernbohrer [2]
Bild 8. Zeitlicher Projektablauf [2]
Bild 9. Chromstahlblechverfahren [2]
Bild 10. Verfahrensablauf Sägeverfahren [2]
Bild 11. Horizontalkraftaufnahme durch Bodenplatten und genoppte Stahlbleche [2]
Bild 12. Bohrlochraster bei druckloser Injektion sowie Druckinjektion mit hydrophobierenden Injektionsmitteln [2]
Bild 13. Bohrlochraster bei Druckinjektion mit organischen Harzen [2]
Bild 14. Injektionsverfahren – Impuls-Sprüh-Verfahren, Infusionsrohr-Verfahren [2]
Bild 15. Wirksamkeitsüberprüfung der Injektionscreme am Objekt durch kapillare Saugversuche an Bohrkernen aus der Injektionsebene [2]
Bild 16. Mauerwerksentfeuchtung – Heizstabtechnik [2]
Bild 17. Mauerwerksentfeuchtung – Mikrowellentechnik [2]
Bild 18. Mauerwerksentfeuchtung – Vakuumtechnik [2]
Bild 19. Anwendungsbereiche Vertikalabdichtungen [2]
Bild 20. Herstellung eines innenliegenden Abdichtungs-Verbundsystems (IAVS) [2]
Bild 21. Sockeldetails Saniersockelputz [2]
Bild 22. Sockeldetails Zementputz [2]
Bild 23. Sockeldetails Steinsockel [2]
Bild 24. Anschlussdetails innen bei Unterbeton oder Kellerdecke [2]
Bild 25. Anschlussdetails innen bei Unterbeton [2]
Bild 26. Anschlussdetails innen – Wandabdichtung unter Kellerdecke [2]
C 8 Untersuchungen zur Vermeidung von Schadstofffreisetzungen aus Fußbodenkonstruktionen insbesondere im Zuge von technischen Trocknungen von Wasserschäden
Bild 1. Einschneiden von Dämmplatten zwischen Installationsleitungen (Foto: A. Piller)
Bild 2. Praxisübliche Installationsführung – Einschneiden von Dämmplatten kaum mehr möglich (Foto: H. Hafellner)
Bild 3. Typischer jahreszeitlicher Verlauf der Schimmelpilzkonzentration der Außenluft in KBE/m
3
in Erfurt/Deutschland [21]
Bild 4. Typischer jahreszeitlicher Verlauf der Schimmelpilzkonzentration im Hausstaub in KBE/g (Quelle: [21])
Bild 5. Prinzipskizze Trocknung im Unterdruckverfahren mit Lochsystem
Bild 6. Trocknung im kombinierten Verfahren, Einblasen und Absaugen über Randschienensystem, Falschluft über Estrichrandfugen der Stirnseiten
Bild 7. Straßenbildung vorprogrammiert (Foto: Sika Österreich GmbH)
Bild 8. Trocknung im Unterdruckverfahren mit Lochsystem, Phase Trocknungsfortschritt, Falschluft über Estrichrandfugen im Bereich des trockenen Bodenaufbaus
Bild 9. Trocknung im Unterdruckverfahren mit Randschienensystem, Phase Trocknungsfortschritt, Falschluft über Estrichrandfugen im Bereich des trockenen Bodenaufbaus
Bild 10. Trocknung im Unterdruckverfahren mit Randschienensystem, deutliche Verbesserung durch Randfugenabdichtung an den Schmalseiten des Raumes – weitgehende Verhinderung von über die Estrichrandfugen in den trockenen Bereichen einströmender Falschluft
Bild 11. Hygienetrocknung als kombiniertes Verfahren mit Randschienensystem, einzelnen Randfugenschienen und Abdichtung der Estrichrandfugen als geschlossenes System
Bild 12. Fußbodenaufbau mit schwimmendem Estrich
Bild 13. Estrichrandfuge mit Fugenverschluss
Bild 14. Randfugenabdichtung (grün), Einblasöffnung (rot) und Luftaustritte bei nicht vorhandenen Expansionsluftöffnungen (blau)
Bild 15. Einblasöffnung in Raummitte und Sporensammler
Bild 16. Messung der Luftgeschwindigkeit
Bild 17. Einlegen des Silikonschlauches
Bild 18. Sehr gute Anpassung an unebene Untergründe (hier noch ohne Schichtstärkenbegrenzung)
Bild 19. Beobachtungsstreifen entlang der Wohnungstrennwand
Bild 20. Sichtfenster mit beginnendem Kapillartransport in der Schüttung
Bild 21. Schematische Darstellung des Grenzschichtmodells
Bild 22. Beispiel für ein TDR-Diagramm
Bild 23. Vor-Ort-Messung während der Flutung der Fußbodenkonstruktion
Bild 24. Ausgewertete Parameter
Bild 25. Schematischer Grundriss des Versuchsraumes; Positionsverschiebung für den nassen Fall
Bild 26. Positionsverschiebung für den feuchten Fall
Bild 27. Pegeländerung für den nassen Fall
Bild 28. Pegeländerung für den feuchten Fall
Bild 29. Trocknung über die Estrichrandfugen ohne Beeinträchtigung des Fußbodenaufbaus
Bild 30. Trocknungsluftzufuhr über Estrichbohrungen, Abluft über Randfugen
Bild 31. Vertikalschnitt durch Estrichrandfuge und ventilartiges Element
C 9 Instandsetzungsplanung bei feuchte- und salzgeschädigtem Mauerwerk
Bild 1. Wassereinwirkung, Wassereinwirkungsklassen und Anwendungsbereiche für Abdichtungen erdberührter Bauteile nach DIN 18533
Bild 2. Bestandteile Instandsetzungskonzept zur Trockenlegung feuchtegeschädigten Mauerwerks (mit Abschnittsverweisen)
Bild 3. Gefahr der Schichtdickenunterschreitungen bei Steinkantenversätzen
Bild 4. „Effektivität“ einer Kratzspachtelung
Bild 5. Verbesserung der Schichtdickeneinhaltung nach Aufbringung eines Dünn- und Ausgleichsputzes
Bild 6. Außenwandabdichtung auf Bestandsmauerwerk
Bild 7. Zusätzliche Überdeckung des Übergangsbereichs einer Kelleraußenwandabdichtung im Anschluss an die Querschnittsabdichtung mit einer Bentonitmatte
Bild 8. Prinzipskizze zum Injektionsschleier im Baugrund
Bild 9. Prinzipskizze zur Ausbildung des Übergangs zwischen einer bituminösen Abdichtung und einer Schleierinjektion
Bild 10. Prinzipskizze zur Ausbildung einer nachträglichen Innenwandabdichtung mit einer Dichtungsschlämme
Bild 11. Vorbereitung einer Wandfläche zur Aufnahme einer nachträglichen Innenabdichtung mit partieller Reparatur des Fugennetzes sowie Injektion gegen kapillar aufsteigende Feuchte am Wandkopf
Bild 12. Prinzipskizze zur Ausbildung einer wasserdruckhaltenden Abdichtung mit einem bituminös abgedichteten Stahlbetoninnentrog [14]
Bild 13. Flächenabdichtung im Bauteil
Bild 14. Anschluss Vertikalabdichtung zur Querschnittsabdichtung und zur Sohle am Beispiel PMBC [9]
Bild 15. Instandsetzungsempfehlung für eine nachträgliche Innenabdichtung der Sohle [9]
C 10 Grundinstandsetzung der Staatsoper Unter den Linden in Berlin
Bild 1. Die fertiggestellte Staatsoper Unter den Linden während des Festivals of Lights im Oktober 2017
Bild 2. Ansicht der Staatsoper Unter den Linden vor der Umbau- und Instandsetzungsmaßnahme im Jahre 2009
Bild 3. Schnitt durch das Bühnenhaus des Operngebäudes aus dem Jahr 1928 [1]
Bild 4. Grundriss des Bühnenhauses mit Fugeneinteilung der Planung aus den 1920er-Jahren [1]
Bild 5. Abdichtung der Blockfugen der Sohle des Bühnenhauses aus den 1920er-Jahren [1]
Bild 6. Abdichtungsführung im Bereich der aufgehenden, tragenden Pfeiler des Bühnenhauses aus den 1920er-Jahren [1]
Bild 7. Aus Rissen im Beton austretende Asphaltmasse der Biehnschen Abdichtung ca. 80 Jahre nach Bauwerkserrichtung
Bild 8. Bohrkernentnahmestelle mit erkennbarer Asphaltansammlung im Bereich von Rissen und Hohlräumen der Betonwand
Bild 9. Alte Undichtigkeiten der Wandkonstruktion durch Kalkaussinterungen verschlossen
Bild 10. Grundriss der Gesamtbaumaßnahme mit Eintragung der unterschiedlichen Abdichtungsvarianten für den Umbau und die Instandsetzung [2]
Bild 11. Abdichtungsdetail der Sohle im Bereich geringer Eintauchtiefe in das Grundwasser [2]
Bild 12. Grundriss des Bühnenhauses mit Kennzeichnung der unterschiedlichen Abdichtungsverfahren [2]
Bild 13. Blick in das Bühnenhaus während der Herstellung der Stahlblechwanne
Bild 14. Prinzipdarstellung der Sohlenausbildung mit Stahlblechabdichtung des Bühnenhauses [2]
Bild 15. Exemplarische Blockfugenausbildung oberhalb der Bühnenhausfundamente im Bau
Bild 16. Blockfugenausbildung mit eingesetztem Fugenprofil (Detail)
Bild 17. Prinzipdarstellung der Abdichtung des Bühnenhauses im Bereich aufgehender Wände und Pfeiler sowie im Übergangsbereich der Wasserwechselzone [2]
Bild 18. Stahlblechsohle mit Trägerrost der Unterbühne
Bild 19. Stahlblechwanne der Unterbühne – Übergang Bodenplatte/Pfeilerummantelung [2]
Bild 20. Detail Stahlblechsohle mit Trägerrost und Rückverankerungen
Bild 21. Ausbetonierter Trägerrost der Unterbühnensohle
Bild 22. Stahlblechwanne im Bereich der Lichtschächte [2]
Bild 23. Stahlwanne im Lichtschachtbereich nach erfolgter Schweißnahtprüfung (violette und weiße Markierungen)
Bild 24. Nördliche Unterbühnensohle zum Zeitpunkt des Einbaus der Verbundanker
Bild 25. Prüfeinrichtung für die Belastungsversuche der Verbundanker
Bild 26. Betonierarbeiten an der Unterwasserbetonsohle des Zuschauerhauses (Positionierung der Bewehrungskörbe mit Peilstangen)
Bild 27. Unterwasserbetonsohle des Zuschauerhauses (einbetonierte Peilstangen dienen gleichzeitig als Rückverankerung der Abdichtung und des Aufbetons)
Bild 28. Fertigstellung der Unterwasserbetonsohle (mit den Peilstangen rückverankerte Dichtteller für die Abdichtungsflansche)
Bild 29. Bituminöse Abdichtung auf der Unterwasserbetonsohle mit Gewindestangen (durch Hüllrohre in der Bauphase geschützt) zur Rückverankerung des Aufbetons in der Unterwasserbetonsohle
Bild 30. Abdichtungsführung unter Bestandsstützen (Abdichtungsprinzip A – Trennung der Stütze und Stahlgrundplatte als Los-Festflansch-Konstruktion) [2]
Bild 31. Abgefangene und aufgetrennte Bestandsstütze
Bild 32. Bestandsstütze mit montierter Stahlgrundplatte und Flanschkonstruktion zum Anschluss der bituminösen Abdichtung
Bild 33. Bestandsstütze nach Anschluss der bituminösen Abdichtung und vor Betonage des Aufbetons
Bild 34. Abdichtungskragen aus Stahl an Bestandsstütze (Abdichtungsprinzip B – Hochführung der Abdichtung bis über HGW) [2]
Bild 35. Stahlummantelung Bestandsstütze
Bild 36. Stahlblechauskleidung des Medienkanals in der Sohle des Zuschauerhauses mit Blechdicken bis zu 30 mm [2]
Bild 37. Medienkanal während der Bauausführung
Bild 38. Medienkanal mit Stahlblechabdichtung
C 11 Wärmedämmung im Erdreich
Bild 1. Beispielhafter Jahresverlauf mittlerer Temperaturprofile im ungestörten Erdreich (eigene Darstellung nach [2])
Bild 2. Bodendämmung mit XPS-Platten bei einer komplizierten Bodenform und unterschiedlichem Bodenniveau, München Seitzstraße (Foto: FIW München)
Bild 3. Bodenplattendämmung des Hotel Adlon in Berlin als Beispiel für das Bauen in Innenstadtlage mit Spundwänden (Foto: DOW Deutschland)
Bild 4. Perimeterdämmung mit abgedichteten Fugen und seitlichen Rändern (Foto: JACKON Insulation GmbH)
Bild 5. Arten der Wasserbelastung an einem erdberührten Bauwerk (Autor nach [16])
Bild 6. Ausbau einer Kellerwanddämmung aus XPS nach 29 Jahren Einbauzeit aus einem Privathaus in Ladenburg (Foto: FIW München)
Bild 7. Beispiel einer CE-Kennzeichnung nach Anhang ZA der DIN EN 13164
Bild 8. Anbringung von EPS als Perimeterdämmung (Foto: FIW München)
Bild 9. Vollflächiges Aufbringen des Klebers auf eine XPS-Platte (Foto: BASF SE)
Bild 10. Vollflächige Verklebung von Schaumglas-Platten an der Kelleraußenwand für die Anwendung im drückenden Wasser (Foto: Deutsche FOAMGLAS GmbH)
Bild 11. Wärmedämmung eines Sockels vor dem Anbringen des WDV-Systems (Foto: BASF SE)
Bild 12. Anwendung von Schaumglasplatten an der Kelleraußenwand und unter der lastabtragenden Gründungsplatte (Deutsche FOAMGLAS GmbH)
Bild 13. Verlegung einer XPS-Dämmung unter der lastabtragenden Gründungsplatte auf einer Sauberkeitsschicht (Foto: BASF SE)
Bild 14. Verlegung von Schaumglasplatten unter der Gründungsplatte mit Bitumen als Kleber und zwischen den Platten (Foto: Deutsche FOAMGLAS GmbH)
Bild 15. Betonieren der Gründungsplatte (Foto: DOW Deutschland)
Bild 16. Ausbau einer XPS-Perimeter-Dämmplatte der Wanddämmung im drückenden Wasser eines Seniorenheims in Bottrop mit Grundwasserabsenkung um ca. 1 m (Foto: FIW München)
Bild 17. Ausbau einer XPS-Perimeterdämmung aus der Kellerwand eines Privatgebäudes in Bocholt im drückenden Wasser mit Grundwasserabsenkung um ca. 1 m (Foto: FIW München)
Bild 18. Dreilagige Verlegung von XPS-Platten unter der lastabtragenden Gründungsplatte eines Wohngebäudes (Foto: DOW Deutschland)
Bild 19. Mehrlagig verschweißte XPS-Platte mit 400 mm Nenndicke (Foto: FIW München)
Orientierungspunkte
Cover
Inhaltsverzeichnis
Fangen Sie an zu lesen
Seitenliste
C1
I
II
III
IV
V
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497





























