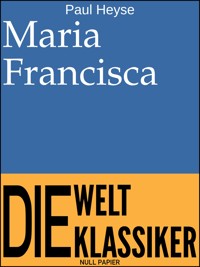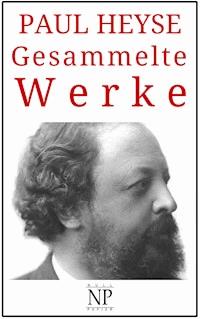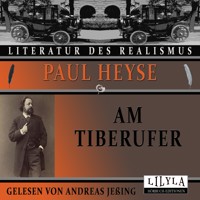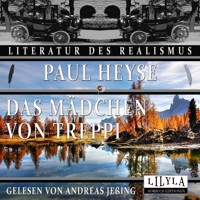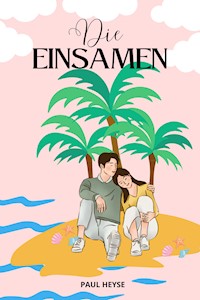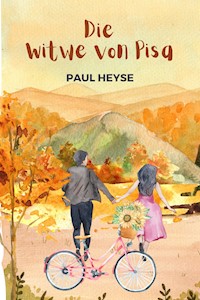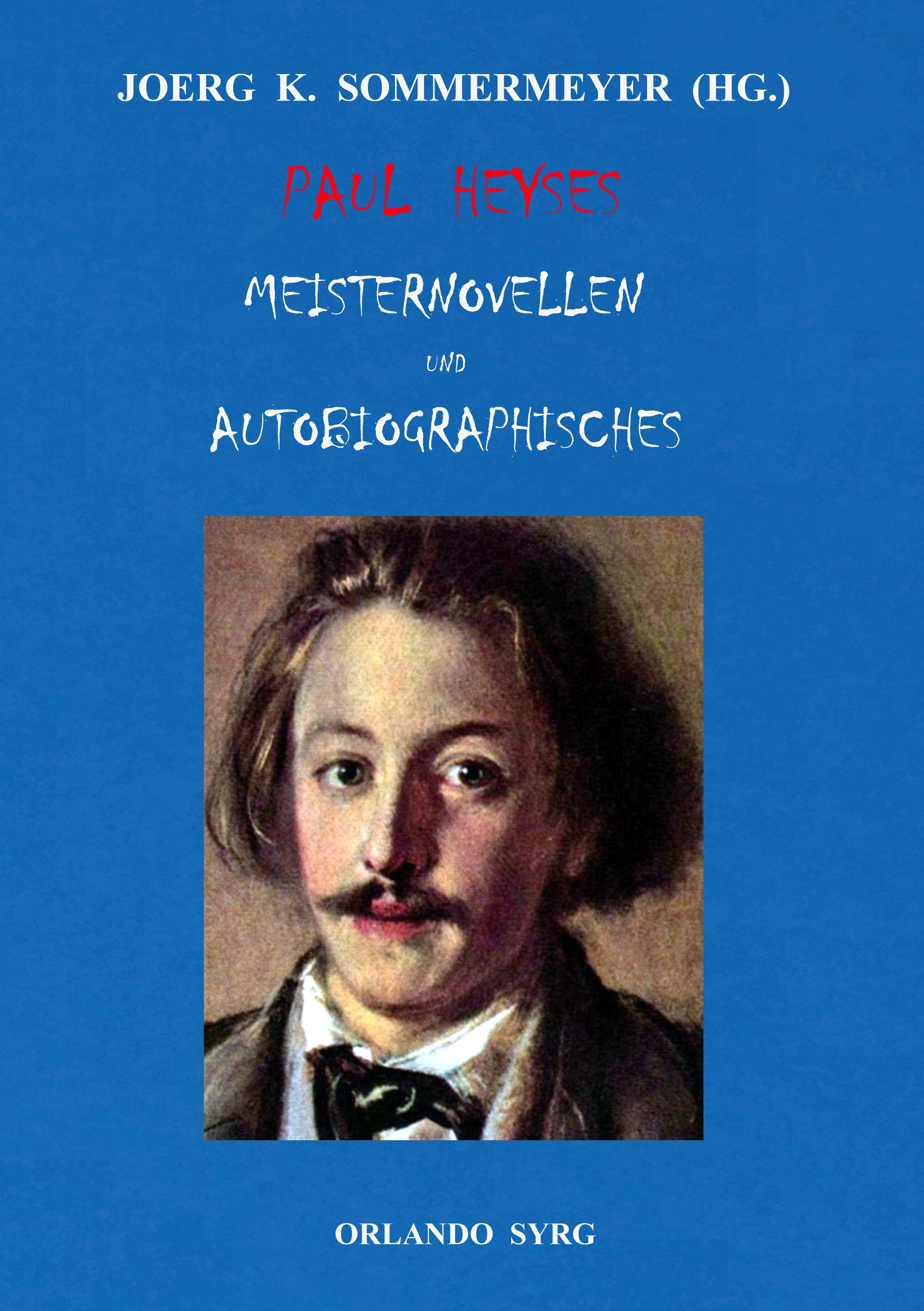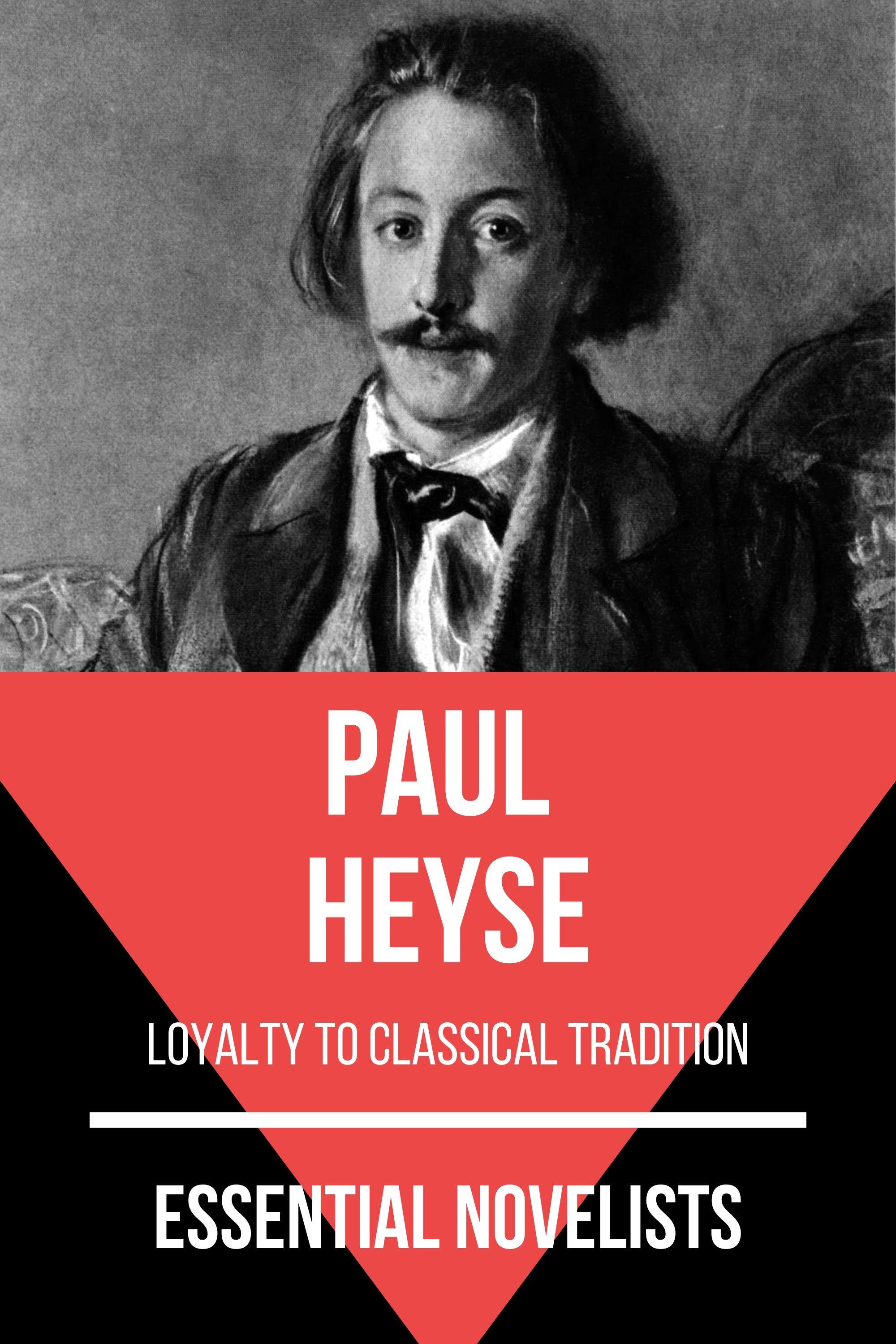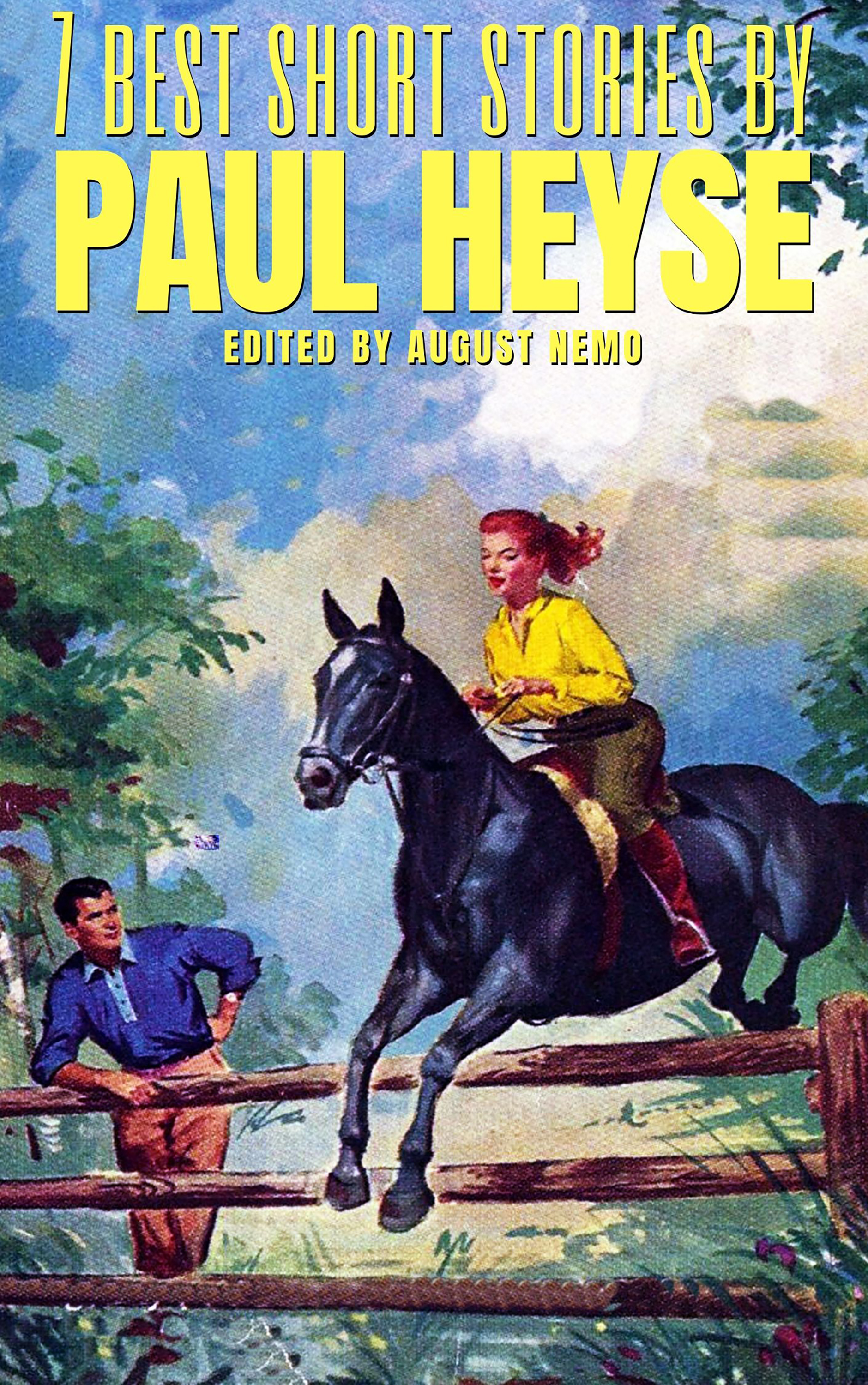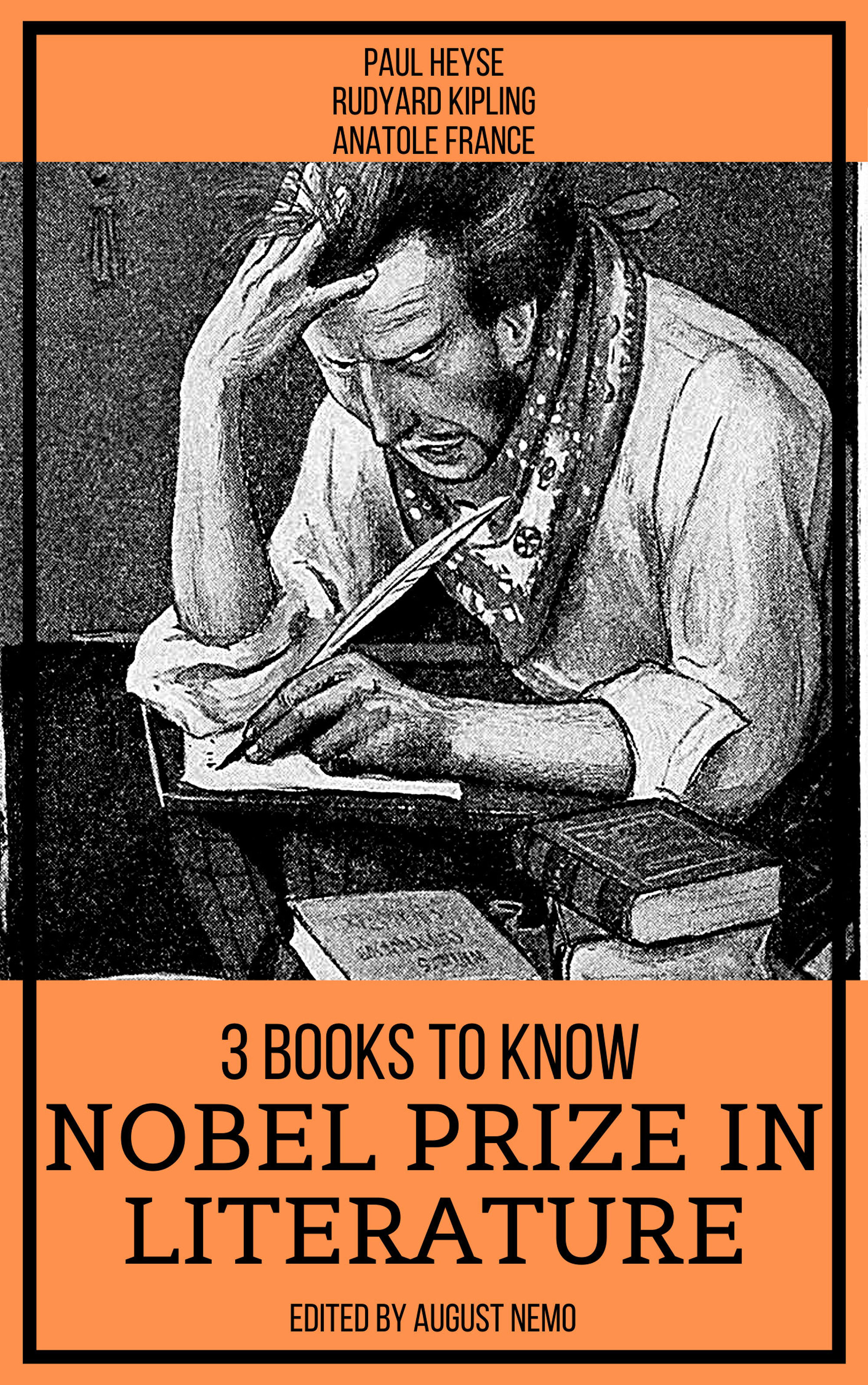Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Null Papier Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: 99 Welt-Klassiker
- Sprache: Deutsch
Neue Deutsche Rechtschreibung Paul Johann Ludwig von Heyse (15.03.1830–02.04.1914) war ein deutscher Schriftsteller, Dramatiker und Übersetzer. Neben vielen Gedichten schuf er rund 180 Novellen, acht Romane und 68 Dramen. Heyse ist bekannt für die "Breite seiner Produktion". Der einflussreiche Münchner "Dichterfürst" unterhielt zahlreiche – nicht nur literarische – Freundschaften und war auch als Gastgeber über die Grenzen seiner Münchner Heimat hinaus berühmt. 1890 glaubte Theodor Fontane, dass Heyse seiner Ära den Namen "geben würde und ein Heysesches Zeitalter" dem Goethes folgen würde. Als erster deutscher Belletristikautor erhielt Heyse 1910 den Nobelpreis für Literatur. Null Papier Verlag
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 103
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Paul Heyse
Beatrice
Novelle
Paul Heyse
Beatrice
Novelle
Veröffentlicht im Null Papier Verlag, 2024Klosterstr. 34 · D-40211 Düsseldorf · [email protected] 2. Auflage, ISBN 978-3-962811-16-7
null-papier.de/neu
Danke
Danke, dass Sie sich für ein E-Book aus meinem Verlag entschieden haben.
Sollten Sie Hilfe benötigen oder eine Frage haben, schreiben Sie mir.
Ihr Jürgen Schulze
99 Welt-Klassiker
Der Tee der drei alten Damen
Arme Leute und Der Doppelgänger
Der Vampir
Der seltsame Fall des Dr. Jekyll und Mr. Hyde
Der Idiot
Jane Eyre
Effi Briest
Madame Bovary
Ilias & Odyssee
Geschichte des Gil Blas von Santillana
und weitere …
Newsletter abonnieren
Der Newsletter informiert Sie über:
die Neuerscheinungen aus dem Programm
Neuigkeiten über unsere Autoren
Videos, Lese- und Hörproben
attraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehr
https://null-papier.de/newsletter
Beatrice
(1867)
Wir hatten bis in die tiefe Nacht hinein geplaudert, unser drei, bei einigen Flaschen Astiweins, die wir durch einen glücklichen Zufall aufgetrieben hatten und nun im kühlen Gartenhaus auf das Wohl des eben aus Italien heimgekehrten Freundes leerten. Er war der älteste von uns und schon ein fertiger Mann, als wir ihn vor zwölf Jahren auf einer Reise im Süden kennenlernten. Auf den ersten Blick hatte uns seine männliche Gestalt, der Adel seines Wesens und eine gewisse melancholische Anmut seines Lächelns für ihn eingenommen. Sein Gespräch, seine ungewöhnliche Bildung und die Bescheidenheit, mit der er sie geltend machte, gewannen uns vollends, und die drei Wochen, die wir miteinander in Rom zubrachten, befestigten eine so warme Freundschaft, wie sie nur je zwischen Ungleichaltrigen bestanden hat. Dann musste er plötzlich nach Genf, seiner Heimat, zurück, wo er an der Spitze eines ansehnlichen Handlungshauses stand. Aber in den folgenden Jahren hatten wir keine Gelegenheit versäumt, uns wiederzusehen, und auch jetzt war ihm der Umweg über unsere Stadt nicht zu weit gewesen, um uns wenigstens auf vierundzwanzig Stunden zu begrüßen.
Wir fanden ihn in seinem Aussehen unverändert; er war noch immer ein schöner Mann, das Haar kaum mit dem ersten Grau angesprengt, die hohe Stirn glatt und weiß. Aber er schien uns schweigsamer als bei unserem letzten Begegnen, manchmal so in sich versinkend, dass er unsere Fragen überhörte, während er minutenlang unverwandt die Perlen des Weins im Glase aufquellen sah oder ein Stück Eis langsam am Kerzenlicht zertauen ließ. Wir dachten ihn gesprächig zu machen, wenn wir ihn nach seiner letzten Reise ausfragten. Aber als auch dieses Lieblingsthema nicht sonderlich einschlug, ließen wir ihn gewähren und sprachen unter uns, froh, dass wir ihn wenigstens leiblich bei uns hatten, und ruhig abwartend, wann er auch geistig zu uns zurückkehren würde.
Indessen kramte ich allerlei Gedanken aus, die mich seit kurzem lebhaft beschäftigt hatten und die, unreif und schroff, wie ich sie hinwarf, den Widerspruch unseres Freundes, der ein scharfer Dialektiker war, zu jeder anderen Zeit gereizt haben würden. Der Zustand des Theaters in Italien hatte den Anstoß gegeben. Ich behauptete, es sei durchaus nicht wunderbar, dass es die Italiener, so pathetisch und leidenschaftlich sie sich gebärdeten, nicht zu einer tragischen Literatur gebracht hätten, die sich neben die griechische, englische und deutsche stellen könnte. Im Grunde sei es bei den Spaniern und Franzosen, trotz ihrer hochberühmten dramatischen Blüteperioden, nicht viel besser damit bestellt. Denn das Temperament der Romanen, ihre Natur wie ihre Kultur, seien nun einmal so streng an das Konventionelle gebunden, dass die eigentlichsten tragischen Probleme, die alle auf der Selbstherrlichkeit des Individuums beruhten, ihnen kaum verständlich würden; dazu komme noch, dass sie auch in der Form sich nie zu befreien und die rücksichtslosen Naturlaute anzuschlagen wagten, die allein den tragischen Schauder in uns erregen könnten. – Wie jedes ästhetische Gespräch, das nicht bloß an der Schale herumtastet, führte auch dieses bald in die rätselhaften Tiefen der Menschennatur, und während Amadeus scheinbar teilnahmslos mit seinem silbernen Stift Figuren in den verschütteten Wein zeichnete, nahm Otto lebhaft Partei für das, was ich als Konvention zu verdammen schien, er aber als das streng waltende Sittengesetz auch in der Dichtung obenan stellte. Mein Satz schien ihm gefährlich, dass jeder tragische Fall das Naturrecht der Ausnahme gegen das bürgerliche Recht der Regel verherrlichen müsse, dass demnach der Begriff einer tragischen Schuld auf das Verbrechen hinauslaufe, einen Dämon im Busen zu haben, der den einzelnen über die engen Schranken der Alltagssatzung hinaushöbe und ihn darin bestärke, mit nichts sich abzufinden, nichts zu dulden, nichts zu verehren, was dem innersten Gefühl widerstreite. Damit lösest du, sagte er, die ganze Weltordnung, die doch wohl ihre guten Gründe hat, zu Gunsten eines unbegrenzten Individualismus auf und scheinst nur dem wahren Wert für die Poesie zuzuerkennen, was sich außer das Gesetz stellt. – Ich suchte ihn dabei festzuhalten, dass es sich hier nur um die eigentlich tragischen Kollisionsfälle handle, und dass große und starke, mit einem Wort, heroische Seelen den Streit der Pflichten anders zu lösen pflegten als der ängstliche, von kleinen Gewohnheiten und Rücksichten eingeengte Mittelschlag der Philister. Geniale Naturen, sagt’ ich, die auf sich selbst beruhten, erweitern durch ihre Handlungen, indem sie das Maß ihrer inneren Kraft und Größe als ein Beispiel vorleuchten lassen, ebenso sehr die Grenzen des sittlichen Gebiets, wie geniale Künstler die hergebrachten Schranken ihrer Kunst durchbrechen und weiter hinausrücken. Und was an Obermaß und Übermut des Selbstgefühls in jenen heroischen Seelen sich rühren mag, wird es nicht eben durch den tragischen Untergang geläutert und gebüßt? Wenigstens nach der Meinung der Philister, denen das Leben das höchste Gut ist, die also auch schwerlich von Handlungen und Gesinnungen zu verführen sind, auf die nach dem Weltlauf der Tod gesetzt ist. Der Dichter aber und die, die ihn verstehen, wird sich das Recht nicht verkümmern lassen, sich der hohen Erscheinungen zu erfreuen, für welche die üblichen Zollstöcke der Moral nicht passen wollen. Und wer das unsittlich schilt, was bei unseren traurig mangelhaften bürgerlichen Einrichtungen starken und freien Menschen als eine heilige Notwehr übrig bleibt, für den ist Schönes nie geschaffen worden, und vom Guten kennt er nur das Nützliche.
Dieses und ähnliches hatt’ ich gesagt, als auf einmal Amadeus aus seinem Hinbrüten zu mir aufsah und mir über den Tisch hinüber die Hand reichte. Ich danke dir, sagte er; du hast da ein gutes Wort gesprochen, das mir wohltut. Unter uns Dreien kann ja auch kein Streit darüber sein, dass die Sitte nicht das Maß der Sittlichkeit ist, und dass die höchsten Aufgaben der Poesie an den Grenzen der Menschheit liegen. Aber gegen eins muss ich Einsprache erheben: dass du den Mangel eines wahrhaft großen tragischen Poeten in Italien aus der konventionellen Gebundenheit des Volkscharakters erklären willst. Als ob Gemüts- und Geschmacksanlagen, Sittliches und Ästhetisches sich notwendig Hand in Hand entwickelten, nicht oft genug eins das andere überholte! Wenn den Italienern das große tragische Talent geboren würde, das sie in ihrem Alfieri freilich längst zu besitzen wähnen, – der Genius des Volkes würde ihm auf halbem Wege entgegenkommen, und die akademischen Vorurteile des Stils hielten gegen eine echte Naturkraft so wenig stand, wie alle anerzogene konfessionelle Sitte gegen das Recht und die Pflicht eines frei geborenen Gemüts. Nein, fuhr er in sichtbarer Erregung fort, und seine Augen schimmerten feucht, das hohle Pathos ihrer Trauerspiele ist nicht der Grundton, auf den die Seele dieser edlen Nation gestimmt ist. Ich wenigstens darf dies nicht anhören, ohne Verwahrung einzulegen. Denn wenn es je ein Wesen gab, das in seinem Gefühl und Handeln auf sich beruhte und seinem Dämon gehorchte, so war es mein Weib, und mein Weib war eine Italienerin.
Er schwieg und wir saßen in der wunderbarsten Erregung ihm gegenüber, ebenfalls stumm und atemlos vor Überraschung. So gut wir ihn und all seine Verhältnisse zu kennen meinten, zum ersten Male hörten wir heute, dass er verheiratet gewesen sei, mit einer Frau, die er so hoch stellte und die er uns doch verleugnet hatte, wie man eine Verirrung verheimlicht.
Nun stand er auf und ging in dem engen, halbdunkeln Raum eine Weile auf und ab, und wir störten ihn weder mit Fragen noch mit Blicken. Endlich trat er zwischen uns und sagte mit seiner tiefen, klangvollen Stimme: Ich habe es euch nicht erzählt, weil mich die Erinnerung zu sehr übermannt und manchmal, wenn ich es nur mir selbst so recht gegenwärtig machte, mich ein Fieber befiel, das mich eine Woche lang nicht wieder verließ. Und doch ist es mir wie eine Schuld gegen euch vorgekommen, dass ich auf alle eure Neckereien, warum ich keine Frau genommen, nur immer mit Scherzen antwortete. Ihr könnt glauben, hauptsächlich um dies endlich zwischen uns ins klare zu bringen, habe ich diesmal, da ich wieder von ihrem Grabe komme, den Heimweg so eingerichtet, dass ich euch treffen musste. Lasst mich also alles heraussagen, wie es mir auf die Zunge kommt. Wir wollen erst noch die Fenster nach dem Garten öffnen; es ist hier so schwül, dass man schwer Atem holt. So! – und nun trinkt und raucht, und ich will auf und ab gehen. Ein Vierteljahrhundert ist darüber hingegangen, und doch steht alles wie von gestern neben mir und lässt mich nicht ruhig bleiben.
Was er dann berichtete, bis an die Morgendämmerung – denn auch nachher konnten wir uns nicht so bald trennen – schrieb ich am folgenden Tage auf, soviel ich konnte mit seinen eigenen Worten. Damals dachte ich nicht, dass es in Wahrheit sein letztes Vermächtnis sein würde. Aber er hatte nicht zu viel gesagt. Die Nacht, in der er es uns erzählte, trug ihm ein Fieber ein, das ihn bis nach Hause begleitete. Eine nächtliche Aufregung beim Löschen eines Hausbrandes trat hinzu. Wenige Wochen, nachdem wir ihn zuletzt gesehen, kam die Nachricht, dass wir ihn verloren hatten.
Nun sind mir diese Aufzeichnungen um so wertvoller, und kaum kann ich mich entschließen, fremde Augen hineinblicken zu lassen. Dann wieder empfinde ich es als eine Pflicht, das wundersame Geschick dieser beiden Menschen nicht im Dunkeln zu lassen. Sollte nicht das, was hohe und edle Menschen erleben, Eigentum der ganzen Menschheit sein?
So will ich ihn denn erzählen lassen.
Ich war eben fünfundzwanzig Jahre alt geworden, als mein Vater starb; seit ich seinen schmerzlichen Todeskampf mit angesehen, schien ich mir um zehn Jahre älter. Kurz vorher hatte meine einzige Schwester, die ich sehr liebte, einen jungen Geschäftsfreund unseres Hauses geheiratet, einen Franzosen, dessen Familie seit lang in Genf angesiedelt war, und der nun seinen Namen unserer Firma hinzufügte. Wir standen uns so nah wie Brüder, und als er und meine Schwester in mich drangen, einige Monate auf Reisen zu gehen, um meine verstörten Lebensgeister wieder ins Gleiche zu bringen, ließ ich mich hierin wie in allen Dingen gern von ihnen bestimmen, zumal ich wohl fühlte, dass ich einer Hilfe von außen sehr bedürftig war.
Auch wirkte die Luftveränderung bald, wie meine Lieben gehofft hatten. Jugend und Lebensmut kehrten mir zurück; ich hatte wieder offene Augen für alle Schönheiten der Natur, und mein Sinn für die Künste, der schon auf früheren Reisen in Deutschland und Frankreich geweckt worden war, fand reiche Nahrung in Mailand und Venedig, wohin ich mich zunächst wandte, um dann in mäßigen Tagesreisen südlicher zu gehen.
Vor allem zog es mich nach Florenz, und die Herrlichkeiten, die ich dort zu finden hoffte, machten mich gegen manches undankbar, was mir auf dem Wege dahin begegnete. So hatt’ ich mir auch für Bologna nicht mehr als einen einzigen Tag festgesetzt, Kirchen und Galerien hastig durchrannt und mich am Nachmittag in einen Wagen geworfen, um nach dem alten Klosterhügel San Michele in Bosco hinauszufahren und mit einer Rundschau von da oben herab mein Reisegewissen über diese merkwürdige Stadt zu beruhigen.
Es war einer der heißesten Tage jenes Hochsommers, und obwohl ich sonst gegen jede Temperatur ziemlich unempfindlich war, lähmte mich doch heute die Schwüle bis zur Erschöpfung. Die Straße, die von San Michele nach der Stadt zurückführt, war völlig öde. Über die Mauern der Gärten ragten die Bäume und Büsche dick verstaubt herüber, die Räder des Wagens gruben sich in den handhohen glühenden Staub schwerfällig ein, mein Kutscher nickte so schlaftrunken auf dem Bock, dass er sich kaum im Gleichgewicht hielt, und sein müdes Tier schlich mit gesenkten Ohren ganz am Rande der Chaussee, um den schmalen Schatten mitzunehmen, den hie und da eine Villa oder Gartenhecke über die Straße warf. Ich hatte mich auf dem Rücksitz bequem ausgestreckt und mir aus meinem Regenschirm ein Zelt gemacht, unter dem ich in einer Art Halbschlaf hindämmerte.