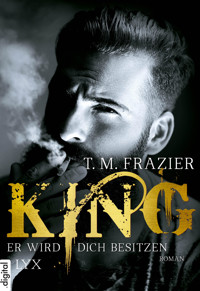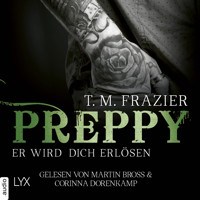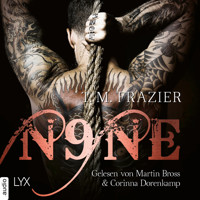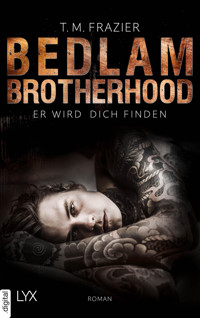
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Bedlam Brotherhood
- Sprache: Deutsch
Weil in der Liebe und im Bandenkrieg alles erlaubt ist ...
Grim erwartet nicht mehr viel vom Leben. Von einer Pflegefamilie zur nächsten gereicht, hat er aufgegeben, irgendwo dazugehören zu wollen, etwas zu fühlen und irgendwann sogar zu sprechen. Bis er Emma Jean kennenlernt. Ihre erste Begegnung dauert nur wenige Minuten, eine unschuldige Berührung und ein paar Worte lang - und verändert beide für immer. Sie sehen sich nie wieder und können sich doch nicht vergessen. Fünf Jahre später steckt Grim als Scharfrichter des berühmt-berüchtigten Bedlam Brotherhoods metertief im Bandenkrieg von New Mexico. Insgeheim ist er immer noch auf der Suche nach Emma Jean - und findet sie bei den Los Muertos, seinem größten Feind. Er und die Meisterdiebin der rivalisierenden Gang wissen beide, dass das Leben sie auf die falschen Seiten eines erbitterten Krieges gestellt hat, und dass sie sich von einander fernhalten müssen. Doch ihrem Verlangen nach einander ist das leider völlig egal ...
"Diese Trilogie ist episch! Wer die KING-Reihe liebt, wird BEDLAM BROTHERHOOD vergöttern." MEGHAN MARCH
Band 1 der Dark-Romance-Reihe BEDLAM BROTHERHOOD von USA-TODAY-Bestseller-Autorin T. M. Frazier
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 279
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Inhalt
Zu diesem Buch
Titel
Widmung
Motto
Prolog
Die Vergangenheit
1
2
3
4
5
Fünf Jahre später …
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Danksagungen
Die Autorin
Die Romane von T. M. Frazier bei LYX
Impressum
Zu diesem Buch
Grim erwartet nicht mehr viel vom Leben. Von einer Pflegefamilie zur nächsten gereicht, hat er aufgegeben, irgendwo dazugehören zu wollen, etwas zu fühlen und irgendwann sogar zu sprechen. Bis er Emma Jean kennenlernt. Ihre erste Begegnung dauert nur wenige Minuten, eine unschuldige Berührung, ein paar Worte lang – und verändert beide für immer. Sie sehen sich nie wieder und können sich doch nicht vergessen. Fünf Jahre später steckt Grim als Henker des berühmt-berüchtigten Bedlam Brotherhoods metertief im Bandenkrieg von New Mexiko. Insgeheim ist er immer noch auf der Suche nach Emma Jean – und findet sie bei den Los Muertos, seinem größten Feind. Er und die Meisterdiebin der rivalisierenden Gang wissen beide, dass das Leben sie auf die falschen Seiten eines erbitterten Krieges gestellt hat und dass sie sich voneinander fernhalten müssen. Doch ihrem Verlangen zueinander ist das leider völlig egal …
T. M. Frazier
Bedlam Brotherhood
ER WIRD DICH FINDEN
Ins Deutsche übertragen von Stephanie Pannen
In der Liebe und im Bandenkrieg ist alles erlaubt.
Für diejenigen, die denken, dass sie auf dieser Welt
ganz allein sind.
Ihr seid es nicht.
Ihr seid geliebt.
Ihr seid einzigartig.
Ihr seid wichtig.
Ihr seid ALLES.
Für einen Jungen namens James, auch bekannt als »Little Preppy«, der ein brandneues Herz bekommen hat.
All meine Liebe und mehr.
Immer für L & C
IMMER
Perversion|/|
Substantiv, feminin
Abweichung vom ursprünglichen Kurs, der ursprünglichen Bedeutung oder dem ursprünglichen Zustand zu einer Verzerrung oder Verkehrung der eigentlichen Absicht: Eine skandalöse Perversion des Gesetzes | Alles große Böse ist eine Perversion des Guten.Sexuelles Verhalten oder Begehren, das als abnormal oder unakzeptabel betrachtet wird.Lacking, Florida
Statistische Angaben
Einwohnerzahl: 15 244
Durchschnittsalter der Einwohner: 26,6
Durchschnittliches Haushaltseinkommen: $ 13 327
Armutsanteil: 74,8 %
Rating auf der Städte-Sicherheitsskala: 2 (Sicherheitshöchstwert 100)
»Evil has no substance of its own, but is only the defect, excess, perversion, or corruption of that which has substance.«
John Henry Newman
Prolog
Grim
Die Straßen von Lacking sind seit Jahren blutrot gefärbt. Mit jedem Tag eskaliert die Gewalt mehr. Auf den Straßen und Gehwegen verrotten Leichen voller Schusslöcher. Als Warnung. Als Zeichen der Macht.
Ein Hinweis, wer hier wirklich darüber entscheidet, wer lebt und wer stirbt, während die drei Hauptgangs um diese Ehre konkurrieren.
Die Einwohner dieser mit Graffiti bedeckten Stadt fürchten das ständige Blutvergießen, den niemals endenden Kugelhagel. Sie fürchten sich davor, zur falschen Zeit im falschen Territorium unterwegs zu sein, die falsche Farbe zu tragen oder die falsche Sache zu sagen. Davor, der Person, die ihnen eine verdammte Pistole in den Mund steckt, nicht auf korrekte Weise Gefolgschaft zu schwören.
Die Einwohner verlassen ihre Häuser nicht mehr nach Einbruch der Dunkelheit.
Einige verlassen sie gar nicht mehr.
Das einzige Gesetz, das es hier noch gibt, ist das der Gangs. Gerechtigkeit kommt nur in Form einer Kugel oder eines Messers. Es ist eine Kombination aus Wildem Westen und gottverdammtem Weltuntergang.
Und es ist mein Zuhause.
Ich bin einer der Gründe, warum die Menschen solche Angst haben, ihr eigenes Zuhause zu verlassen.
Mord strömt durch meine Adern wie ein entgleister Zug.
Man kann nichts so Gutes tun, wenn man nicht mit einem Stück davon geboren wurde. Wenn es etwas anderes wäre, wie Kunst oder das Geschäftsleben, würden die Leute das, was ich habe, Talent nennen. Eine Leidenschaft. Aber ich bin kein verdammter Künstler oder Buchhalter. Mein Geschäft ist die Rache. Darin bin ich gut. Leben zu nehmen, um die Leben derjenigen in der Bruderschaft zu retten. Um ein Zeichen zu setzen. Um eine Botschaft auszurichten.
Oder einfach nur zum Vergnügen.
Dazu wurde ich geschaffen.
Wenn dies das Mittelalter wäre, bin ich mir sicher, dass ich der Mann mit der Kapuze wäre, der den Leuten auf Befehl des Königs den Kopf abschlägt. Ich habe den Mumm dazu. Die Beharrlichkeit.
Das Verlangen.
Man nennt mich Grim.
Ich bin der Scharfrichter der Bedlam-Bruderschaft.
Wer mich sieht, wird sterben.
Nur ein Scherz.
Man sieht mich niemals kommen.
Vor Kurzem wurde ein Waffenstillstand ausgerufen, nachdem der Gouverneur damit gedroht hatte, uns die Nationalgarde auf den Hals zu hetzen.
Seitdem ist alles ruhig.
Zu ruhig.
Wenn man genau hinhört, kann man praktisch hören, wie die Pistolen nachgeladen werden.
Klick klick klack.
Klick klick klack.
Der Waffenstillstand galt für ein Jahr.
Jetzt sind zehn Monate vorbei.
Klick.
Klick.
KLACK.
Die Vergangenheit
1
Tristan
Sechzehn Jahre alt
Emma Jean Parish hatte wildes lockiges Haar und die dazu passende Einstellung.
Als wir uns trafen, zwang sie mir ihre Muschi auf. Ihre Katze. Ein räudiges kleines Ding mit Aggressionsproblemen, die fast so schlimm wie meine waren.
Es war ein bewegender Tag.
Ich packte gerade den Müllbeutel, in dem sich all mein Hab und Gut befand, in das Auto einer Fremden namens Marci. Sie war aus dem Nichts aufgetaucht wie der Geist der Vergangenheit ungewollter Kinder und hatte mir gesagt, dass sie mich mitnehmen würde.
Einfach so.
So wie Marci redete, nahm ich an, dass sie mich in eine Art Übergangsheim für Kinder wie mich brachte. Zu alt, um adoptiert zu werden, und zu gestört für Pflegeeltern. Ich stellte ihr keine Fragen, nicht nur weil ich wusste, dass ich ohnehin keine andere Wahl hatte, sondern auch, weil ich nicht sprach. Es war nicht so, dass ich nicht konnte. Ich tat es einfach nicht.
Worte bedeuten nichts. Wenn man das erst mal kapiert hat, ist die Notwendigkeit zu sprechen mehr eine Bürde als ein Mittel zur Kommunikation.
Außerdem war ich ein Kind im System. Ich ging dorthin, wohin man mich brachte, und alle paar Monate wurde ich wieder woandershin gebracht.
Manchmal hasste ich es.
Manchmal hasste ich es sehr.
Doch dieses Mal war es anders. In mehr als einer Hinsicht. Normalerweise wurde ich von meiner Sachbearbeiterin gefahren und die Leute, die mich empfingen, wirkten so begeistert darüber, als wäre ich eine unerwünschte Reklamesendung.
Noch nie ist jemand gekommen, um mich abzuholen.
Solange sie nicht vorhatte, aus meiner Haut einen Anzug zu nähen, spielte es keine Rolle. Ich brannte darauf, aus dem verdammten Jungenheim herauszukommen. Besonders, da ich kein Junge mehr war. Selbst als ich noch jünger war, habe ich mich nie wirklich wie einer gefühlt.
Ich wollte gerade zurück ins Heim gehen, wo Marci mit meiner Sachbearbeiterin vom Amt, die ebenfalls extra hergefahren war, über meinen Wechsel und wahrscheinlich meine Verhaltensstörungen sprach – meine Vorstrafen, meine Autoritäts- und Aggressionsprobleme, meine mangelnde Kommunikationsfähigkeit usw. – als ich sie sah.
Ein Mädchen, das ein paar Jahre jünger war als ich, stand auf der anderen Seite der schmalen Straße und sah sich langsam und vorsichtig in beide Richtungen um und wiederholte den Vorgang noch zweimal, bevor sie plötzlich losrannte, als würde es sich um einen belebten Highway und nicht um eine kleine, unbefestigte und selten befahrene Landstraße handeln.
Wirre honigblonde Locken standen in jedem Winkel von ihrem Kopf ab, eine Mischung aus der kleinen Waise Annie und Medusa. Haare, die für eine Puppe gedacht waren und nicht für ein lebendes Menschenkind. Und dieses hier hielt eine kleine getigerte Miezekatze in ihren Armen. Tränen liefen dem Mädchen über ihr rotes, verquollenes Gesicht. Ihre Unterlippe war schon ganz zerbissen von all den Versuchen, die Tränenflut zurückzuhalten. Sie trug eine zerrissene Jeansshorts, die ihr bis zu den Knien ging, und ein übergroßes T-Shirt, das sie sich an der Hüfte zum Knoten gebunden hatte. Was auch immer früher für ein Logo auf dem Shirt gestanden hatte, war inzwischen so verblasst, dass es nicht mehr lesbar war.
»Hey, Mister!«, rief sie und blieb vor mir auf dem Gehweg stehen.
Ich sah mich erst nach links und rechts, dann über meine Schulter um, aber es war niemand sonst da. Ich war sechzehn. Sie konnte auf keinen Fall mich meinen, doch dann kam sie schnaufend auf mich zu. Ihre riesigen Augen waren viel zu groß für ihr Gesicht und von einem dunklen, tränenerfüllten Blaugrün.
Ich knotete die Mülltüte zu und warf ihr einen »Was willst du?«-Blick zu.
Sie hielt das Kätzchen im Würgegriff um seinen Hals, während die Beine in der Luft baumelten, doch seltsamerweise schien es das Ding nicht zu stören. Als das Mädchen näher kam, fauchte mich das kleine Mistvieh an. Das Mädchen kicherte laut. Ich trat unbehaglich von einem Bein aufs andere, da ich ein solches Geräusch nicht gewöhnt war.
Ihr Lachen war so schnell verschwunden, wie es gekommen war. Ihr Gesichtsausdruck wurde sehr ernst, als ob ihr etwas eingefallen wäre.
»Meine Pflegemama Tante Ruby sagt, dass ich Mr Fuzzy nicht behalten kann.« Sie schniefte. »Sie … sie hat gesagt, dass ich ihn …« Sie atmete zitternd ein und presste das kleine Fellknäuel fester an sich. Ihre Schultern zitterten, während sie weinte.
Ich verschränkte die Arme vor der Brust. Vielleicht lag es daran, dass ich hinter ihrem Kichern und ihren Tränen für Mr Fuzzy eine vertraute Traurigkeit erkannte.
Sie warf einen Blick auf das Haus. »Sie sind ein Pflegekind, oder?«
Ich nickte.
»Sie reden nicht?«, fragte sie wertfrei.
Ich schüttelte weder den Kopf, noch nickte ich. Es war keine Frage, die ich mit Ja oder Nein beantworten konnte. Es war nicht so, dass ich nicht reden konnte. Ich tat es einfach nicht.
Niemals.
Sie musterte mich und die primitiven Tattoos an meinen Armen. Sie alle waren von Verbrechern und Möchtegernkünstlern während meiner vielen Besuche im Jugendarrest im ganzen Staat gestochen worden. Sie hatten mir mit Büroklammern oder einem spitzen Bleistift in die Haut geritzt und dann Tinte hineingerieben. Ich hatte vor, sie eines Tages mit etwas Epischem und Bedeutungsvollem zu überdecken.
Sobald es so etwas in meinem Leben geben würde.
Das Mädchen blickte auf die Katze, dann wieder in mein Gesicht. Ihre langen Wimpern waren feucht von den vielen frischen Tränen. Was zum Teufel wollte sie von mir? Obwohl es draußen über dreißig Grad war, zog ich mir die Kapuze meines Sweatshirts über den Kopf.
»Sind … sind Sie okay, Mister?« Sie wischte sich mit dem Handrücken über ihre rote Nase.
Was zum Teufel stimmt nicht mit diesem Mädchen? Sie war es doch, die heulte, und jetzt fragte sie, ob ich okay war?
Ich hatte keine Ahnung von Kindern, obwohl ich genau genommen selbst noch eins war.
Ich schlug den Kofferraum von Marcis Auto mit Wucht zu. Das Nummernschild mit der blutenden schwarzen Rose darauf klapperte. Ich drehte dem Mädchen meinen Rücken zu und begann, die Einfahrt zurückzugehen.
»Warten Sie! Warten Sie! Gehen Sie nicht! Wir wurden uns nicht richtig vorgestellt.« Sie lief um mich herum und blieb vor mir stehen, um mich davon abzuhalten, zurück ins Haus zu gehen. Dann nahm sie die Katze in ihre Armbeuge und streckte ihre Hand aus. »Ich bin Emma Jean Parish. Ich bin gerade zwölf geworden und ich mag Zauberei und Lesen. Märchen mag ich auch, obwohl Tante Ruby sagt, dass ich zu alt dafür bin. Horrorfilme und Brüllen mag ich nicht«, plapperte sie. »Was ist mit Ihnen?«
Sie schenkte mir ein trauriges kleines Lächeln und schniefte, während ihre Hand ausgestreckt blieb.
Ich seufzte tief. Der entschlossene Ausdruck in den Augen des Mädchens sagte mir, dass sie nicht abhauen würde, bevor ich ihr nicht geantwortet hatte. Ich schaute auf ihre Hand und zog eine Augenbraue hoch.
»Sie müssen nicht reden, wenn Sie nicht wollen. Können Sie Zeichensprache?«, fragte sie, und mir wurde klar, dass sie mir ins Gesicht sah, damit ich ihre Lippen lesen konnte. »Ich habe aus einer alten Enzyklopädie das Alphabet in Zeichensprache gelernt. Ich kann Sachen buchstabieren, aber sonst nicht viel.«
Sie dachte, ich wäre taub.
Das glaubten viele Leute zuerst.
Als ich erstmals im System gelandet war, hatte man mich in einen Kurs für Zeichensprache gesteckt, weil man dachte, dass ich nicht wusste, wie man kommuniziert. Während ich dort war, habe ich ein paar Sachen aufgeschnappt.
Sie begann, mit der freien Hand zu buchstabieren, was sie gerade gesagt hatte. Ihre Zungenspitze war herausgestreckt, während sie sich darauf konzentrierte, jeden Buchstaben perfekt darzustellen. Wenn sie so weitermachte, würde das hier noch ewig dauern.
Frustriert platzte ich heraus: »Tristan. Und ich bin nicht taub.«
Der Klang meiner eigenen Stimme, den ich seit Jahren nicht mehr gehört hatte, erschreckte mich so sehr wie sie.
»Tristan?« Lächelnd legte sie den Kopf schief. »Und Sie sind gar nicht taub?«
Ich schüttelte den Kopf.
»Tristan«, wiederholte sie. Dann zog sie meinen Arm von der Brust, bis sie meine Hand befreit hatte, und schüttelte sie mit mehr Kraft als die meisten erwachsenen Männer, aber das war es nicht, was mich so schockierte.
Es war das elektrische Gefühl ihrer Haut auf meiner. Das Gefühl, das etwas um mich herum zersprang, bis es fort war. Ich war zu jung, um einen Schlaganfall zu haben, also was zum Teufel war das?
Staunend starrte ich unsere miteinander verbundenen Hände an. Es war lange her, seit ich gesprochen hatte, und noch viel länger, seit ich mich von jemanden hatte anfassen lassen. Das musste dieses Gefühl sein. Ich schüttelte es ab, doch die Elektrizität zwischen uns summte weiter.
»Witzig, Sie sehen gar nicht aus wie ein Tristan.«
Das stimmte. Ich sah aus wie ein Verbrecher. Ein Krimineller. Auch wenn ich ihrer Meinung war. Ich hatte meinen Namen nie besonders gemocht. Tristan klang nach jemandem, der auf eine teure Privatschule ging und seine Hausarbeiten noch vor dem Lacrosse-Training erledigte. Nicht nach jemandem, der mehr Zeit in einer Zelle als im Klassenzimmer verbracht hat und nur dann einen Bleistift in die Hand nahm, wenn er ihn zu einer Waffe anspitzen wollte.
»Aber er gefällt mir«, sinnierte sie und streichelte das Kätzchen. »Ich meine, es ist ein schöner Name. Allerdings nicht für Sie. Darüber sollten Sie noch mal nachdenken.« Sie presste ihre Lippen auf den Kopf der Katze.
Ich zündete mir eine Zigarette an. Über Emma Jeans Kopf hinweg erspähte ich die Sachbearbeiterin, die am Tisch saß und höflich mit Marci redete und dabei lächelte und nickte. Ich hoffte, dass sie sich beeilen würden, damit ich endlich von hier wegkam.
Ich lehnte mich gegen den schwarzen Firebird, nahm einen tiefen Zug und wünschte mir, dass ich mein letztes Gras heute Morgen nicht an Mr Arnold verkauft hatte, den Achtzigjährigen, der neben dem Jungenheim wohnte.
»Wollen Sie mich denn gar nicht fragen, warum ich so traurig bin?«
Ich schüttelte den Kopf, doch Emma Jean sprach trotzdem weiter.
»Wissen Sie, es ist wegen Mr Fuzzy hier. Sie kennen nicht zufällig jemanden, der ein neues Haustier sucht? Denn Tante Ruby sagt, dass sie ihn ins … ins … ins Tierheim bringt, wenn ich ihn heute nicht loswerde.« Sie drückte die Katze, die fauchte und sich wand, doch sie hielt sie fest, ohne zu bemerken, dass sie das Ding praktisch erdrückte. »Und … und …«
Wieder begann sie zu schluchzen. Ihr Gesicht wurde rot. Sie riss den Mund auf, schloss ihre Augen und begann laut loszuheulen.
Ich kratzte mein Handgelenk im Ärmel meines Hoodies. Scheiße, ich hatte keine Ahnung, was man tat, wenn Kinder weinten. Wie zum Teufel stellte man das ab? Ich schaute mich um in der Hoffnung, dass jemand kommen würde, um sie wegzuschaffen, aber es war niemand da.
»Und, kennen Sie jemanden, der sich um Mr Fuzzy kümmern könnte? Er ist ein echt nettes Kätzchen.«
Mr Fuzzy widersprach fauchend.
Ich schüttelte erneut den Kopf.
Emma Jeans blaugrüne Augen waren bereits riesig, aber durch ihre Panik wurden sie noch viel größer. Das Heulen wurde immer lauter. Mit ihrer freien Hand griff sie wieder nach meinem Arm. Erneut fühlte es sich an wie ein elektrischer Schlag, stärker dieses Mal, als ob ich eine Münze in eine Birnenfassung gesteckt hätte.
Warum zum Teufel berührt sie mich immer wieder?
Ich wollte ihre Hand abschütteln, doch sie hielt mich fest wie ein Pitbull seinen Gegner in einem Hundekampf, und ich konnte sie nicht von meinem Arm lösen, ohne ihr einen Finger zu brechen.
Ein kleines Mädchen zu verletzen würde mich geradewegs wieder in den Jugendknast bringen, dabei war ich doch gerade erst rausgekommen. Auf keinen Fall wollte ich so schnell wieder zurück, besonders da mir der Richter gesagt hatte, dass er mich beim nächsten Mal nach Erwachsenenstrafrecht verurteilen würde.
Ich wollte nicht zurück in den Jugendknast, aber verglichen mit dem Gefängnis war das ein Zuckerschlecken. Dort wollte ich wirklich nicht landen.
»Sie verstehen das nicht, Mr Tristan! Wenn Mr Fuzzy im Tierheim nicht adoptiert wird, werden sie ihn einschläfern!« Sie schnappte zitternd nach Luft. »Zuerst fand ich, das klingt gar nicht so schlecht, wer kann schließlich keine gute Mütze voll Schlaf gebrauchen? Tante Ruby ist immer am Schlafen oder Dösen, wenn sie nicht drüben in Lacking im Spielcasino ist, aber die Lehrerin meiner besten Freundin Gabby Vega arbeitet als Freiwillige im Tierheim und sie hat ihr gesagt, dass Einschläfern was ganz anderes bedeutet.«
Wieder holte sie zitternd Luft und lehnte sich näher heran. Ihr Griff um meinen Arm wurde mit jedem Wort fester. Sie senkte ihre Stimme zu einem Flüstern.
»Einschläfern hat gar nichts mit Schlafen zu tun. Es bedeutet …« Endlich ließ sie mich los, um Mr Fuzzys Ohren zu streicheln. Ich rieb mir den Arm. »Es bedeutet, dass sie ihn töten.« Sie stieß ein ersticktes Schluchzen aus, presste ihre Hand auf den Mund und trat einen Schritt zurück. Dann sah sie mit ihren riesigen Augen flehend zu mir auf.
Ich überlegte nur, wie ich dieses Mädchen dazu bringen konnte, nach Hause zu gehen, doch mir fiel nicht schnell genug etwas ein, denn sie begann wieder loszuheulen und der Klang hallte zwischen den Häusern.
Ich zeige niemals Gefühle, hauptsächlich weil ich nichts empfinde, aber diese kleine Göre brachte mich dazu, meine Hände zu Fäusten zu ballen. Ich musste einen Weg finden, um ihr das Maul zu stopfen.
Das wird schon wieder, sagte ich in meinem Kopf und zuckte gleichgültig mit den Schultern.
»Wie soll es wieder werden, wenn Fuzzy nur noch Futter für die Würmer ist?«, heulte sie.
Scheiße. Scheiße. Scheiiiiße.
Ich zog erneut an meiner Zigarette und hielt den Rauch tief in meiner Lunge. Vielleicht hatte ich Glück und würde ersticken, dann wäre all das hier vorbei.
Ich warf einen Blick durchs Küchenfenster und sah, dass mich Marci anstarrte.
Scheiße, ich würde nicht wegen dieser kleinen Göre im Gruppenheim bleiben.
»Halt die Klappe«, befahl ich mit leiser Stimme. Zu leise, als dass sie mich hätte hören können. Ich konnte es ja kaum selbst hören.
»Und niemand will ihn!«, schluchzte sie. Dann legte sie den Kopf in den Nacken und ließ die Schultern hängen, so tief, dass ich hätte schwören können, sie würden den gottverdammten Boden berühren.
Ich sah wieder zum Haus. Meine Sachbearbeiterin stand jetzt am Fenster und deutete auf die Szene, die sich vor mir abspielte.
Scheiße.
Ich bedeutete dem Mädchen, mir zur Seite des Hauses zu folgen, wo man uns vom Fenster aus nicht mehr sehen konnte. Sie tat es. Als wir außer Sicht waren, nahm ich ihr den fauchenden Mr Fuzzy aus den Armen.
Sie begann zu strahlen und nickte begeistert. Ihr Heulen hörte sofort auf. Endlich hatte ich den Schalter gefunden.
»Sie nehmen Mr Fuzzy?«, fragte sie lächelnd und entblößte dabei Zähne, die für ihren Kopf zu groß waren.
Emma Jean wartete nicht auf eine Antwort, die ich nicht geben würde.
»Ja! Danke! Vielen Dank!«, rief sie, hüpfte auf und ab und schlang in einer einseitigen Umarmung ihre Arme um mich.
Dann stellte sie sich auf die Zehenspitzen, um mir einen Kuss auf die Wange zu geben, doch ich drehte gleichzeitig meinen Kopf und der Kuss landete auf meinen Lippen. Ich zog mich nicht zurück. Es war der Schock, der mich vorübergehend erstarren ließ. Sie zog sich ebenfalls nicht zurück.
Eine Sekunde. Zwei. Drei.
Der zwischen uns eingequetschte Mr Fuzzy miaute laut. Die Haustür wurde geöffnet und wieder geschlossen. Emma Jean zog sich mit vor Verwirrung gerunzelter Stirn zurück.
Ich sah gerade rechtzeitig weg, um die Stimmen von Marci und meiner Sachbearbeiterin zu hören.
»Wo ist er hin?«, fragte Marci besorgt.
»Vielleicht ist er weggelaufen«, sagte meine Sachbearbeiterin beiläufig. »Wir könnten ihn rufen, aber er wird wahrscheinlich nicht antworten. Sind Sie sicher, dass Sie es versuchen wollen? Es sind immer die langsamen Kinder, Sie wissen schon, die mit gewissen geistigen Herausforderungen zu kämpfen haben, die die meisten Verhaltensstörungen zu haben scheinen, und er hat bereits viele dieser Störungen gezeigt. Groß und beschränkt ist schon viel, auch ohne die zusätzliche Belastung durch die Gewalt, zu der er fähig ist.«
Ich musste schmunzeln. Als ob dieses Miststück eine Ahnung hätte, wozu ich fähig war.
Ich sah zu Emma Jean herunter, die dem Gespräch konzentriert gelauscht hatte. Ihr Gesicht wurde rot. Sie ballte ihre Hände zu Fäusten.
Marci wollte etwas sagen, doch in diesem Moment sprang Emma Jean vor sie.
»Wie können Sie es wagen!«, brüllte sie und richtete einen anklagenden Finger auf meine Sachbearbeiterin. »Tristan ist nicht dumm. Sie sind die Dumme, denn Sie haben keine Ahnung.«
Ich war gleichzeitig amüsiert und verwirrt, dass mich dieses Kind, das mich erst seit zehn Minuten kannte, jetzt verteidigte, als würde es mich schon mein ganzes Leben lang kennen.
»Wer bist du denn?«, fragte die Sachbearbeiterin in einem falschen freundlichen Tonfall. Sie beugte sich ein Stück zu Emma Jean vor, während sie sich mit den Händen auf ihre Oberschenkel stützte. »Und es tut mir leid, aber du liegst falsch. Er redet nicht, Süße. Ich bin seit Jahren für ihn zuständig. Nie hat er auch nur ein einziges Wort gesagt.« Sie stand wieder auf.
»Tja, das zeigt, dass Sie keine Ahnung haben.« Emma Jean stemmte die Hände in ihre knochigen Hüften. »Lady, woher zum Teufel weiß ich wohl, dass er Tristan heißt?« Sie wartete einen Moment. »Ach ja, weil er es mir GESAGT hat.«
»Er … er hat geredet?«, fragte sie und sah über Emma Jeans Schulter hinweg zu mir.
»Ach nee!« Emma Jean verdrehte ihre Augen. »Haben Sie sich eigentlich schon mal gefragt, ob er vielleicht nur deshalb nicht spricht, weil er nicht mit Ihnen reden will? Oder vielleicht deshalb, weil alle anderen irgendwelchen Mist labern und leere Versprechungen machen, und er deswegen lieber für sich bleibt, weil er nicht zuhören will, wie Ihr dämlicher Mistmund noch eine weitere sinnlose Sache sagt?« Sie sprach, als würde sie nicht nur mich verteidigen, sondern irgendwie auch sich selbst. »Tristan ist hier nicht der Dämliche.« Sie schnaubte. »Das sind nämlich SIE!«
Heilige. Scheiße.
Marci stand hinter der Sachbearbeiterin, die Hand auf den Mund gepresst und die Schultern in stillem Lachen zuckend.
Emma Jean beugte sich vor, um ihre schmutzigen Schnürsenkel zu binden, dann sprang sie wieder auf und zeigte meiner Sachbearbeiterin den Mittelfinger, während diese sie in schockiertem Schweigen anstarrte. Emma Jean ließ ihre Hand sinken und starrte die Frau mit ihren riesigen Augen voller Hass an. Ihr Blick war so mächtig, dass er durch die Luft schoss wie Laserstrahlen. Ihre unschuldigen Tränen von vorhin wirkten jetzt eher wie erfahrener Schmerz.
»In den Worten des großen Bob Dylan«, spie Emma Jean meiner Sachbearbeiterin entgegen, »Kritisiere nie, was du nicht verstehst!«
Emma Jean sah zu mir auf, während die Sachbearbeiterin ihren Kiefer vom Boden aufheben musste. Sie lächelte mich an. Ein vollkommen anderes Mädchen als das, das gerade noch über eine Katze geweint hatte. »Bis dann, Tristan!« Sie begann davonzugehen, rief aber noch über ihre Schulter: »Kümmern Sie sich gut um ihn, Lady!«
»Das werde ich, Süße«, erwiderte Marci lachend.
Emma Jean sah nicht nach links und rechts, wie noch vorhin, als sie daraus eine große Show gemacht hatte. Sie schoss über die Straße und verschwand ohne einen weiteren Blick zwischen den Häusern.
Das Kätzchen in meinem Armen fauchte und schlug seine Krallen in meinen Hoodie und erinnerte mich auf diese Weise an seine Anwesenheit. Ich hielt es anders fest, aber das verschaffte ihm nur mehr Platz, um seine Krallen tiefer in mich zu bohren. Es hinterließ winzige Schlitze in dem dicken Baumwollstoff und zerkratzte meine Haut.
Du kleiner Scheißer.
Meine Sachbearbeiterin murmelte etwas vor sich hin, während sie in ihren Buick stieg. »Viel Glück«, verstand ich, bevor sie davonfuhr. Mein Blick folgte ihrem Wagen nicht, denn ich starrte immer noch über die Straße zu der Stelle, wo Emma Jean verschwunden war.
Was zum Teufel ist hier gerade passiert?
»Da wurde die gute Miss Erikson wohl gerade von einem kleinen Mädchen fertiggemacht«, antwortete Marcis Stimme, als hätte ich meine Frage laut ausgesprochen. Ich drehte meinen Kopf zu ihr und sah sie neben mir stehen, ihre Hand auf einem funkelnden schwarzen Gürtel, der ihr von der Hüfte hing. Sie warf einen Blick auf Mr Fuzzy. »Und du wurdest von einem verarscht.« Sie lächelte mit zusammengepressten Lippen, als würde sie versuchen, ein Lachen zu unterdrücken, auch wenn ich keine Ahnung hatte, was sie so lustig fand. »Ich nehme an, sie hat geheult und dich angefleht, das kleine Fellknäuel hier zu übernehmen.«
Wieder fauchte Fuzzy und stieß mit seinen Hinterbeinen gegen meinen Unterarm.
»Fuck«, fluchte ich und überraschte mich damit selbst wieder. Normalerweise waren selbst meine mentalen Reaktionen lautlos.
Marci korrigierte meine Ausdrucksweise nicht, und ihr Lächeln wurde ein bisschen breiter. »Dieses kleine Mädchen?« Sie hob ihr Kinn und sah mit mir über die Straße. »Das ist doch einer der ältesten Schwindel der Welt. Für einen Streuner ein Zuhause finden …« Sie drückte ihre geschlossene Faust gegen ihre Lippen, dann zuckte sie mit den Schultern. »Egal wie.«
Ich betrachtete das räudige Ding in meinen Armen und verdrehte die Augen über meine eigene Dummheit. Ich war wie vor den Kopf geschlagen. Dieses Kind war viel klüger, als es sich hatte anmerken lassen.
Ich sah Marci an und dann wieder über die Straße.
»Erinnert mich an mich selbst in diesem Alter«, sinnierte sie. »Vor denen muss man sich in Acht nehmen. Trickbetrüger mit goldenem Herz.«
Emma Jean Parish. Ich hatte mit ihr gesprochen. Sie hat mich verteidigt. Sie hat mich geküsst.
SIE HAT MICH REINGELEGT.
Ich war verwirrt. Wütend.
Und irgendwie beeindruckt.
»Du bist ja bezaubernd.« Marci kraulte der Katze den Kopf. Das kleine Mistvieh schnurrte sie an und lehnte sich gegen ihre Handinnenfläche.
Sie nahm mir Mr Fuzzy aus den Händen und hielt ihn an ihre Brust. »Diese Art Mädchen wird entweder eines Tages die Welt übernehmen …« Sie zog ihre Sonnenbrille vom Kopf herunter und über ihre Augen. »Oder sie wird diejenige sein, die sie zerstört.«
Daran hatte ich nicht den geringsten Zweifel.
Marci ging um ihren Firebird herum und öffnete die Fahrertür. »Komm jetzt, lass uns nach Hause fahren.«
Nach Hause?
Nicht in ein Heim.
Nach Hause.
»Oh, und du solltest vielleicht mal nach deiner Geldbörse sehen.« Marci stieg in den Wagen und setzte Fuzzy auf ihren Schoß. Dann startete sie den Motor.
An der offenen Beifahrertür steckte ich meine Hand in die Gesäßtasche meiner verschlissenen Jeans.
Nichts.
Verdammte Scheiße.
Es war das erste Mal, dass mich Emma Jean Parish reingelegt hatte.
Es würde nicht das letzte Mal sein.
2
Emma Jean
Zwölf Jahre alt
Tristan.
Das war ein supercooler Name.
Er hatte eine Menge Tattoos.
Außerdem war er groß und geheimnisvoll mit seinem Hoodie und so.
Er rauchte, und obwohl ich weiß, dass es schlecht für einen ist, sah er verdammt gut damit aus.
Und ganz egal, was dieses Miststück im Hosenanzug denkt: Er ist nicht dumm. Ganz im Gegenteil. Ich konnte seine Intelligenz in seinen goldenen Augen glänzen sehen.
Er ist perfekt.
Noch nie hatte ich irgendjemand für perfekt gehalten. Noch nie hatte ich einen Jungen hübsch oder sogar süß gefunden.
Bis Tristan.
Als ich ihn berührte, hatte ich eine Art elektrischen Schlag gespürt, und ich weiß, dass es ihm genauso gegangen sein muss, denn er hat mich regelrecht schockiert angesehen.
Wir haben einen Schlag bekommen. Ich bin mir sicher, dass das in irgendeinem Märchen vorkam. Und es war bestimmt keine statische Aufladung, weil ich nämlich nicht mal in der Nähe eines Teppichs und auch nicht barfuß gewesen bin.
Ich betrachtete die abgewetzte Geldbörse in meiner Hand, und plötzlich überkam mich ein seltsames Gefühl.
Hmpf. Das ist neu.
Noch nie zuvor hatte ich Schuld empfunden. Und ich hatte nicht vor, jetzt damit anzufangen. Ich schob das fremdartige Gefühl beiseite, denn ich hatte den überwältigenden Drang, die Geldbörse zu öffnen. Mehr über diesen Tristan zu erfahren, der anders war als alle, die ich bisher getroffen hatte.
Der Führerschein darin verriet mir Tristans Nachnamen. Paine.
Kein zweiter Vorname.
Andererseits hatte ich ja auch keinen zweiten Vornamen. Nur einen doppelten Vornamen. Meine Eltern waren kurz nach meiner Geburt gestorben, also hatte ich mir immer meine eigene Version ausgedacht, wie ich zu meinem Namen gekommen war.
Meine Mutter hatte mich unbedingt Emma nennen wollen, und mein Dad unbedingt Jean, also haben sie einen Kompromiss geschlossen und entschieden, mich Emma Jean zu nennen. Natürlich haben sie das entschieden, während sie Händchen hielten, dabei liebevoll in meine Wiege blickten und mir in perfektem Einklang Schlummerlieder vorsangen, bis ich eingeschlafen war.
Ich dachte mir immer irgendwelche Geschichten aus. Es war meine Art, zu entkommen. Und jetzt gerade begann ich, mir eine Geschichte über einen stillen, unartigen Prinzen auszudenken.
Tristan. Ich sprach seinen Namen ein paar Mal im Stillen aus.
Tante Ruby kam ins Wohnzimmer. Ihre Haare waren ein einziges Durcheinander und aus ihrem mit Lippenstift vom gestrigen Abend verschmierten Mund hing eine Zigarette.
Schnell klappte ich die Geldbörse zu und steckte sie hinter die Vorhänge aufs Fensterbrett.
»Was hast du da?«, fragte sie, griff hinter mich und holte die Geldbörse aus ihrem Versteck.
Panisch versuchte ich, danach zu greifen. »Nicht! Das gehört mir!«
»Psst, Kind. Wir wissen beide, dass das nicht stimmt.«
Ich hatte zwei erste Vornamen. Tante Ruby nannte mich bei keinem davon. Kind war noch der freundlichste ihrer Namen für mich.
Tante Ruby machte sich nicht die Mühe, einen Blick auf den Ausweis zu werfen. Ihr einziges Interesse galt dem Geld. Sie zog ein gefaltetes Stück Papier heraus und schaute es sich kurz an, bevor sie es zu Boden fallen ließ. Dann nahm sie ein paar Geldscheine heraus und zählte sie. Vierunddreißig Dollar. Sie warf mir die Geldbörse vor die Füße und steckte sich das Geld in ihren BH.
»Zumindest bringt dein kleines Hobby was ein«, murmelte sie, während ihr der Zigarettenstummel immer noch aus ihrem faltigen Mundwinkel hing. Sie schnappte sich ihren Schlüsselbund von dem chaotischen Flurtisch. Sie sagte mir nicht, wo sie hinging, aber das musste sie auch nicht.
Weil ich es bereits wusste.
Das Casino in Lacking, zwei Städtchen entfernt. Es war immer das Casino. Sie drückte ihre Zigarette aus und zündete sich eine neue an. Dann hob sie ihre Handtasche vom Boden auf, öffnete die Haustür und zuckte zurück, als ihr Sonnenlicht ins Gesicht fiel. Ohne sich zu verabschieden und mit dem verschmierten Make-up vom Vorabend im Gesicht war sie fort.
Ich sank zu Boden und hob das gefaltete Stück Papier auf. Dabei ließ ich niedergeschlagen meine Schultern sinken. Dieses Mal würde ich die Geldbörse wirklich zurückgeben.
Vielleicht.
Ich faltete das Papier auseinander. Es handelte sich um ein Foto von Tristan als kleinem Jungen und einer Frau, die die gleichen strahlend goldenen Augen besaß. Er hatte seinen Arm um sie gelegt und beide lächelten in die Kamera.
Mein Herz setzte einen Sprung aus.
»Emma Jean!«, sagte Gabby, die mit ihrer älteren Schwester Mona im Schlepptau durch die offene Haustür hereinkam. Mona ignorierte mich und ging nach oben. Gabby wirkte panisch. Ihre langen dunklen Haare klebten ihr an der verschwitzten Stirn. In ihren dunklen Augen standen Tränen.
»Was ist?«, fragte ich, während ich aufstand und das Foto in meine Tasche steckte.
»Ich muss weg«, flüsterte sie. »Mein Bruder Marco nimmt Mona und mich zu sich.«
»Wann?«, fragte ich, nun ebenfalls panisch. Gabby war alles, was ich hatte.
»Nächsten Monat«, sagte sie und brach in Tränen aus.
In dieser Nacht lag ich neben meiner schlafenden Pflegeschwester und besten Freundin Gabby, als Tante Ruby lachend mit einem Mann in die Küche kam. Ich versuchte, die Geräusche auszublenden, und schloss meine Augen, aber ich konnte nur daran denken, dass Gabby fortgehen würde. Ich griff nach dem Foto, das unter meinem Kissen steckte, und hielt es mir an die Brust.
Ich versuchte einzuschlafen, während ich mir vorstellte, dass ich eine Prinzessin war, die man ganz allein in einen Turm gesperrt hatte, bis Tristan zu meiner Rettung kam. Nur dass auch er gefangen wurde und ich die Einzige war, die ihn retten konnte. Ich sah, wie er seine Hand nach mir ausstreckte, aber ganz egal, wie sehr ich es auch versuchte, ich konnte ihn einfach nicht berühren.
Das Licht wurde schwächer und schwächer, bis das Letzte, was ich sah, bevor es ganz dunkel wurde, die strahlend goldenen Augen meines ersten Kusses waren.
Meiner ersten Liebe.
Und ich konnte das Gefühl nicht abschütteln, dass sie mich vernichten würde.
Tristan,
tut mir leid, dass ich deine Geldbörse gestohlen hab. Hier sind die vierunddreißig Dollar zurück, die drin waren, plus fünf Dollar Zinsen. Meine Tante Ruby hat das Geld gestohlen, um es zu verspielen, aber ich habe es zurückverdient, indem ich vor der Highschool Limonade mit Wodka verkauft hab. Ich habe immer noch dein Bild. Fändest du es doof, wenn ich es noch ein bisschen behalte? Du siehst so glücklich darauf aus. Es bringt mich zum Lächeln, selbst wenn ich total traurig bin.
Noch mal, tut mir leid. Und zum allerersten Mal meine ich es auch so. Ich bin zurückgegangen, um sie dir zu geben, aber sie haben gesagt, dass du jetzt woanders wohnst. Gefällt dir dein neues Zuhause? Ich muss jetzt Schluss machen. Auf PBS fängt jetzt eine Zaubersendung an und die darf ich nicht verpassen.
– Emma Jean Parish