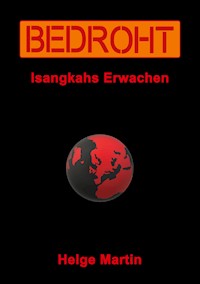
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Isangkah - Reihe
- Sprache: Deutsch
Mein Name ist Linah Planck. Ich bin Physikerin und arbeite an einer Berliner Uni in der Forschung. Diese Geschichte beginnt mit einem Mordanschlag. Auf mich! Nie hätte ich geahnt, welchen Herausforderungen ich mich stellen muss, um aufzuklären, wer dahinter steckt. Der Strudel aus Tod und Intrigen reicht über die Erde hinaus bis weit in die Galaxis. Begleiten Sie mich auf meiner gefährlichen Reise.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 334
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Danke!
Bücher brauchen zu ihrer Vollendung viel Zuwendung und Aufmerksamkeit. Ich danke allen aufs Herzlichste, die mir geholfen haben, die eine oder andere holperige Stelle zu finden und zu glätten, allen voran meiner Familie und Ulrike Seidelmann.
Inhaltsverzeichnis
Blue Light
Meditation mit einem Gully
Und jetzt?
Option zwei also
Showtime!
Henrik
Das Linahsche Lemma
Gewohnheiten
Informationen
Hägar
Und täglich grüßen die Nunjal
Eine kleine Gemeinschaft
Katja
Hen
Analysen
Dies und das und die Liebe
Kwong
Erste Gehversuche
Aheegareth
Kwong 2.0
Analysen
Beratungen unter elf Augen
Ein letztes Mal Berlin?
Abschied
Aufbruch
Am Merkur
Herumschubsen und fallen lassen
Hau den Nullpunkt
Isangkah
Die schwarze Stadt
Klarstellungen
Der Ring
Erleuchtung ist relativ
Ein herzliches Willkommen
Lost in Space
Genesung
Licht am Ende des Tunnels
Die Prüfung
Zerant
Cligue, Cligue, Cligue…
Geschenke
Unterm Strich
Let‘s Party
...
Ausblick ...
...
Glossar ...
Blue Light
Die Rotweingläser hängen umgekehrt über mir zwischen den zierlichen Leisten des auf alt getrimmten Eichenholzrahmens. Sie scheinen unter der Decke der Bar zu schweben und glänzen im Licht der vereinzelten Spots, die die Arbeitsfläche des Tresens vor mir notdürftig ausleuchten. Ihre gewölbten Oberflächen und die dünnen Ränder reflektieren die fokussierten Lichtpunkte. Ein kaum wahrnehmbarer, unter die Haut gehender Ton strahlt von dort zu mir herunter, als würde jemand mit feuchten Fingern über ihre Ränder streichen. Dünner Nebel schiebt sich an ihren Konturen entlang und bedeckt sie mit dunklem Dunst, nicht dicht genug, um sie zu verbergen, doch ausreichend, um die Reflexionen der Spots in graue, unansehnliche Flecken zu verwandeln.
Was zum Teufel ...
Irritiert beobachte ich den Schleier, der sich vor meinen Augen von innen heraus tiefblau verfärbt. Er wird heller und verschmilzt mit den Gläsern am Stielansatz. Wie eine Welle läuft er von dort den Stiel entlang bis über den Kelch. Kanten blitzen auf. Die kräftige Maserung des Eichenholzrahmens und die dünne Staubschicht auf seiner Oberseite werden für einen Augenblick aus der Dunkelheit gerissen. Dann ist es vorbei. Der Effekt wäre mir kaum aufgefallen, wenn nicht dieser durchdringende Ton meine Aufmerksamkeit dort hinaufgelenkt hätte.
Henrik, der heiße Typ mit diesem verwegenen Haarschnitt, fläzt neben mir lässig am Tresen. Die Spitzen seiner stufig geschnittenen, weißblonden Haaren fallen bis zu den graublauen Augen und betonen die Stoppeln seines hellen Zweitagebarts. Er hat die abrupte, beinahe schmerzhafte Ruhe zu Beginn der Pause der Band genutzt, um mich anzugraben. Ich habe ihn schon vor einer Weile bemerkt, aber außer einer kurzen Musterung und einem vorsichtigen Lächeln war bis dahin nichts passiert. Sein Blick folgt meinem zur Decke. Ein ungläubiges Staunen huscht über sein Gesicht. Dann sieht er sich hektisch um, stößt sich mit beiden Händen kraftvoll vom Tresen ab und mustert die Leute um uns fieberhaft. Sie stehen in kleinen Grüppchen um die Bar im Halbdunkel und werden vom schummerigen Restlicht der vereinzelten Spots angestrahlt. Er findet, was er sucht und fasst energisch meinen Unterarm mit einem schmerzhaften Griff, während er ein Pärchen am Tresen gegenüber mit diesen aufmerksamen Augen fixiert.
„Was wollen die denn hier“, knurrt er leise. Als die Frau anfängt, ein Gerät vor sich hin und her zu schwenken, zieht er mich langsam, beinahe vorsichtig, aus dem Licht zur Seite in den dunkleren Bereich, der die Bar von der Tanzfläche trennt.
Was ist hier los, verdammt?
Nervös mustere ich die Frau. Was hat die in der Hand? Ist das ein Handy? Nein. Spontan denke ich an einen Geigerzähler. Ich bin Physikerin. Geigerzähler sind mir vertraut. Ich nutze sie gelegentlich für meinen Job an der Uni, nehme sie aber nicht mit in die Kneipe. So weit geht es dann doch nicht.
Der Mann neben ihr schaut mit ihr gebannt auf dieses Ding. Ein silberner Stab glänzt in seiner linken Hand. Er führt eine Fächerbewegung damit aus. Als sich das Teil in unsere Richtung einpendelt und anfängt, an der Spitze in diesem kalten Blau zu glühen, krallen sich Henriks Hände in meine Taille. Er reißt mich mit aller Kraft zur Seite und schleudert mich weit zwischen die Leute in die Dunkelheit.
Die Zeit scheint still zu stehen. Dieser dunkle Schleier umhüllt die Gläser erneut, wird von blauem Licht durchbrochen, das sich an den Rändern bricht und gleißend hell über die Decke strahlt. Die im Halbdunkel sonst nicht sichtbaren, staubigen Metallröhren der Klimaanlage und die auf dem Putz verlegten Stromkabel werfen lange, schmutzige, blaugraue Schatten. Die Gläser vibrieren und schlagen aneinander, kreischen ohrenbetäubend und zerspringen. Feine Kristallwolken sprühen giftig in alle Richtungen. Wie eine Welle schwappt dieser Schleier an der Stelle, an der wir eben noch standen, über den Tresen und macht ihn fast unsichtbar. Das Holz bläht sich auf. Blaues Leuchten frisst sich in Fragmenten gierig von innen durch das Material, bringt es zum Glühen, um es mit einem dunklen „Wumph“ aufzulösen. Ein nur wenige Schritte entferntes Pärchen steht unvermittelt in diesem grellen, kalten Lichtschein, der sie durch die Lücke in der Bar anspringt. Sie werden durchsichtig und scheinen von einem Windhauch weggeweht zu werden. Für einen Wimpernschlag erkenne ich ihre Skelette, dann lösen sie sich auf, als hätte es sie nie gegeben. Das Restlicht trifft weiter hinten auf eine Wand, zeichnet einen Schattenriss eines Mannes, an dessen Schulter eine Frau lehnt, und der Bar als Relief in den Putz.
Grauenhaft!
In diesem Moment pralle ich auf den Boden. Henrik landet neben mir. Sein Ellenbogen knallt in meine Hüfte. Er schlägt unkontrolliert mit dem Kopf auf.
Autsch!
Nach einem Augenblick panischer Stille setzt ohrenbetäubendes Gekreische ein. Menschen drängen viel zu dicht an uns vorbei. Verzweifelt schüttele ich Henrik. Es dauert ewig, bis er mit beiden Händen seinen Kopf umklammert und ihn vorsichtig bewegt, als wolle er prüfen, ob der Schaden genommen hat. Ich bin sicher, er stöhnt, aber das geht im Tumult unter. Endlich stemmt er sich in eine aufrechte Position, verharrt einen Augenblick und atmet tief durch. Ich ziehe ihn hoch. Natürlich ist mein viel zu kurzes Kleid hochgerutscht. Panisch packe ich es am Saum, fummle es nach unten, glätte es nervös und sehe mich hastig um. Zwischen den vorbeidrängenden Menschen fällt mein Blick auf die Bar.
Heilige Scheiße!
Da, wo eben der auf alt getrimmte, hölzerne Tresen mit der glattpolierten Kupferplatte den Gästen zu imponieren versuchte, starre ich jetzt in ein gähnend schwarzes Loch mit einem Durchmesser, der es mir erlaubt, aufrecht und ohne etwas zu berühren, durchzugehen. An einem silbern schimmernden Bierfass, dessen Rand fahl aus den Resten eines Kühlschranks hervorsteht, fehlt oben ein Stück. Von dort sprüht feiner Nebel in den Raum und erzeugt eine Stimmung wie in einem Horrorfilm.
„Wir müssen hier weg“, brüllt mir Henrik hektisch ins Ohr. Er versucht, den Geräuschpegel zu übertönen, was ihm nicht vollständig gelingt.
Mir ist klar, was er beabsichtigt.
Ein gehetzter Blick in die Runde bestätigt, dass auch die anderen Leute auf die Idee gekommen sind, den Raum so schnell wie möglich zu verlassen. Am Haupteingang bildet sich eine riesige Traube drängender und keifender Menschen, alle mit der deutlich erkennbaren Idee, möglichst zügig von hier zu verschwinden. Die versuchen, gleichzeitig natürlich und ohne dabei übergroße Rücksicht auf die jeweiligen Nachbarn zu nehmen, durch die Tür nach draußen zu gelangen. Es ist ein Chaos.
„Es gibt einen Nebenausgang hinter der Bar“, brülle ich meinem Retter zu. „Duck dich! Lass dich auf keinen Fall sehen!“, schreit der zurück und zieht mich rigoros mit sich. Wir rasen los. Wieder glüht es blau um uns herum. Nach dem erneuten „Wumph“ fehlt die Ecke der Bar, hinter die wir gerade flüchten wollten.
Derlei Dinge sind in meinem beschaulichen Studentinnen-Dasein bisher nicht vorgekommen. Ich begreife, dass ich im Mittelpunkt oder zumindest nahe am Zentrum von etwas stehe, das mir so richtig über den Kopf zu wachsen droht. Immerhin gelingt es uns, hinter die kläglichen Reste der Bar und von dort aus geduckt in den Nebenraum zu hetzen.
Okay. Schritt eins überlebt.
Doch als Henrik sich hastig dem Hinterausgang zuwendet, höre ich es erneut: Die leeren Flaschen neben mir fangen an, in ihren Kästen zu klirren. „Verdammt!“, fluche ich, mich hektisch umsehend. „Nicht schon wieder!“
Die Wand zur Bar neben mir leuchtet blau auf und verschwindet kommentarlos mit einem „Whump“. Die Frau mit dem Handy erscheint in der kreisrunden, beinahe bis zum Boden reichenden Öffnung. In der Hand hält sie den Stab mit diesem blauen Leuchten an der Spitze vor sich und sucht damit den Raum ab. Sie schießt sofort, als sie mich sieht. Hauchdünner, schwarzer Nebel wabert in meine Richtung. Ich habe gute Reflexe, aber diesmal ist es wirklich knapp. Ich verliere eine ganze Menge Haare an dieses gleißend helle, blaue Leuchten, das neben meinem Kopf explodiert, und erstarre für einen Moment fassungslos, denn jetzt ist es endgültig klar: Ich bin gemeint und nicht Henrik oder sonst wer in der Bar.
Sie meint mich! Verdammt! Was will die von mir?
Es gibt keine Chance, ihr zu entkommen. Ihr nächster Angriff wird mich treffen. Das Pärchen hat vorgemacht, was dann mit mir passiert. Aus einem Reflex heraus und so langsam auch mit einer gehörigen Wut im Bauch mache ich das Einzige, was mir noch als Möglichkeit offen zu sein scheint – ich gehe zum Angriff über. Na ja, Angriff ist es eigentlich nicht, aber ich brauche etwas, das mir Zeit verschafft. „Bist du irre“, schreie ich sie an und stampfe stinkesauer und heftig gestikulierend auf sie zu und halte eine Haarsträhne hoch. „Du hast meine Frisur ruiniert!“
Die Distanz ist vier Schritte zu groß. Das reicht nicht. Sie hebt cool und kompromisslos den Stab und zielt auf mich. „Das war es dann wohl“, denke ich noch.
Wenn mir das gestern jemand erzählt hätte, dann hätte ich ihm erklärt, dass es Hotlines für Fälle extremen Realitätsverlusts gäbe, und dass man in Selbsthilfegruppen lernen könne, auch unter extremen Randbedingungen mit sich und der Welt klar zu kommen.
Der Wutausbruch erfüllt seinen Zweck. Die Frau stoppt mitten in der Bewegung und starrt tatsächlich einen momentlang auf meine Haare und schüttelt fassungslos den Kopf. „Du hast sie ruiniert, du Miststück“, pampe ich erneut und fuchtele wild mit den Armen herum.
Ich komme ihr gefährlich nahe. Das sieht sie wohl auch so, denn sie hebt mit einer kurzen, geschmeidigen Bewegung den Stab, deutlich sichtbar bereit, es jetzt zu Ende zu bringen. Ihr Gesichtsausdruck nimmt so eine Mischung aus grimmig und gehässig an, um dann im nächsten Augenblick in ein genussvolles Grinsen umzuschlagen.
Die Frage, ob in so einem Moment das ganze Leben an einem vorbeizieht, kann ich für mich verneinen. Wie in Zeitlupe sehe ich stattdessen eine leere Bierflasche vorbei fliegen. Henrik hat zur Flasche gegriffen und es tatsächlich geschafft, sie nach der Frau zu werfen. Na ja, es ist mehr so die verzweifelte Idee eines Ertrinkenden, der mit irgendwelchen Strohhalmen den Ozean leer zu saufen versucht, bevor er darin untergeht.
Das Ergebnis, ein schlapper Streifschuss am Kopf, der sie zu einem kurzen Nicken veranlasst, ist trotzdem besser als mein Versuch damals beim Sportfest im Ballweitwurf: Genau in dem Moment, als ich zum Wurf ausholte, kam Heiner vorbei. Heiner war Ruderer und hatte für sein Alter eine sehr gut ausgeprägte Figur. Das „V“ seines Oberkörpers brachte er mit engen T-Shirts hervorragend zur Geltung. Natürlich wusste er davon. Alle Mädchen in meiner Klasse waren total in ihn verknallt. Ich auch. Ich erstarrte mitten im Wurf und meine Augen und der Oberkörper folgten seiner Bewegung seitlich nach hinten. Der Ball übrigens auch. Er landete tatsächlich ein Stück hinter mir. Über das Gesicht von Heiner huschte ein wissendes Grinsen, als er davonschwebte. Ich war vierzehn und nicht seine Liga. Er bevorzugte fünfzehn- und sechzehnjährige Mädchen und das auch gerne mal gleichzeitig. Ich brauche die Peinlichkeit des Moments sicher nicht zu erwähnen. Mein Gesicht durchlief trotz der verzweifelten Bemühungen, an etwas anderes zu denken, die Bewegung der extrem weißen Wolken vor dem satten, dunkelblauen Himmel nachzuverfolgen und die ungewöhnlich grüne Farbe der besonders grünen Blätter zu prüfen, peinliche, tiefe Rottöne. Ich glühte bis zu den Ohren. Alle um mich herum grinsten oder kicherten hämisch. Alle, außer unserer Sportlehrerin. „Minus ein Meter“, kommentierte sie den Wurf trocken und trug die Zahl mit stoischer Gelassenheit in die Tabelle auf dem Zettel ihres Klemmbretts ein, was das Gelächter um mich herum nur weiter befeuerte.
Immerhin hat es Henrik geschafft, die Frau für einen Moment abzulenken. Trotzdem drückt sie aus einem Reflex ab. Der Schuss geht sengend heiß seitlich an meiner Hüfte vorbei, ohne nennenswerten Schaden anzurichten. Und jetzt, jetzt endlich erreiche ich sie, kann ihren Arm mit dem Stab zur Seite drücken, packe sie an der Schulter, um sie von mir wegzudrehen, schiebe mich hinter sie und ramme meine Knie in ihre Kniekehlen. Sie knickt ein.
Hab ich dich!
Ich packe sie an ihren Haaren, reiße sie nach unten und schlage ihren Kopf mit aller Kraft auf den Boden.
Die Quälerei im Selbstverteidigungskurs für Frauen an der Uni hat sich in diesem Augenblick definitiv bezahlt gemacht. Ich hätte nie geglaubt, das ausgerechnet einmal gegen eine Frau anwenden zu müssen.
Ach ja, und manchmal ist man einfach zur falschen Zeit am falschen Ort. Heute gilt das für den Typ, der gerade von der Bar durch das Loch in unseren Raum steigt und nach Zielen für den Stab in seiner Hand sucht. Er hat keine Zeit mehr, sich über solch existenzielle Erkenntnisse Gedanken zu machen, denn als ich die Frau zu Boden reiße, halte ich immer noch ihren Arm fest. Der rutscht mir durch die Finger bis zu der Hand mit diesem Stab. Aus dem Ding löst sich einer von den blauen Lichtblitzen und der verdampft den oberen Teil des Mannes bis zur Hüfte mit einem kleinen „Wumph“. Seine Beine bleiben einen Moment stehen, zittern, knicken ein und fallen dann wie in Zeitlupe um.
Das ist jetzt echt ekelhaft!
Die Frau bewegt sich nicht mehr, der Mann ist offensichtlich tot. Erschüttert bis ins Mark stehe für einen Moment fassungslos da. Dann fummle ich ihr angeekelt den Stab aus der verkrampften Hand. „Vorsicht!“, brüllt Henrik aufgeregt, als er meine Absicht erkennt. „Das Ding hat in der Mitte eine Mulde für den Daumen. Damit löst man es aus. Vor- und Zurückschieben reguliert die Stärke.“ Als er mich weiter zittrig an dem Teil herumfingern sieht, fügt er panisch hinzu: „Und zum Sichern am hinteren Ende drehen.“
Der schwarze Stab ist schwerer, als er aussieht. Er hat eine mäanderförmige, recht tiefe, goldene Gravur über seine komplette Oberfläche verteilt und einen kleinen Knubbel am Ende. Der lässt sich leicht drehen und rastet ein. Das blaue Leuchten an der Spitze erlischt.
„Wir müssen hier raus“, stellt Henrik fest und rüttelt an der Tür. „Mist! Sie ist verschlossen!“
Ich haste zu ihm hinüber, fingere hektisch an dem Stab herum, diesmal um ihn zu entsichern. Henrik beeilt sich, aus dem Weg zu kommen.
„Vorsicht, nicht so stark!“, zischt er, während er mich nervös beobachtet. Aber ich habe schon abgedrückt. Der Versuch, das Schloss zu öffnen, gelingt auf Anhieb. Eigentlich ist auch die Tür weg und eventuell fehlt da ein klitzekleines Stückchen von der Mauer. Aber ich schwöre, es ist höchstens ein Meter auf jeder Seite. Ich stöhne, als ich das Ergebnis sehe und kriege Panik vor diesem Ding.
„… und durch Drehen vorne kann man den Strahl fokussieren.“
Er zieht mich nach draußen in die Gasse. Dort laufen ein paar verstörte Leute herum. Doch die meisten flüchten vorne an der Hauptstraße weg vom Lokal.
„Pack ihn weg!“, drängt er leise und zerrt mich hinter sich her über die Gasse. „Wir müssen von hier verschwinden!“, keucht er und schiebt mich zu einem alten Motorroller, der irgendwie das letzte Jahrtausend überstanden hat und eindrucksvoll den Straßenrand als rollende Kunst verziert.
„Bist du irre? Auf diese Rostlaube steige ich nicht!“, brülle ich total panisch. Das Adrenalin tobt bei dem Versuch, die Geschehnisse zu verdrängen, immer stärker durch meinen Körper, die Beine zittern, der Blick verschleiert sich, der Kopf dröhnt und ich knie mich am nächsten Gully auf den Boden, um mich zu übergeben.
Meditation mit einem Gully
Dabei hatte der Abend doch so erfreulich angefangen. Katja, eine Mathematikerin, und ich wohnen zusammen in unserer kleinen Zweizimmerwohnung in Berlin-Wilmersdorf, einer für Studentenverhältnisse viel zu ruhigen Gegend, aber mit einer günstigen Verbindung zu den Unis. Wir haben uns behaglich eingerichtet und so etwas wie eine Wohn- und Lebenskultur entwickelt. Nachmittags gibt es Tee. Kochen und Einkaufen erledigen wir zusammen und dann sind da noch gelegentlich die gemeinsamen Abende vor der Glotze oder in der Kneipe, um dort leidenschaftlich über Gott und die Welt zu diskutieren. Katja ist für mich der Inbegriff einer allerbesten Freundin.
Dieses Wochenende wollten wir es mal wieder so richtig krachen lassen, na ja, das sagte jedenfalls Katja. Ich war schließlich dann doch mit ins Blue Light gekommen, weil sie ihre Fürsorgepflicht für meine Hormonlage entdeckt und mich quasi mit der Ankündigung genötigt hat, irgendwelche Dating-Seiten mit hochnotpeinlichen Anzeigen über meinen hormonellen Notstand zu bestücken und dort meine Telefonnummer mit der Bemerkung „Linah, gut aussehend, mittelgroß, schlank, brünett, ausdrucksvolle braune Augen, sinnliche Lippen, Tag und Nacht erreichbar“, und „dringend“ reinzuschreiben.
Ja, ich war immer noch bockig.
Erik, diese dumme Socke, hat mich vor einer Woche wegen einer anderen abserviert.
Er. Hat. Mich. Verlassen. Dieser. Blödmann.
Und dabei ist seine Neue eine unglaublich bescheuerte Tussi mit so viel Make-up, wie auf der Haut gerade eben noch so haftet. Ich weiß bis heute nicht, wie die wirklich aussieht.
Immer, wenn ich glaube, es könnte mehr als ein netter Flirt zwischendurch werden, kommt der Typ auf die Idee, er sehne sich nach etwas Stockdoofem mit Möpsen so groß wie der Teufelsberg.
Ich klebte an diesem Gedanken wie die Fliege im Spinnennetz. Mir war einfach nicht schon wieder nach so einer Erfahrung, die so richtig blöde Sachen mit meinem Selbstwertgefühl macht. Da ist das Ding mit diesem Verbundenheitsgefühl und dieser kuscheligen Nähe, die ich in einer Beziehung voraussetze wie die Fische das Wasser. Dann braucht es neben der vielen Liebe auch ein ausreichendes Maß an intellektuellen Fähigkeiten. Na ja, ich musste schmerzhaft lernen, dass diese Kombination nicht allzu häufig auftritt. Wenn dann noch ein zumindest rudimentär ausgeprägtes Verständnis für die Gleichberechtigung des weiblichen Teils unserer Gesellschaft dazu kommt, habe ich verloren. Diese Zusammenstellung sieht die Evolution einfach nicht vor.
Trotz all meiner Argumente hatte mir Katja „Feigheit vor dem Freund“ vorgeworfen und mich gegen alle Proteste gnadenlos abgeschleppt, was mir, wenn ich ehrlich bin, auch guttat.
Aber natürlich konnte ich das auf keinen Fall zugeben.
Es fällt mir nicht schwer, jemanden kennenzulernen. Mein Aussehen ist passabel und ich ertrage Smalltalk über mehrere Minuten, aber mit Katja kann ich nicht konkurrieren. Sie sieht unfassbar gut aus. Da ist dieses ansprechende Gesicht, das ihre Intelligenz trotz aller Nettigkeit und des Charmes nicht zu verbergen vermag. Das weißblonde Haar fällt ihr bis auf die Schulter und wird energisch aus dem Gesicht gefegt, wenn es mal wieder vorwitzig nach vorne fliegt. Dann sind da diese ausdrucksstarken, mandelförmigen, freundlichen Augen, dazu die unendlich langen, wohlgeformten Beine und schließlich zu allem Überfluss die sportlichen Rundungen an den richtigen Stellen. Der Stoff, aus dem hitzige Männerträume sind.
Ein echter Hingucker!
Später, in der Kneipe, hat sie mich dann schnöde stehen lassen, angeblich, um mir den nötigen Freiraum für heiße Flirts zu verschaffen. Sie hat sich ihren Kommilitonen Sebastian geschnappt. Mit dem schwofte sie unanständig nah an ihn gedrängelt auf der Tanzfläche herum. Später haben sie sich dann grinsend abgesetzt. Wir werden morgen wohl zu dritt frühstücken.
Sebastian ist wie sie Mathematiker, der die ganze Zeit mit leuchtenden Augen von seiner ersten Veröffentlichung erzählt: „Im sechsdimensionalen Raum schneiden sich zwei dreidimensionale Räume in einem Punkt“, doziert er mit überheblich grinsendem Gesicht und erhobenem Zeigefinger immer, wenn man ihn danach fragt, worauf mir Katja dann, um mein demonstratives Stöhnen abzumildern, wortreich versichert, dass das für einen Mathematiker ein wirklich sehr anschauliches Thema sei. Das könne man sich ja schon beinahe vorstellen.
Na ja, beinahe. Mathematiker!
Ihr Plan hat funktioniert. Als die Band endlich eine Pause einlegte, hat mich Henrik angegraben. Ich mochte seinen Bariton sofort, die Grübchen seiner Wangen und die süßen Lachfältchen an den Augen machten mir ziemlich zu schaffen. Vielleicht hatte ich auch ein völlig unerwartet einsetzendes Herzklopfen, das meinen Oberkörper bis zum Hals erschütterte. Und ja, manchmal ist Frau für solche Reize eben empfänglicher, als das für den Anfang gut ist. „Dann sollte man zumindest eine kritische, prüfende Distanz aufrechterhalten, bis man sicher ist, dass er der Richtige ist“, wiederholt meine Mutter bei jeder Gelegenheit, quasi wie ein Mantra. Und die muss es ja wissen. Sie war schließlich ein Leben lang mit dem Mann verheiratet, den sie mit sechzehn in der Schule kennengelernt hatte. Prüfungszeit: eine Minute, wie ich aus verlässlicher Quelle weiß.
Benommen sehe ich mich um und richte mich auf. Endlich bin ich in der Lage, mich mit schmerzenden Knien von diesem Gully zu lösen. In der Zwischenzeit bin ich mir ganz sicher: In diese Kneipe werde ich nie wieder gehen. Das Relief in der Wand hat sich unauslöschlich in mein Gedächtnis eingebrannt.
Und jetzt?
Eigentlich ist Henrik ganz nett. Er läuft gerade nochmal in die Bar, um Wasser für mich zu holen, denn das Dröhnen in meinem Kopf nimmt weiter zu. Eine furchtbare Migräne kündigt sich an und explodiert mit ersten Paukenschlägen hinter Schläfen und Stirn.
Schwer zu ignorieren.
Alle meine Versuche, wieder einen klaren Gedanken zu fassen, sind bisher grandios gescheitert. Es fühlt sich an, als ob sich auch die letzte Faser weigert, über die Ereignisse nachzudenken. Doch es muss sein. Die Zeit für Entscheidungen wird knapp. Das ist Berlin. Hier ist gleich der Teufel los. Trotzdem findet mein Kopf einen Weg zurück zu den Szenen in der Bar. Wieder läuft mir eine Gänsehaut über den Rücken und die Zehennägel versuchen, sich durch die Schuhe in den harten Asphalt zu graben. Endlich gelingt es, die umherirrenden Gedanken einzufangen und mit allem Nachdruck auf die unmittelbare Zukunft zu richten. Ich zwinge mich zu einer ersten Analyse:
Situation:
Bescheiden. Ich habe zwei Leute getötet. Aus Notwehr. Rechtlich gesehen komme ich wahrscheinlich davon.
Seelenlage:
Würg. Verschieben.
Erklärung für den Anschlag:
Keine. Verschieben.
Optionen für das weitere Vorgehen:
Das wird knifflig. Hier kommt der Grund, weshalb mein Unterbewusstsein so hartnäckig auf Nichtbefassen schaltet und mir statt einer Lösung Kopfschmerzen präsentiert: Es ist diese Waffe. So etwas habe ich noch nie gesehen oder davon gehört. Ich bin promovierte Physikerin und arbeite in der Forschung an der Uni. Weder dieses blaue Leuchten, das ein Loch in die Bar frisst, noch dieser feine, schwarze Nebel sind mir je untergekommen. Jetzt ist die Physikergesellschaft weltweit so etwas wie eine kleine Familie. Zumindest war sie das mal. Wenn jemand neue Phänomene erforscht, dann weiß es die Welt. Um solche Waffen zu entwickeln, benötigt man jahrzehntelange Grundlagenforschung. Dazu kommen Forschungsaufträge mit Veröffentlichungen. Was ich hier gesehen habe, war das Endprodukt, die Waffenreife.
Wenn man alle wahrscheinlichen Erklärungen ausgeschlossen hat, dann ist das Unwahrscheinliche die Lösung: Ich streiche die Option, dass eines der großen Länder wie China oder die USA sich mal wieder etwas Neues ausgedacht haben, um Menschen umzubringen. Was bleibt, ist folgende wackelige Arbeitshypothese: Diese Technologie kommt nicht von der Erde und Henrik kennt die Waffe und ihre Wirkung.
Wieder wird mir schlecht, doch es gelingt, den Brechreiz zu unterdrücken. Das hier ist zu wichtig. Angenommen, ich liege mit meiner Annahme richtig, dann muss ich folgern, dass dieser Stab nicht das einzige Mordinstrument ist, das sie haben. Außerdem sind sie in der Lage, uns zu infiltrieren, denn sie sehen aus wie wir.
Verdammt! Wenn sie mich umbringen wollen, dann kann sie niemand hier auf der Erde davon abhalten. Meine Hinrichtung ist nicht zu verhindern. Darüber hinaus mutiere ich, wenn das alles bekannt wird, in kürzester Zeit zu so einer Art Pantoffeltierchen, das man unter das Mikroskop legt und seine Verhaltensweisen studiert. Ich sehe schon die Zeitungsmeldungen dazu vor meinem geistigen Auge: Terror aus dem All - Außerirdische verüben brutales Attentat auf junge Frau. Sie hatte heute Müsli zum Frühstück, trägt Jeans und eine dunkle Bluse. Dazu ein Bild von mir im knappen Bikini. Tägliche Panikattacken vor weiteren Anschlägen inbegriffen.
Ich möchte schreien. Doch dafür ist keine Zeit.
Wenn hierbleiben nicht funktioniert – bleibt nur die Option, mit Henrik zu verschwinden.
Chancen:
Es scheint zwei Gruppen von Außerirdischen zu geben, die einen sind aggressive Killer, die anderen, also die von Henrik, sind ...? Keine Ahnung.
In der Zwischenzeit bin ich mir sicher, dass mein ritterlicher Freund nicht von der Erde kommt. Folglich begebe ich mich in die Höhle des Löwen, wenn ich ihn überhaupt überreden kann, mich mitzunehmen. Aber er hat Informationen, die ich dringend benötige, um zu verstehen, was hier los ist. Ich will nicht dumm sterben. Physikerinnen tun so etwas nicht!
Auf der anderen Straßenseite verlässt Henrik die Bar und bringt zwei Flaschen Wasser mit über die Straße. Er lächelt mir zu, besorgt, rührend, aber deutlich distanzierter als eben noch. Offensichtlich hat auch er die Zeit zum Nachdenken genutzt.
Dankbar nehme ich das Wasser, trinke mit gierigen, großen Schlucken, um den widerlichen Geschmack aus dem Mund zu vertreiben, und wasche mir das Gesicht ab. Übelste Katzenwäsche. Henrik beobachtet mich aufmerksam, fast schon lauernd.
„Das waren Nunjal.“
„Hmm“, gluckere ich mit vollem Mund.
„Die können menschliche Form annehmen.“
„Klar doch. Kann ich auch. Aber nicht montags“, nuschle ich und schlucke dann das restliche Wasser der einen Flasche hinunter. Ein Teil davon tropft auf mein Kleid und von dort auf die Straße.
„Als ich eben drin war und das Wasser geholt habe, hat die Auflösung schon begonnen.“
„Auflösung?“
„Ja. Wenn Nunjal sterben, verlieren sie die Kontrolle über ihre Zellanordnung und zerfließen zu einer farbigen Pfütze.“
Vor uns hasten Menschen die Straße entlang. Ein Pärchen schleppt eine verletzte Frau mit einer Platzwunde am Kopf an uns vorbei, weg von der Kneipe, irgendwohin. Einige sitzen am Boden, benommen vor sich hinstarrend, an die Hauswand gelehnt oder auf der Bordsteinkante, kopfschüttelnd, gestikulierend, fassungslos, verwirrt. Die meisten warten auf das Eintreffen der Rettungskräfte. Wieder andere wollen einfach nur weg von hier.
Und wir?
In der Ferne höre ich die ersten Sirenen. Sie kommen rasch näher.
Ich seufze nervös und gebe mir einen Ruck: „Henrik, du kennst die Waffe der beiden Verrückten, ich meine die Leute, die das Attentat verübt haben.“
Ich tippe ihm mit der zweiten Wasserflasche auf die Brust und blicke ihn fordernd an. Er lehnt sich irritiert nach hinten und macht einen Schritt zurück.
„Weder die Bauart noch die Wirkung hat hier je einer gesehen“, setze ich unbarmherzig und mit zunehmender Energie in der Stimme nach. „Auch Nunjal kennt hier keiner. Du weißt schon, wie das wirkt?“
Werde ich sauer? Nein, bestimmt nicht. Warum auch. Ich bemühe mich lediglich, betont zu artikulieren.
Er sieht betreten auf den Boden, lässt den Blick mit zusammengebissenen Zähnen über die Verletzten schweifen, um mich mit einem verzweifelten Stöhnen anzusehen.
„Ja, schon klar!“, murmelt er dann. „Aber ich konnte dich da nicht hängen lassen, obwohl ich das hätte tun müssen. Ich brachte das einfach nicht fertig! Käressanko Fah!“
Auch seine Stimme ist in der Lage, Volumen auszuprägen. Dazu starren mich seine graublauen Augen wütend an.
Das kann ich auch.
Wieder schweigt er, atmet zischend durch die Zähne und wischt sich über die heiße Stirn.
„Komm schon, sag was!“, drängle ich. „Wir brauchen eine Lösung. Jetzt!“
Endlich, nach einer unerträglich lang erscheinenden Pause antwortet er gepresst: „Ja, du hast mit deinen Beobachtungen recht. Ich sollte nicht hier sein, wenn eure Ordnungskräfte gleich auftauchen.“
Unsere Ordnungskräfte also. Niemand in Berlin nennt die Bullen Ordnungskräfte. Aber das scheint er nicht zu wissen. Und seine Aussage bringt uns keinen Schritt weiter.
Nach ein paar Augenblicken wird es mir dann zu bunt, denn die Sirenen kommen immer näher und da ist noch nicht mal ansatzweise eine Lösung in Sicht.
„Fassen wir es nochmal kurz zusammen“, formuliere ich deshalb mit einer demonstrativen, freundlichen Ruhe wie bei einem kranken Gaul. „Du sprichst perfekt Deutsch ohne erkennbaren Akzent, aber gelegentlich mit einer ungewöhnlichen Syntax, willst nicht mit der Polizei in Berührung kommen, hast mich gewarnt und mir dann geholfen, zu entkommen. Du kennst diese Nunjal, die sehr merkwürdig sterben und Waffen benutzen, die nicht in diese Welt gehören, weil die Technologie hier nicht bekannt ist. Das alles zielt in eine Richtung, die mir echt unheimlich ist.“
Wieder druckst er herum, gibt sich dann aber deutlich sichtbar einen Ruck und nuschelt: „Ja, du hast Recht. Ich bin nicht – ääääh, also, ja, also ich bin nicht von hier.“
„Nicht von hier oder, na ja - oder so gar nicht von hier?“ Er seufzt tief, lehnt sich mit dieser Echt-jetzt-Miene zurück, sieht mich an, als hätte ich irgendwelche Defizite und wirkt erschöpft, wie er sich so über die Augen wischt. Und, unangenehme Pausen beantworten die meisten Fragen, auch wenn keiner etwas sagt und dafür weiter betreten Löcher in die Luft starrt.
Ich ändere die Taktik: „Möchtest du den Stab wiederhaben? Er ist ganz schön schwer und wenn die Polizei gleich eintrifft, werde ich Probleme damit bekommen.“
Das ist übertrieben. Ich muss denen ja erstmal nichts von diesem Ding erzählen, aber es erhöht den Druck.
Der erste Rettungswagen biegt um die Ecke. Dem Lärm der Sirenen nach zu urteilen, ist ganz Berlin auf dem Weg zu uns.
„Nein, behalte ihn lieber“, murmelt er erstaunt über die Frage und, weil der Rettungswagen in sicherer Entfernung an der nächsten Ecke abwartend stehen bleibt. „Ich hasse diese Dinger und vielleicht bietet er dir ja sogar ein wenig Schutz, falls sie nochmal angreifen.“
„Was?“, brülle ich, spüre, wie der Sabber sich mit Schwung von meinen Lippen löst, „es gibt noch mehr von denen?“
„Ja. Sie arbeiten in Zweierteams und es sind noch zwei weitere davon hier.“ Ich sehe mich panisch um, checke alle Ecken.
Hierbleiben scheidet definitiv aus.
„Käressanko Fah!“, schreie ich außer mir und meine Hände ballen sich ohne mein Zutun zu Fäusten und pressen sich mit aller Kraft gegen die pochenden Schläfen. Henrik sieht mich irritiert an und zieht erstaunt die eine Augenbraue hoch.
„Du lernst schnell“, grinst er dann vorsichtig, legt einen Arm um meine Schultern und zieht mich kumpelhaft zu sich heran, um ein paar Schritte mit mir zu gehen, gerade so, als würde das Gehen die Panik senken.
Ich versuche, diesen erneuten Schlag zu verdauen, und frage: „Gibt es Rückstände, wenn sie - äh - zerfließen?“
„Na ja, die Pfütze bleibt. Aber sie vermischt sich immer mehr mit dem Bier aus der Flasche.“
Ich mache mir keine Illusionen. Die Arbeit der Polizei wird bei dem Zustand der Bar und den merkwürdigen Randbedingungen sehr gründlich ausfallen. Aber ausschlaggebend für die anstehende Entscheidung sind die beiden verbleibenden Nunjal-Teams und ihre unterstellte Beharrlichkeit bei der Ausführung ihres Auftrags.
„Ich habe keine Chance, ihnen zu entkommen. Die finden mich immer wieder!“, presse ich heraus.
Henrik sieht mich kurz an und nickt.
„Und dann bleibt da noch die Frage nach den Motiven dieser Killer“, fahre ich fort. „Wie kann es sein, dass zwei Nunjal den Auftrag haben, mich zu töten? Wer hat denen den Auftrag erteilt und warum machen sie sich auf den weiten Weg zur Erde, nur um mich zu finden und ohne jede Warnung oder sonst irgendwelche Kompromisse zu ermorden? Das ergibt überhaupt keinen Sinn!“ Meine Stimme hebt sich mal wieder ohne mein bewusstes Zutun.
Zuviel Druck auf dem Kessel!
Er winkt ab.
„Das finden wir später heraus. Du hast selbst gesehen, wie brutal sie vorgehen. Deine Ordnungskräfte können dich nicht vor ihnen schützen. Die wissen ja nicht mal, dass es sie gibt. Und sie haben keine Waffen, die geeignet wären, um irgendetwas gegen die auszurichten. Wir haben ihre Aktivitäten vor kurzem erst entdeckt und ich wollte mal nachsehen, was die hier so treiben. Aber ich bin ihnen zu nah gekommen und wurde zum Teil des Geschehens.“
„Gott sei Dank wurdest du das. Danke übrigens für deine Hilfe!“, presse ich heraus. „Aber trotzdem, was machen wir jetzt?“ Spüre ich da die entscheidende, weiche Stelle bei ihm?
Er murmelt zurückhaltend und geistesabwesend „gib mir einen kleinen Moment“ und wendet sich ab.
Drama, Baby! Drama!
Während er unruhig vor mir auf dem Gehweg auf und ab tigert, höre ich ihn mit jemand in so einem melodischen Singsang sprechen, ohne ein Mikrofon oder andere technische Hilfsmittel zu entdecken. Er scheint sich zu verteidigen. Gebannt verfolge ich jeden seiner Schritte und trinke hastig ein paar Schlucke kühlen Wassers aus der zweiten Flasche, um meine Panik hinunterzuspülen. Es hilft nur kurz.
Neben dem Krankenwagen taucht die erste Wanne auf, so nennen die Berliner liebevoll die Mannschaftswagen der Polizei, und stellt sich mit einer dramatischen Schlingerbewegung in sicherer Entfernung zur Bar quer auf die Straße. Das Blaulicht bleibt an.
Mist! Die sperren den Block ab.
Ich kenne das Theater von Demos, auf denen es ein bisschen unruhiger wird. Sowas, wie Bauwagen anzünden, Mollis werfen, Straßensperren errichten. Berlin eben.
Zeit, sich zu verpieseln.
Henrik wandert noch immer. Endlich, nach einer gefühlten Ewigkeit, beendet er sein Gespräch und kommt auf mich zu.
„Wir sollten von hier verschwinden. Kommst du mit?“, fragt er statt einer Erklärung. Ich nicke erleichtert und steige entschlossener, als ich mich fühle, hinter ihm auf das Fossil.
Niemand achtet auf uns, als wir über eine Seitenstraße knatternd abhauen, denn hier sind fast alle auf der Flucht. Henrik fährt betont langsam, biegt immer wieder ab. Einmal, als wir hören, dass sich ein Polizeifahrzeug nähert, wechselt er sogar die Fahrtrichtung. Er will vermeiden, erklärt er mir, dass wir uns offensichtlich vom Tatort entfernen.
Option zwei also
Während ich auf dem Fossil langsam zur Ruhe komme, spielt mir mein Kopfkino großzügig ausgestattete, überaus lebhafte Szenen aus der Bar vor, einige Male zu oft und zu intensiv, um es ignorieren zu können. Ich lasse es schließlich zu, suche nach Stellen, an denen andere Verhaltensweisen zu einem für mich günstigeren Ergebnis hätten führen können, finde aber nichts wirklich Gravierendes. Dazu war es einfach zu überraschend und zu brutal.
Irgendwann beruhigt mich das stete, gleichmäßige Hämmern des Zweitaktmotors zusammen mit dem kühlen Fahrtwind, der mir träge über die Beine streicht. Ich hänge wie erschlagen hinter Henrik und suche nach etwas Wärme an seinem schützenden Rücken. Auf die Frage, wo wir denn eigentlich hinfahren, grinst er nur vorsichtig über seine Schulter. Ich solle es abwarten.
Okay. Nicht meine Stärke.
Vielleicht haben die ja eine Basis hier in Berlin. Die Flucht auf einem lahmen Roller würde jedenfalls dazu passen. Oder er bringt mich in einen Bunker im Keller eines Abrisshauses im Wedding mit riesigen Tunneln und einer Verbindung zur Berliner U-Bahn.
Warum eine Verbindung zur U-Bahn?
Keine Ahnung. Ich habe sie ja nicht gebaut.
Hör auf damit! So kommen wir nicht weiter.
Oder der Oberbau des Funkturms ist wie bei „Men in Black“ in Wirklichkeit ein Raumschiff. Aber dann wäre unsere Richtung falsch, denn wir umkreiseln gerade den Großen Stern und biegen nach Norden ab.
Ich bin Physikerin aus Überzeugung. Mein Studium war hart wie alle naturwissenschaftlichen Fachrichtungen. Immer wieder wurden wir gezwungen, alleine oder im Team in kürzester Zeit passable Ergebnisse zu produzieren. Irgendwie habe ich das trotz aller Widrigkeiten gemocht. Nicht zu vergessen, das berauschende Gefühl, wenn man es endlich geschafft hat und den Abschluss in der Hand hielt.
Na ja. Wie auch immer.
Jedenfalls grüble ich schon eine Weile darüber nach, wie „die“ denn zu uns gekommen sind. Mit einem Raumschiff wahrscheinlich. Mit Schlaftanks, damit sie die lange Reise unbeschadet überstehen und Trockenfutter, das man sekundenschnell rehydrieren und erhitzen kann. Möglicherweise haben sie ja einen hydroponischen Garten und eine Hühnerzucht im Unterdeck? Oder nüchterne, sterile Gänge mit einem Schalter an der Wand und einem Mikrofon, in das man dann „Kirk an Brücke“ hineinrufen kann?
Meine unglaublich essentiellen und überaus wertvollen Gedanken werden jäh unterbrochen, als Henrik am nördlichen Tiergarten ohne Vorankündigung in eine kleine Seitenstraße abbiegt. Er hat es eilig. Ich bin sicher, Katja hätte sich über das Achterbahngefühl gefreut. Ich bin da nicht so ein Fan.
Mein Gott! Katja! Die habe ich völlig vergessen!
Ich zipple mein Smartphone aus der Tasche, scrolle mit dem Daumen die Nachrichten durch und finde eine ganze Reihe Nachrichten von ihr. Die Letzten sind schon beinahe panisch. Und gerade, als ich ihr einhändig auf einem fahrenden Roller und ohne Rücksicht auf meine Gesundheit antworten will, geht ein Ruck durch das Fossil, der mich heftig auf dem harten Sitz zusammenstaucht. Wir bewegen uns nach oben, die Laderampe eines LKWs hinauf auf die Ladefläche, wo das Fossil mit einem aufwändigen Hüpfer in einem Bogen zum Stehen kommt. Sein Motor verstirbt mit einem letzten Röcheln.
Es ist ein weißer LKW mit einem geschlossenen Aufbau, aber ohne rotes Kreuz außen drauf.
Also keine mobile Klapse.
Wie beruhigend.
Die Laderampe fängt sofort nach unserer Landung an, sich zu schließen und den Raum zu verdunkeln.
Angst!
Wo habe ich mich jetzt schon wieder hineingeritten?
Die Lampen der Stadt verschwinden langsam am oberen Rand der Rampe.
Ich fauche Henrik an: „Was zum Teufel soll das?“
Doch der legt seinen Arm besänftigend, ja übervorsichtig, um meine Schulter und zieht mich heran.
„Es bleibt dunkel, bis die Klappe zu ist“, erklärt er mir betont gelassen. „Wir wollen keine Hinweise auf unsere Anwesenheit geben. Es wird gleich hell.“
Das soll mich beruhigen. Tut es aber nicht.
Ich reiße mich los, fluche, weil ich mich schon wieder in eine Situation habe reinziehen lassen, die ich nicht kontrollieren kann, bin sauer auf Henrik, weil er mich da rein manövriert hat, und beschimpfe den Rest der Welt. Ausführlich.
Der Typ neben mir bleibt trotz der möglicherweise ungerechten und ungebührlich laut geäußerten Vorwürfe völlig ruhig, provozierend gelassen und grinst dämlich, als ginge ihn das alles gar nichts an.
Showtime!
Die Wand vor uns wird transparent, dünner, löst sich auf und gibt den Blick auf eine futuristisch anmutende, abgefahrene Halle frei.
Oh. Mein. Gott.
Wände gibt es keine. Dafür unterteilen zu Bäumen verwobene Lichtfaserbündel den gewaltigen Raum. Weiter oben verzweigen sie sich wie Baumkronen und treffen die Decke in vielleicht 15 Metern Höhe. Die feinen Fasern strahlen am Stamm ein warmes Licht in einer Vielzahl von Orange- und Siena-Tönen ab, geschickt mit Rot und Gelb akzentuiert, um den räumlichen Charakter der Säulen zu betonen. Weiter oben folgen dunklere, weinrote und violette Nuancen, die direkt unter der Decke nahtlos in ein diffuses Ultramarinblau übergehen. Der hellblaue Fußboden ist an den Übergängen zu den Wurzelbereichen der Stämme farblich abgesetzt und im Halbdunkel gut zu erkennen.
Atemberaubend.
Meine Augen gewöhnen sich allmählich an das gedämpfte Licht. Die aufgeregte Beklemmung und die verkrampfte Panik bleiben. Der Boden senkt sich nach allen Seiten langsam ab, gerade so, als würden wir auf der gewölbten Oberfläche einer riesigen Kugel stehen.
Zwischen den Bäumen erstrahlen Lichtinseln, um die sich Leute gruppieren, anscheinend, um zu arbeiten. Die Helligkeit stammt von über dem Boden schwebenden Hologrammen. Fast überall erkenne ich Details aus dem Innenraum der Kneipe, die den Tatort zum Teil abgefahren technisch abstrahiert oder real abbilden. Die meisten Leute arbeiten stehend an kleinen Lichtkonsolen. Viele von ihnen blicken kurz auf, als wir uns nähern, einige nicken uns zu und wenden sich dann wieder konzentriert ihrer Betätigung zu.
„Boah!“, entfährt es mir nervös. Das habe ich nicht erwartet. In meiner Fantasie sind Raumschiffe alte Klapperkähne, an denen sich die Protagonisten für die ständig erforderlichen Reparaturarbeiten beharrlich abarbeiten.
„Wir haben zwei Designer an Bord, die den Innenraum nach jedem Zyklus neugestalten. Sie haben sich diesmal wieder selbst übertroffen“, erläutert mir Henrik im besten Plauderton eines ambitionierten Touristikprivatunternehmers an irgendwelchen Pyramiden Nordafrikas.
„Wie lange dauert denn so ein Zyklus?“
„Etwa 30 eurer Stunden.“
Direkt vor mir in der Mitte des Raums erkenne ich eine Sitzgruppe mit einem Bezug wie weißes Leder mit vielleicht zehn, nein zwölf kreisförmig um das Hologramm angeordneten Sitzschalen, die ohne Füße oder so was frei im Raum schweben. Die Abbildung zeigt den Nebenraum der Bar so real und plastisch, dass ich das Bild nicht von der Realität unterscheiden kann. Gerade zoomt jemand die „Pfütze“ der Frau heran, die immer mehr wie eine fahle Bierlache aussieht. Der blaue Schimmer ist zunächst nicht zu erkennen. Aber dann verstellt jemand etwas und die Flüssigkeit verfärbt sich auf dem gefliesten Fußboden intensiv bernsteinfarben, während bläuliche Schlieren sie wie milchiger Rauch durchziehen.
Die Überreste einer Lebensform.





























