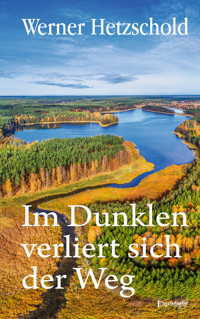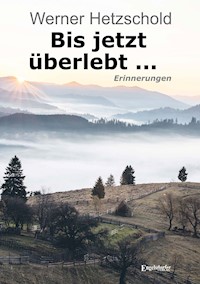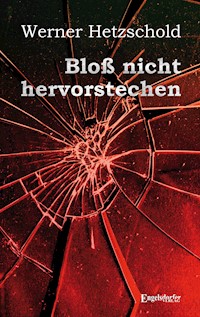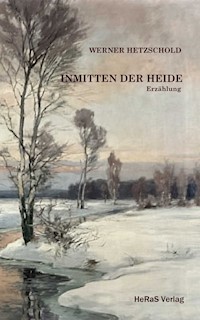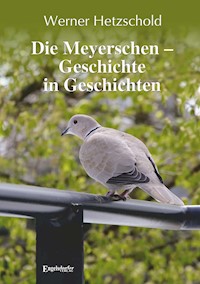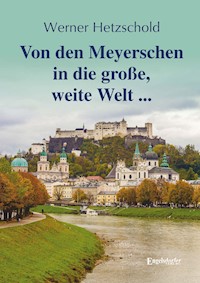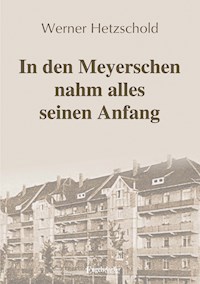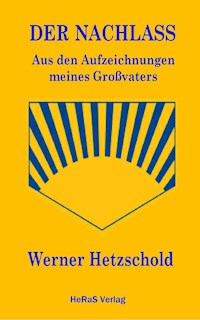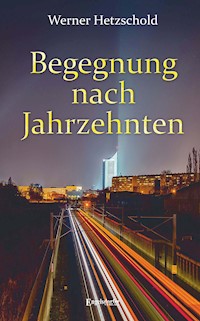
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Engelsdorfer Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Nach vielen Jahrzehnten ist Jan in seine Heimatstadt Leipzig zurückgekehrt. Als Tourist. Noch ist er körperlich fit, fühlt sich auch so. Solange er noch gesundheitlich in der Lage ist, wird er in der Weltgeschichte herum reisen. Immer wieder hat er die vorgesehene Reise in die Stadt seiner Jugend verschoben, weil die Erinnerungen sich stets Zugang zu seinen Träumen verschaffen, ihn mit Bildern überhäufen, die er nicht sehen will. Doch mit zunehmendem Alter meldet sich immer öfters das Verlangen, die Orte seiner Jugend noch einmal zu besuchen, bevor es zu spät ist. Während er durch die Straßen schlendert, die ihm dem Namen nach aus seinen Kindertagen bekannt sind, stellt er fest, scheinbar ist nichts so geblieben, wie er es zurückgelassen hat. Alles hat sich verändert. Nicht nur er! Die Stadt, deren Zentrum ihm einst äußerst vertraut war, hat ihr Aussehen vollkommen gewandelt. Nicht leicht ist es, einen Einheimischen zu finden. Die Stadt lebt vom Tourismus, vom Fremdenverkehr. Werner Hetzscholds kurzweilige Erzählung nimmt den Leser mit auf eine Stadtbesichtigung in der Gegenwart, die von zahlreichen Erinnerungen geprägt ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Werner Hetzschold
BEGEGNUNG NACHJAHRZEHNTEN
Engelsdorfer Verlag Leipzig2022
Bibliografische Information durch die Deutsche Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.de abrufbar.
Copyright (2022) Engelsdorfer Verlag Leipzig
Alle Rechte beim Autor
Titelbild © frank bohneEyeEm [Adobe Stock]
Hergestellt in Leipzig, Germany (EU)
www.engelsdorfer-verlag.de
Nach vielen Jahrzehnten ist Jan in seine Heimatstadt zurückgekehrt. Als Tourist. Noch ist er körperlich fit, fühlt sich auch so. Solange er noch gesundheitlich in der Lage ist, wird er in der Weltgeschichte herum reisen. Immer wieder hat er die vorgesehene Reise in die Stadt seiner Jugend verschoben, weil die Erinnerungen sich stets Zugang zu seinen Träumen verschaffen, ihn mit Bildern überhäufen, die er nicht sehen will. Doch mit zunehmendem Alter meldet sich immer öfters das Verlangen, die Orte seiner Jugend noch einmal zu besuchen, bevor es zu spät ist.
Es ist Anfang Juni. In einem Hotel im Zentrum hat er ein Zimmer gebucht, nicht weit vom Hauptbahnhof entfernt. Es ist eines der Hotels, die bereits vor ihm in der Stadt existierten und auf eine lange und abwechslungsreiche Geschichte zurückblicken. Es hat sich verändert. Als ein altes Gebäude hat er es in der Erinnerung, jetzt präsentiert es sich als eine junge Schönheit mit vielen komfortablen, aber gemütlichen Zimmern. Während er durch die Straßen schlendert, die ihm dem Namen nach aus seinen Kindertagen bekannt sind, stellt er fest, scheinbar ist nichts so geblieben, wie er es zurückgelassen hat. Alles hat sich verändert. Nicht nur er! Die Stadt, deren Zentrum ihm einst äußerst vertraut war, hat ihr Aussehen vollkommen gewandelt. Wie werden sich die einzelnen ihm noch dem Namen nach bekannte Stadtteile verändert haben? Vielleicht sind noch neue Vorstädte hinzugekommen, von deren Existenz er keine Ahnung hat. Er überlegt, findet schnell und unkompliziert eine Lösung. Er wird sich einer City-Tour per Bus anschließen, wird so zügig mit den Sehenswürdigkeiten der Stadt vertraut gemacht werden, ohne lange und zeitraubende Fußmärsche ertragen zu müssen. Ohne zu zögern begibt er sich auf die Suche nach einer Haltestelle. Um die Zeit noch zu verkürzen, erkundigt er sich bei einem Einheimischen nach dem Standort. Nicht leicht ist es, einen Einheimischen zu finden. Die Stadt lebt vom Tourismus, vom Fremdenverkehr. Erleichtert atmet er auf. Vor ihm an der Haltestelle wartet ein City-Bus, ein roter Doppeldecker, schon gut besetzt. Er erhöht das Schritt-Tempo. Unbedingt will er diesen Bus erreichen. Wartezeiten mag er absolut nicht. Er ist erfolgreich. Vielleicht hat ihn der Busfahrer von Weitem bemerkt. Tief atmet er durch, bevor er in den Bus steigt. Er will vermeiden, dass bemerkt wird, dass bereits geringe Anstrengungen ihn außer Atem bringen. Im Obergeschoss findet er einen freien Fensterplatz, der seinen Vorstellungen entspricht. Er ordnet sich und sein Gepäck, ist mit sich zufrieden, dass alles so gut geklappt hat. Die Tour wird ihm gefallen. Nicht nur im Bus wird er sitzen, sondern auch zu Fuß werden Ziele angesteuert. Er kann es gar nicht erwarten, dass die Reise losgeht. Wie ein Kind fühlt er sich, dass sich auf das zu Erwartende freut. Werden die Bilder aus den Kindertagen mit denen der Jetzt-Zeit noch Ähnlichkeiten aufweisen? Oder wird ihm die Stadt aus seinen Kindertagen total fremd, völlig neu erscheinen? Bald wird er es wissen. Er blättert im Katalog, liest, dass die klassische Stadtrundfahrt, auch Rote Tour genannt, ihn zu den bekanntesten und beliebtesten Sehenswürdigkeiten der Stadt führt. Sie wird »Stadt der Linden« genannt. So hieß sie schon während seiner Kindertage. Düben in der Dübener Heide gelegen, war ursprünglich die Stadt der Eichen, denn Dub, russisch 'дуб' bedeutet in den slawischen Sprachen Eiche, zu finden in deutschen Ortsnamen wie Duben. Duben ist ein Ortsteil der Stadt Luckau im Landkreis Dahme-Spreewald in Brandenburg, aber auch im Russischen begegnet Jan der Stadt Dubna. So künden die Namen der Städte von den einstigen Bewohnern dieser Gegend, die überall ihre Namen hinterlassen haben. Etwa 90 Minuten soll die Stadtrundfahrt dauern. In dieser Zeitspanne wird er viel zu sehen bekommen. Nicht nur rote Busse sind unterwegs, sondern auch blau-gelbe Doppeldecker und auch grüne. Moderne Straßenbahnen lenken seine Aufmerksamkeit auf sich. Ihre Farben sind gelb, blau, silbern. Auf der Roten Tour, die er gewählt hat, existieren 13 Gelegenheiten zum Aussteigen, die er für einen persönlichen Spaziergang nutzen kann, um mit einem der Folgebusse die Erkundungsreise fortzusetzen. Jan entscheidet sich und beschließt, erst einmal abzuwarten und alles auf sich zukommen zu lassen.
»Alles in Ordnung?«, hört er eine Stimme.
Ihre Blicke begegnen sich.
»Johanna!«
»Jan! Unser Romantiker! Unser Dichter!« Angenehm, geradezu beruhigend klingt ihre Stimme. Er schaut zu ihr auf. Alt ist sie geworden, stellt er fest, gleichzeitig kommt die Ernüchterung: Das wird sie auch von mir denken. Das Leben ist nicht spurlos an uns vorüber gegangen, hat seine Zeichen, seine Wund-Merkmale gesetzt.
Sie lächelt.
In seinem Gesicht spiegelt sich noch immer das Erstaunen wider, die Überraschung, das Nicht-Erwartete.
»Als Gästeführerin werde ich dich begleiten«, sagt sie mit ihrer sanften, wohl klingenden Stimme. »Für 90 Minuten bist du mir ausgeliefert, wenn du nicht bei einem der 13 Haltepunkte mich verlassen solltest. Bis später!«
»Bis später«, flüstert Jan.
Er sitzt neben ihr. Das kleine Fahrzeug kennt den Weg.
»Du verdienst jetzt deine Brötchen als Gästeführerin. Dir ergeht es wie mir. Die Rente, die uns Vater Staat gewährt, reicht nicht aus, um unsere Bedürfnisse zu befriedigen.«
Wieder umspielt ein feines Lächeln ihr schmales, von Furchen gezeichnetes Gesicht. Emotionslos sagt sie: »Mir reicht meine Rente, aber ich muss mich unter die Leute mischen. Ich brauche das Leben um mich herum, die Abwechslung, die mir die Gastronomie, das Hotelwesen, der Tourismus bieten. Müsste ich abends allein zu Hause bleiben, mir fiele die Decke auf den Kopf. Noch gehöre ich nicht zum alten Eisen, auch wenn ich so ausschaue.«
»Du siehst gut aus, verdammt gut«, fällt ihr Jan ins Wort. »Viele Jahrzehnte sind vergangen, seit wir uns nicht mehr gesehen haben. Und jetzt steht die Johanna Birsen leibhaftig vor mir, beweglich und lebendig, wie ich sie seit Jahrzehnten in Erinnerung behalten habe. Später hörte ich, du hättest einen Herrn Golubeu geheiratet. Aus der Johanna Birsen wurde ein Frau Blau, denn голубой wird für die Farbe Blau verwendet. Dein Gatte hätte auch Herr Pjany heißen können, пьяный bedeutet auch blau. Weitere Bedeutungen sind berauscht, betrunken, besoffen. So aber verkörperst du das Sinnbild der Blauen Blume, bist das Sinnbild der Romantik. Aber als unsere Russisch-Expertin ist dir das ganz sicher bekannt.«
Wieder lächelt sie, versonnen, in Gedanken versunken, verloren, biegt in einen schmalen Sandweg. »Hier können wir das Fahrzeug mit gutem Gewissen stehen lassen«, sagt sie, öffnet die Tür, steigt aus. Jan folgt ihrem Beispiel. Wärme empfängt ihn, die ihm gut tut. Er liebt die Hitze. Nicht genug kann er davon bekommen. Sie folgt einem Weg durch die bunten Wiesen bis zu einer Bank, die unter einer stattlichen Linde steht. »Das ist einer meiner Lieblingsplätze«, verkündet sie. »Hier ist die Landschaft besonders abwechslungsreich. Und das Flüsschen, das sich in der Aue seinen Weg sucht, kennst du vielleicht, bestimmt dem Namen nach.«
Jan zaubert ein nachdenkliches Gesicht, gesteht seine Unkenntnis ein.
»Das ist die Parthe«, offenbart sie ihm. »Du kennst doch, hoffe ich, die Namen der Flüsse dieser Region.«
Jan grinst. Dann sprudelt der Dichter aus ihm heraus: »Auf der Pleiße schwimmt ein Stück Scheiße! Das ist realistische Lyrik!«
»War vielleicht einmal in grauer Vorzeit realistische Lyrik, wie du es bezeichnest, jetzt aber sind die Flüsse wieder sauber. Es leben sogar Fische darin. Die Zeit ist endgültig vorbei, als sie als Abfluss für chemische Relikte dienten. Damals waren sie tote Flüsse, waren giftig, stanken, und die Chemie bedeckte als weißer Schaum die Wasseroberfläche. Das gehört alles zur Vergangenheit, ist Schnee von gestern.«
»Das soll die Parthe sein? Soweit ich mich erinnere, soll die Parthe auch durch den Leipziger Zoo geströmt sein.«
»Das tut sie noch immer! Noch immer fließt sie durch das Gelände des zoologischen Gartens.«
Jan will mehr über Johanna erfahren, die einst zu den Besten ihrer Klassenstufe auf der Erweiterten Oberschule gehörte. »Entschuldige bitte, dass ich eine Änderung unseres Gespräches vornehme, aber hast du nicht nach dem Abitur Russisch und andere slawische Sprachen studiert?«
»Dass du dich daran noch erinnerst?« Wieder ihr nachdenkliches Lächeln.
»Ich habe ein ausgezeichnetes Gedächtnis!«, witzelt er. »Nichts habe ich vergessen. Alles ist noch immer gegenwärtig. Noch deutlich sehe ich dich vor mir, unmittelbar nach dem Abitur zur Feierstunde. Du trägst ein schickes Kostüm. Es wird nicht preisgünstig gewesen sein. Bei diesem Zwirn! Und an dem Revers der Kostümjacke funkelte das eben verliehene Partei-Abzeichen der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands. Du warst zur Genossin avanciert! Wie einige andere aus der Klasse. Ich gehörte weiter dem Fußvolk an, unbedeutend wie ich war. Und dann sind wir uns viele Jahre später in den Kammerspielen begegnet. Damals studierte ich noch Anglistik und Slawistik. Du hattest dein Slawistik-Studium abgebrochen. Du konntest nicht als Lehrerin arbeiten wegen deiner Stimme, wie du damals sagtest. Damals warst du bereits die Chefin in einem großen Hotel, hattest ein Studium der Ökonomie oder des Hotel-und-Gaststätten-Wesens oder Beides absolviert. Damals sahst du umwerfend phantastisch aus mit deinen dunkelblauen Haaren. Sehr gewagt für damalige Zeiten. Bevor wir uns trennten, du warst in Begleitung deines Ehemannes, gabst du mir deine Visitenkarte, die dich eindeutig als die absolute Chefin dieses riesigen Hotels auswies.
»Melde dich, wenn du wieder hier bist!«, sagtest du beim Abschied.
Ich habe mich nie gemeldet.« Er hält kurz inne, dann sagt er: »Schön ist es hier, geradezu idyllisch.«
»Für mich ist es Heimat«, erwidert Johanna.
Er schweigt, verfällt ins Grübeln, gelangt zu dem Ergebnis, dass er keine Heimat hat. Für ihn ist die Heimat dort, wo er ungestört leben kann. Nur will er nicht mit ihr im Augenblick über dieses Thema reden. Statt dessen richtet er die Frage an sie: »Soweit ich mich erinnere, hast du mir damals in den Kammerspielen den Herrn Blau als deinen Ehemann vorgestellt. Bisher hast du ihn nicht erwähnt. Wo ist er abgeblieben?«
»Er ist verloren gegangen. Mir abhanden gekommen. Irgendwann in der Vergangenheit. Er ist nicht mehr da. Und ich habe keine Lust über jemanden zu sprechen, der seit vielen Jahren tot ist, zumindest für mich.«
»Dann sprechen wir nicht über den ungeliebten Toten«, sagt Jan. Und verkneift sich jede ironische Bemerkung.
»Ich habe einen Gasthof. Nicht weit von hier. Seit vielen Jahren betreibe ich ihn. Die Geschäfte gehen gut. Das Personal ist flink, freundlich, zuvorkommend. Hier in der Gegend sind wir die Anlaufstelle, die Nummer Eins, bieten Übernachtungen an.«
»Aber zu DDR-Zeiten hast du ein Riesenhotel geleitet! Hast du diese Veränderung nicht als eine Art Absturz betrachtet?«
»Die Treuhand wird dir ein Begriff sein. Was da abgewickelt wurde, ist in meinen Augen ein Verbrechen. Was da abgelaufen ist, um das zu benennen, fehlt mir die Fantasie und der Menschenverstand, auch der Wortschatz, der Wortwitz. Die Wirtschaft der ehemaligen DDR hielt die Treuhand fest im Würgegriff, erdrosselte alles wirtschaftliche Leben, auch das, was noch lebensfähig, überlebensfähig, lebenstüchtig war. So geschah es auch in der Hotel-Branche. Alle Hotels übernahmen die Wessis. Den Mitarbeiter-Stab brachten sie auch komplett mit. Unseren hervorragend ausgebildeten Leuten wurde keine Chance gegeben. Ihre Ausbildungen wurden oft nicht anerkannt. Sie wurden zurück gestuft. Ausbildungen, die die Wessis nicht kannten, existierten für sie nicht. Es war eine unruhige Zeit, gleichzeitig aber auch voller Dynamik. Ich löste die mir aufgezwungenen Probleme, indem ich trotz meines fortgeschrittenen Alters nach einem Ausweg aus dieser Krise suchte. Ich fand ihn in meinem erlernten Metier, in der Gastronomie und im Tourismus. Abseits der großen Stadt führe ich seit vielen Jahren meinen Gasthof in ländlicher Umgebung, in der von mir selbst gewählten Idylle, die ich als heile Welt empfinde, um deren Existenz ich kämpfe. In einem Zeitungsartikel wurde ich als Ikone der Gästeführer bezeichnet.« Sie lacht. »Viele Jahre war ich in der Ausbildung der Gästeführer integriert, hatte selbst Touren ins Leben gerufen, habe kontinuierlich an Weiterbildungsprogrammen teilgenommen, Ausbildungen absolviert. Niemand ist zu alt, um Neues zu erlernen. Fest entschlossen bin ich, die EU-Zertifizierung der Fremdenführer zu erwerben. Der Erwerb von Bildung hält den Geist fit, beugt dem Verkalken vor.« Wieder lacht sie, macht eine Pause, dann fährt sie mit ihren Ausführungen fort. »Unsere Gästeführer werden nur unter Vertrag genommen, wenn sie ein Zertifikat der Industrie und Handelskammer vorlegen können. Nur so können wir Garantie gewährleisten. Und Garantie schulden wir unseren Gästen. Ständig muss ein Fremdenführer sich fortbilden, weil sich ständig das Leben verändert.«
Einen flüchtigen Blick wirft Jan auf seine Uhr. Er möchte vermeiden, dass sie aus dieser Reaktion schlussfolgert, er könne sich langweilen.
Johanna lächelt. Ihr ist dieser flüchtige Blick nicht entgangen. »Es ist schon spät«, sagt sie. »Ich fahre dich zu deinem Hotel. Wenn du magst, kannst du noch einige Tage bei mir im Gasthof als mein Gast verbringen. Vielleicht gewinnst du sie wieder lieb, deine alte Heimat.«
»Ich habe keine Heimat«, antwortet Jan. »Ich fühle mich überall zu Hause. Schon als Jugendlicher war ich Kosmopolit. Diese Äußerung brachte mir Ärger ein. »Ich muss mich entscheiden, mich bekennen, wofür ich stehe. Ich kann nicht zwischen den Stühlen sitzen. Dein Angebot nehme ich an, wenn es dir ernst damit ist.«
»Abgemacht!« Sie erhebt sich von der Bank, geht in Richtung Auto. Er folgt ihr. Die Kühle der Nacht steigt aus den Wiesen empor.
Jan liegt in seinem Bett. Müde fühlt er sich und abgespannt. Immer häufiger wird ihm bewusst, dass er nicht mehr zu den Jüngsten zählt, dass die Jahre nicht spurlos an ihm vorüber gegangen sind. In Gedanken lässt er den Tag Revue passieren, erlebt alles noch einmal. Die Gegenwart weicht der Vergangenheit. Die vom Alter gezeichnete Fremdenführerin verwandelt sich in ein junges Mädchen. In der neunten Klasse der Erweiterten Oberschule sind sie sich das erste Mal begegnet. Hier gab es keine reine Jungenklasse, sondern nur gemischte Klassen. In den Klassen der Neusprachler dominierten die Mädchen, in den mathematisch naturwissenschaftlichen Klassen waren vorwiegend junge Männer anzutreffen. Johanna kannte Jan bereits vom Sehen, denn sie hatten gemeinsam die Grundschule besucht, sie die Klasse der Mädchen, er die Klasse der Jungen. Ihm war sie in der Grundschule nur deshalb aufgefallen, weil sie Mitglied des Freundschaftsrates war. Und Mitglieder des Freundschaftsrates konnten nur die leistungsstärksten, die besten Thälmann-Pioniere werden. Deshalb schlussfolgerte Jan, dass Johanna bereits in der Grundschule eine sehr gute Schülerin gewesen sein musste, vor allem auch fortschrittlich, der Zukunft zugewandt. In der Erweiterten Oberschule wurde Jan ihr Mitschüler, erlebte hautnah ihre Qualitäten als junge, dynamische Oberschülerin, die in die Leitung der FDJ-Gruppe der Klasse gewählt wurde. Ihn wollte keiner für so eine wichtige Funktion haben, weil seine schulischen Leistungen und sein gesellschaftlicher Einsatz nicht mehr so gut bewertet wurden wie an der Grundschule. Vor allem im Fach Russisch glänzte Johanna. Da war sie absolute Spitze. Jan gehörte dem Mittelfeld an. Er schaffte diese Position innerhalb der Klasse ohne sichtliche Anstrengungen. Er musste dafür nicht pauken wie andere, um positive Ergebnisse zu erzielen. Die Mutter von Johanna lernte er bei eintägigen Klassenfahrten kennen. Bei diesen Exkursionen begleitete sie die Klasse, bei mehrtägigen nicht. Johanna hatte keinen Vater. Wie so viele andere Väter war er nicht aus dem Krieg zurückgekehrt. Er war nicht vermisst, nicht verschollen, nicht irgendwo in Gefangenschaft geraten; er war gefallen. Das wussten Mutter und Tochter genau. Ob ihnen dafür eine schriftliche Bestätigung vonseiten der dafür zuständigen Behörden und Ämter vorlag, wusste Jan nicht. Er wusste es nur von anderen Jungs, dass deren Mütter einen Brief oder mehrere Briefe erhalten hatten, aus denen hervorging, dass der Ehemann im Krieg für das Vaterland den Heldentod gestorben war. Nach dem Krieg fielen diese Ankündigungen wesentlich bescheidener aus in Bezug auf die Wortwahl. Da war nur vom Tod die Rede. Da gab es auch keine Gedenktafeln mehr für die Angehörigen. In der Zeit nach dem Krieg ging es vor allem um die Höhe der Beträge der Witwenrente. So hatte Jan bereits als Grundschüler erfahren, dass die Witwenrenten in der Bundesrepublik Deutschland um ein Beträchtliches höher waren als die in der Deutschen Demokratischen Republik. Für alleinstehende Mütter war das oft der Grund, gemeinsam mit ihren Kindern über Westberlin in die Bundesrepublik Deutschland zu flüchten. Die Bundesrepublik Deutschland, kurz und präzise der Westen genannt oder der goldene Westen, nahm sie mit offenen Armen auf, so wurde unter vorgehaltener Hand gemunkelt. Viele Krieger-Witwen verließen heimlich den Osten in Richtung Westen. Jan interessierte sich nicht sonderlich für diese Problematik, da sie ihn nicht betraf.