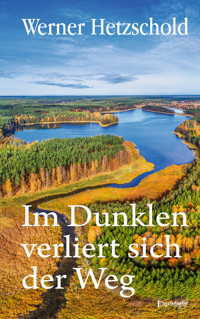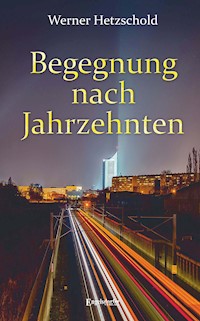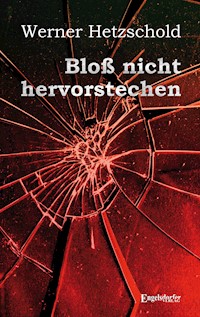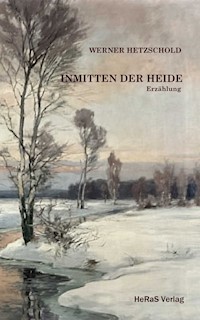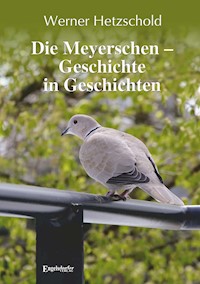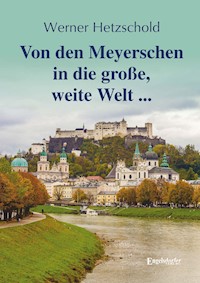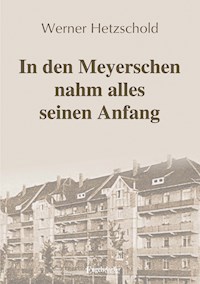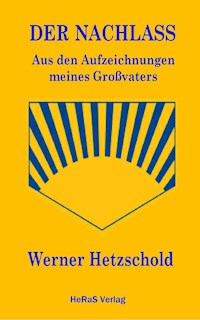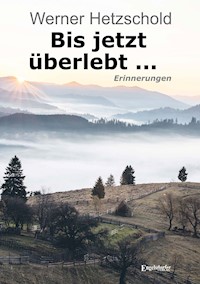
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Engelsdorfer Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Annemarie hat einen Anruf von ihrer Freundin bekommen. Seit der Mittelschule in Grabin kennen sie sich. Alexandra kam aus Dobrylugk, Annemarie aus Stoporsk. Nachdem sie beide sehr erfolgreich die neunte Klasse abgeschlossen hatten, wollten sie Unterstufenlehrerin werden, bewarben sich am Institut für Lehrerbildung in Leipzig. Sie hatten Sehnsucht nach der großen, weiten Welt, die für sie die Messestadt Leipzig repräsentierte. Eine Absage erhielten sie. Die Begründung lautete, dass die Plätze bereits vergeben seien. Ihnen wurde empfohlen, ein Studium an der „Henriette-Goldschmidt-Schule“ aufzunehmen, um sich zur Kindergärtnerin ausbilden zu lassen. Sollten sie mit diesem Vorschlag einverstanden sein, ist die Leitung des Institutes für Lehrerbildung bereit, die Schule von ihrem Entschluss in Kenntnis zu setzen und ihre Bewerbungsunterlagen dieser Bildungseinrichtung zu schicken. Alexandra und Annemarie wählten diesen Ausbildungsweg. Viele Jahrzehnte sind vergangen. Lehrerin sind sie nicht geworden. In der DDR wurden immer dringend Erzieherinnen gebraucht und Lehrerinnen. Wer einmal was war, blieb es auf Lebenszeit. Als alte Frauen erfahren sie, dass das Volkslied „Kleine weiße Friedenstaube“ eine Schöpferin hat, eine Umsiedlerin, so die offizielle Bezeichnung der Heimatvertriebenen in der DDR. „Bis jetzt überlebt ...“ erzählt die Erinnerungen sogenannter Vertriebener. Es tauchen berühmte Künstler*innen auf und bekannte Politiker*innen. Eine Zeitreise, beginnend mit der Donau-Monarchie, dem Vielvölker-Staat Österreich-Ungarn bis in die Gegenwart, vermittelt ein Bild aus scheinbar längst vergangenen Zeiten mit deren vielen Völkern, Ethnien, deren Geschichte und Traditionen und Landschaften wie die Buckowina.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 323
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Werner Hetzschold
BIS JETZT ÜBERLEBT …
Erinnerungen
Engelsdorfer Verlag
Leipzig
2023
Bibliografische Information durch die Deutsche Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.de abrufbar.
Copyright (2023) Engelsdorfer Verlag Leipzig
Alle Rechte beim Autor
Titelfoto © szaboerwin [Adobe Stock]
Hergestellt in Leipzig, Germany (EU)
www.engelsdorfer-verlag.de
Inhaltsverzeichnis
Cover
Titel
Impressum
BISJETZTÜBERLEBT …
Annemarie hat einen Anruf bekommen. Am Apparat war ihre Freundin. Seit der Mittelschule in Grabin kennen sie sich. Alexandra kam aus Dobrylugk, Annemarie aus Stoporsk. Nachdem sie beide sehr erfolgreich die neunte Klasse abgeschlossen hatten, wollten sie Unterstufenlehrerin werden, bewarben sich am Institut für Lehrerbildung in Leipzig. Sie hatten Sehnsucht nach der großen, weiten Welt, die für sie die Messestadt Leipzig repräsentierte. Eine Absage erhielten sie. Die Begründung lautete, dass die Plätze bereits vergeben seien. Ihnen wurde empfohlen, ein Studium an der „Henriette-Goldschmidt-Schule“ aufzunehmen, um sich zur Kindergärtnerin ausbilden zu lassen. Sollten sie mit diesem Vorschlag einverstanden sein, ist die Leitung des Institutes für Lehrerbildung bereit, die „Henriette-Goldschmidt-Schule“ von ihrem Entschluss in Kenntnis zu setzen und ihre Bewerbungsunterlagen dieser Bildungseinrichtung zu schicken. Alexandra und Annemarie wählten diesen Ausbildungsweg zunächst einmal. Beide waren sich darin einig, dass sie Lehrerin zu einem späteren Zeitpunkt immer noch werden könnten.
Viele Jahrzehnte sind vergangen. Lehrerin sind sie nicht geworden. In der DDR wurden immer dringend Erzieherinnen gebraucht und Lehrerinnen. Wer einmal was war, blieb es auf Lebenszeit. Nur Ausnahmen bestätigten die Regel. Annemarie und Alexandra hatten keine Beziehungen, gehörten nicht zu den Privilegierten, zu den Nomenklatur-Kadern, zu den Auserwählten. Jetzt teilt Alexandra aus Frankfurt am Main Annemarie in München telefonisch mit, dass ihr im Internet eine äußerst interessante Information begegnet sei.
„Stell dir vor“, verkündet lautstark und impulsiv wie immer die Rentnerin Alexandra der Rentnerin Annemarie, dass sie völlig unerwartet mit der Nachricht konfrontiert worden sei, dass das Lied „Kleine weiße Friedenstaube“ eine Wiedergeburt erlebt. „Stell dir vor“, lärmt Alexandra. „hier steht geschrieben, kleine weiße Friedenstaube DDR-Friedenslied erlebt Wiedergeburt.“ Du musst unbedingt deine Kiste hochfahren, musst unbedingt den Text lesen. Ungemein interessant ist er! Melde dich später, teile mir deine Eindrücke, deine Meinung mit. Ich lege jetzt auf! Bis später!“
Kurze Zeit später meldet sich Alexandra. Erregt klingt ihre Stimme: „Hast du die Nachrichten gehört?“ Noch bevor Annemarie antworten kann, überhäuft Alexandra sie mit ihren Botschaften. „Die ganze Welt muss verrückt sein! Die ganze Welt ist aus den Fugen geraten. Höchst widersprüchlich sind die Nachrichten. Gibt es überhaupt eine objektive Berichterstattung? Ich zweifle daran. Wenn ich den Nachrichten Glauben schenken soll, zweifle ich am gesunden Menschenverstand. Ich kann nicht glauben, dass solche Verbrechen in der Welt geschehen. Ich misstraue Allem …“
„Jetzt sprichst du wie mein Jan“, unterbricht Annemarie. Auch er misstraut Allem und Jedem, glaubt an keine objektive Berichterstattung. Nur auf den Standpunkt kommt es an! Betont er immer wieder! Und als nächster Satz folgt: „Und willst du nicht mein Bruder sein, so schlag´ ich dir den Schädel ein …“ Einen Augenblick hält Annemarie inne, dann fragt sie: „Was ist passiert? Worüber erregst du dich?“
„Es wird Krieg geben! Die Menschen schlagen sich die Köpfe ein. Genau das geschieht momentan! Und dabei soll der Mensch ein vernunftbegabtes Wesen sein! Für mich gibt es keine gerechten, keine ungerechten Kriege! Dass wir zwischen diesen beiden Formen zu unterscheiden haben, wurde uns auch einmal gelehrt …“ Alexandra macht eine Pause, sucht nach Worten, nach den passenden Worten, redet: „Als wir Kinder waren, hörte ich oft in der DDR die Formulierungen: >Stell dir vor, es ist Krieg und Keiner geht hin!< oder >Nie wieder soll eine Mutter ihren Sohn beweinen< …“
„Ich habe diese Sprüche nicht vergessen“, pflichtet Annemarie der Freundin bei. „Sicherlich erinnerst du dich auch noch an diese Volksweisheit >Nie wieder eine Waffe in die Hand nehmen!< oder an das hinter vorgehaltener Hand geflüsterte Sprichwort zu Stalins Tod: >Händchen falten, Köpfchen senken, fünf Minuten an Stalin denken!<„. Und es dauerte nicht lange, und die vormilitärische Ausbildung stand auf dem Lehrplan.“
„So viel Widersprüchliches haben wir erlebt! Und jetzt sind wir alt!“, seufzt Alexandra, um dann befreit lachend auszurufen: „Und das Leben geht weiter! Packen wir es an! Noch gehören wir nicht zum alten Eisen! Aber jetzt mach ich erst einmal Schluss! Und du googlest nach der „Kleinen weißen Friedenstaube“.
Annemarie überlegt nicht lange, geht in das Nebenzimmer, in dem der Computer steht, der augenblicklich nicht von ihrem Jan in Beschlag genommen wird, fährt das Gerät hoch, findet das Gesuchte, vertieft sich in den Text. Den Text der kleinen weißen Friedenstaube kann sie noch immer auswendig aufsagen. So verinnerlicht hat sie diese Strophen. Damals gehörte dieses Lied zum Stammrepertoire der im Kindergarten gesungenen Volkslieder. Nur war die Autorin ihr unbekannt. Damals war ihr gleichgültig, wer den Text verfasst hatte. Sicher war sie damals überzeugt, dass die kleine weiße Friedenstaube ein Volkslied war, so zu sagen im Volke entstanden war und gar keinen Verfasser nötig hatte. Volkslieder hatte das Volk geschaffen. Sie hatten keinen namentlich bekannten Schöpfer. Sie waren einfach da, wurden gesungen. Zum ersten Mal in ihrem Leben erfährt die Rentnerin Annemarie den Namen der Dichterin, die noch unter den Lebenden weilt, beinahe einhundert Jahre alt ist. Auf dem Foto, das Bestandteil des Artikels ist, erscheint die Schöpferin wesentlich jünger. Richtig fit sieht sie aus! Annemarie lächelt, erinnert sich an ihre Ausbildung an der Puddingschule, die es noch immer gibt. Beim vergangenen Klassentreffen in Wittenberg feierten die noch am Leben verbliebenen alten Damen diese Zeit ihrer Ausbildung, ließen ihre einstigen Lehrerinnen und Lehrer hochleben, auch die kleine weiße Friedenstaube. Der Name des Dichters blieb unerwähnt, weil ihn keiner kannte, weil nie jemand ihn hinterfragt hatte, weil es für alle ein innerhalb des Volkes entstandenes Volkslied war. Annemarie erfährt nunmehr als Rentnerin, dass die Schöpferin dieses Liedes Erika Schirmer heißt und nicht nur Lieder komponierte und dafür die Texte schrieb, sondern dass sie auch Scherenschnitte anfertigte, wahre Kunstwerke, auch Scherenschnitte von der Friedenstaube. Jetzt innerhalb des Ukraine Konfliktes wird wieder auf das in der DDR entstandene Friedenslied aufmerksam gemacht. Die Autorin hat selbst am eigenen Leibe Flucht und Vertreibung kennen und spüren gelernt. Gemeinsam mit ihrer Mutter floh sie 1945 aus Schlesien. 19 Jahre war sie alt, als Erika Erna Mertke das einstige Polnisch Nettkow, das 1920 in Schlesisch Nettkow umbenannt wurde, verlassen musste. Nichts sollte von der deutschen Bevölkerung übrigbleiben, weder deutsche Denkmäler noch deutsche Namen. Alles wurde liquidiert. Als Umsiedlerin, so die offizielle Bezeichnung der Heimatvertriebenen in der DDR, lebte sie im Eichsfeld, dann als Kindergärtnerin auf Rügen, ab 1948 in Nordhausen. In dieser Stadt ist sie bis heute verblieben. Damals konnte Erika Schirmer ihren beruflichen Traum verwirklichen. Nach erfolgreichem Lehrerstudium war sie in Nordhausen an einer Grundschule tätig, später wurde sie als Pädagogin für körperlich und geistig behinderte junge Menschen eingesetzt. Den Anstoß zu dem Text, so gesteht die Dichterin, hat ein Plakat gegeben mit einer weißen Taube, gemalt von Picasso. Annemarie kennt dieses Bild, auch die Geschichte um dieses Bild. Diese weiße Taube fliegt von rechts nach links. Es wurde behauptet von denen, die meinten es zu wissen, dass diese Friedenstaube, wie sie später genannt wurde, von Ost nach West fliegt, den Frieden, die Völkerverständigung in den Westen bringt. Als Kind, so wurde erzählt, soll der kleine Pablo wunderschöne Tauben gemalt und gezüchtet haben. Vielleicht sind das alles nur Legenden, die im spanischen Volke kursieren. Dieses Bild war der Auslöser für das Gedicht „Kleine weiße Friedenstaube“, sagt die Dichterin. Gemeinsam mit ihren Kindern hat sie es im Kindergarten gesungen. Ihre Praktikantinnen, ihre Kolleginnen, ihre Kinder haben es verbreitet, weiter gegeben, es populär gemacht. Mittels der Mundpropaganda wurde es weiter gereicht, verbreitet, wurde zum Volkslied, wurde gesungen in den Kindergärten der DDR, in den Schulen bei Fahnenappellen, während der zahlreichen Pionier-Nachmittage. Annemarie hat diese Pionier-Nachmittage noch in lebhafter Erinnerung. Wie alle aus ihrer Klasse in der Dorfschule in Stoporsk singen sie gemeinsam mit ihrer Lehrerin, Fräulein Hübsch, „Kleine weiße Friedenstaube, fliege übers Land; allen Menschen, groß und kleinen, bist du wohlbekannt. Fliege übers große Wasser, über Berg und Tal; Bringe allen Menschen Frieden, grüß sie tausendmal. Und wir wünschen für die Reise Freude und viel Glück, kleine weiße Friedenstaube, komm recht bald zurück.“ So lautete damals der Text. Später muss es noch andere Versionen gegeben haben. Irgendeine Strophe hörte sich so an „Du sollst fliegen, Friedenstaube, allen sag es hier, dass nie wieder Krieg wir wollen, Frieden wollen wir.“ Annemarie überlegt: Da gab es doch einen Text „Kleine weiße Friedenstaube“ für ein Lied, das von Marianne Rosenberg gesungen wurde. Es nannte sich nicht mehr schlicht und einfach Lied, sondern Song. Strophen, die sie damals während ihrer Kindheit in der Stoporsker Dorfschule gesungen hat, waren auch in dem Song der Marianne Rosenberg enthalten, soweit ihr der Text der Marianne Rosenberg in ihrem Gedächtnis haften geblieben ist. Viele Schlagersängerinnen in vielen Ländern hatten das ihr vertraute Lied in ihrem Repertoire. Irgendwann muss die Rosenberg sich dahingehend geäußert haben, dass sie das Lied „Kleine weiße Friedenstaube“ nicht kannte. Durch puren Zufall sei sie bei der Zusammenstellung eines Albums für Kinder auf dieses Lied von der Frau Schirmer gestoßen. Die Sängerin erkannte, dass das Lied hervorragend unsere Zeit widerspiegelt. Wie Annemarie vertritt die Sängerin die Meinung, dass es im Krieg nur Verlierer gibt. Annemarie ergänzt: Die Notleidenden sind die einfachen Menschen, nicht die Entscheidungsträger. Annemarie muss aufpassen, dass sie nicht sentimental, mitleidig, wehmütig, nicht unkritisch wird, wenn sie mit ihrer Kindheit, mit ihrer sorglosen, unbeschwerten Kindheit konfrontiert wird zwischen den Feldern und Wiesen nahe dem Wald in dem idyllisch gelegenen Stoporsk in der Niederlausitz. Die „FRÖSI“ fällt ihr ein. Das war der Name einer Zeitschrift für Kinder. Diese Zeitschrift wurde in einem eigens für Kinder geschaffenen Verlages veröffentlicht. „Fröhlich sein und singen“ war ihr voller Name. Mit dem Verschwinden der DDR verschwand auch diese Kinderzeitschrift, deren Leserin die Pionierin Annemarie war. Aus ihrem Kopf sind aber nicht die Lieder verschwunden, die zu ihrem Liedgut gehörten. Spontan fällt ihr ein „Wenn Mutti früh zur Arbeit geht“, „Es wollen Zwei auf Reisen gehn“, „Fröhlich sein und singen“, „Stolz das blaue Halstuch tragen“. Während ihrer Kindheit begegnete sie diesen Texten auch in den Schulbüchern. Sie gehörten einfach zum Bildungsgut wie die kleine weiße Taube. Wenn sie in den Schulbüchern ihrer Urenkel blättert, findet sie nirgends solche einprägsamen Texte. Gefühle spielen wohl keine Rolle mehr. Alles ist verkopft. Und jetzt während Corona fällt so viel Unterricht aus, dass der Unterrichtsstoff kaum nachzuholen ist. Diese Bildungsdefizite bleiben. Früher wurde viel geschrieben, gelesen, sogar das Fach Schönschrift gab es. Sie versteht die Welt nicht mehr. Heute kann sie alles ergooglen, früher musste sie in Büchern nachschlagen, sich alles mühsam und Zeit aufwendig erarbeiten, zusammensuchen. Die Dichterin und Pädagogin Erika Schirmer bewundert sie. Dem Internet kann sie entnehmen, dass erst im hohen Alter ihre Verdienste als Künstlerin gebührend vonseiten der Entscheidungsträger gewürdigt worden sind. Annemarie liest, dass Frau Schirmer 1996 die Auszeichnung für Vorbildliche Integration von Aussiedlern in die BRD vonseiten der Präsidentin des Deutschen Bundestages empfangen hat. 1998 wurde ihr der Kunstpreis des Landesverbandes der Vertriebenen für ihren Gedichtband „Heimat, die ich meine – Nordhausen“ verliehen. 2013 wurde sie Ehrenbürgerin der Stadt Nordhausen, 2014 Ehrenbürgerin ihrer Geburtsstadt Czerwiénsk. Annemarie ist überzeugt, dass bei der Wiedergabe des Lebenslaufes dieser Volkskünstlerin Fehler unterlaufen sein müssen. Den größten Teil ihres Lebens und Schaffens hat diese Volkskünstlerin in der Deutschen Demokratischen Republik verbracht. Eine Auszeichnung als Künstlerin, als Pädagogin hat sie offensichtlich laut Vita im Internet nie in der DDR erhalten. Nach der so genannten Wende verstummte ihr Lied, war in keinem Buch, geschweige denn in irgendeinem Schulbuch zu finden. Erlebt ihr Schaffen vielleicht jetzt eine Renaissance? Annemarie drückt ihr die Daumen, ganz fest. Verdient hat sie es! Auf jeden Fall!
Das Telefon meldet sich. Annemarie vernimmt die Stimme ihrer Freundin Alexandra. Völlig aufgelöst ist sie. Ihre Worte überschlagen sich.
„Beruhige dich erst einmal! Die Welt wird nicht gleich untergehen. Bei diesem Redefluss verstehe ich kein Wort.“ Annemarie versucht ihre Freundin zu beschwichtigen.“
Stell dir vor, ich habe eine Nachricht per Mail erhalten, die mich umhaut, die mich völlig aus dem Gleichgewicht bringt.“
„Und was ist das für eine Botschaft, die dich umhaut. Diese Reaktion von dir ist neu, zumindest für mich.“
„Lass es mich erklären!“, reißt Alexandra das Wort an sich. „Bisher habe ich zu keinem Menschen über diese meine neue Leidenschaft gesprochen. Nicht einmal dir gegenüber habe ich sie erwähnt. Streng gehütet habe ich sie. Mit keinem Menschen geteilt, nicht einmal mit dir, obwohl du meine beste Freundin bist. Keinem Menschen habe ich anvertraut, dass ich Geschichten schreibe. Diese Geschichten habe ich meinem Lehrer, meinem Dozenten des Lehrganges Kreatives Schreiben ausgehändigt, wollte sein fachmännisches Urteil hören. Er ist der Einzige, den ich in meine Pläne eingeweiht habe. Er hat mir empfohlen, sie einem Verlag zuzuschicken, der E-Books publiziert. Da wären die Kosten günstiger als bei einem Verlag, der gedruckte Bücher auf den Markt bringt. Gewöhnlich muss der Schreiber und Auftraggeber sich an den Druckkosten beteiligen und Bücher auf eigene Kosten übernehmen. Die entstehenden Druckkosten sind nicht unerheblich. Ich sagte ihm, dass ich seine Empfehlung mir durch den Kopf gehen lasse …“
„Und wie hast du dich entschieden?“ Annemarie ist hellhörig geworden. Dass ihre beste Freundin schreibt und ihr nichts davon sagt, enttäuscht sie, entfacht aber ihre Neugier.
„Im Internet habe ich einen Anbieter entdeckt, der mir zusagt aufgrund seiner Offerte.“
„Am besten, du schickst mir die Offerte und die Mail, die dir dieser Anbieter zugeschickt hat. Ich melde mich, sobald ich mir Klarheit verschafft habe. Einverstanden? Mit Ungeduld erwarte ich deine Botschaft.“ Annemarie beendet das Telefonat, speichert den ihr von Alexandra übermittelten Text, liest, langsam, Wort für Wort. Die Offerte flößt Vertrauen ein, ist übersichtlich gestaltet, verständlich, eindeutig und unmissverständlich verfasst. Jeder Leser versteht sie. Jeder begreift sie. Keine Winkelzüge gibt es, zumindest findet Annemarie keine. Jedes Wort klopft sie auf dessen Bedeutung ab. Der im Internet publizierte Text lautet: Ihr Manuskript für mich, die Vorteile einer Verlagsveröffentlichung, größere Reichweite, Marketingunterstützung, Übernahme (und Finanzierung!) von Lektorat und Korrektorat, mehr Zeit fürs eigentliche Schreiben, professionelleres Endprodukt, alle Autoren werden mit 50% an den Erlösen beteiligt!, Liebe Autoren, bei Zusendung eines Manuskripts beachten Sie meine Tipps zur richtigen Einsendung von Manuskripten – und mit Exposé geht alles besser.
Alle Hinweise, alle Tipps hat Alexandra beachtet, gewissenhaft alle Fragen beantwortet, nichts ignoriert. Der Zero-Verlag bringt nur EBooks auf den Markt. Annemarie nimmt diesen Zero-Verlag unter die Lupe, indem sie mittels Internet über diesen freundlichen, geradezu zuvorkommenden, offensichtlich uneigennützigen, neue Autoren fördernden Anbieter Auskünfte einholt. Gerade unerfahrene Autoren ermutigt die Offerte. Immer wieder begegnet Annemarie der Wortgruppe >Nur Mut!<. Alexandra ist sehr mutig gewesen, hat den Hinweis >Ihre Nachricht – Möchten Sie mir sonst noch etwas mitteilen?< freimütig und offenherzig ausführlich beantwortet. Den Fragebogen zur Vorstellung Ihres Manuskriptes hat Alexandra so exakt wie nur möglich ausgefüllt, dabei viel Persönliches preisgegeben, mehr als vielleicht gut ist. Annemarie prüft, holt alle ihr zur Verfügung gestellten Informationen, die über diesen Verlag in das Internet gestellt worden sind, mittels Internet ein. Sie erfährt, dass der Verlag ausschließlich auf digitale Medien spezialisiert ist und auf die Aufbereitung gemeinfreier Bücher. Es werden nicht nur Bücher aus öffentlichen Quellen verarbeitet, sondern lektoriert, in die neue Deutsche Rechtschreibung übertragen, kommentiert und … Annemarie findet Beiträge über den Zero-Verlag, die diesen Verlag und seinen Betreiber in einem völlig anderen Licht erscheinen lassen. Da äußert sich der Verleger zu einer Frage eines Kunden wie folgt: >Ja, Sie haben ein unverschämte Frage zu einem GESCHENKTEN Buch gestellt. Was denken Sie sich eigentlich, dass ich nichts bessere zu tun habe, als für EINE Person ein neues Cover zu gestalten und dann auch noch geschenkt? Zitat Ende.< Dabei hatte der Kunde höflich angefragt: >„Sehr geehrter Herr [edit /jh]! Ich habe das Gratisbuch des Newsletter herunter geladen jedoch lässt es sich nicht öffnen da die Datei Beschädigt ist. Andere Bücher kann ich ohne Probleme öffnen. Wie kann ich vorgehen damit ich das Buch lesen kann. Vielleicht wäre es möglich, dass Sie den Schriftzug „Gartis“ entfernen könnten. Vielen Dank für Ihre Bemühungen.< Annemarie muss aus dem im Internet geführten Schriftverkehr zur Kenntnis nehmen, dass die Gratisbücher nur Werbemittel sind. Sie wird aufgeklärt >Der Laden lebt ja vom Verkauf gemeinfreier Titel. Dagegen ist grundsätzlich nichts einzuwenden, wenn die dann eben klasse umgesetzt sind. Nur das kann ein Grund sein, Geld dafür auszugeben. Und anscheinend geht es dem Mann damit gar nicht so schlecht.< Ihre Nachforschungen begeistern Annemarie. Sie durchforstet im Internet die über diesen Verleger gemachten Angaben, ordnet sie ein in zwei Spalten: Was spricht für ihn, was gegen ihn als Mensch. Sie sammelt: >Wie hattest Du denn Deine Anfrage formuliert? Ich glaube kaum, dass jemand so (extrem) unwirsch reagiert, wenn man höflich und freundlich fragt. Dann ist die Antwort wirklich haarsträubend. Der Mann scheint Choleriker zu sein … So eine Antwort ist immer unverschämt. Der Zero-Verlag will wohl keine Kunden. Gut zu wissen. Deshalb ist er auch ein Choleriker geworden und ich bin wohl nicht der Einzige, dem es so ergangen ist. Wie gesagt, mit ihm als Mensch komme ich auch nicht klar, inzwischen kaufe ich dort aber auch nichts mehr, da er nichts mehr anbietet, was mich interessiert. Ich dachte, cholerisch sein ist eine Charaktereigenschaft, die man nicht einfach mal so entwickelt, nur weil irgendetwas nicht so ganz rund läuft. Ich denke eher im Gegenteil: Das nicht-so-ganz-rund-Laufen offenbart die sowieso schon vorhandene cholerische Ader.<
Annemarie denkt nach, fasst zusammen, kommt zu dem Ergebnis, dass das, was über ihn gesagt wird, nicht wohlwollend klingt, diesen Mann in keinem freundlichen Licht zeigt, ihn unsympathisch macht. Sie, ihre Freundin Alexandra sind nicht technisch begabt, haben keine Ahnung, nicht den leisesten Schimmer, wie ein E-Book hergestellt wird, wie ein E-Book-Verlag funktioniert. Offensichtlich ist dieser Verleger ein äußerst technisch begabter und versierter Mensch, hat schon mit seinem Verlag viele Preise gewonnen, verfügt über reiche Erfahrungen in Bezug auf die Produktion der E-Books, ist leidenschaftlich bei der Sache, produziert E-Books per Fließband-Methode. Irgendwo hat Annemarie die Wortgruppe digitale Rationalisierung gelesen. Diese von ihr nicht nachvollziehbare Technik muss es sein, die er bis zur höchsten Perfektion, zur höchsten Vervollkommnung beherrscht, die er mit Leidenschaft und höchstem Engagement betreibt. Er bescheinigt sich eine schnelle Auffassungsgabe, dass er mehrere geistig anspruchsvolle Aufgaben gleichzeitig löst, die Probleme bereits erkennt und beseitigt, bevor sie offiziell angesprochen werden. Perfektion ist das Wort, dass immer wieder auftaucht, von ihm benutzt wird für seine Selbstdarstellung. Die Maximen, die er an sich stellt, sind Schnelligkeit, Machbarkeit, Zukunftssicherheit. Annemarie liest von ihm verbreitete Floskeln wie „Ich denke und lebe online, bleibe immer am Ball.“ Alles kann er besser, stellt Annemarie sachlich fest. Diese Erkenntnis war der Auslöser, seinen eigenen Verlag zu gründen. Auf diese Weise ist er in das Verlagswesen hineingeschlittert. Und mit großem Erfolg! Und das als Quereinsteiger! So schreibt er über sich. Annemarie gelangt zu dem Ergebnis, dass die von diesem Verleger ausgewählten jungen Autoren wenigstens siebzig Jahre tot sein müssen. Sie überlegt, was der Grund dafür ist. Sie ist kein Fachmann, kennt sich nicht im Verlagswesen aus. Vielleicht wird ein über siebzig Jahre Toter von diesem Verleger deshalb bevorzugt behandelt, weil er sich nicht beschweren, sich nicht wehren kann, wenn er nicht so veröffentlicht wird, wie er es gern möchte. Bei einem lebenden Autoren, vor allem bei einer lebenden Autorin muss ein Herausgeber mit Widerstand rechnen, wenn sie mit seiner Verfahrensweise nicht einverstanden ist, ihr nicht zustimmt. Vielleicht muss der Verleger für deren Werke nichts bezahlen, weil alle diese nicht mehr unter den Lebenden weilenden Autoren jetzt von allen gedruckt werden können, die sie drucken wollen, so wie es diese Verleger als Drucker beabsichtigen. Der Gedruckte kann sich nicht wehren, weil er schon so lange nicht mehr unter den Lebenden weilt. Wenn der Verleger das Werk von Alexandra veröffentlicht, muss er eventuell Alexandra ein Honorar zahlen, es sei denn, Alexandra wird für die Veröffentlichung ihres Buches zur Kasse gebeten. Annemarie liest wie Alexandra nur Bücher, die als richtiges Buch zum Anfassen ihr vorliegen, in deren Seiten sie herumblättern kann, keine digitalen Bücher sind. Sie bekommt Kopfschmerzen, die Augen brennen, tränen, die Buchstaben verschwimmen, tanzen. Sie kann sich nicht länger konzentrieren, wenn sie lange Zeit vor dem Bildschirm ausharrt. Für sie bringt die Lektüre eines E-Books nur Nachteile. Annemarie ist überzeugt, nur gesundheitliche Schäden trägt sie davon, wenn sie statt der Buchseiten dem Bildschirm den Vorrang gibt. Deshalb Finger weg!
Annemarie wendet sich der Botschaft des Verlegers zu, die bei Alexandra Schreikrämpfe verursacht hat. Schwarz auf Weiß leuchten die Buchstaben ihr entgegen.
> Ich veröffentliche keine Spinnereien von wehleidigen, dauerbeleidigten Verschwörungstheoretikern, ungebildeten Relationisten oder Impfschwurblern, die sich für von Gott erleuchtet halten
BITTE VERSCHONEN SIE MICH ZUKÜNFTIG VON JEDER KONTAKTAUFNAHME <
Annemarie traut ihren Augen nicht. Immer wieder liest sie den Text, versucht ihn zu deuten, zu verstehen. Diese E-Mail ist eine literarische Kostbarkeit, ein literarisches Kleinod, spiegelt den Geist, den Bildungsgrad, den geistigen Horizont, das Feingefühl des Schreibers wider, ist eine Perle, ein Juwel, eine Kostbarkeit der Höflichkeit, des Anstandes, der Umgangsformen. Der Absender gibt vor, nach dem Abitur mit Erfolg ein Studium an einer deutschen Universität erworben zu haben, über zahlreiche Qualifikationen zu verfügen. Als Quereinsteiger wurde er zum führenden Verleger der E-Book-Branche gekürt. Alle, die sich über diesen Mann im Internet geäußert haben, bescheinigen ihm Arroganz, Unhöflichkeit, Überheblichkeit. Dieser Verleger, der zweifellos auf seinem Gebiet ein absolutes Spitzenprodukt sein mag, verfügt über eine äußerst mangelhafte Kenntnis in Bezug auf den Schriftverkehr. Weder Anrede noch Grußformel gibt es. Der Text strotzt vor sprachlichen Unikaten, die Annemarie fremd sind. Der von ihm gewählte Stil wirkt auf die alte Frau grotesk, absurd, abstoßend, verletzend, widerwärtig, eines gebildeten Menschen unwürdig. Für Annemarie ist dieser Verleger Abschaum der Menschheit. Sie hält inne. Ausgangspunkt war das Volkslied „Kleine weiße Friedenstaube“. Ihre Gedanken wandern zurück in die Vergangenheit, in die Zeit, in der sie eine junge, lebensfrohe Kindergärtnerin war. Sie sieht das Bild vor sich, das damals in ihrem Gruppenraum hing. Es hieß >Besuch zum 1. März<. Auf diesem Bild waren zwei Bilder zu sehen. Auf dem linken Bild prangte eine farbenfrohe Matrjoschka, auf dem rechten ein Junger Pionier mit rotem Halstuch, offensichtlich ein sowjetischer Pionier. Der Spruch ist ihr noch immer geläufig: „Von der Sowjetunion lernen heißt siegen lernen.“ Dieses Bild entdeckte sie im Internet. Sie zaubert es auf den Bildschirm. Der Text lautet: >Besuch zum 1. März. Heute warten wir auf Helgas großen Bruder. Er ist Soldat der Volksarmee. Er und seine Kameraden sorgen dafür, dass wir alle im Frieden leben können. Wir wollen unseren Gast mit einem Lied erfreuen. Alle Schüler kennen es gut. Es heißt „Kleine weiße Friedenstaube“.< Der erste März war der Tag der Nationalen Volksarmee, war ein Ehrentag, ein Gedenktag in der DDR. In Betrieben, Schulen, Kindergärten wurde der Tag feierlich begangen mit Fahnenappellen, mit der Verleihung von Auszeichnungen. Ob damals in der DDR Erika Schirmer einen Preis, eine Auszeichnung für die „Kleine weiße Taube“ bekommen hat? Annemarie geht der Gedanke nicht aus dem Sinn, dass diese Volkskünstlerin erst nach der Wiedervereinigung Auszeichnungen erhielt. Wie sie jetzt dem Lebenslauf im Internet entnehmen kann, empfing sie in der ehemaligen DDR keine Anerkennung. Annemarie weiß, alles ist möglich. Warum auch nicht das, diese späte Ehrung? Vorstellen kann sie es sich nicht! Frau Schirmer musste sich nicht um die Veröffentlichung ihres Textes kümmern. Mundpropaganda reichte aus. Im Zusammenhang mit diesem E-Book-Verleger begegnet ihr im Internet eine neue, unbekannte Autorin, die sich wie ihre Freundin gern gedruckt sehen möchte. Sicher gibt es Frauen ohne Ende, die wie Alexandra das langersehnte Ziel haben, es unermüdlich verfolgen, Schriftstellerin zu werden, zu sein. Nicht ohne Anteilnahme vertieft sich Annemarie in den Text, der um die Publikation eines Buches kreist. Die Autorin schreibt, dass sie die Erfahrung gemacht hat, wenn sie sich gedruckt sehen möchte, eine vom Verlag vorgegebene Anzahl von potentiellen Käufern garantieren muss, die das Buch vorbestellen. Die Autorin fragt nach, ob diese Vorgehensweise jetzt generell üblich ist. Sie räumt ein, dass ihr bekannt ist, dass Kleinverlage, die die Bezeichnung Druckkostenzuschuss-Verlag wie der Teufel das Weihwasser fürchten, vom Autor einen finanziellen Beitrag einfordern, um dessen Werk vermarkten zu können, da er noch unbekannt sei, sich erst einen Namen erarbeiten muss. Die Autorin gesteht, dass sie ein komisches, ein mulmiges Gefühl hat, wenn sie sich vorstellt, dass sie für ihr Werk die Werbetrommel rühren soll und obendrein noch dafür zur Kasse gebeten wird. Sie habe bereits von anderen Autorinnen gehört, die sich auf so einen Deal eingelassen haben, dass der von ihnen zu entrichtende Betrag zwecks Werbung beträchtlich höher ausfiel als der Druckkostenzuschuss in einem Druckkostenzuschuss-Verlag oder bei einem Dienstleister, wie sich Kleinstverlage manchmal nennen, die als Druckkostenzuschuss-Verlag nicht in Verruf gelangen möchten. Bekannte, Freunde, Mitstreiter, angehende Schriftstellerinnen setzten alle Hebel in Bewegung, um genügend Vorbestellungen aufbieten zu können, kauften auf eigene Kosten eine Leserschaft. Annemarie kann sich nur schwer vorstellen, dass sich Alexandra auf so ein dubioses Geschäft einlässt. Wie belastend, wie fragwürdig es ist, den geeigneten Verlag zu finden, hat ja Alexandra bei diesem zweifelhaften E-Book-Verlag Zero erlebt. Mit einer freundlichen, Vertrauen einflößenden Offerte wird die Debütantin angelockt, umgarnt, um dann madig gemacht zu werden. Dieser Verleger muss ein Psychopath sein, eine andere Erklärung gibt es für Annemarie nicht. Wie soll sie sich Alexandra gegenüber verhalten? Nimmt sie jetzt Kontakt mit ihr auf ohne jegliche Vorwarnung, flippt die Freundin aus. Sie wird sie laufend unterbrechen, Annemarie konfus machen. Es ist deshalb besser, sie auf ein Gespräch vorzubereiten. Annemarie entschließt sich für die schriftliche Einstimmung, sucht nach den passenden Worten: „Hallo Alexandra, ich bin der festen Ansicht, dass du zu den wenigen Auserwählten gehörst, die eine Rückmeldung von diesem sensiblen, genialen E-Book-Verleger bekommen hat. Im Internet tauschten sich einige E-Book-Fans über die Gepflogenheiten dieses Mannes aus, die seine Bücher heruntergeladen hatten und sich zwecks diverser Auskünfte an ihn gewandt hatten. Wenn auf ihre Fragen überhaupt eine Reaktion erfolgte, dann fiel die Antwort qualitativ so aus wie in deinem Falle. Der Mann muss im wahren Leben ein echter Kotzbrocken sein. Seine Frau ist zu bewundern, dass sie dieses vor Eitelkeit strotzende Ekel erträgt, seine Launen, seinen Frust. Dieser ominöse Schriftsatz soll dich zukünftig von jeder Kontaktaufnahme mit diesem arroganten Fachidioten verschonen, die da lautet:
> Ich veröffentliche keine Spinnereien von wehleidigen, dauerbeleidigten Verschwörungstheoretikern, ungebildeten Relationisten oder Impfschwurblern, die sich für von Gott erleuchtet halten
BITTE VERSCHONEN SIE MICH ZUKÜNFTIG VON JEDER KONTAKTAUFNAHME <
Irgendwo, irgendwann habe ich diese weisen Worte gelesen: >Für jede Barriere gibt es im Zeitalter der digitalen Kommunikation eine Methode, sie zu überwinden.< Du überwindest diese Barriere, indem du seine digitale Kommunikation mittels des E-Books ignorierst. Schwer wird es dir nicht fallen, da wir auf Papier gedruckte Bücher bevorzugen, lesen. Diesen Text werde ich schicken. Das Weitere werden wir mündlich besprechen.
Per E-Mail schickt Annemarie den Text Alexandra zu, fährt das Gerät nicht herunter, wartet ab. Es ist möglich, dass sich Alexandra umgehend meldet, in der Verfassung, in der sie sich momentan befindet. Der Text dieses arroganten Fachidioten hat sie ganz schön mitgenommen, nach unten gerissen, sie zerschmettert, am Boden zerstört, sie an ihrem Talent zweifeln lassen. Annemarie kann sich ein Leben ohne Computer, ohne Internet nicht mehr vorstellen. Sie ist von der digitalen Technik abhängig, benötigt sie wie die Luft zum Atmen. Nur kann sie sich nicht vorstellen, dass gedruckte Bücher passé sein sollen. Sie liebt das gedruckte Buch, sie liebt es die Buchseiten zu berühren, ihren Duft einzuatmen, in den Seiten zu blättern. Ein Buch aufzuschlagen, zu öffnen, bereitet ihr unendlichen Genuss. Auf ein Buch möchte sie nicht verzichten. Es gehört zu ihrem Leben, ist Bestandteil ihres Lebens. Trotzdem signalisiert ihr Verstand, dass es sicher wie das Amen in der Kirche, eine Zeit geben wird, in der gedruckte Texte nur auf dem Bildschirm angeboten werden. Schlagartig hat sich in den letzten Jahren die Gestaltung von Texten verändert. Viele einst angesehene Berufe werden nicht mehr gebraucht, sterben aus. Was nicht mehr benötigt wird, geht unter, verschwindet von der Bildfläche. Die Vorstellung, dass es nur noch Bücher geben wird, die ihre Existenz der Digitalisierung verdanken, erzeugt in ihr ein Gefühl der Trauer, der Wehmut, des Schmerzes. Ihre Gefühle spielen im Welt-Geschehen keine Rolle, werden ignoriert, nicht zur Kenntnis genommen, weil sie nicht bemerkt werden. Sie kann sie sich ersparen, erspart sich dadurch Kummer und Leid. Ihre Gedanken kehren zurück zur kleinen weißen Friedenstaube, zu ihrem Schöpfer. Mittels Internet informiert sich Annemarie über Picasso, will ihr Kenntnisse auffrischen, ergänzen, erweitern, auf den neuesten Stand bringen. Sie erfährt, dass sein Gesamtwerk Grafiken, Gemälde, Zeichnungen, aber auch Plastiken und Keramiken umfasst, deren Gesamtzahl mit über 50.000 Kunstwerken angegeben wird. Er war Bildhauer, Grafiker, Maler. Ein langes, abwechslungsreiches, abenteuerliches Leben war ihm vergönnt. 1881 erblickte er in Málaga im Sonnen verwöhnten Spanien das Licht der Welt. 1973 verstarb er im südfranzösischen Mougins, einer Kleinstadt mit künstlerischem Flair und mediterranem Ambiente und südländischen Charme, das auf einem Felsplateau etwa neun Kilometer nördlich von Cannes entfernt in eine malerische Landschaft eingebettet ist. Bis Nizza, das Annemarie als Touristin erlebt hat und von dessen Attraktivität sie begeistert war, muss sie 30 Kilometer zurücklegen. Sie erinnert sich, dass Picasso eine Fülle von Vornamen hatte. Im Internet werden sie akribisch aufgezählt. Picassos voller Name lautete Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Ruiz y Picasso. Ihr fällt die Anekdote ein, als ein Spanier mit einem ähnlich langen und klangvollen Namen abends spät vor einer Herberge eine Unterkunft sucht und auf Geheiß des Wirtes seinen Namen nennt, dieser sagt: „Es tut mir unendlich Leid, meine Herren, aber so viel Raum für so viele Gäste habe ich nicht.“ Annemarie hat nicht vergessen, dass Picasso in ihrer Jugend ein Künstler war ohne Fehl und Tadel. Überall wurde er in den höchsten Tönen gelobt, verehrt, vergöttert, angehimmelt. Sie sieht ihre Eltern vor sich. Sie schüttelten nur den Kopf, jeder aus einem anderen Grunde. Die Mutter sagte: „Ich kann es nicht begreifen, nicht fassen, nicht für möglich halten, dass alle Welt diesen alten, kahlköpfigen, zerknitterten Greis wie einen Gott anhimmelt. Könnte er singen wie mein Joseph Schmidt oder mein Richard Tauber, könnte ich dieses Verhalten nachvollziehen. Oder hätte er göttliche Musik komponiert wie mein Guiseppe Verdi oder mein Puccini, dann hätte diese Anbetung ihre Berechtigung. Aber dieser Picasso malt Bilder, von denen die meisten gar keine richtigen Bilder sind, so wie ich sie kenne, zum Beispiel die von Dürer. Dieser Picasso malt Bilder, die in meinen Augen geradezu hässlich, abstoßend, widerwärtig sind. Und dann wird mir gesagt, von den so genannten Experten, die es eigentlich wissen müssten, das sei echte Kunst. Ich mag diese Kunst nicht. Eine Ausnahme ist die kleine weiße Friedenstaube. Das ist ein hübsches Bild, beweist, dass dieser Picasso auch richtig malen kann wie andere Künstler auch. Wie zum Beispiel mein Ludwig Richter. Er malt Bilder, die Menschen wie ich verstehe, ohne jegliche Erklärung von irgendwelchen Experten oder anderen Leuten, die vorgeben, Experten, Kunstkenner zu sein. Dann habe ich irgendwo gelesen, dass dieser alte Knabe mit ganz jungen Frauen Kinder haben soll. Mit diesen jungen Frauen, außer mit seiner richtigen Frau, ist er nicht einmal verheiratet. Ich kann mir nicht vorstellen, was diese jungen Frauen an diesem hässlichen alten Mann finden.“
Der Vater beneidete Picasso, weil er solches Glück, solche Chancen bei jungen Frauen hatte. Der Vater sagte: „Es soll sogar junge, ganz junge und hübsche, sogar schöne Frauen gegeben haben, die sich das Leben genommen haben, nur weil sie diesen alten Mann nicht bekommen konnten. Freiwillig begehen sie Selbstmord, nur weil sie diesen alten Zausel nicht allein für sich haben können. Eine russische Briefmarke, jetzt sagt man aber nicht mehr russisch, sondern sowjetisch, habe ich gesehen, auf der dieser Picasso mit seiner Friedenstaube abgebildet ist. Sogar die Russen verehren ihn, bringen eine Briefmarke heraus.“
Annemarie weiß, Picasso war in ihrer Jugend ein Künstler von absoluter positiver Ausstrahlung. Keine Kritik an ihm war zugelassen. In den Massenmedien war er der vor Reinheit leuchtende Superheld. Diese Inkarnation hat sich bis auf den heutigen Tag erhalten. In Museen dieser Welt dominiert er als der prominente Künstler des 20. Jahrhunderts. Im Internet konnte sie lesen, dass Picasso 1962 mit dem Internationalen Lenin-Friedenspreis ausgezeichnet worden ist. Unter den momentanen politischen Ansichten und Glaubensbekenntnissen vieler aktueller Entscheidungsträger auf allen Ebenen der Hierarchie des Staatsapparates müsste er sich heute für sein Verhalten öffentlich rechtfertigen, weil er den Preis akzeptiert hat. Heute ist Lenin wie Picasso wie Karl Marx keine Vorzeige-Person mehr ohne Wenn und Aber, heute werden sie von ihrem Sockel gestoßen, werden wie Kriminelle behandelt, ihre Fehler werden in den Fokus gerückt wie einst ihre Tugenden, ihre Unfehlbarkeit, ihre göttliche Grandiosität. Jetzt hat es auch Picasso erwischt! Vor einigen Tagen konnte sich Annemarie davon überzeugen, als sie im Internet einen Artikel über diesen Künstler zu lesen bekam. In diesem Artikel kamen vor allem Frauen zu Wort, die ihm sexuelles Fehlverhalten vorwarfen, ihn als besitzergreifend schilderten, ihr Verhältnis zu ihm beschrieben. Da tauchte der Name Fernande Olivier auf. Sie soll seine erste Muse und Lebenspartnerin von 1905 bis 1912 gewesen sein. Versonnen lächelt Annemarie. Mehr als einhundert Jahre liegt diese Liaison nun zurück, bot Anlass für viele Bilder und Bücher. Im Internet erkundigt sich Annemarie über diese Frau. Mit 24 Jahren begann ihre sexuelle Beziehung zu Picasso. Zu diesem Zeitpunkt hatte Fernande Olivier entsprechend Annemaries Einschätzung bereits eine abwechslungsreiches Leben hinter sich. Mit siebzehn Jahren gebar sie einen Sohn, heiratete nach fünf Monaten den Vater ihres Kindes. Nachdem der Vater mit dem Sohn spurlos untergetaucht war, ging sie eine Ehe mit einem Bildhauer ein, lernte durch ihn das Pariser Künstlerleben kennen. Sie verdingte sich als Modell, nannte sich fortan Fernande Olivier. In ihrem Metier als Modell lernte sie Picasso kennen, wurde seine Geliebte. Nach der Trennung von Picasso 1912 verdiente sie ihren Lebensunterhalt als Modell, später als Lehrerin. 1933 publizierte sie ihre Erinnerungen über die gemeinsam verbrachte Zeit mit Picasso. Der zweite Teil wurde nach ihrem Tode veröffentlicht.
Intensiv beschäftigt sich Annemarie mit dem Lebenslauf des Künstlers. Sein langes Leben lang wurde er von einer Frau verwöhnt, mitunter sogar von mehreren gleichzeitig. In der Regel waren diese Frauen erheblich jünger als er. Sie hätten seine Töchter sein können, sogar seine Enkelinnen. Annemarie liest die Überschrift: Picassos Witwe Jacqueline nimmt sich das Leben. Am 15. Oktober 1986 schied diese Frau freiwillig aus dem Leben. Mehr als vierzig Jahre war sie jünger als er. Die letzten zwanzig Jahre bis zu seinem Tode hatte sie als seine zweite Ehefrau mit ihm das Leben verbracht, sich ihm, seinen Launen und Extravaganzen untergeordnet, ihr Dasein ihm geweiht. Dreizehn Jahre nach seinem Tod, von ständigen Depressionen gequält, begeht sie Selbstmord. Der über siebzig-jährige Picasso lernt Jacqueline Roque kennen, als ihn gerade seine Geliebte und die Mutter zwei seiner Kinder verlassen hat. Diese Situation stürzt ihn in ein tiefes schwarzes Loch. Zum ersten Mal in seinem Leben verlässt ihn eine Frau. Diese Erfahrung war ihm bisher erspart geblieben. Jacqueline verleiht ihm neue Kreativität, bestärkt ihn selbstlos und aufopferungsvoll in seinem alles verschlingenden Charisma, in seinem alles und jeden verschlingenden Absolutismus. Über Marie Françoise Gilot teilt das Internet Annemarie mit, dass sie eine französische Malerin, Grafikerin und eine an Erfolgen gewöhnte Schriftstellerin war. Berühmtheit erlangte sie mit ihrer Autobiografie unter dem Titel „Leben mit Picasso“. Ihr künstlerisches Talent hatte sie von ihrer Mutter geerbt, die eine äußerst begabte Malerin war. Ihr Vater sorgte als talentierter und erfolgreicher Geschäftsmann für das Wohl der Familie, hatte eine juristische Karriere für seine Tochter vorgesehen, soll sich ihr gegenüber autoritär verhalten haben. Sie wählte die Kunst, verwirklichte sich als Malerin. Während der deutschen Besatzung organisierte sie 1943 als 21-Jährige ihre erste Ausstellung, die ein voller Erfolg wurde. Bei dieser Gelegenheit begegnete sie dem vierzig Jahre älteren Pablo Picasso, der sich gerade von seiner ersten Ehefrau Olga Stepanowna Chochlowa getrennt hatte. Marie Françoise Gilot´s zu Liebe beendete er sein Verhältnis zu der attraktiven Dora Maar, einer französischen Fotografin und Malerin, die die Muse und gleichzeitig das Modell von Picasso gewesen war. Françoise Gilot kehrte mit ihren beiden Kindern aus Südfrankreich nach Paris zurück. Ein Journalist ermutigte sie über ihr Leben mit Picasso zu schreiben. Picasso setzte alle Hebel in Bewegung, um die Veröffentlichung des Buches zu verhindern. Er boykottierte ihre künstlerische Laufbahn, indem er allen Pariser Galerien verbot ihre Bilder auszustellen. Er drohte diesen Institutionen an, dass sie bei Nicht-Einhaltung dieser Weisung nie wieder ein Bild von ihm erhalten sollten. Jeder Kontakt zwischen ihnen brach ab.
Picassos erste Ehefrau Olga Stepanowna Chochlowa war eine russische Ballett-Tänzerin. Sie nahm seinen bürgerlichen Namen Ruiz an. Laut Standesamt nannte sie sich Olga Ruiz Picasso. Über diese erste Ehefrau holt Annemarie Auskünfte per Internet ein. Aus finanziellen Gründen, so heißt es im Internet, lehnte Pablo Picasso eine Scheidung von Olga Koklowa ab. Als Picasso Jacqueline Roque heiratet, ist seine erste Ehefrau bereits fünf Jahre tot. Olga Chochlowa stammte aus einer russisch-ukrainischen Familie. Im Internet werden Annemarie folgende Schreibweisen angeboten: Olga Khokhlova Olga Stepanowna Chochlowa (russisch Óльга Степановна Хохло́ва, … ALTERNATIVNAMEN, Khokhlowa, Olga; Chochlowa, Olga Stepanowna; Koklowa, Olga. Sie wurde in Neschin am 17. Juni 1891 geboren und verstarb am 11. Februar 1955 in Cannes in Frankreich. Von 1909 bis 1917 gehörte sie dem Ensemble Ballets Russes an, das viele Gastspiele in Europa gab. So begegnete sie 1917 dem jungen Pablo Picasso in Rom. 1918 schlossen sie den Bund fürs Leben. Olga ebnete Picasso den Weg in die gehobene Gesellschaft. 1935 trennte sich Olga von Picasso nach dessen Affaire mit einem seiner Modelle, reiste mit dem gemeinsamen Sohn Paolo nach Südfrankreich. Über Neschin entdeckt Annemarie im Internet folgende Schreibweisen: Nischyn (ukrainisch Ніжин; russisch Нежин Neschin, polnisch Nieżyn) ist eine Stadt in der Oblast Tschernihiw in der Ukraine und Zentrum des gleichnamigen Rajons Nischyn. Gogol lehrte an der Universität in Nischyn. Über ihn findet sie folgende Angaben: Nikolai Wassiljewitsch Gogol war ein russischer Schriftsteller ukrainischer Herkunft. Er ist einer der wichtigsten Vertreter der russischen Literatur. Annemarie unterbricht ihre Suche nach weiteren Informationen, denkt nach. Sie kommt zu dem Ergebnis, dass geschichtlich betrachtet vor gar nicht langer Zeit keine qualitative Wertung zwischen ukrainisch und russisch vorgenommen wurde. Sie hat nicht vergessen, dass in ihrer Jugend die vielen heute souveränen Staaten alle zur Sowjetunion gehörten, vor allem die hauptsächlich von Slawen bewohnten Gebiete wie Weißrussland und die Ukraine. Keiner schien so richtig zu wissen, wie viele Völker, Volksgruppen in der Sowjetunion lebten. Es war ein Vielvölkerstaat. Der Begriff