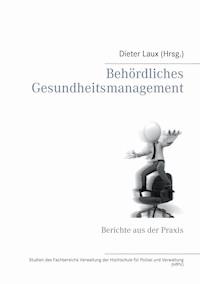
Behördliches Gesundheitsmanagement E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Studierenden des Masterstudiengangs Public Management an der Hochschule für Polizei und Verwaltung (HfPV) haben sich im Rahmen des Moduls "Personalressourcenmanagement" mit der Thematik Behördliches Gesundheitsmanagement beschäftigt und praktische Fälle in öffentlichen Verwaltungen betrachtet. Die in diesem Buch betrachteten Organisationen werden anonymisiert dargestellt. Sie stehen stellvertretend für eine Vielzahl ähnlicher Organisationen, die sich im Bereich des Behördlichen Gesundheitsmanagements engagieren. Das Aufzeigen von positiven und negativen Aspekten ihrer Arbeit soll sie in Summe unterstützen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 149
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Herausgeber:
Dr. Dieter Laux ist Lehrbeauftragter für Betriebswirtschaftslehre im Fachbereich Verwaltung der Hochschule für Polizei und Verwaltung (HfPV) in Wiesbaden. Im Hauptamt verantwortet er das strategische Bildungsmanagement der Polizeiakademie Hessen.
In Seminaren zu Personalmanagement versucht er gemeinsam mit Masterstudenten zu ergründen, wie der öffentliche Dienst durch neue Sichtweisen sein Personalmanagement optimieren könnte.
Die Autorinnen und Autoren:
Bei den Autorinnen und Autoren handelt es sich um Praktiker der öffentlichen Verwaltung. Sie sind Studenten (PM Wie010) des Studiengangs Master of Public Management (MPM) und haben die Thematik „Gesundheitsmanagement im öffentlichen Dienst“ im Rahmen des Moduls „Personalressourcenmanagement“ aus wissenschaftlicher Sicht betrachtet.
Abbildung auf dem Cover: Presenter Media (http://www.presenterMedia.com) mit ID 97783.
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Vorwort
Behördliches Gesundheitsmanagement als ganzheitliche Aufgabe einer Landesverwaltung
Betriebliches Gesundheitsmanagement einer Großstadt
Grenzen der Telearbeit in der Finanzverwaltung durch Datenschutz und Steuergeheimnis
Können horizontale Belohnungsstrategien einen Beitrag zur Personalbindung leisten?
Analyse des Age-Managementkonzepts zur Erhaltung der Arbeitsfähigkeit älterer Mitarbeiter einer Stadt
Erfolgsfaktoren für die Wirksamkeitskontrolle im Rahmen einer Gefährdungsanalyse nach dem Arbeitsschutzgesetz
Chancen und Grenzen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements für die Generation X
Bewertung der Umsetzung des Betrieblichen Eingliederungsmanagement
Abkürzungsverzeichnis
AO
Abgabeordnung
ArbSchG
Arbeitsschutzgesetz
BAuA
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
BDSG
Bundesdatenschutzgesetz
BGM
Behördliches Gesundheitsmanagement
BEM
Betriebliches Eingliederungsmanagement
BKK
Betriebskrankenkassen
BVerfG
Bundesverfassungsgericht
DAK
Deutsche Angestelltenkrankenkasse
DGUV
Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung
DIN
Deutsche Industrienorm
DV
Dienstvereinbarung
EN
Europäische Norm
GBU
Gefährdungsbeurteilung
GDA
Gemeinsame Deutsche Arbeitsschutzstrategie
GG
Grundgesetz
IAG
Institut für Arbeit und Gesundheit der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung
ICD
Internationale statistische Klassifikation von Krankheiten
ISO
International Organization for Standardization
KGSt
Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement
LASI
Länderausschuss zu Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz
NZA
Neue Zeitschrift für Arbeits- und Sozialrecht
SBG
Sozialgesetzbuch
TK
Techniker Krankenkasse
TVöD
Tarifvertrag für Beschäftigte des öffentlichen Dienstes
TVSuE
Tarifvertrag für Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes
VBG
Verwaltungs-Berufsgenossenschaft
WHO
World Health Organisation
Vorwort
Die Studierenden des Masterstudiengangs Public Management an der Hochschule für Polizei und Verwaltung haben sich im Rahmen des Moduls „Personalressourcenmanagement“ mit der Thematik Behördliches Gesundheitsmanagement beschäftigt und praktische Fälle dazu betrachtet.
Im Kapitel „
Behördliches Gesundheitsmanagement als ganzheitliche Aufgabe einer Landesverwaltung
“ wird dargestellt, wie eine Landesorganisation die Thematik aufgenommen und in einzelne Teilbereiche gegliedert hat. In Summe handelt es sich um eine gesamtheitliche Betrachtung, die zentral von einer dafür eingerichteten Organisation gesteuert wird.
Im Kapitel „
Behördliches Gesundheitsmanagement einer Großstadt
“ wird dem Ansatz nachgegangen, dem eine Großstadt bereits seit zehn Jahren folgt. Dabei wird auch kritisch zur Wirksamkeit der Maßnahmen Stellung bezogen.
Im Kapitel „
Grenzen der Telearbeit in der Finanzverwaltung durch Datenschutz und Steuergeheimnis
“ wird dargestellt, auf welche Problemstellungen Rücksicht zu nehmen ist, wenn dem Gedanken der Telearbeit gefolgt wird.
Im Kapitel „
Können horizontale Belohnungsstrategien einen Beitrag zur Personalbindung leisten
“ wird dargestellt, welche Möglichkeiten und Grenzen in Belohnungsstrategien liegen können und inwieweit dies Auswirkungen auf ein Behördliches Gesundheitsmanagement haben kann.
Im Kapitel „
Analyse des Age-Managementkonzepts zur Erhaltung der Arbeitsfähigkeit älterer Mitarbeiter einer Stadt
“ wird dargestellt, wie eine Stadtverwaltung mit der Themenstellung des Demografischen Wandels umgeht und inwieweit sich eine Konzeption für älteres Personal finden lässt.
Im Kapitel „
Erfolgsfaktoren für die Wirksamkeitskontrolle im Rahmen einer Gefährdungsanalyse nach dem Arbeitsschutzgesetz
“ wird dargestellt, wie sich der Arbeitsschutz am Beispiel einer kommunalen Kindertagesstätte umsetzen lässt und inwieweit dies in diesem Fall gelungen erscheint.
Im Kapitel „
Chancen und Grenzen des betrieblichen Gesundheitsmanagement für die Generation X
“ wird betrachtet, inwieweit den Vorstellungen und auch Vorurteilen gegenüber der sogenannten Generation X in Bezug auf das Betriebliche Gesundheitsmanagement gefolgt werden kann.
Im Kapitel „
Bewertung der Umsetzung des Betrieblichen Eingliederungsmanagements
“ wird dargestellt, wie die Umsetzung des Betrieblichen Eingliederungsmanagements in einer Großstadt erfolgt ist und welche Ansätze die Großstadt verfolgt hat.
Die in diesem Buch betrachteten Organisationen werden anonymisiert dargestellt. Sie stehen stellvertretend für eine Vielzahl ähnlicher Organisationen, die sich im Bereich des Behördlichen Gesundheitsmanagement engagieren. Das Aufzeigen von positiven und negativen Aspekten ihrer Arbeit soll sie in Summe unterstützen. Es wurde deshalb darauf verzichtet, die Organisationen namentlich zu nennen.
Bei den hier veröffentlichten Artikeln handelt es sich um Hausarbeiten der Studierenden, die mit Quellen versehen sind. Soweit es der Anonymisierung dient, werden diese Quellen hier nicht genannt, um keinen Rückschluss auf die betrachteten Organisationen zu ermöglichen. Sie können aber bei Bedarf vorgelegt werden.
Ich danke den Autorinnen und Autoren für ihre engagierte Mitarbeit im Modul und der Bereitschaft, das Ergebnis einem größeren Leserkreis zur Verfügung zu stellen.
Wiesbaden, im April 2017
Dr. Dieter Laux
Berichte aus der Praxis
Behördliches Gesundheitsmanagement als ganzheitliche Aufgabe einer Landesverwaltung
Dieter Laux1
1. Einleitung
Die betrachtete Landesorganisation ist Teil einer bundesdeutschen Landesverwaltung. Sie ist mit schwierigen Themen im sozialen Umgang der Gesellschaft betraut und sieht sich deshalb oftmals Anfeindungen gegenüber. Zwar ist das eingesetzte Personal für seine Aufgabenstellung besonders geschult2, aber die psychische Belastung und damit einhergehend die Belastung der Gesundheit des Personals sind spezifisch zu betrachten.
Unabhängig von klassischen Definitionen zu Gesundheitsmanagement definiert die Landesorganisation ihr Behördliches Gesundheitsmanagement als eine Summe von Einzelmaßnahmen, die zum Wohlbefinden am Arbeitsplatz führt.
Dazu gehören:
Bewegung, Ernährung und Entspannung
Arbeitsorganisation und Arbeitsbedingungen
Gemeinsame Werte, Normen und Regeln
Wertschätzung, Beteiligung, Information und Transparenz
Persönliche Gesundheit und eigene Kompetenzen
Im Folgenden wird dargestellt, wie sich die Landesorganisation in einem Gesamtpaket dieser Aufgabe widmet3. Dabei sind nicht alle Maßnahmen dargestellt. Sie aufzuzählen würde möglicherweise thematisch ein eigenes Buch füllen. Zumindest soll dargestellt werden, mit welchem Ansatz die betrachtete Landesorganisation an die Thematik herangeht.
2. Gesundheit im Dienst
Die betrachtete Landesorganisation ist sich der besonderen Herausforderung für ihr Personal bewusst. Es befindet sich weitgehend in einem Wechselschichtdienst und ist mit besonderen psychischen Herausforderung4 in ihrem Arbeitsalltag konfrontiert. Das dort eingesetzte Personal hat sich dem bewusst gestellt und ist dafür rekrutiert worden.
Dennoch sieht es die Landesorganisation als elementar an, für die Gesundheit ihres Personals am Arbeitsplatz zu sorgen, zumal auch die Beschäftigten zu betrachten sind, die nicht unmittelbar mit allen Belastungen konfrontiert sind und trotzdem eine spezifische Arbeitsplatzbelastung zu bewältigen haben.
Ziel ist es, Möglichkeiten zur Förderung der Gesundheit zur Verfügung zu stellen, um das Personal möglichst lange für ihren Teil der täglichen Arbeit fit zu halten.
2.1 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
Die Landesorganisation hat sich dazu entschlossen, eine zentrale Stelle einzurichten und diese zu einer zentralen Fach- und Servicedienststelle zur Beratung und Unterstützung der obersten Leitungsebene sowie der Behörden in den Themenfeldern des Arbeitsschutzes zu entwickeln. Dazu wurde bei der bestehenden Zentralstelle für das Gesundheitsmanagement eine Stelle mit entsprechender Fachkompetenz im Bereich Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin eingerichtet5.
Die zentrale Stelle koordiniert zusammen mit den dezentralen Stellen in den Behörden die Umsetzung der Maßnahmen für den Arbeitsschutz und die Arbeitsmedizin. Wie schwierig sich das gestalten kann, zeigt die Fülle von Vorschriften, bei denen allein zu diesem Themenkomplex eine Aushangpflicht besteht (Auszug aus dem Intrapol der betrachteten Landesorganisation):
Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG)
Arbeitsgerichtsgesetz (ArbGG)
Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)
Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV)
Arbeitszeitgesetz (ArbGG)
Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG)
Bürgerliches Gesetzbuch (§612 Abs. 3, § 612a BGB)
Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)
Bildschirmarbeitsverordnung (BildscharbV)
Heimarbeitsgesetz (HAG)
Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG)
Jugendarbeitsschutzuntersuchungsverordnung (JArbSchUV)
Kinderarbeitsschutzverordnung (KindArbSchV)
Mutterschutzgesetz (MuSchG)
Unfallverhütungsvorschriften (UVV)
Dazu kommen Beratungen in Bezug auf bestimmte Themenbereiche und Hinweise auf Schutzmöglichkeiten und Arbeitshilfen für das Personal, z.B.
Informationen über den Umgang mit Sommerhitze im Büro
Gewährung von Brillen für Bildschirmarbeitsplätze
Gymnastik im Büro
Nutzung von höhenverstellbaren Schreibtischen
Gesundheit im Büro.
2.2 Dienst- und Gesundheitssport
Bei der betrachteten Landesorganisation stellt die körperliche Fitness einen wesentlichen Bestandteil der Anforderungen an das im Außeneinsatz befindliche Personal dar. Während des Verfahrens zur Personalauswahl müssen Bewerber diese Fitness6 durch die Teilnahme an standardisierten Tests nachweisen. Nur wer hier die Mindestnormen erfüllt, kann in diese Landesorganisation eingestellt werden.
Insoweit befindet sich in dieser Landesorganisation bereits infolge der Personalauswahl ein als „gesund“ bewertetes Personal. Maßnahmen der Gesundheitsförderung dienen in diesem Fall also nicht vorrangig der Herstellung eines bestimmten Gesundheitszustands, sondern vielmehr soll genau dieser Zustand möglichst lange erhalten bleiben.
Wer sich dazu entschieden hat, sich den besonderen Anforderungen dieser Organisation zu stellen und dies auch erfolgreich nachweisen konnte, wird erfahrungsgemäß zumindest in den ersten Jahren seines Dienstes selbst für die Beibehaltung dieser Fitness sorgen.
Das ändert sich mit zunehmendem Alter. Während die einen noch immer dem Sport mit Begeisterung nachgehen, lassen sich andere eher auf ein körperlich weniger aktives Berufsleben ein.
Um diesen Trend zumindest zu bremsen, wird den spezifisch eingestellten Bediensteten die Möglichkeit7 gegeben, innerhalb ihrer Dienstzeit ein Sportangebot des Landes wahrzunehmen. Die wählbaren Sportangebote richten sich dabei danach aus, ob sie für die Sicherstellung der besonderen Dienstfähigkeit förderlich sind.
2.3 BGM-mobil
Die betrachtete Landesorganisation hat bei Erhebungen herausgefunden, dass die wichtigen dezentralen Stellen von den Angeboten der Gesundheitsprävention bzw. des Dienstsports kaum Gebrauch machen. Gerade diese Außenstellen sind in ihrer täglichen Arbeit – sie erfolgt in Form eines Schichtdienstes – besonderen Belastungen ausgesetzt. Deshalb ist eine Sensibilisierung dieser Gruppe von besonderem Interesse.
Die Idee zur Aktivierung des Potenzials der Außenstellen wurde dadurch umgesetzt, dass die Prävention unmittelbar vor Ort getragen und so das Personal quasi „abgeholt“ wird. Dazu wurde ein Fahrzeug der Transporterklasse beschafft und mit unterschiedlichen Materialien für die Gesundheitsprävention ausgestattet. Als Marketingmaßnahme erhielt das Fahrzeug den Namen „BGM-mobil“. Der Schriftzug ist außen auf dem Fahrzeug angebracht.
Da das Fahrzeug eindeutig als Behördenfahrzeug erkennbar ist, kann hierbei sogar zusätzlich an die Bürger die Botschaft übermittelt werden: „Uns ist die Gesundheit unseres Personals wichtig!“ Hierbei ist nicht zu unterschätzen, dass so ein positives Image gefördert und damit die Bereitschaft von jungen Menschen unterstützt wird, sich einem solchen Arbeitgeber anzuschließen.
Als Hauptthemenfelder haben die Initiatoren des Projekts Bewegung, Sport, Entspannung, Schlaf und Ernährung identifiziert. Zu den kreativen Beratungsansätzen gehört u.a. die Durchführung eines Ernährungsquizes. So sollen die Teilnehmenden beispielsweise erraten, wie viele Stücke Würfelzucker in den verschiedenen Nahrungsmitteln enthalten sind.
Dazu gehört dann auch das Probieren von Alternativen. Nach dem Motto „Probieren geht über Studieren“ werden Fruchtsäfte frisch zubereitet und zur Verfügung gestellt“. Die Erfahrungen des Teams sind sehr positiv, so dass dieses Konzept dauerhaft beibehalten wird.
3. Auffangen von Belastungen im Dienst
Die Landesorganisation sieht es als ihre Aufgabe an, eine kompetente und vertrauensvolle Beratung für das Auffangen von Belastungen im Dienst anzubieten. Dazu hat sie als festen Bestandteil ihrer Behörde Personalberatungsstellen mit sozialen Ansprechpersonen für Krisensituationen eingerichtet, an die sich das Personal ohne Einhaltung des Dienstweges wenden kann.
Um einen Willen zur Veränderung zu unterstützen und einen gemeinsamen Weg zu finden, werden unterschiedliche Angebote unterbreitet. Die nachfolgenden Kapitel bieten hierzu eine kleine Auswahl8.
Dazu gehören u.a. die
Begleitung in psychischen Krisen
Begleitung bei Langzeit- und Suchterkrankung
Beteiligung an der Vor- und Nachbereitung kritischer Einsatzlagen
Mitwirkung an der Nachbereitung potentiell traumatisierender Ereignisse
Stressbewältigung.
3.1 Betriebliches Eingliederungsmanagement
Die betrachtete Landesorganisation hat die Grundlage für das Betriebliche Eingliederungsmanagement (BEM) ihren Behörden und Organisationen durch eine Rahmendienstvereinbarung mit dem zuständigen Hauptpersonalrat formalisiert.
Die Leitung und der Hauptpersonalrat haben sich darauf verständigt, das BEM ausschließlich zur Unterstützung der Beschäftigten bei der Überwindung gesundheitlicher Probleme und zur Erhaltung des Arbeitsplatzes einzusetzen. Ziel ist es dabei, die Gesundheit der Beschäftigten zu fördern und zu erhalten.
Das BEM sieht vor, sich um Beschäftigte zu kümmern, die innerhalb von zwölf Monaten länger als 42 Kalendertage ununterbrochen oder wiederholt dienst- bzw. arbeitsunfähig sind (bzw. waren) 9.
Die Hilfestellungen erfolgen durch ein Integrationsteam, bestehend aus
einer speziell für das BEM beauftragten Person der Behörde
einer mit der Personalberatung beauftragten Person
jeweils einer Vertretung der Behörde, des Personalrats und der Schwerbehindertenvertretung.
Das Integrationsteam prüft Maßnahmen zur Eingliederung der Betroffenen. Als denkbar nennt die Vereinbarung u.a. folgende Maßnahmen:
Stufenweise Wiedereingliederung
Technische und ergonomische Umgestaltung des Arbeitsplatzes
Hinweise über Beratungen zur medizinischen Rehabilitation
Ggf. Veränderung des Aufgabenbereichs.
Als Kernelement sieht die Vereinbarung vor, dass der Wille der Betroffenen im Vordergrund steht. Jeder einzelne Verfahrensschritt bedarf ihrer Zustimmung. Um dies sicherzustellen, besteht die Pflicht zur Dokumentation der Zustimmung. Dies wird dadurch gestärkt, dass die Betroffenen ein einmal erklärtes Einverständnis in jedem Stadium des Verfahrens wieder zurückziehen können.
Auf die Vertraulichkeit ihrer Daten sollen sich die Betroffenen verlassen können. So dürfen die erhobenen Daten ausschließlich zur Durchführung des BEM-Verfahrens genutzt werden. Die Verwendung zu anderen Zwecken ist ausdrücklich untersagt. In die Vorschrift wurde dazu bewusst ein Hinweis aufgenommen, dass bei Zuwiderhandlungen dienst- bzw. arbeitsrechtliche Verstöße darstellen.
3.2 Psychosoziale Unterstützung
Die betrachtete Landesorganisation geht von ihrer Fürsorgeverpflichtung aus und möchte dafür Sorge tragen, Beschäftigte möglichst vor Schädigungen und übermäßigen psychosozialen Belastungen im Rahmen ihrer Dienstverrichtung zu bewahren bzw. etwaige Auswirkungen so gering wie möglich zu halten.
Eine speziell für diesen Zweck zentral eingerichtete Organisation bietet eine psychosoziale Hilfe an. Sie wird unterstützt von einem Netzwerk, das aus den Personalberatungsstellen der Behörden gebildet wird. Die zentrale Organisation fungiert dabei als Koordinierungsstelle und Fachaufsicht.
Zu den Leistungen der psychosozialen Hilfe10 zählt die Unterstützung beim Umgang mit Angst, Belastungen, Stress, Konflikten, Mobbing, Burnout Depression und einer Vielzahl analoger Themen. Im Extremfall kann es auch zur Intervention bei einem bevorstehenden Suizid kommen. Gerade aufgrund der besonderen Thematiken geht die betrachtete Landesorganisation davon aus, dass das Angebot zur psychosozialen Unterstützung nur dann genutzt wird, wenn die Beschäftigten das Vertrauen haben, dass ihre Belange in einem geschützten Rahmen behandelt werden. Das setzt Freiwilligkeit und Vertraulichkeit voraus.
Die Landesorganisation sichert und schützt dies und ist deshalb – gemessen an den zugrundeliegenden Umständen – auf Informationen über seine Beschäftigten zu verzichten. Dies setzt Vertrauen in das verantwortliche Handeln seiner Beschäftigten und seiner Führungskräfte11 voraus.
Als Unterstützungsangebote wurden Angebote zu drei Zeitpunkten entwickelt (in einem Erlass geregelt) 12:
Primäre Prävention
: Anlassunabhängie Vorbeugung von psychosozialen Belastungen.
Sekundäre Prävention
: Anlassbezogene Vorbeugung von psychosozialen Belastungen nach für die Beteiligten potenziell kritischen Ereignissen.
Tertiäre Prävention
: Beratung bzw. Unterstützung bei einem vorhandenen psychosozialen Problem, das die Betroffenen nicht unmittelbar alleine lösen können.
Nach Abschluss einer Unterstützungsmaßnahme wird die hierfür angelegte Akte bei der zuständigen Stelle aufbewahrt. Sie steht nur dem engsten Kreis der Unterstützenden zur Verfügung und kann ohne Entbindung von der Schweigepflicht nicht weiter verwendet werden.
3.3 Konfliktmanagement
Die betrachtete Landesorganisation ist sich bewusst, dass Konflikte im privaten und im beruflichen Kontext alltäglich sind. Im Idealfall lassen sich die Konflikte lösen und ein konfliktarmes Klima schaffen. Das ist aber nicht immer möglich, denn manchmal können Unstimmigkeiten nicht „aus dem Weg geräumt“ oder gar vergessen werden.
Mit einem Konfliktmanagement13 soll die Bearbeitung und die Lösung von Konflikten angestrebt werden. Das Personal soll dazu qualifiziert werden, mit Konflikten umzugehen.
Dabei stehen folgende Themen im Vordergrund:
Umgang mit Emotionen
Strategien in akuten, eskalierenden Situationen
Konfliktgespräche.
Ziel ist es, das Personal dazu zu bringen, sein eigenes Konfliktverhalten zu reflektieren und dabei den eigenen Konfliktstil zu entdecken bzw. den Umgang damit zu lernen. Mit zunehmender Eskalation sollen abgestimmte Interventionsschritte angegangen werden, die letztlich auch mit fachkundigem Rat begleitet werden können.
Der Landesorganisation ist es wichtig ihrem Personal zu signalisieren, dass es keine Schwäche darstellt Konflikte zu haben. Problematischer sei es vielmehr, Konflikte zu übersehen, zu negieren oder „tot zu schweigen“, obwohl geeignete Unterstützungsangebote im Rahmen des vorhandenen Konfliktmanagements vorhanden seien.
3.4 Seminarkonzept „Erholung für die Seele“
Die betrachtete Landesorganisation hat sich dazu entschlossen, auf die besonderen Belastungen ihres Schichtdienstpersonals einzugehen und diesem ein Seminar zur „Erholung für die Seele“14 anzubieten.
Es geht in dem Seminar darum, wieder zurück zu sich selbst zu finden. Dazu steht ein Hotel als Seminarumgebung zur Verfügung, das sich sowohl durch seine Abgeschiedenheit außerhalb der Stadt auszeichnet als auch durch seine vielfältigen Möglichkeiten zum Entspannen und wieder „aufzutanken“.
Inhaltlich geht es um das Aufzeigen von Möglichkeiten, mit dem eigenen Stress in Zukunft besser umzugehen. Der Bericht von den ersten Seminaren stellt hierbei dar, mit welchen Methoden in dem Seminar gearbeitet wurde:
Klassische Entspannungsverfahren
: Atemtraining, autogenes Training sowie progressive Muskelrelaxation.
Körperorientierte Übungen
: Body Sense, Rücken-Training, Shiatsu, dynamische Entspannung, Mountainbiken, Wandern, Joggen, Nordic-Walking oder einfach nur Spazierengehen, Thermenbesuch oder im Garten ausruhen.
Psychoedukation
: Vermittlung von psychologischem Wissen, das sich wissenschaftlich fundiert auf psychische gesundheits- und störungsrelevante Informationen und Kompetenzen bezieht.
Mentaltraining
: Förderliche Denkweise entwickeln, Reframing sowie Klopfmassage.
Es werden hierbei keine „Zwangsveranstaltungen“ innerhalb des Seminars angeboten, sondern die Teilnehmenden können die Angebote „nach eigenem Gusto“ nutzen bzw. ausprobieren.
Von Teilnehmenden wurde dabei geäußert, dass sie das Seminar nachhaltig positiv beeinflusst habe. So sei dem eigenen privaten Umfeld die gute Laune der Teilnehmenden aufgefallen. Man habe viele Anregungen erhalten, die zu einem Teil in der Zukunft umgesetzt werden sollen. Außerdem sehe man die Möglichkeit, sich mit den Kolleginnen und Kollegen, die man im Seminar kennengelernt habe, zur kollegialen Beratung treffen, um auch hieraus wieder Impulse zu erhalten.
4. Zusätzliche Unterstützung
Ergänzend zu den vorgenannten Maßnahmen hat sich die betrachtete Landesorganisation weitere Maßnahmen auferlegt. Sie sollen das Personal darin unterstützen, ihren Beruf im Einklang mit ihrem Privatleben ausüben zu können15.
4.1 Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Die Landesorganisation hat für die Themenstellung zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf16 eine Rahmendienstvereinbarung mit dem zuständigen Hauptpersonalrat abgeschlossen.
Darin wird bewusst herausgehoben, dass es nicht nur um Familien mit Kindern geht, sondern sich die Landesorganisation bewusst ist, dass die Pflege von Angehörigen immer mehr an Bedeutung gewinnt. Die Landesorganisation möchte dazu beitragen, dass allen Beschäftigten ein Anspruch auf eine gute Balance von Erwerbsleben und Privatleben ermöglicht wird. Sie weist in der Vereinbarung explizit darauf hin, dass sie in der Vereinbarkeit von Familie und Beruf einen integralen Bestandteil ihrer Fürsorgestrategie sieht.
So sollen u.a. familienfreundliche Teilzeitmodelle ermöglicht werden. Der Flexibilität wird dabei ein besonderer Raum gegeben. Ziel ist es, eine flexible und individuelle Ausgestaltung mit größtmöglichem Arbeitsumfang zu realisieren, der möglichst hin zu einer frühzeitigen Rückkehr in eine Vollzeittätigkeit führt. Die individuellen Arbeitszeitmodelle sind dabei von den Behörden eng zu begleiten und einzelfallbezogen zu evaluieren.
Zu den Unterstützungsmöglichkeiten zählt die Einrichtung von alternierenden Telearbeitsplätzen. Dabei wird angestrebt, die Arbeitszeit von Teilzeitbeschäftigten zu erhöhen. Auch kann in besonderen Ausnahmesituationen eine vorübergehende Verlagerung des Arbeitsplatzes in das häusliche Umfeld erfolgen.





























