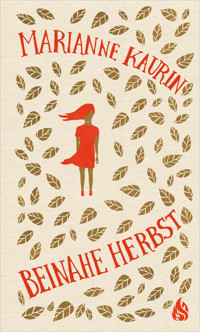
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Arctis Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Sonja wartet auf ihre jüngere Schwester Ilse. Sie hätte längst zu Hause sein sollen. In Oslo fällt der erste Schnee. Plötzlich klopft es an der Tür. Draußen stehen drei Polizisten. Es ist das Jahr 1942. Der preisgekrönte Roman "Beinahe Herbst" handelt vom Schicksal der jüdischen Familie Stern im okkupierten Norwegen, von der Kraft der ersten großen Liebe, vom Hoffen und Verlieren, von kleinen Zufällen und großen Träumen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 270
Veröffentlichungsjahr: 2019
Sammlungen
Ähnliche
Marianne Kaurin
Beinahe Herbst
Aus dem Norwegischen von Dagmar Mißfeldt
Die Originalausgabe erschien 2012 unter dem Titel
Nærmere høst im Aschehoug Verlag, Oslo.
Die Übersetzung wurde gefördert von NORLA,
Norwegian Literature Abroad.
Deutsche Erstausgabe
© Atrium Verlag AG, Imprint Arctis, Zürich 2019
Alle Rechte vorbehalten
© Marianne Kaurin
First published by H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard) AS, 2012
Published in agreement with Oslo Literary Agency
Übersetzung: Dagmar Mißfeldt
Lektorat: Maike Frie, Münster
Coverillustration und -gestaltung: Helene Brox
Coverüberarbeitung: Suse Kopp, Hamburg
Bildnachweis: Karte von Oslo 1938 (Vorsatz) und 1940 (Nachsatz), mit freundlicher Genehmigung von Oslo byarkiv und Creative Commons BY-SA3.0NO (unveränderter Abdruck von https://www.oslo.kommune.no/OBA/Kart/Oslo 1938/index.html und https://www.oslo.kommune.no/OBA/kart/1940/index.html)
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
ISBN978-3-03880-131-3
www.arctis-verlag.com
Folgt uns auf Instagram unter www.instagram.com/arctis_verlag
Der Sommer ist vorbei.
Die Blätter in den staubigen Straßen, vertrocknet und eingerissen, gelbe, rote, sie liegen haufenweise entlang der Mietshäuser und warten aufs Verfaulen. Die Luft ist beißend und bringt einen Geruch, eine Wende. Bald wird der Wind auffrischen und es gibt strömenden Regen, der gegen die Fenster, auf den Asphalt prasselt, tiefe Furchen in den Kies gräbt. Bald ist die Erde feucht und kalt, voller Würmer, Maden und Käfer, die sich eifrig den Bauch vollschlagen. Bald ist die Anhöhe hart und undurchdringlich, bald gibt es Schnee. Eine harte Haut auf gefrorenem Wasser und steifem Gras, weiß und kühl, um alles ruhen zu lassen, was tot ist.
Noch scheint die Sonne, sie steht tief und wärmt wenig, und jetzt fällt das Licht schräg auf ein Tor in Oslos Stadtteil Grünerløkka. Durch das Tor kommt Ilse Stern. Sie geht schnell, sie lächelt. Draußen auf der Biermanns gate dreht sie sich um. Das graue Mietshaus steht wie eine leere Hülle im trüben Nachmittagslicht, eine schlafende Mauerwand mit geschlossenen Fenstern. Von außen sieht es aus wie jedes andere Mietshaus. Vier Stockwerke, dunkle Gardinen, ein schmiedeeisernes Tor, durch das man nach einem Durchgang mit Abfalltonnen in einen schattigen Hof kommt. Hinter den Fenstern im zweiten Stock rührt sich nichts. Von außen kann man nicht alles erkennen, was sich dort drinnen bewegt, dort atmet, pocht und lebt.
Ilse biegt um die Ecke in die Toftes gate. Sie hat es geschafft. Sie ist aus der Wohnung entkommen, ohne dass Mutter sie mit all ihrem Gemecker davon abgehalten hat. Nicht ein Wort, dass sie immer nur an sich denkt, dass sie keine Rücksicht nimmt, kein »Pass auf dies und pass auf das auf« und dass sie vor der Ausgangssperre wieder zu Hause zu sein hat.
Sie machten Mittagsschlaf, als sie ging, Mutter und Vater, sie schnarchten so passend. Sonja und Miriam waren im Park Torshovdalen. Miriam hatte gequengelt, Ilse solle auch mitkommen: »Bitte, bitte, Ilse, komm mit, wir können die Anhöhe runter um die Wette laufen.« Ha! Was war Wettlaufen in Torshovdalen im Vergleich mit Ilses Plänen an diesem Samstagnachmittag? Was war das schon für ein Vorschlag an einem Tag wie diesem?
Wie eine Schlange war Ilse in der engen Wohnung herumgeschlichen, um die beiden schlafenden Krummrückigen nicht zu wecken. Mutters Handtasche hing im Flur am Hakenbrett. Ilse nahm sie lautlos ab, öffnete sie vorsichtig, Taschentücher und Quittungen, sie kramte darin, bis die Finger das Gesuchte fanden. Vor dem Spiegel in der Küche trug sie in dicken Schichten Lippenstift auf. Sie zog eine Schnute, legte den Kopf schräg, schloss die Augen, spürte die Kälte, die von der Spiegeloberfläche ausging, den Atem, von dem das Glas beschlug. Rot, rosa, die Lippen groß und voll, zum Küssen bereit. Ihr Haar hatte sie mit genau hundert Bürstenstrichen gebürstet, zuerst zur einen, dann zur anderen Seite. Sie spiegelte sich lange, im Profil von rechts, lächelte. Der Küchenboden lag voller schwarzer Haare, als sie fertig war. Mutter konnte es nicht ausstehen, dass sie sich in der Küche bürstete: »Das ist unappetitlich, Ilse, die Haare können ins Essen kommen.« Ilse bückte sich, sammelte die Haare auf, knäuelte sie zu einer kleinen Kugel zusammen und warf sie in den Mülleimer. Einen Zettel legte sie noch auf den Küchentisch, bevor sie losging: »Bin kurz weg.« Mehr nicht.
Die Wärme der Sonne legt sich auf ihr Gesicht, der Staub wirbelt von den Straßen auf, das Laub raschelt, sie watet hindurch. Die Toftes gate erstreckt sich vor ihr wie ein Boulevard, sie muss ihn nur hinab- und geradeaus gehen. Sie ist auf dem Weg. Jetzt passiert es. Sie trägt das Sommerkleid, das weiße mit den roten Punkten, das Sonja genäht hat, es ist viel zu spät im Jahr, um nur in einem Sommerkleid vor die Tür zu gehen, das weiß sie genau, aber trotzdem, wenn es einen Tag gibt, an dem sie im Sommerkleid geht, sich von ihrer allerbesten Seite zeigt, dann heute. Das Kleid ist kurzärmelig, aus einem dünnen Baumwollstoff, und einmal im Sommer, ja, genauer gesagt am 16. Juli kurz nach vier Uhr, hatte Hermann sie angesehen und zu ihr gesagt, dass es ihr stehe. Jetzt merkt sie, wie die kalte Luft durch den Stoff weht, wie sie Gänsehaut bekommt. Die Härchen auf den nackten Unterarmen stellen sich auf wie schwarze Fühler. Sie muss die Arme hinter dem Rücken halten, damit er das nicht sieht.
Ilse läuft fast die schmalen Wege im Park Birkelunden hinab. Heute macht im Pavillon niemand Musik, dort hat schon lange niemand mehr musiziert. Früher kam sie oft am Sonntag mit der Familie hierher, so wie viele Nachbarn aus dem Mietshaus in der Biermanns gate. Essen im Korb, Saft in Flaschen, sie machten es sich auf Decken gemütlich, sie und Sonja tobten mit Hermann und Dagny und den anderen Kindern. Odd Rustad aus dem Dritten forderte seine Frau zum Tanz auf und bewegte sich selbstsicher über die Rasenfläche, wobei er laut trällerte und alle über ihn lachten. Jetzt ist es so anders, so still, alle sind wie auf der Hut. Die Pauluskirche steht auf der gegenüberliegenden Seite. Sie schaut zum Turm hoch. Als sie klein war, redete Sonja ihr ein, dass dort oben ein Mann wohne, ein Kirchendiener mit Holzbein und langen, strähnigen Haaren, der dort ein Mädchen gefangen halte, in einem eigens angefertigten Kerkerloch und sie hungern lasse, bis sie nur noch ein Skelett mit Brille war: »Ja, denn sie hatte eine Brille getragen, dieses Mädchen.« Ilse hatte sich immer besonders fest an Sonjas Hand geklammert, wenn sie Birkenlunden durchquerten, bis sie ungefähr zwölf war. So oft hatte sie von diesem bebrillten Skelett Albträume gehabt, so oft hatte sie einen Umweg gemacht, um dort nicht vorbeigehen zu müssen.
Die großen Birken im Park rauschen so schön. Die Straßen sind irgendwie breiter als sonst, weniger staubig, weniger vermüllt. Sie hat vier Worte im Kopf, sie sind einfach aufgetaucht, wie eine Regel, wie ein Marsch: »Alles beginnt im Herbst. Alles beginnt im Herbst. Eins, zwo, drei, vier. Alles beginnt im Herbst.« Irgendetwas wartet auf sie, jemand wartet auf sie. Sollen doch die Bäume so viele Blätter verlieren, wie sie schaffen, soll die Anhöhe doch hart und undurchdringlich werden, soll es doch so viel Regen und Wind geben, wie es will, und der Krieg, der blöde Krieg, kann sich zum Teufel scheren, denn sie, Ilse Stern, im Sommerkleid und mit Lippenstift, fünfzehneinhalb Jahre in den nächsten Tagen, ist unterwegs zu etwas, das heiß und rot pulsiert, und nichts und niemand kann sie aufhalten.
Auf dem Olaf Ryes plass sitzen Leute und unterhalten sich, einige auf dem Rasen, andere auf den grünen Bänken, die im Halbkreis um den Springbrunnen stehen. Noch ist Wasser darin, es gluckert, die hohen Bäume werfen Schatten auf den Platz, ein paar Kinder spielen Fangen, laufen lachend und schreiend hintereinander her. Es kommt ihr so lange her vor, dass sie auch einmal dazugehörte und so ein schmuddeliges Stadtkind mit dünnen Zöpfen war, das in den Parks und Straßen von Grünerløkka herumrannte.
Ilse schaut nach einem schmächtigen Jungen mit blonden, strubbeligen Haaren und einer Lücke zwischen den Schneidezähnen, einem Jungen mit schönen, schmalen Händen und schlenderndem Gang, einem, der wie Hermann duftet. Er ist nirgendwo zu sehen. Der Wind streicht durch die Baumkronen. Sie wartet.
Vor ein paar Tagen, ganz genau um Viertel nach sechs am Dienstag, klopfte es bei ihr zu Hause an der Tür. Er stand entspannt im Treppenhaus, die eine Hand hinter dem Rücken.
»Ilse Stern«, sagte er, wie es so seine Art war. Nein, nicht ganz, in seiner Stimme schwang etwas mit, etwas Neues.
»Hermann Rød«, antwortete Ilse.
Kurz war es still. Ilse Stern und Hermann Rød. Niemand sagte etwas. Ilse machte einen Schritt ins Treppenhaus, schloss die Tür hinter sich. Mutter saß beleidigt in der Stube, sie hatten sich gerade gestritten, jetzt überlegte sie sich bestimmt den nächsten Angriff. War Hermann aus dem Grund gekommen, waren sie und Mutter zu laut geworden? Mutters Stimme war ins Falsett gekippt, als sie das mit dem Mehl herausgefunden hatte: »Was hast du nur wieder für Ideen, Ilse, sich Mehl ins Gesicht schmieren?« Das war ein dämlicher Streit, einer von vielen. Hatte Hermann drinnen bei sich gehört, wie sie sich angeschrien hatten? Und hatte sie noch immer Mehl im Gesicht? Sie wischte sich schnell die Wange ab.
»Was gibt’s, Hermann?«, fragte sie unsicher.
Er streckte die Hand aus, zwei Papierzettel, er wedelte damit in der Luft herum, beugte sich zu ihr.
»Kino im Parktheater, Sonnabend, fünf Uhr«, verkündete Hermann. »Reihe sieben, Plätze acht und neun.«
Sie hat diese Verabredung so deutlich vor Augen gehabt: Hermann, wie er unter den großen Bäumen auftaucht, sie, wie sie rot gepunktet und sommerlich auf der Bank sitzt, wie er ihr behutsam den Arm um die Schultern legt, sie ins Kino-Dunkel führt.
Oh nein, die Nachbarn aus dem Dritten, die gehen spazieren, die ganze Familie, die Mädchen laufen voraus, Herr und Frau Rustad hinterher. Warum hat sie keine Tasche mitgenommen, dann könnte sie jetzt darin wühlen, oder sie hätte ganz zufällig dort sitzen und ein Buch lesen können. Wenn sie sich nur ein bisschen verstecken könnte, gerade jetzt will sie nicht mit ihnen reden. Odd, der sich immer so aufspielt, Witze macht und lacht: Ach, guck an, im Sommerkleid sitzt du hier, das werden wir deiner Mutter sagen, und auf wen wartest du eigentlich? Ilse dreht sich weg, tut, als habe sie gerade etwas Interessantes zwischen den Baumstämmen entdeckt, streckt den Rücken durch, aber es ist zu spät, es nützt nichts, sie haben sie schon entdeckt. Odd Rustad hebt die Hand und winkt aufgeregt, Karin und Lilly kommen auf sie zugelaufen.
»Ach nee«, sagt Odd Rustad, er macht ein neugieriges Gesicht. »Hier sitzt das junge Fräulein Stern ganz mutterseelenallein und wächst und gedeiht?«
Warum muss er immer so was sagen, sich so unglaublich wichtigmachen?
»Wer wird denn das Vergnügen haben, die Dame zu treffen?«
Natürlich. Das musste er ja fragen. Sie hat keine Lust, ihm zu verraten, dass sie auf Hermann wartet. Dass sie blau gefroren und fein angezogen hier sitzt und auf den Nachbarsjungen wartet.
»Grete Kvist«, antwortet sie schnell, ohne nachzudenken.
»Ach was. Grete Kvist, so, so«, sagt Odd Rustad und zwinkert ihr schelmisch zu.
Grete Kvist. Wie um alles in der Welt ist sie nur auf diesen Namen gekommen?
Eine halbe Stunde vergeht. Sie sieht kein Stück von seinem schlendernden Gang, dem blonden, strubbeligen Haar, riecht keinen Hermann-Duft, und vor dem Parktheater hat sich eine Warteschlange gebildet. Haben sie verabredet, sich im Park zu treffen oder vor dem Kino? Sie ist sich plötzlich unsicher: War es um fünf Uhr, Reihe sieben, Plätze acht und neun? Auf dem Plakat vor dem Parktheater sieht sie, dass der Film zwei Mal gezeigt wird. Um fünf und um sieben Uhr. Die Zuschauer werden eingelassen, sie steht noch immer draußen, allein. Beide Beine zittern leicht, die Fühler stehen von ihren Armen ab wie schwarze Stacheln, kann es sieben Uhr sein, Reihe fünf, Plätze acht und neun?
Der Sommer. So schön ist er gewesen. Lange, heiße Tage, die Sonne brennend über dem Mietshaus. Die Nachmittage im Schatten des Fliederbusches unten im Hof, summende Insekten, Ilse auf der Bank unter dem Busch mit einem aufgeschlagenen Buch auf dem Schoß. Sie hätte genauso gut ein chinesisches Wörterbuch oder eine von Mutters Strickanleitungen mit nach draußen nehmen können, die Buchstaben verwandelten sich ohnehin in kleine schwarze Käfer, die über die Seiten kullerten, schnell und sachte wegkrochen, während Ilse hoch zu den Fenstern rechts im zweiten Stock schaute. War er dahinter, würde er sie bald entdecken, sich aus dem Küchenfenster lehnen, rufen, winken, nach unten kommen? Klappern von Fensterriegeln, Schritte über die Holzbohlen im Tordurchgang, Stimmen, das dumpfe Zuklappen der Haustür, das Zuschlagen des schmiedeeisernen Tores – sie deutete alles als Zeichen, setzte sich gerade hin und hielt sich das Buch vors Gesicht. Die Augen über der Buchkante, ein Soldat in einem Schützengraben, sie beobachtete alle, die vom Tordurchgang zur Haustür und von der Haustür zum Tordurchgang vorbeikamen. Und wenn Hermann auftauchte, ob er nach Hause kam oder nach draußen ging, dann war sie zur Stelle; zufällig und perfekt platziert, ein Zierstrauch, im grauen Hof plötzlich gesprossen. Dann legte sie das Buch auf den Schoß, rutschte ein ganz kleines bisschen nach links und machte ihm neben sich Platz, auf der rechten Seite, sie war von rechts am hübschesten, im Profil von dieser Seite sah sie erwachsener aus, sie musste sich ihm von der Schokoladenseite zeigen. Stundenlang konnten sie so dasitzen. Die Sonne verzog sich hinter den Dächern des Mietshauses zur Vogts gate, kühl die Luft, taufeucht das Gras, sie lachten, redeten, dicht nebeneinander auf der Bank. Mutter brachte alles immer damit zum Platzen, dass sie sich aus dem Schlafzimmerfenster lehnte und sie mit raschen, wütenden Handbewegungen ins Haus scheuchte.
»Weißt du was?«, sagte er eines Tages, als sie dort saßen. Er schaute sie an, lächelte ein wenig zaghaft, machte ein geheimnisvolles Gesicht, als gäbe es etwas, das er ihr erzählen musste. Wollte er ihr jetzt seine Liebe deklarieren oder wie das hieß? Am Ende jedes Romans, den sie las, gab es immer so eine Szene: Die jungen Liebenden bekamen einander, alle Handlungsstränge liefen da zusammen und wurden entwirrt. Sie streckte den Rücken durch, machte sich bereit, schüttelte den Kopf.
»Ich fange bei einem Kunstmaler eine Lehre an.«
Eine kleine Enttäuschung, winzig klein.
»Bei einem Kunstmaler?«
Er nickte.
Sie konnte es sich nicht vorstellen. Hermann hatte nie erwähnt, dass er malen oder zeichnen konnte, er hatte sich nie für so etwas interessiert. Kunstmaler? Vielleicht gab es manches, was sie nicht über ihn wusste, obwohl sie einander so gut kannten.
»Warum?«
»Weil ich Lust dazu habe«, antwortete er. »Und weil sich jetzt die Gelegenheit geboten hat. Ich fange schon nächste Woche an.«
Ilse wusste nicht, was sie sagen sollte. Glückwunsch, wie schön für dich, dann musst du nicht für den Rest deines Lebens Bierkästen verladen. Sie wusste, dass er die Arbeit in der Brauerei hasste. Sie sah ihn an. Hermann Rød, der weltberühmte Künstler aus Grünerløkka, der Arbeitersohn, der jetzt ein Künstlerleben in schicken Cafés führte, umschwärmt, verehrt, aber treu, immer der Frau treu, die mit ihm durch dick und dünn gegangen war, die immer an seiner Seite war, die schöne Ilse Stern.
»An was denkst du, Ilse?«
Sie schaute ihn an. Seine leuchtend blauen Augen sahen gespannt und zugleich ängstlich aus.
»Was sagt dein Vater dazu?«, fragte sie nach einer Weile.
Hermann runzelte die Stirn. Die weißen Härchen in seinen Augenbrauen hoben sich widerspenstig.
»Ich habe es ihm noch nicht erzählt«, antwortete er und pulte am Lack auf der Bank. »Aber das wird ihm bestimmt nicht gefallen.«
Ilse sah es plötzlich vor sich: Hermanns Vater, ein stattlicher Mann, der nur für die Ringnes Brauerei gelebt hatte, der seinem einzigen Sohn Arbeit besorgt hatte, nach seinen Worten eine anständige Arbeit, und jetzt wollte ausgerechnet dieser Sohn mit Kunstmalerei anfangen. Nein, Tinius würde diese Vorstellung nicht gefallen.
Genau das mochte sie an Hermann. Er traf seine eigenen Entscheidungen, er machte, was er wollte. Vielleicht hatte er festgestellt, dass er eigentlich Künstler war, dass es nicht zu ihm passte, in einer Brauerei zu arbeiten, vielleicht war das schon lange sein Traum gewesen, ohne dass er ein Wort darüber verloren hatte. Und dann machte er das eben. Weil er dazu Lust hatte.
»Viel Glück«, wünschte sie ihm, als sie Mutters winkende Hände in dem geöffneten Schlafzimmerfenster sah.
In diesem Sommer hatte sich etwas angeschlichen, worauf sie nicht gefasst war, aber jetzt hing es da, es hatte sich festgesaugt, ein Insekt, das süßes Blut schlürfte: die Liebe. Alles, was sie darüber gelesen hatte, sich ausgemalt und worauf sie sich eingestellt hatte, und trotzdem. Sollte hier die Liebe auftauchen, in einem Hinterhof in Grünerløkka, in einem dunklen Tordurchgang, wo es nach Abfall stank, wo sie immer Ratten und Mäuse fingen? Sie wohnten schon ein Leben lang Wand an Wand, jeweils in der eigenen Wohnung in der Biermanns gate 10, zweiter Stock, drei Schritte von Tür zu Tür. Sie hatten unter dem Fliederbusch geheiratet, als sie fünf war und er sieben. Dagny Larsen aus dem Erdgeschoss war die Pastorin: »Willst du Ilse Stern, die neben dir steht, haben?«, fragte sie feierlich und kicherte den anderen Kindern zu, die im Kreis um das Brautpaar standen. »Ja«, antwortete Hermann laut und deutlich und dann mussten sie sich küssen, meinte Dagny. »Das machen doch alle, wenn sie geheiratet haben, so was Ekliges.« Ilse hatte das Spiel bis zum Küssen mitgemacht, aber dann hatte sie den Strauß aus Löwenzahn weggeworfen und sich im Keller versteckt.
Hermann Rød. Der Held. Der nicht groß und dunkelhaarig war wie Helden sonst immer in den Büchern. Ilse konnte Nein antworten, wenn sie eigentlich Ja meinte, und Ja, wenn sie Nein sagen wollte, ihre Hände waren schweißnass, es war anstrengend, Arme und Beine zu koordinieren. Und plötzlich saß sie da, wie festgeklebt auf den grauen Brettern, jeden Nachmittag auf der Bank unter dem Fliederbusch, und wartete. Sie waren Freunde. Ja, schon. Doch war da nicht gleichzeitig noch etwas mehr an der Art, wie seine Hand mit den rauen Fingern über ihren Arm strich, wie er sie ständig berührte, während sie miteinander sprachen? War das Zufall?
Jetzt steht sie tropfnass im Tordurchgang und weiß nicht, was sie glauben soll. Sie hatte bis zur nächsten Vorstellung gewartet, sich wieder angestellt und gehofft, dass sie sich geirrt hatte, dass es um sieben Uhr war, Reihe fünf, Plätze acht und neun. Zwei Männer in Uniform kamen zu ihr, sprachen mit ihr Deutsch, boten ihr eine Zigarette an. Sie drehte sich weg, die zwei Uniformierten zogen ab, doch dann blieben sie ein Stück weiter stehen, glotzten sie an und lachten, ja, sie hatten sie ganz eindeutig ausgelacht. Im Schein von den Fenstern des Parktheaters sah sie sich: der Mund verkniffen, blass, das Haar platt am Gesicht, der Körper formlos und mager, zitternd in dem gepunkteten Kleid. Sie spürte, wie der Regen am Haaransatz juckte, die feuchte, dünne Luft, den Dunst vom Gehweg.
Rock und Jacke liegen zusammengeknüllt hinter der Abfalltonne. Ihr Plan war so klar, als sie am Nachmittag von zu Hause aufbrach, Mutter würde von dem Sommerkleid nichts mitbekommen, sie würde Jacke und Rock anziehen, bevor sie die Wohnung wieder betrat, aber sie hatte nicht bedacht, dass es Regen geben könnte. Sollte sie jetzt Jacke und Rock über das nasse Kleid ziehen oder zuerst das Kleid loswerden? Sie zieht die trockenen Sachen über das Kleid, das ihr am Körper klebt. Es ist spät geworden, viel zu spät, warum war sie nur auf dem Olaf Ryes plass stehen geblieben?
Mutters Stimme, schon im Treppenhaus kommt es ihr so vor, als könne sie sie hören, scharf an den Rändern, gezackt, vorwurfsvoll, sie weiß, welche Worte sie zu hören bekommen wird. Sie ist gedankenlos, sie nimmt keine Rücksicht, sie soll sich bloß nicht einbilden, dass sie kommen und gehen kann, wie es ihr passt, auch sie ist ein Mitglied dieser Familie, für sie gelten keine anderen Regeln. Dann kommen die Vorwürfe, das schlechte Gewissen, das ihr eingetrichtert werden soll. Hier haben sie sich die ganze Zeit Sorgen um sie gemacht, Mutter würde bald einen Nervenzusammenbruch kriegen, jeden Tag konnte sie mir nichts, dir nichts zusammenbrechen, zerbrechen, es konnte nicht angehen, dass sie sich so benahm.
Oben im zweiten Stock legt sie den Kopf an die Tür zur Nachbarwohnung. Dort drinnen ist es still. Ganz still. Sie kann es einfach nicht verstehen, dass er nicht gekommen ist. Er hatte doch mit den Eintrittskarten in der Hand vor ihr gestanden, gekauft und bezahlt, fünf Uhr, Reihe sieben, Plätze acht und neun, sie weiß es ganz genau, sie konnte es auswendig. Das Sommerkleid und der Lippenstift, und sie war nervös auf der Straße auf und ab gelaufen, alles beginnt im Herbst, zum Teufel, sie schämt sich bei dem Gedanken daran. Sie würde Hermann auf keinen Fall erzählen, dass sie so lange auf ihn gewartet hat, das darf er nie erfahren. Wenn er sie vergessen hat, dann würde sie ihn ganz bestimmt auch vergessen, ihn wegschieben, fort, hinaus.
Sie holt tief Luft und hält den Atem an, bis sie die Türklinke herunterdrückt. »Hallo«, sagt sie so gut gelaunt, wie sie kann, als sie den schmalen Flur betritt.
Hermann steht lange vor Ilses Tür, als er an dem Abend nach Hause kommt. In der einen Hand hält er das Gemälde, die andere ist frei, er ballt sie zur Faust, die Knöchel rot und trocken. Soll er klopfen? Traut er sich? Er hatte geglaubt, er werde ruhig sein, sobald er zu Hause ankommt, sobald er den Tordurchgang betritt, die Treppen hoch und sich etwas erholt, die Angst abgeschüttelt hat, dann sei er bereit, entschlossen, standhaft.
Da drinnen ist es still. Kein Ton zu hören. Ob sie noch wach ist? Nein, es ist spät. Sie ist bestimmt schon zu Bett gegangen. Wenn er klopft, muss er ihr erklären, warum er sie versetzt hat, und das kann er nicht. Soll heißen, er kennt zwar den Grund, sich aber eine Erklärung, sich auch noch eine gute und sachliche, auszudenken, die Ilse ihm abnehmen wird, bringt er nicht fertig.
Er geht zurück zur eigenen Tür und schließt auf.
In der Wohnstube herrscht Dämmerlicht. Die Verdunkelungsrollos sind heruntergezogen, aber eine Lampe brennt noch. Vater sitzt im Sessel am Fenster. Der Schein der Lampe fällt auf sein Gesicht, das mit einem Mal so sanft aussieht. Er sitzt nur im Netzunterhemd da, sein dicker Bauch bläht sich beim Einatmen immer zu einem prallen Ball auf, die Haare auf seiner Brust lugen durch die Maschen. Auf dem Tisch vor ihm stehen zwei leere Bierflaschen, eine halb volle. Er macht es sich jeden Samstagabend etwas gemütlich, er besäuft sich nie, sitzt nur im Sessel und trinkt in großen gierigen Zügen. Früher hörte er immer Radio, er konnte dann dasitzen, leise vor sich hin singen und im Takt mitschnipsen. Jetzt sitzt er nur noch rum, dreht Däumchen, kippt Bier in sich hinein und starrt Löcher in die Luft.
»Vater?«
Hermann legt ihm behutsam die Hand auf die Schulter.
»Vater? Willst du nicht zu Bett gehen?«
Sein Vater zuckt zusammen, richtet sich im Sessel auf und sieht Hermann an, als sei er ein Fremder.
»Ach nee, da bist du ja«, antwortet er nach einer Weile. »Das wird aber auch Zeit, dass du nach Hause kommst.«
Er wischt sich den Mund ab, reibt sich das Gesicht, streckt die Hand nach der halb vollen Flasche aus und nimmt einen Schluck.
»Ja, es ist spät geworden. Hoffentlich bist du nicht aufgeblieben, um auf mich zu warten.«
»Nee, so weit kommt’s noch«, meint sein Vater. »Dann hätte ich in diesem Sessel schon viel Zeit verbracht.«
»War euer Abend nett?«, fragt Hermann vorsichtig.
»Nee«, antwortet sein Vater einsilbig.
»Ach, nein. Warum denn nicht?«
Sein Vater stöhnt erschöpft. Atmet stoßweise und schüttelt den Kopf.
»Deine Mutter ist den ganzen Abend hier rumgelaufen wie ein Tiger im Käfig. Wir haben’s langsam satt, dass du uns nicht sagst, wo du bist. Und dann war Herr Stern hier und wollte wissen, ob du mit Ilse aus bist.«
Letzteres ist eine Frage, das erkennt er am Tonfall in der Stimme. Hermann hatte vorgehabt zu sagen, dass er mit Ilse aus war. Dass sie im Kino gewesen und danach spazieren gegangen waren, dass sie die Zeit vergessen hatten. Das geht jetzt nicht. Er würde auffliegen.
»Ich bin doch in Frogner gewesen«, erklärt er. Plan B. »Das habe ich wohl vergessen zu sagen.«
Als Beweis hält er das Bild hoch: ein Aquarell, eine Landschaft in gedämpften Farben.
»Hast du das da gemalt?«
»Ja«, sagt Hermann. »Gefällt’s dir?«
Sein Vater schnaubt.
»Ich habe doch gesagt, ich verstehe nichts von Kunst. Und außerdem finde ich’s merkwürdig, so spät am Samstagabend noch Unterricht zu machen.«
Hermann sagt nichts. Er weiß nicht, was er sagen soll. Welche Erklärung er auch immer liefert, nie wäre sie überzeugend, sein Vater würde mit den üblichen Floskeln kommen: Welchen Sinn hatten solche Kunstsachen, warum interessierte sich Hermann mit einem Mal ausgerechnet für so was, war er denn nicht mehr zufrieden mit der Arbeit in der Brauerei, war er sich vielleicht etwa mit einem Mal zu fein dafür?
Den ganzen Sommer über hatte er sich den Kopf zerbrochen, wie er seinem Vater die Sache beibringen sollte. Zuerst hatte er Ilse davon erzählt. Er hatte den Eindruck, dass sie das spannend fand. Etwas seltsam vielleicht, dass er sein Talent verschwiegen hatte, aber vor allem schien es sie zu beeindrucken. Sein Vater hatte allerdings nicht so reagiert.
»Kunstmaler?«, rief er. »Sag mal, hab ich mich da gerade verhört? Du willst bei einem Kunstmaler in die Lehre gehen?«
Er spuckte die Wörter beinahe aus, fast, als seien sie Gift und er könne sie nicht schnell genug loswerden.
»Ja«, antwortete Hermann. »Ich habe schon immer Lust gehabt, malen zu lernen.«
Sein Vater starrte ihn mit offenem Mund an. Er rief nach der Mutter. Zeigte mit dem Finger auf Hermann, als handelte es sich bei ihm um ein seltenes, in einem Käfig ausgestelltes Tier.
»Der Junge will mit Kunstmalerei anfangen«, rief er und fuchtelte Hermann mit dem zitternden Zeigefinger vor der Nase herum. »Hörst du das, Ingeborg, er will mit Kunstmalerei anfangen!«
Seiner Mutter fiel auch die Kinnlade herunter, Hermann hätte genauso gut erzählen können, er hätte einen Mann erschossen oder würde eine Expedition zum Nordpol machen.
»Und wie stellste dir das vor, wie du das unter einen Hut kriegst?«, fragte sein Vater.
»Was meinst du damit?«
»Ich meine«, fuhr er höhnisch fort, »dass du dich um deine Arbeit zu kümmern hast. Wann hast du denn vor, auch noch Kunstmalerei zu machen?«
»Am Nachmittag«, antwortete Hermann. »Es ist drüben in Frogner.«
»Ach so, in Frogner«, sagte sein Vater in einem sarkastischen Ton. »Da hat man bestimmt Zeit für so was.«
»Ich habe nicht vor, deshalb die Arbeit zu vernachlässigen«, murmelte Hermann.
Aber er hatte seine Arbeit vernachlässigt. Mehrmals hatte er sich verspätet, war unkonzentriert und müde gewesen, nachdem er sich die ganze Nacht um die Ohren geschlagen hatte. Einmal hatte er bei einem Kasten den Griff verfehlt und vierundzwanzig Bierflaschen waren herausgefallen und zu Bruch gegangen. Er merkte, dass der Vorarbeiter ihn beobachtete, dass er misstrauisch war – und seine Eltern auch. Seine Mutter stellte sich ganz dicht neben ihn, schnupperte an seinem Atem. Sie hatten die bange Vermutung, dass er zu viel trank, dass da draußen im Westend nur gezecht wurde, dass das der Grund war, warum er abends nicht nach Hause kam.
Vater schlurft ins Schlafzimmer, macht die Tür hinter sich zu, sagt nicht »Gute Nacht«. Hermann macht sich in der Stube das Bett, legt das Laken aufs Sofa und holt die Bettdecke aus der blauen Kiste. Lange liegt er wach und starrt einen Riss in der Deckenfarbe an.
Wenn Isak hier gewesen war und nach Ilse gefragt hatte, konnte das nur eins bedeuten: Auch sie war nicht nach Hause gekommen. Vielleicht hatte sie auf ihn gewartet, er sieht sie vor sich, fragt sich, was sie denkt. Wenn er sie richtig einschätzt, dann sind ihre Gedanken bestimmt nicht gerade stubenrein. Sie konnte manchmal so übertreiben, sie hatte sich bestimmt jede Menge Geschichten zusammengereimt. Oder vielleicht hatte sie Angst um ihn gehabt, gedacht, ihm sei etwas zugestoßen. Ganz kurz wird ihm heiß bei der Vorstellung.
Er fragt sich, was er ihr beim nächsten Treffen sagen soll. Wie er die Sache retten kann, ohne dass Ilse allzu misstrauisch wird. So vieles muss er im Griff haben, die ganze Zeit so viele Versionen. Es kommt ihm so vor, als würde er eine Kommode mit unendlich vielen Schubladen mit sich herumschleppen und müsste immer aufpassen, welche Schublade er gerade aufzieht, welche er geschlossen hält. Er wird auch morgen nicht dazu kommen, mit ihr zu sprechen. Um zehn Uhr muss er wieder in Frogner zur Stelle sein, bei Einar Vindju. »Wir haben jetzt viel zu tun«, hatte Einar gesagt, bevor Hermann sich an diesem Abend auf den Weg machte.
Hermann war heute den ganzen Weg zu Fuß nach Frogner gegangen, die Luft war kalt und beißend, aber die Sonne schien, sie hing über der Stadt, trübe und fern, wärmte vorsichtig. Er erreichte das Eckhaus in der Fredrik Stangs gate, klingelte, dreimal kurz. Einar Vindju stand in der Tür, als er die Treppe hochkam. Die großen Glastüren zum Wohnzimmer standen offen: sein Atelier, voller Farbtuben, Pinsel und Staffeleien, leerer Leinwände und Gemälde, die zum Trocknen auf den Boden gestellt waren. Der Gestank von Chemikalien stach in der Nase. Die große Wohnung, der Ort war perfekt. »Nebenan wohnen schwerhörige alte Tanten«, hatte Einar an einem der ersten Tage gesagt, »und sie lieben mich.«
Hermann hatte von der Verabredung zum Kino um fünf Uhr erzählt.
»Aha«, sagte Einar und pustete Rauchringe ins Zimmer. »Mit der jungen Ilse Stern?«
Hermann nickte.
»Ja«, antwortete er und schob die Hand in die Jackentasche, wie um sich zu vergewissern, dass er die Eintrittskarten bei sich hatte.
Warum hatte er das eigentlich getan, die Eintrittskarten gekauft? Er hatte eine Eingebung gehabt, hatte nicht nachgedacht, sich einfach in die Warteschlange eingereiht und bezahlt. Ilse wollte so gern ins Kino gehen, er auch, er wollte sich nur in einen Sessel setzen, in etwas versinken, was nichts mit ihm zu tun hatte. Jetzt stecken die Karten ungenutzt in derselben Jackentasche und er ist in Erklärungsnot und mit den Nerven fertig. Er darf sich jetzt nicht in noch mehr verstricken, es ist jetzt schon schlimm genug. Er kann niemanden so nah an sich heranlassen, das halten seine Nerven nicht aus, damit hätte er zu viel im Griff zu behalten, zu viele lose Enden, zu viele Schubladen in der verfluchten Kommode, die geschlossen bleiben müssen. Der Sommer war so schön gewesen. Ilse und er draußen im Hinterhof. Aber jetzt, jetzt ist Herbst, alles ist jetzt anders. Jetzt passt es nicht. Er hat genug mit sich selbst zu tun. Mehr als genug, genau genommen.
Er muss immer daran denken, wie Ilse sich bei ihrer nächsten Begegnung wahrscheinlich verhalten wird. Er schließt die Augen und sieht sie vor sich. Das dunkle Haar, den Hals, den Körper, die Stupsnase, die er so mag. Sie wird wütend auf ihn sein und er wird sich wie immer damit abfinden müssen, wie ein Schwein auf der Schlachtbank zu liegen. Er dreht sich um, zieht die Decke über den Kopf, hört seinen Atem, kurz und stoßweise. Nie hätte er gedacht, dass die Sache so anstrengend werden würde, als man ihn gefragt hatte, ob er mitmachen wolle. Er war so entschlossen, so wütend gewesen, zum Teufel, hatte er gedacht. Jetzt würde er am liebsten aus der Rolle des unzuverlässigen, gedankenlosen Zechbruders und Möchtegernkünstlers aussteigen. Er sehnt sich nach einer verdammten Kommodenschublade, nur einer, die immer offen steht. Es macht ihn im Grunde seines Herzens fertig, Hermann Rød zu sein. Und morgen würde es einfach so weitergehen. Und am nächsten Tag und am übernächsten auch. Aber wie lange noch, fragt er sich, wie er da liegt mit dem Gesicht zur Wand, wie lange lohnt sich das noch?
Alles ist weiß.
Ilse hat keine Schuhe an. Der Schnee reicht ihr bis zu den Knien. Sie steht nur im Nachthemd draußen und spürt, wie der kalte Wind durch den dünnen Stoff weht, auf ihren Körper trifft wie Stecknadeln – klein und spitz. Sie sieht die anderen; verschwommene Gestalten in der weißen Landschaft, weich und zerfließend, sie sind warm angezogen. Mutter, Vater, Sonja und Miriam. Sie ruft nach ihnen, ruft, dass sie stehen bleiben sollen, dass sie auf sie warten müssen. Sie hören sie nicht, drehen sich nicht um. Sie gehen einfach weiter geradeaus, weg von ihr, auf ein schwaches gelbliches Licht zu. Es gleicht einem Scheiterhaufen, der kurz vorm Erlöschen ist. Ihre Rücken, sie verschwinden vor ihren Augen, werden von dickem, qualmendem Rauch verschluckt.
»Ilse?«





























