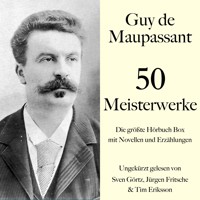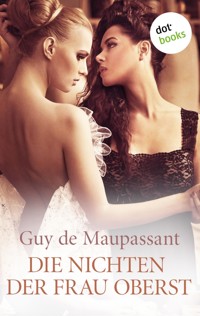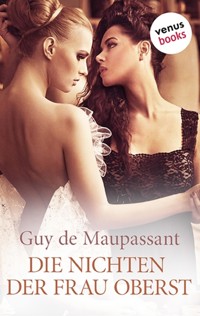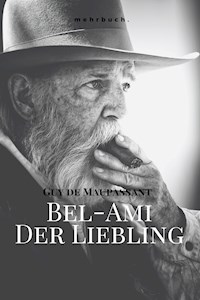
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
mehrbuch-Weltliteratur! eBooks, die nie in Vergessenheit geraten sollten. Der mittelmäßig begabte Journalist Georges Duroy bezaubert die Damen der Pariser Gesellschaft mit seinem Charme und seinem attraktiven Äußeren. Zahlreiche Geliebte und zwei Ehefrauen ermöglichen es ihm, Reichtum und Ansehen zu erlangen. Sein intrigenreicher Aufstieg in die höchsten sozialen und politischen Sphären ist unaufhaltsam.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 533
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
0,0
Bewertungen werden von Nutzern von Legimi sowie anderen Partner-Webseiten vergeben.
Legimi prüft nicht, ob Rezensionen von Nutzern stammen, die den betreffenden Titel tatsächlich gekauft oder gelesen/gehört haben. Wir entfernen aber gefälschte Rezensionen.
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Erster Teil
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
Zweiter Teil
I
II.
III.
IV.
V
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
I.
Die Kassiererin gab auf sein 5-Francs-Stück das Geld heraus und Georges Duroy verließ das Lokal. Stattlich gewachsen, richtete er sich auf mit der Haltung eines ehemaligen Unteroffiziers und drehte schneidig-militärisch seinen Schnurrbart zwischen den Fingern. Er warf auf die übriggebliebenen Gäste einen schnellen, flüchtigen Blick; einen jener Blicke des schönen Burschen, die unfehlbar treffen, wie der Raubvogel seine Beute.
Die Frauen blickten ihm neugierig nach: es waren drei kleine Nähmädchen, eine Musiklehrerin unbestimmten Alters, schlecht gekämmt, nachlässig gekleidet mit einem alten, verstaubten Hut und einem Kleid, das niemals sitzen wollte. Dazu zwei bürgerliche Frauen mit ihren Männern, Stammgäste des kleinen Lokals mit »festen Preisen«.
Auf der Straße blieb er einen Augenblick stehen und überlegte, was er unternehmen sollte. Es war der 28. Juni — in der Tasche blieben ihm 3 Francs 40 Centimes für den Rest des Monats übrig. Dafür konnte er sich zwei Mittagessen leisten, dann allerdings kein Frühstück, oder umgekehrt. Er überlegte sich, daß ein Frühstück nur 22 Sous, ein Mittagessen dagegen 30 kostete. Begnügte er sich bloß mit dem Frühstück, so würden ihm 1 Francs 20 Centimes verbleiben, das bedeutete zweimal Würstchen mit Brot und zwei Glas Bier auf dem Boulevard. Dies war sein kostspieliges Vergnügen, das er sich abends gönnte.
Daraufhin ging er die Rue Notre-Dame de Lorette hinunter.
So schritt er dahin, wie zur Zeit, als er die Husarenuniform trug, in strammer Haltung mit etwas gespreizten Beinen, wie ein Reiter, der eben vom Pferde gestiegen ist. Ohne auf jemand Rücksicht zu nehmen, ging er seinen Weg durch die Straßenmenge. Er stieß die Passanten und wollte niemandem ausweichen. Seinen alten Zylinderhut rückte er etwas auf das eine Ohr, und laut klangen seine Schritte auf dem Pflaster. Verächtlich und herausfordernd betrachtete er die Menschen, die Häuser, die ganze Stadt: er — der schicke, schneidige Soldat, der zufällig Zivilist war.
Sein fertiggekaufter Anzug kostete nur 60 Francs, trotzdem trug er eine gewisse betont knallige Eleganz zur Schau; etwas ordinär, dafür echt und eindrucksvoll. Groß und schön gewachsen, hatte er dunkelblondes, rötliches, von Natur krauses Haar, das in der Mitte gescheitelt war; mit einem kecken Schnurrbart, der sich auf seiner Oberlippe kräuselte, und hellen, blauen Augen mit kleinen Pupillen, sah er dem Mordskerl aus einem Hintertreppenroman ähnlich.
Es war ein heißer Sommertag. Kein frischer Luftzug regte sich in Paris. Die Stadt glühte wie ein Kessel und erstickte in der schwülen Nacht. Die Straßenkanäle hauchten üblen Duft aus ihren Granitrachen, und aus den Küchen und Kellerräumen drangen ekle Gerüche von Spülwasser und alten Speiseresten auf die Straße.
Unter den Haustoren saßen die »concierges« (Hauswarte) in Hemdsärmeln rittlings auf ihren Strohsesseln und rauchten die Pfeife. Träge schlichen die Menschen dahin, mit entblößtem Kopf, den Hut in der Hand tragend.
Als Georges Duroy den Boulevard erreichte, blieb er stehen, unschlüssig, was er nun tun sollte. Er hatte Lust, in die Champs Elysée und die Avenue du Bois de Boulogne zu gehen, um unter den Bäumen etwas frische Luft zu schöpfen.
Aber ein anderes Verlangen regte sich in ihm, und zwar nach einem Liebesabenteuer. Wie ihm so ein Abenteuer in den Weg laufen sollte, davon hatte er keine Ahnung, aber seit drei Monaten wartete er darauf jeden Tag und jeden Abend. Dank seiner schönen, stattlichen Erscheinung hatte er wohl hier und da ein bißchen Liebe kosten dürfen; genügen tat ihm das nicht, er hoffte immer auf mehr und auf Besseres.
Mit heißem Blut aber leerer Tasche erregten ihn die Dirnen, die ihm an den Straßenecken zumurmelten: »Komm mit, feiner Junge«, doch er getraute sich nicht, ihnen zu folgen, denn bezahlen konnte er sie nicht, und dann träumte er auch von anderem, von etwas vornehmerer Liebe und minder gemeinen Küssen.
Trotzdem liebte er die Orte, wo es von jenen öffentlichen Mädchen wimmelte; er suchte gern ihre Ballokale, ihre Cafés, ihre Straßen auf. Er liebte, sie anzusprechen, sie zu duzen, ihre aufdringlichen Parfüms einzuatmen und ihre Nähe zu fühlen. Sie waren doch schließlich Frauen; Frauen, die zur Liebe bestimmt waren. Verachten tat er sie nicht, so wie jeder Mann sie verachtete, der im Schoß der Familie aufgewachsen ist.
Er lenkte seine Schritte nach der Madeleinekirche und folgte dem Menschenstrom, der sich, von der Hitze bedrückt, schwerfällig dahinwälzte.
Die Cafés waren überfüllt, dichtgedrängt saßen die Menschen am Bürgersteig, im grellen, blendenden Licht der erleuchteten Fenster. Vor ihnen auf kleinen runden oder viereckigen Tischen standen Gläser mit roten, gelben, grünen und in allen Farben schillernden Flüssigkeiten, und in den Karaffen sah man große, durchsichtige Eisstücke glänzen, die das schöne, klare Wasser kühlten.
Duroys Schritte wurden langsamer, und das Verlangen nach einem erfrischenden Getränk trocknete ihm die Kehle. Ihn packte ein glühender Durst, ein Durst eines heißen Sommerabends; er dachte immerfort an das köstliche Gefühl, wenn ihm etwas Kaltes durch die Kehle rinnt. Wenn er sich aber heute auch nur zwei Glas Bier gestattete, dann war es morgen mit seinem kargen Abendbrot vorbei, und die Stunden des Hungers am Monatsende waren ihm nur zu wohl bekannt.
Er sagte sich: »Bis zehn Uhr muß ich aushalten, und dann trinke ich einen Bock à l'Americain. Donnerwetter, habe ich jetzt einen Durst!« Und er blickte all diese Menschen an, die an den Tischen saßen, tranken und ihren Durst löschen konnten, soviel sie wollten. Und während er äußerlich keck und zuversichtlich an den Cafés vorüberging, taxierte er mit raschem Blick nach dem Aussehen und der Kleidung eines jeden Gastes, wieviel Geld er wohl mit sich trug. Eine Wut ergriff ihn gegen diese ruhig dasitzenden Leute. Wenn man ihre Taschen durchsuchte, so würde man Gold, Silber und Kleingeld finden. Durchschnittlich mußte jeder wohl zwei Zwanzigfrancsstücke bei sich haben, etwa hundert Menschen saßen in jedem Café, und hundertmal zweimal zwanzig macht viertausend Francs. »Schweinehunde!« murmelte er vor sich hin und ging mit wiegenden Schritten weiter. Hätte er nur einen an irgendeiner dunklen Straßenecke fassen können, würde er ihm weiß Gott ohne Bedenken den Hals umgedreht haben, wie er es mit den Dorfhühnern an den Tagen der großen Manöver tat.
Er dachte an seine zwei Dienstjahre in Afrika und an die Art und Weise, wie man in den kleinen Vorposten im Süden den Arabern das Geld abnahm. Ein grausames, zufriedenes Lächeln glitt über seine Lippen, als er eines Streiches gedachte, der drei Männern vom Stamme der Uled-Alan das Leben kostete und ihm und seinen Kameraden zwanzig Hühner, zwei Schafe und Gold einbrachte und heiteren Gesprächsstoff für sechs Monate.
Die Schuldigen waren nie entdeckt worden, man hatte sie auch freilich nie gesucht, da der Araber sozusagen als natürliche Beute der Soldaten galt.
In Paris war das anders. Hier konnte man nicht mit dem Säbel an der Seite und dem Revolver in der Faust, fern vom wachsamen Auge der bürgerlichen Gerichtsbarkeit, in voller Freiheit herumplündern.
Wahrhaftig, er dachte mit Wehmut an diese zwei Jahre in der Wüste zurück. Wie schade, daß er nicht da unten geblieben war! Er hatte sich Besseres erhofft, als er heimkehrte. Und nun ... Ach ja, jetzt hatte er, was er wollte!
Er schnalzte mit der Zunge, als wollte er konstatieren, wie völlig ausgedörrt sein Mund schon wäre.
Langsam und müde schob sich die Menge an ihm vorüber, und er dachte immer noch: »Dieses Pack! All diese Idioten haben Geld in der Westentasche!« Er rempelte die Menschen an und pfiff dazu eine lustige Melodie. Männer, die er geschubst hatte, drehten sich schimpfend um, und die Frauen riefen entrüstet: »Ungezogener Lümmel!« Er ging am Vaudeville vorbei und blieb vor dem Café Americain stehen. Er fragte sich, ob er nicht doch ein Glas Bier trinken sollte, so quälte ihn der Durst. Ehe er sich entschloß, sah er auf die beleuchtete Uhr mitten auf dem Fahrdamm. Es war ein Viertel nach neun. Er kannte sich zu genau: sobald das Glas Bier vor ihm stünde, würde er es mit einem Zug hinunterschlucken. Was sollte er dann bis elf Uhr anfangen?
Er überlegte: »Ich gehe noch bis zur Madeleine und kehre dann langsam zurück.«
Als er an die Ecke des Place de l'Opera kam, begegnete er einem dicken jungen Manne, dessen Gesicht ihm irgendwie bekannt erschien.
Er folgte ihm und suchte sich zu erinnern, während er halblaut vor sich hinsprach: »Zum Teufel, wo kenne ich diesen Kerl her?«
Er ging und grübelte, ohne daß es ihm einfiel; dann plötzlich erschien ihm derselbe Mensch durch einen eigentümlichen Vorgang des Gedächtnisses weniger dick, jünger, in Husarenuniform. »Halt, Forestier!« rief er laut, beschleunigte seine Schritte und klopfte dem vor ihm Gehenden auf die Schulter. Dieser wandte sich um, blickte ihn an und sagte:
»Was wünschen Sie, mein Herr?«
Duroy lachte: »Erkennst du mich nicht?«
»Nein.«
»George Duroy von den 6. Husaren.«
Forestier streckte ihm beide Hände entgegen: »Du bist es, Alter! Wie geht es dir?«
»Ausgezeichnet. Und dir?«
»Mir geht es nicht allzu gut. Denke dir, meine Brust ist wie aus Papiermaché. Sechs Monate im Jahr quält mich ein Husten, die Folge einer Bronchitis, die ich mir in Bougival geholt habe kurz nach meiner Rückkehr nach Paris. Es sind jetzt schon vier Jahre her.«
»So, du siehst aber ganz gesund aus.«
Forestier nahm seinen alten Kameraden am Arm und erzählte ihm von seiner Krankheit, von den Ärzten, die er konsultiert hatte, deren Meinungen und Ratschlägen und der Schwierigkeit, in seiner Stellung ihren Verordnungen zu folgen. Er sollte den Winter im Süden zubringen, aber wie konnte er das? Er war verheiratet, Journalist, und hatte eine gute Stellung. »Ich redigiere den politischen Teil in La Vie Française, ich schreibe die Senatsberichte für den ‘Salut’, und im ‘Planete’ erscheinen hin und wieder literarische Feuilletons von mir. Ich habe meinen Weg gemacht.«
Duroy war überrascht und sah ihn erstaunt an. Forestier hatte sich sehr verändert, er war reifer geworden. Sein Gebaren, seine Haltung zeigten den gesetzten, selbstsicheren Mann und sein Bäuchlein wußte von guten Diners zu erzählen. Früher war er mager, klein und schlank, ein ausgelassener Lebemann und streitsüchtiger Radaumacher, stets angeheitert. Die drei Jahre in Paris hatten aus ihm einen ganz anderen, einen beliebten und ernsthaften Menschen gemacht, der schon einige weiße Haare an den Schläfen hatte, obgleich er nicht mehr als siebenundzwanzig Jahre zählte.
Forestier fragte: »Wo gehst, du hin?«
Duroy antwortete: »Nirgends. Ich mache einen Spaziergang, bevor ich nach Hause gehe.«
»Weißt du was, willst du mich vielleicht nach der Vie Française begleiten? Ich habe noch ein paar Korrekturen zu erledigen. Dann wollen wir zusammen ein Glas Bier trinken?«
»Sehr gern.«
Und Arm in Arm gingen sie weiter mit der leichten Vertraulichkeit, die zwischen Schulkameraden und Waffengefährten herrscht.
»Was machst du in Paris?« fragte Forestier.
Duroy zuckte die Achseln: »Kurz gesagt, ich krepiere vor Hunger. Als meine Dienstzeit vorbei war, wollte ich hierher kommen, um ... um mein Glück zu machen, oder vielmehr, um in Paris leben zu können. Seit sechs Monaten bin ich bei der Verwaltung der Nordbahn angestellt. Ich verdiene fünfzehnhundert Francs im Jahr, keinen Centime mehr.«
Forestier murmelte: »Zum Teufel, das ist nicht viel!«
»Das glaube ich. Aber was soll ich sonst anfangen? Ich bin allein, ich kenne niemanden und habe keine Protektion. An gutem Willen fehlt es mir schon nicht, aber die Mittel?«
Sein Freund betrachtete ihn vom Kopf bis zu den Füßen, wie ein praktischer Mensch, der einen Gegenstand abschätzt; dann versetzte er in überzeugtem Ton:
»Sieh mal, mein Junge, hier hängt alles von deinem Auftreten ab. Ein findiger Kopf bringt es hier leichter bis zum Minister als bis zum Bureauchef. Man muß sich aufdrängen und nicht schüchtern bitten. Aber wie, zum Henker, kommt es, daß du nichts Besseres gefunden hast als eine Stelle bei der Nordbahn?«
»Ich habe überall gesucht«, erwiderte Duroy, »und nichts gefunden. Augenblicklich habe ich zwar etwas in Aussicht, man bietet mir eine Stelle als Stallmeister in der Reitbahn von Pellerin an. Da bekomme ich mindestens dreitausend Francs.«
Forestier blieb plötzlich stehen:
»Tu das nicht. Das ist dumm, wo du doch zehntausend Francs verdienen könntest. Du verschließt dir mit einem Schlage die Zukunft. In deiner Schreibstube bist du wenigstens versteckt, niemand kennt dich, und wenn du dich stark genug fühlst, kannst du eines schönen Tages auch von dort aus Karriere machen. Aber wenn du Stallmeister bist, dann ist alles aus. Du kannst geradesogut Oberkellner in einem Restaurant werden, wo ganz Paris verkehrt. Wenn du erst einmal Leuten der Gesellschaft oder ihren Söhnen Reitunterricht gegeben hast, dann könnten sie sich nicht mehr daran gewöhnen, dich als ihresgleichen zu betrachten.«
Er schwieg, dachte einige Sekunden nach und fragte:
»Hast du das Abiturium gemacht?«
»Nein, ich bin zweimal durchgefallen.«
»Das tut nichts, wenn du deine Studien nur einigermaßen zu Ende geführt hast. Wenn von Cicero oder Tiberius die Rede ist, dann weißt du ungefähr, wer das ist?«
»Ja, ungefähr.«
»Gut, mehr weiß überhaupt niemand, mit Ausnahme von einem Dutzend Dummköpfen, die nicht imstande sind, sich selbst zu helfen. Jedenfalls ist es nicht schwer, als intelligent und gebildet zu gelten. Man darf sich nur nicht bei einer offenbaren Unwissenheit erwischen lassen. Man dreht und wendet sich, man weicht dem Hindernis aus, umgeht es und bewältigt das andere mit Hilfe eines Konversationslexikons. Alle Menschen sind dumm wie die Gänse und unwissend wie Karpfen.«
Er sprach in ruhig spöttischem Tone, wie einer, der die Welt kennt und blickte dabei lächelnd auf die vorübergehende Menge. Plötzlich aber begann er zu husten und blieb stehen, bis der Anfall vorüber war. Dann fuhr er in mutlosem Ton fort:
»Ist es nicht entsetzlich, daß ich diese Bronchitis nicht los werde? Und jetzt sind wir mitten im Hochsommer. Oh! Im Winter geh ich nach Menton, um mich auszukurieren. Mag kommen, was will, meine Gesundheit geht mir über alles.«
Sie waren jetzt am Boulevard Poissonière und standen vor einer großen Glastür, die von innen mit einer Zeitung beklebt war. Drei Leute waren stehengeblieben, um das Blatt zu lesen.
Über dem Tor stand in großen Buchstaben aus Gasflammen der Name der Zeitung: »La Vie Française« geschrieben. Und die Passanten, die plötzlich in das grelle Licht dieser drei Worte traten, wurden nun auf einmal deutlich sichtbar wie am hellichten Tage, um dann sofort wieder im Dunkel zu verschwinden.
Forestier öffnete die Tür:
»Geh rein«, sagte er.
Duroy ging hinein, stieg eine pomphafte, schmutzige Treppe hinauf, die man von der Straße aus ganz überblicken konnte, ging durch das Vorzimmer, in dem zwei Bureaudiener seinen Gefährten grüßten, bis er in einen Warteraum gelangte. Die Räume waren verstaubt und abgenutzt, mit Tapeten aus schmutzigem, unechtem, grünem Samt, die voller Flecken und hier und da durchlöchert waren, als hätten die Mäuse sie angeknabbert.
»Setz dich,« sagte Forestier, »ich bin in fünf Minuten wieder da.«
Und er verschwand hinter einer der drei Türen, die aus diesem Zimmer führten.
Der seltsame, eigentümliche, unbeschreibliche Geruch eines Redaktionsbureaus erfüllte den Raum. Duroy blieb unbeweglich, etwas eingeschüchtert und überrascht sitzen.
Von Zeit zu Zeit liefen Leute an ihm vorbei; sie kamen aus einer Tür und verschwanden durch die andere, noch ehe er Zeit hatte, sie anzusehen. Bald waren es junge, sehr junge Leute mit geschäftigem Gesichtsausdruck, die in der Hand ein Blatt Papier trugen, das bei ihrem Laufen im Winde flatterte. Manchmal waren es auch Setzer, unter deren von Tinte beschmutzten Leinenkitteln man reinweiße Hemdkragen und eine elegante Tuchhose von modernem Schnitt sah. Vorsichtig trugen sie bedruckte Papierstreifen, frische, noch feuchte Korrekturfahnen. Bisweilen trat ein kleiner Herr mit einer etwas auffallenden Eleganz, mit einer etwas zu engen Taille, mit Beinkleidern, die zu eng anlagen, und mit übermäßig spitzen Schnabelschuhen, ein, irgendein Reporter, der Neuigkeiten aus der Lebewelt brachte. Auch andere kamen, ernste, gewichtige Persönlichkeiten. Sie trugen Zylinderhüte mit ganz flachen Rändern, als ob sie sich durch diese Form von der ganzen übrigen Menschheit unterscheiden wollten.
Forestier erschien wieder, Arm in Arm mit einem hochgewachsenen, mageren Mann in den dreißiger Jahren. Dieser war in einen Frack, mit weißer Krawatte, gekleidet, hatte dunkles Haar, einen Schnurrbart mit scharfgedrehten Spitzen und eine dreiste, selbstbewußte Miene. Forestier sagte zu ihm:
»Adieu, verehrter Meister!«
Der andere drückte ihm die Hand: »Auf Wiedersehen, mein Lieber!« und stieg dann, einen Spazierstock unter dem Arm, pfeifend die Treppe hinab.
»Wer ist das?« fragte Duroy.
»Jaques Rival — du weißt doch? — der berühmte Chronist und Duellant. Er hat eben seine Korrektur durchgelesen. Garin, Montel und er gelten augenblicklich als die geistvollsten und wirksamsten Feuilletonisten in ganz Paris. Für zwei Artikel, die er wöchentlich schreibt, verdient er bei uns jährlich dreißigtausend Francs.
Beim Weitergehen begegneten sie einem kleinen dicken Herrn mit langen Haaren und unsauberem Äußeren, der schweratmend die Treppe hinaufkam.
Forestier grüßte sehr tief:
»Norbert de Varenne,« sagte er, »der Dichter der ,Erloschenen Sonne', auch ein hochbezahlter Mann. Jede Erzählung, die er herausgibt, kostet dreihundert Francs und die allerlängsten haben noch nicht zweihundert Zeilen ...
Aber komm jetzt ins Café Napolitain, ich sterbe vor Durst!«
Kaum hatten sie sich an den Tisch gesetzt, als Forestier rief: »Zwei Bier!« und dann sein Glas mit einem Zuge herunterstürzte, während Duroy das Bier mit langsamen Schlucken trank und sorgsam auskostete, wie eine wundervolle und seltene Kostbarkeit. Sein Gefährte schwieg, er schien nachzudenken und fragte dann plötzlich:
»Warum willst du es nicht mit dem Journalismus versuchen?«
Der andere blickte ihn überrascht an, dann sagte er:
»Aber... das ist ... ich habe doch noch nie etwas geschrieben.«
»Ach was, man versucht es, man fängt an. Ich könnte dich zum Beispiel gebrauchen, um Erkundigungen einzuziehen und um Besuche zu machen. Du bekämst zu Anfang zweihundertfünfzig Francs und die Droschken bezahlt. Soll ich mit dem Chef sprechen?«
»Aber natürlich möchte ich das, sehr gerne.«
»Also dann sei so gut und komme morgen zu mir zum Essen. Es werden nur fünf oder sechs Personen sein: der Chef, Herr Walter, seine Frau, Jaques Rival und Norbert de Varenne, die du ja soeben gesehen hast, und schließlich noch eine Freundin meiner Frau. Also abgemacht?«
Duroy zögerte, errötete und wurde verwirrt. Endlich murmelte er:
»Es ist nur ... ich habe keinen passenden Anzug ...«
Forestier war starr.
»Was? Du hast keinen Frack? Teufel noch mal! Das ist doch etwas Unentbehrliches! In Paris kann man ein Bett vielleicht entbehren, einen Frack nie. Dann griff er plötzlich in seine Westentasche, zog eine Handvoll Geld hervor und legte zwei Zwanzigfrancsstücke vor seinen alten Freund hin, wobei er in einem herzlichen und vertrauten Ton sagte:
»Du gibst sie mir wieder, wenn du kannst. Leihe oder kaufe dir die nötigen Kleidungsstücke, indem du eine Anzahlung gibst. Jedenfalls erwarte ich dich morgen um halb acht in. meiner Wohnung, 17 Rue Fontaine, zu Tisch.«
Duroy war verwirrt, aber er nahm das Geld und stammelte:
»Du bist wirklich zu liebenswürdig, ich danke dir herzlich ... Verlaß dich darauf, ich werde es nie vergessen.«
»Gut, gut!« fiel ihm der andere ins Wort. »Nicht wahr, wir trinken noch ein Bier?« Und er rief: »Kellner, noch zwei Bock!«
Dann, als sie ausgetrunken hatten, fragte der Journalist:
»Willst du noch ein Stündchen bummeln?«
»Aber gewiß!«
Und sie brachen auf und gingen in der Richtung nach Madeleine.
»Was sollen wir tun?« fragte Forestier. »Man sagt, in Paris hat man stets was zu tun, wenn man bummelt. Das ist nicht wahr. Wenn ich abends bummeln will, weiß ich nie, wohin ich gehen soll. Eine Fahrt ins Bois macht nur Spaß, wenn noch ein Weib dabei ist, und da hat man nicht immer eins bei der Hand. Die Cafés mit Musik mögen meinen Drogisten mit seiner Frau zerstreuen, mich nicht. Was also tun? Nichts! Man müßte hier einen Sommergarten haben, wie den Park Monceau, der nachts geöffnet wäre, wo man ausgezeichnete Musik hörte und unter den Bäumen Erfrischungen nehmen könnte. Das wäre kein eigentliches Vergnügungslokal, aber ein Ort, wo man sich behaglich aufhalten könnte. Man müßte hohe Eintrittspreise nehmen, um hübsche Damen herbeizulocken. Man sollte da auf kiesbestreuten Fußwegen herumspazieren können, die elektrisch beleuchtet wären, und sich setzen können, wenn man Lust hätte, um von fern und nah Musik anzuhören. So etwas gab es früher bei Muzard, aber das war zu sehr Ballokal, zuviel Tanzmusik und zuwenig Platz, zuwenig Schatten und Dunkelheit. Es müßte ein sehr schöner, sehr großer Garten sein. Das wäre herrlich! ... Also, wo willst du hin?«
Duroy war noch immer verlegen und wußte nicht, was er vorschlagen sollte. Endlich entschloß er sich:
»Ich kenne die Folies Bergère noch gar nicht, da möchte ich ganz gern einmal hin.«
»Donnerwetter!« rief Forestier, »die Folies Bergère? Da werden wir ja kochen wie im Backofen. Aber meinetwegen, es ist dort immer lustig.«
Sie gingen wieder zurück, um die Rue du Faubourg-Montmartre zu erreichen.
Die erleuchtete Fassade des Theaters warf grellen Schein auf die vier Straßen, die sich an dieser Stelle kreuzten. Eine Reihe von Droschken wartete auf den Schluß der Vorstellung.
Forestier ging hinein, Duroy hielt ihn zurück:
»Wir haben ja noch keine Billetts.«
Worauf der andere sehr selbstbewußt erwiderte:
»Wenn ich dabei bin, braucht man nicht zu bezahlen.«
Als er sich den drei Kontrolleuren näherte, grüßten sie ihn, und dem mittelsten reichte er die Hand. Der Journalist fragte: »Haben Sie noch eine gute Loge frei?«
»Aber gewiß, Herr Forestier.«
Er nahm den Zettel, der ihm gereicht wurde, öffnete die gepolsterte, kupferbeschlagene Tür, und sie befanden sich im Theaterraum.
Tabakdunst verschleierte wie ein leichter Nebel den Hintergrund, die Bühne und die entfernten Teile des Theaters. Dieser Nebel, der ununterbrochen in feinen bläulichen Streifen aus sämtlichen Zigarren und Zigaretten der Besucher emporstieg, ballte sich an der Decke und bildete unter der mächtigen Wölbung einen Wolkenhimmel von Rauch um den Kronleuchter und über der dicht mit Zuschauern besetzten Galerie.
In der geräumigen Vorhalle am Eingang, die zu den Wandelgängen führte, schweiften aufgeputzte Mädchen inmitten einer Menge dunkelgekleideter Männer umher, eine Gruppe von Frauen wartete auf die Ankömmlinge, und hinter den drei Schanktischen thronten drei geschminkte, welke Verkäuferinnen von Getränken und Liebe. In den hohen Scheiben hinter ihnen spiegelten sich ihre Rücken und die Gesichter der Vorübergehenden.
Forestier drängte sich schnell durch alle diese Gruppen und schritt rasch vorwärts, wie ein Mann, auf den man Rücksicht zu nehmen hat. Er trat an die Logenschließerin heran und sagte:
»Loge siebzehn!«
»Bitte, hier, mein Herr!«
Sie wurden in einen kleinen hölzernen Kasten eingeschlossen, der keine Decke hatte, rot tapeziert war und vier Stühle gleicher Farbe enthielt, die so eng aneinander standen, daß man sich kaum zwischen ihnen hindurchschieben konnte. Die beiden Freunde setzten sich. Nach rechts und links schlossen sich in weitem Bogen, dessen Enden auf die Bühne stießen, eine lange Reihe ähnlicher Kästen an, wo gleichfalls Menschen saßen, von denen man nur Kopf und Brust sehen konnte.
Auf der Bühne machten drei junge Männer in eng anliegenden Trikots, ein großer, ein mittlerer und ein ganz kleiner, abwechselnd Trapezkunststücke. Zunächst trat der große mit kurzen, schnellen Schritten an die Rampe vor, lächelte und grüßte mit einer Kußhand. Unter dem Trikot sah man die Muskeln seiner Arme und Beine arbeiten; er drückte seine Brust möglichst kräftig heraus, um seinen etwas zu dicken Bauch zu verbergen. Sein Gesicht glich dem eines Friseurgehilfen, und ein tadelloser Scheitel teilte sein Haar genau in der Mitte des Kopfes. Mit graziösem Sprung faßte er das Trapez und umkreiste es dann, mit den Händen daran hängend, wie ein rollendes Rad. Bisweilen hing er mit ausgestreckten Armen und steifem Körper unbeweglich wagerecht in der leeren Luft, indem er sich allein durch die Kraft seiner Handgelenke festhielt. Dann sprang er ab, grüßte nochmals lächelnd unter dem lauten Beifall des Parketts und trat wieder an die Wand zurück und zeigte bei jedem Schritt dem Publikum das Spiel seiner Muskeln.
Duroy hatte wenig Interesse für die Darbietung. Er wandte seinen Kopf und beobachtete unaufhörlich die hinter ihm vorbeiflutende Menge von Männern und Kokotten.
Forestier sagte: »Sieh dir mal die Leute im Parkett an, nichts als Spießbürger mit ihren Frauen und Kindern, alles brave, dumme Gesichter, die sich das hier ansehen wollen. In den Logen sitzen die Stammgäste der Boulevards, einige Künstler und Halbweltdamen, hinter uns findest du die seltsamste Mischung, die es in Paris geben kann. Was das für Männer sind? Beobachte sie mal: alles mögliche, alle Berufe und Klassen, aber das Gesindel überwiegt. Da sind die Kommis, Bankangestellte, Beamte, Verkäufer, ferner Reporter, Zuhälter, Offiziere in Zivil, Bummler im Frack, die grade im Restaurant gegessen haben und von der Großen Oper zu den Italienern rennen, und schließlich noch eine ganze Menge verdächtiger Individuen, aus denen man nicht recht klug wird. Was die Frauen angeht, so gibt es hier nur eine Art: die Halbwelt vom Americain. Sie verkaufen sich für ein oder zwei Goldstücke, wobei sie von Fremden auch fünf nehmen, und winken ihren ständigen Kunden zu, wenn sie frei sind. Man kennt sie alle seit zehn Jahren, man sieht sie jeden Abend das ganze Jahr hindurch in denselben Lokalen, mit Ausnahme, wenn sie einmal eine heilsame Kur im Frauengefängnis von St. Lazare oder im Lourcine durchmachen.«
Duroy hörte nicht mehr zu. Eins von diesen Mädchen lehnte sich über die Loge und sah ihn an. Es war eine üppige Brünette mit weißgeschminktem Gesicht und schwarzen Augen, die mit dem Farbstift unterstrichen waren, und riesigen, angemalten Augenbrauen. Über ihrer allzu starken Brust spannte sich die dunkle Seide ihres Kleides, und ihre geschminkten, blutroten Lippen gaben ihr etwas Tierisches, Sinnliches, Wildes, das aber trotzdem anziehend wirkte.
Sie winkte mit einer Kopfbewegung einer ihrer Freundinnen zu, die gerade vorbeikam, einer ebenfalls korpulenten, rothaarigen Kokotte, und sprach zu ihr so laut, daß man es hören konnte:
»Sieh mal her, das ist ein hübscher Junge. Wenn er mich für zweihundert Francs haben wollte, ich würde nicht nein sagen.«
Forestier drehte sich um und schlug Duroy lächelnd auf die Schenkel: »Das gilt dir, du hast Erfolg, mein Lieber, ich gratuliere!«
Der frühere Unteroffizier wurde rot und mechanisch tastete er nach den zwei Goldstücken in seiner Westentasche. Der Vorhang fiel und das Orchester begann einen Walzer zu spielen.
Duroy fragte: »Wollen wir nicht auch einmal durch den Wandelgang gehen?«
»Wie du willst.«
Sie verließen ihre Loge und waren sofort von dem Strom der Menge umgeben. Gedrückt, gepreßt, hin und her gestoßen, gingen sie weiter und ein Wald von Hüten wogte vor ihren Augen. Zwischen Ellenbogen, Brüsten und Rücken der Männer drängten sich behend paarweise die Kokotten hindurch, die sich hier so recht in ihrem Element, wie Fische im Wasser, zu fühlen schienen.
Duroy war entzückt. Er ließ sich treiben und wurde von der stickigen Luft, die durch Tabak, Menschenausdünstungen und Dirnenparfüms verpestet war, berauscht. Aber Forestier schwitzte, keuchte und hustete.
»Gehen wir in den Garten«, sagte er.
Sie wandten sich nach links und kamen in eine Art Wintergarten, wo zwei geschmacklose Fontänen ein bißchen kühle Luft schafften. Unter den paar Taxusbäumen und Thujas saßen Männer und Frauen an Zinktischen und tranken.
»Noch ein Bier?« fragte Forestier.
»Ja, gern.«
Sie setzten sich und beobachteten das Publikum. Von Zeit zu Zeit blieb ein herumspazierendes Mädchen stehen und fragte mit ordinärem Lächeln:
»Laden Sie mich nicht ein?« — Und wenn Forestier erwiderte : »Ja, zu einem Glas Wasser aus dem Springbrunnen«, so entfernte sie sich mit einem ärgerlichen Schimpfwort.
Aber die dicke Brünette tauchte wieder auf. Sie kam in übermütiger Haltung, Arm in Arm mit der dicken Rothaarigen. Sie bildeten wirklich ein hübsches, gut ausgesuchtes Frauenpaar.
Sobald sie Duroy erblickte, lächelte sie, als hätten sich ihre Augen schon vertraute und verschwiegene Dinge gesagt. Sie nahm einen Stuhl und setzte sich ruhig ihm gegenüber und ließ ihre Freundin auch Platz nehmen. Dann rief sie mit lauter Stimme:
»Kellner, zwei Grenadine!«
Erstaunt sagte Forestier:
»Du genierst dich wirklich nicht!«
»Ich bin in deinen Freund verliebt«, antwortete sie. »Er ist wirklich ein schöner Kerl. Ich glaube, ich könnte seinetwegen Dummheiten begehen.«
Duroy wußte vor Verlegenheit nicht, was er sagen sollte. Er drehte an seinem wohlgepflegten Schnurrbart und lächelte nichtssagend vor sich hin. Der Kellner brachte die Limonaden und die beiden Freundinnen tranken sie in einem Zuge aus. Dann standen sie auf und die Brünette nickte Duroy wohlwollend zu und gab ihm mit ihrem Fächer einen leichten Schlag auf den Arm: »Danke, mein Schatz. Du bist nicht sehr geschwätzig.«
Dann gingen sie fort, sich in den Hüften wiegend.
Forestier begann zu lachen:
»Sag mal, alter Freund, weißt du, daß du wirklich Erfolg bei Weibern hast? So was muß man pflegen, damit kann man sehr weit kommen.« Er schwieg eine Sekunde, dann setzte er hinzu mit dem träumerischen Ton von Leuten, die laut denken: »Durch sie erreicht man auch am meisten. Und als Duroy immer noch vor sich hin lächelte, ohne etwas zu erwidern, fragte er: »Bleibst du noch hier? Ich will nach Hause, ich habe genug.«
»Ja,« murmelte der andere, »ich bleibe noch etwas. Es ist ja noch nicht spät.«
Forestier stand auf. »Auf Wiedersehen, also bis morgen. Vergiß nicht, um halb acht abends, 17 Rue Fontaine.«
»Abgemacht, auf morgen, danke!« — Sie drückten sich die Hände, und der Journalist ging fort.
Sobald er fort war, fühlte Duroy sich frei. Er tastete vergnügt von neuem nach den beiden Goldstücken in seiner Westentasche. Dann erhob er sich und mischte sich unter die Menge, die er suchend durchforschte.
Bald erblickte er die beiden Mädchen, die Brünette und die Rothaarige, die immer noch in stolzer Haltung durch die Menge zogen.
Er ging direkt auf sie zu. Als er ihnen ganz nahe war, verlor er wieder den Mut.
Die Brünette sagte: »Na, hast du deine Sprache wiedergefunden?«
Er stotterte: »Allerdings!« Ein zweites Wort konnte er aber nicht hervorbringen.
Alle drei blieben stehen und hielten die Bewegung der Spaziergänger auf, die einen Wirbel um sie bildeten.
Die Brünette fragte ihn plötzlich: »Kommst du zu mir?«
Er zitterte vor Begierde und erwiderte schroff:
»Ja, aber ich habe nur ein Goldstück in der Tasche.«
Sie lächelte gleichgültig: »Das tut nichts.«
Sie nahm ihn beim Arm, als Zeichen, daß sie ihn erobert hatte.
Als sie das Lokal verließen, überlegte er, daß er sich mit den andern zwanzig Francs ohne Schwierigkeiten für den nächsten Abend einen Frack leihen könnte.
II.
»Bitte, wo wohnt hier Herr Forestier?«
»Im dritten Stock links.«
Der Concierge gab diese Auskunft mit freundlichem Ton, aus dem Hochachtung vor dem Mieter zu entnehmen war.
George Duroy stieg die Treppe hinauf. Er war ein wenig verlegen, etwas schüchtern und fühlte sich nicht sehr behaglich. Zum ersten Male in seinem Leben trug er einen Frack, und das ganze Zubehör dieser Kleidung störte ihn. Er fühlte, daß vieles an ihm defekt war. Seine Stiefel sahen ziemlich elegant aus, denn er hielt auf gute Fußbekleidung, waren aber keine Lackschuhe. Das Hemd hatte er sich erst vormittags für vier Francs fünfzig im Louvre gekauft, und der schmale, gestickte Brusteinsatz sah schon jetzt zerknittert aus. Übrigens waren die anderen Oberhemden, die er sonst trug, alle mehr oder weniger beschädigt und konnten überhaupt nicht in Frage kommen. Die Hosen waren ihm viel zu breit, sie paßten sich schlecht der Beinform an und schlugen über der Wade häßliche Falten. Man sah es ihnen an, daß sie abgenutzt und für einen anderen zugeschnitten waren. Nur der Frack saß gut, denn er hatte einen gefunden, der richtig zu seiner Figur paßte.
Langsam stieg er die Treppe hinauf. Vor Angst pochte ihm sein Herz. Vor allem quälte ihn die Furcht, lächerlich zu erscheinen. Plötzlich sah er gerade vor sich einen Herrn in großer Toilette, der ihn betrachtete. Sie standen so dicht beieinander, daß Duroy unwillkürlich einen Schritt zurücktrat. Dann blieb er verblüfft stehen: es war sein eigenes Spiegelbild in einem hohen Wandspiegel, der im Flur des ersten Stockes eine lange Perspektive vortäuschte. Er zitterte vor lauter Freude, nie hätte er gedacht, daß er so vornehm und elegant aussehen könnte. Zu Hause, in seinem kleinen Rasierspiegel, dem einzigen, den er besaß, hatte er sich nicht richtig betrachten können und war nach einem flüchtigen Blick über die Mängel seiner improvirsierten Gesellschaftstoilette außer sich geraten. Der Gedanke, lächerlich zu erscheinen, machte ihn verrückt. Als er sich aber plötzlich in dem Spiegel erblickte, hatte er sich nicht einmal erkannt, er hatte sich für einen anderen gehalten, für einen Herrn aus bester Gesellschaft, den er beim ersten Anblick für sehr elegant und schick hielt. Und jetzt, wo er sich sorgfältig betrachtete, fand er, daß die Gesamtwirkung tatsächlich zufriedenstellend war.
Darauf studierte er seine Haltung, wie ein Schauspieler, der seine Rolle lernt. Er lächelte sich zu, reichte sich selber die Hand, machte verschiedene Gebärden, versuchte sich einzelne Gemütsbewegungen vorzuspielen: Erstaunen, Freude, Beifall; er beobachtete die Nuancen des Lächelns und studierte die stumme Sprache der Blicke, um sich bei Damen beliebt zu machen und ihnen anzudeuten, daß er sie liebt und bewundert.
Eine Tür ging im Treppenflur auf. Er fürchtete, überrascht zu werden, und lief hastig hinauf, aus Angst, daß ihn ein Gast seines Freundes so gesehen hätte, wie er sich selbst Faxen vormachte. Er erreichte den zweiten Stock, bemerkte einen anderen Spiegel und mäßigte seine Schritte, um sich im Vorbeigehen wieder genau beobachten zu können. Seine Erscheinung kam ihm jetzt wirklich elegant vor. Sein Auftreten und seine Haltung waren gut. Und ein maßloses Selbstvertrauen und Übermut erfüllten seine Seele. Ja, mit diesem Äußeren und mit dem festen Willen, vorwärts zu kommen, mit seiner rücksichtslosen Energie und seinem unabhängigen Verstand mußte er Glück haben. Die Treppe zum dritten Stock wäre er am liebsten hinaufgesprungen. Vor dem dritten Spiegel blieb er nochmals stehen, drehte gewohnheitsmäßig den Schnurrbart, nahm seinen Zylinderhut ab, um seine Frisur glatt zu streichen und murmelte mit halblauter Stimme: »Ein glänzender Einfall.« Dann streckte er die Hand aus und klingelte.
Die Tür ging fast im selben Moment auf und er befand sich vor einem ernsthaften, glattrasierten Diener in schwarzem Frack, der eine so tadellose Haltung zeigte, daß Duroy, ohne zu begreifen weshalb, von neuem dieselbe unerklärliche Unsicherheit und Verlegenheit fühlte; vielleicht durch den unbewußten Vergleich der Schnitte ihrer Anzüge hervorgerufen. Dieser Diener, der Lackschuhe trug, nahm Duroy den Überzieher ab, den dieser auf dem Arm getragen hatte, damit die Flecke nicht allzu sichtbar waren, und fragte ihn:
»Wen darf ich melden?«
Dann hob er den Türvorhang und rief den Namen in den Salon hinein.
Aber Duroy verließ plötzlich alle seine Würde. Er fühlte sich vor Furcht gelähmt und atmete schwer. Er stand jetzt an der Schwelle eines neuen Lebens, von dem er geträumt und auf das er gehofft hatte.
Trotzdem ging er weiter. Eine junge, blonde Dame stand ganz allein in einem großen hellerleuchteten Zimmer, das voller Topfpflanzen war, wie ein Treibhaus.
Ganz außer Fassung gebracht, blieb er plötzlich stehen. Wer war diese Dame, die ihn lächelnd erwartete? Dann fiel ihm ein, daß Forestier verheiratet war, und der Gedanke, daß diese hübsche, elegante Blondine die Frau seines Freundes war, verblüffte ihn vollends.
Er murmelte:
»Madame, ich bin ...«
Sie reichte ihm die Hand.
»Ich weiß es, mein Herr. Charles hat mir erzählt, wie er Sie gestern getroffen hat, und ich bin sehr froh, daß er den guten Einfall hatte, Sie heute zum Diner einzuladen.«
Er errötete bis an die Ohren und wußte absolut nicht, was er erwidern sollte. Er fühlte sich beobachtet, von Kopf bis zu den Füßen gemustert, abgeschätzt, gewogen. Er hatte Lust, sich zu entschuldigen, einen Grund zu erfinden, um die Nachlässigkeit seiner Kleidung zu erklären, aber er fand keinen, und wagte es nicht, diesen heiklen Punkt zu berühren. Er setzte sich in einen Armsessel, den sie ihm anbot, und als er unter sich den weichen und elastischen Samt des Polsters fühlte, als dessen Seitenlehnen ihn wie ein Paar zärtlicher Arme umfingen, da war es ihm, als sei er jetzt endlich in ein neues, reizvolles Leben getreten, als hätte er was Kostbares erobert, als sei er nun endlich etwas geworden; und er betrachtete Frau Forestier, deren Blicke unverwandt auf ihm ruhten. Sie trug ein hellblaues Kaschmirkleid, das ihre biegsame Figur und ihre volle Brust zur Geltung brachte. Durch die weißen Spitzen, mit denen der Kragen und die kurzen Ärmel besetzt waren, schimmerte das Fleisch ihrer Arme und ihres Busens, und die Haare, die auf dem Scheitel zusammengenommen waren und sich im Nacken leicht kräuselten, bildeten eine leichte Flaumwolke über dem Halse.
Ihre Blicke beruhigten Duroy, sie erinnerten ihn, ohne daß er wußte warum, an den Blick des Mädchens, das er gestern in den Folies Bergère getroffen hatte. Madame Forestier hatte blaugraue Augen, von einem seltsamen Ausdruck, eine schmale Nase, starke Lippen, ein etwas fleischiges Kinn und unregelmäßige, verführerische Gesichtszüge voll Anmut, Liebenswürdigkeit und List. Es war eins von diesen Gesichtern, die mit jeder Linie einen besonderen Reiz und Schönheit ausdrücken und die mit jeder Bewegung etwas zu sagen oder zu verbergen scheinen. Nach einer kurzen Pause fragte sie ihn:
»Sind Sie schon lange in Paris?«
Er gewann allmählich seine Selbstbeherrschung wieder:
»Seit einigen Monaten erst, Madame. Ich bin bei der Eisenbahn angestellt, aber Ihr Gatte hatte mir die Hoffnung gemacht, ich könnte mit seiner Hilfe Journalist werden.«
Sie hatte ein noch ausdrucksvolleres und wohlwollenderes Lächeln und murmelte mit leiser Stimme:
»Ich weiß.«
Es klingelte von neuem und der Diener meldete: »Madame de Marelle.«
Es war eine kleine Brünette, die mit flinken Bewegungen eintrat. Ihre Gestalt schien von Kopf bis zu den Füßen in ihrem ganz einfachen dunklen Kleide hervorzutreten. Nur eine rote Rose, die sie sich ins Haar gesteckt hatte, zog gewaltsam das Auge an. Sie unterstrich den Charakter ihres Aussehens, sie betonte ihr eigenartiges Wesen und gab ihr den lebhaften, schnellen Ausdruck, der zu ihr paßte. Ein kleines Mädchen in kurzem Kleide folgte ihr. Madame Forestier eilte ihr entgegen:
»Guten Tag, Clotilde.«
»Guten Tag, Madeleine.«
Sie umarmten sich. Dann hielt das Kind seine Stirn zum Kusse hin, mit der Sicherheit einer Erwachsenen und sagte:
»Guten Tag, Kusine.«
Madame Forestier gab ihr einen Kuß und stellte dann vor:
»Monsieur Georges Duroy, ein guter Freund von Charles, — Madame de Marelle, meine Freundin und Verwandte.«
Sie fügte hinzu:
»Sie wissen, wir sind hier ganz einfach unter uns, ohne Feierlichkeit und Zwang. Das ist selbstverständlich, nicht wahr?«
Der junge Mann verbeugte sich.
Doch die Tür ging von neuem auf und ein ganz kleiner, runder, dicker Herr erschien. Er führte am Arm eine große, schöne Frau, größer als er selbst, viel jünger, mit vornehmem Benehmen und ernstem Wesen. Das war Herr Walter, Deputierter, Finanzier, Geld- und Geschäftsmann, ein südfranzösischer Jude, Direktor der Vie Française, und seine Frau, geborene Basile-Ravalau, die Tochter des Bankiers gleichen Namens. Dann kamen gleich nacheinander der elegante Jaques Rival und Norbert de Varenne, dessen Rockkragen unter der steten Berührung der langen Dichtermähne glänzte, die bis an die Schulter reichte und diese mit kleinen weißen Schuppen bedeckte.
Seine schlecht gebundene Krawatte schien er nicht das erstemal zu tragen. Mit der Grazie eines galanten alten Herrn küßte er Frau Forestier auf das Handgelenk und sein langes Haar fiel dabei wie ein Wasserfall auf den nackten Arm der jungen Dame. Nun erschien auch der Hausherr und entschuldigte sich für sein spätes Erscheinen. Er sei jedoch in der Redaktion durch den Fall Morel zurückgehalten worden. Der radikale Abgeordnete Morel hatte soeben den Minister wegen einer Kreditforderung für die Kolonisierung Algiers interpelliert.
Der Diener meldete: »Es ist angerichtet!«
Man ging in das Speisezimmer.
Duroy saß bei Tisch zwischen Madame de Marelle und ihrer Tochter. Er fühlte sich von neuem verlegen, weil er fürchtete, irgendeinen Irrtum in der richtigen Handhabung von Gabel, Löffel oder Gläsern zu begehen. Vier Gläser standen vor ihm, von denen eins etwas matt bläulich war. Was mochte man wohl aus diesem trinken? Während der Suppe herrschte Schweigen, dann fragte Norbert de Varenne:
»Haben Sie den Prozeß Gauthier gelesen?«
Und nun redete man hin und her über diesen Ehebruchsskandal, der durch eine Erpressung besonders verwickelt war. Man sprach nicht darüber, wie man im Familienkreis über Ereignisse spricht, die in den Zeitungen stehen, sondern wie man unter Ärzten über Krankheiten, unter Obsthändlern über Früchte spricht. Man war nicht entrüstet oder erstaunt über die Tatsachen, man forschte nur mit einer beruflichen Sorgfalt und mit vollständiger Gleichgültigkeit gegenüber dem Verbrechen selbst, nach dessen tieferen, verborgenen Ursachen. Man suchte einfach die Motive der Handlung zu erklären, all die psychischen Vorgänge, die dieses Drama veranlaßt hatten; es war sozusagen das wissenschaftliche Resultat einer besonderen Geistesverfassung. Auch die Damen nahmen an dieser Untersuchung regsten Anteil.
Es wurden dann noch andere Ereignisse diskutiert, besprochen, von allen Seiten beleuchtet und nach ihrer Wichtigkeit beurteilt mit dem scharfen, praktischen Sinn der Zeitungsmenschen, der Nachrichtenhändler, des zeilenweisen Verschacherns der menschlichen Komödie, genau, wie man unter Kaufleuten die Gegenstände prüft und dreht und abschätzt, bevor man sie dem Publikum zum Verkauf anbietet. Dann kam das Gespräch auf ein Duell, und Jaques Rival ergriff das Wort. Das war sein Fach: niemand anders durfte diese Frage behandeln.
Duroy traute sich nicht, an der Unterhaltung teilzunehmen. Er betrachtete ein paarmal seine Nachbarin, deren üppiger Busen ihn erregte. An ihrem Ohr hing ein Diamant, der durch einen dünnen Goldfaden gehalten wurde, wie ein Wassertropfen, der über das Fleisch geglitten war. Von Zeit zu Zeit machte sie eine Bemerkung, die stets ein Lächeln auf ihren Lippen hervorrief. Sie hatte einen witzigen, liebenswürdigen, schnell auffallenden Esprit, den Esprit eines alles wissenden Gassenjungen, der die Dinge mit Gleichmut betrachtet und mit leichtem, lustigem Spott über sie hinweggeht.
Duroy versuchte vergeblich, ihr irgendein Kompliment zu sagen, und da er nichts fand, beschäftigte er sich mit ihrer Tochter; er goß ihr Wein ein, hielt ihr die Schüssel, bediente sie und erwies sich als aufmerksamer Nachbar. Das Kind war viel ernster als seine Mutter, dankte mit ruhiger Würde, nickte mit dem Kopf und sagte:
»Sie sind sehr liebenswürdig...«, und dann lauschte sie wieder mit nachdenklichem Gesichtsausdruck der Unterhaltung der Erwachsenen.
Das Essen war vortrefflich und fand allgemeinen Beifall. Herr Walter aß wie ein hungriger Wolf, sprach fast gar nichts und betrachtete unter seinem Kneifer mit schrägen Blicken die Speisen, die ihm serviert wurden. Norbert de Varenne wetteiferte mit ihm und ließ Sauce auf den Hemdeinsatz fallen.
Forestier überwachte das Ganze mit lächelnder Aufmerksamkeit, er wechselte von Zeit zu Zeit mit seiner Frau Blicke des Einverständnisses, als wollte er sagen: »Siehst du, unser schwieriges, gemeinsames Werk klappt ausgezeichnet.«
Die Gesichter wurden rot, die Stimmen laut. Alle Augenblicke flüsterte der Diener den Gästen ins Ohr: »Corton — Château Larose.«
Duroy fand den Corton nach seinem Geschmack und ließ jedesmal sein Glas füllen. Eine angenehme, erwärmende Fröhlichkeit erfüllte ihn, eine heiße Freude, die ihm vom Magen in den Kopf stieg, durch seine Adern rann und ihn ganz durchdrang. Er fühlte sich von vollkommenstem Behagen erfüllt, von einem Behagen des Lebens und Denkens, des Körpers und der Seele.
Und es überkam ihn ein Verlangen, zu sprechen, sich hervorzutun, gehört und geschätzt zu werden, wie diese Männer, deren geringste Bemerkungen lauten Beifall fanden.
Die Unterhaltung ging unaufhörlich, sprang von einer Ansicht zur anderen, hatte nun alle Ereignisse des Tages erschöpft und dabei tausend Fragen gestreift. Dann kehrte sie zu der großen Interpellation des Herrn Morel über die Kolonisation in Algier zurück.
Herr Walter machte zwischen zwei Gängen ein paar scherzhafte Bemerkungen, denn er war geistreich und für Witze veranlagt. Forestier erzählte über seinen Artikel vom nächsten Tage. Jaques Rival verlangte eine militärische Verwaltung mit Überlassung von Ländereien an alle Offiziere, die zwanzig Jahre im Kolonialdienst verbracht hatten.
»Auf diese Weise«, sagte er, »werden sie eine energische Bevölkerung schaffen, die das Land seit längerer Zeit kennt und liebt, seine Sprache beherrscht und über alle Schwierigkeiten in kolonialen Fragen Bescheid weiß, an denen die Neulinge unfehlbar stolpern müssen.«
Norbert de Varenne unterbrach ihn.
»Ja ... sie werden über alles Bescheid wissen, nur nicht über die Landwirtschaft. Sie werden Arabisch verstehen, aber keine Ahnung davon haben, wie man Rüben pflanzt oder Getreide sät. Sie werden stark im Fechten sein und schwach im Düngen. Nein, dieses neue Land muß für jedermann offen sein. Die Tüchtigen werden dann dort ihren Weg machen, die anderen gehen eben zugrunde. Das ist ein soziales Gesetz.«
Es folgte ein kurzes Schweigen. Man lächelte.
George Duroy öffnete den Mund, und erstaunt über den Klang seiner Stimme, als ob er sich selbst noch nie hatte reden hören, sagte er:
»Woran es da unten am meisten fehlt, das ist der gute Boden. Die wirklich fruchtbaren Ländereien kosten da gerade soviel wie in Frankreich und werden als Kapitalanlage von reichen Parisern aufgekauft. Die wirklich armen Kolonisten, die auswandern, um Brot zu gewinnen, sind auf die Wüste angewiesen, wo aus Mangel an Wasser gar nichts gedeiht.«
Alle blickten ihn an; er fühlte, wie er rot wurde.
Herr Walter fragte: »Kennen Sie Algier, mein Herr?«
Er antwortete: »Jawohl, mein Herr, ich war dort achtundzwanzig Monate und habe mich in allen drei Provinzen aufgehalten.«
Nun fragte ihn plötzlich Norbert de Varenne, der den Fall Morel vergaß, über die Einzelheiten in den Sitten der Eingeborenen, die er von einem Offizier erfahren hatte. Es handelte sich um Mzab, eine seltsame, kleine, arabische Republik inmitten der Sahara, im trockensten Teile jenes heißen Erdteiles.
Duroy war zweimal in Mzab gewesen und erzählte nun von den Sitten dieses eigenartigen Landes, wo Wassertropfen Goldwert haben und jeder Bewohner zu allen öffentlichen Arbeiten verpflichtet ist und im Handel und Gewerbe eine Ehrlichkeit herrscht, wie man sie bei zivilisierten Völkern in Europa kaum kennt.
Er sprach mit einem gewissen Schwung; der Wein und der Wunsch zu gefallen, trieben ihn an. Er erzählte Anekdoten aus dem Soldatenleben, Kriegsgeschichten und allerlei kleine Züge aus dem Leben der Araber. Er fand sogar ein paar farbige Ausdrücke zur Schilderung der weiten, gelben Wüstenebene, die unter der verzehrenden Sonnenglut in ewiger öde liegt. Alle Damen hielten die Augen auf ihn gerichtet.
Frau Walter murmelte mit ihrer langsamen Stimme:
»Sie könnten aus ihren Erinnerungen eine Reihe reizender Artikel machen.«
Daraufhin betrachtete auch Herr Walter über seinen Kneifer den jungen Mann, wie er es immer tat, wenn er ein Gesicht wirklich genau sehen wollte. Die Speisen sah er sich unter dem Kneifer hinweg an.
Forestier ergriff die Gelegenheit:
»Verehrter Chef, ich erzählte Ihnen bereits von Herrn George Duroy, und bat Sie, ihn für die politischen Informationen bei uns anzustellen. Seitdem Marambot uns verlassen hat, habe ich niemanden für dringende und vertrauliche Erkundigungen zur Verfügung und für die Zeitung ist dieser Mangel recht bedeutend.«
Papa Walter wurde plötzlich ganz ernst und nahm seine Brille ab, um Duroy noch genauer betrachten zu können. Dann sagte er:
»Sicherlich hat Herr Duroy einen originellen Verstand. Wenn er mich morgen nachmittag um drei Uhr besuchen will, werden wir das besprechen.«
Nach einer kurzen Pause wandte er sich direkt an den jungen Mann:
»Aber schreiben Sie uns sofort eine kleine Reihe von Erinnerungen über Algier. Erzählen Sie über Ihre Eindrücke und bringen Sie damit die Kolonialfrage in Verbindung, so wie Sie es eben taten. Es ist aktuell, höchst aktuell, und es wird unseren Lesern ohne Zweifel zusagen.
Aber beeilen Sie sich. Ich brauche den ersten Artikel schon morgen oder übermorgen, damit wir das Publikum bearbeiten können, solange man darüber in der Kammer debattiert.«
Frau Walter fügte mit jener ernsthaften Liebenswürdigkeit, die sie immer zeigte, noch hinzu:
»Und Sie hätten einen reizenden Titel: ‘Erinnerungen eines afrikanischen Jägers’, nicht wahr, Herr Norbert?«
Der alte Dichter, der erst spät zu Ansehen und Ruhm gekommen war, verabscheute Neulinge und mißtraute ihnen. Er antwortete trocken:
»Ja, ausgezeichnet, vorausgesetzt, daß die Artikel auch die entsprechende Stimmung haben werden, was sehr schwer sein wird. Es kommt nämlich auf die richtige Stimmung an, oder musikalisch ausgedrückt, auf den Ton.«
Madame Forestier warf Duroy einen wohlwollenden, lächelnden Blick zu, wie ein erfahrener Kenner, der sagen will: »Du, du wirst schon deinen Weg machen.«
Madame de Marelle hatte sich mehrmals zu ihm hingedreht, und der Diamant in ihrem Ohr zitterte unaufhörlich, als wollte der dünne Wassertropfen sich ablösen und fallen. Nur die Kleine blieb unbeweglich und ernst und hielt den Kopf über ihren Teller gebeugt.
Der Diener ging rings um den Tisch und schenkte Johannisberger in die mattblauen Gläser, und dann wendete sich Forestier zu Herrn Walter und brachte einen Trinkspruch aus: »Auf langes Gedeihen der Vie Française!«
Alle verbeugten sich vor dem Chef, der lächelte, und Duroy, durch seinen Erfolg berauscht, leerte sein Glas in einem Zuge. Er hätte, so war ihm zumute, ein ganzes Faß austrinken können, er hätte einen Ochsen aufessen, einen Löwen erwürgen können. Er fühlte übermenschliche Kraft in sich, unbesiegbare Energie und unbegrenzte Hoffnungen. Jetzt war er inmitten dieser Menschen zu Hause, er hatte sich hier eine Stellung verschafft, seinen Platz erobert. Jetzt blickte er jedem einzelnen zuversichtlich ins Auge, und zum ersten Male wagte er auch seine Nachbarin anzusprechen.
»Sie haben die schönsten Ohrringe, Madame, die ich je gesehen habe.«
Lächelnd wandte sie sich zu ihm hin.
»Es war ein guter Einfall von mir, die Diamanten so einfach am Ende eines Goldfadens aufzuhängen. Nicht wahr, sie sehen aus wie Tautropfen?«
Verwirrt durch seine eigene Kühnheit und voller Angst, ob er auch nicht eine Albernheit sage, murmelte er:
»Ganz reizend ... Aber an Ihren Ohren sehen sie besonders schön aus.«
Sie dankte ihm mit einem Blick, mit einem jener offenen Frauenblicke, die bis ins Herz dringen.
Als er den Kopf herumwandte, begegnete er wieder den Augen der Frau Forestier, die ihn noch immer wohlwollend ansahen, doch glaubte er in ihnen jetzt eine lebhaftere Heiterkeit, eine leise Hinterlist und eine Ermutigung zu lesen.
Die Herren redeten jetzt alle durcheinander, mit lebhaften Gebärden und schallender Stimme. Man besprach den Riesenplan der Untergrundbahn. Der Gegenstand war auch beim Dessert noch nicht erschöpft und jeder hatte einige Dinge zu sagen über die zu langsamen Verbindungen in Paris, über die Unbequemlichkeiten der Straßenbahn und der Omnibusse und über die grobe Unverschämtheit der Droschenkutscher.
Dann verließ man den Speisesaal, um Kaffee zu trinken. Duroy bot aus Scherz dem kleinen Mädchen seinen Arm an, das ihm mit ernster Miene dankte und sich auf die Fußspitzen stellte, um ihre Hand auf den Arm des Nachbars legen zu können.
Als er in den Salon eintrat, hatte er von neuem das Gefühl, in ein Treibhaus zu kommen. Hohe Palmen öffneten ihre anmutigen Fächer in allen vier Ecken, stiegen bis zur Decke empor und verbreiteten sich dann wie Wasserstrahlen. Zu beiden Seiten des Kamins standen zwei runde Gummibäume mit ihren langen, dunkelgrünen, übereinander wachsenden Blättern, und auf dem Flügel prangten zwei ganz originelle, runde Sträucher, mit Blüten bedeckt, die einen dunkelrosa, die anderen schneeweiß. Sie sahen aus, als ob sie künstlich wären und zu schön, um echt zu sein.
Die Luft war angenehm frisch, von einem diskreten, zarten Parfüm erfüllt, das man nicht näher bestimmen konnte.
Duroy fühlte sich jetzt bedeutend sicherer und sah sich das Zimmer aufmerksam an. Es war nicht groß, und außer den Sträuchern war nichts darin, was den Blick besonders auf sich lenkte, keine lebhaften Farben traten hervor; man fühlte sich ruhig und gemütlich darin; es umfing den Körper sanft wie eine zärtliche Liebkosung. Die Wände waren mit einem alten, violetten Stoff bespannt, mit kleinen gelblichen Pünktchen, die kleine Blümchen darstellten und so groß waren wie eine Fliege. Blaugraue Tuchportieren mit leichten Stickereien aus roter Seide bedeckten die Türen und Fenster, und durch das ganze Zimmer standen, wahllos verstreut, Sitzmöbel in allen Formen und Größen, Chaiselongues, große und kleine Fauteuils, Puffs und Taburetts mit Louis-XVI.-Seide oder schönem Utrechter Samt bezogen, mit granatfarbenem Muster auf cremefarbenem Grund.
»Nehmen Sie eine Tasse Kaffee, Herr Duroy?«
Frau Forestier reichte ihm die volle Tasse mit einem freundlichen Lächeln, das ihre Lippen nicht verließ.
»Ja, gnädige Frau, ich danke Ihnen.«
Er nahm ihr die Tasse aus der Hand, und während er sich ängstlich vorbeugte, um mit der silbernen Zange ein Stück Zucker aus der Schale zu nehmen, die das kleine Mädchen hielt, sagte die junge Dame halblaut:
»Sie müssen jetzt Frau Walter den Hof machen.«
Dann entfernte sie sich, bevor er ein Wort hatte antworten können.
Zunächst trank er seinen Kaffee aus, weil er fürchtete, denselben womöglich noch auf den Teppich zu gießen. Dann fühlte er sich etwas freier und suchte nach einer Möglichkeit, sich der Frau seines zukünftigen Direktors zu nähern und eine Unterhaltung anzuknüpfen.
Plötzlich bemerkte er, daß sie eine leere Tasse in der Hand hielt. Sie befand sich ziemlich weit von einem Tisch und wußte nicht recht, wo sie die Tasse hinstellen sollte. Er eilte auf sie zu.
»Gestatten Sie, Madame.«
»Ich danke Ihnen, mein Herr.«
Er trug die Tasse fort und kam wieder zurück:
»Wenn Sie wüßten, gnädige Frau, welch glückliche Stunden mir die Vie Française da unten in der Wüste bereitet hat. Sie ist wirklich die einzige Zeitung, die man außerhalb Frankreichs lesen kann, denn sie ist geistvoller, literarischer und lange nicht so monoton und banal wie die übrigen. Man findet alles, was man will.«
Sie lächelte mit liebenswürdiger Gleichgültigkeit und sagte dann ernst:
»Herr Walter hat sich viel Mühe gegeben, eine solche Zeitung zu schaffen. Sie entspricht dem jetzigen modernen Bedürfnis.«
Sie begannen zu plaudern. Er sprach leicht und oberflächlich mit einer reizvollen Stimme. Auch hatte er viel Anmut im Blick und einen unwiderstehlich bestechenden Schnurrbart. Er wirbelte sich kraus und allerliebst auf der Lippe, dunkelblond, mit einem Stich ins Rötliche, während die Haarspitzen etwas heller schimmerten.
Sie unterhielten sich über Paris und seine Umgebung, über die Ufer der Seine, über die Badeorte, Sommerfrischen und alle diese Dinge, über die man ohne jegliche geistige Anstrengung endlos plaudern kann.
Dann trat Norbert de Varenne mit einem Likörglas in der Hand heran, und Duroy zog sich diskret zurück.
Madame de Marelle, die sich eben mit Madame Forestier unterhielt, rief ihn heran: »Also, Sie wollen es mit dem Journalismus versuchen?« fragte sie etwas schroff.
Da sprach er mit unbestimmten Worten über seine Pläne und begann dann mit ihr genau dieselbe Unterhaltung, die er vorher mit Frau Walter geführt hatte. Jetzt, wo er den Gegenstand besser beherrschte, zeigte er sich etwas gewandter und wiederholte, wie aus sich heraus, das, was er gerade gehört hatte. Dabei blickte er seiner Dame fortwährend in die Augen, wie um seinen Worten einen tieferen Sinn zu geben.
Sie erzählte ihm ihrerseits Geschichten mit dem lebhaften Ton einer Frau, die weiß, daß sie geistreich und witzig ist, und die immer lustig wirken kann. Dann wurde sie vertraulich, legte die Hand auf seinen Arm, senkte die Stimme, um Nichtigkeiten zu sagen, die dadurch das Gepräge einer Vertraulichkeit erhielten.
Er war innerlich entzückt, der jungen Frau, die sich ihm so eifrig widmete, auch körperlich nahe zu sein. Am liebsten hätte er um ihretwillen sofort irgendeine große Tat vollführt und ihr gestanden, daß er sie schätze und nur deswegen manchmal verstumme, weil er ganz von ihr eingenommen sei.
Aber plötzlich rief Madame de Marelle ohne jede Veranlassung: »Laurine!« Das kleine Mädchen kam. »Setz' dich hierher, mein Kind, du erkältest dich am Fenster!«
Und Duroy empfand ein tolles Verlangen, das Kind zu küssen, als sollte auch die Mutter von diesem Kusse etwas verspüren. Er fragte in einem galanten, väterlichen Ton:
»Darf ich Sie küssen, kleines Fräulein?«
Das Kind sah ihn erstaunt an. Madame de Marelle sagte lachend: »Antworte: heute möchte ich es schon, denn immer geht das nicht.«
Duroy setzte sich sofort hin, zog Laurine auf sein Knie und streifte die zarten, wolligen Haare des Kindes mit den Lippen.
Die Mutter war erstaunt: »Wie, sie ist nicht davongelaufen? Das ist ja sonderbar. Sonst läßt sie sich nur von Frauen küssen. Sie müssen unwiderstehlich sein, Herr Duroy.«
Er wurde rot, antwortete nichts und schaukelte mit einer leichten Bewegung das kleine Mädchen auf den Knien.
Madame Forestier trat zu ihm und stieß einen Ruf des Erstaunens aus: »Schau, ein Wunder, Laurine ist gezähmt.«
Jaques Rival trat mit der Zigarre im Munde heran und Duroy verabschiedete sich, um durch irgendein ungeschicktes Wort den guten Eindruck, den er gemacht hatte, nicht wieder zu zerstören und das begonnene Eroberungswerk in Frage zu stellen.
Er verbeugte sich, drückte leicht die kleinen Frauenhände, die sich ihm entgegenstreckten, und schüttelte kräftig den Herren die Hand. Es fiel ihm dabei auf, daß Jaques Rivals Hand heiß und trocken war und seinen Druck herzlich erwiderte, während die Hand Norbert de Varennes feucht und kalt war und sich kaum fassen ließ. Vater Walters Hand war kühl und weich, ohne Energie und Ausdruck, die Forestiers fett und warm. Sein Freund flüsterte ihm zu:
»Morgen um drei. Vergiß nicht!«
»O nein, sei unbesorgt!«
Als er sich wieder auf der Treppe befand, war seine Freude so groß, daß er am liebsten hinabgelaufen wäre. Er nahm immer zwei Stufen auf einmal.
Plötzlich erblickte er in dem großen Spiegel des zweiten Stockes einen übereiligen Herrn, der auf ihn zugesprungen kam. Beschämt blieb er stehen, als hätte man ihn auf einer Dummheit ertappt. Dann betrachtete er sich lange Zeit aufs höchste verwundert, daß er wirklich ein so hübscher Kerl war. Freundlich lächelte er sich zu und verabschiedete sich dann von seinem Ebenbild mit einem tiefen, feierlichen Gruß, wie man eine hochgestellte Persönlichkeit grüßt.
III.
Georges Duroy befand sich wieder auf der Straße und überlegte, was er tun sollte. Er hatte Lust zu laufen, zu träumen, immerfort zu gehen, an seine Zukunft zu denken und die milde Nachtluft einzuatmen; doch der Gedanke an die Artikelserie, die Vater Walter bestellt hatte, gab ihm keine Ruhe, und er beschloß, sofort nach Hause zu gehen und sich an die Arbeit zu setzen. Mit eiligen Schritten ging er weiter, erreichte den äußeren Boulevard und gelangte endlich in die Rue Boursault, wo er wohnte. Seine Wohnung befand sich in einem sechsstöckigen Haus, das von etwa zwanzig Arbeiter- und Kleinbürgerfamilien bevölkert war. Er stieg die Treppe hinauf und beleuchtete mit Wachsstreichhölzern die schmutzigen Stufen, auf denen Papierfetzen, Zigarrenstummel und Küchenabfälle herumlagen. Er empfand ein widerwärtiges Gefühl und einen Drang, so rasch als möglich von hier fortzukommen und so zu wohnen, wie es die reichen Leute tun, in sauberen Wohnungen mit schönen Teppichen. Ein schwerer Geruch von Speiseresten, Unrat und unsauberer Menschlichkeit, ein stagnierender Duft von Fett und Mauern, den kein frischer Luftzug vertreiben konnte, erfüllte das Haus von oben bis unten.
Das Zimmer des jungen Mannes lag im fünften Stock und ging wie auf einen tiefen Abgrund, auf den weiten Einschnitt der Westbahn, gerade oberhalb der Tunneleinfahrt, vor dem Bahnhof Batignolles, hinaus. Duroy öffnete das Fenster und lehnte sich auf das verrostete, eiserne Fensterbrett.
Unter ihm glühten in der Tiefe der finsteren Wölbung drei rote, unbewegliche Signallaternen wie große, feurige Raubtieraugen, und weiter, immer weiter, sah er immer noch andere Lichter. Fortwährend gellten lange und kurze Pfiffe durch die Nacht, die einen nahe, die andern kaum hörbar in der Richtung nach Asnieres. Sie klangen wie menschliche, rufende Stimmen. Einer kam näher und näher, sein klagender Ton klang von Sekunde zu Sekunde lauter; plötzlich blitzte ein großes gelbes Licht auf, das lärmend dahinrollte, und Duroy sah die lange Wagenreihe in der Tunnelmündung verschwinden.
Dann sagte er zu sich: »Also an die Arbeit«, und stellte das Licht auf den Tisch. Doch wie er sich hinsetzen wollte, um zu schreiben, bemerkte er erst, daß er nur eine Schachtel Briefpapier hatte.
»Das ist kein Unglück«; er half sich, indem er die Bogen auseinanderfaltete und sie in ihrer ganzen Größe benutzte. Er tauchte die Feder in die Tinte und schrieb mit seiner schönen Handschrift auf den Kopf des ersten Bogens die Worte:
»Erinnerungen eines afrikanischen Jägers.«
Dann suchte er nach dem Anfang des ersten Satzes. Er saß, den Kopf auf die Hände gestützt, die Augen auf das weiße Papier gerichtet, das sich vor ihm ausbreitete. Was sollte er schreiben? Er fand absolut nichts von dem wieder, was er kurz vorher erzählt hatte, keine Anekdote, keine einzige Tatsache, nichts. Plötzlich fiel ihm ein: »Ich muß mit meiner Abreise aus der Heimat beginnen.« Und er schrieb: »Es war ungefähr am 15. Mai des Jahres 1874, als das erschöpfte Frankreich sich von den Schicksalsschlägen der schrecklichen Kriegsjahre erholte.«
Dann stockte er wieder, er wußte nicht, wie er nun das Folgende schildern sollte, seine Einschiffung, die Reise, seine ersten Eindrücke ... Nachdem er zehn Minuten gegrübelt hatte, beschloß er, diesen einleitenden Teil auf den nächsten Morgen zu verschieben und einstweilen mit der Beschreibung von Algier zu beginnen.
Und er schrieb auf sein Papier:
»Algier ist eine ganz weiße Stadt...«, da blieb er wieder stecken. Er sah in Gedanken die hübsche, helle Stadt vor sich, die sich von der Höhe des Gebirges bis zum Meer hinunterzog, wie eine Kaskade von niedrigen Häusern mit flachen Dächern. Aber er fand keinen Ausdruck für das, was er gesehen und empfunden hatte.