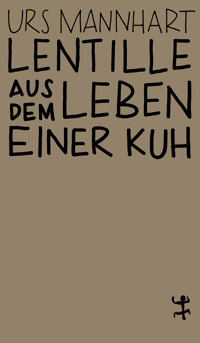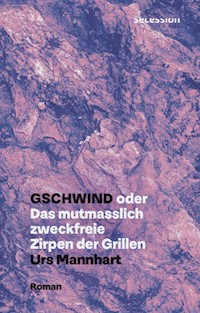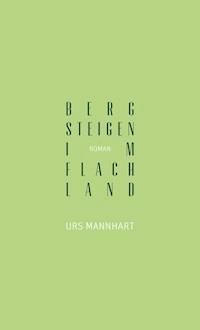
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Secession Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Reporter Thomas Steinhövel bereist Europa an all seinen Wundern und Wunden, von seinem Wohnort in der Schweiz aus nach Skandinavien, wo das Blut der Fische heller ist und Frauen anders lieben, in die Wälder der Karpaten, wo ein uralter Berg Gold birgt, viel Gold, die Bewohner aber, um Geld zu verdienen, zum Erdbeerpflücken nach Spanien gehen oder nach Norwegen auf eine Bohrinsel. Er ist dabei, wie im tieferen Südosten in einem Land, das den jüngsten Krieg in Europa erlitt, gemordet wird, einfach weil Menschen eben so sind, wie sie sind, oder weil sie aussagen wollen in Den Haag, um die Kriegsverbrecher und Mörder anzuklagen. Urs Mannhart, der Autor, verliert nie die Menschen aus dem Blick. Er verbindet mit lakonisch genauer Sprache Geschichten voller Leben, aufgeladen durch die politischen und sozialen Spannungen in Europa, er zieht die Fäden zwischen all diesen Schicksalen, den verschiedenen Arten zu lieben, zu lachen, den schönen und den furchtbaren Erlebnissen, dem Mut wie der Hoffnung, der Chancenlosigkeit wie dem zarten, fragilen Glück.Urs Mannhart stellt durch seinen packenden Roman die Frage nach Recht und Gerechtigkeit in Europa und konfrontiert uns mit einer zersplitterten, einer widersprüchlichen Identität unseres Kontinents.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 870
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
BERGS T E I G E NIROMANMFLACHLAND
URS MANNHART
BERGSTEIGENIROMANMFLACHLAND
URS MANNHART
Der Verlag dankt:
SWISSLOS / Kultur Kanton Bern,
der Kulturabteilung der Stadt Bern,
sowie der MIGROS-Kulturprozent
für die freundliche Unterstützungzum Druck dieses Werkes.
Erste Auflage© 2014 by Secession Verlag für Literatur, ZürichAlle Rechte vorbehaltenLektorat: Angelika Klammer, Christian RuzicksaKorrektorat : Patrick Schärwww.secession-verlag.com
Gestaltung, Typographie, Satz und Litho :KOCHAN & PARTNER, München
eISBN 978-3-905951-37-0
ISBN 978-3-905951-32-5
INHALT
1. KAPITEL ŠABAC – OBRENOVAC, SERBIEN
2. KAPITEL BAKU UND VELAMIR, ASERBAIDSCHAN
3. KAPITEL BERN, SCHWEIZ
4. KAPITEL ROȘIA MONTANĂ, RUMÄNIEN
5. KAPITEL PRIŠTINA, KOSOVO
6. KAPITEL BAKU, ASERBAIDSCHAN
7. KAPITEL PRIŠTINA UND MITROVICA, KOSOVO – ŠABAC, SERBIEN
8. KAPITEL OBRENOVAC, SERBIEN
9. KAPITEL BERN, SCHWEIZ
10. KAPITEL LANGENTHAL UND BERN, SCHWEIZ
11. KAPITEL BELGRAD, SERBIEN
12. KAPITEL ABRUD, RUMÄNIEN
13. KAPITEL NIŠ, SERBIEN
14. KAPITEL LANGENTHAL – BERSCHIS, SCHWEIZ
15. KAPITEL ŠABAC – BELGRAD, SERBIEN
16. KAPITEL BERSCHIS, FLUMS UND TSCHERLACH, SCHWEIZ
17. KAPITEL OBRENOVAC – ŠABAC, SERBIEN
18. KAPITEL BERN UND LANGENTHAL, SCHWEIZ
19. KAPITEL KRANJSKA GORA, SLOWENIEN
20. KAPITEL LANGENTHAL, SCHWEIZ
21. KAPITEL ŠABAC – GRDELICA, SERBIEN
22. KAPITEL BELGRAD, SERBIEN – DEN HAAG, NIEDERLANDE
23. KAPITEL BUKAREST, RUMÄNIEN
24. KAPITEL BERN, SCHWEIZ
25. KAPITEL BUKAREST – MIERCUREA SIBIULUI, RUMÄNIEN
26. KAPITEL ŠABAC, SERBIEN
27. KAPITEL MIERCUREA SIBIULUI – ROȘIA MONTANĂ, RUMÄNIEN
28. KAPITEL BERN, SCHWEIZ
29. KAPITEL ROȘIA MONTANĂ – VIȘEU DE SUS, RUMÄNIEN
30. KAPITEL DEN HAAG, NIEDERLANDE
31. KAPITEL WASSERTAL, RUMÄNIEN
32. KAPITEL LANGENTHAL, SCHWEIZ
33. KAPITEL WASSERTAL, RUMÄNIEN
34. KAPITEL ŠABAC, SERBIEN
35. KAPITEL ROȘIA MONTANĂ, RUMÄNIEN
36. KAPITEL HUELVA, SPANIEN
37. KAPITEL ZÜRICH FLUGHAFEN – LANGENTHAL, SCHWEIZ
38. KAPITEL DEN HAAG, NIEDERLANDE
39. KAPITEL DEN HAAG, NIEDERLANDE
40. KAPITEL LANGENTHAL, SCHWEIZ – MOSKAU, RUSSLAND
41. KAPITEL DEN HAAG, NIEDERLANDE – LANGENTHAL, SCHWEIZ
42. KAPITEL ŠABAC, SERBIEN
43. KAPITEL MOSKAU, RUSSLAND
44. KAPITEL DEN HAAG, NIEDERLANDE
45. KAPITEL HUELVA, SPANIEN
46. KAPITEL MOSKAU, RUSSLAND
47. KAPITEL MOSKAU, RUSSLAND
48. KAPITEL ISTOK, KOSOVO
49. KAPITEL AUSSERHALB MOSKAUS, RUSSLAND
50. KAPITEL ISTOK – KLINË E MESME, KOSOVO
51. KAPITEL MOSKAU, RUSSLAND – LANGENTHAL, SCHWEIZ
52. KAPITEL HUELVA, SPANIEN – CERBÈRE, FRANKREICH
53. KAPITEL DEN HAAG, NIEDERLANDE
54. KAPITEL CERBÈRE, FRANKREICH – MAILAND, ITALIEN
55. KAPITEL KLINË E MESME, KOSOVO – MONTENEGRO
56. KAPITEL MAILAND, ITALIEN
57. KAPITEL BIJELO POLJE – BAR, MONTENEGRO
58. KAPITEL ABRUD – ROȘIA MONTANĂ, RUMÄNIEN
59. KAPITEL BAR, MONTENEGRO – KLINË E MESME, KOSOVO
60. KAPITEL POWAROWO – ST. PETERSBURG, RUSSLAND
61. KAPITEL DEN HAAG, NIEDERLANDE – WIEN, ÖSTERREICH – DUKLA, POLEN
62. KAPITEL BASEL, SCHWEIZ – HADERSLEVO, DÄNEMARK
63. KAPITEL ST. PETERSBURG, RUSSLAND – OSTSEE
64. KAPITEL DUKLA, POLEN
65. KAPITEL SKËNDERAJ – RADONIQ, KOSOVO
66. KAPITEL OSLO, BERGEN UND LAKSEVÅG, NORWEGEN
67. KAPITEL DUKLA, POLEN
68. KAPITEL LAKSEVÅG, NORWEGEN
69. KAPITEL ŠABAC, SERBIEN
70. KAPITEL BERGEN, NORWEGEN
71. KAPITEL INZLINGEN, DEUTSCHLAND – BASEL, SCHWEIZ
72. KAPITEL STOCKHOLM, SCHWEDEN – OSTSEE
73. KAPITEL RADONIQ, KOSOVO
74. KAPITEL LANGENTHAL, SCHWEIZ
75. KAPITEL TROMSØ, NORWEGEN
76. KAPITEL BERN, SCHWEIZ – ROM, ITALIEN
77. KAPITEL RADONIQ – PRIŠTINA, KOSOVO
78. KAPITEL ROM, ITALIEN
79. KAPITEL TROMSØ, NORWEGEN
80. KAPITEL ŠABAC – VIŠNJIČEVO, SERBIEN
81. KAPITEL BELGRAD – ŠABAC, SERBIEN
82. KAPITEL TROMSØ, NORWEGEN
83. KAPITEL PRIŠTINA – RADONIQ, KOSOVO
84. KAPITEL ŠABAC, SERBIEN
85. KAPITEL ŠABAC – BADOVINCI, SERBIEN
86. KAPITEL RADONIQ, KOSOVO
87. KAPITEL BIJELJINA – ZABRĐE, BOSNIEN
Wir teilen. Ich trinke aus seinem Zahnputzbecher. Er aus der Flasche.Thomas Brunnsteiner
Wirklich daheim ist man nur,wo man einen Toten auf dem Friedhof hat.Alois Hotschnig
Eine tiefere Neugierde für die Welt ist nicht allgemein verbreitet.Ryszard Kapuściński
1. KAPITEL
ŠABAC – OBRENOVAC, SERBIEN
Die Quartierstraße lag völlig im Dunkeln, der Hahn hatte noch keinen Krächzer hören lassen und die staubige, mit der heiligen Madonna verzierte Küchenuhr zeigte erst halb fünf, als die Milizionäre in die Wohnung eindrangen, das Schlafzimmer, die Wohnstube, die mit Geigen, Cellos, Bassgeigen und allerlei Holz gefüllte Werkstatt, die Vorratskammer und das Studierzimmer stürmten, mit ihren Knüppeln alle zusammentrieben, vergeblich nach dem jüngsten Sohn fragten und nicht nur Bogdan Mandić, den hageren, siebenundzwanzigjährigen Regieassistenten, Dramaturgen und Bühnenbildner, sondern auch dessen Vater Dmitrij, einen über die Stadt Šabac weit hinaus bekannten Instrumentenbauer, dazu drängten, sich anzukleiden, und den Frauen unter drohenden Gebärden befahlen, den Mund zu halten. Während drei Milizionäre Dmitrij und Bogdan in Handschellen legten, schauten sich die anderen beiden neugierig um, als wollten sie etwas mitlaufen lassen, dann beschimpften sie den Haushalt als staatsfeindlichen Schmutz und führten die beiden Männer ab.
Dragica, Bogdans Mutter, sonst enorm rührselig, war zu schockiert, um weinen zu können. Ein Japsen, ein Schnappen nach Luft war alles, was sie hören ließ.
Auf der Ladefläche des Lastwagens, auf die zu klettern Bogdan und Dmitrij gezwungen wurden, saß bereits ein gutes Dutzend Dissidenten, Männer, die dem Rekrutierungsbefehl nicht nachgekommen waren, Männer jeden Alters, die zu Beginn des orthodoxen Weihnachtsfests in Belgrad für den Rücktritt Miloševićs protestiert oder sich in den vergangenen Monaten regimekritisch verhalten hatten, Männer, die sich nicht an der Vertreibung der Albaner aus dem Kosovo beteiligen wollten, Männer, deren Namen deswegen auf der Liste der UDBA standen. Dieser omnipräsente Geheimdienst, der allen anderslautenden Informationen zum Trotz den Untergang Jugoslawiens bestens überstanden hatte, war in der Familie Mandić seit Jahrzehnten gefürchtet: Dmitrij verlor in den 80er-Jahren seine Stelle als Musiklehrer, da er damals ganz offiziell, also mit Zollbestätigung, ausländische Literatur eingekauft hatte.
Dass Dmitrij nun festgenommen worden war, hatte vielleicht auch damit zu tun, dass er noch nie etwas unternommen hatte gegen die pazifistische Haltung seines Sohnes Bogdan, der 1995 im Krieg gegen die Bosniaken als Dienstverweigerer im Knast saß, und wohl auch damit, dass er gegenwärtig nichts unternahm gegen das Dafürhalten seines jüngeren Sohns Aca, der sich, studienhalber erst in Paris, später in Moskau lebend, bereits der damaligen Rekrutierungswelle entzogen hatte und nun seit Jahren schon, inzwischen papierlos, nichts anderes mehr tun konnte, als in der russischen Hauptstadt auf bessere Zeiten zu warten.
Ebenfalls mit auf der Ladefläche saßen die Philosophen, vier gebildete, kulturinteressierte Männer in ihren Fünfzigern, die sich seit Jahren mit Dmitrij trafen, zu fünft flaschenweise Rotwein tranken und über den fortschreitenden Niedergang der serbischen Politkultur, über den Stumpfsinn nationalistischer Maßnahmen, die immer weiter steigende Inflation des Dinar und die stupiden wirtschaftspolitischen Gegenmaßnahmen debattierten.
Die Plane wurde zugeschlagen, Wagentüren knallten, begleitet von schweren Motorrädern fuhr der Lastwagen los. Vorn auf der Ladefläche saßen, meist im Dunkeln, dann wieder schwach und käseblass erhellt von einer vorbeiziehenden Straßenlampe, die drei Milizionäre, ihre Gewehre quer über der Brust, Entschlossenheit im Gesicht.
Bogdan verbot sich, diese Männer ein zweites Mal anzuschauen, zu deutlich war die Verachtung, die in ihm hochstieg. Bald stellte er erschrocken fest, dass er es versäumt hatte, den von ihm nachtsüber jeweils abgelegten Ehering anzustecken. Bestimmt hatte Elisa den Ring bereits gefunden und hielt ihn nun in ihrer Hand wie die letzte Erinnerung an einen Verschollenen.
Der Lastwagen machte Halt in einer weiteren Straße, wo Bogdan, die Sicht verdeckt von der Plane, zuhören musste, wie die Stiefel der Milizionäre auf ein Haus zumarschierten, wie zwei Hunde kläfften, wie Glas zu Bruch ging und eine Tür eingetreten wurde. Wenig später schon saßen zwei Dissidenten mehr auf der Ladefläche.
Als der Lastwagen wieder Fahrt aufnahm, blickte Bogdan seinem Vater lange in die Augen, suchte zum ersten Mal seit Wochen in dem allein in Schattierungen erkennbaren Gesicht nach einem tiefen Vertrauen, nach Versöhnung auch. Im Frühjahr, kurz vor der Hochzeit, waren Bogdan und Elisa, um einander ungestört lieben zu können, aus dem gleich neben dem Schlafzimmer von Bogdans Eltern gelegenen Studierzimmer in Dmitrijs Werkstatt geflüchtet, wo Elisa mit einer ausholenden Bewegung einen Hammer touchiert hatte, der im freien Fall eine fast schon fertige Geige zerstörte.
Momente später bereits hatte Dmitrij im Schlafanzug in der Werkstatt gestanden, hatte den nackten Bogdan, die nackte Elisa, vor allem aber die ruinierte Geige gesehen, und ehe jemand auch nur eine Silbe zu sagen vermochte, hatte Dmitrij, als wären sie grundschulkleine Kinder, erst Bogdan, dann Elisa eine kräftige Ohrfeige verpasst.
In der Folge hatte Bogdan während zweier Wochen nicht mit seinem Vater gesprochen, kein einziges Wort. Seither sehnte er sich nur umso mehr nach dem Tag, an dem er es sich würde leisten können, zusammen mit Elisa eine eigene Wohnung zu beziehen.
Es war sonderbar, aber genau diese damals in der Werkstatt als derart beleidigend empfundene Reaktion erschien Bogdan nun gerecht; erstmals verstand und billigte er die Handlung seines Vaters. Bogdan war froh, gemeinsam mit seinem Vater verhaftet worden zu sein, und er hoffte, jener Konflikt habe sich damit auch für Dmitrij wortlos erledigt.
Beim nächsten Halt waren kurz nach dem Gepolter der Stiefel auch Schreie zu hören, kreischende Frauenstimmen, und die dumpfen Schläge der Knüppel – Geräusche, die Bogdan fast den Magen kehrten. Nach einer langen Weile kletterte der junge Stjepan auf die Ladefläche, Stjepan Branković, mit dem Bogdan die Schule besucht und sich vor Jahren einmal wegen eines Mädchens geprügelt hatte. Damals hatte er ihn verspottet, weil sein Vater zu den Neureichen Serbiens zählte, zu jenen ekelhaften Geschäftsmännern, die nach der Privatisierung des Staatseigentums unglaublich reich geworden waren. Dass sie Stjepan nun festnahmen, konnte nur bedeuten, dass er mit seinem Vater zerstritten war – Bogdan fühlte sich gestärkt durch einen weiteren Verbündeten. Bloß fragte er sich, was wohl mit Stjepans Bruder geschehen sein mochte, mit dem Geige spielenden Buca Branković. Im Sommer 1995 hatte er sich zusammen mit Buca eine Zelle geteilt, denn sie hatten im Krieg gegen die Bosniaken in derselben Kompanie gedient und beide hatten sie den Befehl verweigert. Dass sie den schmalen Buca nun nicht ebenfalls verhaftet hatten, erstaunte Bogdan; für kurze Zeit war er ganz erfüllt vom Wunsch, das Glück möge diesen Mann, mit dem er sich freundschaftlich stark verbandelt fühlte, dieses Mal nicht verlassen.
Wenig später ließ der Lastwagen die Quartierstraßen Šabacs hinter sich und fuhr aus der Stadt hinaus.
Wenn die Dämmerung dies ermöglichte, studierte Bogdan die um ihn versammelten, von der holpernden Fahrt zu einem beständigen Nicken gezwungenen Gesichter. Seit er sie das letzte Mal gesehen hatte, waren die meisten Männer um Jahre gealtert, schienen sich auf jenes Gesicht vorzubereiten, mit dem man sie in die Erde legen würde.
Bogdan wünschte sich, dieser Gedanke wäre rückgängig zu machen. Was die Miliz gemeinhin mit Dissidenten anstellte, wusste er, und es gab wenig Grund zu hoffen, das Regime werde mit ihnen zivilisierter umgehen als mit den anderen. Er schaute sich das blitzende Metall der Handschellen an, das kalt in die Haut seiner Handgelenke schnitt; die Angst, gefoltert zu werden, stieg drohend in ihm auf. Das gemeinsame Leben mit Elisa, das eben erst begonnen hatte, lag bereits hinter dichtem Nebel. Ganz gleich, was man mit ihnen anstellen würde, das bisher gelebte Leben war zu Ende.
Sich dem Lärm, den Erschütterungen der Fahrt ergebend, biss sich Bogdan in den Ringfinger, biss mit seinen Zähnen ein schmerzendes Mal an genau die Stelle, wo gestern Abend noch sein Ehering ein anderes Leben verkündet hatte.
Eskortiert von knatternden Motorrädern, brachte sie der Lastwagen von dem am Knie der Save gelegenen Šabac nach der südöstlich von Belgrad gelegenen Kleinstadt Obrenovac, wo man sie vor einer von einem ausgedehnten militärischen Übungsgelände umgebenen Kaserne absetzte. Wie sich zeigte, waren in dieser Nacht auch anderswo Befehlsverweigerer und Dissidenten eingesammelt worden; insgesamt zählte Bogdan knapp sechzig Männer, die, bekleidet teils bloß mit einem Schlafanzug, im großzügigen Innenhof standen, zusammengehalten vom Lauf einiger Gewehre. Noch war es kühl, aber die eben aufgegangene Sonne strahlte mit einer Freundlichkeit, die Bogdan für geradezu absurd hielt.
Es ging ein Zucken durch die Reihen, als Vinko Tošorović aufkreuzte. Niemand hatte damit gerechnet, dem in dieser Region bestens bekannten, bereits in den Brüderkriegen Anfang der 90er-Jahre seiner Härte wegen berühmt gewordenen Kommandanten zu begegnen. Dass sich Tošorović, dieser vom Kriegsverbrechertribunal in Den Haag angeklagte, von Slobodan Milošević aber beschützte Befehlshaber höchstpersönlich mit Verweigerern und Dissidenten abzugeben die Mühe machte, bedeutete nichts Gutes. Das wusste Bogdan nur zu gut, denn es war Tošorović, der jenes Gefangenenlager geleitet hatte, in welchem er mit Buca Branković die schlimmste Zeit seines Lebens hatte durchmachen müssen.
Bogdan stand dicht bei seinem Vater, aber er fühlte, dass er bereits im Begriff war, diesen geliebten Menschen zu verlieren, dass sie alle einander verlieren würden. Dmitrij, die Philosophen oder Stjepan Branković – sie würden einander kaum beistehen können. Trost fand Bogdan allein in den Gedanken an Buca, der all das, was nun kommen mochte, nicht miterleben musste.
Mit seinen fleischigen, rot leuchtenden Wangen und dem wie eine exakt verlaufende Schnittverletzung im Gesicht stehenden Mund schritt Kommandant Tošorović vor der versammelten Menge auf und ab, begutachtete Gesichter, stellte sich dann breitbeinig vor den Männern auf, trug seine Anklage wie einen zusätzlichen Verdienstorden auf der Brust und erklärte, dass er Lust bekomme, diesen ganzen elenden Haufen mit einer einzigen Salve niederschießen zu lassen. Mit Staatsfeinden müsse man gerade jetzt, da Serbien Opfer werde einer internationalen, von den USA angeführten Verschwörung, kurzen Prozess machen. Leider sei Munition derzeit knapp, weil die Kosovo-Albaner sich in den Kopf gesetzt hätten, die Wiege der serbischen Nation für sich und ihre lächerlichen Unabhängigkeitsträume zu beanspruchen.
Damit endete seine Rede, eine bedrohliche Stille kehrte ein. Eine Bö bauschte die Krone einer Esche, hinter dem breiten Rücken Tošorovićs startete ein Panzer den Motor, ein Geräusch, das geeignet gewesen wäre, den Lärm einer Salve akustisch abzumildern. Aber es wurde nicht geschossen, auch fügte Tošorović seinen Worten nichts mehr hinzu, abgesehen von jenem sanften, kaum hörbaren »Hurensöhne«, mit dem er sich abwandte. Es war ihm anzusehen: Er war stolz auf die Anklage aus Den Haag, war stolz, zur Fahndung ausgeschrieben zu sein. Die Glut in den Augen Tošorovićs lähmte Bogdan, aber er ahnte, er würde zu vielem bereit sein, solange dies dazu beitragen konnte, sich loszureißen aus dem Bereich seiner Macht.
Die Dissidenten wurden ins Innere der Kaserne gebracht, wo alles ins Stocken geriet, als es hieß, es seien die Zellen im Keller bereits voll. Eine Diskussion entbrannte, ein dicker Milizionär, der die Meute am liebsten gleich hingerichtet hätte, fluchte über die Nachsicht Tošorovićs. Ein anderer polterte gegen die Idee, die Gefangenen in Zimmern unterzubringen, in welchen sie in den Luxus von Tageslicht kommen würden. In dem entstehenden Durcheinander verlor Bogdan den Blickkontakt zu seinem Vater, der sich inzwischen wahrscheinlich in der Menge all derer befand, die im Erdgeschoss in einen hinteren Teil des Gebäudes gedrängt wurden. Bogdan wurde mit den Übrigen in den dritten Stock kommandiert, wo man sie zu viert oder fünft in Zimmer sperrte, in denen es weder Wasser noch Toiletten, dafür aber große Fenster gab.
Gürtel, Zigaretten, die letzten noch vorhandenen persönlichen Gegenstände wurden konfisziert. Ein Team aus nervös arbeitenden Milizionären hob die Fenster aus den Angeln, und während die Gefangenen mit Maschinenpistolen in Schach gehalten wurden, mauerten drei Männer mit Backsteinen die Aussparungen zu. Sie wollten nicht verstehen, weshalb man diesem Pack nun auch noch wertvolles Baumaterial opferte; sie hörten auch dann nicht zu fluchen auf, als der letzte Stein verbaut war. Aber es war ein Befehl Tošorovićs, daran war nicht zu rütteln. Schließlich wurden die frischen Mauern im Halbdunkel mit langen Brettern vernagelt, damit war die Zelle fertig, die Tür wurde ins Schloss gezogen und der Schlüssel zweimal gedreht.
Das Warten begann.
Von seinen vier Mithäftlingen kannte Bogdan allein Stjepan, der, ab und an von seinen Füßen aufschauend, den Blick Bogdans suchend, erleichtert schien, das Zimmer auch mit ihm teilen zu können. Stjepans Augen erinnerten Bogdan an das Gesicht Bucas, an Bucas Art, unsicher unter den Brauen hervorzublicken.
Die Kaserne war alt und hellhörig; vom Flur her war jeder Schritt zu vernehmen, jedes von der Miliz geäußerte Wort, und deswegen war klar, dass auch die Miliz sie ziemlich gut hören würde. Dennoch und gleich am ersten Abend, als sie niedergeschlagen, mit unterdrückter Wut, angsterfüllt und hungrig beieinandersaßen, schilderte Stjepan die Geschichte seines Vaters. Dieser war, als Rechtsanwalt in Belgrad arbeitend, in den vergangenen fünf Jahren mit der Verteidigung von Mafia-Mitgliedern und rücksichtslosen Privatunternehmern reich geworden. Er spreche und denke mit bäuerlichem Akzent, stehe aber mit Krawatte in einem mit teuren Möbeln ausstaffierten Büro. Er trage einen Anzug von Versace, an seinem Handgelenk blitze eine überdimensionierte Rolex, und derzeit lasse er sich im Nobelviertel Dedinje eine Villa mit Schwimmbad bauen.
Was seinen Bruder Buca angehe, so habe er, fügte Stjepan an, nicht die geringste Ahnung, wie es ihm gelungen sei, der Verhaftung zu entgehen – Buca sei zwar klein und schmal, und der Bosnienkrieg habe ihn noch dünner werden lassen, er sei mit Oberarmen dünn wie ein Geigenhals zurückgekehrt –, aber die Milizionäre hätten ihr Haus derart rigoros durchkämmt, dass sich auch eine Küchenschabe nicht hätte verstecken können.
Später diskutierten die Männer über Politik, über den nationalistischen Wahn vieler Serben, die alle Albaner aus dem Kosovo vertreiben wollten, sprachen über die kriegsähnlichen Zustände, die infolge serbischer Massaker an Albanern in der Region Drenica herrschten. Schätzungsweise 450 000 Albaner waren seither auf der Flucht, und all die Männer, welche die Miliz nun rekrutiert hatte, sollten wahrscheinlich die Straßen sperren, die Maschinengewehre bedienen und die gewiss nicht ausbleibenden Gegenschläge der ebenfalls und nicht minder heftig einem nationalistischen Wahn anheimgefallenen UÇK abwehren.
Stjepan war sich sicher, die Nato würde bald schon mit ihrer Luftwaffe eingreifen, nicht nur, weil die internationale Gemeinschaft das Morden im Kosovo nicht länger tolerieren werde, sondern auch, weil die USA vitale Interessen hätten, im Kosovo eine für den Nahen Osten geostrategisch eminent wichtige Militärbasis zu eröffnen. Aber nicht einmal die Nato würde garantieren können, dass sie diese Kaserne in drei, vier Monaten unverletzt würden verlassen können.
Die Energie für derartige Diskussionen verging den Männern bereits am zweiten Tag, als die Miliz statt eines Essens lediglich einen mit Wasser gefüllten Krug ins Zimmer stellte. Wer den Krug zu lange am Mund hielt, wurde angeschrien; sogar Bogdan, obwohl er durchaus verstand, dass das ein Versuch der Miliz war, sie vertieren zu lassen, konnte sich nicht zurückhalten, einem anderen Gefangenen, der nicht aufhören wollte zu trinken, den Krug aus den Händen zu reißen. Darüber, dass sie auf dem nackten Boden zu schlafen hatten, beschwerte sich niemand mehr. Auch an die Handschellen hatten sie sich inzwischen gewöhnt.
Als Bogdan am fünften Tag zum Verhör abgeführt wurde, hoffte er, in den Fluren der Kaserne etwas über seinen Vater zu erfahren, ihn zu erspähen, einen alles sagenden Blick zu tauschen und seine Stimme zu hören. Eine idiotische Hoffnung, die er erst loswurde, als ihn die Miliz zu einem rückseitigen Treppenhaus schleppte, hinabführte ins Kellergeschoss und hineinschob in einen waschküchenartigen Raum. Vier Milizionäre waren dort im Licht einer nackten Glühbirne und im Geruch alter Seife versammelt, zwei von ihnen groß und muskulös, einer von ihnen war gewiss Mitglied der UDBA, denn er hatte Tonband, Papier und Stift bereitgelegt.
Als die Tür hinter ihm ins Schloss fiel, wurden Bogdan die Handschellen abgenommen, bloß um die Hände hinter seinem Rücken wieder zu fesseln. Der Strick um die Handgelenke wurde mit einem an der Decke befestigten Seil verbunden, und solange die Milizionäre mit diesem Seil beschäftigt waren, konzentrierte sich Bogdan angestrengt auf die zart rostzerfressene Hinweistafel an der Wand, die ihn über den ordnungsgemäßen Gebrauch der industriellen Waschmaschine informierte, die in diesem Raum bis vor einigen Jahren gestanden haben musste. Als die Milizionäre ihre Knotenarbeit erledigt hatten und ihm mit geringem Aufwand die Arme hinter dem Rücken hochziehen konnten, bis es teuflisch schmerzte, schaffte es Bogdan nicht mehr, sich abzulenken. Er kannte diese Methode von den Erzählungen seines Vaters; er wusste, dass man im Zweiten Weltkrieg vielen Gefangenen auf diese Weise die Schulter ausgekugelt hatte, was nicht nur ungemein quälend war, sondern in den meisten Fällen auch dafür sorgte, dass der Gefolterte ein ganzes Leben lang seine Arme nie mehr über den Kopf zu heben vermochte.
Die Milizionäre zogen am Strick, bis Bogdan von einem satten Schmerz durchströmt wurde, der ihn fühlen ließ, ihm werde der Schädel platzen. Seelenruhig fragte ihn der Protokollführer, wo sich sein Bruder Aca aufhalte.
Diese Frage überraschte Bogdan wenig, aber die Antwort würde auch die ärgste Folter nicht aus ihm herausbringen. Aca hielt sich illegal in Moskau auf, seine Studien in Linguistik und Literatur waren beendet, er hatte sich als Umgangssprache das Französische angewöhnt, um möglichst nicht als Serbe erkannt zu werden, sein Pass war abgelaufen und sein genauer Wohnort der Familie Mandić lange schon unbekannt: Aca, hochbesorgt um sich und die ganze Verwandtschaft, hatte vor langer Zeit aufgehört, Briefe nach Šabac zu senden, und er wünschte, keine zu erhalten. Wenn ihn Bogdan etwas wissen lassen wollte, ließ er den Brief, weil es Aca so wünschte, dem Institut für Ozeanografie zukommen, einer renommierten Bildungsstätte der Lomonossow-Universität, in der sich Aca umtrieb.
Dass die Uniformierten nicht zufrieden waren, als er ihnen sagte, er habe seit über einem Jahr nichts mehr von Aca gehört, überraschte Bogdan nicht. Er band seinen Blick fest an der Hinweistafel der inexistenten Waschmaschine, die Fragen wurden schärfer. Während einer vollen Stunde wurde er derart gefoltert, dass er schließlich erbrechen musste. So lange, bis sein leerer Magen nur mehr bissige Säure hergab, worauf abermals Knüppel und Flüche auf ihn niedergingen. Wortlos schleppten sie ihn hernach zurück ins Zimmer, zurück zu den anderen, die eine ähnliche Behandlung noch vor sich hatten.
2. KAPITEL
BAKU UND VELAMIR, ASERBAIDSCHAN
An Bord einer betäubend lauten, weniger von Technik als von unbegründetem Optimismus zusammengehaltenen Propellermaschine der aserbaidschanischen Fluggesellschaft saß steif und stumm, eingeklemmt zwischen einem Fenster, aus dem er aufgrund hartnäckiger Flugangst nie blickte, und einem elegant gekleideten, scharf gewürztes Fleisch in sich hineinschaufelnden Fotografen, der schmale und immer etwas staubig wirkende Thomas Steinhövel, ein dreiunddreißigjähriger, nach einem besser bezahlten Beruf sich sehnender Journalist, dem, obwohl er lange schon saß, unwohl war in den vielleicht doch zu kleinen Lederschuhen, die er am Tag vor der Abreise in einer Langenthaler Brockenstube gekauft hatte, und der nun ahnte, dass dieser unbekümmerte, um sieben Jahre jüngere, üblicherweise für finanzkräftige Werbefirmen arbeitende Fotograf, dieser kleine, schwarz gelockte, auch aus hundert Metern Entfernung als Italiener zu erkennende Gerardo Gambelli, mit dem zusammen er das erste Mal unterwegs war, unter einer bezahlbaren Unterkunft gewiss nicht dasselbe verstehen würde wie er. Aber so war es immer: Für fast jede Geschichte gab ihm die Redaktion einen anderen Fotografen, eine andere Fotografin mit, meistens waren das chaotische Anfänger, die es aufregend fanden, auch einmal für die Presse arbeiten zu können, oder es waren berufsnaiv von Projekt zu Projekt eilende, meist magersüchtige Kunsthochschulabgängerinnen oder aber finanziell sorgenfreie, von ihren Kenntnissen überzeugte Berufstöchter, Menschen jedenfalls, die sich von einem bescheidenen Honorar nicht abschrecken ließen. Was Thomas Steinhövel mehr noch als die möglichen Schwierigkeiten mit Gambelli beschäftigte, waren die bitteren, in ihren Wiederholungen störrischen Gedanken an Martina, die ihn vor zwei Wochen verlassen hatte, weil er, wie sie ihm vorgeworfen hatte, dauernd unterwegs sei, weil er sich, abgesehen von seinen Recherchen und Reportagen, für nichts Zeit nehme, wobei sie vollkommen ignorierte, dass er sich, dieses Problem sehr wohl erkennend, bereits darauf eingestellt hatte, die nächste Reportage so zu terminieren, dass sie hätte mitreisen können. Aber diese Überlegungen führten zu nichts, die Frau war weg, Steinhövel wusste es, und von der auf seinem Schoß liegenden New York Times war auch keine Lösung zu erwarten. Er schlug das Blatt trotzdem nochmals auf, blickte kritisch auf den zuvor flüchtig gelesenen Artikel über die bürgerkriegsähnliche Lage im Kosovo und stellte erst jetzt fest, dass diese Zeilen verfasst worden waren von einem Korrespondenten, der im fernen Budapest hockte, stellte erst jetzt fest, dass also auch die New York Times kaum Geld mehr hatte, Journalisten dorthin zu schicken, wo wirklich Geschichte geschrieben wurde, und es folglich hinnahm, Artikel abzudrucken, die nicht viel mehr als das beinhalten konnten, was ein halbwegs kluger, hin und wieder durch die gängigen Fernsehkanäle zappender Korrespondent aus serbischer und kosovo-albanischer Propaganda an spröden Minimalwahrheiten herauszufiltern vermochte.
Halbwegs beruhigt, für die in Bern beheimatete Tageszeitung Der Bund arbeiten zu können, die altmodisch genug war, sich jeden Samstag in einer Beilage mit dem Namen Der große Bund den Luxus einer aufwendig recherchierten, schlecht bezahlten Reportage zu gönnen, faltete Steinhövel die New York Times wieder zusammen und freute sich bereits, seinen Text mit dem erfahrenen Marc Widmann besprechen zu können, einem eigensinnigen, koffein-, nikotin- und zeitungsabhängigen Redakteur, dem es immer wieder gelang, mit triftigen Argumenten auf Mängel und Ungenauigkeiten hinzuweisen, deren Behebung aus einer durchschnittlichen manchmal eine wirklich lesenswerte Reportage werden ließ.
Mit Gambellis Frage, ob er eigentlich wisse, dass er seine Schwester Marlene gut kenne, konnte Thomas Steinhövel erst nichts anfangen, dann aber erinnerte er sich, dass ihm Marlene, mehrere Jahre musste das nun zurückliegen, von einer stürmischen, bald einmal unglücklichen Liebe zu einem einigermaßen jungen, im Berner Obstberg-Quartier wohnhaften Italo-Secondo erzählt hatte, von einem dunkel gelockten, elegant gekleideten Typen, dessen Temperament und Leidenschaft sie zwar liebte, mit dessen Unverbindlichkeit und immer wieder auftretender Spontansehnsucht nach Distanz sie aber nicht zurande gekommen war und der, wie sich nach und nach abgezeichnet hatte, zwar ungemein heftig in sie verliebt gewesen sein musste, sich dessen ungeachtet aber wiederholt in den Netzen irgendwelcher Verführungen verstrickte – Steinhövel war sicher, dass Marlenes damalige Liebschaft Gambelli geheißen hatte.
»Ja«, sagte Steinhövel schließlich nüchtern und fühlte sich, als Gambelli dem nichts hinzuzufügen hatte, in seiner Vermutung bestätigt.
Dann wagte er doch einen Blick aus dem Fenster, von dem aus er die baumlos braunen oder von Gestrüpp bewachsenen Hügel so deutlich sah, dass die Maschine bereits beachtlich an Höhe verloren haben musste. Also beschloss er, sich spätestens im Moment der Landung von den Gedanken an Martina zu lösen und sich ganz auf die Gegenwart zu konzentrieren, was nicht besonders schwierig war, da die Maschine derart hart aufsetzte, dass Steinhövel für einen kurzen Moment glaubte, der Pilot habe vergessen, die Räder auszufahren.
Bei der Passkontrolle sah es zunächst so aus, als würde man von Gambelli, der zwei große Analogkameras und ein einem Minenwerfer nicht unähnliches Stativ mit sich schleppte, verlangen, sich bis auf die Unterhosen auszuziehen. Erst als Steinhövel seinen internationalen Journalistenausweis und die Akkreditierung vorlegte, rümpfte der Typ die Nase und nickte.
Erleichtert ließen Steinhövel und Gambelli die Halle hinter sich, standen alsbald auf einer einen großen Parkplatz überragenden Treppe und blickten in die Ferne, wo sich, verdüstert von trüber Luft, das Zentrum Bakus befinden musste. Getragen von einem kühlen Wind, schwebten über dem Parkplatz im getrübten Januarhimmel Dutzende von Krähen, deren Gekrächze trotz des irren Gehupes, das auf dem Platz herrschte, gut zu hören war. Ebenfalls gut zu hören war der linke Lederschuh Steinhövels; egal, wie er den Fuß auch abrollte, bei jedem Schritt gab der Schuh ein lautes Quietschen von sich – das musste der Grund sein, weswegen dieser optisch tadellose Schuh in der Brockenstube gelandet war.
Zweiunddreißig sowohl sich gegenseitig wie auch sich selber mit besseren Angeboten übertrumpfende Taxifahrer abwimmelnd, warteten Steinhövel und Gambelli auf einen gewissen Kamran, einen der einschlägigen Agentur gemäß ortskundigen Übersetzer, den Steinhövel gebucht hatte für diese Reportage, in der er berichten wollte über Baku und das Kaspische Meer, über den größten See der Welt, dessen Wasserspiegel in den letzten zwanzig Jahren um fast drei Meter gestiegen war, was sieben Städte und fünfunddreißig Dörfer unter Wasser gesetzt hatte.
Unvermittelt kletterte direkt vor ihnen ein stämmiger Mann mit roten Haaren aus einem prähistorisch anmutenden Mercedes und marschierte stracks auf sie zu; das Gesicht von Sommersprossen übersät, ruhten seine Augen unter dichten Brauen und strahlten, als empfange er langjährige Freunde.
Bei der Begrüßung stellte sich heraus, dass Kamran weder Deutsch noch Russisch verstand, sondern ausschließlich Azeri sprach. Für die Übersetzung ins Deutsche war die dem Beifahrersitz entsteigende Iryna zuständig, eine groß gewachsene Frau Ende zwanzig mit burschikosem Haarschnitt. Sie war vielleicht nicht das, was man gemeinhin schön nannte, in ihren Augen aber funkelte ein verschmitzter, selbstbewusster Charme, aus dem im Moment des von ihr verlängerten Händedrucks das Gefühl erwachte, mit ihr an einer privaten, nicht unromantischen Kleinverschwörung teilzunehmen. Steinhövel war überzeugt, mit ihr gut zusammenarbeiten zu können, aber er war auch sicher, dass Gerardo Gambelli, der in Bern sehr darunter litt, sich zwischen zwei Frauen entscheiden zu müssen, Mühe haben würde, Irynas Charme zu widerstehen.
Kamran sagte etwas, was sich ungemütlich anhörte.
»Wir müssen aufs Amt«, übersetzte Iryna, und Steinhövel, unsicher, wo er einsteigen sollte, blickte forschend zu Gambelli, der fest entschlossen wirkte, sich die Rückbank mit Iryna teilen zu wollen. »Vorn ist es gefährlich«, sagte Iryna zackig, womit Steinhövel und Gambelli auf die Rückbank verwiesen wurden, deren altes Kunstleder sich anfühlte wie unbenutztes Schmirgelpapier. Kaum hatten sie Platz genommen, zerrte Kamran am Schaltknüppel, trat kraftvoll in die Pedale und reihte den kumpelhaften Wagen ein in den dichten und schnellen Verkehr, in das große Gedröhne. Erst jetzt begriff Steinhövel, dass die Rechnung, die Kamran am Schluss des Auftrags stellen würde, Irynas Arbeiten wegen gewiss doppelt so saftig ausfiele. Das würde weitreichende Sparmaßnahmen erfordern – aber er erinnerte sich an den Vorsatz, sich ganz auf die Gegenwart zu konzentrieren.
Vertraut mit den bürokratischen Vorgängen in mittel- und osteuropäischen Ländern, neugierig auch, wie viele Stunden der Besuch auf dem Amt wohl verschlingen würde, fragte Steinhövel nach dessen Namen.
»Das Amt heißt ›Abteilung für Arbeit und Migration der Verwaltung des zentralen Rayons für innere Angelegenheiten der Stadt Baku‹«, sagte Iryna nach einigen Überlegungen und legte ein Lächeln in den Rückspiegel.
»Das klingt, als würde es mindestens fünf Stunden dauern«, sagte Steinhövel zu Gambelli, aus dessen Mund eine kleine Bö Zwiebelgeruch zu ihm herüberwehte, vielleicht mit ein Grund, weswegen Iryna es vorgezogen hatte, vorn zu sitzen. Gambelli nickte abwesend und schaute wieder durchs schmutzige Fenster auf die mit zahllosen Satellitenschüsseln geschmückten Plattenbauten, an denen sie vorbeirauschten.
Kamran zwängte seinen scheppernden Mercedes durch das Zentrum, in welchem es trotz des kräftigen Winds nach Öl, Erde und schlecht brennendem Feuer roch, und bretterte, als sich das Gedränge lockerte, durch Häuserzeilen mit erdfarbenen, vogelnestartig ausgekleideten Balkonen – die Agglomeration franste aus. Vögel kreisten, hielten ihre Schwingen regungslos im Wind, nahe einer Kreuzung lungerte ein Rudel von sechs, sieben Hunden in den Schatten einiger Zapfsäulen, ihre Bäuche hoben und senkten sich, die Zungen berührten beinahe den Asphalt.
Kamran hielt an, um zwei Frauen, die sich vor einem Gemüsestand unterhielten, nach dem Weg zu fragen. Ihre Gesichter waren nicht minder verrunzelt als die Kohlköpfe, die sie beschützend in Händen hielten, ihr Misstrauen war deutlich spürbar. Kamran musste ihnen Gambellis, Steinhövels und schließlich auch seine Geschichte erzählen, ehe die Frauen bereit waren, den Ortsunkundigen den Weg zu weisen. In einem großen Bogen erreichten sie den Stadtrand und nach weiteren Befragungen auch das Amt, das, am Ende einer mit tiefen Schlaglöchern beschenkten Straße gelegen, versteckt war in einem unscheinbaren, renovierungsbedürftigen Wohnblock. Die Schlange der wartenden Menschen reichte bis ins Treppenhaus, aber dank Irynas kräftigem Engagement mussten Steinhövel und Gambelli nur anderthalb Stunden warten, bis sie in eines der winzigen, von Regalen, Ordnern und Dokumenten verstellten Zimmer eingelassen und angehört wurden von einer blondierten Sekretärin, die eine gleichzeitig postmodern wie auch mittelalterlich wirkende, jedenfalls goldglänzende Bluse trug, ein Kleidungsstück, das sich nicht sonderlich anstrengte, weder die großzügigen Epauletten noch den weißen, stark einschneidenden Büstenhalter zu verbergen.
Als die notwendigen sechs Formulare ausgefüllt, unterschrieben, gestempelt und kopiert waren, als Iryna, Steinhövel und Gambelli die sauerstoffarme Luft der durchtriebenen postsowjetischen Bürokratie endlich verlassen konnten, fragte der stämmige, an seinen alten Mercedes lehnende Kamran mit einem Grinsen, das seinem Gesicht einen schulbubenhaften Anstrich verlieh, ob sie bereit seien für ein kühlendes Bad.
Schlechtes Wetter sah anders aus, gewiss, aber Steinhövel verstand die Frage nicht, denn der nächste Sommer war mindestens vier Monate entfernt. Das Grinsen Kamrans aber gefiel auch Gambelli, und neugierig stiegen sie ein.
Mit rotem Brusthaar, um die Lenden nichts als eine knapp geschnittene, zeitlos unmodische Badehose, spazierte Kamran zwei Stunden später auf pfostenhaft soliden Beinen in ein kitschig glitzerndes Meer. Hundert Meter weiter vorne, im gleißenden Licht des Nachmittags, stand ein dunkles Mädchen mit schwarzem Haar bis zu den Hüften in der Brandung. Velamir hieß das Dorf in ihrem Rücken; sie befanden sich nordöstlich von Baku und damit, falls man Kamrans Worten Glauben schenken wollte, am schönsten Strand der Welt. An einem Strand, der sich von anderen Stränden dadurch unterschied, dass es hier keinen Sand, keinen Kies, keine Felsen gab. Denn Kamran, weiter und weiter hinauswatend, war umgeben von wasserumspülten Pinien, wasserumspülten Kiefern, umstanden von wasserumspülten Akazien, stand auf einem von rotbraunen Nadeln bedeckten Boden und also mitten in einem Wald, in dessen Geäst sich nun ein Eichhörnchen von Baum zu Baum hangelte, in einem Wald, der langsam erstickte am salzhaltigen Wasser, welches diesen Küstenstreifen im Nordosten Bakus überflutet hatte.
Es war viel zu kalt, um zu baden, aber die karge Anmut dieser Natur beeindruckte Steinhövel, nicht nur, weil hier alles Pflanzliche dem Tod geweiht war, sondern, weil dieser Ort dem zum Trotz unglaublich schön war, zu pittoresk, um wirklich zu sein, zu absurd, um nicht zwei Doppelseiten in Anspruch nehmen zu dürfen. Zum Glück hatte Steinhövel mit Marc Widmann 21 500 Zeichen vereinbart, die maximale Länge für Reportagen im Großen Bund, und als einer, der sich immerfort ärgerte über den Sensationshunger der Presse, war er beglückt, unvermutet vor einer derartigen und derart stillen Sensation zu stehen. Überzeugt, die ersten entscheidenden Sätze der Reportage zu schreiben, füllte er in einer winzigen Handschrift mit einem geklauten Kugelschreiber sogleich anderthalb Seiten seines Notizbuchs.
Um nicht so mutlos wie Gambelli zu erscheinen, der, ganz in Irynas Nähe sitzend, an einem Objektiv herumschraubte, zog sich Steinhövel bis auf die Unterhose aus und watete, mager und blass wie er war, ins erstaunlich warme Wasser. Mit jedem Schritt wurde er in diesem bizarren Wasser von kleinen, zappeligen Viechern angegriffen, von Garnelen und Krebsen, die ihm in die Waden kniffen und an den Fußsohlen zwickten. Das Wasser hatte er sich schmutziger vorgestellt: Auch wenn da so etwas wie ein silberglänzender Ölfilm über allem lag, flitzte einige Male sogar ein kleiner Fisch an ihm vorbei, und nun, da er weder an die schmalen Honorare, die lächerlichen Pauschalspesen, die knappen Abgabetermine, die nicht existierenden Sozialabgaben dachte, war Thomas Steinhövel einen Moment lang glücklich, auf der Suche nach einer neuen Stelle erfolglos geblieben zu sein, glücklich, noch immer als Reporter arbeiten zu können.
Auf dem Weg zurück ins Trockene, zum geparkten Mercedes, wo Iryna wartete, schämte er sich dann doch, nie Geld auszugeben für Unterwäsche und deswegen in dieser verwaschenen, von einem restlos erschöpften Gummiband nur knapp an seiner Hüfte gehaltenen Unterhose auf diese gepflegte Frau zustaksen zu müssen.
Gambelli, der auf der Suche nach einem guten Bild durch den mehr oder weniger trockenen Teil des Waldes spaziert war, kam zurück, legte einen neuen Film in die Kamera, putzte die Linse des Objektivs mit einem Pinsel und fragte, ob man nicht bald etwas essen gehen könne.
Kamran, sichtlich stolz, dass es ihm gelungen war, Steinhövel ins Wasser zu locken, sagte, er lade gerne alle auf ein Bier ein, habe aber zuvor einen privaten Transportauftrag zu erledigen. Also chauffierte er Iryna, Gambelli und den nun doch fröstelnden Steinhövel in Velamir zu einem noch nicht überfluteten Lokal und versprach, in einer Viertelstunde zurück zu sein.
Vor dem Eingang saß ein Beinamputierter mit hölzernen Krücken, und drinnen, im staubigen Licht über den kurzbeinigen Tischen, hatte sich ein halbes Dutzend Männer versammelt, sie husteten und redeten, was sich so einfach nicht unterscheiden ließ.
Die drei setzten sich, schauten sich um. Der Boden war gekachelt in gesprenkeltem Türkis, die Wand pink. Von der Diele baumelte ein hölzerner Ventilator, ein Fernseher ließ sein Kabel hängen wie ein vom Schlaf übermanntes Tier. Mit all seinen pathetischen Fanfaren erklang aus einem unsichtbaren Lautsprecher Forever Young, aber von einem Schankwirt, bei dem etwas hätte bestellt werden können, fehlte jede Spur.
Steinhövel hatte erwartet, dass eventuell seine quietschenden Lederschuhe, sicher aber die bestrickende Iryna in diesem allein von Männern besuchten Lokal sofort alle Blicke auf sich ziehen würden, aber es passierte nichts, die Männer husteten, redeten und kümmerten sich nicht, ob die Fremden bedient wurden.
So saßen sie und warteten. Während Gambelli schweigend hungerte und sich Steinhövel nach einem wärmenden Tee sehnte, erzählte Iryna gestenreich von ihrem Traum, einmal nach Paris zu fahren. Die Vorstellung von Paris als der schönsten Stadt der Welt schien für sie eine unumstößliche Wahrheit.
Durch eine Hintertür erschien Kamran und stellte sich hinter den Tresen mit einer Selbstverständlichkeit, die klarmachte, dass er nicht nur Chauffeur eines Privattaxis, sondern auch Schankwirt war. Steinhövel gefiel dies, weil er damit rechnete, im ersten Stock mit Gambelli für die nächsten zehn Tage ein billiges Zimmer beziehen zu können.
Zu viert saßen sie dann am Tresen dieser eigentümlichen Bar, tranken helles Bier, prosteten sich zu und kamen ins Gespräch. Während Gambelli auch das zweite Glas umgehend leerte, erklärte Steinhövel, dass er sich wünsche, in den kommenden Tagen noch mehr überflutete Gebiete zu besuchen, erklärte, dass er mit dieser Reportage versuchen wolle, widersprüchliche Erklärungen zum steigenden Wasserspiegel einander gegenüberzustellen; er nannte Namen von Geografen und Ozeanologen, mit denen er bereits vor einigen Wochen ein Treffen vereinbart hatte. Falls er die Redaktion überzeuge, sagte Steinhövel, so hoffe er, zusammen mit den Bildern Gambellis drei ganze Zeitungsseiten füllen zu können.
Stets darauf achtend, dass sich die Gläser nie leerten, schüttelte Kamran, als Iryna das Wort »wissenschaftlich« übersetzte, kräftig lachend den Kopf und fuhr mit seiner Hand durch die Luft. Die Schilderung, dass sie hier in einer Schankstube hockten, die vor wenigen Jahren noch vierzig Meter weiter vorne gestanden hatte, in einer Kneipe, die er, Kamran, mithilfe eines Baukrans hierhergezogen habe, damit die Eingangstür nicht mehr im Meer stand, faszinierte Steinhövel.
Als die Dämmerung hereinbrach und Kamran als Schankwirt abgelöst wurde, führte er Iryna, Gambelli und Steinhövel auf einer langwierigen Fahrt durch einen zähflüssigen Verkehr hinein nach Baku, auf einen zentralen Platz, wo prunkvolle Gebäude im käsig gelben Licht eine eindrucksvolle Kulisse bildeten. Jählings bog Kamran auf einen Parkplatz ein und bat seine Gäste auszusteigen. Steinhövel ging davon aus, dass es sich um eine Sicherheitsmaßnahme handelte, als Kamran sie aufforderte, ihr Gepäck mitzunehmen. Als er aber sah, dass Kamran schnurstracks auf den Eingang des mit fünf Sternen verzierten Hotel Moskwa zusteuerte, wurde ihm unwohl. Einer Reportage war es meist zuträglich, privat beherbergt zu werden, und wenn dies nicht möglich war, stieg Steinhövel ausnahmslos in sternlosen Unterkünften ab – sogleich wurde ihm klar, dass er nicht nur Gambelli, sondern auch Kamran würde erklären müssen, aus finanziellen Gründen nicht in einem derart luxuriösen Hotel übernachten zu können.
Besorgt wandte sich Steinhövel an Iryna, während Kamran bereits an einem mit Messingeinsätzen verzierten Holztresen vor einer hübschen Rezeptionsdame stand, deren Haare derart kunstvoll hochgesteckt waren, dass er für einen Moment wünschte, es gäbe zum Schutz derartiger Kostbarkeiten so etwas wie ein Unesco-Weltfrisurerbe.
Kamran, der bisher eher wie ein Landwirt gewirkt hatte, offenbar aber mühelos gehobene Umgangsformen an den Tag legte, unterhielt sich mit der Rezeptionistin wie mit einer Vertrauten.
Iryna packte Kamran am Unterarm und schickte sich an, ihm das Problem zu schildern, der aber erklärte, die Zimmer seien reserviert, gute, saubere Zimmer, die beiden Herren würden sich gewiss wohlfühlen. Hinter ihm wedelte die Rezeptionistin bereits mit zwei Schlüsseln durch die distinguierte Luft.
Als Steinhövel begriff, dass nicht nur eines, sondern sogar zwei Zimmer reserviert worden waren, blieb ihm erst einmal der Mund offen stehen, dann starrte er verzweifelt auf seine quietschenden Lederschuhe. Iryna erklärte ihm, dass es in Baku aufgrund des Generalverdachts auf homoerotische Neigungen für zwei Herren nicht möglich sei, ein Doppelzimmer zu belegen. Ebenso wenig sei es möglich, Reservierungen zu stornieren. Es sei schwierig genug, ein Hotel zu finden, das bereit sei, Ausländer ohne staatliche Einladungen zu beherbergen, Kamran habe sich gewiss außerordentlich bemüht.
Hilfesuchend sah Steinhövel zu Gambelli.
Der blickte sich um, fuhr sich mit der rechten Hand durch die Locken, zuckte mit den Schultern und sagte: »Ich weiß zwar nicht, wie die Zimmer sind, aber ich finde das Hotel ganz in Ordnung.«
Steinhövel seufzte. Und er ärgerte sich über Gambelli, der vor allem für solvente Firmen fotografierte und also, wenn sie die Reportage hinter sich gebracht hätten, wieder dick würde verdienen können, während er, Steinhövel, vor der Wahl stünde, sich entweder um die nächste Reportage oder einen anderen Job kümmern zu müssen.
Es schmeichelte ihm zwar, von Gambelli für einen erfolgsverwöhnten, gut verdienenden Reporter gehalten zu werden, aber Gambelli hatte wohl noch nicht begriffen, dass es, weil vielen gut verdienenden bereits gekündigt worden war, nur noch schlecht verdienende Journalisten gab. Zudem ärgerte er sich, überall auf der Welt als reicher Schweizer zu gelten, während er nun, da das Einlesen der Kontokarte am Apparat übermäßig lange dauerte, bereits sicher war, nicht mehr genügend Geld auf dem Konto zu haben. Dann funktionierte die Bezahlung aber doch, was Steinhövel freute, denn es bedeutete, dass das Honorar für jene aus Ungarn berichtende Reportage, die er vor drei Wochen hatte publizieren können, eingetroffen sein musste. Allerdings bedeutete es auch, dass soeben ein nicht unwesentlicher Teil des Honorars aus seiner dünnen Karte herausgesogen worden war.
Während sie von einem Liftboy und der stolzen Rezeptionistin in den dritten Stock begleitet wurden und ihnen auf dem Flur zwei Putzkräfte mit rosa Schürze, rosa Haube und vanillefarbenem Staubwedel begegneten, vergrub sich Steinhövel stumm in die Hoffnung, Marc Widmann gleich nach der Heimreise eine höhere Spesenpauschale abringen zu können, während Iryna, angetrieben von Gambelli, die beiden erstaunlich gekleideten Reinigungsdamen davon zu überzeugen versuchte, sich in den nächsten Tagen einmal bei Tageslicht für ein Porträt zur Verfügung zu stellen.
»Morgen sind wir nicht mehr hier«, hätte Steinhövel am liebsten gezischt, aber er hielt sich zurück.
»Die Zimmer sind die besten unseres Hauses«, sagte die Rezeptionistin, aber Steinhövel überließ es Gambelli, erfreut zu lächeln.
Elend sich fühlend, nahm er den Zimmerschlüssel entgegen. Nicht über horrend teure, altmodisch gekleidetes Reinigungspersonal beschäftigende Hotels, sondern über das Kaspische Meer wollte er schreiben, das war sein Auftrag, und nun zerbrach er sich den Kopf darüber, wie er diesen unbrauchbaren Luxus wieder würde loswerden können.
Zu seiner eigenen Überraschung war er froh über Kamrans Vorschlag, noch etwas trinken zu gehen. Diesmal fehlte es Steinhövel nicht an Gründen, mit der Trinkgeschwindigkeit Gambellis mitzuhalten.
Ihren dunklen Augen gegenübersitzend, erzählte der im angetrunkenen Zustand leicht schwatzhaft werdende Steinhövel einer ihm besser und besser gefallenden Iryna, wie er sich vor sieben Jahren aus idealistischen Gründen dafür entschieden habe, auf eine feste Anstellung und ein geregeltes Einkommen zu verzichten, um mittels aufwendiger Reportagen Licht in sonst von den Medien nur selten erhellte Landstriche zu bringen. Dafür habe er seine damalige Wohnung aufgegeben und sei aus Bern weg- und aufs Land, nach Langenthal, gezogen. Als Steinhövel anfing, von seinen Mitbewohnern zu erzählen, davon, dass er sich, um Schlaf zu finden, Gummipfropfen in die Ohren drücken müsse, davon, dass es ihn störe, morgens um drei Uhr auf dem nächtlichen Weg zur Toilette in der Küche einen Spaghetti kochenden und Goethes Faust rezitierenden Mitbewohner anzutreffen, einen kulturell in Italien verwurzelten Langzeitgermanistikstudenten, dass es ihn störe, wenn Rexhep, der junge Kosovo-Albaner, bis weit nach Mitternacht mit vier anderen, sich in der Lautstärke überbietenden Kosovaren die Zukunft ihres Landes verhandle, dass es ihn störe, wenn Jörg, der dritte Mitbewohner, ein Heavy-Metalabhängiger Langzeitarbeitsloser, während Stunden die Toilette blockiere, um dort, vor dem einzig verfügbaren Spiegel, zu prüfen, ob sich seine herumgewirbelte Mähne während des ausgeklügelten Luftgitarrenspiels stilecht verhalte, fiel ihm mit einem Male auf, wie wenig ihn Iryna beachtete, wie nahe sie an Gambelli herangerutscht war, wie sehr sie sich in Gambellis Gesicht und seine in betörender Regelmäßigkeit sprießenden Bartstoppeln vertiefte. Enttäuscht hielt Steinhövel den Mund und überließ das Gespräch den anderen.
Da Kamran gerade mit seinem Telefon beschäftigt war, entschuldigte sich Steinhövel, eilte zur Rezeption und erklärte dort der zuvorkommend lächelnden Rezeptionistin in seinem besten Russisch, dass es sich um ein Missverständnis handle – er und Gambelli würden leider nicht hier übernachten können. Die Rezeptionistin lächelte unentwegt, jetzt aber war es ein Lächeln, mit dem sie ihn zum Teufel schickte. Telefonisch hielt sie Rücksprache und wickelte, ohne auf ihr Lächeln zu verzichten, unmotiviert die Telefonschnur um den Zeigefinger, bis dieser vollständig ummantelt war. In Gedanken an Marc Widmann drückte sich Steinhövel unter der Tresenkante beide Daumen. Schließlich willigte sie ein, die zweite Nacht zu stornieren.
Als Steinhövel erleichtert zur Bar zurückkehrte, fand er Kamran dort allein hinter einem abermals gefüllten Glas. Gerardo und Iryna seien spazieren gegangen, erklärte Kamran, lächelte und prostete ihm zu.
Nach Mitternacht, Steinhövel hatte auf dem unangenehm teuren Laken bereits Schlaf gefunden, wurde er geweckt von weiblichem Gekicher und männlichem Geflüster, das durch die für ein Luxushotel extrem dünne Wand aus Gambellis Zimmer zu ihm drang. Aufgebracht marschierte er auf und ab, machte sich Notizen, dann steckte er sich zwei gelbe Stöpsel in die Ohren, bemühte sich, ruhig zu atmen, und legte sich wieder hin.
Als er anderntags nach einigen Irrgängen durch den kolossal weitläufigen Bau endlich den Speisesaal fand, fiel ihm ein ganz hinten im Saal sitzendes, innig sich küssendes Paar auf. Er benötigte einige Augenblicke, bis er erkannte, dass es sich um Gambelli und Iryna handelte.
Schnellen Schrittes verließ Steinhövel den Saal, packte seine Tasche, fluchte, den langen Flur abschreitend, über Gambelli, warf ihm vor, eine Reportage mit einem amourösen Sonntagsspaziergang zu verwechseln, knallte, mit seiner Tasche in der Lobby angekommen, den Schlüssel auf den Tresen und machte sich auf, ein billiges Hotel zu suchen.
3. KAPITEL
BERN, SCHWEIZ
Weil sie nicht gerne in vollbesetzten Bussen unterwegs war und sich abends, nach langen Stunden im Büro von Amnesty International, die sie über Akten gebeugt und hinter Bildschirmen verbrachte, nach frischer Luft sehnte, ging die bald sechsunddreißigjährige Marlene Steinhövel auch heute Abend zu Fuß nach Hause, selbst wenn es nicht wirklich zutraf, dass sich dank dieser Spaziergänge ihre Gedanken besser von der Arbeit lösten. Sie hatte die Drogenabgabestelle, die Lorrainebrücke und den Anstieg zum Viktoriaplatz bereits hinter sich gebracht, als sie an einem Tramhaltestellenunterstand in der Moserstraße eine handgeschriebene Anzeige entdeckte: Junge Ratten zu verkaufen. Auch Schlangenbesitzer dürfen sich melden. Marlene überlegte nicht lange, wählte die Nummer und sagte, kaum hörte sie eine grobe Frauenstimme, dass sie die jungen Ratten unbedingt kaufen wolle. Weil es still blieb am anderen Ende der Leitung, war sich Marlene sicher, dass die Ratten vor einer Viertelstunde an eine massige, lethargische Schlange verfüttert worden waren. Aber die Frau hustete, räusperte sich und fragte, wann sie sich die Tiere würde anschauen können.
»Freunde nennen mich Dan«, sagte die Frau keine zwanzig Minuten später und bat Marlene einzutreten. Tapeziert mit Harley-Davidson-Postern, US-Flaggen und Airbrush-Bildern mit einsamen, einen vollen Mond anheulenden Wölfen, herrschte in dieser im Norden Berns, fast schon in Ostermundigen gelegenen Blockwohnung ein sonderbarer, tierisch anmutender Geruch. Dan, die noch ein paar Jahre vor sich hatte, wollte sie so alt werden, wie sie aussah, strich sich schwarze Strähnen aus der Stirn, schlurfte in schwarzen Lederhosen und einem viel zu großen, in wilden Farben bedruckten Shirt in die von einem Fernseher dominierte Stube, zeigte auf ein fleckiges, von Tierhaaren bedecktes Sofa und bat Marlene, Platz zu nehmen.
Erstaunt betrachtete Marlene die am Boden liegenden Kleider, die schwarz glänzenden Motorradhelme, die beiden Albino-Kaninchen, die in einem Käfig neben dem Sofa gehalten wurden, setzte sich auf das behaarte Polster und war mehr und mehr überzeugt davon, den sonderbaren Geruch auf tierischen Urin zurückführen zu müssen. Nun schämte sie sich, auf das Inserat reagiert zu haben – ihr schien, als sei sie nur hier, weil sie, falls dies möglich wäre, gerne auch Schlangen von einer vegetarischen Lebensweise überzeugt hätte.
Dan, die kurz in der Küche verschwunden war, kam zurück mit zwei Dosen Bier, setzte sich hin, legte ihre schwarzen Socken neben die beiden Aschenbecher auf den Salontisch, riss die Dosen auf, stellte eine vor Marlene hin, fragte, ob sie Schlangen halte, und begann zu trinken.
»Nein«, sagte Marlene. Unsicher betastete sie die Bierdose.
Statt zu antworten, nahm Dan nochmals einen großen Schluck Bier.
Um freundlich zu wirken, schickte sich Marlene an, auch vom Bier zu trinken, aber die still schwelende Frage, mit welchem Urin diese klebrigen Dosen wohl besudelt worden waren, hemmte sie.
Noch weniger gelang es ihr, sich mit Dan zu unterhalten. Dan schien das nicht zu stören: Kaugummi kauend trank sie aus ihrer Dose und hielt diese mehrmals zu ihrer linken Schulter, auf der unvermittelt, wohl aus den Tiefen ihres Oberteils aufgetaucht, eine dicke Ratte saß, die erst am Bier schnupperte, um dann ihre spitze, blassrosa Nase in Marlenes Richtung auszustrecken. Vielleicht hatte ihr Bruder Thomas – auch er ein Vegetarier – eben doch recht, wenn er sagte, sie verzichte aus falschen Motiven auf Fleisch: Nicht Mitleid sei der richtige Antrieb, sondern die Einsicht, dass der Hunger auf der Welt zu überwinden wäre, würden die Menschen, statt Tiere zu mästen, das Getreide selber essen.
Als die Dose leer war, holte Dan die streichholzschachtelkleinen, tapsigen Jungratten aus einem Käfig, ließ sie auf dem Salontisch umherschnuppern, beobachtete gebannt Marlenes Gesicht und blickte, als sich dort Begeisterung zeigte, Marlene so freundlich an, als wähne sie die beiden Ratten bei ihr in guten Händen.
»Am liebsten würde ich sie natürlich behalten«, sagte Dan, »aber Julia hat jetzt auch noch fünf bekommen.«
Marlene wollte nicht wissen, wie viele Ratten in dieser Wohnung lebten, sie wollte einfach diese zwei hier, und sie wollte so rasch wie möglich an die frische Luft. Als sie zwei Zwanzigernoten auf den Tisch legte und Dans strahlende Augen sah, wusste sie, dass sie den Notausgang aus dieser beklemmenden Situation gefunden hatte.
In der Straßenbahn sitzend, die beiden Winzlinge verloren in einer Schuhschachtel auf ihrem Schoß, nagte ein schlechtes Gewissen an ihr, da sie Dan gegenüber behauptet hatte, sie sei bestens informiert, was die Haltung von Ratten betrifft. Dass die beiden Exemplare auf ihrem Schoß nicht mehr auf Muttermilch angewiesen waren, war so gut wie alles, was sie über diese Tiere wusste.
In der erstbesten Zoohandlung ließ sich Marlene von einem bärtigen Verkäufer, der wirkte, als hielte er zu Hause Waschbären, ein dünnes Buch mit dem Titel Mein glückliches Nagetier überreichen, kaufte eine große Packung Futtermischung und überzeugte ihn, ihr die beiden größten verfügbaren Gehege nach Ladenschluss nach Hause zu liefern.
Am Waffenweg angekommen, betrat sie das kühle, steinerne Treppenhaus und beachtete seit Langem wieder einmal die dort angebrachte Hausordnung, welche das Halten von Haustieren verbot. Sich selbst überzeugend, dass diese Ratten bedeutend zu klein waren, um als Haustiere zu gelten, erklomm sie die Stufen und hoffte, die Schachtel an ihren Mitbewohnerinnen vorbei unbemerkt in ihr Zimmer tragen zu können. Corinna, Monika und Claire jedoch saßen angeregt miteinander redend in einer dampfenden, von asiatisch anmutenden Gerüchen gefüllten Küche: Zwischen Marlenes Eintreten und der Frage, was für Schuhe sie sich gekauft habe, vergingen ungefähr anderthalb Sekunden. Diese Neugierde war typisch, brachte Marlene doch beinahe täglich etwas mit nach Hause, was für alle Mitglieder der Wohngemeinschaft von Interesse war: politisches Material, druckfrische Dokumentationen, Infoblätter aus der Sans-Papiers-Beratungsstelle, Petitionen, die unterschrieben sein wollten, diskussionswürdige Unterlagen aus dem Amnesty-Büro. Gestern erst hatte sie die Entwürfe jener Broschüren gezeigt, mit denen Amnesty gegen die umstrittene Asylgesetzrevision kämpfen wollte, über die das Schweizer Stimmvolk Anfang Sommer würde abstimmen müssen, und die Vermutung, sie habe sich neue Schuhe gekauft, kam – weil allen klar war, wie konsumkritisch und konsumgehemmt Marlene lebte, weil klar war, dass die teuren, in Österreich angefertigten Paul-Green-Lederstiefeletten, die sie sich vor anderthalb Jahren geleistet hatte, eine große Ausnahme darstellten – einer Beleidigung nahe. Mit einer gewissen Genugtuung stellte Marlene deswegen die Schuhschachtel zwischen die Reispfanne und die gebratenen Tofuwürfel auf den Küchentisch und hob den Deckel. Erst kreischten sie, bald aber reagierten die drei Frauen begeistert auf die kleinen Geschöpfe, fanden ihre tapsige Art großartig, ihre winzigen, auf ihren Unterarmen und der Handfläche Halt suchenden Pfoten süß.
»Es sind zwei Weibchen«, sagte Marlene. Ein bisschen klang es, als hätte sie sie selbst zur Welt gebracht. Sie hob eines auf, ließ es auf dem Handrücken herumspazieren, kichernd, bis die anderen auch an den Fingerbeeren gekitzelt werden wollten.
Als es klingelte, stand ein bärtiger Zoohändler mit zwei Gehegen vor der Tür.
»Nur herein!«, rief Marlene und lotste den Mann in ihr Zimmer, wo er, charmant von ihr bedrängt, mit einer Zange und etwas Gewalt die Maschendrahtwände so verformte, dass aus zwei großen Gehegen ein riesiges wurde. Corinna, Monika und Claire schauten interessiert zu, waren nun aber nicht mehr sicher, ob die seit langen Monaten schon ohne Liebesaffäre auskommende Marlene die Ratten nur der Ratten wegen gekauft hatte. Tatsächlich machte sich Marlene Sorgen, nicht attraktiv genug gekleidet zu sein, während sie Schulter an Schulter mit dem Zoohändler an den Gehegen werkelte: Das schwarze Hemd, das sie heute trug, stammte aus der Garderobe Gerardo Gambellis. Marlene wusste nicht mehr, mit welchem Liebesschwur er es ihr geschenkt hatte, vielleicht hatte sie es auch einfach nach einer Nacht bei ihm mitlaufen lassen. Auch wenn die Geschichte mit Gambelli lange schon zu Ende war, das Hemd trug sie noch immer gern. Grundsätzlich mochte sie das: Kleider mit Geschichte. Sie kaufte ihre Klamotten, von der Unterwäsche abgesehen, fast ausnahmslos in Secondhandgeschäften, nicht zuletzt, weil sie Firmen wie H&M, Tally Weil oder New Yorker für verachtenswert hielt und es ablehnte, ein System zu unterstützen, aufgrund dessen in Bangladesch und anderswo Frauen unter menschenunwürdigen, mitunter tödlichen Bedingungen zu arbeiten hatten und von der Schulbildung ferngehalten wurden.
Dass der Zoohändler sich nicht überreden ließ, nach seiner Arbeit zum Abendessen zu bleiben, war zwar für alle enttäuschend, allerdings gab es dank einer jüngst eingetroffenen Mail doch noch Grund zum Feiern: Nur vierzehn Tage nach dem Bewerbungsgespräch erhielt Marlene die Zusage für eine Stelle in der Abteilung Zeugenschutz am Internationalen Strafgerichtshof für Kriegsverbrechen im ehemaligen Jugoslawien in Den Haag – eine Nachricht, die Marlene vor Freude durch das Zimmer tanzen ließ. Dank ihrer Qualifikationen und der im Arbeitszeugnis aufgelisteten Superlative war Marlene zwar tatsächlich nicht ohne Hoffnungen auf diese Stelle zu dem Bewerbungsgespräch gereist. Nun, da sie die Zusage erhalten hatte, schien es ihr jedoch wie ein unzulässiges Glück. Diese Nachricht hatte auch ihre traurigen Seiten, denn bei Amnesty, wo auch Corinna arbeitete, fühlte sich Marlene zu Hause wie in einer gut eingespielten Lebensgemeinschaft.
Es wäre falsch zu behaupten, Marlene verstünde sich mit ihrem Bruder stets blendend, aber die beiden pflegten einen engen, von engagierten Diskussionen vertieften Kontakt. Weil Thomas für seine Reportagen oft im Osten Europas unterwegs war und sich seit Jahren schon für den Balkan interessierte, war klar, dass Marlene, kaum hatte sie mit ihren drei Mitbewohnerinnen eine Flasche Sekt geleert, die Nummer ihres Bruders wählte.
Aufgrund der schlechten Funkverbindung wurden sie mehrmals unterbrochen, was aber den Vorteil hatte, dass ihr Thomas ungefähr dreieinhalb Mal gratulierte. Er wollte wissen, worin ihre Aufgabe bestehen werde.
»Ich arbeite im Zeugenschutzprogramm«, sagte Marlene. »Was das genau heißt, werde ich sehen.«
Es entstand eine Pause, die nicht der schlechten Funkverbindung geschuldet war, und weil es sich für Marlene anhörte, als sei Thomas mit ihrer Antwort unzufrieden, fügte sie an: »Du wirst meine Hilfe kaum nötig haben, aber falls du einmal eine Reportage über Den Haag schreiben möchtest, werde ich dich gerne mit Insiderwissen beliefern.«
Marlene wusste, dass Thomas schon lange mit dem Gedanken spielte, eine Reportage über die Hintergründe der Kosovo-Krise zu schreiben. Seine Frage, ob sie sich auf den Umzug nach Den Haag freue, stimmte sie nachdenklich weit über den Anruf hinaus. Die Veränderungen, die unweigerlich auf sie zukommen würden, fühlten sich ja auch kalt an; es schien ihr, sie müsse dieses Bern, diese Stadt, in welcher sie auch dank ihres Studiums mit vielen Menschen befreundet war, in den kommenden Wochen noch richtig wertschätzen.
Aus diesem Grund verlängerte sie wenige Tage später nach Feierabend ihren Spaziergang. Als sie zum Stadttheater gelangte, in dessen Eingangsbereich sich eine Menschentraube drängte, musterte Marlene die auffälligsten unter den schön gekleideten Frauen, die an der einen Hand eine überteuerte Tasche, an der anderen einen überteuerten Mann führten. Sie betrachtete ein Plakat, das das Theaterstück eines ihr aus den Medien bekannten Lorenz Langeneggers ankündigte, eines Schweizer Theaterautoren, dem, so verhieß es das Plakat, immer wieder das Kunststück gelänge, das Dramatische im Alltäglichen aufzuspüren.
Als Marlene feststellte, dass sie ausnahmslos umgeben war von Paaren, wurde ihr bewusst, weswegen es ihr in den letzten Jahren nie gelungen war, sich in dieser Stadt wirklich wohlzufühlen. Manchmal tat es ihr – den ganzen Tag konfrontiert mit Menschenrechtsverletzungen – einfach nur weh, sich in der von Wohlstand dick gepolsterten Unbekümmertheit des schweizerischen Alltags bewegen zu müssen. Die Armut, auf der dieser Wohlstand zu guten Teilen beruhte, war längst aus der Schweiz ausgewiesen worden, und die Einsicht, mit ihrem Engagement für Amnesty keinerlei wirtschaftliche Veränderungen herbeiführen zu können, obwohl die Menschenwürde oft von ökonomischen Umständen abhängig war, löste in Marlene nur deswegen keine depressiven Grundstimmungen aus, weil ihr zu deutlich war, wie wenig sich mit Depressionen erreichen ließ.
Sie hätte nach Hause gehen können, den Laptop hochfahren und nochmals an jener Argumentationsstrategie arbeiten können, mit der Amnesty gegen die Asylgesetzverschärfung kämpfen wollte, oder aber sie hätte sich einen apolitisch-erholsamen Zimmerabend machen können, hätte sich auf ihr Bett und unter den staubigen Kronleuchter werfen, ayurvedischen Tee schlürfen, alten Jazz auflegen und mitsummen, im rührenden Roman Spaziergänger Zbinden lesen, die Ratten durchs Zimmer rennen lassen, sich die Zehennägel grün lackieren, die Stirnfransen schneiden und mit ihren über Jahre gesammelten Rezepten endlich so etwas wie ein eigenes Kochbuch beginnen können – aber oft genug hatte sie in den letzten Wochen ihre Abende allein im Zimmer verbracht, oft genug hatte sie sich konfrontiert damit, dass sie sich aufgrund ihrer politischen Haltung mehr und mehr an den gesellschaftlichen Rand gedrängt sah. Ihrem Bruder Thomas war es egal, der Minderheit anzugehören, stets ein Ja in die Urne zu legen, wenn die Mehrheit, besonders deutlich in den erzkonservativen zentralschweizerischen Kantonen, Nein stimmte, aber Marlene wollte nicht in eine Stimmung absacken, die sie in gut gekleideten Menschen nur apolitisches Amüsierpersonal erkennen ließ. Also gab sie sich einen Ruck und reihte sich ein in diese Abendgesellschaft. Unvermittelt stand sie vor einem Mann, der sie, gekleidet in einen schweren, modischen Mantel, mit dunkler Hornbrille auf der Nase und schwarzgrauem Kraushaar über seiner hohen Stirn, entfernt an Gerardo Gambelli erinnerte. Etwas größer und auch ein paar Jahre älter als sie war er. Schüchtern streckte er ihr eine Eintrittskarte entgegen und fragte, ob sie noch eine brauche.
Marlene prüfte die ihr hingehaltene Karte, blickte in das Gesicht des Fremden, dessen angenehme Stimme sie für ihn eingenommen hatte.
Im Vorverkauf habe er zwei Tickets für je vierundfünfzig Franken gekauft, jetzt möchte er eines wieder loswerden, sagte der Mann; mit zwanzig Franken sei er vollkommen zufrieden. Marlene sagte zu, legte ihm das Geld in die Hand und verabschiedete sich.
Auf der Theatertoilette betrachtete sie sich im Spiegel, prüfte, ob Frisur und Ausstrahlung saßen, zupfte den schwarzen, körbchenlosen Büstenhalter zurecht, schüttelte eine Unruhe ab, von der sie nicht wusste, was sie zu bedeuten hatte. Gewiss wäre es an der Zeit gewesen, sich wieder zu verlieben und die üppige Liebessehnsucht, die Gerardo Gambelli vor Jahren in ihr geweckt, immer wieder enttäuscht und abermals neu entfacht hatte, umzuwandeln in eine heftige und dennoch realistische Liebesbeziehung, aber jetzt, da sie bald schon in Den Haag leben würde, hatte sie wenig Lust, ihr Herz in Bern zu verschenken. Mit einem letzten kritischen Blick in den Spiegel verließ sie die Toilettenräume.
Die schweren, zum Theatersaal führenden Flügeltüren standen inzwischen offen, einige Zuschauer hatten bereits ihren Sitz aufgesucht, andere standen herum, lose verstrickt in ein Kleingespräch. Eingebettet in das gedämpfte Licht und die dumpfen Geräusche des Foyers, dachte Marlene, dass die Zuschauer schon vor dem eigentlichen Theater mit dem Theater begannen. Sie bemühte sich, nun nicht an die frappierenden Argumente gegen eine Asylgesetzrevision zu denken, und ließ ihren Blick wandern: Der Saal füllte sich, bestimmt war die Aufführung ausverkauft.
Als sich mitten in diese Beobachtungen ein bekanntes Gesicht schob, zuckte Marlene innerlich zusammen. Es handelte sich um den Mann im Mantel, der ihr die Karte verkauft hatte. Auf der Seitentreppe stehend, hielt er Ausschau nach seinem Platz.
Marlene war überzeugt, dass auch er erst jetzt begriff, was von Anfang an hätte klar sein müssen: dass sie nebeneinandersitzen würden. Kurz stellte sich Marlene seine Freundin oder Frau vor; die Annahme, dieser Mann sei geschieden, gefiel ihr besser als diejenige einer mit Grippe im Bett liegenden Ehefrau.
Der Mann schälte sich, als er Platz nehmen wollte, aus dem schweren Stoff seines Mantels und musste feststellen, dass für dieses Kleidungsstück kein Platz war, nirgends.