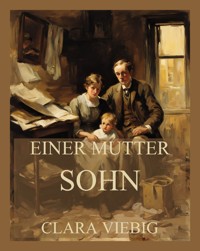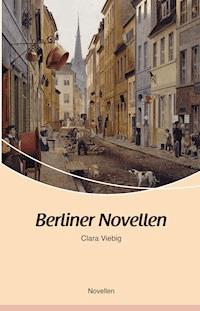
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Rhein-Mosel-Vlg
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In diesem Band »Berliner Novellen« werden zehn Großstadtnovellen Clara Viebigs zusammengefasst. Sie spielen im Berlin ihrer Zeit und in sehr unterschiedlichen sozialen Milieus. Dabei durchzieht wie ein roter Faden Clara Viebigs Menschlichkeit die Erzählungen. Ob im Erziehungsheim oder in der bürgerlichen Villa, ob unter Straßenjungen oder in der Ausbildungskompanie, stets ist den Protagonisten die Empathie der Autorin gewiss. Es ist diese tiefe Menschlichkeit, die das gesamte Werk Clara Viebigs prägt und ihren Ruf als große Erzählerin begründet hat.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 206
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
© 2017 e-book-Ausgabe Rhein-Mosel-Verlag Brandenburg 17 D-56856 Zell/Mosel Tel. 06542/5151 Fax 06542/61158 www.rhein-mosel-verlag.de Alle Rechte vorbehalten ISBN 978-3-89801-852-4 Ausstattung: Stefanie Thur Titelbild: Eduard Gaertner »Die Parochialstraße« Korrektur: Melanie Oster-Daum
Clara Viebig
Berliner Novellen
RHEIN-MOSEL-VERLAG
Die Einzige
Sie hatten sich nun doch geheiratet, trotz alles Abredens der Verwandten.
»Du weißt nicht, was die Ehe ist«, hatte die Mutter zur Tochter gesagt und die Stirn kraus gezogen. »Er hat bereits ein Leben hinter sich; du bist die erste nicht, die ihm gefällt. Du wirst ihn nicht fesseln, du bist zu jung für ihn, zu unerfahren, zu – zu – zu wenig pikant. Er bedarf der Abwechslung. Man weiß, – es wird mir schwer, aber ich muss es dir sagen, – daß er Geliebte gehabt hat, mehr als eine! «
»Ich bin seine einzige Geliebte, ich werde die einzige sein – ja, sieh mich nur nicht so an, Mutter – ich, ich ganz allein!« hatte die Tochter gerufen und den blonden Kopf mit leidenschaftlichem Schütteln in den Nacken geworfen. »Laß mich!«
»Törichtes Kind!« Die Mutter seufzte und dann weinte sie. »So tu, was du nicht lassen kannst und willst!«
Die Tochter hatte leise nachgeseufzt und die Hände heimlich gefaltet. »Lieber Gott, laß mich glücklich werden und ihn auch! – Warum sollte ich nicht glücklich werden?! Ich liebe ihn, und er liebt mich!« Und als der Bräutigam kam, hing sie sich ihm an den Hals und flüsterte ihm ins Ohr: »Liebst du mich, wirst du mich immer, immer lieben?! Nicht wahr, ich bin deine Geliebte, deine einzige Geliebte?«
Er sagte nichts, aber er küßte sie auf die Wangen, auf die Augen, auf den Mund, und sie erschauerte unter seinen Küssen.
So heirateten sie.
Nun war über ein Jahr seit ihrer Hochzeit verstrichen.
Ein trübtrauriger schwerer Novembertag. Der Regen schlägt eintönig mit hartem Trommeln an die Fenster, die blind von Nässe sind; man kann nicht auf die Straße sehen. Noch ist es nicht Abend, und doch ist es auch kein Tag mehr; die Grenze ist da, auf der sich Licht und Finsternis scheiden.
Ein graues Dämmern hockt in den Zimmerecken und kriecht über die Tapeten. Der Spiegel starrt wie eine blanke, undurchsichtige Scheibe von der Wand. Hinter dem hohen Eichenschrank knistert es, die geschnitzten Engelsköpfe an seinen Türen sind Fratzen geworden; das verglimmende Feuer im Kamin wirft einzelne zuckende Streifen über den Teppich.
Es ist sehr still in dem eleganten Raum. Die seidenen Vorhänge und Portièren hängen schlaff nieder, dunkler und dunkler werden sie in ihren Falten. Die Frauengestalt, die auf der Chaiselongue liegt, die Arme hinterm Kopf verschränkt, rührt sich nicht.
›Trom, trom, trom‹ macht der Regen an den Scheiben; immer dasselbe eintönige Geräusch. Es kann einen krank machen, ganz elend, man muß weinen und weiß selbst nicht warum. –
»Oh –!« Ein langer, zitternder Seufzer hallte durchs Zimmer, in der Stille klang er lauter; die Seufzende erschrak vor dem eignen Ton. Sie fuhr zusammen und richtete sich dann auf, ihre Füße hingen von der Chaiselongue herunter und baumelten unruhig hin und her. So saß sie, dem Kamin zugewendet.
Das Feuer glimmte wieder stärker, von einem Windstoß, der sausend durch den Schornstein herabfauchte, aufgestört. Der Feuerschein zeigte jetzt das bleiche Gesicht mit den weiten Augen, die ganze jugendlich-schmächtige Gestalt vom blonden Haar herab bis zur zierlichen Schuhspitze. Das waren noch die weichen Mädchenzüge mit der zarten Rundung des Kinns und den schwellenden Lippen, aber eine nachdenkliche Falte hatte sich zwischen den Brauen festgesetzt, und die Augen waren nicht mehr rund, kindlich-zärtlich, sie waren sehnsüchtigdunkelumrandet.
Nun stützte die junge Frau den Arm aufs Knie und legte die Wange in die Hand; sie starrte ins Feuer und wippte dabei mit der Fußspitze auf und nieder.
Ganz allein, ganz allein – –!
Der Wind im Schornstein machte melancholische Musik, langgezogen tutete er; der Regen trommelte stärker. Jetzt ist die Stunde, sich an jemand anzuschmiegen, die Arme um einen Nacken zu schlingen und zu flüstern: »Liebst du mich?«
Die Lippen der jungen Frau bewegten sich, sie murmelten etwas und dann zuckten sie schmerzlich. Die großen Augen zwinkerten, langsam füllten sie sich mit Tränen – da, horch, ein Klingeln an der Entreetür!
Die Einsame fuhr vom Sitz empor, ihr Herz klopfte. Wenn man oft und lange vergeblich gewartet hat, wird man nervös.
Mit bebenden Händen strich sie sich das Haar aus der Stirn – warum machten die draußen nicht auf, war denn keiner von der Dienerschaft da?
Sie sprang zur Stubentür und riß sie auf, ihr graute plötzlich so allein. Als bliese ihr ein kalter Hauch ins Genick, so sah sie sich hastig scheu um.
Der lange Korridor war ganz leer. Durch die bunten Gläser der Ampel blinkte das Licht trübe. Sie schienen alle fort zu sein, die Mädchen, sowie der Bursche; sie standen wohl auf der Hintertreppe und schäkerten mit andern. Da – wieder der schrille Ton der elektrischen Klingel!
Leise schlich die junge Frau zur Entreetür und sah durch das runde Guckloch. Draußen auf dem Absatz der Marmortreppe stand eine Gestalt im Regenmantel, einen kleinen Hut mit Schleier tief ins Gesicht gedrückt – eine Frau, ein Mädchen. Wohl irgendeine Schneidermamsell oder die Jungfer einer Bekannten.
Die Dame öffnete: »Was wünschen Sie?« Sie fragte es ganz freundlich, war sie doch froh, die eigne Stimme zu hören, begierig auf die eines andren Menschen. Die Stille bedrückte sie.
»Ist der Herr Rittmeister zu Haus?« fragte die draußen und schob sich langsam zur Tür hinein. Das Wasser tropfte von ihrem Regenmantel; wo sie stand, war bald eine kleine Lache. Unter dem einstmals eleganten Hut hingen ein paar mattblonde Haarsträhnen vor, der Schleier hatte mitten auf der Nase ein Loch.
»Nein, er ist nicht zu Hause. Wünschen Sie etwas?«
»N – – – ein – ja, ne – doch. Ja, ich möchte ihn sprechen!« Zögernd blieb die Fremde stehn und sah unschlüssig auf ihre Fußspitzen. »Ich habe so ’nen weiten Weg – wann kommt er denn heute wieder?«
»Ich weiß es nicht.« Über das hübsche Gesicht der Frau Rittmeister flog es wie Verlegenheit. Was sollte sie für Auskunft geben? Ihr Mann teilte ihr nie mit, wann er wieder kam. ›Kind, du mußt mich nicht quälen,‹ pflegte er zu sagen, ›frage nicht so viel – ja, ja, ich weiß schon, du liebst mich, du bist meine goldne Maus, meine kleine Puppe, meine einzige Geliebte!‹
»Ich weiß es nicht«. Die junge Frau sagte es tonlos und schlug die Augen dabei nieder. Die Blicke der anderen waren so unbequem, geradezu quälend; unter dem weißen, schwarzgepunkteten Schleier bohrten sie sich dunkel, halb dreist, halb scheu, hervor.
»So –? Sie wissen es also nich – na, denn entschuldigen Sie man!«
Die Fremde machte eine Art Verbeugung und nahm den Türgriff in die Hand; plötzlich zitterte sie, schwankte, erblaßte bis in die Lippen. Sie murmelte: »Entschuldigen Sie, ich bin nich wohl, ich bin krank gewesen. Un denn die vielen schlaflosen Nächte und das Patschwetter draußen – ach Gott!« Sie lehnte sich schwer gegen die Wand und starrt in das Licht der Ampel.
Jetzt sah die Frau Rittmeister erst, was für ein hübsches Gesicht die Unbekannte hatte: ein zierliches Näschen, wundervolle Augen, einen feinen Teint und schimmerndes, mattblondes Haar; die Schönheit verlor nur etwas durch den Mund mit den schlaffen Linien.
Ein unerklärliches Gefühl durchfröstelte plötzlich ihre Glieder, glitt den Rücken auf und nieder und setzte sich oben im Genick mit einem schmerzhaften Druck fest. Was wollte die Person?!
»Wünschen Sie etwas von meinem Mann?« fragte sie hochfahrend und angstvoll zugleich.
»Von Ihrem Mann – aha – Sie sind also die Frau Rittmeistern?!« Das Mädchen lachte schrill, riß die Augen neugierig auf und stand mitten im Korridor.
Einen Augenblick starrten sich die beiden Frauen an. Beide gleich hübsch, gleich schmächtig, jugendliche, noch nicht ausgereifte Gestalten; die eine im eleganten, langschleppenden Hauskleid, um die Füße der ändern eine schmutzige Regenlache.
Sie maßen sich vom Scheitel bis zur Sohle. Das Licht der Ampel spielte über beide hin; sie waren beide gleich bleich.
Im Korridor war es totenstill; unten im Haus ging eine Tür und klappte. Sonst nichts.
Jetzt hörte man ein paar tiefe unruhige Atemzüge, und jetzt sagte die Fremde – sie hatte ein heiseres angekränkeltes Organ –: »So jung sind Sie? Ne, so was! Sie können ja kaum zwanzig sein. Sagen Sie Ihrem Mann – ne, ne, lassen Sie man!« Sie drehte sich kurz um und griff wieder nach der Tür. »Man muß schon sehen, wie man alleine zurecht kommt. Ich wer’ Ihnen –« aus ihrem neugierigen Blick wird ein fast mitleidiger – »ich wer’ Ihnen keinen Krach machen. Ich –« ein rauhes Husten bricht ihre Rede ab, ihre schmächtige Gestalt erschüttert unter der Anstrengung.
»Was – was wollen Sie? Wer sind Sie?! – – Nein, Sie gehen nicht!« Mit einer heftigen Wendung vertrat die junge Frau der Hustenden die Tür. Ihre Lippen waren weiß geworden, ihr Atem flog: »Sie sind seine Geliebte – ich weiß es – Sie wollen was von ihm, Sie sind seine Geliebte, seine Geliebte, Geliebte – – –!« In wahnsinniger Aufregung wiederholte sie immer das letzte Wort.
»Na, ja doch, gnäd’ge Frau, beruhigen Se sich man! Ich nehme es ihm ja auch gar nicht übel, daß er sich verheirat’t hat. Das ’s doch immer so. Aber was für mich tun hätte er doch gekonnt!« Sie rückte den verschobnen Hut zurecht und zupfte den Schleier mit spitzen Fingern übers Gesicht. »Als ich noch bei der Gerstel im Modewarenmagazin war, hätte ich nich gedacht, daß es mir mal so schlecht gehn könnte. Wenn ich jetzt nachts so viel wach liege, muss ich weinen, daß ich mal so dumm war. Was ich eigentlich gedacht habe, das weiß ich selbst nich; ’s war nu mal so. Un wie er mir die nette Wohnung mietete, war ich so riesig fidel! Sie glauben gar nich, was wir da für famose Abende gehabt haben. Das is ja nu alles zu Ende, ach Gott ja, aber –«
»Kommen Sie herein,« sagte die junge Frau mit einer eigentümlich harten, metallisch klingenden Stimme. Sie zog die Fremde gewaltsam am Handgelenk hinter sich her ins Zimmer. Mit zitternden Fingern tastete sie am Hahn des Glühlichts herum – nun flammte das auf hinter blutroten Seidenschleiern. Es war alles ganz hell, grausam hell.
Mit weit aufgerissenen Augen starrte die elegante Dame das Mädchen an; Wut, Schmerz, Enttäuschung, bange Neugier lagen in ihrem Blick. Und nun stöhnte sie mit zuckenden Lippen: »Sie sind seine Geliebte, Sie waren seine Geliebte – schon lange – bis wann – erzählen Sie!« Die Stimme versagte ihr, sie ließ sich in einen Sessel fallen und schlug die Hände vors Gesicht.
»Gott, gnäd’ge Frau!« Das Mädchen stand mitten im Zimmer unterm Kronleuchter, der rote Schimmer der Lampenschleier warf einen blutigen Schein auf ihren blassen Teint. Ein triumphierendes Lächeln hob für Momente ihre kurze Oberlippe und verlieh dem Mund einen grausamen Ausdruck. Vergleichend glitt ihr Blick von dem Kleid der Dame zu dem eignen triefenden Regenmantel; aber nur für ein paar flüchtige Augenblicke blieb der grausame Ausdruck, dann wurde er mitleidig. »Gnädige Frau, haben Se sich doch man nich so,« – sie trat einen Schritt näher und tupfte der Schluchzenden auf die Schulter, – »so was kommt vor. Das konnten Sie sich doch ungefähr denken, so’n schöner Mann wie der Rittmeister! Darüber machen Sie sich man keine Illusionen. Ich erhebe ja auch gar keine Ansprüche, ich mache mir jetzt mal jar nischt mehr aus ihm. Mag er wieder ’ne andre an der Nase führen.« Sie schnippte mit den Fingern in die Luft, – »wenn se so dumm ist!«
»Sie lieben ihn nicht mehr – so haben Sie ihn nie lieb gehabt?« Die junge Frau ließ die Hände vom Gesicht gleiten und griff hastig nach dem Arm der anderen: »Haben Sie ihn nie lieb gehabt?«
»Oh – un ob!« Eine leichte Röte flog dem Mädchen über das blasse Gesicht. »Was glauben Sie wohl? Wenn er mir so mittags nachgestiegen kam, die Jägerstraße lang, und des Abends in Zivil am Geschäft vorbeistrich, und den Hut zog, und einen so ansah – – –! Ich hätte damals unseren Buchhalter heiraten können, ’ne ganz gute Partie, aber ich hatte für keinen anderen Augen im Kopfe, ich war wie besessen. Und denn machten wir Pfingsten ganz früh ’ne Partie nach’m Grunewald, ich hatte ’n weißes Kleid an und ’nen großen weißen Hut mit Rosen, den hatte ich mir von ’nem Pariser Modell abgesehn. Und da fuhren wir auf’m Wasser, un er war so reizend, er sagte immer: ›Meine süße Maus, meine einzige Geliebte!‹ – Un ich glaubte ihm. Liebe jnädige Frau, Sie werden es ja wohl selber wissen, wie einem so einer was Vorreden kann! Man is doch auch nur einmal jung, man kann wirklich nich dafür. Nu ging ich mit ihm. Er wollte nich, daß ich im Geschäft blieb, er richtete mir die Wohnung ein, nah bei der Kaserne. Tante, bei der ich gewohnt hatte, schimpfte erst, aber als es mir so gut ging, sagte se nischt mehr. Ich war so vergnügt. Wie er sich vorm Jahr verheiratete, da hab’ ich wohl geweint, aber es war nich so schlimm. Er kam doch oft abends und war immer sehr nett, und denn wurde das kleine Mädchen geboren, und ich war ganz närrisch vor Freude!« Sie atmete tief auf und preßte die verschlungenen Hände ineinander.
Mit vorgebeugtem Oberkörper reckte sich die junge Frau ihr entgegen: »Weiter – weiter!«
»Weiter?!« Die Miene des Mädchens verfinsterte sich plötzlich, den schlanken Leib schüttelnd, riß sie die verschlungenen Hände auseinander und ballte sie zu Fäusten. Ihre schwarzen Sammetaugen wurden stechend. »Der Lügner, der Betrüger! Seit ’nem halben Jahr hat er ’ne andere, jetzt weiß ich’s. Darum hat er sich nischt mehr wissen gemacht und is nich gekommen, und ich habe auf ihn gewartet, gewartet!« Der rauhe Husten erschütterte sie wieder wie vorher draußen an der Tür. »Erst hat er die Miete geschickt und auch sonst Geld, jetzt nichts mehr. Seit vier Wochen keinen Ton! Ich habe an ihn geschrieben – jawohl – keine Antwort! Wieder geschrieben – wieder keine Antwort. Die Kleine zahnt und schreit die ganzen Nächte; ich bin so ’runter, ich weiß selbst nich recht, was mir fehlt, ich bin« – sie drückte die geballte Faust gegen die Brust – »ganz kaput! Gestatten Sie!« Sie setzte sich mit ihrem nassen Regenmantel schwer auf den nächsten seidengepolsterten Stuhl.
Kein Laut jetzt. Zwei, drei, fünf Minuten verstrichen, keine der beiden Frauen sprach. Die roten Lampenschleier zitterten von der Hitze, ihr ganz leises Knistern wurde hörbar.
Endlich stand die junge Frau langsam auf, ihre weichen Züge waren hart geworden, gleichsam erstarrt. Sie senkte den Kopf: »Und was wollen Sie jetzt? Was soll ich tun?«
»Sie –?« Die andere sah sie verwundert an. »Sie?! Mit Ihnen habe ich doch gar nichts zu tun, was geht Sie das alles an? Aber Ihren Mann will ich sprechen, ich muß ihn sprechen, ich wer’ ihn sprechen, ich – ich – ich« – sie sprang wieder auf wie ein gereiztes Tier – »ich wer’ ihm den Standpunkt klarmachen, dem – dem Kerl!« Zornige Tränen brachen ihr aus den Augen. »Denkt er, ich soll verhungern, und der arme Wurm dazu – verhungern?!«
»Verhungern – – –!« Einem Echo gleich kam es von den Lippen der jungen Frau, mit einer unglaublichen Bitterkeit wiederholte sie das Wort: »Verhungern! Nein, das sollen Sie nicht!« Sie ging an ihren Schreibtisch und kramte darin. »Hier« – es waren mehrere Scheine, die sie dem Mädchen reichte – »mein Geburtstagsgeld von Mama. Mehr habe ich jetzt nicht, aber ich will Ihnen schicken, sobald Mama mir wieder etwas gibt. Sie können sich darauf verlassen. Bitte, gehn Sie jetzt, und – meinem Mann« – zögernd, fast widerwillig glitten ihr diese zwei Worte über die Lippen – »bitte, sprechen Sie nicht mit meinem Mann!«
»Das hat ja jetzt auch jar keinen Zweck mehr. Denken Sie vielleicht, ich will ihn ausquetschen, was ’rauspressen? Ne, gnäd’ge Frau, man hat doch auch seinen Stolz; ich will nur nich verhungern mit dem Kind, bis ich wieder Stellung gefunden habe. Wär’ ich nur erst gesund!«
Das Mädchen hustete wieder krampfhaft, in der Brust rasselte es dabei. »Ich hab’ mich erkältet im Wochenbett. – Aber, gnäd’ge Frau, ich habe Sie schon zu lange belästigt, ich danke Ihnen vielmals!«
Sie nahm die Scheine in die linke Hand und streckte die rechte, im schäbigen Glacé mit lauter aufgeplatzten Nähten, aus. »Sie sind sehr gut, gnäd’ge Frau, ich wünsche Ihnen alles Schöne, möcht’s Ihnen immer so gut gehn! Sie haben ja auch alles, was das Herz bejehrt!«
Wohlgefällig glitzerten die schwarzen Augen durchs Zimmer. Dann drehte die schmächtige Person mit einem Aufleuchten der Blicke die Scheine hin und her. »Ich kann das aber eigentlich doch gar nich von Ihnen annehmen, gnäd’ge Frau – so viel! Ich nehme Ihnen ja alles Geld mit!«
Die Frau Rittmeister machte eine abwehrende Handbewegung wie: ›Nehmen Sie nur!‹ Sie hörte kaum die Dankesworte, sie neigte nur den Kopf mechanisch.
Gott sei Dank, jetzt schloß sich die Tür, jetzt waren die schwarzen Augen fort!
Draußen verhallende Schritte auf dem Gang, die Entreetür fiel ins Schloß.
Wieder allein!
Mit einem wimmernden Laut bricht die Einsame zusammen, sie kann sich nicht aufrichten, nicht rühren, nur denken – denken.
Im Schornstein pfeift der Wind, der Regen trommelt an die Scheiben: ›Tromtromtrom, die Einzige!‹ – ›Huhuhuh, die Einzige!‹ – – –
Mit einem Stöhnen hält sich die junge Frau die Ohren zu; sie hört es doch, sie hört es immerfort: Die Einzige, die Einzige!
Der Sonnenbruder
Er hielt sich vorzugsweise gern im Freien auf, vom Morgen bis Mittag, vom Mittag bis Abend, und noch länger. Auf dem Schmuckplatz vor’m Landsberger Tor, besonders in den Anlagen des Friedrichshain, war seine Heimat. Da saß er auf irgend einer Bank.
Die Sonne meinte es gut mit ihm. Sie wärmte ihm den Rücken und schien ihm, wenn er gähnte, bis in den Magen. Behaglich streckte er die Beine weit von sich in den Sand; die Hände vergrub er in den Hosentaschen, die Mütze hatte er tief über die Augen gerückt. Man hätte ihn für eine Figur aus dem Panoptikum halten können, so unbeweglich saß er. Er lauschte dem Gesang der Vögel, die am großen Froschteich in den Büschen jubilierten.
Gelangweilte Kindermägde, den quietschenden Sportwagen vor sich herschiebend, hellgekleidete Buben und Mädchen, mit Eimer und Schüppe vom Spielplatz kommend, eilten an ihm vorbei. Schwitzende Pfennig-Rentiers, die gern ihre Zeitung im Freien lesen, geschwätzige Zimmervermieterinnen mit schlotternden Busen und Butterstullen, magere Jungfrauen mit verputzten Bandschnippelchen und feuchtschnauzigen Hündchen, alle mieden sie die grüngestrichene Bank, wo er saß. Höchstens ein Liebespaar, das im Drange seiner Gefühle nicht wußte wohin ließ sich beim Dämmerschein des sinkenden Abends, des regungslosen Zuschauers nicht achtend, bei ihm nieder; aber da floh er indigniert und suchte dunklere Schatten.
Der Nachttau störte ihn nicht. Den fröstelnden Schauer vertrieb er sich mit einem Schluck aus der Pulle, deren Pfropfen aus der hinteren Rocktasche ragte; nie versäumte er’s, sich die Flasche allabendlich in der nächsten Destille frisch füllen zu lassen.
Durch fortgesetzte Übung hatte er es dahin gebracht, im Sitzen schlafen zu können, das Liegen auf der harten Bank machte die Glieder zu steif. So brauchte er in der Frühe nur die Arme einmal über den Kopf zu recken, das Maul aufzureißen, daß die junge Sonne seinen hintersten hohlen Zahn vergoldete, und er war allert, zu neuen Taten bereit. Die Vögel tirilierten in allen Büschen dem Morgen entgegen; mit einem gewissen Stolz empfand es der Frühaufsteher: er war der erste Berliner, der die liebe Sonne sah. Liebkosend fingerte sie ihm um’s stopplige Kinn.
Menschenleer war noch der Hain, leerer als am späten Abend; keine leidigen kosenden Liebespaare, keiner, der sich mit Selbstmordabsichten hinter den Büschen am großen Teich verlor. Auch noch kein Schutzmann vigilierte – alles rein, keine blanken Knöpfe blinkerten!
Ach ja, die Polizei, wenn die nicht wäre! Wenn’s den verdammten Kerlen einfiel, eine Razzia abzuhalten, war man selbst im Hain nicht sicher. Dann hieß es: den Harmlosen gespielt, den müden Arbeiter vorgeschwindelt, der, vom Bau kommend, auf einer Bank vom Schlummer überfallen worden war.
Ede Papeczinski hatte eine instinktive Abneigung gegen alles, was Uniform hieß; wenn er nur eine von weitem sah, drückte er sich gleich um die nächste Ecke. Zwar fand er sich auch wohl ein, wenn die Wache am Kastanienwäldchen aufzog, oder die Truppen mit klingendem Spiel von der Parade auf dem Tempelhoferfeld durch die Friedrichstadt einmarschierten; aber es fiel ihm nicht ein sich unter die Schar der entzückten Rowdies zu mischen, die kameradschaftlich, rechts und links, in gleichem Schritt und Tritt, die Truppen geleiteten. Er kam nicht des militärischen Schauspiels wegen, nur einzig und allein um der Damen und Herren willen, die, neugierig gedrängt, auf dem Trottoir standen und so gut wie neue Taschentücher und auch Portemonnaies bei sich trugen. –
Nun suchte die Polizei schon eine ganze Weile nach dem stellenlosen Arbeiter Eduard Papeczinski. Ein Glück, daß er das bei Zeiten erfahren! Nicht, daß er was von der Polizei zu befürchten gehabt hätte, aber –
»Du, Ede«, hatte sein Freund, der Schnaps-Willem, gesagt, mit dem er öfters beim Gläschen zusammen gekommen und der ihn jetzt höchst geheimnisvoll auf einer Bank des Friedrichhains aufsuchte, »du, Ede, se suchen dir! In de Penne haben se schonst zweemal nach der jefragt. De sollst ieben, sagen se, irjendwo wärtser in irjend so’n Lausenest, ieben wie jeder Mutter Sohn. Jriffe kloppen, mit de Beene strampeln un – puff, vorbeischießen, det et knallt.«
Schnaps-Willem schnitt eine Grimasse: »Det wäre nischt vor mir, jut, det ik aus de Jahre ’raus bin! Aberst du, junges Huhn, du wirst der janz schneidig machen in de Uhneform. Haste die an’n Leibe, stellste ooch wat vor. Denn biste nobel, denn jehörste nich mehr mank de Karnallje!«
Puh – Uniform! Ede wurde von einem Grausen geschüttelt; schon das Wort »Uniform« machte ihm Aufstoßen. Unwillkürlich drehte er den Kopf hin und her, als fühlte er bereits die lästig würgende Binde am Halse. Au, und die Kommißstiefel drückten! Er war jetzt an Laatschen gewöhnt. Voller Entsetzen gedachte er seiner Militärzeit, der ganzen Drillerei für nichts und wieder nichts, der Märsche im Laufschritt, des Putzens des Schießprügels und der vielen Knöpfe. Aber da war er wenigstens doch noch ein paar Jahr jünger gewesen, schlanker in der Taille und behender auf den Beinen. Jetzt, seit dem Frühjahr, seitdem er nicht mehr bloß wochenweise, nein, gänzlich die Arbeit eingestellt, hatte er sehr an Embonpoint zugenommen. Das Essen machte es freilich nicht – das hatte er sich fast abgewöhnt – aber die Sonne nährte ihren Mann. Auf der märkischen Heide gab’s keine grüngestrichenen Bänke, auf denen man in beschaulicher Ruhe sich die Sonne in den Magen scheinen lassen konnte.
» – – Bataillon marrsch! Ganzes Bataillon kehrt! – – «
Da hieß es, die Beine geschmissen, daß der Staub in Wolken flog. Und dann nur Wasser zu trinken – Wasser – brr! Er schüttelte sich und stöhnte und sah sich wie hilfesuchend um.
»Mach der doch dünne«, flüsterte Schnaps-Willem und grinste pfiffig. »Eh’ se der ausbaldowern, dauert det noch ’ne Weile. Du wirst ooch den Kohl nich jrade fett machen. Dali! Ik weeß nich, uf wat de noch wartst!«
Recht hatte der Schnaps-Willem. Wo so viele Vaterlandsverteidiger übten, kam es wirklich auf einen weniger nicht an! Und Ede drückte dem Freund dankbar die Hand und verließ schleunigst die warm-besonnte, grüne Bank in den warm-besonnten grünen Anlagen. –
Acht Tage drückte er sich nun umher in allen möglichen dunklen Ecken; wie ein lichtscheues Tier traute er sich nur nachts heraus aus seinen Schlupfwinkeln: den düsteren Kellern abgelegener Baustellen, den verlassenen Bretterbuden und Sandhöhlen der Laubenkolonie des Ostens.
Nun nährte ihn gar nichts Warmes mehr – er durfte ja nicht in der Sonne sitzen. Die Flasche allein, die ihm Schnaps-Willem jeden Abend getreulich am geheimen Rendezvousplatz zusteckte, befriedigte das Knurren seines Magens nicht. Die Sonne, die Sonne! Er sehnte sich so nach ihr.
Um Mitternacht wenigstens schlich er nach der grüngestrichnen Bank im Friedrichshain, aber die Sonne schien ja nicht! Und zu allem Mißgeschick fand er noch so ein verdammtes Paar auf seinem Lieblingsplatz, und hinter dem Busch glaubte er plötzlich eine Uniform auftauchen zu sehen.
Da zitterte er und enteilte, floh durch die nachtstillen Straßen wie ein gejagter Hund und verkroch sich wieder weit draußen im Dunkel in einer halb eingestürzten Bretterbude.
Die Sonne des neuen Tages zog freundlich auf, aber nicht für den Flüchtling. Der lag in seinem Versteck auf dem Bauch, hatte die Ellbogen aufgestützt und stemmte den schweren Schädel zwischen die Hände.
Er versuchte zu schlafen, aber wirre Phantasien beunruhigten ihn, er träumte mit offenen Augen. Uniformen mit blinkenden Knöpfen umstellten das Feld.
– – – Bataillon marrrsch! Ganzes Bataillon kehrt! – –