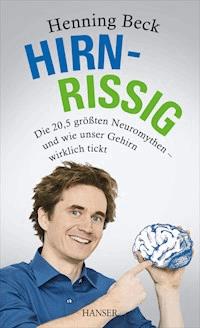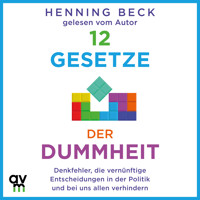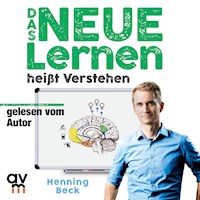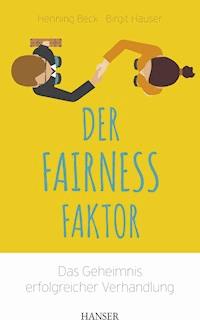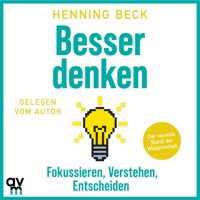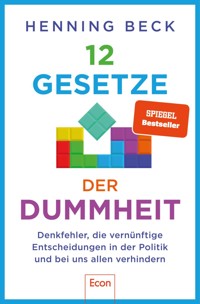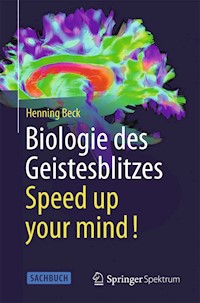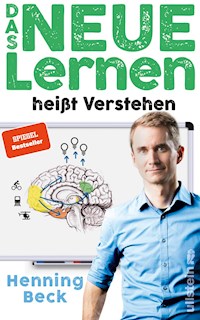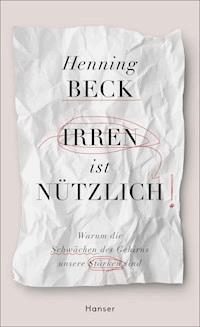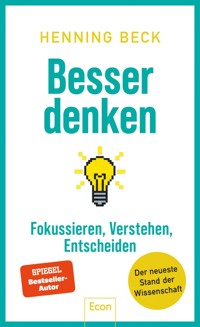
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Die Zukunft gehört denen, die besser denken Was macht uns erfolgreich? Unser Denken! Kein anderes Lebewesen kann so gezielt planen, lernen, kooperieren und Probleme lösen wie wir. Doch in einer Welt, die von Informationsflut, komplexen Herausforderungen und künstlicher Intelligenz geprägt ist, wird das Denken selbst zu einer immer größeren Aufgabe. Dieses Buch ist ein Crashkurs für die Denkfähigkeiten des 21. Jahrhunderts. Basierend auf neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen zeigt der Neurowissenschaftler und Bestsellerautor Henning Beck zeigt, wie wir den Überblick behalten, klüger entscheiden und effektiver lernen können. Mit vielen praktischen Strategien für Anfänger und Profis – von der Informationsbewältigung bis hin zur »Champions League des Denkens«.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Besser denken
HENNING BECK, geboren 1983, studierte Biochemie in Tübingen und wurde im Fach Neurowissenschaften promoviert. Er arbeitete an der University of California in Berkeley, publiziert regelmäßig in der WirtschaftsWoche und für Deutschlandfunk Nova, hält Vorträge zu Themen wie Hirnforschung und Kreativität und ist Autor von Hirnrissig, Irren ist nützlich,Das neue Lernen und 12 Gesetze der Dummheit. Henning Beck lebt in Frankfurt am Main.
Welche Rolle spielt unser Denken in einer Zukunft, die von digitalen Systemen geprägt ist? Welche Fähigkeiten brauchen wir, um komplexe Probleme zu lösen und flexibel zu handeln? Und vor allem: Wie machen wir unser Denken widerstandsfähig gegenüber den Herausforderungen durch KI?Unser Gehirn ist ein Hochleistungsorgan: formbar, kreativ, anpassungsfähig. Es hat uns an die Spitze der Evolution gebracht – doch in einer zunehmend unübersichtlichen Welt stößt es an neue Grenzen. Henning Beck zeigt, wie wir das volle Potenzial unseres Denkens entfalten können. Fundiert, unterhaltsam und mit klarem Blick für das Wesentliche erklärt er, wie wir unsere Aufmerksamkeit fokussieren, bessere Entscheidungen treffen und die Stärken des menschlichen Geistes gezielt nutzen. Denn wer die Zukunft mitgestalten will, muss verstehen, wie Denken wirklich funktioniert.
Henning Beck
Besser denken
Fokussieren, verstehen, entscheiden – Der neueste Stand der Wissenschaft
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein.de
© Ullstein Buchverlage GmbH, Friedrichstraße 126, 10117 Berlin 2025Wir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor.Alle Rechte vorbehaltenBei Fragen zur Produktsicherheit wenden Sie sich bitte an [email protected]: Rothfos & Gabler, HamburgCovermotiv: © iam95 / Imazins / Getty ImagesAutorenfoto: © Hans ScherhauferE-Book powered by pepyrusISBN978-3-8437-3669-5
Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Das Buch
Titelseite
Impressum
Vorwort
1 Konzentration & Fokus
Wie Sie die Informationsflut bändigen und Ablenkungen vermeiden
Die Schwäche des Gehirns
Der Türsteher des Gehirns
Wie sich Informationen ins Gehirn drängeln
Problem 1: Wir suchen, ohne zu finden
Problem 2: Unsere Aufmerksamkeit nutzt sich ab
Problem 3: Digitale Medien zerteilen unsere Aufmerksamkeit
Was sollen wir tun?
2 Planung & Aufschieben
Wie Sie Aufgaben clever planen und sich nicht mehr verzetteln
Die Gleichung des Aufschiebens
Problem 1: Der Wert einer Aufgabe nimmt mit der Zeit ab.
Problem 2: Wir schätzen die Zeit systematisch falsch ein.
Problem 3: Die Aufgabe ist unangenehm oder schwierig.
Problem 4: Die Ablenkung
Ansatzpunkt 1: Die Erfolgserwartung erhöhen
Ansatzpunkt 2: Den Wert des Projektes erhöhen
Ansatzpunkt 3: Die Zeit verkürzen
Ansatzpunkt 4: Minimieren Sie Ablenkung.
Und was ist mit To-do-Listen?
Den eigenen Weg finden
3 Gewohnheiten
Wie man sie verändert und neue entwickelt
Das größte Geschäftsmodell der Welt
Den Autopiloten anwerfen
Die Fluglotsen unseres Handelns
Keine Belohnung ist Antrieb genug
Die Gefahr des Nichtdenkens
Die unheimliche Macht der Gewohnheit
Der Bausatz für automatisiertes Denken
Die harte Nuss: Gewohnheiten brechen
4 Lernen
Wie man Wissen aufbaut und die Welt versteht
Das Wissensparadox: wenn man lernt, ohne zu verstehen
Der Weg des Wissens ins Gehirn
Konzepte erkennen
Lernstrategie 1: Informationen verteilen!
Lernstrategie 2: Testen Sie sich!
Lerntechnik 3: Erklären Sie!
Lerntechnik 4: Erzeugen Sie Bilder!
Selber denken macht schlau.
5 Entscheidungen
Wie man klug auswählt und klar handelt
Die vier Todsünden des Entscheidens
The good, the bad, and the brain
Die Emotion integrieren
Problem Auswahlüberlastung – Wenn die Wahl zur Qual wird
Tipp 1: Kategorisieren Sie!
Tipp 2: Reduzieren Sie Ihre »Vorlieben-Unsicherheit«!
Tipp 3: Fangen Sie mit dem Einfachen an!
Tipp 4: Bleiben Sie spontan!
Problem Perfektionismus – Wenn wir nicht zufrieden sind
Tipp 5: Freunden Sie sich mit der Entscheidung an!
Problem: Entscheidungsmüdigkeit – Wenn uns die Kraft ausgeht
Tipp 6: Teilen Sie sich die Kraft ein!
Problem: Riskante Entscheidungen in Unsicherheit
Tipp 7: Spielen Sie Optionen durch!
Tipp 8: Fragen Sie Nicht-Experten oder Außenstehende!
Tipp 9: Entscheiden Sie!
6 Widerstandsfähigkeit
Wie man unter Druck die Nerven behält
Das Versagen unter Druck
Fehlerquelle 1: Die Überlastungsablenkung
Wir sind uns selbst der größte Feind
Den Moment umdeuten
Sicherheit erlangen
Fehlerquelle 2: Die »Du denkst zu viel«-Falle
Wir konzentrieren uns auf das Falsche
Den Fokus justieren
Die Kontrolle gewinnen
Fehlerquelle 3: Die Übererregungsproblematik
Das Unerwartete vorbereiten
Den Stress trainieren
7 Anpassungsfähigkeit
Wie man im Denken flexibel bleibt und neue Situationen meistert
Wie man untergeht – oder sich ändert
Wenn der Affe schlauer ist
Wer zu viel abschaut, kann verlieren
Nicht der »Umfaller« sein
Erfolg macht träge
Über den Tellerrand schauen
Die Richtung im Kopf ändern
Wechseln Sie Ihre Aufgaben!
Schaffen Sie Abwechslung!
Ändern Sie Ihr Umfeld!
Ändern Sie die Fragestellung!
8 Kritisches Denken
Wie man Dinge hinterfragt und besser durchdringt
Der Triumph der Faulheit
Kritisch zu sich selbst sein
Wie das Denken endet
Problem 1: Das geistige Abladen
Problem 2: Die geistige Abhängigkeit
Problem 3: Die geistige Eitelkeit
Selbstverteidigungstechnik 1: Lesen Sie lateral!
Selbstverteidigungstechnik 2: Strukturieren Sie Ihr Denken!
Selbstverteidigungstechnik 3: Halten Sie inne!
Selbstverteidigungstechnik 4: Trainieren Sie sich!
9 Kreativität
Wie man Denkmuster bricht und neue Lösungen entwickelt
Das Unmessbare fassen
Nur wer abschweift, kann gewinnen
Das Tagträumareal
Arbeitsteilung für Ideen
Die kreative Geheimwaffe
Das schwere Problem der Kreativität
Ansatz 1: Nutzen Sie Beschränkungen!
Ansatz 2: Beherrsche dein Handwerk – und brich dann die Regeln!
Ansatz 3: Ein Ziel haben
Nachwort
Anmerkungen
Leseprobe: 12 Gesetze der Dummheit
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
Vorwort
Vorwort
Es ist brütend heiß, und ich stehe in der staubigen Savanne in Südafrika. Um mich herum trockene Sträucher, ein paar Bäume und sonst nichts. »Steig bloß nicht aus«, hatten sie gewarnt, bevor wir mit unserem Auto in den Nationalpark gefahren sind, um Großwild zu beobachten. Hier gibt es schließlich Löwen, und kein Ranger ist in der Nähe, der im Ernstfall helfen könnte. Aber ich muss mir die Beine vertreten. Und obwohl ich im Umkreis von Hunderten von Metern keinerlei Großkatzen erkennen kann, habe ich ein ungutes Gefühl. Ganz so, wie man es aus populären Erklärungen über unser »Steinzeitgehirn« kennt: wie wir völlig gestresst waren, weil hinter dem nächsten Busch ein Säbelzahntiger lauern könnte.
In diesem Moment wird mir klar: Hier bin ich ein potenzielles Opfer. Ich habe nichts, was mich in dieser feindseligen Welt am Leben halten könnte. Würde man mich in einer Überlebens-Show mitten in der Savanne aussetzen, ich würde keinen Tag durchhalten. Meine Haut ist so hell, dass sie schon nach einem Nachmittag in der afrikanischen Sonne Blasen wirft. Meine Fußsohlen sind butterzart, weil ich ständig gutes Schuhwerk trage. Barfuß hundert Meter über unwegsames Gelände? Vergessen Sie’s. Mich blendet Sonne so schnell, dass ich die Augen so fest zusammenkneifen muss, bis ich fast nichts mehr sehe. Ich bin zu empfindlich für diese harte Natur.
Dafür bin ich an das Großstadtleben in Deutschland so gut angepasst wie ein Löwe an seine Savanne: Ich bewege mich zielsicher und ohne aufzuschauen durchs Gewirr aus U- und S-Bahnen, nehme blinkende Werbeanzeigen kaum noch wahr und tippe nebenbei Nachrichten an Verwandte im europäischen Ausland. Auf der linken Spur der Autobahn bewege ich mich traumwandlerisch sicher. Das ist mein natürliches Habitat, nicht das Buschland in Afrika. Und wenn ich auf all meinen Reisen dorthin eines gelernt habe, dann, wie gnadenlos die Natur sein kann. In meiner Erinnerung sind die Mücken dort fingergroß, das Gestrüpp so scharf wie Rasierklingen und die Sonne so erbarmungslos, als würde ich unter einem Brennglas stehen. Ich bin nicht gemacht für diese wunderschönen Gegenden, in denen Menschen schon als Vegetarier gelten, wenn sie nur Hühnchen essen.
In dem Moment, als ich neben meinem Auto in der Steppe stand, begriff ich zum ersten Mal wirklich, was es bedeutet, ein Gehirn zu haben. Ich hatte nichts, womit ich mich gegen einen Löwen hätte verteidigen können – außer meinem Gehirn. Anderthalb Kilogramm Fett und Eiweiß, clever in Wasser verwoben, reichen aus, um die Welt zu beherrschen. Dass ich besser denken konnte als ein Löwe, war mein Vorteil: Ich stieg wieder ins Auto, ein Produkt jahrtausendelanger menschlicher Erfindungskraft, drückte das Gaspedal und verfügte über die Leistung von 120 Pferden. Heute mache ich Selfies mit dem König der Tiere hinter Panzerglas im Frankfurter Zoo. 20 Watt Denkleistung sind genug, um vom potenziellen Opfer zum Herrscher zu werden. Das ist lächerlich wenig. Mein Backofen hat 2.000 Watt. Aber der denkt nicht hundertmal so gut wie ich. Denke ich zumindest.
Unsere Anpassungsfähigkeit verdanken wir unserem Denken. Das ist unser Erfolgsmodell: Wer besser denkt, ist überlegen: Er kann andere austricksen, ihnen Fallen stellen oder mit ihnen kooperieren. Alle Säugetiere haben Emotionen und bauen Sozialsysteme auf. Doch unser Erfolgsrezept ist nicht, besser zu fühlen, sondern besser zu denken: zu planen, zu kooperieren, zu verstehen, zu lernen und sich zu hinterfragen.
Die Geschichte der Menschheit ist deswegen auch eine Geschichte der Optimierung des Denkens. Praktisch alle bahnbrechenden Erfindungen führten dazu, das Denken zu erleichtern: die Schrift, der Buchdruck, Taschenrechner, Computer, das Internet. Ständig lagerten wir Denkfähigkeiten aus, um uns Freiraum für noch mehr Nachdenken und neue Ideen zu schaffen. Genau diese Entwicklung hat dazu geführt, dass wir heute so denken müssen wie nie zuvor.
Meine Mutter lernte noch Stenografie und rechnete mit Logarithmentafeln, mein Vater musste mit dem Rechenschieber arbeiten – Fähigkeiten, die heute niemand mehr braucht. Früher bestand ein großes Problem darin, überhaupt an Informationen zu kommen und diese dann nicht mehr zu vergessen. Kein Wunder, dass ich in der Schule Gedichte auswendig lernen musste. Das schulte nämlich (unter anderem) meine Fähigkeit, Informationen zu behalten. Heute wäre es undenkbar, alle wichtigen Informationen zu memorieren. Denn mittlerweile besteht das größte Problem nicht im Erlangen von Informationen, sondern im Sortieren und Priorisieren. Andernfalls drohen wir, in der Flut von Nachrichten unterzugehen.
Seit zwei Millionen Jahren muss der Mensch sein Denken immer wieder an neue Bedingungen anpassen. Und genau deswegen erleben wir heute, wie sehr unser Verstand an seine Grenzen stößt: Neue Medien überfluten uns mit Informationen, deren Menge sich alle drei Jahre verdoppelt. Wir verlieren den Überblick in einer immer komplexer werdenden Welt, wir haben das Gefühl, dass die Zeit zu rasen scheint, wir werden vergesslich, können schlecht abschalten oder uns nur schwer konzentrieren. Und als wäre das alles nicht genug, steht aktuell die größte Kränkung der Menschheitsgeschichte vor der Tür: künstliche Intelligenz, die uns endgültig vom Thron zu stoßen droht. Nach Kopernikus sind wir nicht mehr der Mittelpunkt des Universums, nach Darwin nicht mehr die Krone der Schöpfung – und nun verlieren wir im Angesicht neuer intelligenter Technologien auch noch unser letztes Alleinstellungsmerkmal: am besten denken zu können. Was soll aus uns werden, wenn wir nicht mehr die Cleversten auf diesem Planeten sind?
Auf den nächsten Seiten lade ich Sie ein, Ihr Denken fit zu machen für die Herausforderungen unserer Zeit. Ein Crashkurs in den wichtigsten »Waffengattungen« des menschlichen Denkens, damit Sie auch in Zukunft noch kraftvoll nachdenken können. Ich möchte zeigen, welche Denkstärken wir wirklich brauchen, wenn wir in der heutigen Welt unser Gehirn besser nutzen wollen. Denn einige Fähigkeiten von früher sind überflüssig geworden. Deshalb finden Sie in diesem Buch keine Gedächtnistricks, mit denen man sich zwei Telefonnummern mehr merken kann. Viel wichtiger als das Auswendiglernen ist heute das Anwendenkönnen von Informationen. Ich zum Beispiel kenne nicht mal die Telefonnummer meiner Schwester (die ist in meinem Telefon gespeichert). Aber ich weiß, wann und wie ich sie anrufen muss. Das ist viel wichtiger, als wenn es andersrum wäre.
Was sind also die wichtigsten Denktechniken für das 21. Jahrhundert? Für dieses Buch habe ich unzählige Studien analysiert, Publikationen durchforstet und mit klugen Köpfen aus aller Welt gesprochen. Das Ergebnis ist ein kompaktes Destillat des aktuellen Wissens, das ich in neun handliche Kapitel verdichtet habe. Betrachten Sie dieses Buch am besten als eine Art »Rezeptsammlung« fürs Denken. Sie können Kapitel auslassen, vor- oder zurückspringen oder sich gleich auf Denkfähigkeiten konzentrieren, die für Sie am wichtigsten sind.
Im ersten Teil lernen Sie die Grundlagen kennen, um mit der Informationsflut unserer Zeit klarzukommen: Wie behalten Sie die Übersicht? Wie filtern Sie die für Sie wichtigen Infos heraus? Wie konzentrieren Sie sich auf Ihr Problem, planen die nächsten Schritte – und durchbrechen alte Gewohnheiten, um Ihr Denken nachhaltig zu verändern?
Im zweiten Teil geht es um das »Denken für Fortgeschrittene«: Wie lernt man clever und wertet Informationen so aus, dass echte Einsichten entstehen? Wie trifft man gute Entscheidungen, gerade unter Stress und wenn die Widerstände groß sind? Am Ende erfahren Sie die Tricks der »Champions League des Denkens«, einige harte Nüsse, bei denen sich das Knacken wirklich lohnt. Denn sie verschaffen Ihnen einen echten Denkvorsprung: Sie entwickeln ein Gespür dafür, wie Sie Veränderungen nicht nur hinnehmen, sondern aktiv mitgestalten. Wie Sie flexibel denken, Dinge kritisch erfassen und sich nicht von KI die Butter vom Brot nehmen lassen. All das mit dem Ziel, auch in Zukunft noch auf kluge Ideen zu kommen und Probleme auf neue Weise zu lösen.
All diese Denkfähigkeiten sind nicht neu. Schon als die Menschheit in Afrika ihren Anfang nahm, waren diese Möglichkeiten im Gehirn angelegt. Dass wir heute mit einem »Steinzeithirn« durch die Welt laufen (und ebendieses »steinzeitliche Denken« die Ursache für unsere Probleme sei), halte ich allerdings für ein Gerücht. Ich drehe den Spieß gerne um: An unserem Gehirn hat sich seit der späten Steinzeit anatomisch nicht allzu viel getan. Wahrscheinlich könnte man Ötzi rasieren, ihm einen Anzug verpassen – und er würde heute in keinem Meeting besonders auffallen. Denn das eigentlich Beeindruckende am menschlichen Gehirn ist nicht seine ursprüngliche Ausstattung, sondern seine Anpassungsfähigkeit. Ob Sie vor 5.000 Jahren im Allgäu, heute in New York City oder in 300 Jahren auf dem Mars geboren werden, Ihr Gehirn wird klarkommen – wenn Sie wissen, wie Sie es clever nutzen.
Was sich geändert hat, sind die Herausforderungen. In diesem Buch erfahren Sie, welches geistige Rüstzeug man heute braucht, um diese zu meistern und auch in Zukunft besser zu denken. Denn völlig egal, wie diese Zukunft aussehen wird: Es werden Menschen sein, die sie gestalten. Menschen, die besser denken als je zuvor.
1 Konzentration & Fokus
Wie Sie die Informationsflut bändigen und Ablenkungen vermeiden
»Wahrscheinlich erwarten Sie hier ein schlaues Zitat. Doch tatsächlich zeigen diese Zeilen nur, wie gut man Ihre Aufmerksamkeit steuern kann, wenn man unerwartete Informationen zielgenau platziert.«
Henning Beck
Vor ziemlich genau 25 Jahren bekam ich mein erstes Handy. Es war zwar so groß wie zwei Fäuste, sein Display hatte allerdings nur zwei Zeilen. Eine Kurznachricht zu verschicken kostete umgerechnet 20 Cent, dafür hatte man aber auch ganze 160 Zeichen Platz. Was für ein großartiges Gefühl von Freiheit.
Was waren die frühen 2000er-Jahre beseelt von der Hoffnung, dass nun das Zeitalter des mündigen Menschen anbrechen würde. Praktisch die gesamte Menschheitsgeschichte kämpfte man damit, an Informationen zu kommen. Menschen wurden manipuliert, indem man ihnen wichtige Informationen vorenthielt oder gezielt Informationen streute. Doch dieses Zeitalter schien nun vorbei. Erstmals konnte man nicht nur jederzeit mit Freunden kommunizieren, sondern dank des aufkommenden Internets in Sekundenschnelle auf Informationen zugreifen, für die man früher stundenlang Bücher wälzen musste.
Die Zukunft war verheißungsvoll: Wenn Wissen nun endlich kostenlos und frei verfügbar wäre, würden die Menschen zunächst klüger werden und später besser handeln können. So sah es zumindest Bill Clinton, der damalige US-Präsident, als er Ende 1999 über die Zukunft digitaler Medien sprach: »Zusammen haben wir die Macht, darüber zu bestimmen, was das Internet sein soll. Ein Instrument der Mitwirkung, der Bildung, der Aufklärung, des wirtschaftlichen Fortschritts und der Bildung von Gemeinschaften.«1
Damals glaubte man, das größte Problem bestünde darin, die »digitale Kluft« zwischen Menschen mit Internetzugang und Menschen ohne Internetzugang zu überwinden. Sobald alle Menschen Zugang zu digitalen Informationen hätten, wäre der wichtigste Schritt getan, um besseres Denken zu fördern. Was für ein Irrtum. 2021 wertete man über 3,7 Milliarden Smartphone-Interaktionen von mehr als 15 Millionen Personen in Frankreich über einen Zeitraum von anderthalb Monaten aus. Das Ergebnis: Je ungebildeter die Menschen waren, desto häufiger schauten sie banale Videos oder scrollten stundenlang durch Social Media – je höher der Bildungsabschluss und das Vermögen der Personen waren, desto eher wurden auf dem Smartphone Nachrichten gelesen, Informationen gesucht oder E-Mails verschickt. Tatsächlich ließ sich allein anhand des digitalen Nutzungsverhaltens feststellen, wie hoch der Bildungsstand und wie ausgeprägt die soziale Ungleichheit in bestimmten Regionen war.2 Gib den Menschen Zugang zum Internet, und sie werden besser denken? Eine naive Vorstellung.
Wer hätte vor 25 Jahren gedacht, dass das größte Problem unserer Zeit nicht darin besteht, Zugang zu Informationen zu bekommen, sondern sich gegen einen Overkill an Informationen zu verteidigen? Menschen werden nicht frei, nur weil man ihnen uneingeschränkten Zugang zu Informationen gewährt. Im Gegenteil: Menschen können ebenso in ihrer Denkfreiheit eingeschränkt sein, wenn sie von einer Flut an Nachrichten, Bildern, Videos, Meldungen so überfordert werden, dass sie nicht mehr in der Lage sind, das Wesentliche zu erkennen. Man muss nur das Falsche oft genug wiederholen, dann glaubt man selbst den größten Unsinn.3»Flood the zone with shit«, »Überflute die Nachrichtenwelt mit Schwachsinn«, so die Parole von Steve Bannon, dem früheren Medienstrategen von Donald Trump.4 Sie steht für ein Konzept, das über parteipolitische Grenzen hinaus die größte Herausforderung unserer Zeit beschreibt: Je mehr Informationen man verarbeiten muss, desto wahrscheinlicher ist es, dass man irgendwann darunter kollabiert.
Hinzu kommt: Das menschliche Denken ist im Grunde nicht dafür geeignet, eine Vielzahl an Informationen gleichzeitig zu verarbeiten. Im Gegenteil. Was wir besonders gut beherrschen, ist die Ablenkung. Je größer das Angebot an medialen Inhalten, desto leichter lassen wir uns davon vereinnahmen. Unser Gehirn, über Jahrtausende auf geistige Unterversorgung eingestellt und deswegen gierig nach jeder neuen Information, findet sich nun plötzlich im digitalen Schlaraffenland wieder. Wie ein Kind in einer Schokoladenfabrik stürzen wir uns – selbst als Erwachsene – in diese Welt des medialen Überflusses. Kein Wunder, dass wir dabei die Selbstbeherrschung verlieren.
Es sind nicht allein die allseits verfügbaren Geräte, die uns ablenken, wir selbst sind das Problem. Knapp 90 Prozent der Smartphone-Nutzung gehen von uns aus.5 Nicht das vibrierende Telefon oder die aufpoppende Nachricht reißt uns aus den Arbeitsabläufen, sondern wir selbst greifen zum Gerät und unterbrechen uns dabei ständig. Je öfter das passiert, desto häufiger haben wir geistige Aussetzer, erinnern uns schlechter und beenden unsere Aufgaben nicht, weil wir gedanklich nicht bei der Sache sind.6 Paradoxerweise greifen wir gerade deshalb öfter zum Smartphone, weil wir uns schlechter konzentrieren können, woraufhin wir uns noch schlechter konzentrieren können. Ein Teufelskreis.
Mehr als die Hälfte aller Beschäftigten betrachtet Smartphones als den größten Produktivitätskiller bei der Arbeit.7 Laut einer Umfrage des Marktforschungsunternehmens Screen Education verbringen Angestellte pro Tag etwa zwei Stunden damit, private Nachrichten zu durchstöbern, online zu shoppen oder auf Social Media zu verweilen.8 Das ist natürlich nichts im Vergleich zum Smartphone-Gebrauch der 16- bis 18-Jährigen. Diese sind im Durchschnitt fast fünf Stunden pro Tag am Handy.9 Und da sind die ganzen heimlichen Nutzungen während des Unterrichts noch gar nicht eingerechnet.
Vielleicht haben Sie Glück, dieses Buch in gedruckter Form zu lesen. Dann entgehen Sie zumindest der ständigen Versuchung, am Bildschirm zu einer anderen Aufgabe zu wechseln. Tatsächlich unterbrechen Menschen ihre Bildschirmarbeit alle vierzig Sekunden, weil sie dort anderweitig abgelenkt werden oder selbst aktiv nach Zerstreuung suchen.10 Die Kosten dieser ständigen Unterbrechungen sind gewaltig: So schätzt man den volkswirtschaftlichen Schaden durch Unterbrechungen, Ablenkungen und überflüssige Meetings allein in Deutschland auf fast 60 Milliarden Euro.11
Die größte geistige Herausforderung unserer Zeit ist es deswegen, die Informationsflut zu bändigen und Ablenkungen konsequent zu vermeiden. Die schlechte Nachricht an dieser Stelle: Vergessen Sie es, das wird nicht funktionieren! Ihr Gehirn ist keine Maschine, die sich nach Belieben programmieren lässt. Wenn Sie versuchen, ständig fokussiert zu sein, werden Sie nur eines sein: enttäuscht. Ich kenne Menschen, die sich seit zehn Jahren jedes neue Buch besorgen, in dem erklärt wird, wie sie (nun aber endgültig!) dauerhaft konzentriert sind. Und trotzdem schaffen sie es nicht, weil die Versuchung, nach dem Smartphone zu greifen, größer ist als der Wille, konzentriert zu bleiben.
Der Schlüssel liegt nicht darin, dass wir Ablenkungen krampfhaft vermeiden, sondern darin, dass wir akzeptieren, dass Ablenkungen dazugehören, wenn wir uns auf die wichtigen Sachen konzentrieren wollen. Werfen wir also einen Blick hinter die Kulissen des Gehirns: Warum fällt es uns so schwer, dauerhaft konzentriert zu bleiben? Was sind die größten digitalen Verführungen zur Ablenkung? Und was sollten wir tun, um uns in einer Welt vor Ablenkungen dennoch klug (und manchmal konzentriert) zu verhalten?
Die Schwäche des Gehirns
Henning Beck aus Frankfurt wettet, dass Sie, verehrte Leserin, verehrter Leser, es nicht schaffen, dieses Kapitel am Stück zu lesen, ohne dabei nicht ein einziges Mal abgelenkt oder unterbrochen zu werden. Topp, die Wette gilt!
Was mich so sicher macht, gegen Ihre Willenskraft anzutreten? Ich habe die Wissenschaft auf meiner Seite. Dieses Kapitel umfasst nämlich etwa 7.300 Wörter. Wenn Sie die Pubertät hinter sich gelassen haben, beträgt Ihre Lesegeschwindigkeit etwa 250 Wörter pro Minute. Sie brauchen also etwa 30 Minuten, um dieses Kapitel zu Ende zu lesen. Wenn Sie sich deswegen fragen, warum ich in praktisch allen meinen Büchern meine Kapitel auf diese Maximallänge bringe: Das tue ich mit Absicht. Denn das ist in etwa die Höchstdauer, die Menschen beim Lesen aufbringen können, um sich auf ein Thema zu konzentrieren.
Während Sie lesen, unterliegen Sie permanent der Versuchung, gedanklich abzuschweifen oder von äußeren Einflüssen unterbrochen zu werden. Denn natürlich ist das Gehirn nicht am Stück 30 Minuten gleich gut konzentriert, sondern denkt in Etappen. So beträgt die mittlere Aufmerksamkeitsspanne von Erwachsenen gute 70 Sekunden und, wenn Sie das 65. Lebensjahr hinter sich gelassen haben, noch etwa 60 Sekunden.12 Sprich: Jede Minute muss man gedanklich kurz innehalten, um dem Impuls nach Ablenkung zu widerstehen. Das ist ziemlich genau jetzt der Fall, denn in diesem Unterkapitel haben Sie bisher 210 Wörter gelesen.
In dieser Sekunde halten Sie gedanklich also kurz inne. Sie verschnaufen einen Moment, um nun (hoffentlich unabgelenkt) weiterzulesen.
Sie merken schon, es fällt nicht ganz so leicht, dauerhaft konzentriert zu sein. Der Grund: Unser Gehirn ist fortwährend auf der Suche nach Neuem. Dabei hat es ein Problem: Es gibt sehr viel Neues. Ständig werden wir von Sinnesreizen stimuliert, von denen natürlich nur ein Bruchteil wirklich relevant ist. Um dabei nicht die Übersicht zu verlieren, ist es entscheidend, die unwichtigen Reize rauszufiltern. Dabei nutzt das Gehirn einen Trick.
Der Türsteher des Gehirns
Wer in einen beliebten Club möchte, kennt das Problem: Man muss am Türsteher vorbei. Gäbe es diese Einlasskontrolle nicht, wäre der Club schnell überfüllt, Chaos bräche aus. Ganz ähnlich funktioniert unser Gehirn: Kontinuierlich wird es mit Sinnesreizen konfrontiert, die potenziell alle ins Bewusstsein vorstoßen könnten. Würde das unkontrolliert passieren, würden wir die Übersicht verlieren. Wir wären kognitiv verloren in einem heillosen Durcheinander aus unbedeutenden Informationen.
Auch wir haben deswegen einen »Türsteher« im Gehirn: den Thalamus. Getreu seines Namens (griech. thalamos bedeutet so viel wie »Raum«) ist er gewissermaßen das »Vorzimmer zum Großhirn«. Bevor ein Sinnesreiz ins Bewusstsein vorstoßen darf, muss er erst am Thalamus vorbei (einzige Ausnahme ist der Geruchssinn). Nun ist der Thalamus recht wählerisch und blockt die allermeisten Sinnesreize ab. Sie lesen beispielsweise gerade dieses Buch. Sehr wahrscheinlich tragen Sie Kleidung. Aber Sie achten in aller Regel nicht darauf, wie sich Ihre Hose anfühlt. Kurzum: Die allermeisten Sinnesreize nehmen wir nicht wahr, weil sie es gar nicht ins Bewusstsein schaffen.
Andererseits ist es offenbar möglich, die Durchlässigkeit des Sinnesfilters zu beeinflussen. Ganz so, als würde der Türsteher die Order bekommen, doch einen bestimmten Typ von Gästen bevorzugt in den Club zu lassen. Im Gehirn wird diese Order vom sogenannten Kontrollnetzwerk ausgesprochen – einer Region, die vor allem im vorderen Bereich Ihres Gehirns liegt. Indem Sie sich also bewusst vornehmen, auf etwas zu achten, können Sie diesen Sinnesreizen einen bevorzugten Zugang gewähren. Haben Sie zum Beispiel gerade Schuhe an? Eine Brille auf der Nase? Einen Ring am Finger? Spüren Sie, wie Sie das Buch in den Händen halten? Jetzt tun Sie das, aber bis vor ein paar Sekunden hatten Sie diese Empfindungen schlicht ausgeblendet.
Im Grunde scannt unser Gehirn die ganze Zeit unsere Umgebung, ob uns nicht doch ein bedeutender Sinnesreiz durch die Lappen geht. Ganz ähnlich wie ein Radar, das etwa alle zwei Sekunden einmal die komplette Umgebung erfasst. Im Gehirn läuft dieser Scan-Vorgang deutlich schneller ab: etwa fünfmal pro Sekunde überprüft das Gehirn die Umgebung nach potenziell spannenden Reizen13 – so kann unser Sinnesfilter angepasst werden. Kurzum: Nicht die Ablenkung entscheidet, ob uns etwas ablenkt, sondern unser Gehirn.
Wie sich Informationen ins Gehirn drängeln
Aufmerksamkeit und Konzentration sind nicht dasselbe. Aufmerksam sind Sie in den allermeisten Fällen, wenn Sie wach sind. Ihr Gehirn scannt permanent, ob es interessanten Reizen den Zutritt zum Bewusstsein gewährt, und gleicht dafür die Aufgabe, die Sie gerade bearbeiten, mit den eintreffenden Sinnesreizen ab. Das ist Aufmerksamkeit. Konzentration hingegen ist die Fähigkeit, unerwünschte Störreize aktiv auszublenden, damit man sich einer bestimmten Aufgabe (und zwar nur dieser) widmen kann.
Es gibt zwei Gründe, weshalb wir in einem konzentrierten Zustand abgelenkt werden. Erstens, wenn Informationen neuartig sind. Wenn Sie stundenlang dieselben Klamotten anhaben, spüren Sie diese nicht mehr. Aber sobald Sie einen Stein im Schuh haben, fällt er Ihnen auf. Denn die Situation hat sich geändert. Der Fachbegriff für diese hervorstechende Neuartigkeit lautet »Salienz« (also Auffälligkeit). Sie erkennen die Gesichter Ihrer Freunde und Verwandten in einer Gruppe besonders leicht, achten auf rote Signalfarben oder schrecken hoch, wenn eine Spinne über den Boden krabbelt. Im Gehirn übernimmt ein separates Nervennetzwerk, das Salienz-Netzwerk, die wichtige Aufgabe, solche neuartigen Reize zu bewerten. Sobald ein Reiz besonders auffällig ist, wird er vom Salienz-Netzwerk erkannt, ans Kontrollnetzwerk weitergeleitet und schließlich dem Thalamus die Order erteilt, diesen hervorstechenden Sinnesreiz durchzulassen.
Es gibt noch ein zweites Kriterium, das Reize besonders ablenkend macht: die Aussicht auf eine Belohnung. Sobald wir erwarten, dass wir durch eine Information belohnt werden, suchen wir aktiv danach. Wenn Sie denken, dass Ihr Beitrag auf Social Media viele Likes bekommen könnte, greifen Sie aktiv zum Smartphone, um das zu überprüfen. Oder wenn Sie eine Nachricht auf WhatsApp verschickt haben, wollen Sie sehen, ob die andere Person sie schon gelesen hat – und nehmen deswegen das Handy von sich aus zur Hand.
Ich fasse zusammen: Unsere Konzentration, also die Fähigkeit, unsere Sinnesfilter scharf zu stellen, wird von drei Arealen beeinflusst. Das Kontrollnetzwerk scannt permanent nach potenziell interessanten Sinnesreizen. Das Salienz-Netzwerk achtet vor allem auf Auffälligkeiten in unserem Umfeld. Belohnungsareale erzeugen eine Erwartungshaltung, wenn wir uns potenziell angenehmen Informationen zuwenden. Das eigentliche Problem ist jedoch: Alle drei Areale werden durch moderne Ablenkungsindustrien gekapert. Und genau darin liegt der Kern unserer Konzentrationsschwäche.
Problem 1: Wir suchen, ohne zu finden
Das Problem digitaler (und sozialer) Medien liegt nicht unbedingt im Inhalt. Sondern darin, dass sie nichts bieten, worauf man am Ende stolz sein könnte. Fast alles in unserem Leben hat ein Ziel, einen Abschluss, bei dessen Erreichen man sich rühmen kann, etwas geschafft zu haben. Bei Social Media ist das anders. Man scrollt durch unerschöpfliche Feeds, vergisst darüber die Zeit und fragt sich schließlich: Was habe ich erreicht? Ich kann es Ihnen sagen: gar nichts.
In den 1990ern habe ich Computerspiele gespielt – stundenlang. Und dennoch besteht ein Unterschied zur allgegenwärtigen Zerstreuung durch digitale Medien: Computerspiele hatten damals ein Ende. Wenn man nach fünf Stunden »Civilization 2« endlich den Weltraum besiedelt hatte, war man geschafft, aber glücklich. Warum? Weil unsere Belohnungsareale nur dann aktiv werden, wenn wir etwas erreichen (am besten mehr als erwartet). Sprich: Dinge, die kein Ende haben, können nicht glücklich machen.
Dieses Buch hat eine letzte Seite. Wenn Sie es weglegen, können Sie es zu den anderen Büchern ins Regal stellen, die zeigen, welche geistigen Errungenschaften Sie bereits angehäuft haben. So wird jedes gelesene Buch zum sichtbaren Fortschritt Ihrer geistigen Verbesserung. Nur deswegen konnte die Bücherwand einst zum Statussymbol des Bildungsbürgertums werden.
Musikalben haben einen letzten Song. Filme eine letzte Szene. Fernsehserien eine letzte Folge. Das macht sie wertvoll. Deswegen hat man früher Musikalben, CDs oder DVDs für alle sichtbar im Wohnzimmer präsentiert. Heute leben wir in einer Welt ohne Abschluss – ohne Letztes. Es gibt kein letztes Video, das Sie auf TikTok anschauen können. Es gibt auch keine letzte E-Mail, keinen letzten Post auf Instagram, kein letztes Lied auf Spotify. Denn das ist das Prinzip: Wer niemals fertig ist, macht immer weiter – weil es kein Ankommen gibt.
Niemand prahlt damit, wie viele Videos er online geschaut hat. »Wow, gestern habe ich ganze 500 Videos auf Instagram geschafft« – ein selten vorgetragener Beweis der eigenen geistigen Fähigkeit. Denn es ist keine Leistung, sich dauerhaft berieseln zu lassen. Man scrollt ewig durch endlose Reels, um doch am Ende nirgendwo anzukommen. Ein Leben ohne Selbstwirksamkeit.
»Zwinge den Nutzer nicht, nach mehr Inhalten zu fragen. Gib sie ihm einfach«, schrieb Aza Raskin 200614 – und stellte dann seine Designlösung für die Suchmaschine der Zukunft vor: das Endlosscrollen. Was so elegant und harmlos daherkommt, hat den Erfolg von Social Media überhaupt erst ermöglicht. Früher bestanden Internetseiten tatsächlich aus einzelnen Seiten. Wie in einem Bilderbuch blätterte man sich durch die Fotos, Texte und Menüs. Klick für Klick. Wie umständlich! Aza Raskin hingegen ließ sich von Google Maps inspirieren. Dort konnte man sich schon immer durch die Karten bewegen, ohne Umblättern. Google Maps ist bis heute endlich, aber zugleich grenzenlos. Man kann immer weitersuchen. Genau dieses Prinzip prägt nun heute große Teile unserer Medienwelt. Indem man Menschen dorthin führt, wo es keine Grenze des Konsums mehr gibt, macht man sie zu Dauerkonsumenten. Wir sind zu ewig Suchenden geworden – aber wir finden nie etwas.
Das liegt daran, dass die Inhalte von Social Media eben nicht sättigen sollen. Man bleibt in dem seltsamen Zwischenzustand, etwas zu konsumieren, ohne jemals eine echte Befriedigung zu erhalten. Interessanterweise ist das sogar messbar. Als man 2021 untersuchte, warum junge Menschen besonders gerne zu Social Media greifen, kam heraus: Nicht das gute Gefühl, das sie durch die Nutzung bekommen, ist entscheidend, sondern die Hoffnung, dass es ein gutes Gefühl werden könnte.15 Anders gesagt: Es liegt im Interesse digitaler Plattformen, dass sie niemals ein gutes Gefühl vermitteln. Stattdessen zielen sie darauf ab, dass wir immer weiter hoffen. Hoffende Menschen sind viel bessere Konsumenten als glückliche Menschen.
Das bleibt nicht ohne Folgen. In einer repräsentativen US-Umfrage vom Marktforschungsinstitut The Harris Poll kam Ende 2024 heraus:16 47 Prozent der 18- bis 27-Jährigen wünschen sich, sie hätten TikTok niemals kennengelernt. 57 Prozent verknüpfen Social Media mit Langeweile. Knapp 60 Prozent möchten, dass der Smartphonegebrauch bis zur Oberstufe (der High School) von den Eltern limitiert wird. Wohlgemerkt: Das sagen die jungen Leute über sich. Ich habe auch noch nie einen Zwanzigjährigen getroffen, der damit angibt, früh mit Social Media begonnen zu haben: »Seht her, ich habe schon mit neun Jahren auf Instagram angefangen.« Wer so etwas sagt, blamiert sich intellektuell – und das völlig zu Recht.
Das Gefühl, dass Social Media bei allem Überfluss irgendwie »leer« wirkt, ist gewollt. Denn genau diese Leere sorgt dafür, dass wir immer wieder zugreifen. Die eigene Leistung wird dabei niemals sichtbar, und man erreicht kein greifbares Ende – was für wunderbare Zutaten, um unser Belohnungszentrum (ich sollte besser sagen: Erwartungszentrum) im Gehirn anzukurbeln. Im Grunde lenkt Social Media nicht ab. Wir sind das Problem: Wir lenken uns selbst ab, weil wir nicht erkennen, dass endlose Inhalte eigentlich bedeutungslos sind. Wenn ich mir unendlich viele Videos anschauen kann, dann verliert das einzelne zwangsläufig an Wert.
Am Ende bleiben wir atemlos, getrieben von ewiger Unrast, auf der Suche nach dem beglückenden Video, dem lustigen Bild, dem spannenden Post, damit wir sagen können: »Prima, jetzt hat es sich gelohnt.« Doch dieser Moment tritt nie ein.
»Wir müssen uns Sisyphos als einen glücklichen Menschen vorstellen«, so Albert Camus 1942. Das war 62 Jahre, bevor Facebook gegründet wurde. Vielleicht würde er seine Meinung heute ändern. So wie Aza Raskin, der mittlerweile zu einem der größten Kritiker von Social Media geworden ist.
Problem 2: Unsere Aufmerksamkeit nutzt sich ab
Neulich schaute ich wieder einmal den Hitchcock-Klassiker Die Vögel. Nicht nur, weil er an der wirklich schönen Westküste der USA spielt (übrigens meiner Meinung nach die spektakulärste Küstenstrecke der Welt), sondern auch, weil er ein bahnbrechendes Meisterwerk des Thrillers und Horrors ist. Vögel, die die Herrschaft über die Menschen übernehmen, spektakuläre Kamerafahrten, die einen gruseln lassen, ein heraufziehendes Unheil, das man im Gegensatz zu den Hauptfiguren längst spürt.
Der Film war eine einzige Enttäuschung! Er funktioniert heute nicht mehr. Er ist unfassbar langsam, die Kameraeinstellungen ziehen sich endlos. Es gibt noch nicht mal Filmmusik. Jedes Mal, bevor irgendein nichts ahnender Trottel von einer Möwe attackiert wird, hatte ich längst zum Smartphone gegriffen. Damit bin ich nicht allein. Über 90 Prozent aller Deutschen nutzen das Handy regelmäßig parallel zum Fernsehen.17 Denn wir sind anderes gewohnt, als es sich Hitchcock in den 1960ern gedacht hat. Mein Gehirn ist durch brutal schnelle Schnitte à la Jason Bourne derart hochgepusht, dass ich bei jeder noch so gruseligen Möwe fast einschlafe. Ganze Generationen von Kino-Superhelden haben in meinem Denken vor allem eines hinterlassen: den kaum zu befriedigenden Anspruch nach einer noch spektakuläreren Sequenz.
Im Grunde setzt die Verfügbarkeit von Informationen auf Social Media die Messlatte für unser Gehirn extrem hoch: Unser Salienz-Netzwerk scannt ständig nach neuen und auffälligen Reizen in der Umgebung. Digitale Geräte liefern das im Überfluss. Noch bin ich stolz, dass meine vierjährige Nichte bisher tatsächlich nur eine einzige Fernsehsendung gesehen hat: die Sendung mit dem Elefanten. Schauen Sie sich gerne mal an, wie gemütlich und langsam dieser Elefant ist! Ein Leben in Zeitlupe. Was wird mit dem Gehirn meiner Nichte passieren, wenn sie einmal PAW Patrol erlebt hat: die populäre Kinder-Trickfilmsendung, in der die Hundehelden in einem blinkenden Feuerwerk aus Bilderreizen über den Bildschirm springen und jedes frühkindliche Salienz-Netzwerk an die Grenzen bringt? Sie wäre nicht das erste Kind, das einem Bilderrausch überlassen wird. Das mit Abstand meistgesehene YouTube-Video ist keineswegs ein Musikclip von Ed Sheeran oder der »Gangnam Style«, sondern der »Baby Shark Dance« – mit knapp 16 Milliarden Aufrufen. Und in den Top 5 der meistgesehenen YouTube-Videos sind vier Kindervideos, die wohl kaum dazu gedacht sind, Kontemplation und Fokus zu fördern. Eine Umfrage der US-Medienagentur Common Sense Media zeigte im Frühjahr 2025: Ein Viertel der Eltern zeigt ihren Kindern Videos, um sie ruhigzustellen.18 Unter Vierjährige verbringen im Durchschnitt 61 Minuten pro Tag mit solchen YouTube-Videos – und je niedriger der Bildungsgrad der Eltern, desto mehr Videos werden konsumiert.19
Es ist nicht grundsätzlich schlecht, schnell geschnittene oder grelle Videos anzusehen. Doch dabei definiert man »Auffälligkeit« für das Gehirn völlig neu. Oder anders gesagt: Man gewöhnt sich an das Erregungslevel, das durch solche Stimuli ausgelöst wird.20 Gerade digitale Medien eröffnen einen endlosen Strom an Unterhaltung, der paradoxerweise dazu führt, dass sich Menschen schneller gelangweilt fühlen. Denn die Maßstäbe für spannende Sinnesreize werden immer weiter hochgeschraubt, bis man unweigerlich enttäuscht ist. So wie ich mir keinen Hitchcock-Film mehr anschauen kann, weil ich einfach mehr erwarte als ein Messer in Zeitlupe hinter einem Duschvorhang.
Es ist ein perfides Prinzip: Wie eine Nahrung, die nicht sättigt, sondern immer hungriger macht, erhöhen digitale Medien das Erregungslevel, während sie letztlich nur die Konkurrenz des Banalen bieten. Eine niederländische Studie von 2021 untersuchte, wann Menschen bei ihrer Arbeit besonders häufig zum Smartphone greifen. Das Ergebnis: Je gelangweilter oder mental erschöpfter sie waren, desto öfter griffen sie zum Handy. Doch anstatt mentale Erfrischung oder neue Energie zu tanken, fühlten sich die Studienteilnehmer nach der Nutzung noch gelangweilter als zuvor.21 Eine repräsentative Untersuchung von Nutzern der Plattform X zeigte 2024: Je öfter sich Menschen auf der Plattform tummelten, desto radikaler wurden sie (das sollte nichts Neues sein) und desto gelangweilter fühlten sie sich.22 Und am perfidesten finde ich den Effekt, der ebenfalls 2024 gemessen wurde: Je stärker sich Menschen beim Konsum von digitalen Medien langweilen, desto häufiger spulen sie Videos vor, springen zwischen Clips hin und her und werden dabei immer ungeduldiger, um letztlich durch genau dieses Vorspulen und Hin und Her am Ende noch gelangweilter zu sein.23
Zahlreiche Studien belegen inzwischen, dass digitale Medien unsere Erwartungshaltung so hochschrauben, dass wir nur enttäuscht und abgestumpft zurückbleiben. Damit schaffen sie sich ihre eigene Kundschaft. Leider ist die Welt kein ständiger »Baby Shark Dance«. Es gibt Momente, in denen wir uns in reizarmen Umgebungen auf etwas konzentrieren müssen. Das halten wir allerdings immer schlechter aus, woraufhin wir als vermeintliches Gegenmittel mehr digitale Medien konsumieren, um dadurch noch ungeduldiger und gelangweilter zu sein. Danke für nichts!