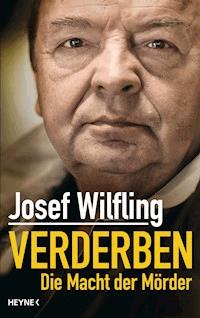Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Penguin Random House Verlagsgruppe
Redaktion: Johann Lankes, München
Copyright © 2010
by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München. Umschlagfoto: Guido Krzikowski
Herstellung: Helga Schörnig
ISBN 978-3-641-04442-8V004
www.heyne.de
www.penguinrandomhouse.de
Inhaltsverzeichnis
Stellvertretend für alle Kinder, die einem Verbrechen zum Opfer fielen, soll ...
Vorwort
GRAUSAMKEIT
HEIMTÜCKE
TÖTEN FRAUEN ANDERS ALS MÄNNER?
MORDLUST
PERVERSITÄTEN
VERDECKUNG
LEICHENZERSTÜCKELUNG
WOLLUST
GEMEINGEFÄHRLICH
HABGIER
Copyright
Stellvertretend für alle Kinder, die einem Verbrechen zum Opfer fielen, soll dieses Buch an
Peter A.
erinnern, der am 17. Februar 2005 im Alter von acht Jahren in München von einem Sexualtäter ermordet wurde, der schon 1995 in Regensburg einen elfjährigen Buben mit über 70 Messerstichen getötet hatte und nach neuneinhalb Jahren Jugendhaft im Jahre 2004 freigelassen werden musste, obwohl nach Meinung aller Experten zu befürchten stand, dass er wieder töten würde. Denn damals gab es im Jugendstrafrecht noch keine rechtliche Handhabe, die nachträgliche Sicherungsverwahrung zu verhängen. Selbst dann nicht, wenn jemand nach wie vor gefährlich und hochgradig rückfallgefährdet war.
Nach dem Mord an Peter A., der bundesweit für Schlagzeilen sorgte, haben sich hochrangige Bundespolitiker darauf hinaus geredet, die geltenden Gesetze seien ausreichend, sie müssten nur richtig angewandt werden. Das war gelogen. Denn erst nach diesem Verbrechen erfolgte eine Gesetzesänderung, bei der es sich allerdings um einen unrealistischen politischen Kompromiss handelt. So ist es nunmehr zwar möglich, auch bei solchen Tätern die nachträgliche Sicherungsverwahrung zu verhängen, die nach Jugendrecht verurteilt wurden, allerdings sind die Voraussetzungen an Bedingungen geknüpft, die sogar Richter als lebensfremd bezeichnen. Es wird sich also nicht viel ändern. Das finde ich traurig.
VORWORT
Jeder Mensch hat den Wunsch, in Würde sterben zu dürfen. Wird jemand ermordet, nimmt man ihm diese Würde. Das kann man in den Gesichtern toter Menschen erkennen, denen andere Menschen – aus welchen Gründen auch immer – das Leben genommen haben. Ich jedenfalls habe in all den Jahren keines gesehen, bei dem ich den viel zitierten »friedlichen Gesichtsausdruck« hätte feststellen können. Selbst bei denjenigen nicht, die freiwillig aus dem Leben schieden oder die eines natürlichen Todes gestorben sind und derer ich als Todesermittler und nicht als Mordermittler ansichtig wurde. Tote sind nicht schön anzuschauen und Ermordete noch viel weniger.
Ich weiß nicht mehr, wie oft ich an einem Tatort stand und mich gefragt habe, wie so etwas möglich ist. Wobei mich weniger die schlimmen Bilder betroffen machten, als vielmehr das fehlende Mitgefühl für das Opfer, das oft in so erschreckender Weise deutlich wurde. Wie können Menschen so erbarmungs- und gefühllos, so brutal und kaltblütig sein, habe ich mich immer wieder gefragt. Bis heute konnte ich keine Antwort finden und es konnte mir auch niemand eine geben. Nicht einmal die Gerichte samt ihrer psychiatrischen Gutachter konnten immer ergründen, was wohl im Innersten eines Mörders wirklich gewirkt haben könnte – auch wenn sich rein juristisch immer ein Tatmotiv finden oder mit hoher Wahrscheinlichkeit annehmen ließ. Denn dafür sorgte schon der allumfassende § 211 des deutschen Strafgesetzbuches, in dem das aufgezählt ist, was in unserem Kulturkreis im Zusammenhang mit der vorsätzlichen Tötung von Menschen als besonders verwerflich und verachtenswert angesehen wird und der wie folgt lautet:
§ 211 – Mord
1. Der Mörder wird mit lebenslanger Freiheitsstrafe bestraft.
2. Mörder ist, wer aus Mordlust, zur Befriedigung des Geschlechtstriebs, aus Habgier oder sonst aus niedrigen Beweggründen, heimtückisch oder grausam oder mit gemeingefährlichen Mitteln oder um eine andere Straftat zu ermöglichen oder zu verdecken, einen Menschen tötet.
Jedenfalls ist mir in den 22 Jahren, die ich bei der Münchner Mordkommission gearbeitet habe, kein einziger Mordfall untergekommen, der nicht in einer der drei Gruppierungen dieses Paragraphen hätte untergebracht werden können. Und wenn man bedenkt, dass ich im Laufe dieser zwei Jahrzehnte rund 1000 versuchte und vollendete Tötungsdelikte miterlebt und ca. 100 davon selbst bearbeitet habe, dann glaube ich sagen zu dürfen, dass die Väter des Strafgesetzbuches allen Respekt verdienen. Interessant ist auch ein Vergleich mit den sieben Todsünden aus der Bibel, durch den der Wandel und die Werteverschiebung innerhalb der menschlichen Gesellschaft deutlich werden. Sie lauten:
• Habgier (Geiz, Habsucht)
• Hochmut (Übermut, Eitelkeit, Ruhmsucht)
• Neid (Missgunst, Eifersucht)
• Trägheit (Faulheit, Feigheit, Ignoranz)
• Völlerei (Gefräßigkeit, Unmäßigkeit, Maßlosigkeit)
• Wollust (sexuelle Ausschweifungen, Perversitäten)
• Zorn (Wut, Vergeltung, Rachsucht)
Während es heute keine Todsünde oder kein Verbrechen mehr ist, geizig, wollüstig, verfressen, versoffen oder stinkfaul zu sein, war es dafür in früheren Zeiten unerheblich, ob man Menschen heimtückisch, grausam oder mit gemeingefährlichen Mitteln wie z.B. Brandstiftung umgebracht hat. Was nicht verwundert, wenn man nur an die unfassbaren Tötungsrituale bei Hinrichtungen denkt. Darüber hinaus war es damals im Gegensatz zu heute nicht von Bedeutung, wenn die Tötung eines Menschen darauf ausgerichtet war, eine andere Schand- oder Straftat zu ermöglichen oder zu verdecken (sogenannter Verdeckungsmord).
Bemerkenswert ist aber, dass sich einige der früheren Todsünden noch immer in der Gruppe der »niedrigen Beweggründe« wiederfinden. Unter niedrigen Beweggründen versteht man die besonders verwerfliche vorsätzliche Tötung, der ein verachtenswertes Motiv zugrunde liegt und die man deshalb als auf tiefster Stufe stehend bezeichnet. Hier einige Beispiele zum Vergleich:
• Mordlust
• Befriedigung des Geschlechtstriebes
• Habgier
• Rachsucht
• krasse Selbstsucht
• Wut aus nichtigem Anlass
• triebhafte Eigensucht
• Lust an körperlicher Misshandlung
• Eifersucht, aber nicht in jedem Fall
• Blutrache, aber auch nicht in jedem Fall
Wer also einen Menschen vorsätzlich tötet und dabei eines der im § 211 StGB aufgezählten Mordmerkmale verwirklicht, wird vom Totschläger zum Mörder und ist zwingend zu lebenslanger Freiheitsstrafe zu verurteilen. Sofern er natürlich beweiskräftig überführt werden konnte und falls er zur Tatzeit nicht noch Jugendlicher oder (sonst irgendwie) schuldunfähig war.
In der Zeit von 1987 bis 2009, in der ich der Münchner Mordkommission angehörte, ereigneten sich in unserem Zuständigkeitsbereich insgesamt 361 vollendete und 767 versuchte Fälle von Mord und Totschlag. Genau genommen handelt es sich dabei um die bekannt gewordenen Tötungsdelikte, da man gerade in diesem Bereich von einer hohen Dunkelziffer ausgehen muss. So haben wissenschaftliche Untersuchungen ergeben, dass mindestens jedes zweite Tötungsdelikt gar nicht erst bekannt oder als solches erkannt wird. So viel zu der Frage, ob es den perfekten Mord gibt.
Aus der Gruppe der niedrigen Beweggründe habe ich drei Mordmerkmale ausgesucht, nämlich Habgier, Mordlust und Befriedigung des Geschlechtstriebes (Wolllust). Je einen Fall schildere ich zu Heimtücke, Grausamkeit und Gemeingefährlichkeit und einer beschäftigt sich mit Verdeckungsmord. Darüber hinaus habe ich mir ein paar Ausführungen zu allgemein interessanten Themen wie Perversitäten, Leichenzerstückelungen oder der Frage erlaubt, ob Frauen anders morden als Männer. Was den Untertitel dieses Buches betrifft, so habe ich mich für die nüchterne, wertfreie Formulierung »Wenn aus Menschen Mörder werden« entschieden. Das Warum habe ich bewusst ausgeklammert, weil ich tiefenpsychologische Betrachtungen dazu gerne kompetenteren Leuten überlassen möchte. Damit hoffe ich, einen kleinen, aber realistischen Einblick in die Welt von Mord und Totschlag und die Abgründe der menschlichen Seele geben und einen Eindruck von der Arbeit in einer echten Mordkommission vermitteln zu können. Weil ich ein Mann der Praxis bin, maße ich mir keine juristischen oder psychologischen Wertungen an und überlasse auch die moralische Sicht der Dinge jedem Einzelnen selbst.
Was die Arbeit in einer echten Mordkommission betrifft, so steht die Teamarbeit im Vordergrund. Den Super-Detektiv à la »Columbo« gibt es nicht, und einer wie »Schimanski« würde bei keiner einzigen Mordkommission in Deutschland länger als einen Tag Dienst tun. Übrigens lag unsere Aufklärungsquote auch ohne Mithilfe eines »Sherlock Holmes« kontinuierlich zwischen 95 und 100 Prozent. So viel zu dem Risiko, das man eingeht, wenn man meint, den perfekten Mord begehen zu können.
Aus datenschutzrechtlichen Gründen wurden Namen, Berufe, örtliche und zeitliche Gegebenheiten verändert. Die geschilderten Fälle orientieren sich zwar an echten Kriminalfällen, wurden aber abgewandelt, anonymisiert und durch fiktive Anteile unkenntlich gemacht.
Josef Wilfling München im Januar 2010
GRAUSAMKEIT
Seit drei Wochen hatte sich Emil S. nicht mehr gemeldet. Die 79-jährige Alwine W. machte sich Sorgen. Bislang hatten sie sich mindestens einmal wöchentlich in einem Café oder zum Essen in der Bahnkantine getroffen. Aber Emil S. ging nicht mehr ans Telefon, und auch im Justizzentrum, wo sie sich fast täglich die Zeit vertrieben und die dortigen Prozesse verfolgten – am liebsten natürlich Mordprozesse -, war er schon lange nicht mehr gesehen worden. Sie gehörten zur dortigen Stammzuhörerschaft und kannten sich untereinander.
Alwine läutete an Emils Haustür und konnte die Glocke sogar bis nach unten hören, weil die Balkontür von seiner Wohnung im zweiten Stock offen stand. Es wurde aber nicht geöffnet. Also klingelte sie schließlich bei der Nachbarin im zweiten Stock, die ihr vom Sehen her bekannt war und die in ihrem Alter sein durfte. Tatsächlich betätigte diese den Türöffner, und Alwine ging nach oben. Ingesamt sechs Parteien lebten in dem zweistöckigen Block, der zu einer großen Wohnanlage gehörte, welche von der Bundesbahn in den 1960er-Jahren errichtet worden war und in der fast ausschließlich Bahnbedienstete wohnten, vorwiegend Pensionisten und Rentner. Es waren preisgünstige Wohnungen, die zwar klein, inzwischen aber auf modernsten Stand gebracht worden waren.
Der betagten Nachbarin war gar nicht bewusst, dass sie Emil S. schon lange nicht mehr gesehen hatte. Erst jetzt im Nachhinein falle ihr auf, dass er ihr ja jeden Tag die Zeitung eingeworfen habe und dass das schon seit geraumer Zeit nicht mehr der Fall war. »Da wird doch nichts passiert sein mit dem Herrn S. Ganz gesund war der ja auch nicht mehr, so wie der schon vor Jahren geschnauft hat, wenn er die Treppe hochging«, meinte sie. Alwine W. klopfte mehrfach kräftig an Emils Wohnungstür, aber es rührte sich nichts. Sie hob den Briefkastenschlitz hoch. Ein Schwall unangenehm riechender Luft wehte ihr entgegen. Sie kannte diesen Gestank nur allzu gut aus den Kriegsjahren, in denen sie viele Leichen gesehen und gerochen hatte.
Alwine W. rief die Polizei. Die beiden jungen Beamten zögerten nicht lange und ließen die Wohnung öffnen. Einer von ihnen ging hinein. Es dauerte keine 20 Sekunden, und er kam kreidebleich wieder heraus, mit einer Hand Mund und Nase zuhaltend. »Hol die Kripo«, sagte er zu seinem Kollegen, »der ist umgebracht worden. In seinem Hals steckt ein Besen.«
Als meine beiden Kollegen und ich am späten Nachmittag an den Tatort kamen, hatte sich vor dem Haus eine kleine Menschenmenge versammelt. Neugierige Nachbarn, denen jetzt allen einfiel, dass sie Herrn S. ja schon so lange nicht mehr gesehen hatten. Da man aber kaum engen persönlichen Kontakt untereinander hatte und lediglich normale nachbarschaftliche Beziehungen pflegte – was in einer Großstadt bedeutet, dass man sich grüßt und gelegentlich ein paar Worte wechselt -, war niemandem aufgefallen, dass Emil S., der wie viele andere immerhin schon seit 40 Jahren hier lebte, irgendwie fehlte.
Als ich die Ansammlung der Anwohner sah, war mir klar, dass nun allerlei Erkenntnisse und Gerüchte ausgetauscht und vermischt werden würden, was natürlich einer objektiven Informationsgewinnung abträglich war. Und oft wird das, was man erfahren hat, gerne als eigenes Wissen verkauft – besonders wenn Belohnungen ausgesetzt sind.
Es sah nicht gut aus. Liegezeit mindestens drei Wochen, schätzte die Leichenschauerin. Da die Balkontür weit offen stand, hielt sich der Gestank in Grenzen. Es war ein grausiger, fast schon skurriler Anblick. Keiner von uns hatte Derartiges vorher gesehen. Der Besenstil ragte aus dem Hals heraus und stand kerzengerade in die Höhe, wobei die Bürste zwischen Balkontür und Türrahmen eingeklemmt war. Dadurch konnte die Tür nicht zuschlagen, und gleichzeitig hatte der Besenstiel einen festen Halt. Der Körper des Mannes war aufgedunsen, der Kopf war schwarz-klumpig, und die wohl schon dritte Generation von Maden war dabei, ihr Werk fortzusetzen. Die Leiche war bekleidet mit Hemd und Hose.
Wir vereinbarten mit dem Erkennungsdienst, nach der fotografischen Sicherung des Tatortes den Besenstil ca. 30 Zentimeter über dem Hals abzusägen und die Leiche bekleidet und unverändert ins Institut für Rechtsmedizin bringen zu lassen. Mit bloßem Auge war lediglich erkennbar, dass wohl Gesicht und Schädel zertrümmert waren, eine visuelle Identifizierung war nicht mehr möglich. Bei genauerem Hinsehen erkannte man auch einige scharfrandige Hautdurchtrennungen im Kopfbereich, wie sie von einem Messer hätten verursacht worden sein können. Ein solches lag aber nirgends offen herum, wie wir bei erster Durchsicht feststellten. Auf dem Tisch befand sich eine leere Geldbörse, und man konnte an den lose herunterhängenden Antennen- und Stromkabeln sehen, dass auf der kleinen Anrichte, wo die Staubschicht entsprechend ausgespart war, ein Fernsehgerät gestanden haben müsste. Ein Raubmord?
Die Wohnungstür war unbeschädigt und nur ins Schloss gezogen. Der Schlüssel steckte an der Innenseite. Der oder die Täter müssen also eingelassen worden sein. Ein Einsteigen und auch eine Flucht über den Balkon, der zur Hofseite hinausging, konnte ausgeschlossen werden. Die Tat muss sich nicht zwangsläufig bei offenem Fenster zugetragen haben. Denkbar, dass die Balkontür erst nachträglich geöffnet und fixiert wurde. Zumal niemand bisher etwas gehört haben will und die Tat garantiert nicht geräuschlos abgelaufen war.
Alwine W. selbst lebte seit vielen Jahren alleine in einer kleinen Altbauwohnung in der Innenstadt. In Emils Wohnung war sie schon seit Jahren nicht mehr gewesen. Die alte Dame war körperlich und geistig zwar noch sehr rüstig, aber der Vorfall hatte ihr zu schaffen gemacht. Sie saß auf der Stiege im Treppenhaus, hatte die Arme auf den angezogenen Knien verschränkt und den Kopf darauf gelegt. Ich bot ihr an, sie nach Hause zu fahren. Unterwegs könnten wir uns ja unterhalten, schlug ich vor, und sie nahm dankbar an. Es habe ja einmal eine Zeit gegeben, da habe sie sich Hoffnungen gemacht, begann sie zu erzählen, als wir in meinem Dienstwagen saßen. Seit über 20 Jahren sei sie Witwe und Emil war von jeher alleinstehend. Sie hätten sich schon vor dem Krieg gekannt, seien beide bei der Bahn als Zugbegleiter eingesetzt gewesen und bei Transporten an die Front oft von Tieffliegern angegriffen worden. Viele Male seien sie dem Tod nahe gewesen, das habe zusammengeschweißt. Er sei ihre erste große Liebe gewesen und auch ihr »erster Mann«. Aber im letzten Kriegsjahr hätten sie sich aus den Augen verloren, und nach dem Krieg hätten sich ihre Wege getrennt. Sie habe einen anderen Mann geheiratet und eine Tochter bekommen, Emil sei ledig geblieben. Erst nach dem Tod ihres Mannes hätten sie sich wieder getroffen, und seither hätten sie sporadischen Kontakt gepflegt. Leider habe Emil kein Interesse mehr an einer festen Beziehung gehabt, mehr als eine Freundschaft wollte er nicht. Natürlich sei ihr klar gewesen, dass sie ihm wohl zu alt war, auch wenn ihr acht Jahre Altersunterschied als nicht allzu gravierend vorkamen. Auch Frauen könnten sich doch mal »etwas Jüngeres suchen«, oder? Wir mussten beide herzhaft lachen. Eine unglaublich nette alte Dame, die ich da durch die Stadt fuhr. Ihre unerfüllte Liebe sollte keine große Rolle spielen bei den weiteren Ermittlungen. Und dennoch berührte mich ihre Geschichte. Ihre Aussage wurde später auch vor Gericht verlesen und trieb manchem die Tränen in die Augen. Unter Tausenden Menschen, die ich in meinen Berufsleben kennengelernt habe, gehört sie zu denen, die ich nie vergessen werde.
Natürlich sei ihr nicht verborgen geblieben, dass Emil einen Hang zu wesentlich jüngeren Frauen hatte, und sie habe auch gewusst, dass zeitweise eine junge Frau bei ihm wohnte, die noch nicht einmal 30 Jahre alt war. Monika habe sie geheißen, wie mit Familiennamen, könne sie nicht sagen. Emil habe sie als Angeklagte im Gericht kennengelernt. Weil sie mit zwei Freundinnen einen jungen Mann drei Tage lang in einem Zimmer gefangen gehalten hatten. Ein spektakulärer Prozess damals, der wochenlang für Schlagzeilen gesorgt hatte. Emil habe mit der Frau Kontakt aufgenommen, als sie noch im Gefängnis war. Erst habe er ihr geschrieben, und dann habe er sie sogar besucht. Sie habe ihm leid getan, und er habe ihr helfen wollen, wieder Fuß zu fassen. Als sie vorzeitig frei kam, habe sie ihn tatsächlich aufgesucht und sei bei ihm eingezogen. Sie selbst habe diese junge Untermieterin nur ein einziges Mal gesehen, als sie Emil abholte. Da wusste sie dann auch, warum Emil sie gerne aufgenommen hatte. Sie entsprach wohl seinen erotischen Vorstellungen. Man könnte sie als »dralle Blondine« bezeichnen, vorsichtig ausgedrückt. Auf sie wirkte die junge Frau jedenfalls sehr ordinär. Mehr wisse sie allerdings nicht darüber, und Emil habe auch nicht viel erzählt. Dass sich zwischen den beiden eine sexuelle Beziehung entwickelt hatte, gab er unumwunden zu. Daraus hatte er noch nie ein Geheimnis gemacht. Schon gar nicht ihr gegenüber. War sie doch für ihn so etwas wie die ältere Schwester. Leider. Vor ein paar Monaten sei die junge Frau wieder ausgezogen. Es muss wohl doch nicht so optimal gewesen sein. Seine Untermieterin muss stinkfaul gewesen sein und ihn finanziell regelrecht ausgesaugt haben. Emil sei jedenfalls froh gewesen, als sie weg war.
Als ich wieder zurück am Tatort war, berichtete mir ein Kollege von einer jungen, ziemlich großen und kräftigen Frau, die schon mehrfach unten im Hof mit einem pinkfarbenen Fahrrad hin- und hergefahren sei und wie gebannt zur Tatwohnung herauf gesehen habe. »Na und?«, sagte ich. »Da unten stehen viele und starren herauf. Die wird wohl hier wohnen und neugierig sein wie alle anderen.«
»Kann sein«, sagte der Kollege, »aber merkwürdig war das schon, weil sie sich nämlich auffallend von den anderen Leuten fernhielt. Als ob sie unauffällig beobachten wollte, was sich da tut. Anwohner haben mir gesagt, sie heiße Monika S. und wohne hier in der Nähe.«
Es elektrisierte mich förmlich. »Das muss sie sein!«, rief ich und berichtete dem Kollegen kurz, was mir die alte Dame erzählt hatte. »Die schauen wir uns an. Und zwar gleich.«
Bereits 20 Minuten später hatten wir die Wohnung gefunden, in der Monika S. mit dem pinkfarbenen Fahrrad wohnen sollte. Der Wohnblock war nicht weit entfernt von dem des Opfers, gehörte aber zu einer anderen Anlage. Am Klingelschild stand der Name »Matthias A.«. Bei ihm, so hatten wir natürlich längst ermittelt, handelte es sich um den Freund dieser Monika. Er war auch als alleiniger Mieter eingetragen. Keine Vorstrafen und von Beruf Kraftfahrer, wie uns telefonisch mitgeteilt worden war. Monika S. war unter dieser Anschrift polizeilich nicht gemeldet. Deshalb kannten wir weder ihre Personalien noch wussten wir zu diesem Zeitpunkt, welch ein »amtsbekanntes Früchtchen« sie war.
Wir läuteten bei anderen Mietern, um erst einmal ins Haus zu kommen. Das klappte. Die Wohnung lag im Parterre rechts. Wir hörten darin aufgeregte Stimmen, konnten aber nichts verstehen. Wir klingelten an der Wohnungstür, und es dauerte keine fünf Sekunden, bis Matthias A., ein schlanker, ca. 35 Jahre alter und etwa 1,80 Meter großer Mann, öffnete. Er wirkte ungepflegt, hatte einen Dreitagebart und dunkles, langes Haar, das strähnig bis zu den Schultern reichte. Er war offensichtlich gerade im Begriff, die Wohnung zu verlassen, da er einen Anorak trug und eine Reisetasche in der Hand hatte. Zwei Meter hinter ihm stand eine blonde, große, kräftige Frau im Flur und schaute genauso erschreckt wie Matthias A., als sie hörte, dass wir von der Kriminalpolizei seien. Der blasse und nervös wirkende Mann setzte die Tasche ab, wir baten um Einlass, und er trat wortlos zurück und machte uns den Weg frei.
»Wollen Sie verreisen?«, fragte ich und deutete auf die Reisetasche.
»Nein, nur zum Bezirkskrankenhaus nach Haar«, antwortete Matthias A. nach kurzem Zögern. So, als wäre ihm keine andere Antwort eingefallen.
»Ach ja, nach Haar? Was ist denn passiert?«
Matthias A. deutete auf die Frau im Hintergrund und erklärte, sie habe psychische Probleme und deshalb wollte er sie in ärztliche Behandlung bringen. Jetzt wurde es interessant.
»Was ist denn passiert?«, fragte ich abermals.
»Sie hat viel Blut gesehen«, antwortete er und fügte sofort an: »Im Schlachthof. Wir waren am Schlachthof, weil wir eine Arbeit für sie gesucht haben, und da hat sie hineingeschaut und all das Blut gesehen, und jetzt dreht sie fast durch.«
Wo sie das viele Blut wirklich gesehen haben dürfte, konnte ich zwar nicht wissen, aber ich ahnte es. Ganz bestimmt nicht im Schlachthof. Abgesehen davon, dass man dort nicht so einfach in den Schlachtbereich hineinspazieren kann, klang es doch sehr nach einer hastig überlegten Ausrede, was Matthias A. da von sich gab.
»Aha«, sagte ich deshalb nur und machte den Vorschlag, uns besser getrennt zu unterhalten. Dann würde es schneller gehen, gab ich als Begründung an, ohne aber zu erklären, was ich damit genau meinte. Trotzdem wollte keiner von beiden wissen, weswegen wir eigentlich hier seien. Mein Kollege, so fuhr ich fort, würde am besten mit ihm im Wohnzimmer sprechen und ich würde mit der Dame kurz im Treppenhaus reden wollen. Matthias A. nickte, doch die Frau reagierte panisch. Sie wolle unbedingt bei ihrem Freund bleiben, meinte sie fast flehentlich und hakte sich bei ihm unter, als ob sie ihn festhalten wollte. Es dauerte etwas, bis ich sie freundlich lächelnd davon überzeugt hatte, dass ich auch ein ganz netter Mensch wäre und sie sich vor mir doch nicht fürchten müsse. Schließlich ging mein Kollege mit Matthias A. in das Wohnzimmer der kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung und ich ging mit der Frau ins Treppenhaus. Und hier sollte ich das schnellste Geständnis meiner gesamten Laufbahn erhalten.
»Kennen Sie einen Herrn Emil S.?«, fragte ich.
»Nein.«
»Sie sind aber doch vorhin mit Ihrem pinkfarbenen Fahrrad dauernd an seinem Wohnhaus vorbeigefahren und haben hinaufgestarrt zu seiner Wohnung, in der Sie doch schließlich eine Zeit lang gelebt haben, oder?«
»Das schon, aber mit der Sache habe ich nichts zu tun.«
»Mit welcher Sache?«
»Der da drin hat ihn umgebracht. Der hat auch einen Anwalt, ich habe keinen. Fragen Sie ihn. Er hat den Emil erschlagen, nicht ich. Ich war nur dabei.«
Wir gingen hinaus auf den Hof. Ich rief einen Streifenwagen, und drei Minuten später war Monika S. unterwegs zum Polizeipräsidium. Festgenommen und als Beschuldigte über ihre Rechte belehrt.
Kaum war der Streifenwagen weg, kam mein Kollege mit Matthias A. aus dem Haus. Ich ging auf die beiden zu.
»Sie sind festgenommen, Herr A. Wegen Mordverdachts. Heben Sie bitte die Hände, ich muss Sie durchsuchen«, sagte ich zu ihm. Wortlos streckte er die Hände seitlich aus, und ebenso wortlos begann mein Kollege, ihn zu durchsuchen. Ich war mir nicht sicher, wer von den beiden mehr überrascht bzw. verblüfft war, erfuhr aber nachträglich, dass es mein Kollege war. Matthias A. durfte nämlich sofort gewusst haben, warum er festgenommen wurde, was dadurch erkennbar war, dass er abermals nicht nach dem Grund fragte. Mein Kollege dagegen konnte natürlich nichts von dem Blitzgeständnis der Frau ahnen. Er handelte wie ein Roboter völlig automatisch und wurde auch noch fündig. An einem ledernen Schlüsseletui, das er dem Beschuldigten aus der Hosentasche zog, waren dunkle Flecken erkennbar, die sich später als Mischspur zwischen Opfer- und Eigenblut erweisen sollten: ein klarer Sachbeweis.
Monika S. schob die gesamte Schuld auf ihren Freund. Der sei gewalttätig und deshalb habe sie zu »ihrem Rentner« zurückgewollt. Das habe ihm nicht gepasst und deshalb hätte er ihn mit einem Gewehr erschlagen. Das mit dem Besenstil sei allerdings sie gewesen. Sie habe das aber nur gemacht, weil sie Angst vor Matthias hatte. So wie der getobt habe, habe sie befürchten müssen, er würde auch sie umbringen. Zumal sie ihn ja verlassen wollte. Deshalb habe sie so getan, als würde sie mitmachen. Und weil der Emil doch eh schon »so gut wie tot« gewesen sei, habe es doch nichts mehr ausgemacht, »dass ich ihm den Besenstil reingesteckt habe in den Hals, oder?« Und auf die Idee, die »Sachen« aus der Wohnung mitzunehmen, sei auch er gekommen. Weil er nämlich kein Geld mehr hatte. Das sei übrigens einer der Gründe gewesen, warum sie zu Emil S. zurück wollte. Matthias A. sei arbeitslos gewesen, habe aber kein Arbeitslosengeld mehr bekommen und hätte Sozialhilfe beantragen müssen. Nicht einmal einen funktionierenden Fernseher habe er mehr gehabt. Geschweige denn, dass er sie hätte ausreichend versorgen können.
Auf die Frage, ob sie Matthias A. lieben würde oder zumindest einmal geliebt hätte, antwortete sie mit einem klaren Nein. Sie habe noch nie jemanden geliebt. Sexuell sei er zwar besser gewesen als Emil S., aber das habe ihr nicht so viel bedeutet. Wenn sie Lust hatte, habe sie ihn gelassen, ansonsten habe sie nichts dabei empfunden.
Matthias A. legte erst ein Geständnis ab, als er die Zusage hatte, dass seine Monika ärztliche Hilfe bekomme. Er nahm alles auf sich. Sogar die Sache mit dem Besen. Selbst als ihm vorgehalten wurde, Monika habe bereits ihren Tatbeitrag eingestanden, beharrte er auf seiner Version. Monika habe »nichts gemacht«, er sei der allein Schuldige. Er war dieser Frau verfallen, war ihr hörig. Anders war sein Verhalten nicht zu deuten.
Beide Geständnisse lagen vor, noch während im Institut für Rechtsmedizin die Obduktion andauerte. Der Kollege, der ihr beiwohnte, war genauso überrascht von der schnellen Klärung wie die Mediziner. Sie stellten fest, dass der Besenstil in den Hals gerammt worden war, als der Mann noch gelebt haben musste. Entsprechend vital unterblutete Weichteile wiesen darauf hin. Kein schöner Tod. Und wohl ziemlich schmerzhaft.
Monika S. hatte ein bewegtes kriminelles Vorleben. Sie war vorbestraft wegen schweren Raubes, Freiheitsberaubung, Körperverletzung und sexueller Nötigung. Zusammen mit zwei Komplizinnen – sie hatte auch einen Hang zu gleichgeschlechtlichem Sex – hatte sie einen jungen Studenten in einer stadtbekannten Lesbenkneipe, in die sich der junge Mann verirrt hatte, mit sogenannten K.-o.-Tropfen betäubt. Dann schleppten sie ihn auf ein Zimmer, fesselten ihn dort an ein Bett, hielten ihn drei Tage lang fest und missbrauchten ihn sexuell nach allen »Regeln der Kunst«. Abgesehen davon, dass sie ihn auch noch ausraubten und sein Konto plünderten.
Eine nach der anderen und manchmal auch gemeinsam hatten sie ihr Opfer unvorstellbar gedemütigt. Die Details waren eine Mischung aus explosiver Erotik und widerlichen Perversitäten. Weil der junge, unerfahrene Mann aus gutem Hause teilweise Todesangst erlitten und wohl für den Rest seines Lebens einen psychischen Schaden davongetragen haben dürfte, verurteilten die Richter die drei »Grazien« zu mehrjährigen Freiheitsstrafen, wobei Monika S. mit drei Jahren noch am besten davonkam. Aber nicht, weil sie weniger Anteil am Geschehen hatte, sondern weil ihr Intelligenzquotient an der Grenze zur Debilität anzusiedeln war. Mit anderen Worten: Monika S. war zwar strohdumm, aber gefährlich raffiniert, absolut narzisstisch, gefühlskalt und gelegentlich scharf wie Nachbars Lumpi, wie man so schön sagt im Volksmund.
In einer langwierigen Gerichtsverhandlung gelang es letztendlich doch noch, die einzelnen Tatbeiträge und den genauen Tatablauf festzustellen. Auch mithilfe des Anwaltes von Matthias A., der seinen Mandanten davon überzeugen konnte, dass ihn Monika S. nicht liebte, sondern nur ausgenutzt hatte. Sie habe es nicht verdient, dass er sich für sie opfere. Matthias A. sah es ein, gab seine Märtyrerrolle auf und korrigierte seine Aussagen entsprechend, ohne aber seinen Tatbeitrag zu verschleiern.
Matthias A. sagte aus, dass Monika S. an jenem Tag, obwohl es schon spät war und beide im Stehausschank schon genug getrunken hatten, unbedingt noch den »geilen alten Sack«, wie sie Emil S. zu nennen pflegte, besuchen wollte. Bei ihm hatte sie gewohnt, bevor sie Matthias kennenlernte. Der Rentner hatte die beiden nur widerwillig in seine kleine Wohnung gelassen, wo sie sich gleich selbst aus dem Kühlschrank bedienten. Nach weiteren drei Flaschen Bier musste Matthias A. auf die Toilette und seine Monika mit dem vermeintlichen Nebenbuhler im Wohnzimmer zurücklassen. Er schloss aber die Klotür nicht, um zu hören, worüber die beiden reden würden. Zumal Monika schon den ganzen Abend so komische Andeutungen gemacht hatte.
Matthias wollte gerade vom winzigen Flur zurück ins Wohnzimmer, als er hörte, wie Monika zum Gastgeber sagte: »Ich will wieder bei dir einziehen.« Das genügte. Die ablehnende Antwort des Rentners nahm er gar nicht mehr wahr. Wut, Eifersucht und Verzweiflung stiegen in ihm hoch. Da er nichts anderes zur Hand hatte, mit dem er seinen Nebenbuhler hätte angreifen können, zog er sein Schweizer Taschenmesser aus der Hosentasche, klappte blitzschnell die größte Klinge heraus, die dieses Allround-Messerchen aufzuweisen hatte, stürmte ins Wohnzimmer und stürzte sich auf den völlig verdutzten Emil S. Mit der linken Faust schlug er wahllos auf dessen Kopf ein, und gleichzeitig stach er wie von Sinnen mit dem Messer zu, ohne darauf zu achten, wo er ihn traf. In seiner Rage merkte er gar nicht, dass sich die Klinge eingeklappt hatte und er sich selbst tiefe Schnitte im rechten Handballen und am kleinen Finger beibrachte. Er spürte nichts.
Der Rentner kippte von der Couch, schrie kurz um Hilfe, dann versagte ihm die Stimme. Er lag rücklings am Boden, jappste nach Luft und hob abwehrend die Hände. Aber das nützte nichts. Er kam nicht so schnell hoch, wie Matthias A. das alte Luftgewehr von der Wand genommen hatte, das dort zur Zierde hing. Dieses packte er mit beiden Händen am Lauf, holte kräftig aus und schlug mit dem Gewehrkolben auf den am Boden liegenden Rentner ein. Dabei wurde er angefeuert von Monika, die lachte und herumsprang, als würde sie einen Freudentanz aufführen. »Schlag ihn tot, die Drecksau, schlag ihn tot!«, schrie sie, sprang auf die Couch und hüpfte dort auf und ab. Emil S. schleppte sich noch ein Stück zur offen stehenden Balkontür, dann verließen ihn die Kräfte. Sein Kopf war ein einziger blutiger Klumpen, aber er röchelte noch. Matthias A. ging die Kraft aus, seine Schläge wurden weniger und kraftloser.
Das war der Moment, in dem Monika in Aktion trat. Sie packte einen Besen, der in der Ecke stand, drehte ihn um, so dass die Bürste nach oben zeigte, und rammte den hölzernen Stiel mit aller Kraft in den Hals des vor ihr am Boden liegenden Rentners. Die Wucht war so groß, dass der Besenstiel trotz des abgerundeten Endes in die Halspfuhle unterhalb des Kehlkopfes eindrang, bis zu den Halswirbeln durchschlug, diese zertrümmerte und im Hals stecken blieb. Damit der Besen nicht umfiel, klemmte Monika das Bürstenteil in die Balkontür ein und ließ den Stiel im Hals des alten Mannes stecken. Wie lange dieser noch gelebt haben dürfte, konnte nicht geklärt werden. Er starb zum einen an den schweren Kopfverletzungen, die ihm durch die Schläge mit dem Gewehrkolben beigebracht worden waren, und zum anderen hätte er auch die Verletzung durch den Besenstiel nicht überlebt. Ein Gemeinschaftswerk des Pärchens also, wenn auch aus völlig unterschiedlichen Motiven. Noch während das Opfer langsam ausblutete, machten sich die beiden daran, alle ihnen stehlenswert erscheinenden Gegenstände einzupacken. »Der braucht das Zeug sowieso nicht mehr, der alte Drecksack. Dafür hat er mich ja auch oft genug ficken dürfen«, lachte Monika und kabelte den kleinen Farbfernseher ab, der fast Tag und Nacht lief, als sie noch bei Emil S. gewohnt hatte. Sogar wenn der Rentner den täglichen Oralverkehr bei ihr ausgeübt und sich dann auf sie gelegt hatte, um wenigstens kurz in sie einzudringen, lief der Fernseher. Sie empfand nichts dabei, wenn sich der »geile alte Sack« an ihr »zu schaffen machte« und sich »aufgeilte«. Sie hatten sich schließlich darauf geeinigt, dass sie dafür umsonst bei ihm wohnen dürfe, verpflegt würde und so lange fernsehen könne, wie sie wolle. Den Farbfernseher hatte der Rentner eigens deswegen gekauft.
Monika S. und Matthias A. wurden wegen gemeinschaftlich begangenen Mordes zu lebenslangen Freiheitsstrafen verurteilt. Das Gericht sah bei Monika S. das Mordmerkmal der Grausamkeit verwirklicht. Grausam tötet, wer seinem Opfer aus gefühlloser, unbarmherziger Gesinnung besondere Schmerzen oder Qualen zufügt, heißt es im Kommentar zum Strafgesetzbuch. Dass dies erfüllt war, daran hatte niemand ernsthafte Zweifel. Nicht einmal der Anwalt von Monika S. Sie habe dem Opfer nicht deshalb den Besenstil in den Hals gestoßen, weil sie Angst vor der Reaktion ihres Mittäters hatte, sondern weil sie voller Wut und Hass auf den Rentner war, der sich geweigert hatte, sie wieder bei sich wohnen zu lassen. Und dass es nicht dem Wunsch von Mattias A. entsprang, nach einer solchen Tat auch noch Wertgegenstände zu entwenden, sondern dem Egoismus von Monika S. zuzuschreiben war, daran hatte das Gericht nicht die geringsten Zweifel. Denn wer käme schon auf die Idee, einen Farbfernseher mitgehen zu lassen, außer einer Person, die als fernsehsüchtig einzustufen ist und ausgerechnet zu der Zeit kein TV-Gerät hatte.
Bei Matthias A. war das Mordmerkmal des niedrigen Beweggrundes der Eifersucht erfüllt und das der Heimtücke auch, da er sein Opfer angegriffen hatte, als dieses völlig arg- und wehrlos war. Das Mordmerkmal der Habgier war bei ihm nicht erfüllt, da der Entschluss zum Diebstahl der Wertgegenstände erst nach der Tötungshandlung gefasst wurde und von Monika S. ausging.
HEIMTÜCKE
Annabella W. ging ins Wohnzimmer, nahm das Telefon und rief die Polizei an.
»Jetzt hätte er es fast geschafft«, schrie sie weinend den Polizeibeamten entgegen, die kurze Zeit später aus dem Aufzug im achten Stockwerk stiegen. Die Nachbarn aus dem gleichen Stockwerk und dem darunter liegenden hatten sich allesamt im großräumigen, quadratisch gestalteten Treppenhaus des sehr gepflegten, achtstöckigen Hochhauses versammelt. Die unmittelbare Wohnungsnachbarin, eine ältere Dame, hatte liebevoll ihren Arm um Annabella W. gelegt, die auf einem Stuhl neben ihrer geöffneten Wohnung saß, eingehüllt in eine warme Wolldecke. Trotzdem zitterte sie wie Espenlaub, ihre Beine wippten auf und ab. Ihr Sohn hockte neben ihr und tröstete sie: »Es wird alles gut, Mama«, sagte er immer wieder.
Ein Streifenbeamter hatte längst den Notarzt angefordert, der fünf Minuten später vor Ort war. Die Retter hatten die Leiche von Helmut W. aus dem schmalen Raum zwischen Bett und Wand herausziehen müssen. Sie lag nun vor dem Fußende des Ehebettes am Boden. Der Notarzt bescheinigte einen nicht natürlichen Tod und trug als Todesursache »Verbluten nach innen und außen infolge zahlreicher Messerstiche« in die Todesbescheinigung ein. (Die Rechtsmediziner sollten später 34 Einstiche zählen.) Dann kümmerte sich der Notarzt um das Opfer, also um Annabella W. Er gab ihr eine Beruhigungsspritze, eine Einlieferung ins Krankenhaus lehnte sie ab. Sie habe ja ihren Sohn und käme schon klar, meinte sie.
Der Kollege des Kriminaldauerdienstes, der mich kurz nach 2.00 Uhr aus dem Bett geläutet hatte, schilderte knapp den Sachverhalt und meinte, so wie es aussehe, dürfte es sich um eine Notwehrhandlung bzw. eine Notwehrüberschreitung gehandelt haben. Die Frau habe bereits eine erste Aussage gemacht. Demnach sei sie von ihrem gewalttätigen Mann mit einem Küchenmesser angegriffen worden, als sie zu Bett gegangen war. Irgendwie sei es ihr gelungen, ihm das Messer zu entreißen. In ihrer Todesangst habe sie dann auf ihn eingestochen. Sie wisse nicht mehr, wie lange und wie oft. Der Mann sei auch schon mehrfach wegen häuslicher Gewalt in Erscheinung getreten.
Ich fuhr zum Tatort in Erwartung des üblichen Milieus. Es ist zwar eine Tatsache, dass häusliche Gewalt in besseren Kreisen nicht seltener vorkommt als in der sozialen Unterschicht, aber in der sogenannten Oberschicht ruft die Frau Generaldirektor eher ihren Familienanwalt an als die Polizei, wenn sie von ihrem sturzbetrunkenen Gatten wieder einmal vermöbelt wurde, weil sie ihm eine Szene gemacht hat wegen dieser Schlampe von Sekretärin.
Als ich das vornehme Hochhaus betrat, war ich überrascht. Man sah auf den ersten Blick, dass hier vorwiegend Eigentümer wohnen, die bei jedem Kratzerchen im Treppenhaus eine Eigentümerversammlung einberufen. Also ein Umfeld, in dem man einen solchen Sachverhalt eher nicht vermuten würde. Zumindest dann nicht, wenn man sich von seinen Vorurteilen leiten lässt, die natürlich auch Ermittler haben und gegen die man tagtäglich ankämpfen muss. Sonst verliert man die Bodenhaftung. Noch überraschter war ich, als ich hörte, dass das 54-jährige Tatopfer ein Kollege war. Ein Polizeioberrat sogar, Chef einer großen Abteilung bei der Verkehrspolizei. Aha, dachte ich, ein Machtmensch. Niemand hat mehr Macht als die Kollegen der Verkehrspolizei. Dort gelten knallharte Regeln, und sogar hochgestellte Persönlichkeiten müssen klein beigeben, wenn sie in eine Verkehrskontrolle geraten. Nicht einmal die Bundeskanzlerin kann einen Strafzettel zurücknehmen, wenn es der kleine Verkehrspolizist nicht will – vorausgesetzt, er ist rechtmäßig ergangen. Für mich übrigens ein Zeichen echter Demokratie. Selbst Richter haben einen nur geringen Ermessensspielraum, wenn es um Verkehrsdelikte geht, bei denen die Strafrahmen meist schon katalogisiert vorgegeben sind.
Annabella W., 49-jährige Realschullehrerein für Englisch und Geschichte, war bereits zur Blutentnahme gebracht worden. Um es vorwegzunehmen: Sie stand unter keinerlei Alkohol-, Drogen- oder Medikamenteneinfluss. Der Sohn war zum Polizeipräsidium gefahren worden, da natürlich die Art seiner Beteiligung zu klären war. Fest stand, dass zur Tatzeit drei Personen in der Wohnung waren, von denen eine erstochen wurde. Die Rolle der beiden anderen war abzuklären. Auch wenn es auf der Hand zu liegen schien, wer das Messer geführt hatte. Aber war es glaubhaft, dass der junge Mann von der Tat nichts mitbekommen haben will, wie er gegenüber den Kollegen des Kriminaldauerdienstes angegeben hatte? Obwohl ein heftiger Kampf stattgefunden haben muss? Ein Kampf auf Leben und Tod, wenn man der Mutter glauben durfte? Bleibt da ein 20-jähriger, erwachsener junger Mann einfach in seinem Zimmer und traut sich nicht heraus?
Als Erstes machte mich stutzig, dass Annabella W.s Hausschuhe fein säuberlich nebeneinander links vor der Schlafzimmertür standen. Es waren pinkfarbene Slipper mit einem weißen, flauschigen Pommel obendrauf und mit relativ hohen Absätzen. Nicht das geringste Blutspritzerchen war darauf zu erkennen. Ich fragte mich, warum jemand schon vor Betreten des Schlafzimmers die Hausschuhe ausziehen sollte, anstatt erst am Bett selbst? Deshalb sind es ja Hausschuhe, damit man sie überall in der Wohnung tragen kann. Außer man hat etwas vor, bei dem diese Dinger stören könnten, überlegte ich. Ich hatte – Gott bewahre – zwar noch keine solchen Schuhe getragen, wusste aber von meiner Frau, dass man in derlei Schuhwerk keinen sicheren Stand hat. Jedenfalls nicht, wenn man beispielsweise auf eine Leiter steigt oder etwas verrichtet, bei dem man leicht umknicken kann. Wie bei einem Kampf zum Beispiel.
Was für einen Grund könnte es noch gegeben haben, warum sie die Hausschuhe außerhalb des Tatzimmers ausgezogen hatte? Ganz klar: Hätte sie diese angelassen, wären sie massiv mit Blut besudelt worden. Das wiederum hätte nicht zu ihrer Aussage gepasst, wonach sie im Bett angegriffen worden sei. Denn im Bett trägt man nun einmal keine Hausschuhe, und auf ihrer Seite des Bettes, wo sie normalerweise hätten stehen müssen, war kein einziges Spritzerchen Blut. Noch eigenartiger aber war, dass ihre Hälfte des Bettes so wirkte, als hätte dort niemand drin gelegen, geschweige denn um sein Leben gekämpft. Das Bettlaken war faltenfrei, die Bettdecke war fein säuberlich zurückgeschlagen und glattgestrichen. Es sah so aus, als hätte in diesem Bett niemand gelegen bzw. geschlafen. Wie wäre das möglich, wenn sie hier angegriffen worden war?
War es denkbar, dass sie als planende, intelligente Täterin solch einen dilettantischen Fehler gemacht hatte? War das einer dieser einfachen, handwerklichen Fehler, wie sie weniger schlauen Tätern garantiert nicht unterlaufen würden? Also der Mangel an Erfahrung im Umgang mit alltäglichen, handwerklichen oder praktischen Verrichtungen, wie man ihn immer wieder ausgerechnet bei Leuten erlebt, die einen hohen Bildungsstand haben und dennoch oft nicht wissen, wie man eine Dose öffnet oder woher man eine Rolle Klopapier bekommt?
Die Bettdecke, mit der Helmut W. zugedeckt war, wies keinen Einstich auf. Das war komisch. Zumindest, wenn man glauben sollte, dass der Kampf wirklich im Bett stattgefunden hatte. Dass bei der Vielzahl der geführten Stiche kein einziger in die Bettdecke getroffen haben soll, mit der das Opfer zugedeckt gewesen sein muss – es war schließlich Winter und nicht besonders warm im Schlafzimmer – war kaum vorstellbar. Mehrere Einstiche wies aber der Schlafanzug auf, allerdings nur hinten. Dadurch war der Rückschluss berechtigt, dass er vorne offen gewesen sein muss. Was wiederum nicht der Gewohnheit des Opfers entsprach, wie wir später erfahren sollten. Hatte Annabella ihn eigens aufgeknöpft? Derartiges kennt man allerdings nur von Selbstmördern, die sogar dünnste Hemdchen ausziehen, weil sie befürchten, dadurch könnte das Eindringen der Klinge und damit der schnelle, schmerzlose Tod behindert werden. Gleiche Vorsichtsmaßnahmen werden natürlich auch von Tätern getroffen, sofern sie die Möglichkeit und die Zeit haben, diese Art von Vorbereitungshandlung durchführen zu können. Bei Affekt- oder Spontantaten ist das natürlich so gut wie nie der Fall, und oft genug haben uns durchstochene Kleidungsstücke aufgezeigt, wo und wie oft ein Opfer getroffen wurde. Wertvoll war solches Basiswissen beispielsweise dann, wenn das Opfer noch im Operationssaal lag und wir schon mit der Vernehmung der Täter beschäftigt waren. Und zwar deshalb, weil wir natürlich meist nicht mit der (ganzen) Wahrheit bedient werden. Aber gerade die herauszufinden, ist ja unsere Aufgabe. Vor dem Hintergrund, dass Beschuldigte das Recht haben, zu lügen, ist man deshalb für jede Information dankbar.
In der restlichen Wohnung gab es keine Auffälligkeiten. Außer dass im Wohnzimmer eine Packung mit Baldrian-Dragees stand, die fast leer war. Wer musste sich da beruhigen?
Es blieben eine Menge offener Fragen und Ungereimtheiten. Jedenfalls bestanden erhebliche Diskrepanzen zwischen dem, was die Frau bisher ausgesagt hatte, und dem, was wir am Tatort ablesen konnten. »Nicht kompatibel«, dachten wir.
Annabella W. wollte keinen Anwalt. Sie fühle sich nicht schuldig, gab sie zu Protokoll. Obwohl ihr bewusst sei, dass sie einen Menschen getötet habe. Deshalb sei sie auch aussagebereit, stehe Rede und Antwort. Sie habe in Notwehr gehandelt. Seit Wochen schon sei ihr Mann mit einem großen Küchenmesser zu Bett gegangen. Er habe ihr Angst machen und sie damit zum Auszug zwingen wollen. Damit hätte sie dann den ersten Schritt getan im sogenannten Trennungsjahr, das sie eigentlich in der eigenen Wohnung hinter sich bringen wollten. »Wer zuerst geht, hat verloren«, so wurde die Lage gesehen.
Aber schläft man weiterhin im selben Bett, als ob nichts gewesen wäre? Sicher, es war nur eine Dreizimmerwohnung. Aber warum hatte nicht einer von ihnen im Wohnzimmer geschlafen? Sie habe nicht nachgeben können, weil sie keinesfalls weichen wollte, erklärte sie. Auch innerhalb der Wohnung nicht. Es sei um so etwas wie die Vormachtstellung gegangen. Sie und ihr Sohn wollten bleiben und er sollte gehen. Aber war es glaubhaft, dass man dafür wochenlang neben einem Mann schläft, der ein riesiges Küchenmesser auf seinem Nachtkästchen liegen hat? Das passte einfach nicht zu dieser selbstbewussten Persönlichkeit. Wie konnte sich eine so emanzipierte, gebildete, intelligente Frau auf diese primitive Art und Weise wochenlang demütigen lassen? Nicht einmal bei unserer »Kundschaft« am anderen Ende der sozialen Leiter hatte ich bisher Gleichartiges erlebt.
Annabella W. blieb bei ihrer Version. Ihr Mann sei gegen 22.00 Uhr von seiner Geliebten gekommen, sie habe im Wohnzimmer noch ferngesehen. Es habe wieder einmal einen verbalen Streit gegeben. Das Übliche. Irgendwann, so habe er gedroht, bevor er zu Bett ging, würde er sie abstechen. Ihr sei zwar nicht wohl gewesen in ihrer Haut, aber eigentlich habe sie nicht geglaubt, dass er dies auch wirklich umsetzen würde. Sie begann zu schluchzen an dieser Stelle der Vernehmung, wobei aber keine Tränen zu sehen waren. Es war eher ein Weinversuch. Jeder gute Vernehmungsbeamte registriert so etwas. Versuchtes täuschendes Verhalten nennt man das.
Sie sei also gegen 24.00 Uhr zu Bett gegangen. Er habe diesmal nicht geschnarcht, das sei ihr aufgefallen. Trotzdem habe sie kein Licht gemacht, habe sich ins Bett gelegt und wollte sich gerade zudecken, als er plötzlich über ihr gewesen sei. »Jetzt bist du dran!«, habe er gezischt. Er habe das Messer in seiner linken Hand gehabt und zum Stich ausgeholt. Sie habe Todesangst bekommen. Was dann passiert sei, wisse sie nicht mehr genau. Irgendwie habe sie seinen Arm zu fassen gekriegt und ihm das Messer entwinden können. Dabei sei ihr sicher zugute gekommen, dass er aufgrund seines schweren Bandscheibenleidens relativ unbeweglich und langsam war. Dann habe sie blindlings zugestochen. Immer und immer wieder. Sie wisse nicht mehr, wie oft, und sie wisse auch nicht, wohin. Ihr sei nicht einmal bewusst gewesen, dass sie beide aus seiner Betthälfte gefallen seien. Irgendwie habe sie sich hochgerappelt und das Zimmer verlassen. Das Messer habe sie vorher fallen lassen. Auf dem Flur sei Sohn Florian gestanden. Er habe nichts gesprochen, nur angstvoll geschaut. Sie sei ins Wohnzimmer gegangen und habe die Polizei gerufen.
Auf die Frage, wie es ihr gelungen sein will, dem viel stärkeren Mann das Messer zu entwinden, ohne selbst die geringste Verletzung davonzutragen, verwies sie abermals auf die stark eingeschränkte Bewegungsfreiheit ihres Mannes. Nur deshalb sei es ihr gelungen, ihm das Messer zu entwinden. Offenbar habe sie in ihrer Todesangst enorme Kräfte entwickelt. Da ihr Mann als Rechtshänder das Messer in der linken Hand hielt, verfügte er womöglich nicht über die Kraft, die er mit seiner Rechten gehabt hätte. Sie dagegen habe als Rechtshänderin mit ihrem rechen Arm zugepackt und dadurch den Kraftunterschied ausgleichen können. Wie es ihr aber genau gelungen sei, ihm das Messer abzunehmen, konnte sie weder schlüssig erklären noch demonstrieren. Sie blieb in diesem Punkt so oberflächlich, dass es keine Zweifel gab: Sie schilderte einen Vorgang, den sie so nicht erlebt, sich nur gedanklich zurechtgelegt hatte. Wie bei »Columbo« dachte ich mir. Dort meinen die Täter auch immer, irgendwelche Ungereimtheiten erklären und aufklären zu müssen. Aber dass ein Mann, der sich kaum bewegen kann, zwei Stunden nachdem er zu Bett gegangen war, plötzlich hellwach einen Messerangriff gestartet haben soll, erschien mir doch sehr lebensfremd.
Ihre Hausschuhe würde sie immer im Flur ausziehen und nicht erst vor dem Bett. Da es im Schlafzimmer dunkel sei und sie kein Licht mache, wenn sie zu Bett gehe, habe sie sich das angewöhnt. Raffiniert, dachte ich. Das ist kaum zu widerlegen. Auf die Frage, warum ihr Bett unbenutzt war, konterte sie mit der Behauptung, es sei nicht unbenutzt gewesen, es habe nur unbenutzt gewirkt. Sie sei ja nur ganz kurz drin gelegen, als er sie angegriffen habe. Und nach kurzem Kampf sei sie sofort auf seine Seite gerollt. Da ihre Matratze mit einem Spannbettuch überzogen sei, sei es logisch, dass es keine Falten geschlagen habe und unbenutzt wirkte. Drum nenne man sie ja Spannbetttücher, erklärte sie schnippisch und war schließlich beleidigt wegen all dieser Fragen. Ob ich Zweifel hätte an ihrer Aussage, wollte sie wissen. Dann sähe sie nämlich keine Basis mehr für weitere Angaben zur Sache.
Ich ruderte zurück, um einen Abbruch zu verhindern. Allerdings nur insoweit, als ich ihr erklärte, es müssten eben alle Eventualitäten abgeklärt und alle Ungereimtheiten ausgeräumt werden. Das komme letztendlich auch ihr zugute, manifestiere es doch die Glaubhaftigkeit. Das überzeugte sie, und so erklärte sie schließlich noch, warum die Bettdecke so fein säuberlich zurückgeschlagen war. Weil sie nämlich noch gar nicht dazugekommen war, diese hochzuziehen, so schnell sei der Angriff erfolgt.
Natürlich hatte ich längst erkannt, dass diese Aussagebereitschaft Teil ihres Tatplanes war. Es wirkt schließlich nicht sehr gut, wenn man einerseits in Notwehr gehandelt haben will, andererseits aber die Aussage verweigert oder einen Anwalt braucht. Wozu, wenn man nichts zu verbergen hat? Also ließ ich mich weiterhin instrumentalisieren und nahm ihre Aussage mitsamt der Ungereimtheiten und der Widersprüche brav entgegen. So wie es meine Pflicht war.
Ihre Angaben erschienen mir nicht glaubhaft. Wer schon einmal gesehen hat, wie ein Bett aussieht, in dem gekämpft oder andere Leidenschaften vollzogen wurden, egal ob Spannbetttuch oder nicht, der wusste, dass in ihrer Betthälfte weder ein Kampf stattgefunden noch begonnen haben kann. Wir würden eine Rekonstruktion machen, nahmen wir uns vor.
Annabella W., die Angegriffene, hatte keinerlei Abwehrverletzungen davongetragen. Ihr Mann Helmut, der Angreifer, hatte dagegen schwerste Abwehrverletzungen an beiden Händen und Armen. Sogar in den Kopf war er mehrmals getroffen worden. Der Mann hatte um sein Leben gekämpft, das stand fest. Er hatte offensichtlich versucht, die Stiche mit den Armen und Händen abzuwehren. Zwei Herzstiche hatte er erlitten, jeder einzelne wäre für sich allein tödlich gewesen. Die meisten anderen Stiche fanden sich vorwiegend im Oberkörper; sowohl im Brust- als auch im Rückenbereich, zwei Einstiche waren sogar an der Außenseite des rechten Oberschenkels. Sie müssen gesetzt worden sein, als Helmut W. schon am Boden vor dem Bett lag. Die Stiche wurden größtenteils mit enormer Wucht geführt, beim Auftreffen auf das Knochengerüst hatte sich die Messerspitze verbogen. In die Weichteile war die 25 Zentimeter lange Klinge teilweise bis zur vollen Länge eingedrungen.
Wir sprechen bei derartigen Verletzungsbildern von »Blutrausch« oder dem sogenannten Übertöten. Womit gemeint ist, dass Täter mehr getan haben, als zur Tötung nötig gewesen wäre. Meist ein Hinweis darauf, dass sich aufgestaute Emotionen oder Perversionen entladen haben dürften. Letzteres konnte man ausschließen. In einen Blutrausch können übrigens auch Täter geraten, die ihre Tat eiskalt geplant und eigentlich gar nicht die Absicht hatten, derart überzureagieren. Panik, Angst, plötzlich hervorbrechender Hass oder unerwartete Gegenwehr können ebenfalls Auslöser dafür sein, warum Täter die Kontrolle über sich verlieren. Und genau darauf wollte Annabella W. hinaus. Sie sei in Panik geraten, habe Todesangst gehabt und deshalb die Kontrolle über sich verloren. Ich glaubte ihr kein Wort.
Der Sohn Christoph blieb bei seiner Version, nichts mitbekommen zu haben. Die Vernehmung musste abgebrochen werden, da der junge Mann eine Kreislaufschwäche erlitt. Er war, wie man das salopp ausdrückt, fix und fertig. Eine tiefergehende Befragung war deshalb in dieser Nacht nicht mehr möglich.
Morgen würde Annabella W. dem Haftrichter vorgeführt werden. In der Regel haben wir Ermittler nicht viel Zeit, um so viel Beweismaterial zusammenzutragen, dass es zum Erlass eines Haftbefehles reicht. Hat uns doch der Gesetzgeber eine Frist »bis zum Ablauf des darauffolgenden Tages« ab Festnahmezeitpunkt gesetzt. Spätestens dann muss eine vorläufig festgenommene Person wieder auf freien Fuß gesetzt oder einem Ermittlungsrichter vorgeführt worden sein. Dummerweise kommt es vor, dass Straftäter fünf Minuten vor Mitternacht festgenommen wurden. Das bedeutet, dass der erste Tag bereits nach fünf Minuten abgelaufen und damit für uns verloren ist. Bleibt uns also nur noch der darauffolgende Tag, um unsere Beweise zu sammeln und alle Vernehmungen durchzuführen. Viel lieber ist uns Ermittlern deshalb, wenn jemand fünf Minuten nach Mitternacht festgenommen wurde. Wir haben dann zusammen mit dem darauffolgenden Tag insgesamt fast 48 Stunden zur Verfügung, um der Staatsanwaltschaft die Beweise und Indizien vorzulegen, die sie braucht, um einen Haftbefehl beantragen zu können.
Annabella W. war morgens um 1.30 Uhr festgenommen worden. Wir hatten also theoretisch noch 46 Stunden und 30 Minuten Zeit, Beweise für ihre Schuld oder Unschuld zu sammeln. Ziel unserer Arbeit ist nämlich nicht die Be- oder Entlastung von Tatverdächtigen, sondern die Ermittlung der Wahrheit. Egal, wie diese aussieht. Auch wenn uns immer wieder unterstellt wird, es käme uns nur darauf an, möglichst schnell einen Täter präsentieren zu können. Das tut weh, weil es nicht stimmt. Allein schon deshalb nicht, weil keine Staatsanwältin und kein Staatsanwalt für derartige Machenschaften zu gewinnen wäre. Abgesehen davon, dass nach der Staatsanwaltschaft auch noch der Ermittlungsrichter zu manipulieren wäre und nach dem Ermittlungsrichter die nächste Haftprüfung durch einen anderen Richter usw. Ich habe es jedenfalls nie erlebt, dass es leicht gewesen wäre, Juristen von der Notwendigkeit eines Haftbefehles zu überzeugen. Im Gegenteil. Oft genug haben wir uns geärgert, weil Täter auf freiem Fuß belassen wurden, obwohl unserer Meinung nach die Anordnung der Untersuchungshaft angezeigt gewesen wäre.
Was der Computer ausspuckte, kam der Beschuldigten entgegen. Wiesen die Unterlagen doch aus, dass Annabella W. über einen längeren Zeitraum Opfer sogenannter häuslicher Gewalt war. Es fand sich sogar ein ärztliches Attest, aus dem hervorging, dass sie über Ohrensausen und Kopfschmerzen geklagt hatte, angeblich verursacht durch Schläge auf den Kopf seitens ihres Ehemannes. Das Attest hatte sie laut Unterlagen einige Tage nach einem dieser Einsätze persönlich auf der Polizeiwache nachgereicht. Der Hausarzt war übrigens der Ehemann einer ihrer Stammtischdamen, die ebenfalls Ärztin war.
Alle Ermittlungsvorgänge waren jedoch im Sande verlaufen, mit Verweis auf den Privatklageweg eingestellt worden von der Staatsanwaltschaft. Wie die meisten Ermittlungsvorgänge dieser Art. Aber die Vorgänge waren aktenkundig und vermittelten zumindest den Eindruck, als ob Gewalt in dieser Beziehung keine Seltenheit gewesen wäre. Absicht?
Dreimal nämlich hatte sie in den letzten Wochen die Polizei in die eheliche Wohnung gerufen, weil sie »vom Feind in ihrem Bett« geschlagen worden sein will. Und einmal hatte sie Anzeige wegen Diebstahls erstattet, in der sie ihren Mann beschuldigte, eine wertvolle chinesische Vase gestohlen zu haben, die ihr alleine gehört habe.
Allerdings wiesen diese Anzeigen bei genauerem Hinsehen einige Merkwürdigkeiten auf. In keinem Fall nämlich hatten die Beamten irgendwelche Verletzungen feststellen können und der anwesende Ehemann habe jedes Mal glaubhaft versichern können, dass es sich um rein verbale Streitigkeiten gehandelt habe und er selbst nicht verstehen könne, warum seine Frau die Polizei gerufen hat. Ganz plötzlich habe sie völlig hysterisch reagiert und herumgebrüllt, sie lasse sich von ihm nicht länger misshandeln. Obwohl er seine Frau noch nie in ihrer immerhin 22-jährigen Ehe geschlagen habe.
Das war alles, auf das wir zurückgreifen konnten. Ein kleiner Aktenvermerk, mehr nicht. Aber die Erfahrung zeigt ja immer wieder, dass man auch von toten Menschen eine Aussage bekommen kann. Man muss nur denoder diejenigen finden, denen sie zu Lebzeiten vertraut und denen sie sich vor allem anvertraut haben. Niemand ist dazu besser geeignet als eine Geliebte. Oder die beste Freundin. Dem besten Freund dagegen erzählt man nicht alles. Männer offenbaren sich nicht so schonungslos wie Frauen. Behaupte ich.
In unserem Fall hatten wir eine solche Person gefunden. Es war die Geliebte von Helmut W. Und sie wurde zu seinem Sprachrohr. Denn mit dieser Frau hatte er über alle seine Sorgen und Nöte gesprochen, vor ihr hatte er keine Geheimnisse. Es war so, als ob wir ihn selbst hätten vernehmen können. Sie sprach quasi stellvertretend für ihn, so gut, wie sie informiert war.
Helmut W.s Freundin war Hauptkommissarin und arbeitete in einer Verkehrsabteilung. Mit ihren 35 Jahren war sie zehn Jahre jünger als ihr Liebhaber, der einer anderen Abteilung angehörte. Sie hatten sich in der Kantine kennengelernt und irgendwann angenähert. Helmut W. wohnte seit längerer Zeit schon bei ihr, kehrte aber absichtlich jeden Abend in die eheliche Wohnung zurück, um die Auflagen hinsichtlich des Trennungsjahres nicht zu verletzen. Sie hatte ihm davon abgeraten, aber er wollte es durchziehen. Zehn Monate hatte er schon hinter sich gebracht. Als die Zeugin gefragt wurde, ob sie sich vorstellen könne, dass Helmut W. seine Frau geschlagen haben könnte, lächelte die junge Frau. Sie wisse von den Polizeieinsätzen, die von Annabella W. regelrecht inszeniert worden seien. Helmut W. sei eine Seele von Mensch gewesen, ein Mann, der keiner Fliege etwas zu leide tun konnte. Eine eher introvertierte Persönlichkeit, gebildet, großzügig, vernünftig und gütig. Auf seinen Sohn sei er sehr stolz gewesen, er habe ihn geliebt und konnte deshalb sogar damit leben, dass dieser nahezu ausschließlich der Mutter zugewandt war und ihn eigentlich seit Jahren nicht mehr beachtete. Seine Frau habe den eigenen Sohn gegen den Vater aufgehetzt. Das habe ihm sehr weh getan, aber er habe es hingenommen, um den Jungen nicht zu verwirren. Er wollte ihm alles ermöglichen, damit er seinen Weg gehen konnte, der ja sehr vielversprechend aussah. Der Mutter sei es ums Geld gegangen, sonst um nichts. Helmut W. wollte ohnehin alles seinem Sohn vermachen, da gab es nicht die geringsten Zweifel.
Niemand konnte eigentlich so recht verstehen, warum Annabella ihren Mann so grundlos beschuldigt hat. Sie habe ihn sogar wegen Diebstahls angezeigt, obwohl alle Gegenstände in der Wohnung sein Eigentum waren. Auch die chinesische Vase, die zwar sie ausgesucht, er aber bezahlt hatte. Tatsächlich habe sie seit Wochen wertvolle Gegenstände verschwinden lassen. Obwohl er gar nicht vorgehabt hätte, Anspruch auf diese Gegenstände zu erheben. Außer den zwei oder drei Bildern, die er von seinen Eltern geerbt hatte. Es gebe eigentlich nur einen Grund, warum seine Frau das gemacht habe: Sie wollte ihn mit allen Mitteln provozieren. Ausrasten sollte er, schreien, schimpfen. Er hatte den Eindruck gehabt, als ob es ihr am liebsten gewesen wäre, wenn er sie wirklich geschlagen hätte. Aber warum nur? Das hatte er sich einfach nicht erklären können. Alles andere habe ihn nicht aus der Ruhe gebracht. Schon gar nicht ihr Gerede vom Erbe des Sohnes. Es sei ihr nämlich nur darum gegangen, die Eigentumswohnungen samt Mieteinnahmen schon jetzt dem Sohn zu sichern. Schließlich habe er eine Geliebte, die erst 35 Jahre sei und noch Kinder bekommen könne, habe sie gemeint. Aber über diese dümmlichen Argumente habe Helmut nur geschmunzelt. Damit habe sie ihn schon lange nicht mehr ärgern können.
Nie und nimmer hätte Helmut W. ein Messer zur Hand genommen, geschweige denn mit ins Bett, versicherte seine Geliebte. Das sei ja geradezu lächerlich. Wenn es nicht so traurig wäre, müsste sie an dieser Stelle lachen. Im Übrigen sei Helmut so gut wie bewegungsunfähig gewesen. Er wäre wegen seines schlimmen Bandscheibenleidens gar nicht in der Lage gewesen, sich im Bett aufzurichten, sich zu drehen und den Arm samt einem Messer zu erheben.
Dass er die Nächte bei seiner Frau verbracht habe, habe sie nicht gestört. Es habe ihr auch nichts ausgemacht, dass er zumindest hin und wieder noch mit ihr geschlafen habe. Sie war seine Ehefrau, noch waren sie miteinander verheiratet. Helmut habe ihr gegenüber auch offen darüber gesprochen. Vor zwei Wochen beispielsweise habe er ihr erzählt, dass Annabella plötzlich zum ihm ins Bett gekommen sei und Sex wollte. Regelrecht verführt habe sie ihn, und schließlich habe er nachgegeben. Auch wenn er sich hinterher geärgert habe.
Annabella W. habe natürlich von ihr gewusst. Helmut habe kein Geheimnis daraus gemacht, dass er eine neue Beziehung hatte. Auch wer sie sei, sei Annabella bekannt gewesen. Zusammengetroffen waren sie aber nur ein einziges Mal, als sie in Helmuts Auto vor dessen Wohnanwesen auf ihn gewartet habe. Annabella sei auf sie zugekommen, habe sie angesehen, den Kopf geschüttelt und unglaublich herablassend gesagt: »Ja, genauso habe ich Sie mir vorgestellt.« Dann habe sie sich hämisch grinsend abgewandt und im Weggehen noch laut und unüberhörbar »Bauerntrampel« gesagt.
Die Freundin von Helmut W. hatte einen absolut glaubwürdigen Eindruck gemacht, ihre Angaben waren schlüssig und glaubhaft. Obwohl sie allen Grund gehabt hätte, zeigte sie keinen Belastungseifer. Sie war entsetzt darüber, dass der Sohn während der Tat in der Wohnung war, und hoffte inständig, dass er keinen Schaden davongetragen habe, der arme Junge. Was das äußere Erscheinungsbild betraf, war die Freundin von Helmut W. das krasse Gegenteil seiner Ehefrau. Relativ groß für eine Frau, gut gebaut, kräftig und hübsch. Das, was man eine warme, weiche Frau nennt. Fraulich halt. Ganz anders als die superschlanke, asketisch wirkende Annabella W. mit den zwar ausgesprochen attraktiven, aber harten, etwas kantigen Gesichtszügen. Unterschiedlicher hätten diese beiden Frauen gar nicht sein können.