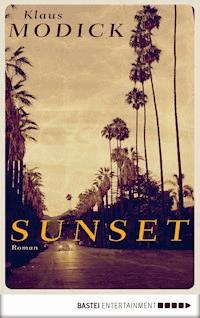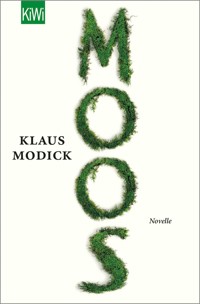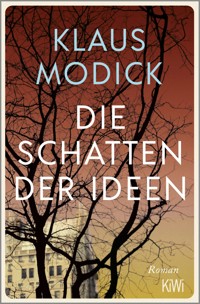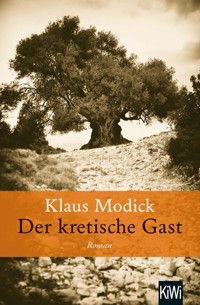9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Bestseller - Ein schrecklich böser und rasend komischer Roman über den Literaturbetrieb Der chronisch klamme Schriftsteller Lukas Domcik findet in Tante Theas Koffer ein Konvolut mit Aufzeichnungen aus ihrer Jugend in den Dreißiger- und Vierzigerjahren. Zunächst kann er mit dem Backfischgeschreibsel nichts anfangen, doch dann lernt er die schöne Rachel kennen. Um ihr ganz nahezukommen und endlich auch mal das ganz große Geld zu machen, entwirft er einen genialen Plan: Aus dem deutschen Schicksal der Tante ließe sich mit leichter Hand und reichlich Chuzpe ein anrührender Weltbestseller verzapfen. Doch im Rausch seiner Amour fou verliert Domcik schon bald die Übersicht ... Klaus Modick, der seit Monaten mit seinem jüngsten Roman Konzert ohne Dichter in den Bestsellerlisten zu finden ist, erzählt in Bestseller zugespitzt und auf unterhaltsame Weise, wie der Literaturbetrieb funktioniert. Eine bitterböse Satire über Geld, Liebe und das Schreiben in Kriegszeiten, die den schmalen Grat zwischen Erinnerung und Fiktion auslotet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 314
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Klaus Modick
Bestseller
Roman
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Klaus Modick
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Klaus Modick
Klaus Modick, geboren 1951, studierte in Hamburg Germanistik, Geschichte und Pädagogik, promovierte mit einer Arbeit über Lion Feuchtwanger und arbeitete danach u.a. als Lehrbeauftragter und Werbetexter. Seit 1984 ist er freier Schriftsteller und Übersetzer und lebt nach zahlreichen Auslandsaufenthalten und Dozenturen wieder in seiner Geburtsstadt Oldenburg. Für sein umfangreiches Werk wurde er mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, u.a. mit dem Nicolas-Born-Preis, dem Bettina-von-Arnim-Preis und dem Rheingau Literaturpreis. Zudem war er Stipendiat der Villa Massimo sowie der Villa Aurora. Zu seinen erfolgreichsten Romanen zählen »Der kretische Gast« (2003), »Sunset« (2011), »Konzert ohne Dichter« (2015) und »Keyserlings Geheimnis« (2018).
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
In Tante Theas Koffer findet ihr Erbe, der mittelmäßig erfolgreiche und chronisch klamme Schriftsteller Lukas Domcik, ein Konvolut mit Aufzeichnungen aus ihrer Jugend in den Dreißiger- und Vierzigerjahren. Zunächst kann er mit dem unsäglichen Backfischgeschreibsel nichts anfangen. Doch dann lernt er die schöne Rachel kennen. Um ihr ganz nahezukommen und um endlich auch mal das ganz große Geld zu machen, entwirft er einen genialen Plan: Mit leichter Hand und reichlich Chuzpe ließe sich aus dem deutschen Schicksal der Tante ein anrührender Weltbestseller verzapfen. Und mit Rachel als vorgeblicher Autorin wäre auch für die telegene Vermarktung gesorgt. Doch im Rausch seiner Amour fou verliert Domcik schon bald die Übersicht …
Klaus Modick, mit seinem jüngsten Roman »Konzert ohne Dichter« monatelang auf der SPIEGEL-Bestsellerliste zu finden, erzählt in seinem schrecklich bösen und rasend komischen Roman »Bestseller« »zugespitzt und auf leichte, unterhaltsame Weise, wie der Literaturbetrieb funktioniert.« NDR
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
© 2015, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
eBook © 2015, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Covergestaltung: Barbara Thoben, Köln
Covermotiv: © plainpicture/Anja Weber-Decker
ISBN978-3-462-30996-6
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
Fälschungsfall George Forestier
Motto
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
Informationen zum Fälschungsfall George Forestier habe ich Hans-Jürgen Schmitts Aufsatz Der Fall George Forestier (in: Karl Corino (Hg.): Gefälscht! Nördlingen 1988) entnommen. Zu danken habe ich Rupprecht Siebecke für juristische Erläuterungen, Thommie Bayer für eine rettende Idee, Hermann Kinder für kollegialen Zuspruch und Matthias Bischoff fürs Lektorat.
Mais ne suffit-il pas que tu sois l’apparence
Pour réjouir un cœur qui fuit la vérité?
Qu’importe ta bêtise ou ton indifférence?
Masque ou décor, salut! J’adore ta beauté.
Charles Baudelaire
1
Höchste Zeit, die Wahrheit zu sagen. »Nichts als die Wahrheit« (Dieter Bohlen). Um falschen Erwartungen vorzubeugen, gebe ich allerdings zu bedenken, dass es »die« Wahrheit nicht gibt, sondern bestenfalls meine subjektive Wahrheit der leidigen und extrem dumm gelaufenen Affäre. Die »volle« oder »ganze« Wahrheit ergäbe sich vielleicht, wenn alle Beteiligten ihre Sicht der Sache darlegten; aber es wäre von mir zu viel verlangt und Ihnen als Leser nicht zuzumuten, all diese Hochstapler und Schwadroneure, Schaumschläger und Betriebsnudeln noch einmal zu Wort kommen zu lassen.
Die »reine« Wahrheit also? Unmöglich. Außer in der Waschmittelwerbung ist auf dieser Welt rein gar nichts rein, nicht einmal das sprichwörtliche Glas Wasser, das bekanntlich von Bakterien nur so wimmelt. Die »nackte« Wahrheit womöglich? Kommt nicht infrage! Das Wort »nackt« hat mir noch nie gefallen. Es klingt brutal und hoffnungslos unerotisch, verbirgt nichts, verspricht also auch nichts, lähmt die Fantasie, vernichtet die Verlockung und damit das Begehren. Davon scheinen sogar diejenigen eine Vorstellung zu haben, von denen man es am wenigsten erwarten würde: die FKK-Freaks. Sie bemänteln ihr bloßes Treiben ja nicht etwa mit dem Begriff Nacktkörperkultur, sondern bemühen die Freikörperkultur (Kultur!) oder, beinah schon schamhaft bedeckt, den Nudismus.
Nehmen wir als beliebiges Beispiel die Nacktschnecke. In Kräuter- und Gemüsebeeten treibt sie ihr schleimiges Unwesen und unersättliches Vernichtungswerk, und bei allem Respekt vor der Kreatur als solcher will es mir einfach nicht gelingen, die gemeine Nacktschnecke mit Nachsicht zu behandeln. Ich meine, allein schon der Name! Gut, in der Natur könnte man derlei tolerant durchwinken, aber sieht’s denn im kulturellen Bereich besser aus? Aufs sogenannte Regietheater beispielsweise muss ich leider später noch ausführlicher zu sprechen kommen.
Wenn mein Hausarzt beim jährlichen Rundumcheck zu mir sagen würde: Bitte ziehen Sie sich mal nackt aus, würde ich mich gleich wieder anziehen und die 10 Euro Praxisgebühr zurückverlangen. Das weiß oder ahnt der Arzt natürlich und sagt also vorsichtshalber: Bitte machen Sie sich ganz frei. Diese Formulierung darf man allerdings auch nicht allzu streng beim Wort nehmen, weil man sonst zügig depressiv werden könnte. Man strebt sein ganzes Leben danach, sich frei zu machen und frei zu werden, beispielsweise von den sogenannten gesellschaftlichen Zwängen, vom chronischen Ärger über die Literaturkritik oder von seinen Schulden bei der Bank, sucht seit Kant emsig nach dem Ausgang aus der selbst verschuldeten Unmündigkeit und rennt dabei, wenn man Glück hat, offene Türen ein. Wenn man Pech hat, also meistens, geht man aber nur mit dem Kopf durch die Wand und landet dann in irgendeinem Nebenzimmer. Vor der nächsten Wand.
Trotzdem mache ich mich lieber ganz frei als nackt. Oder gar splitternackt. Splitterfasernackt. Es entbehrt jeder Logik, aber das widerliche Wort ist tatsächlich steigerungsfähig, so unsinnig steigerungsfähig wie Wahrheit, reine Wahrheit, nackte Wahrheit. Ich meine, wahr ist wahr, und nackter als nackt geht doch gar nicht. Das wäre sonst ja schon fast Obduktion und Vivisektion. Übrigens klingt die Sache nicht nur übel, sondern sieht auch fast immer unerfreulich aus. Selbst die schönsten Frauen – ich komme auf das Thema gleich noch ausführlicher, Geduld! – wirken erotischer, wenn sie, wie minimalistisch auch immer, bekleidet sind statt, Entschuldigung, nackt ausgezogen. Angezogen, jedenfalls ein bisschen angezogen, wirkt einfach anziehender.
Okay, ich weiß natürlich, dass die Floskeln von der »ganzen«, »reinen« und »nackten Wahrheit« nur Metaphern sind. Ich musste aber diese kleinkarierte Klärung der Begriffe vorausschicken, damit Sie erstens wissen, was ich unter Wahrheit verstehe, und sich zweitens nicht der Illusion hingeben, dass ich mir hier, wiederum metaphorisch gesprochen, die Brust aufreiße, um mit Herzblut zu schreiben, oder gar, wie man so sagt, die Hosen herunterlasse, um Ihnen Einblicke ins säuische Getümmel meiner Obsessionen zu gewähren. In eigener Sache kann ich höchst diskret sein. Für diesen Bericht habe ich gute Gründe, aber irgendwelche nackten Wahrheiten meiner Abgründe dürften der Wahrheitsfindung entschieden abträglich sein. Von bizarren, der Mitteilung werten sexuellen Fantasien werde ich im Übrigen auch gar nicht verfolgt, und meine erotischen Wunschvorstellungen regen sich auf einem eher unspektakulären Niveau. Zum Beispiel finde ich Frauen mit kleinem Busen ungleich attraktiver als Trägerinnen quellender Oberweiten, was mich etwa von Heimito von Doderer unterscheidet, der ja geradezu närrisch nach üppigen Großeutern war, weshalb das Titelkürzel seines Romans Die Dämonen,DD nämlich, häufig als Kürzel für »Dicke Damen« interpretiert wurde. Auch sein Faible für Sahnetorten, das tiefenpsychologisch vermutlich mit seinem Busenfetischismus verkoppelt war, ist mir fremd: Ich bevorzuge ofenfrischen Butterkuchen ohne Sahne. Ich meine, nichts gegen Doderer, der zwar nicht alle Tassen im Schrank hatte, aber erstklassige Romane und Tagebücher geschrieben hat, worin er mir nun wiederum geistesverwandt ist; aber das, was mich sonst noch mit ihm verbindet, lasse ich auf sich beruhen, sonst komme ich zu spät oder gar nicht auf den Punkt. Zwar habe ich die Wahrheit versprochen, und die ist nicht unkompliziert, aber langweilen möchte ich Sie natürlich auch nicht, obwohl die Wahrheit meistens entsetzlich langweilig und unglaubwürdig ist. Um sie interessant und glaubwürdig zu machen, saugt sich unsereiner Fiktionen aus den Fingern. Um wahr zu wirken, muss die Wirklichkeit gefälscht werden. Das ist das ganze Geheimnis der Literatur. Und im Fall meines Bestsellers hat es ja im Grunde auch bestens funktioniert. Dass die Welt, die betrogen werden will, empört »Betrug« schreit, wenn sie dahinterkommt, erfolgreich betrogen worden zu sein, empfinde ich als schizophren – aber um auf den Punkt zu kommen, greife ich jetzt vor, was den Punkt auch zuverlässig verfehlt.
Wo war ich stehen geblieben? Richtig: Obsessionen, erotische Fantasien, Wunschvorstellungen, dieser ganze heikle Komplex. Er wird zwar im Folgenden keine leitmotivische Rolle spielen oder als billiger Sex-sells-Running-Gag fungieren, aber wenn ich schon davon spreche beziehungsweise schreibe, darf sie nicht unerwähnt bleiben. Welche sie? Isabelle Adjani natürlich. Wer sonst? Wenn ich in meinen Wunschvorstellungen hegte, was man die Traumfrau zu nennen pflegt, dann wär’s Isabelle Adjani. Eine Traumfrau hege ich aber allein schon deswegen nicht, weil das eine aus den besten Teilen diverser schöner, interessanter, kluger, humorvoller und reicher Frauen aus verschiedenen Epochen zusammengepuzzelte Person ergäbe, im besten Fall also das Produkt einer mental-virtuellen Vollkommenheitschirurgie, vermutlich aber doch eher eine Art weibliches Anti-Frankenstein-Monster. Und dem würden dann jene kleinen Schönheitsfehler abgehen, die man am Ende mehr liebt als alle Perfektion – es sei denn, man würde diese Fehler gleich mit implantieren, wobei man sich vermutlich aber auch gewaltig verheben könnte.
Besser, man nimmt’s, wie’s kommt, beispielsweise in Gestalt von Isabelle Adjani in jüngeren Jahren, also etwa um die dreißig, und zwar in dem Film Die Frau nebenan. Haben Sie den gesehen? Die männliche Hauptrolle spielt wie in allen französischen Filmen Gérard Depardieu, auf den ich wegen dieses Films beziehungsweise wegen Isabelle Adjani wütend eifersüchtig war, und Regie führte Claude Sautet oder Eric Rohmer, einer dieser Nouvelle-Vague-Weichzeichner jedenfalls. Bevor ich Ihnen aber jetzt was Falsches erzähle, google ich das mal schnell nach. Momentchen bitte –
Entschuldigung! Der Regisseur war selbstverständlich François Truffaut. Wer sonst? Und die weibliche Hauptrolle spielt gar nicht Isabelle Adjani, sondern Fanny Ardant, was mich jetzt zwar ein bisschen verwirrt, aber Fanny Ardant sieht in dem Streifen natürlich auch hinreißend aus. Und Adjani und Ardant kann man durchaus schon mal verwechseln. Mir geht es hier aber eigentlich nicht um den Film als solchen und auch nicht darum, ob die Adjani besser aussieht als die Ardant beziehungsweise umgekehrt, sondern nur um eine einzige Einstellung. Isabelle, Entschuldigung, Fanny Ardant sitzt da im Zwielicht aufgestellter Jalousien (Sie wissen ja, was »jalousie« auf Französisch heißt!) in einem Hotelzimmer auf der Bettkante, hat ein Herrenhemd an, das nicht zugeknöpft ist und also zugleich verhüllt und enthüllt, die Beine im Schneidersitz übereinandergeschlagen, und blickt mit leicht geöffneten Lippen herausfordernd und dennoch distanziert in die Kamera. Und genau diese laszive Pose und dieser zwischen Verachtung und Gier changierende Blick, genau dies Bild muss sich mir als Ur- oder Idealvorstellung erotischer Verführungsmacht und sinnlichen Begehrens so tief eingegraben haben, dass ich es bis zu jenem Moment vergaß, als es unverhofft für einen flüchtigen Augenblick zu Fleisch und Blut zu werden schien.
2
Ich komme also zur Sache oder jedenfalls zu einem Teilaspekt der Sache. Ob die Episode im ICE nach München überhaupt dazugehört, vermag ich im Rückblick nicht mehr zweifelsfrei zu entscheiden, aber da ich nun den Komplex Obsessionen etc. pp. kamikazeartig losgetreten habe, komme ich im Dienst der Wahrheitsfindung um die Schilderung dieser unverhofften Begegnung nicht mehr herum. Ist sie erst einmal auf die Bürste gedrückt, kriegt man die Zahnpasta nicht wieder in die Tube. Und ob man meine Bahnbekanntschaft als Beginn des Dramas verstehen kann, als den Moment, der den Stein ins Rollen brachte und schließlich die Lawine auslöste, ist mir auch nicht ganz klar. Aber, wie sagt das chinesische Sprichwort doch so treffend: Wenn in Shanghai ein Sack Reis umfällt, schlägt in Peking ein Schmetterling mit den Flügeln. Oder so ähnlich. Jedenfalls werfen große Ereignisse stets unscheinbare Schatten voraus, die zu erkennen nicht jedem gegeben ist – doch haben wir Schriftsteller für derlei ein untrügliches Sensorium. Und außerdem: Mit irgendetwas muss man schließlich anfangen, auch wenn’s schwerfällt. Der Anfang fällt deswegen schwer, weil er den ersten Spatenstich jenes Kanals bildet, der aus dem Ozean des Möglichen und Unerzählten eine Geschichte oder einen Roman oder auch nur einen kargen Bericht wie diesen ableiten will. Und wenn dann der Autor als Kanalarbeiter an der falschen Stelle zu graben beginnt und statt auf den Ozean schließlich auf die trüben Teiche namens Alles-schon-mal-dagewesen trifft – gar nicht auszudenken.
Über den raffinierten und tiefen Doppelsinn der letzten drei Worte bitte ich Sie einen Moment zu meditieren. Gar nicht auszudenken! Ja, eben! Die besten Geschichten kann man sich gar nicht ausdenken. Sie liegen auf der Straße oder sitzen, wie in meinem Fall, im ICE oder in der Seniorenresidenz, vulgo Altersheim. Apropos Altersheim: Schon der alte Fontane wusste: Finden ist besser als erfinden. Das korrespondiert jetzt auch wieder auf verwickelte Weise mit dem oben angeschnittenen Wahrheitsproblem, aber ich möchte die Angelegenheit nicht unnötig verkomplizieren oder in die Länge ziehen, sonst könnten Sie noch auf die Idee kommen, ich bekäme für diesen Bericht schnödes Zeilenhonorar. Ich bekomme dafür vermutlich genauso viel wie für das ominöse Werk, über dessen Entstehungsgeschichte hier in rückhaltloser Offenheit berichtet wird – nämlich gar nichts. Aber die Wahrheit ist sowieso unbezahlbar.
Also dann. Sitzen Sie bequem? Ich eher nicht, weil die Höhenverstellung meines Schreibtischsessels defekt ist. Über den Zusammenhang zwischen Körperhaltungen beim Schreiben und stilistischen Eigenarten, Schreibhaltungen, wenn man so will, haben meines Wissens weder die Germanistik noch die Orthopädie (oder wer immer dafür zuständig wäre) getrennt oder interdisziplinär als orthopädische Literaturwissenschaft jemals seriös geforscht. Doktoranden, aufgepasst: weiße Flecken auf der Landkarte! Mal sehen, vielleicht komme ich auf das Problem später noch einmal zurück. Nichts darf umkommen, wie meine Großmutter zu sagen pflegte.
Im ICE nach München saß ich damals allerdings sehr bequem, hatte seit Bremen Hauptbahnhof ein Abteil für mich allein und behauptete meinen Anspruch auf flächendeckende Privatsphäre, indem ich mir die Schuhe auszog, die Füße auf den gegenüberliegenden Sitz legte, die beiden Sitze links von mir mit Reisetasche und Trenchcoat und den Sitz rechts von mir mit Zeitungen belegte. Um auch den Sitz rechts gegenüber als besetzt zu markieren, griff ich in die Reisetasche und zog den erstbesten Gegenstand heraus, nämlich meine Kulturtasche. Ich habe schon öfter ergebnislos darüber nachgedacht, warum ein Behältnis für Zahnbürste und -pasta, Seife und Shampoo, Bullrich-Salz und Aspirin, also die sogenannten Toilettenartikel (auch so ein Wort!), zur hochstaplerischen Bezeichnung Kulturtasche, gelegentlich noch dumpfer: Kulturbeutel, avancieren konnte, als seien Sodbrennen und Kopfschmerzen Zeichen von Unkultur. Über diesen Missbrauch des Kulturbegriffs könnte man einen längeren Essay verfassen, aber der würde an dieser Stelle »den Rahmen der vorliegenden Arbeit sprengen«, um mal zu dieser streng akademischen Formulierung zu greifen, mit der ich mich schon bei der Abfassung meiner Dissertation um Fragen herumlaviert hatte, deren Beantwortung unzumutbare Recherchen erfordert hätten.
Außerdem bin ich ein erklärter Feind ausufernder Exkurse und hege Misstrauen gegen jedermann, nicht nur gegen einschlägige Schriftstellerkollegen, der mit seinem Anliegen oder Thema nicht pfeilgerade zur Sache kommt, sondern ebenso bedeutungsfrei wie selbstverliebt vor sich hin schwadroniert und einem, wie’s im Teenagerslang nicht unzutreffend heißt, das Ohr abtextet. Es sind ja genau diese Leute, die sich in leeren Restaurants stets noch an den einzigen, von uns besetzten Tisch quetschen oder eben in halb leeren Zügen wie diesem ICE so lange durch die Waggons streifen, bis sie in uns das würdige Opfer ihrer Redseligkeit erspäht haben und uns mit einem munterbeiläufigen »Ist hier noch frei?« unentrinnbar auf Leib und Seele rücken. Die Redseligen tarnen sich zwar anfangs durch allerlei Scheinaktivitäten, indem sie noch eine Weile demonstrativ gelangweilt im Bahn-Magazin blättern oder ihre Stullen von der Stange, neudeutsch: Sandwiches, auspacken, diese aber nicht etwa stumm verzehren, sondern unverzüglich darauf hinweisen, wie köstlich der Schinken-Mozzarella-Rucola-Belag sei, den es in dieser sensationellen Qualität nur beim Leinebäcker am Hannoveraner Hauptbahnhof gebe, einfach sensationell, dann aber mit einem »Ich fahre übrigens bis Frankfurt« schnell zupackender werden und die von uns erwartete, aber vorerst verweigerte Replik mit einem »Und Sie?« erpressen. Und dann sagen wir »München« und sitzen in der Falle, und nach mehr oder minder ausufernden Monologen der Redseligen kommt unausweichlich die Frage: »Und was machen Sie so beruflich?« Sagen Sie dann nie, unter keinen Umständen, dass Sie Schriftsteller sind, weil die nächste Frage des Grauens entweder »Ach! Und was schreiben Sie denn Schönes?«, lauten wird oder aber: »Müsste ich Sie dann nicht kennen?« Der Kollege Helmut Krausser hat in einem seiner Tagebücher darauf hingewiesen, dass diese Fragen besonders zuverlässig auch an nächtlichen Hotelbars auf den Tresen gezerrt werden, und er habe es sich zur Gewohnheit gemacht, seinen Beruf in solchen Fällen als Pornoproduzent anzugeben, was die Redseligen unverzüglich zum Verstummen bringe, sei es vor Entrüstung, sei es vor Peinlichkeit, das eigene Interesse an Pornografie einzugestehen. Pornoproduzent ist natürlich schwer zu toppen, aber ich habe durchaus positive Erfahrungen mit der Professionsangabe Esperanto-Übersetzer gemacht, die meistens lediglich ein ahnungsvoll gemeintes, also komplett ahnungsloses Kopfnicken der Redseligen hervorruft. Auf des Esperantos mächtige Mitreisende bin ich noch nie getroffen, und es hat sich auch noch kein Redseliger zu behaupten getraut, schon mal eine Urlaubsreise nach Esperanto gemacht zu haben. Eigentlich schade.
Meine mittels Kulturtasche et cetera ausgesandten Besetzt-Signale gelten besonders auch den Bundeswehrspacken, wenn sie mit Aldi-Bier im Marschgepäck rudel- und rottenweise ins Wochenende abrücken, statt, wie unlängst ein Bundesverteidigungsminister feierlich gelobt hat, Deutschlands Freiheit am Hindukusch oder Horn von Afrika zu verteidigen.
Atzender als unsere weltweit operierende Schutztruppe sind nur noch die Handybekloppten, die ihre Lieben daheim alle fünf Minuten über die Fortschritte ihrer An- oder Abreise informieren: »Schatz? Bist du das? – Die Verbindung ist grad schlecht! Funkloch oder was!« Hierbei gilt übrigens die Regel: Je tiefer oder breiter »das Funkloch oder was«, desto schriller und waggongreifender die Stimme des Telefonierenden. »Ja, nö, alles prima! – Wollte nur sagen, dass ich pünktlich ankomme. – In Kassel steig ich dann um, gell! – Nö, ja, ach so, nö, alles wie besprochen. – Kassel kommt gleich. Schatz? – Schatz?! – Scheißfunkloch!«
Im Zug zu schreiben, habe ich mir längst abgewöhnt, nicht nur wegen der Handyclowns, Wochenendstoßtrupps und Labersäcke, sondern wegen der notorisch Neugierigen und brachial Besserwissenden, die einem seitlich auf den Laptop schielen und mit Bemerkungen wie »Sind Sie etwa Dichter?« jeden Rest von Inspiration vernichten. Eine Mitreisende, die sich als Oberstudienrätin für Deutsch und Geschichte geoutet hatte, glotzte einmal eine Weile ungeniert auf meinen Monitor, schüttelte dabei mehrfach missbilligend den Kopf, schnalzte wie warnend mit der Zunge, tippte schließlich mit dem Zeigefinger auf den Monitor und zischte scharf: »Dass mit Es-Zett schreibt man jetzt mit Doppel-Es. Und zusammenschreiben wird nicht mehr zusammengeschrieben. Gerade Leute wie Sie sollten sich dem Fortschritt nicht verschließen.« Verschließen sprach sie dabei mit deutlich akzentuiertem Doppel-Es aus. Was sie mit »Leute wie Sie« meinte, erfuhr ich nicht, weil ich wortlos den Laptop zuklappte und mich auf ein Bier ins Bordbistro verdrückte. Es war jedenfalls mein letzter Versuch, in einem Zuge (man beachte den Doppelsinn!) literarisch produktiv zu werden.
Aber lesen! Lesen in der Bahn kann schön sein. Endlich hat man Zeit und Muße für die dicken Schinken, die man längst hätte lesen wollen, vor deren Umfang (Proust) oder schwer merkbaren Namen (Dostojewski) man aber bislang zurückschreckte; die man hätte lesen sollen, weil die Literaturkritik sie uns als »wichtig«, »bedeutsam« oder »innovativ« andiente, die man aber eigentlich nie lesen wollte; und die man hätte lesen müssen, weil sie in der Fernsehsendung Lesen! zur nationalen Pflichtlektüre ausposaunt wurden.
Diesmal hatte ich mir aus der Kategorie »wollen« Walter Kempowskis Tagebuch Alkor eingepackt, allerdings mit schwer schlechtem Gewissen, weil sich aus der Kategorie »sollen« in meinem Arbeitszimmer auch noch Kempowskis Echolot wie eine Waggonladung Braunkohlebriketts stapelte. Daran kann ich mich vielleicht mal im Alter wärmen. Und lesen müssen muss man eh nicht; dann lieber doof.
Mit den besockten Füßen auf dem gegenüberliegenden Sitz hatte ich es mir also recht kommod gemacht, zog das Buch aus der Reisetasche und klappte es auf, als auch schon die Schiebetür zum Abteil aufgerissen wurde. Der Zugbegleiter, vulgo Schaffner, »Personalwechsel!« rief, nein: schrie er, als sei ausgerechnet mein Privatabteil ein voll besetzter Großraumwaggon. »Die Fahrausweise bitte!!«
Gegen Kommandotöne bin ich allergisch (ungedient!); diese Allergie wirkt kettenreaktionär und weckte in mir auch sogleich den unbestechlichen Sprachpuristen. »Wieso Plural?«, murmelte ich.
»Hä?« Der Mann sah mich verständnislos an, als hätte ich Esperanto gesprochen.
»Einzahl«, dolmetschte ich, »der Fahrausweis«, und reichte ihm ungnädig mein Ticket.
Er besah es sich mit hochgezogenen Augenbrauen, als handelte es sich um eine perfide Fälschung – was ich, im Nachhinein betrachtet, als Omen kommender Dinge hätte verstehen müssen, als einen jener Schatten, die große Ereignisse vorauswerfen und für die unsereiner, ich sagte es bereits, ein untrügliches Sensorium hat. Aber damals ließ es mich wohl im Stich.
»Dann bräuchte ich auch noch Ihre Bahn-Card«, sagte der Schaffner schnöde und misstrauisch.
Die Korrektur, dass es nicht bräuchte, sondern brauchte zu heißen habe, verkniff ich mir. War ich denn der Deutschlehrer dieses Mannes?
Er starrte auf die Karte, stutzte, sah mir verblüfft ins Gesicht, blickte wieder auf die Karte, zuckte mit den Achseln, stempelte das Ticket ab und reichte es mir mit der Bahn-Card zurück, wobei sich auf seinem Gesicht ein impertinentes Grinsen breitmachte. »Na dann, gute Reise«, sagte er, warf einen missbilligenden Blick auf meine hochgelegten Füße und rammte amtlich die Schiebetür hinter sich zu.
Was gab’s denn da zu grinsen? Ach so, das Foto. Beim Ausfüllen des Bahn-Card-Antrags hatte ich kein akzeptables aktuelles Passbild zur Hand gehabt. In meinem Alter sind aktuelle Passbilder nie akzeptabel. In diesen maschinellen Fotokabuffs kann man sich drehen und wenden, seriös blicken oder heitere Miene machen wie man will – das Ergebnis sieht immer aus, als hätte man im Irish Pub sieben Nächte durchgesoffen, und entspricht verdächtig der Kategorie Verbrecheralbum. Und ich habe auch keine Lust mehr, mir bei professionellen Fotografen, oder schlimmer: jungen professionellen Fotografinnen, Sprüche wie »Mal sehen, was sich da noch machen lässt« anzuhören. Solche Sätze kenne ich hinlänglich vom chronisch sinnloser werdenden Friseurbesuch. Für die Bahn-Card nahm ich einfach einen angegilbten Abzug des Fotos, das vor zwanzig Jahren als Autorenporträt die Novelle Ferne Farne geziert hatte (mein literarisches Debüt: immer noch lieferbar in der Erstauflage, immer noch sehr lesenswert). Leute, die mich schon lange kennen, also zum Beispiel ich selbst, erkennen mich darauf auch zuverlässig wieder, aber fantasielose Banausen wie dieser Bahnschaffner sehen offenbar einen anderen. Sich after all those years selber treu zu bleiben, ist ein rein innerer Wert, dem unser Äußeres leider zu spotten scheint. Entschuldigung, ich gerate ins Philosophieren, was ja vielleicht eine Alterserscheinung ist.
Trost oder zumindest Ablenkung suchend, schlug ich wieder Kempowskis Tagebuch auf, gruselte mich leicht bei seinem notorischen Verfolgungswahn, der eine Verschwörungstheorie der angeblich den Kulturbetrieb diktierenden »Linken« gegen sein Werk unterstellt, obwohl »links« heutzutage nur noch da ist, wo der Daumen rechts ist, bewunderte aber seine Meisterschaft im Klagen ohne zu leiden und seinen Anspruch, nationale Pflichtlektüre zu werden. Mit der Welt versöhnt sei er erst, wenn jeder, aber auch wirklich jeder des Lesens mächtige Deutsche seine Werke lese. Meine Erfolgshoffnungen sind bescheidener. Ganz Deutschland müsste es gar nicht sein; die Einwohnerzahl meiner Heimatstadt würde reichen – allerdings müsste ich dann darauf bestehen, dass meine Bücher nicht nur gelesen, sondern auch gekauft werden. Büchereiausleihen zählen nicht und schon gar nicht privat weiterverliehene Exemplare, die man dann, wenn überhaupt, berieben, verschmuddelt und bestoßen zurückbekommt. Bei einem der Einfachheit halber angenommenen Ladenverkaufspreis von 20 Euro ergäbe sich ein Honorarertrag von zirka – hoppla, jetzt hätte ich mich mit diesen schnöden Mammondetails fast verplaudert, denn wenn die komplette Stadt kauft und liest, lesen natürlich auch die Sachbearbeiter vom Finanzamt mit. Sagen wir mal so: Es würde reichen. Jedenfalls finanziell.
Doch lebt der Mensch, wie die Bibel weiß, nicht vom Brot allein, und der Dichter, wie der Dichter weiß, nicht allein von seinen Tantiemen. Mein wiederkehrender Traum vom literarischen Ruhm und erfüllten Dichterglück, den ich trotz erklärter Selbstdiskretion hier preisgebe, weil er den Punkt berührt, auf den unumwunden zu kommen ich versprochen habe, sieht so aus: Ich sitze allein in einem Bahnabteil, als plötzlich die schönste Frau der Welt hereinkommt. Also zum Beispiel die junge Isabelle Adjani oder meinetwegen auch Fanny Ardant. Sie würdigt mich kaum eines Blicks, fragt nicht einmal, ob der Platz mir schräg gegenüber noch frei sei, sondern lässt sich dort in selbstbewusster Unnahbarkeit nieder, zieht umstandslos ein Buch aus der Tasche und beginnt zu lesen. Und jetzt kommt’s! Es ist natürlich nicht irgendein Buch, sondern einer meiner Romane, sagen wir mal Novemberblues. Mit angehaltenem Atem beobachte ich, dass schon nach wenigen Augenblicken ein verklärtes Lächeln wie ein Sonnenaufgang über ihr Gesicht zieht, dass mit jeder Seite ihre Wangen eine bezauberndere Röte annehmen und schließlich glühen, dass sie hin und wieder leise, zustimmende Glücksseufzer ausstößt. Und so weiter. Dass sie also mein Buch liebt. Liebt!
Und dann sage ich plötzlich so feinfühlig, beiläufig und sonor wie möglich ins köstliche Schweigen: »Gefällt Ihnen das Buch?«
Sie blickt mich indigniert über den Seitenrand an, aufgestört aus der Bekanntschaft mit dem Schriftsteller, den sie so sehr liebt, überlegt einen Moment, ob sie sich auf das einlassen soll, was sie für die öde Fangfrage eines Redseligen halten muss, kann aber die Liebe zu diesem Schriftsteller auch nicht einfach verleugnen, sagt also: »Es ist das schönste Buch, das ich je gelesen habe«, und liest weiter.
Da das Vergnügen in der Verzögerung hegt, setze ich noch eine Fermate von einer halben Seite und lasse dann ganz unprätentiös die Bombe platzen: »Und ich habe es geschrieben.«
Sie lässt das Buch auf die Knie sinken, mustert mich mitleidig und leicht misstrauisch wie einen harmlosen Irren, der sich für Shakespeare hält, stutzt dann jedoch und schlägt das Buch auf der hinteren Innenklappe auf. Das Autorenfoto ist zwar keine zwanzig Jahre alt, aber doch noch sehr viel jugendfrischer als meine Leibhaftigkeit, und trotzdem huscht über ihr himmlisches Antlitz jetzt das staunende Lächeln des Wiedererkennens: »Sie sind es«, stammelt sie, »Sie sind es tatsächlich. Lukas –« Und ihre Stimme versagt in süßem Erschrecken.
»Domcik«, sage ich cool, »ganz recht. Ich bin Lukas Domcik.«
Wie’s weitergeht, darf ich Ihren eigenen Fantasien überlassen. In seinem Reigen hätte jedenfalls Arthur Schnitzler nach derlei Vorgeplänkel schon bald folgende schöne Gedankenstrichzeile geschrieben:
Okay, ich weiß natürlich: Nicht wegen seiner Person, sondern wegen seines Werks geliebt und begehrt zu werden, gehört gleichfalls zu den Alterserscheinungen von Schriftstellern, denen die Bücher gewissermaßen zu tertiären Geschlechtsmerkmalen geworden sind. Dies in der gebotenen Kürze vorausgeschickt, können Sie aber vielleicht nachvollziehen, was in mir vor- und abging, als sich in Kassel-Wilhelmshöhe die Abteiltür öffnete und mein indignierter Blick, der »alles restlos besetzt« signalisieren sollte, die unfassbar blauen Augen der in diesem Moment schönsten Frau der Welt traf. Die Frage, ob bei mir vielleicht noch ein Platz frei sei, war noch gar nicht ganz zu Ende gesprochen, als ich bereits mein komplettes Platzhalter-Geraffel beiseitegeräumt hatte.
»Aber ich bitte Sie«, schleimte ich einladend.
»Sehr liebenswürdig«, frostete sie, ließ sich auf dem Sitz nieder, der eben noch für meine Kulturtasche reserviert gewesen war, und stellte einen kleinen Koffer neben sich ab. Über einem türkisfarbenen T-Shirt, unter dem sich zart solche Rundungen abzeichneten, die einen wie Doderer nie interessiert hätten, trug sie ein weißes, offen stehendes Herrenhemd, dazu auf schmalen Hüften sehr formvorteilhafte Jeans. Während ich noch fieber-, wenn nicht schon wahnhaft überlegte, wie ich sie ins Gespräch locken könnte, ohne mich als senil-lüsternen Redseligen zu outen, streifte sie mit lässiger Gebärde ihre flachen Pumps von den Füßen und schob die untergeschlagenen Beine unter die Oberschenkel. So saß sie im Schneidersitz vor mir wie – Sie ahnen es längst – Fanny Ardant in Die Frau nebenan, jenes Urbild meiner erotischen Fantasien also. Der Anblick brachte mich offenbar um den Verstand, denn als sie nun ihr Köfferchen öffnete und ein Buch herauszog, war ich mir absolut sicher, dass es sich nur um eins meiner unsterblichen Werke handeln konnte. Doch als sie es aufschlug und vor ihre blauen Augen führte, so dass ich den Titel erkannte, kam ich mir vor wie ein Ballon, dem die Heißluft entweicht. Vermutlich habe ich sogar ein entsprechendes Zischen oder Stöhnen von mir gegeben, denn sie warf mir einen angeekelten Blick zu, schüttelte fast unmerklich den Kopf und »vertiefte sich« dann in ein Buch von Guido Knopp mit dem Titel Die Frauen des Führers oder so ähnlich.
Auf Knopp und Konsorten muss ich im Folgenden leider noch sehr viel ausführlicher zu sprechen kommen. An dieser Stelle mag genügen, dass ich mein Gepäck nahm, grußlos das Abteil verließ und nach einigem Suchen noch einen Platz in einem anderen Abteil fand, zwischen zwei Redseligen, zwei alkoholisierten Wehrpflichtigen und einem, wie sich auf Insistieren eines Redseligen herausstellte, Pornoproduzenten.
3
Von der eher schlecht besuchten Lesung aus München zurückkehrend, fand ich entsprechend übellaunig zwei Nachrichten auf dem Küchentisch vor. Die erste war von meiner Frau Anne, die übrigens vor gut zwanzig Jahren auch schon mal die schönste Frau der Welt gewesen war. Die Notiz besagte, dass sie wegen ihrer Damendoppelkopfrunde erst spät nach Haus kommen würde. Die zweite war ein Einschreiben vom Amtsgericht Berchtesgaden, das meine Stimmung beträchtlich hob. Es wurde mir nämlich eröffnet, dass ich gemäß allerlei einschlägiger Paragrafen als Alleinerbe des Nachlasses der am 12. April 2005 in der Seniorenresidenz Maria Hilf in Berchtesgaden verstorbenen Frau Emma Theodora Elfriede Westerbrink-Klingenbeil, geboren am 30. März 1910 in Rüstringen, anzusehen sei und mich innerhalb einer Frist von vier Wochen zu äußern hätte, ob ich das Erbe antreten wolle.
Emma Theodora Elfriede Westerbrink-Klingenbeil? In irgendeinem dusteren Winkel meines Oberstübchens wirbelte der Name Staub auf, wollte mir aber nichts Genaues sagen. Nachdem ich mich rat- und weitgehend verständnislos durch das juristische Kauderwelsch des Schreibens buchstabiert hatte, verstand ich ein Wort jedoch sehr deutlich. Und siehe, das Wort nahm, je länger ich es ansah, eine immer verlockendere Strahlkraft an: Alleinerbe. Wer immer diese Frau gewesen sein mochte, aus welchem Grund auch immer sie mich zu ihrem Erben eingesetzt hatte – ich war es, und zwar ich allein! Seniorenresidenz in Berchtesgaden klang irgendwie edel und teuer, jedenfalls teurer als Diakonisches Altersheim in meinetwegen Magdeburg. Frau Westerbrink-Klingenbeil musste wohlhabend gewesen sein, mindestens, vermutlich reich, vielleicht sogar unermesslich reich. Anders als »nackt« und »wahr«, ließ »reich« sich also beliebig superlativieren. Schon der aparte Name roch geradezu nach einem riesigen Vermögen. Emma Theodora Elfriede. So hieß doch keine Arme! Und ein Doppelname wie Westerbrink-Klingenbeil klang verdächtig nach bekennendem FDP-Mitglied – also besserverdienend.
Blieb die Frage, warum die betuchte Unbekannte ausgerechnet mich in den warmen Regen ihres Nachlasses stellte. Bei genauerem Nachdenken gab es darauf nur eine Antwort: Es musste sich um eine Verehrerin handeln, eine Mäzenatin, eine begeisterte Leserin, die auf diese Weise dem Autor, dem sie so viele glückliche Stunden Lesezeit in der Behaglichkeit ihrer Seniorenresidenz zu verdanken hatte, posthum ihre Referenz aussprach. So etwas kam ja vor, und zwar nicht nur posthum. Hatte der Multimillionär Reemtsma nicht seinerzeit Arno Schmidt eine stattliche Rente zukommen lassen, auf dass der chronisch klamme, mir darin verwandte Kollege fürderhin seine Zettelkästen füllen konnte, ohne dabei stets ans leere Konto zu denken? Warum sollte nicht, was dem einen armen Poeten sein Reemtsma war, dem anderen seine Emma Theodora Elfriede werden?
Um Licht in den Paragrafendschungel des Schreibens zu bringen, rief ich bei meinem Anwalt an, der jedoch laut Kanzleitelefonistin »zu Gericht« und erst morgen Vormittag wieder erreichbar war. Meine Erbschaft wollte gleichwohl gefeiert werden, und so kreuzte ich schon am frühen Abend im Bühnen-Bistro am Theater auf. Bei der zwangsverordneten Umstellung von D-Mark auf Euro hatte Egon, der Wirt, wie fast jeder Gastronom der Einfachheit halber einen Umtauschkurs von 1:1 walten lassen, was zur schlagartigen Verdoppelung sämtlicher Preise geführt hatte. Ein Gläschen mäßigen Weins kostete nun so viel wie eine Flasche besseren Weins in der Weinhandlung. Egons Stammkundschaft hatte Boykott geschworen, war aber einer nach dem anderen meineidig geworden, da die Preise anderswo auch auf Euronorm gebracht worden waren, und hatte sich sukzessive und komplett wieder im Bühnen-Bistro eingefunden. Um das Gesicht des unbeugsamen Boykotteurs nicht ganz zu verlieren, hatte ich allerdings meine Trinkgewohnheiten insofern umgestellt, als ich bei Egon den Wein verweigerte und nur noch Bier orderte. Dieser Umstand erklärt die Ungläubigkeit, ja Fassungslosigkeit, in die ich Egon stürzte, als ich an diesem Abend seine rhetorische Frage, ob’s ein Halber vom Fass sein solle, nicht routiniert abnickte, sondern mit dem Wort »Champagner« konterte.
»Hä?«, sagte er.
»Und zwar ’ne Flasche«, sagte ich und setzte mich auf einen Barhocker.
»Hausmarke oder was?« Stoiker Egon hatte sich schon wieder in der Gewalt beziehungsweise wahrte, da es jetzt ja um Champagner ging, die Contenance.
»Den teuersten.«
Egon zog die Augenbrauen hoch, zuckte die Achseln, durchsuchte die Kühlschränke hinterm Tresen und hielt mir schließlich eine Flasche 1996er Dom Pérignon vor die Nase. »240 Euro«, sagte er. »Teureren hab ich leider nicht.«
»Macht nichts«, sagte ich gnädig.
Während er Eiswürfel in einen Flaschenkühler lud, konnte ich ihm ansehen, wie es in ihm arbeitete, und wettete mit mir selbst, dass die unvermeidliche Frage in der Lottofloskel serviert werden würde.
Auf Egon war Verlass. »Hast du etwa im Lotto gewonnen oder wie?« Er entkorkte die Flasche, goss eine Schale voll und setzte sie mir vor.
Ich schüttelte schweigend den Kopf und schlürfte genüsslich ein Schlückchen. Nicht übel.
»Oder endlich den Weltbestseller geschrieben, den du immer schon mal schreiben wolltest?«, hakte Egon nach, was ich unfair fand. Die Sache war nämlich die, dass ich die Manuskriptablieferung meines vorvorletzten Romans Fünf Fenster so feucht und lange im Bühnen-Bistro gefeiert hatte, bis ich in einer vom Alk freigeschwemmten Größenwahnattacke gelallt haben soll, das werde nun garantiert »voll der geile Wellbessler«. Ich konnte mich an diese hoffnungsfrohe Prognose zwar nicht mehr erinnern, aber da es mehrere Ohrenzeugen gab, wurde sie mir gelegentlich mitfühlend bis hämisch nachgetragen, insbesondere nachdem eine Kritik dem Roman attestiert hatte, Heimatliteratur zu sein. Egons Spitze lockte mich jedoch nicht aus der Reserve. Den Grund für meine Champagnerlaune behielt ich eisern für mich, sonst hätte ich in kürzester Frist sämtliche Schnorrer der Stadt, wenn nicht gar des Landes am Hals gehabt. Geteilte Freude mag ja doppelte Freude sein, aber geteilter Reichtum macht arm.
Ich hatte lange genug in Hamburg gelebt, um mich an die hanseatische Lebensweisheit zu erinnern: Geld hat man, aber man spricht nicht drüber. So zählte ich nur stillvergnügt die in der Schale aufsteigenden Champagnerperlen. Jede signalisierte einen Tausender. Vielleicht sogar Zehntausender. Nach der dritten Schale und hundertzwölften oder hundertdreizehnten Perle verzählte ich mich, gab es auf und überlegte, was ich mit dem ganzen Schotter eigentlich anfangen wollte. Endlich würde ich das Leben eines Großschriftstellers führen, das mir gemäße Leben also. Die Erstwohnsitzvilla am Comer See. Oder am Lago Maggiore. Nebenbei ein paar kleinere Niederlassungen. Wohnungen mit Dachterrasse am römischen Campo dei Fiori und im Pariser Le Marais, Apartment im New Yorker Greenwich Village. Meine studierenden Kinder Marie (viertes Semester Jura in Göttingen) und Till (erstes Semester Wirtschaftswissenschaft in Freiburg) hätten nun Wahlfreiheit zwischen Harvard, Yale, Princeton, Oxford. Die Studiengebühren nur noch Peanuts. Das BAföG-Almosen konnte uns gestohlen bleiben. Die Künstlersozialkasse konnte mir den Buckel runterrutschen. Was ich da monatlich an die Vermögensvernichtungsmaschine namens Rentenkasse abdrücken musste, war sowieso nichts als staatlich legalisierter Raub. Ab jetzt jedoch: Existenzangst ade! Weil Geld endlich mal eine wirkliche Rolle spielte, würde Geld in meinem Leben ab sofort keine Rolle mehr spielen.
Und dann das gewaltige, zweitausendseitige Werk schreiben, das ich immer schon schreiben wollte, das aus Geldmangel aber noch nie übers Stadium einer Größenwahnfantasie hinausgekommen war. Die literarische Welt würde in Ehrfurcht erstarren. Oder, noch besser, gar nicht mehr schreiben. Nichts mehr. Nie wieder. Die Erlösung! Ich meine, wer schreibt schon gern? Sich Romane auszudenken ist das zweitschönste Vergnügen. Inspiration. Sie zu schreiben artet leider in saure Arbeit aus. Transpiration. Mir fiel die Anekdote von André Gide ein, in der ein Nachwuchsschriftsteller den verehrten Meister darum bittet, sein Manuskript zu lesen und zu beurteilen. Sollte Gides Urteil negativ ausfallen, verspricht der Debütant in spe feierlich, nie wieder etwas zu schreiben. »Was?«, ruft da Gide aus. »Sie könnten zu schreiben aufhören und tun es nicht?« Zwar war die Planstelle des Schweigers im Literaturbetrieb durch Wolfgang Koeppen besetzt, aber der war ja nun auch schon eine Weile tot. Über die Gründe meines Schweigens würden die Feuilletons rätseln und erneut das Ende der Fiktionen verkünden. Abhandlungen und Dissertationen über den tieferen Sinn des Ungesagten würden verfasst. Das Nicht-Geschriebene würde mein Opus Magnum, mein Autoren-Ich würde immer geheimnisumwitterter werden und schließlich zur Inkarnation der Leerstelle an und für sich avancieren.
Die Champagnerschale war leer. Auf meinen Wink dienerte Egon herbei und füllte nach. Auch er schien bereits über mein Schweigen nachzudenken und streifte mich mit einem fast ehrfürchtigen Blick.
Andererseits bestand natürlich die Gefahr, dass in der Literaturkritik meine Verfolger vom Dienst, die gemäß Ernst Jünger ab einem gewissen Niveau jeder hat, mein Schweigen bejubeln würden. Oder, noch schlimmer, kein Schwein würde bemerken, dass ich nicht mehr schriebe. Keine Sau würde ein neues Buch von mir erwarten. Niemandem würde etwas fehlen, gäbe es keine Bücher mehr von mir. Nicht gut. Sogar ziemlich übel. Also vermutlich doch weiterschreiben. Aber ohne materielle Sorgen, ohne Rücksicht auf den Verlag, ohne Vorschussgeschacher, ohne Furcht vor den Halbjahresabrechnungen, ohne –