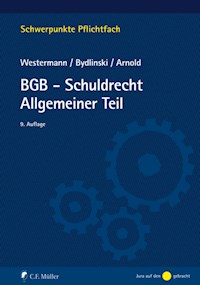
26,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C.F. Müller
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Schwerpunkte Pflichtfach
- Sprache: Deutsch
Das bewährte Lehrbuch zum Allgemeinen Schuldrecht, das für die 9. Auflage völlig neu bearbeitet wurde, gibt vorlesungsbegleitend einen aktuellen, systematischen und verlässlichen Überblick über diesen zentralen Prüfungsstoff des Zivilrechts. Es ermöglicht darüber hinaus eine gezielte Wiederholung und Vertiefung einzelner Abschnitte im Hinblick auf die Erste Juristische Prüfung. Anhand von nach didaktischen Gesichtspunkten ausgewählten Fällen werden die Grundlinien der schuldrechtlichen Materien entwickelt, die wichtigsten sich hieraus ergebenden Einzelfragen geklärt und ein vollständiger Überblick über den Stand der Diskussion zum Allgemeinen Schuldrecht vermittelt. Dem Studienanfänger wird hierdurch das Eindringen in dieses zentrale Rechtsgebiet erleichtert, dem Examenskandidaten ein zusammenhängender Überblick zu den Kernfragen gegeben. Zur Neuauflage: Die §§ 1 bis 14 des Lehrbuchs hat Prof. Dr. Stefan Arnold völlig neu geschrieben und konzipiert, die §§ 15 bis 23 verantwortet in bewährter Weise Prof. Dr. Peter Bydlinski. Bei der gesamten Überarbeitung wurden aktuelle Entwicklungen in Gesetzgebung und Rechtsprechung wiederum sorgfältig berücksichtigt. Im Mittelpunkt der Darstellung stehen: -Grundprinzipien, Arten und Inhalte der Schuldverhältnisse -das Recht der Leistungsstörungen - das Verbraucherrecht -das Schadensersatzrecht -die Einbeziehung Dritter in das Schuldverhältnis -das Erlöschen von Schuldverhältnissen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
BGB – SchuldrechtAllgemeiner Teil
begründet von
Dr. Harm Peter Westermannem. o. Professor an der Eberhard Karls Universität Tübingen(Alleinautor bis zur 3. und Mitautor bis zur 5. Auflage)
bearbeitet von
Dr. Peter Bydlinskio. Universitätsprofessor an der Karl-Franzens-Universität Graz(Mitautor seit der 4. Auflage)
und
Dr. Stefan Arnold, LL.M. (Cambridge)o. Professor an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster(Mitautor seit der 9. Auflage)
9., völlig neu bearbeitete Auflage
www.cfmueller.de
Impressum
Bibliografische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.
ISBN 978-3-8114-5356-2
E-Mail: [email protected]
Telefon: +49 89 2183 7923Telefax: +49 89 2183 7620
www.cfmueller.de
www.cfmueller-campus.de
© 2020 C.F. Müller GmbH, Waldhofer Straße 100, 69123 Heidelberg
Hinweis des Verlages zum Urheberrecht und Digitalen Rechtemanagement (DRM)Der Verlag räumt Ihnen mit dem Kauf des ebooks das Recht ein, die Inhalte im Rahmen des geltenden Urheberrechts zu nutzen. Dieses Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.Der Verlag schützt seine ebooks vor Missbrauch des Urheberrechts durch ein digitales Rechtemanagement. Bei Kauf im Webshop des Verlages werden die ebooks mit einem nicht sichtbaren digitalen Wasserzeichen individuell pro Nutzer signiert.Bei Kauf in anderen ebook-Webshops erfolgt die Signatur durch die Shopbetreiber. Angaben zu diesem DRM finden Sie auf den Seiten der jeweiligen Anbieter.
Vorwort
Dieses Schwerpunkte-Lehrbuch ist im Rahmen der 9. Auflage völlig neu bearbeitet und in zentralen Bereichen des Allgemeinen Schuldrechts neu geschrieben und konzipiert worden. Als Ko-Autor hinzugetreten ist Stefan Arnold, der die §§ 1 bis 14 verantwortet; die §§ 15 bis 23 liegen weiterhin in den Händen von Peter Bydlinski.
Die Überarbeitung berücksichtigt insgesamt wiederum sorgfältig die aktuellen Entwicklungen in Gesetzgebung und Rechtsprechung. Das betrifft vor allem das Verbraucherrecht, das zum 13. Juni 2014 in Umsetzung der Verbraucherrechte-RL sowie zum 1. Januar 2018 durch das Gesetz zur Reform des Bauvertragsrechts und zur Änderung der kaufrechtlichen Mängelhaftung an europäische Vorgaben angepasst wurde. In die Darstellung aufgenommen wurde auch § 271a BGB, der infolge der Zahlungsverzugs-RL zum 29. Juli 2014 Eingang in das BGB gefunden hat und mit Wirkung zum 18. April 2016 durch das Vergaberechtsmodernisierungsgesetz inhaltlich erneut angepasst wurde. Die Modifikationen der §§ 312, 312g BGB im Kontext von Pauschalreisen (durch das zum 1. Juli 2018 in Kraft getretene 3. Reiserechtsänderungsgesetz) sind ebenfalls einbezogen. Viele zentrale aktuelle Entscheidungen – etwa die Rechtsprechung zum Widerrufsrecht beim Kauf von Matratzen – wurden berücksichtigt, teilweise in vereinfachten Fallbeispielen, von denen das Lehrbuch nunmehr 78 (gegenüber bisher nur 44) enthält.
Hinsichtlich der Gesetzgebung befindet sich das Buch auf dem Stand vom 1. Januar 2020. Damit sollte es allen, die dieses Werk zur Hand nehmen, möglich sein, sich aktuell, systematisch und verlässlich in den nach wie vor ganz zentralen Prüfungsstoff des Allgemeinen Schuldrechts einzuarbeiten — sei es erstmals, sei es im fortgeschrittenen Stadium zu Wiederholungs- und Vertiefungszwecken.
Für vielfältige Hilfe, vor allem für Materialsammlung, Aktualisierung der Register und kritisch-begleitende Inhaltskontrolle, danken wir insbesondere Herrn Nils Buchholz, Herrn Thorben Eick, Frau Susann Frühauf, Frau Sarah Graubner, Herrn Cedric Hornung, Herrn Klaus Kies, Frau Lena Klos, Herrn Jan Menke, Frau Michelle Otto, Frau Rabea Regh, Herrn Marcus Schnetter, Frau Hanna Schuran und Herrn Norman Weitemeier (alle Münster) sowie Herrn Mag. Martin Trummer (Graz).
Wir hoffen sehr, dass das neu gestaltete Werk gut aufgenommen wird und allen Benutzerinnen und Benutzern wertvolle Dienste leistet. Kritik und Anregungen – am besten per E-Mail (zu den §§ 1 bis 14 an [email protected], zu den §§ 15 bis 23 an [email protected]) – werden wir gerne aufgreifen.
Graz und Münster, im Februar 2020 Peter Bydlinski, Stefan Arnold
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Abkürzungsverzeichnis
Literaturverzeichnis
Teil IGrundlagen
§ 1Ziele und Prinzipien des Schuldrechts
I.Gerechtigkeit als Idee des Schuldrechts
1.Austauschgerechtigkeit (bzw ausgleichende Gerechtigkeit) und Verteilungsgerechtigkeit
2.Verteilungsgerechtigkeit im Schuldrecht
II.Rechtssicherheit und Rechtsfrieden
III.Vertragsfreiheit
1.Grundgedanken
2.Formale und materielle Aspekte der Vertragsfreiheit
3.Der gesetzliche Rahmen der Vertragsfreiheit im BGB
4.Praktische Bedeutung der Vertragsfreiheit
IV.Der Grundsatz der Gleichbehandlung
1.Gleichbehandlung als Rechtsprinzip des allgemeinen Schuldrechts
2.Diskriminierungsschutz durch das AGG
3.Gleichbehandlung außerhalb gesetzlich und richterrechtlich anerkannter Tatbestände?
V.Vertrauensschutz
VI.Treu und Glauben (§ 242)
1.Treu und Glauben als allgemeines Rechtsprinzip
2.Funktionen
3.Missbrauchspotential in Generalklauseln
4.Die Bedeutung von „Treu und Glauben“ und „Verkehrssitte“
5.Verhältnis zu anderen Generalklauseln
6.Rechtliche Sonderverbindung als Anwendungsvoraussetzung
7.Fallgruppen
a)Konkretisierung und Ergänzung rechtlicher Befugnisse
b)Begrenzung rechtlicher Befugnisse (insbesondere: Rechtsmissbrauch und Verwirkung)
c)Korrektur rechtlicher Befugnisse
VII.Trennungs- und Abstraktionsprinzip
VIII.Relativität der Schuldverhältnisse
1.Grundprinzip
2.Ausnahmen
§ 2Überblick und Systematik des Schuldrechts
I.Das Schuldverhältnis als rechtliche Sonderverbindung
II.Allgemeiner und Besonderer Teil des Schuldrechts
III.Schuldverhältnisse: Begriff, Einteilung und Abgrenzung
1.Schuldverhältnis im engeren und im weiteren Sinn
2.Rechtsgeschäftliche und gesetzliche Schuldverhältnisse
a)Überblick
b)Rechtsgeschäftliche Schuldverhältnisse
c)Gesetzliche Schuldverhältnisse
3.Schuldverhältnisse außerhalb des zweiten Buchs des BGB
4.Gefälligkeiten
a)Grundlagen
b)Die maßgeblichen Auslegungskriterien
c)Abgrenzung und Folgefragen anhand der Beispielsfälle
d)Schuldverhältnisse ohne Leistungspflicht iSd § 241 Abs. 1
5.Zielschuldverhältnis und Dauerschuldverhältnis
§ 3Schuldrechtliche Pflichten – Einteilung und Abgrenzungen
I.Leistungspflichten (§ 241 Abs. 1)
1.Funktionen und Bedeutung
2.Nebenleistungspflichten
3.Primärleistungspflichten und Sekundärleistungspflichten
4.Tun und Unterlassen (§ 241 Abs. 1 S. 2)
II.Schutzpflichten (§ 241 Abs. 2)
1.Begriff und Funktion
2.Inhalt und Reichweite
3.Schutzpflichten, Leistungspflichten und Nebenleistungspflichten
4.Deliktische und vertragliche Schutzpflichten
III.„Schulden“ und „Haften“
1.Begrifflichkeiten
2.Unbeschränkte Vermögenshaftung des Schuldners als Regelfall
3.Beschränkte Vermögenshaftung des Schuldners in Ausnahmefällen
4.Eigenmächtige Durchsetzung der Haftung in Ausnahmefällen
IV.Naturalobligationen
V.Obliegenheiten
VI.Lösung Fall 7
§ 4Die Entstehung von Schuldverhältnissen
I.Überblick
1.Gesetzliche Schuldverhältnisse
2.Rechtsgeschäftliche Schuldverhältnisse
a)Allgemeine Rechtsgeschäftslehre
b)Die Draufgabe (§§ 336-338)
II.Kontrahierungszwänge
1.Allgemeine Charakteristiken
2.Beispiele
a)Spezialgesetzliche Kontrahierungszwänge
b)Kontrahierungszwänge nach allgemeinen Regeln (§ 826 BGB, § 21 Abs. 1 AGG)
III.Unbestellte Leistungen (§ 241a)
1.Zweck und Systematik
2.Voraussetzungen
3.Rechtsfolgen
a)§ 241a Abs. 1: Ausschluss vertraglicher Ansprüche
b)§ 241a Abs. 2: Gesetzliche Ansprüche
4.Lösung Fall 13
IV.Formvorschriften
1.Grundsatz der Formfreiheit
2.Formarten, Regelungsorte und Beispiele, Zwecke gesetzlicher Formvorschriften
3.§ 311b Abs. 1 (Grundstücksverträge)
a)Praktische Bedeutung
b)Zwecke des § 311b Abs. 1
c)Voraussetzungen des § 311b Abs. 1
d)Rechtsfolgen von Verstößen gegen § 311b Abs. 1
e)Fall 14 Lösung
4.Verträge über das Vermögen (§ 311b Abs. 2 und Abs. 3)
a)Verträge über das gegenwärtige Vermögen (§ 311b Abs. 3)
b)Verträge über das künftige Vermögen (§ 311b Abs. 2)
5.Verträge über den Nachlass (§ 311b Abs. 4 und Abs. 5)
6.Lösung Fall 15
Teil IIDer Inhalt von Schuldverhältnissen
§ 5Schuldarten
I.Stückschuld, Gattungsschuld, Vorratsschuld
1.Stückschuld
2.Gattungsschuld (§ 243), einschließlich der Vorratsschuld
a)Begriff der Gattungsschuld (§ 243 Abs. 1)
b)Wichtigste Rechtsfolgen
c)Konkretisierung (§ 243 Abs. 2)
d)Lösung Fall 16
II.Geldschuld und Zinsen (§§ 244-248)
1.Grundlagen
a)Überblick über gesetzliche Regelungen zu Geld und Geldschuld
b)Funktionen des Geldes; Bargeld, Buchgeld, gesetzliche Zahlungsmittel
c)Geldschulden als Wertverschaffungsschulden
d)Der maßgebliche Bestimmungszeitpunkt bei Geldschulden
2.Geldschulden, § 275 und der Topos „Geld hat man zu haben“
3.Das Inflationsrisiko im Kontext der Geldschuld
4.Geldschulden als qualifizierte Schickschulden (§§ 270 Abs. 1 und 4, 269)
5.Fremdwährungsschuld (§ 244)
6.Geldsortenschuld (§ 245)
7.Ansprüche auf Zinszahlung (§§ 246-248)
a)Begründung durch Rechtsgeschäft oder Gesetz
b)Zinsbegriff
c)Akzessorietät
d)Zinssatz – Grundregel, Sonderregeln und Basiszinssatz
8.Verbot des Zinseszinses (§§ 248, 289 S. 1)
9.Lösung Fall 18
10.Lösung Abwandlung zu Fall 18: Ausgangsfrage
11.Lösung Abwandlung zu Fall 18: Zusatzfrage
III.Wahlschuld (§§ 262-265) und Ersetzungsbefugnis
1.Wahlschuld (§§ 262-265)
a)Voraussetzungen
b)Wahlrecht
c)Unmöglichkeit der Wahlschuld (§ 265)
2.Ersetzungsbefugnis
a)Zweck und dogmatische Konstruktion
b)Entstehung
c)Elektive Konkurrenz
d)Bindungswirkung der Ausübung der Ersetzungsbefugnis
e)Unmöglichkeit
3.Lösung Fall 19
IV.Leistungsbestimmung durch eine Partei oder einen Dritten (§§ 315 ff)
1.Funktionen und Hintergründe von Leistungsbestimmungsrechten
2.Leistungsbestimmung durch eine Partei (§§ 315 und 316)
a)Entstehung des Leistungsbestimmungsrechts
b)Ausübung des Leistungsbestimmungsrechts
3.Leistungsbestimmung durch einen Dritten (§§ 317-319)
a)Grundsätze
b)Maßstab (§ 319: offenbare Unbilligkeit)
c)Mehrere Dritte
4.Lösung Fall 20
V.Aufwendungsersatz, Wegnahmerecht, Auskunft und Rechenschaft
1.Überblick
2.§§ 256, 257 (Aufwendungsersatz und Befreiungsanspruch)
a)Normzweck
b)Voraussetzungen des § 256
c)Rechtsfolge des § 256
d)Der Befreiungsanspruch aus § 257
3.Wegnahmerecht (§ 258)
4.Auskunfts- und Rechenschaftspflichten
a)Regelungscharakter der §§ 259-261
b)Auskunftsansprüche – Zwecke und Rechtsgrundlagen
c)Rechenschaftsansprüche
5.Lösung Fall 21
§ 6Modalitäten der Leistungserbringung
I.Leistungszeit
1.Fälligkeit und Erfüllbarkeit: Begriffe und Relevanz
2.Bestimmung von Fälligkeit und Erfüllbarkeit
a)Parteivereinbarung
b)Gesetzliche Bestimmungen
c)Umstände
d)Zweifelsregeln (§ 271)
3.Besondere Bestimmungen (§ 475 Abs. 1, § 271a)
a)§ 475 Abs. 1
b)§ 271a (Wirksamkeit von Zahlungs-, Überprüfungs- und Abnahmefristen)
4.Lösung Fall 22
II.Leistungsort (§ 269)
1.Begriff des Leistungsorts
2.Leistungsort (Erfüllungsort) und Erfolgsort bei Holschuld, Bringschuld und Schickschuld
a)Holschuld, Bringschuld und Schickschuld
b)Vorrangigkeit der Parteivereinbarung
c)Einzelfallumstände (insbes. „Natur des Schuldverhältnisses“)
d)Wohnsitz des Schuldners/gewerbliche Niederlassung
3.Lösung Fall 26
III.Leistung durch Dritte
1.Grundlagen
2.Voraussetzungen des § 267
a)Keine Pflicht des Schuldners, in Person zu leisten
b)Leistung eines Dritten
3.Rechtsfolgen der Drittleistung
4.Ablösungsrecht des Dritten (§ 268)
5.Lösung Fall 27
IV.Teilleistungen (§ 266)
1.Grundlagen
2.Teilbarkeit der Leistung
3.Begriff der Teilleistung
4.Konsequenzen der Teilleistung entgegen § 266
5.Ausnahmen von der fehlenden Teilleistungsberechtigung
6.Lösung Fall 29
§ 7Die Verbindung von Leistungspflichten durch Zurückbehaltungsrechte
I.Das allgemeine Zurückbehaltungsrecht (§§ 273, 274)
1.Grundgedanke
2.Das Zurückbehaltungsrecht als Einrede
3.Voraussetzungen des Zurückbehaltungsrechts aus § 273
a)Wechselseitige Forderungen
b)Konnexität der Ansprüche („aus demselben rechtlichen Verhältnis“)
c)Durchsetzbarkeit und Fälligkeit des Gegenanspruchs
d)Kein Ausschluss des Zurückbehaltungsrechts
4.Abwendung des Zurückbehaltungsrechts durch Sicherheitsleistung (§ 273 Abs. 3)
5.Lösung Fall 30
II.Einrede des nicht erfüllten Vertrags (§§ 320, 322)
1.Grundgedanke
2.Anwendungsbereich
3.Voraussetzungen
a)Gegenseitige Ansprüche im Synallagma
b)Wirksamkeit und Fälligkeit des Anspruchs auf die Gegenleistung (beachte aber: § 215)
c)Vertragstreues Verhalten des Schuldners
d)Kein Ausschluss des Zurückbehaltungsrechts
4.Schranken (§ 320 Abs. 2, § 320 Abs. 1 S. 3)
a)§ 320 Abs. 2
b)Keine Abwendung durch Sicherheitsleistung
5.Rechtsfolgen
6.Unsicherheitseinrede bei Vorleistungspflicht (§ 321)
7.Lösung Fall 32
Teil IIILeistungsstörungsrecht
§ 8Einführung und Grundlagen
I.Begriff, Zwecke und Regelungsorte
II.Pflichtverletzung als facettenreicher Zentralbegriff
1.Pflichtverletzung, Pflichteninhalt und Schuldverhältnis
2.Pflichtverletzung bei Unmöglichkeit der Leistung (§ 275 Abs. 1)
III.Kategorien von Leistungsstörungen
1.Nichtleistung (ganz oder teilweise)
2.Leistungsverzögerung
3.Schuldnerverzug (§§ 286-288)
4.Schlechtleistung
5.Nebenpflichtverletzungen und Schutzpflichtverletzungen
6.Gläubigerverzug (Annahmeverzug)
7.Leistungserschwerung, Unzumutbarkeit, Geschäftsgrundlage
IV.Die Systematik des § 280
1.§ 280 Abs. 1 als Grundtatbestand für Schadensersatzansprüche bei Verletzungen von Pflichten aus dem Schuldverhältnis
a)Schuldverhältnis
b)Verletzung einer Pflicht aus dem Schuldverhältnis
c)Vertretenmüssen des Schuldners (§ 280 Abs. 1 S. 2)
d)Durch die Pflichtverletzung entstandener Schaden
2.Die weiteren Differenzierungen und Voraussetzungen von § 280 Abs. 2 und Abs. 3
a)Schadensersatz wegen Verzögerung der Leistung (§ 280 Abs. 2)
b)Schadensersatz statt der Leistung (§ 280 Abs. 3)
V.Die Abgrenzung der Schadenskategorien
1.Zur Bedeutung der Abgrenzung
2.Schadensersatz „statt der Leistung“ (§ 280 Abs. 3)
a)Abgrenzung nach dem jeweiligen Interesse („schadensphänomenologischer Ansatz“)
b)Abgrenzung nach dem letztmöglichen Zeitpunkt der Leistungserbringung
c)Die Abgrenzung in der Rechtsprechung
3.Schadensersatz „wegen Verzögerung der Leistung“ (§ 280 Abs. 2)
4.(Einfacher) Schadensersatz bzw Schadensersatz „neben der Leistung“ (§ 280 Abs. 1)
5.Lösung Fall 34
VI.Vertretenmüssen
1.Grundlagen
a)Vertretenmüssen als zentrale Voraussetzung von Schadensersatzansprüchen
b)Eingeschränktes Verschuldensprinzip
c)Darlegungs- und Beweislast, Bezugspunkt
2.Eigenes Verschulden des Schuldners (§§ 276 und 277)
a)Grundsätze
b)Verschuldensfähigkeit (§ 276 Abs. 1 S. 1 iVm §§ 827, 828)
c)Vorsatz
d)Fahrlässigkeit (§ 276 Abs. 2)
e)Vertragliche Einschränkungen der Verschuldenshaftung (Haftungsausschlüsse oder -begrenzungen)
f)Vertragliche Erweiterungen durch den Inhalt des Schuldverhältnisses (insbesondere: Garantien)
g)Gesetzliche Haftungserweiterungen
3.Haftung für Erfüllungsgehilfen (§ 278)
a)Grundgedanke
b)Bestehendes Schuldverhältnis
c)Erfüllungsgehilfe
d)Handeln „in Erfüllung“ einer Schuldnerpflicht
e)Verschulden des Erfüllungsgehilfen
f)Rechtsfolgen
g)Abweichende Vereinbarungen
4.Haftung für gesetzliche Vertreter (§ 278 Var. 1)
a)Grundgedanke
b)Begriff des gesetzlichen Vertreters
c)Weitere Voraussetzungen und Rechtsfolgen
5.Lösung Fall 36b)
§ 9Nicht oder nicht vertragsgemäße Leistung: Das Rücktrittsrecht aus § 323 und aus § 324
I.Grundlagen
II.Voraussetzungen des § 323
1.Gegenseitiger Vertrag
2.Nichtleistung
3.Fälligkeit und Durchsetzbarkeit
4.Erfolglose Fristsetzung bzw Entbehrlichkeit der Fristsetzung
a)Fristsetzung
b)Entbehrlichkeit der Fristsetzung
5.Fruchtloser Fristablauf (außer bei Entbehrlichkeit der Fristsetzung gem. § 323 Abs. 2)
6.Ausschlussgründe
a)§ 323 Abs. 5 S. 1 (Teilleistungen)
b)§ 323 Abs. 5 S. 2 (Mangelhafte Leistung)
c)§ 323 Abs. 6 1. Alt. (alleinige oder überwiegende Verantwortlichkeit des Gläubigers)
d)§ 323 Abs. 6 2. Alt. (Annahmeverzug des Gläubigers)
e)Keine Vertragsuntreue des Gläubigers
7.Rücktrittserklärung
III.Rücktritt wegen Schutzpflichtverletzung (§ 324)
1.Regelungszweck und Anwendungsbereich
2.Voraussetzungen
a)Pflichtverletzung
b)Unzumutbarkeit
IV.Rechtsfolgen des Rücktritts im Überblick (§§ 346 ff)
V.Lösung Fall 38
§ 10Rücktrittsfolgenrecht (§§ 346-354)
I.Grundlagen, Anwendungsbereich der §§ 346-354
1.Vertragliche Rücktrittsrechte
2.Gesetzliche Rücktrittsrechte
II.Ausübung des Rücktritts: Die Rücktrittserklärung (§ 349)
III.Befreiungswirkung des Rücktritts (Erlöschen der Leistungsansprüche)
1.Grundsätzliches
2.Schwebelage des Schuldners nach Ablauf der Nachfrist
IV.Das Rückgewährschuldverhältnis der §§ 346-348
1.Rückgewähr der empfangenen Leistungen und der gezogenen Nutzungen (§ 346 Abs. 1)
a)Rückgewähr empfangener Leistungen „in natura“
b)Rückgewähr tatsächlich gezogener Nutzungen
c)Leistungsort
d)Rücknahmepflicht
e)Schadensersatzanspruch gem. § 346 Abs. 4
2.Wertersatz (§ 346 Abs. 2)
a)§ 346 Abs. 2 S. 1 Nr 1
b)§ 346 Abs. 2 S. 1 Nr 2
c)§ 346 Abs. 2 S. 1 Nr 3
d)Bemessung der Wertersatzpflicht (§ 346 Abs. 2 S. 2)
3.Entfallen der Wertersatzpflicht (§ 346 Abs. 3)
a)Während Verarbeitung oder Umgestaltung auftretender Mangel (§ 346 Abs. 3 S. 1 Nr 1)
b)Verantwortlichkeit des Gläubigers und fehlende Kausalität (§ 346 Abs. 3 S. 1 Nr 2)
c)Privilegierung beim gesetzlichen Rücktritt (§ 346 Abs. 3 S. 1 Nr 3)
d)Herausgabe verbleibender Bereicherung (§ 346 Abs. 3 S. 2)
4.Nutzungs- und Verwendungsersatz (§ 347)
a)Nutzungsersatz
b)Verwendungsersatz (§ 347 Abs. 2)
5.Zug-um-Zug-Erfüllung (§ 348)
V.Lösung Fall 39
§ 11Schadensersatz statt der Leistung nach §§ 281, 282 und Aufwendungsersatz (§ 284)
I.Funktionen des § 281
II.Voraussetzungen des Anspruchs aus §§ 280 Abs. 1, Abs. 3, 281
1.Schuldverhältnis
2.Pflichtverletzung
3.Vertretenmüssen (§ 280 Abs. 1 S. 2)
4.Erfolglose Fristsetzung bzw. Entbehrlichkeit der Fristsetzung
a)Fristsetzung
b)Entbehrlichkeit der Fristsetzung
5.Fruchtloser Fristablauf (außer bei Entbehrlichkeit der Fristsetzung gem. § 281 Abs. 2)
6.Kein Ausschluss bei fehlender Vertragstreue
III.Schadensersatz statt der ganzen Leistung bei Teilleistungen und nicht wie geschuldeter Leistung
1.Teilleistungen (§ 281 Abs. 1 S. 2)
2.Mangelhafte Leistung (§ 281 Abs. 1 S. 3)
IV.Schadensersatz statt der Leistung wegen Schutzpflichtverletzung (§ 282)
1.Regelungszweck und Anwendungsbereich
2.Voraussetzungen
a)Pflichtverletzung
b)Vertretenmüssen
c)Unzumutbarkeit
V.Rechtsfolgen des Schadensersatzes statt der Leistung
1.Ausschluss des Leistungsanspruchs gem. § 281 Abs. 4
2.Schadensersatz statt der Leistung
a)Grundlagen
b)Schadensberechnung bei gegenseitigen Verträgen
VI.Lösung Fall 41
VII.Aufwendungsersatz (§ 284)
1.Regelungszweck
2.Aufwendungen als Schäden: Die Rentabilitätsvermutung
3.Voraussetzungen des § 284
a)Anspruch auf Schadensersatz statt der Leistung
b)Aufwendungen
c)Vergeblichkeit der Aufwendungen
d)Billigkeit
4.Rechtsfolgen
5.Verhältnis zu Schadensersatz statt der Leistung und Rücktritt
VIII.Lösung Fall 43
IX.Lösung Fall 44
§ 12Unmöglichkeit der Leistung
I.Die Unmöglichkeit im System des Leistungsstörungsrechts
II.§ 275: Konsequenzen für die Leistungspflicht (§ 275)
1.Anwendungsbereich
2.Variationen der Unmöglichkeit
a)Objektive und subjektive Unmöglichkeit
b)Anfängliche und nachträgliche Unmöglichkeit
c)Vollständige und teilweise Unmöglichkeit
3.§ 275 Abs. 1: Unmöglichkeit
a)Unüberwindbare Leistungshindernisse
b)Zweckerreichung und Zweckfortfall
c)Rechtliche Unmöglichkeit
d)Unmöglichkeit bei Gattungsschulden
e)Vorübergehende Unmöglichkeit
f)Absolutes Fixgeschäft
4.§ 275 Abs. 2: Unzumutbarkeit wegen groben Missverhältnisses
5.§ 275 Abs. 3 Unzumutbarkeit bei persönlichen Leistungspflichten
6.Rechtsfolgen
7.Lösung Fall 45
III.§ 326: Gegenleistungspflicht im gegenseitigen Vertrag
1.Grundlagen
2.Der Grundsatz des § 326 Abs. 1 S. 1: „Keine Ware, kein Geld“
a)Normzweck
b)Teilweises Entfallen bei Teilunmöglichkeit (§ 326 Abs. 1 S. 1 2. HS)
c)Ausschluss der Grundregel gem. § 326 Abs. 1 S. 2
3.Ausnahmen vom Grundsatz des § 326 Abs. 1 S. 1
a)Vom Gläubiger zu verantwortende Unmöglichkeit (§ 326 Abs. 2 S. 1 1. Alt.)
b)Annahmeverzug des Gläubigers (§ 326 Abs. 2 S. 1 2. Alt.)
c)Anrechnung von Ersparnissen (§ 326 Abs. 2 S. 2)
4.Beiderseits zu vertretende Unmöglichkeit
5.Inanspruchnahme des Surrogats gem. § 285 (§ 326 Abs. 3)
6.Rückforderung nicht geschuldeter Gegenleistungen (§ 326 Abs. 4)
7.Rücktrittsrecht (§ 326 Abs. 5)
a)Regelungszweck
b)Teilunmöglichkeit (§ 326 Abs. 5 2. HS iVm § 323 Abs. 5 S. 1 und S. 2)
8.Lösung Fall 47
IV.Sekundärleistungsansprüche als Folge der Unmöglichkeit
1.Schadensersatz statt der Leistung
a)Schadensersatz statt der Leistung bei anfänglicher Unmöglichkeit (§ 311a Abs. 2)
b)Schadensersatz statt der Leistung bei nachträglicher Unmöglichkeit (§§ 280 Abs. 1, Abs. 3, 283)
c)Besonderheiten bei Teilunmöglichkeit
2.Surrogatsherausgabe (§ 285)
a)Regelungszweck und Anwendungsbereich des § 285
b)Voraussetzungen
c)Rechtsfolgen
3.Aufwendungsersatz (§ 284)
4.Lösung Fall 48
§ 13Schuldnerverzug und Gläubigerverzug
I.Der Schuldnerverzug (§ 286)
1.Begriff und Bedeutung des Schuldnerverzugs
2.Voraussetzungen
a)Wirksamer, fälliger und durchsetzbarer Anspruch
b)Nichtleistung
c)Mahnung
d)Entbehrlichkeit der Mahnung (§ 286 Abs. 2)
e)Entgeltforderungen (§ 286 Abs. 3)
f)Vertretenmüssen (§ 286 Abs. 4)
g)Keine Beendigung des Schuldnerverzugs
3.Rechtsfolgen
a)Ersatz von Verzögerungsschäden (§§ 280 Abs. 1, Abs. 2, 286)
b)Verzugszinsen und sonstiger Verzugsschaden (§ 288)
c)Haftungsverschärfungen zulasten des Schuldners im Verzug (§ 287)
4.Abweichende Vereinbarungen
II.Der Gläubigerverzug (§§ 293-304)
1.Grundlagen und Funktionen
2.Voraussetzungen des Gläubigerverzugs
a)Wirksamer und erfüllbarer Anspruch
b)Leistungsfähigkeit des Schuldners (§ 297)
c)Ordnungsgemäßes Angebot oder Entbehrlichkeit des Angebots
d)Nichtannahme der Leistung
e)Kein vorübergehendes Annahmehindernis
3.Rechtsfolgen
a)Haftungsmilderungen
b)Übergang der Leistungsgefahr (§ 300 Abs. 2)
c)Gegenleistungsgefahr (§ 326 Abs. 2 S. 1 1. Alt.) und Ausschluss des Rücktrittsrechts (§ 323 Abs. 6 2. Alt.)
d)Ersatz von Mehraufwendungen (§ 304)
III.Lösung Fall 51
Teil IVVerbraucherrecht
§ 14Verbraucherrecht im Allgemeinen Schuldrecht
I.Grundlagen des Verbraucherschutzrechts
1.Entwicklung und Zweck des Verbraucherschutzrechts
2.Systematik bzw Regelungsorte
3.Die zentralen Regulierungsinstrumente: Informationspflichten und Widerrufsrechte
a)Informationspflichten
b)Widerrufsrechte
II.Anwendungsbereich des Verbraucherschutzrechts
1.Die Legaldefinition des Verbrauchervertrags in § 310 Abs. 3
2.Anwendbarkeit der §§ 312a ff
a)Entgeltlichkeit der Leistung: Grundsätzliches
b)Standardsituationen: Unternehmer erbringt vertragstypische Leistung
c)Umgekehrte Leistungsrichtung: Verbraucher erbringt die vertragstypische Leistung
d)Sonderproblem: Bürgschaftsverträge
3.Einschränkungen beim Anwendungsbereich (§ 312 Abs. 2 bis Abs. 7)
a)Minimalanwendungsbereich (§ 312 Abs. 2)
b)Eingeschränkter Anwendungsbereich (§ 312 Abs. 3, § 312 Abs. 4 S. 2)
c)Weitere Sonderregime (§ 312 Abs. 5, 6 und 7)
III.Verbraucherverträge: Allgemeine Regelungen (§§ 312, 312a, 312k)
1.Hintergrund, Systematik und Zweck der Regelungen
2.Allgemeine Pflichten und Grundsätze (§ 312a)
3.§ 312k: Einseitig zwingender Charakter, Umgehungsverbot, Beweislast
IV.Verträge im elektronischen Geschäftsverkehr (§§ 312i, 312j)
1.Hintergrund, Systematik und Zweck der Regelungen
2.§ 312i: Allgemeine Pflichten im elektronischen Rechtsverkehr (auch im b2b-Bereich)
3.§ 312j: Besondere Pflichten im elektronischen Rechtsverkehr gegenüber Verbrauchern
V.Außerhalb von Geschäftsräumen geschlossene Verträge (AGV) und Fernabsatzverträge (FAV): §§ 312b-312h
1.Regelungszweck und gesetzliche Systematik
2.§ 312b: Außerhalb von Geschäftsräumen geschlossene Verträge (AGV)
a)Überblick
b)Geschäftsräume (§ 312b Abs. 2)
c)Die Tatbestände des § 312b Abs. 1
3.§ 312c: Fernabsatzverträge (FAV)
a)Überblick
b)Fernabsatzverträge (§ 312c Abs. 1 und 2)
4.§§ 312d, 312e iVm Art. 246a, 246b EGBGB: Informationspflichten
a)Überblick und Systematik
b)§ 312d Abs. 1: AGV und FAV, die keine Verträge über Finanzdienstleistungen sind
5.§ 312g: Widerrufsrecht bei AGV und FAV
a)Hintergrund und Systematik
b)Ausnahmenkatalog (§ 312g Abs. 2)
6.§ 312h: Textform bei Kündigung von Dauerschuldverhältnissen
VI.Widerrufsrecht bei Verbraucherverträgen (§§ 355-361)
1.Regelungszweck
2.Gesetzliche Systematik
3.Die Rechtsnatur des Widerrufsrechts
4.Die Ausübung des Widerrufsrechts
a)Inhalt und Form der Widerrufserklärung (§ 355 Abs. 1 S. 2)
b)Widerrufsfrist (§ 355 Abs. 2 S. 1 und Modifikationen)
c)Sonderbestimmungen für das Widerrufsrecht (§ 356 und §§ 356a-356e)
5.Rechtsfolgen des Widerrufs
a)Umwandlung des Vertrags in ein Rückabwicklungsverhältnis (§ 355)
b)Einzelheiten der Rückabwicklung bei FAV und AGV (§ 357)
c)Einzelheiten der Rückabwicklung bei anderen Vertragstypen (§§ 357a-357d)
6.Verbundene und zusammenhängende Verträge (§§ 358-360)
a)Regelungszweck und Systematik
b)Mit dem widerrufenen Vertrag verbundene Verträge (§§ 358-359)
c)Zusammenhängende Verträge (§ 360)
7.Treu und Glauben im Widerrufsrecht
VII.Besonderheiten bei der Klauselkontrolle (§ 310 Abs. 3)
1.Fiktion der Stellung Allgemeiner Geschäftsbedingungen durch den Unternehmer (§ 310 Abs. 3 Nr 1)
2.Klauseln, die zur einmaligen Verwendung bestimmt sind (§ 310 Abs. 3 Nr 2)
3.Begleitumstände des Vertragsschlusses bei der Inhaltskontrolle nach § 307 Abs. 1 und 2
VIII.Lösung Fall 54
§ 15Haftung aus geschäftlichem Kontakt (culpa in contrahendo)
I.Die Grundlagen des Rechtsinstituts
1.Entstehung und Problematik
2.Dogmatische Einordnung
3.Grundsätzliches zu Pflichten und Haftung
II.Die Haftungsvoraussetzungen im Einzelnen
1.Die gesetzlich geregelten Fälle
a)Aufnahme von Vertragsverhandlungen
b)Vertragsanbahnung
c)Ähnliche geschäftliche Kontakte
d)Einbeziehung „vertragsfremder“ Dritter
2.Pflichtwidrigkeit und Verschulden
3.Schaden und Schutzbereiche
III.Rechtsfolgen der schuldhaften Verletzung vorvertraglicher Pflichten
1.Allgemeines
2.Vertrauens- und Nichterfüllungsschaden
3.Schadensersatzformen
4.Mitverschulden
IV.Das Verhältnis zu anderen Regelungskomplexen
1.Willensmängel
2.Gewährleistung
3.Verletzung vertraglicher Schutzpflichten
4.Verhältnis zum Minderjährigenschutz
V.Lösung Fall 58
§ 16Störung der Geschäftsgrundlage (§ 313 BGB)
I.Die Entwicklung des Rechtsinstituts
II.Der Tatbestand der Geschäftsgrundlagestörung
III.Die Störung der Geschäftsgrundlage im Einzelnen
1.Grundsätzliches
2.Nachträgliche Störungen der Geschäftsgrundlage (§ 313 Abs. 1)
3.Ursprüngliche Geschäftsgrundlagestörungen (§ 313 Abs. 2)
IV.Rechtsfolgen von Störungen der Geschäftsgrundlage
1.Anspruch auf Vertragsanpassung (§ 313 Abs. 1)
a)Grundsätzliches
b)Durchsetzung
c)Anspruchsinhalt
d)Folgen der Anpassung
2.Vertragsauflösung (§ 313 Abs. 3)
V.Die wichtigsten Fallgruppen und ihre rechtliche Behandlung
1.Problemdarstellung
2.Beiderseitiger Irrtum
3.Äquivalenz- und Zweckstörungen
4.„Große Geschäftsgrundlage“
VI.Das Verhältnis von § 313 zu anderen Normen und Rechtsinstituten
1.Anfechtungsrecht
2.„Faktische“ und „persönliche“ Unmöglichkeit (§ 275 Abs. 2 und Abs. 3)
3.Gewährleistungsrecht
4.Recht zur außerordentlichen Kündigung (§ 314)
VII.Lösung der Ausgangsfälle
Teil VSchadensersatzrecht
§ 17Funktionen und Grundelemente des Schadensersatzrechts
I.Die Funktionen des Schadensersatzrechts
1.Prinzipien und Problematik
2.Grundstruktur
II.Die Kausalität
1.Äquivalenztheorie
2.Adäquanztheorie
3.Schutzzweck der verletzten Norm
4.Rechtmäßiges Alternativverhalten
5.Tätermehrheit
6.Sonderformen der Kausalität
III.Lösung Fall 62
§ 18Schadensbegriff, Schadensberechnung und Arten des Ersatzes
I.Begriff und Arten des Schadens
1.Begriff
2.Schadensarten
II.Das System der Ersatzansprüche
1.Inhalt der Schadensersatzpflicht
2.Schadensberechnung
III.Anspruchsmindernde Faktoren
1.Mitverschulden
2.Vorteilsausgleichung
IV.Problemfälle zur Abgrenzung von Vermögens- und Nichtvermögensschaden
1.Ausfall der Arbeitskraft
2.Nutzungsausfall beim Kfz
3.„Kind als Schaden“
V.Lösung Fall 67
Teil VIEinbeziehung Dritter in das Schuldverhältnis
§ 19Vertrag zugunsten Dritter
I.Grundstruktur und Hauptfälle des Vertrags zugunsten Dritter
1.Problematik
2.Echter und unechter Vertrag zugunsten Dritter
3.Struktur
4.Formvorschriften
II.Abwicklung der verschiedenen Rechtsbeziehungen
1.Einwendungen des Versprechenden
2.Leistungserbringung trotz Einwendungsrechts
3.Leistungsstörungen
III.Lösung Fall 68
§ 20Vertraglicher Drittschutz und Drittschäden
I.Die Problematik des vertraglichen Drittschutzes
1.Problemdarstellung
2.Lösungsmöglichkeiten
II.Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter
1.Rechtliche Einordnung
2.Voraussetzungen
a)Tatsächliche Leistungsnähe des Dritten („Gefahrenbereich“ des Vertrages)
b)Interesse des eigentlichen Vertragsgläubigers am Schutz des Dritten?
c)Erkennbarkeit (und Zumutbarkeit) der Drittbezogenheit für den Schuldner
d)Besonderes Schutzbedürfnis des Dritten
3.Rechtsfolgen
III.Drittschadensliquidation
1.Begriff
2.Voraussetzungen und gesetzliche Anhaltspunkte
3.Fallgruppen
a)Handeln für fremde Rechnung
b)Obligatorische Gefahrentlastung
c)Obhutsverhältnisse
4.Rechtsfolgen
IV.Drittgerichtete Ausdehnungen des vorvertraglichen Schutzbereichs (§ 311 Abs. 2 und 3)
V.Lösung Fall 70
§ 21Abtretung
I.Begriff, Voraussetzungen und Hauptfälle der Abtretung
1.Grundsätzliches
2.Der Abtretungsvorgang
3.Praktische Bedeutung
4.Wirksamkeitsvoraussetzungen
a)Grundsatz
b)Das Bestimmtheitsproblem
5.Beschränkung und Ausschluss der Abtretung
a)Gesetzliche Einschränkungen
b)Rechtsgeschäftliche Einschränkungen
6.Die Wirkungen der Abtretung
II.Schuldnerschutz bei der Zession
1.Ausgangslage
2.Einwendungen des Schuldners
3.Schuldbefreiende Zahlung an den Altgläubiger
III.Die Abtretung als Kreditsicherungsinstrument
1.Die Rechtsstellung des Sicherungsnehmers
2.Rechtslage bei Zurückführung der gesicherten Forderung
3.Vorausabtretung und Bestimmbarkeit
4.Gültigkeitsschranken bei der Globalzession
IV.Klausurgliederung Fall 73
§ 22Schuldnerwechsel und Schuldnermehrheit
I.Vorbemerkung
II.Schuldübernahme
1.Begriff
2.Voraussetzungen
3.Rechtsfolgen
4.Schicksal von Sicherheiten
5.Genehmigungsverweigerung
III.Schuldbeitritt
1.Begriff
2.Abgrenzung
3.Rechtliche Behandlung
4.Gesamtschuldverhältnis
5.Gesetzlicher Schuldbeitritt
IV.Schuldnermehrheit und Gesamtschuldnerausgleich
1.Erscheinungsformen der Schuldnermehrheit
2.Teilbare Schulden
3.Entstehung von Gesamtschuldverhältnissen
a)Gesamtschuldverhältnisse kraft vertraglicher Vereinbarung
b)Gesamtschuldverhältnisse kraft gesetzlicher Anordnung
4.Abgrenzung
a)Gemeinschaftliche Schuld und Gesamtschuld bei unteilbarer Leistung
b)Gesamthandschuld
5.Merkmale der Gesamtschuld
a)Identität des Gläubigerinteresses
b)Zweckgemeinschaft?
c)Gleichstufigkeit
d)Gleicher Rechtsgrund?
6.Außenverhältnis
7.Innenverhältnis
8.„Unechte“ Gesamtschuld
9.Legalzession
10.Ausgleich bei „gestörter Gesamtschuld“
V.Lösung Fall 75
Teil VIIErlöschen von Schuldverhältnissen
§ 23Erfüllung und Erfüllungssurrogate
I.Erfüllung
1.Erfüllungswirkung
2.Erlöschensgründe
3.Beteiligung Dritter
II.Erfüllungssurrogate
III.Die Aufrechnung
1.Begriff und Zwecke
2.Aufrechnungslage
3.Aufrechnungserklärung
4.Aufrechnung durch Vertrag
5.Wirkungen der Aufrechnung
6.Gesetzliche Aufrechnungsausschlüsse
7.Aufrechnungsausschlussvereinbarungen
8.Zusammenfassung
IV.Lösung Fall 78
Sachverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
aA
anderer Ansicht
aaO
am angegebenen Ort
Abl EU
Amtsblatt der Europäischen Union
Abs.
Absatz
AcP
Archiv für die civilistische Praxis
aE
am Ende
aF
alte Fassung
AG
Aktiengesellschaft; Amtsgericht
AGB
Allgemeine Geschäftsbedingungen
AGG
Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz
aM
anderer Meinung
Anm.
Anmerkung
Anw-Komm
Anwaltskommentar
AP
Arbeitsgerichtliche Praxis
AT
Allgemeiner Teil
AtomG
Atomgesetz
Aufl.
Auflage
AuslInvestmentG
Gesetz über den Vertrieb ausländischer Investmentanteile und über die Besteuerung der Erträge aus ausländischen Investmentanteilen
BAG
Bundesarbeitsgericht
BauR
Baurecht
BayObLG
Bayerisches Oberstes Landesgericht
BB
Betriebsberater
BeckRS
Beck-Rechtsprechung
Bd
Band
Begr.
Begründer/Begründung
BFH
Bundesfinanzhof
BGB
Bürgerliches Gesetzbuch
BGBl
Bundesgesetzblatt
BGH
Bundesgerichtshof
BGHZ
Entscheidungen des BGH in Zivilsachen
BKR
Zeitschrift für Bank- und Kapitalmarktrecht
BörsG
Börsengesetz
BR
Bürgerliches Recht
BR-Drs.
Bundesrats-Drucksache
BRAGO
Bundesgebührenordnung für Rechtsanwälte
BSHG
Bundessozialhilfegesetz
BT
Besonderer Teil
BT-Drs.
Bundestags-Drucksache
BVerfG
Bundesverfassungsgericht
BVerwG
Bundesverwaltungsgericht
bzgl
bezüglich
bzw
beziehungsweise
ca.
circa
CCZ
Corporate Compliance Zeitschrift
cic
culpa in contrahendo
CMR
Übereinkommen über den Beförderungsvertrag im internationalen Straßengüterverkehr
DAR
Deutsches Autorecht
DB
Der Betrieb
ders.
derselbe
dh
das heißt
DNotZ
Deutsche Notar-Zeitung
DStRE
Deutsches Steuerrecht – Entscheidungsdienst
DZWiR
Deutsche Zeitschrift für Wirtschafts- und Insolvenzrecht
EFZG
Entgeltfortzahlungsgesetz
Einl.
Einleitung
EuGH
Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften
f, ff
folgend(e)
FamRZ
Zeitschrift für das gesamte Familienrecht
FG
Festgabe
Fn
Fußnote
FS
Festschrift
G
Gesetz
GG
Grundgesetz
ggf
gegebenenfalls
GmbH
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GS
Großer Senat; Gedächtnisschrift
GWR
Gesellschafts- und Wirtschaftsrecht
hA
herrschende Ansicht
HaftPflG
Haftpflichtgesetz
HB
Handbuch
HGB
Handelsgesetzbuch
HK
Handkommentar; Heidelberger Kommentar
hL
herrschende Lehre
hM
herrschende Meinung
Hrsg.
Herausgeber
IBR
Immobilien- und Baurecht
idS
in diesem Sinn
i.e.S.
im engeren Sinne
insb.
insbesondere
InsO
Insolvenzordnung
InvG
Investmentgesetz
iSd
im Sinne (des; der)
iVm
in Verbindung mit
JA
Juristische Arbeitsblätter
JGG
Jugendgerichtsgesetz
JherJB
Jherings Jahrbuch für die Dogmatik des bürgerlichen Rechts
JR
Juristische Rundschau
Jura
Juristische Ausbildung
JuS
Juristische Schulung
JZ
Juristenzeitung
KAGB
Kapitalanlagengesetzbuch
KAGG
Gesetz über Kapitalanlagegesellschaften
Kfz
Kraftfahrzeug
KG
Kammergericht
krit.
kritisch
KTS
Zeitschrift für Insolvenzrecht
leg cit
legis citatae (der zitierten Vorschrift)
LG
Landgericht
Lkw
Lastkraftwagen
LM
Lindenmaier/Möhring, Nachschlagewerk des BGH
LuftVG
Luftverkehrsgesetz
LSK
Leitsatzkartei des deutschen Rechts
MDR
Monatsschrift für Deutsches Recht
Mot.
Motive zum Entwurfe eines BGB für das Deutsche Reich Bd. II, Berlin/Leipzig 1898
MünchKomm
Münchener Kommentar
mwN
mit weiteren Nachweisen
nF
neue Fassung
NJ
Neue Justiz
NJW
Neue Juristische Wochenschrift
NJW-RR
NJW-Rechtsprechungs-Report, Zivilrecht
Nr
Nummer
NZA
Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht
NZG
Neue Zeitschrift für Gesellschaftsrecht
NZM
Neue Zeitschrift für Miet- und Wohnungsrecht
NZV
Neue Zeitschrift für Verkehrsrecht
oä
oder ähnliche
ÖBA
Österreichisches Bank-Archiv
OLG
Oberlandesgericht
OLG-Rp
OLG-Report
PartGG
Partnerschaftsgesellschaftsgesetz
PflVersG
Pflichtversicherungsgesetz
PKW
Personenkraftwagen
ProdHaftG
Produkthaftungsgesetz
Prot.
Protokolle der Kommission für die 2. Lesung des Entwurfs des BGB, Hrsg. Reichsjustizhauptamt Berlin 1897
pVV
positive Vertragsverletzung
r + s
recht und schaden
RegE
Regierungsentwurf eines Schuldrechtsmodernisierungsgesetzes, BT-Drs. 14/6040
RG
Reichsgericht
RGZ
Amtliche Sammlung von Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen
Rn
Randnummer
Rspr
Rechtsprechung
S.
Satz; Seite
s.
siehe
SGB
Sozialgesetzbuch
SMG
Schuldrechtsmodernisierungsgesetz
sog
so genannt, -e, -er, -es
SR
Schuldrecht
StGB
Strafgesetzbuch
StVG
Straßenverkehrsgesetz
SÜ
Schuldübernahme
SVR
Straßenverkehrsrecht
UmweltHG
Umwelthaftungsgesetz
usw
und so weiter
uU
unter Umständen
VerbrKrG
Verbraucherkreditgesetz
VerkProspG
Wertpapier-Verkaufsprospektgesetz
VersR
Versicherungsrecht
vgl
vergleiche
VOB Teil A/B
Verdingungsordnung für Bauleistungen, Teil A/B
Vorbem.
Vorbemerkungen
VVG
Gesetz über den Versicherungsvertrag
WG
Wechselgesetz
WHG
Wasserhaushaltsgesetz
WM
Wertpapier-Mitteilungen
WpHG
Wertpapierhandelsgesetz
zB
zum Beispiel
ZBB
Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft
ZEuP
Zeitschrift für europäisches Privatrecht
ZEV
Zeitschrift für Erbrecht und Vermögensnachfolge
ZfBR
Zeitschrift für deutsches und internationales Baurecht
ZfIR
Zeitschrift für Immobilienrecht
ZfPW
Zeitschrift für die gesamte Privatrechtswissenschaft
ZfS
Zeitschrift für Schadensrecht
ZHR
Zeitschrift für das gesamte Handelsrecht und Wirtschaftsrecht
ZIP
Zeitschrift für Wirtschaftsrecht
ZMR
Zeitschrift für Miet- und Raumrecht
ZPO
Zivilprozessordnung
ZRP
Zeitschrift für Rechtspolitik
zT
zum Teil
ZVglRWiss
Zeitschrift für Vergleichende Rechtswissenschaft
ZWE
Zeitschrift für Wohnungseigentumsrecht
z.Z.
zurzeit
Literaturverzeichnis
Assmann/Schütze
Handbuch des Kapitalanlagerechts4 (2015)
Bamberger/Roth/Hau/Poseck
Kommentar zum BGB4 (2019)
BeckOK
Beck’scher Online-Kommentar BGB51 (2019)
BeckOGK
beck-online.GROSSKOMMENTAR (2019)
Brox/Walker
Allgemeines Schuldrecht42 (2018) – zit.: SR AT42
Bülow
Recht der Kreditsicherheiten9 (2017)
Canaris
Handelsrecht24 (2006)
Deutsch
Allgemeines Haftungsrecht2 (1996)
Emmerich
BGB-Schuldrecht Besonderer Teil15 (2018) – zit.: Schuldrecht Besonderer Teil
Erman (Begr)
Handkommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch15 Bd 1 (2017)
Esser/E. Schmidt
Schuldrecht Bd I, Allgemeiner Teil, Teilband 28 (2000) – zit.: SR I/28
Esser/Weyers
Schuldrecht Bd II, Besonderer Teil, Teilband 28 (2000) – zit.: SR II/28
Fikentscher/Heinemann
Schuldrecht11 (2017) – zit.: SR10
Flume
Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, Bd 24 (1992) – zit.: AT II4
Gernhuber
Die Erfüllung und ihre Surrogate2 (1994)
Jauernig (Hrsg)
Bürgerliches Gesetzbuch17 (2018) – zit.: BGB17
Kayser/Thole (Hrsg)
Heidelberger Kommentar zur Insolvenzordnung9 (2018) – zit.: HK-InsO9
Kötz/Wagner
Deliktsrecht13 (2016)
Lange/Schiemann
Schadensersatz3 (2003)
Larenz/Canaris
Lehrbuch des Schuldrechts Bd 2, Besonderer Teil, 2. Halbband13 (1994) – zit.: SR II/213
Larenz
Lehrbuch des Schuldrechts Bd 1, Allgemeiner Teil14 (1987) – zit.: SR I14
Lieb/Jacobs
Arbeitsrecht9 (2006)
Looschelders, Dirk
Schuldrecht, Allgemeiner Teil16 (2018) – zit.: SR AT16
Lorenz/Riehm
Lehrbuch zum neuen Schuldrecht (2002) – zit.: SR
Medicus/Petersen
Bürgerliches Recht26 (2019) – zit.: BR27
Medicus/Petersen
Allgemeiner Teil des BGB11 (2016) – zit.: BGB AT11
Medicus/Lorenz
Schuldrecht I, Allgemeiner Teil21 (2015) – zit.: SR AT21
Medicus/Lorenz
Schuldrecht II, Besonderer Teil18 (2018) – zit.: SR BT18
MünchKommBGB
Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Bd 18 (2018), Bd 28 (2019), Bd 38 (2019), Bd 47 (2016), Bd 57 (2017/2018)
NK
NomosKommentar BGB3 (2016)
Nörr/Scheyhing/Pöggeler
Sukzessionen2 (1999)
Palandt (Begr)
Bürgerliches Gesetzbuch78 (2019)
Schack
BGB-Allgemeiner Teil16 (2019) – zit.: Allgemeiner Teil
Schack/Ackmann
Das Bürgerliche Recht in 100 Leitentscheidungen7 (2018)
Schimansky/Bunte/
Bankrechts-Handbuch Bd 15 (2017)
Lwowski (Hrsg)
Schulze (Schriftleitung)
Bürgerliches Gesetzbuch Handkommentar10 (2019)
Soergel
Bürgerliches Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen Bd 2 (1999), Bd 2a13 (2002), Bd 5/313 (2010)
Staudinger
Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen (seit 1993) – teilweise Neubearbeitungen
Wolf/Neuner
Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts11 (2016) – zit.: BGB AT11
Teil IGrundlagen
§ 1Ziele und Prinzipien des Schuldrechts
§ 2Überblick und Systematik des Schuldrechts
§ 3Schuldrechtliche Pflichten – Einteilung und Abgrenzungen
§ 4Die Entstehung von Schuldverhältnissen
Teil I Grundlagen › § 1 Ziele und Prinzipien des Schuldrechts
§ 1Ziele und Prinzipien des Schuldrechts
I.Gerechtigkeit als Idee des Schuldrechts
II.Rechtssicherheit und Rechtsfrieden
III.Vertragsfreiheit
IV.Der Grundsatz der Gleichbehandlung
V.Vertrauensschutz
VI.Treu und Glauben (§ 242)
VII.Trennungs- und Abstraktionsprinzip
VIII.Relativität der Schuldverhältnisse
1
Klempnerin K kauft für ihr Geschäft einen gebrauchten Pkw zu 4.000 Euro von Unternehmer S. Mit S hat K keinen Kontakt. Sie verhandelt nur mit Autohändlerin V, die den Kauf vermittelt. Dabei sagt V, dass sie als Autoexpertin überzeugt sei, dass die Bremsen in „tip-top Zustand“ seien. V hätte allerdings leicht erkennen können, dass die Bremsen defekt sind. Wenige Tage nach Übergabe des Fahrzeugs kommt es wegen des Defekts an den Bremsen zu einem Unfall, bei dem K verletzt wird. Kann K von V Schadensersatz verlangen?
Der Unternehmer U hat schon lange ein Auge auf das benachbarte Grundstück seines Angestellten A. Eines Tages gelingt es U endlich, A zum Verkauf des Grundstücks zu bewegen. Er versichert A, dass eine notarielle Beurkundung nicht erforderlich sei, weil ein Vertrag mit ihm aufgrund seines Ansehens ohnehin großes Gewicht habe und er grundsätzlich alle seine Verträge einhalte. A vertraut darauf und traut sich auch U gegenüber nicht, auf notarielle Beurkundung zu bestehen. Als nach mehreren Monaten noch immer kein Geld auf dem Konto des A eingegangen ist, wird er stutzig und schreibt an U. U antwortet, dass er inzwischen doch nicht mehr an dem Grundstück interessiert sei und der Vertrag aufgrund des Formmangels ohnehin nichtig sei. Kann sich U auf den Formmangel berufen?
S ist der Sohn von V, lebt allerdings bei seiner geschiedenen Mutter M. Im Juli 2015 fordert er V schriftlich dazu auf, ihm Auskunft über dessen Einkommens- und Vermögensverhältnisse zu geben. V sendet ihm die gewünschten Informationen zu und bittet seinerseits um Angaben zum Gehalt der Mutter, welche er in der Folge auch bekommt. Auf dieser Grundlage errechnet er einen monatlichen Unterhalt von 140 Euro. Er teilt S seinen Standpunkt mit und bittet ihn, dazu Stellung zu nehmen und eventuell eine eigene Berechnung vorzulegen. Nachdem er trotz mehrmaliger Nachfragen keine Antwort erhält, beginnt er mit der Zahlung des Unterhalts auf Basis der von ihm errechneten Summe. Im August 2017 meldet sich dann wiederum S, der den ihm zustehenden Unterhalt mit 205 Euro pro Monat angibt und dementsprechend Nachzahlung verlangt. V weigert sich unter Verweis auf die verstrichene Zeit. Zu Recht?
A verkauft B ein Gemälde, an dem diese schon lange interessiert war, für 1.000 Euro. Noch bevor B das gute Stück bei A abholen und ihrerseits bezahlen kann, macht C allerdings ein Angebot über 1.500 Euro, dem A nicht widerstehen kann. Er nimmt es an und übergibt das Gemälde unverzüglich an C, der ihm wiederum das Geld aushändigt. B ist empört und möchte das nicht auf sich sitzen lassen. Als sie von A erneut Übereignung verlangt, entgegnet dieser wahrheitsgemäß, er selbst habe das Gemälde nicht mehr und C sei nicht zur Herausgabe bereit. B überlegt nun, wie sie trotzdem an das Kunstwerk gelangen kann, und sieht ihre einzige Chance darin, C in die Pflicht zu nehmen. Kann sie von C Übergabe und Übereignung verlangen?
2
Das Schuldrecht ist keine akademische Spielerei oder Zweck an sich. Es erfüllt vielmehr in unserem Rechtssystem und unserer Gesellschaft wichtige und vielschichtige Aufgaben. Man kann deshalb das Schuldrecht auch nicht aus sich selbst heraus, isoliert von seinem ökonomischen oder sozialen Hintergrund, verstehen. Vielmehr lässt sich das Schuldrecht nur begreifen, wenn und indem man sich Gedanken über seine Ziele macht. Dazu dient dieses Kapitel. Auch für die Lösung von Fällen und Prüfungsarbeiten ist es wichtig, sich Gedanken über die Motivation hinter einer Norm zu machen. Wer Fälle löst, muss häufig teleologisch argumentieren, also nach Zwecken bestimmter schuldrechtlicher Normen fragen. Dazu ist es hilfreich, auch über die Ziele des Schuldrechts als Rechtsgebiet nachgedacht zu haben. Die Ziele des Schuldrechts spiegeln sich größtenteils in seinen Prinzipien wider. Dabei geht es um Grundgedanken oder Grundstrukturen, die für das Schuldrecht prägend sind und die Rechtsanwendung bei schwierigen Fällen leiten können. Prinzipien können miteinander in Konflikt geraten. Die Vertragsfreiheit umfasst beispielsweise die Freiheit, einen Vertrag mit einer anderen Person abzuschließen oder auch nicht abzuschließen. Das Prinzip der Gleichbehandlung kann dagegen verlangen, dass jemand einen Vertrag mit einer Person abschließt, mit der er nicht kontrahieren möchte. Die Prinzipien müssen daher bei der Bestimmung dessen, was gilt, gegeneinander abgewogen werden. Diese Abwägung ist in erster Linie Aufgabe des Gesetzgebers. Aber auch in der Anwendung des Rechts (vor allem durch Gerichte) kann es zu Abwägungsentscheidungen kommen, die sorgsam begründet werden müssen.
Teil I Grundlagen › § 1 Ziele und Prinzipien des Schuldrechts › I. Gerechtigkeit als Idee des Schuldrechts
I.Gerechtigkeit als Idee des Schuldrechts
3
Sucht man nach einer Idee des Rechts, also einem außerhalb des Rechts liegenden Prinzip, auf dessen Verwirklichung alles Recht ausgerichtet ist, gelangt man zur Gerechtigkeit. Gustav Radbruch bringt diese Zielrichtung des Rechts klar zum Ausdruck: „Die Idee des Rechts kann nun keine andere sein als die Gerechtigkeit.“[1] Auch das Schuldrecht ist Teil des Rechts, so dass auch seine Grundidee keine andere als die Gerechtigkeit sein kann.[2] Die Gerechtigkeit lässt sich nicht durch abstrakte Definitionen bestimmen. Sie ist ein Ideal, dessen Verwirklichung schuldrechtliche Normen zwar zum Ziel haben, das sie aber letztlich nie vollständig erreichen können. Die konkreten Inhalte der Gerechtigkeit stehen nicht objektiv fest, so als könnten sie in der Rechtsanwendung lediglich entdeckt werden. Vielmehr werden sie immer wieder von neuem bestimmt. Dabei spielen auch die jeweiligen ökonomischen, gesellschaftlichen, sozialen und politischen Verhältnisse eine wichtige Rolle. Die Konkretisierung der Gerechtigkeit erfolgt im juristischen Diskurs der Akteure des Rechts – also durch Richterinnen und Richter, aber auch Beamte, Anwältinnen und sogar Rechtswissenschaftlerinnen und Rechtswissenschaftler.[3]
4
Die Gerechtigkeit als Grundidee des Schuldrechts zu sehen, kann helfen, unserer Privatrechtsordnung Stabilität zu vermitteln: Das Schuldrecht wird maßgeblich davon mitgeprägt, dass Ansprüche durch staatliche Gewalt durchgesetzt werden.[4] Dies zu akzeptieren, fällt den meisten Menschen leichter, wenn sie annehmen dürfen, dass die Regeln des Schuldrechts auf Gerechtigkeit hin ausgerichtet und nicht bloß beliebig gesetzt sind.[5] Ein weiterer Vorzug der Gerechtigkeit als Idee des Rechts liegt darin, den juristischen Diskurs zwanglos auf breitere Grundlage zu stellen: Rechtliche Diskussionen werden so grundsätzlich offen für Gerechtigkeitsargumente. So lassen sich auch Diskurse über Generalklauseln wie § 138 oder § 242 besser erklären, die ohnehin auch außerrechtliche, moralische Argumentationslinien aufweisen.
1.Austauschgerechtigkeit (bzw ausgleichende Gerechtigkeit) und Verteilungsgerechtigkeit
5
Herkömmlich wird als Gerechtigkeitsform des Privatrechts die Austauschgerechtigkeit (bzw ausgleichende Gerechtigkeit) betrachtet, die Verteilungsgerechtigkeit gilt dagegen als Gerechtigkeitsform des öffentlichen Rechts.[6] Diese Zuordnung erscheint auf den ersten Blick gerade für das Schuldrecht plausibel, dessen Paradigma ja der zweiseitige Austauschvertrag ist. Bei näherer Betrachtung zeigt sich jedoch, dass Austauschgerechtigkeit (bzw ausgleichende Gerechtigkeit) und Verteilungsgerechtigkeit im Schuldrecht gleichwertig und gleichberechtigt nebeneinanderstehen und das Schuldrecht prägen.[7]
6
Die Austauschgerechtigkeit – die paradigmatisch auf die Gerechtigkeit zwischen zwei Personen abzielt, ohne Verteilungswirkungen oder Verallgemeinerungen zu betrachten[8] – steht im Schuldrecht bei vielen Regeln und Prinzipien im Vordergrund. Häufig geht es im Schuldrecht gerade um die Gerechtigkeit im Verhältnis von Schuldner und Gläubiger. Wenn etwa Hauptleistungspflichten das Äquivalenzinteresse schützen, soll damit die Gleichheit von Leistung und Gegenleistung gesichert und so ein auf die beiden beteiligten Personen fokussierender Gerechtigkeitsgedanke umgesetzt werden. Das Austauschverhältnis wird dabei wie durch ein Brennglas betrachtet. Auf Auswirkungen, die über das konkrete Zweipersonenverhältnis hinausgehen (die man auch externe Effekte nennen kann), scheint es nicht anzukommen. Was zwischen den beiden Parteien „gleichwertig“ ist, hängt auch entscheidend von dem ab, was die Parteien vereinbart haben (vgl auch § 346 Abs. 2 S. 2). Hier zeigt sich die besondere Nähe der Austauschgerechtigkeit zur Vertragsfreiheit. Auch das Schadensrecht zielt in vielen Fällen vor allem darauf ab, einen beiderseits gerechten Interessenausgleich zwischen Schädiger und Geschädigtem herzustellen.[9] So ist die Ausgleichs- und Genugtuungsfunktion des Schadensersatzrechts Ausdruck der ausgleichenden Gerechtigkeit.
2.Verteilungsgerechtigkeit im Schuldrecht
7
Aber auch die Verteilungsgerechtigkeit – der es um die Verteilung von Chancen, Risiken und Vermögen geht und die externe Effekte einbezieht[10] – steht bei zahlreichen Regeln und Prinzipien des Schuldrechts im Vordergrund. Verteilungsgerechtigkeit zeigt sich immer dann, wenn Normen und Prinzipien sich nicht mehr nur mit den Interessen der konkret Beteiligten erklären lassen, sondern auch als Steuerungsinstrument für potenziell künftige Fälle dienen. Verteilungsgerechtigkeit steht für eine regulative Perspektive des Rechts. Im Schuldrecht zeigt sie sich häufig. Einfache Beispiele sind diejenigen Normen und Rechtsgebiete, die (vereinfacht gesprochen) den Schutz bestimmter Personengruppen bewirken – etwa das soziale Mietrecht, das Verbraucherrecht oder auch das Arbeitsvertragsrecht. Ähnlich liegt es, wenn Schuldrecht Gemeinwohlbelange verwirklicht – so etwa bei zahlreichen Kontrahierungszwängen, etwa im Bereich der Daseinsvorsorge.[11] Wenn Regeln der Verhaltenssteuerung dienen, steht ebenfalls die Verteilungsgerechtigkeit im Vordergrund.[12] Ein Beispiel ist die Präventionsfunktion des Schmerzensgeldes bei Verletzungen des Persönlichkeitsrechts.[13] Sie zielt darauf ab, künftige Verletzungen zu verhindern.
8
Inwieweit bzw an welchen Stellen des Schuldrechts Verteilungsgerechtigkeit oder Austauschgerechtigkeit im Vordergrund stehen, ist in erster Linie eine Entscheidung des Gesetzgebers. In der Rechtsanwendung sind die gesetzgeberischen Wertungsentscheidungen zu berücksichtigen. Beide Gerechtigkeitsperspektiven können zu identischen Forderungen führen oder Anwendungsentscheidungen in gleicher Weise begründen. Es kann in der Rechtsanwendung aber auch dazu kommen, dass ein Konflikt zwischen der Austauschgerechtigkeit und der Verteilungsgerechtigkeit zu entscheiden ist. Solche Konflikte können immer nur im Einzelfall aufgelöst werden. Dabei besteht kein Vorrang der einen oder anderen Gerechtigkeitsform. Vielmehr sind Verteilungsgerechtigkeit und Austauschgerechtigkeit im Schuldrecht gleichwertige und gleichrangige Gerechtigkeitsperspektiven.[14] Ähnlich wie bei der Abwägung zwischen Prinzipien kommt es daher bei Konfliktentscheidungen zuvorderst auf eine sorgsame Begründung der jeweiligen Vorrangentscheidung an. Allgemeine Aussagen lassen sich nur schwer treffen. Denn die Entscheidung hängt immer von den jeweiligen historischen, sozialen, ökonomischen und politischen Kontexten der jeweiligen Regelungsmaterie und des jeweiligen Einzelfalls ab. Beispielsweise dürfte die Perspektive der Austauschgerechtigkeit bei Schuldverhältnissen zwischen Unternehmern sowie im Handelsrecht im Vordergrund stehen, weil in diesen Kontexten Schnelligkeit und Sicherheit ein hohes Gut sind. Die mit der Austauschgerechtigkeit einhergehende Abstraktion und Dekontextualisierung kommt dem entgegen, weil beides die Rechtsanwendung vereinfacht. Andererseits spielt die Gerechtigkeitsperspektive der Verteilungsgerechtigkeit dort eine besondere Rolle, wo es um den Schutz Schwächerer geht oder auch, wenn die Prävention bestimmter Verhaltensweisen im Vordergrund steht.
Teil I Grundlagen › § 1 Ziele und Prinzipien des Schuldrechts › II. Rechtssicherheit und Rechtsfrieden
II.Rechtssicherheit und Rechtsfrieden
9
Ein wichtiges Ziel des Schuldrechts ist es, Rechtssicherheit zu gewährleisten und so zum Rechtsfrieden beizutragen. Schuldner und Gläubiger erhalten durch die schuldrechtlichen Normen und ihre Konkretisierungen in der Rechtsprechung Klarheit über ihre wechselseitigen Rechte und Pflichten. So können Streitigkeiten oft schon im Vorfeld verhindert werden.
Teil I Grundlagen › § 1 Ziele und Prinzipien des Schuldrechts › III. Vertragsfreiheit
III.Vertragsfreiheit
1.Grundgedanken
10
Schuldverhältnisse beruhen oft auf Verträgen. Welche Inhalte Verträge haben, wird in der Praxis auch durch Parteivereinbarungen mitbestimmt. Das wird vom Prinzip der Vertragsfreiheit aufgegriffen. Die Vertragsfreiheit gehört zur Privatautonomie. Als schuldrechtliches Prinzip hat die Vertragsfreiheit eine wichtige Funktion: Sie berücksichtigt unser Bedürfnis, uns zumindest auch als freie und verantwortliche Menschen denken zu können.[15] Vertragsfreiheit umfasst die Abschlussfreiheit der Vertragsparteien. Private Akteure dürfen, soweit ihnen Abschlussfreiheit zukommt, frei entscheiden, ob sie überhaupt kontrahieren wollen, mit wem sie kontrahieren wollen und in welcher Form. Ähnliches gilt für den Inhalt der Verträge: Die Vertragsparteien – und nur sie – können im rechtlich vorgegebenen Rahmen eigenverantwortlich den Inhalt ihrer Verträge bestimmen und ändern (Vertragsinhaltsfreiheit). Man spricht insoweit auch von der Gestaltungsfreiheit und der Abänderungsfreiheit. Die einzelnen Facetten der Vertragsfreiheit werden durch viele gesetzliche Bestimmungen ausgestaltet.[16]
2.Formale und materielle Aspekte der Vertragsfreiheit
11
Vertragsfreiheit hat – wie die Freiheit im Allgemeinen – formale („Freiheit von“[17]) und materielle („Freiheit zu“[18]) Facetten. Im Liberalismus des 19. Jahrhunderts wurden Privatautonomie und Vertragsfreiheit weitgehend formal konzipiert, also als Institute der Sicherung formaler Freiheit verstanden.[19] Es ging vor allem darum, „Freiheit von staatlicher Einmischung“ zu garantieren. Diese Konzeption wirkt bis heute fort: Vertragsfreiheit wird oft als Selbstgesetzgebung Privater verstanden. Vertragsinhalte gelten danach nicht etwa deshalb, weil sie aus einer überindividuellen Perspektive zweckmäßig oder gerecht sind, sondern schlicht, weil sie privatautonom gesetzt sind.[20] Freiheit ersetzt danach Gerechtigkeit.[21] Die als „frei“ und „gleich“ gedachten Menschen selbst, nicht aber der Staat, definieren den Inhalt privatautonom begründeter Rechtssätze. Dem Staat kommt lediglich eine „Nachtwächterfunktion“ zu: Er sichert vor allem die Geltung und die Vollstreckung frei verhandelter Vertragsinhalte.[22] Das Hauptanliegen dieser Konzeption besteht darin, die Verkehrssicherheit und den Wettbewerb zu fördern. Ein wichtiges Kennzeichen des formalen Verständnisses von Vertragsfreiheit ist die Abstraktion, die Ausklammerung individueller Besonderheiten und sozialer, ökonomischer und historischer Kontexte.[23] Vielen Normen des allgemeinen Schuldrechts liegt noch heute eine formale Konzeption zugrunde. Gerade das allgemeine Schuldrecht abstrahiert häufig von den individuellen Merkmalen der Personen und reduziert sie auf ihre grundlegenden Eigenschaften als „Schuldner“ bzw „Gläubiger“. Das zeigt sich fast durchgängig an allgemein gehaltenen Schuldrechtsnormen, beispielsweise gleich bei § 241: Für diese Norm scheinen wirtschaftliche Machtrelationen, Informationsgefälle und ähnliches irrelevant zu bleiben.
12
Dem allgemeinen Schuldrecht liegt oft aber auch die Konzeption material verstandener Vertragsfreiheit zugrunde.[24] Materielle Elemente gehen über die formale Freiheit hinaus: Vertragsfreiheit wird vielmehr mit verschiedenen Inhalten aufgefüllt: Danach dient die Vertragsfreiheit verschiedenen Zwecken wie der Erzielung eines gerechten Austausches zwischen den Beteiligten, die in Solidarität kooperieren. Material verstandene Vertragsfreiheit berücksichtigt auch die ökonomischen, sozialen und politischen Kontexte. Das zeigt sich etwa dann, wenn Aufklärungspflichten zum Schutz unterlegener Bevölkerungsschichten angenommen werden[25] und natürlich deutlich im Verbraucherrecht: Die Vertragsinhalte – jenseits der Hauptleistungspflichten („Ware gegen Geld“) – werden dort weitgehend von Regeln bestimmt, die zugunsten der Verbraucher zwingend sind.[26] Die materiellen Elemente des Schuldrechts sind nach Inkrafttreten des BGB zunächst vor allem in der Rechtsprechung entwickelt worden.[27] Im Laufe der Zeit kamen sie immer klarer auch in gesetzlichen Regeln zum Ausdruck. Seit den 1970er Jahren steht diese Entwicklung im Zeichen des europäischen Rechts: Der europäische Gerichtshof und der europäische Gesetzgeber treiben die Materialisierung des Schuldrechts immer weiter voran.[28] Viele schuldrechtliche Normen berücksichtigen Ungleichgewichtslagen und soziale, ökonomische und gesellschaftliche Kontexte, in denen Verträge geschlossen werden.[29] Das entspricht der Gerechtigkeitsperspektive der Verteilungsgerechtigkeit.[30] Materiell verstandene Vertragsfreiheit ist ein Funktionselement der Gerechtigkeit. Die Grenzen der Vertragsfreiheit sichern in diesem Verständnis nicht bloß die Bedingungen der Möglichkeit von Vertragsfreiheit. Vielmehr verfolgen sie eigenständige Gerechtigkeitsanliegen.
3.Der gesetzliche Rahmen der Vertragsfreiheit im BGB
13
Die Vertragsfreiheit wird im BGB nur innerhalb der gesetzlichen Vorgaben gewährt. Dazu gehören beispielsweise Formvorschriften, deren Missachtung in der Regel zur Nichtigkeit der Verträge führt (vgl § 125).[31] Weitere wichtige Rahmenbedingungen ergeben sich aus den §§ 134, 138 und 242. Allgemeine Geschäftsbedingungen unterliegen zudem einer weitgehenden Kontrolle nach den §§ 305 ff. Im Bereich des Verbrauchervertragsrechts, in dem die regulative Perspektive klar im Vordergrund steht, ist die Vertragsinhaltsfreiheit jenseits der Hauptleistungspflichten nahezu bedeutungslos.[32] Ähnliches gilt für das Arbeitsvertragsrecht und das Wohnraummietrecht. Viele weitere Voraussetzungen der Vertragsfreiheit sind im besonderen Schuldrecht zu finden. So ist die Vertragsinhaltsfreiheit im Kaufrecht etwa durch Regelungen zu Gewährleistungsausschlüssen schwach ausgeprägt (vgl etwa §§ 444, 476). Dazu treten viele weitere Rahmenbedingungen in Spezialgesetzen, wie etwa der Gebührenordnung für Ärzte, die Preise nur in sehr engen Grenzen frei vereinbaren können. Im Gemeinwohlinteresse bestehen außerdem zahlreiche Kontrahierungszwänge, die die negative Vertragsfreiheit ausschließen.[33]
14
Man kann die gesetzlichen Rahmenbedingungen der Vertragsfreiheit auch als „Grenzen der Vertragsfreiheit“ oder „Schranken der Vertragsfreiheit“ bezeichnen. Das ist eine durchaus übliche Terminologie.[34]Rhetorisch rufen die Bilder von „Grenzen“ und „Schranken“ freilich Assoziationen hervor, aus denen sich eine Rechtfertigungslast ergibt. Das ist durchaus gewollt: Gesetzliche Rahmenbedingungen der Vertragsfreiheit werden als rechtfertigungsbedürftiger „Eingriff“ in die Vertragsfreiheit „als solche“ gesehen. Analytisch ist das Bild jedoch irreführend: Denn die Rahmenbedingungen der Vertragsfreiheit sind kein Eingriff in eine abstrakte Freiheit „als solche“, die zuvor unberührt bestand. Sie verteilen vielmehr spezifische Freiheitsbefugnisse. Die Vertragsfreiheit als Prinzip sagt nichts über konkrete einzelne Befugnisse aus, die das Recht uns zuschreibt und denen logisch zwingend korrelierende Pflichten gegenüberstehen. Das Recht verteilt diese Befugnisse, so dass manchem mehr, manchem weniger Handlungsspielräume zukommen. Das zeigen Kontrahierungszwänge deutlich, die sich regelmäßig nur an eine bestimmte Personengruppe richten und damit spezielle Akteure im Wirtschaftsleben in den Blick nehmen. So verpflichtet das AGG die Clubbetreiberin, Menschen nicht wegen ihrer Hautfarbe von der Tür zu weisen.[35] Darin liegt eine Einschränkung der Freiheitsbefugnisse der Clubbetreiberin. Zugleich – und logisch zwingend – werden damit Freiheitsbefugnisse auf Seiten der betroffenen Menschen erhöht. Freiheitsaspekte werden durch die Regeln, innerhalb derer die Vertragsfreiheit wirkt, also immer (und fortlaufend) neu verteilt. Die entscheidende Frage ist stets, welche spezifischen Freiheitsbefugnisse begrenzt werden sollen oder nicht. Konkrete Antworten auf diese Fragen werden im politischen und juristischen Diskurs gegeben.
4.Praktische Bedeutung der Vertragsfreiheit
15
Die Bedeutung der Vertragsfreiheit in der rechtlichen Praxis darf nicht überschätzt werden. Ihre Erklärungskraft für konkrete Rechte und Pflichten ist in der Praxis der Rechtsanwendung eher gering. Oft ist es auch schwierig, den vertraglich vereinbarten Willen zu ermitteln. Vertragsvereinbarungen sind oft lückenhaft oder unklar. Wenn der Vertragsinhalt durch (einfache) Auslegung nach §§ 133, 157





























