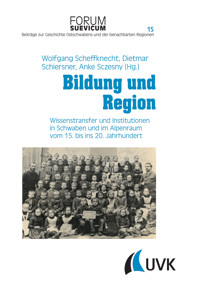
Bildung und Region E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: UVK
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Forum Suevicum
- Sprache: Deutsch
Die Beiträge des Bandes nähern sich der Bildungsgeschichte aus regionalhistorischer Perspektive: Inwiefern und wie stehen Räume einerseits und Bildungsinhalte, -institutionen und -transfer andererseits in einer sich gegenseitig erhellenden Verbindung? Untersuchungsraum ist vor allem Oberschwaben und der benachbarte Alpenraum (Tirol, Vorarlberg, St. Gallen) von der Frühen Neuzeit bis ins 20. Jahrhundert. Der Bildungsbegriff ist weit gefasst und reicht von der schulischen Ausbildung bis zur Selbstbildung. Ein Schwerpunkt liegt auf der Untersuchung von Institutionen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 809
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
FORUM SUEVICUMBeiträge zur Geschichte Ostschwabens und der benachbarten Regionen
HerausgegebenvonDietmar Schiersnerim Auftrag des Memminger Forums für schwäbische Regionalgeschichte e.V.
Band 15
FORUM SUEVICUMBeiträge zur Geschichte Ostschwabens und der benachbarten Regionen
Band 15
Bildung und Region
Wissenstransfer und Institutionen in Schwaben und imAlpenraum vom 15. bis ins 20. Jahrhundert
Herausgegeben vonWolfgang Scheffknecht, Dietmar Schiersner und Anke Sczesny
Einbandmotiv: MAG Zusmarshausen, Schulklasse 1897.
Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
Dieser Band wurde veröffentlicht mit freundlicher Unterstützung der Stadt Memmingen, der Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindelheim, der Bezirk-Schwaben-Stiftung für Kultur und Bildung und des Zentrums für Regionalforschung der Pädagogischen Hochschule Weingarten.
DOI: https://doi.org/10.24053/9783381114924
© UVK Verlag 2023
– ein Unternehmen der Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KG
Dischingerweg 5 · D-72070 Tübingen
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Alle Informationen in diesem Buch wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Fehler können dennoch nicht völlig ausgeschlossen werden. Weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen übernehmen deshalb eine Gewährleistung für die Korrektheit des Inhaltes und haften nicht für fehlerhafte Angaben und deren Folgen. Diese Publikation enthält gegebenenfalls Links zu externen Inhalten Dritter, auf die weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen Einfluss haben. Für die Inhalte der verlinkten Seiten sind stets die jeweiligen Anbieter oder Betreibenden der Seiten verantwortlich.
Internet: www.narr.de
eMail: [email protected]
Lektorat und Layout: Angela Schlenkrich, Augsburg
ISSN 1431-9993
ISBN 978-3-381-11491-7 (Print)
ISBN 978-3-381-11493-1 (ePub)
Vorwort
Die 18. Tagung des ›Memminger Forums für schwäbische Regionalgeschichte e. V.‹ widmete sich vom 18. bis 20. November 2022 dem Thema ›Bildung und Region. Wissenstransfer und Institutionen in Schwaben und im Alpenraum vom 15. bis ins 20. Jahrhundert‹. Ein Jahr später als ursprünglich geplant – die pandemiebedingten Gründe dafür sind sattsam bekannt – kamen im Memminger Rathaus Referentinnen und Referenten aus dem bayerischen und dem württembergischen Schwaben, aus Tirol, Vorarlberg und St. Gallen zusammen, stellten ihre Forschungen dem interessierten Publikum vor und luden zur Diskussion ihrer Thesen ein. Bewusst hatten sich die Veranstalter gegen eine virtuelle oder hybride Veranstaltungsalternative im Jahr 2021 ausgesprochen, zählt doch der Ort der Zusammenkunft, das Memminger Rathaus mit seiner spürbar reichsstädtischen Aura, zu den unverzichtbaren Konstituenten der Forumstagungen. Für eine historische Vereinigung, die sich von Anfang an mit der Bedeutung des Raumes für die Geschichte auseinandersetzt, scheint das nur konsequent, denn ein Rathaus ist auch Ort von Information und Wissensvermittlung, von Debatte und Öffentlichkeit. Im Memminger Rathaus trafen Gesandte anderer Reichsstädte und umliegender Herrschaften ein; städtische Bürger und bäuerliche Untertanen führte ihr Weg ebenso hierher wie Geistliche, Kaufleute oder Adlige aus Stadt und Umland: An solch einem Ort werden regionale Vernetzung und Austausch über Grenzen hinweg beispielhaft sichtbar und erfahrbar.
Dort tagen zu dürfen ist deswegen ein Privileg, für das wir der Stadt Memmingen, ihrem seinerzeitigen Oberbürgermeister Manfred Schilder und dem Stadtrat zu besonderem Dank verpflichtet sind. Nicht weniger danken wir der Stadt Memmingen für deren überaus großzügige Förderung bei der Drucklegung unseres Tagungsbandes sowie der Bezirk-Schwaben-Stiftung für Kultur und Bildung. Unterstützung gewährte zudem dankenswerterweise auch für den vorliegenden 15. Band der Reihe ›Forum Suevicum‹ wiederum die Sparkasse Schwaben-Bodensee.
Für inhaltlich wertvolle Anregungen ebenso wie für personelle Unterstützung dankt das Memminger Forum dem ›Zentrum für Regionalforschung (ZeReF)‹ der Pädagogischen Hochschule Weingarten als einem für Fragen der Bildung prädestinierten Kooperationspartner. Allen Autorinnen und Autoren gilt für diesen Band ein besonderer Dank für ihre Bereitschaft, sich bei der Verschriftlichung ihrer Vorträge einer diesmal sehr rigiden Zeitdisziplin zu unterwerfen, damit der Tagungsband im gewohnten Turnus erscheinen konnte. Nicht weniger zu danken ist auch deswegen unserer Lektorin Angela Schlenkrich M. A., die selbst unter enormem Zeitdruck mit gewohnter Zuverlässigkeit und Akribie zu Werke ging. Stefan Selbmann vom UVK-Verlag und dem Memminger MedienCentrum danken wir für die verlegerische Betreuung und den Druck dieses Buches.
In gesellschaftlichen Debatten, politischen Vorgaben und administrativen Vorgängen wird heute alles, was mit Ausbildung und Bildung zu tun hat, in einem atemraubenden Tempo traktiert. Die Grenze zur Absurdität ist längst überschritten, wenn neue Reformen auferlegt und gefordert werden, noch ehe vorangehende Neuordnungen wirksam werden konnten. Möge die Auseinandersetzung mit historischen Facetten und Dimensionen des Themas zum Nachdenken und zur Nachdenklichkeit anregen.
Lustenau, Weingarten und Augsburgim September 2023
Wolfgang Scheffknecht,Dietmar Schiersner und Anke Sczesny
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
WOLFGANG SCHEFFKNECHT/DIETMAR SCHIERSNER/ANKE SCZESNY
Einführung
I. Stadt und Land
STEFAN SONDEREGGER
Schreiben, Rechnen, Buch führen. Handlungswissen als Schlüssel zum beruflichen Erfolg in einer internationalen Handelsstadt. St. Gallen im Übergang vom Mittelalter in die Frühe Neuzeit
NICOLE STADELMANN
Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Die vielfachen Möglichkeiten einer handwerklichen Ausbildung in St. Gallen
LOTHAR SCHILLING
Periodika als Medien der Vermittlung ökonomischen Wissens im südlichen Reich im 18. Jahrhundert
REGINA DAUSER
Realienkunde für künftige Handwerker? Zum Augsburger Schulwesen im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts
ANKE SCZESNY
Das ländliche Volksschulwesen in Schwaben am Beispiel des Bezirksamtes Zusmarshausen (1802–1871)
ERICH MÜLLER-GAEBELE
Das Schulhaus als Gegenstand bildungshistorischer Forschung. Beispiele aus Oberschwaben
GERHARD HETZER
Mundart und Hochsprache in Volksschulen des 19. Jahrhunderts. Spannungsbögen und Ausgleichsversuche
STEFFEN KAISER
Von Ackerbau- und Winterschulen. Die Entwicklung des landwirtschaftlichen Schulwesens im Königreich Württemberg 1818–1914
II. Religion und Konfession
WOLFGANG SCHEFFKNECHT
Universitätsbesuch und Seelsorge. Rekrutierung und Ausbildung von Priestern im frühneuzeitlichen Vorarlberg
DIETMAR SCHIERSNER
Humanismus und Konfessionalisierung. Die Lateinschulstiftung und Schulordnung Anton Fuggers in Babenhausen (1554). Einführung – Edition – Übersetzung
BARBARA RAJKAY
Familie, nicht Kloster. Evangelische Mädchenbildung in Augsburg
MARIELUISE KLIEGEL
Übe früh dich hauszuhalten. Die Vermittlung textiler Alltagskompetenzen in der Mädchen- und Lehrerinnenbildung
THOMAS ALBRICH
Über die Anfänge der Deutschen Schule bey der Judenschaft in Hohenems vor 1814
CLAUDIA RIED
Ein staatliches Erfolgsmodell? Jüdisches Schul- und Bildungswesen in bayerisch-schwäbischen Landgemeinden während der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts
DOMINIK BURKARD
Kirchenpolitische Implikationen der württembergischen Schulpolitik der NS-Zeit zwischen zeitgenössischer Wahrnehmung und revisionistischem Rückblick
Autorenverzeichnis
Nachweis der Abbildungen
Abkürzungsverzeichnis
AA
Altes Archiv (Bestand: StadtA SG)
AD 57
Archives départementales de la Moselle
ADB
Allgemeine Deutsche Biographie
ÄA
Ämterarchiv (Bestand: StadtA SG)
AIZ
Augspurgischer Intelligenz-Zettel
Art.
Artikel
AWT
Archiv des Wilhelmsstifts Tübingen
BA
Bezirksamt
BayHStA
Bayerisches Hauptstaatsarchiv
BBKL
Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon
BR
Bürgerregister (Bestand: StadtA SG)
BSB
Bayerische Staatsbibliothek München
BVP
Bayerische Volkspartei
CGM
Codex Germanicus Monacensis
CIB/MIB
Churbaierisches Intelligenzblatt/Münchner Intelligenzblatt (ab 1777)
DA
Diözesanarchiv
DNVP
Deutschnationale Volkspartei
Ev.-Luth. KA
Evangelisch-Lutherisches Kirchenarchiv
EWA
Evangelisches Wesensarchiv
FA
Fürstlich und Gräflich Fuggersches Familien- und Stiftungsarchiv
FAZ
Frankfurter Allgemeine Zeitung
fl.
Gulden
FS
Festschrift
GemA
Gemeindearchiv
gen.
genannt
ha
Hektar
HStA
Hauptstaatsarchiv
k. b.
königlich bayerisch
kr.
Kreuzer
LGäO
Landgericht älterer Ordnung
MInn
Ministerium des Innern
MK
Ministerium für Unterricht und Kultus
NDB
Neue Deutsche Biographie
NF
Neue Folge
NSDAP
Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei
OSB
Ordo Sancti Benedicti
OSF
Ordo Sancti Francisci
p.
pagina
PfarrA
Pfarrarchiv
r
recto
RM
Reichsmark
RP
Ratsprotokolle
SA
Sturmabteilung
SpA
Spitalarchiv
StA
Staatsarchiv
StadtA
Stadtarchiv
StadtA SG
Stadtarchiv der Ortsbürgergemeinde St. Gallen
TH
Technische Hochschule
UA
Universitätsarchiv
v
verso
VadSlg
Vadianische Sammlung der Ortsbürgergemeinde St. Gallen
VD 16
Verzeichnis der im deutschen Sprachgebiet erschienenen Drucke des 16. Jahrhunderts der Bayerischen Staatsbibliothek [analog VD 17, VD 18]
Veröff.
Veröffentlichung(en)
Veröff. SFG
Veröffentlichungen der Schwäbischen Forschungsgemeinschaft e. V.
VLA
Vorarlberger Landesarchiv
VP
Verordnetenprotokolle (Bestand: StadtA SG)
WJB
Württembergische Jahrbücher für Statistik und Landeskunde
ZBLG
Zeitschrift für bayerische Landesgeschichte
ZHVS
Zeitschrift des Historischen Vereins für Schwaben
ZWLG
Zeitschrift für Württembergische Landesgeschichte
WOLFGANG SCHEFFKNECHT/DIETMAR SCHIERSNER/ANKE SCZESNY
Einführung
Das Feld der Bildungsgeschichte ist weit; sie wird, von der Philosophie über die Pädagogik und Soziologie bis hin zu den Geschichtswissenschaften, von verschiedenen Disziplinen mit unterschiedlichen Methoden und Erkenntnisinteressen beleuchtet. In den Erziehungswissenschaften hat sich in den letzten Jahrzehnten ein eigener disziplinärer Schwerpunkt unter dem Begriff der ›Historischen Bildungsforschung‹ entwickelt. Das jüngst, 2021, erschienene Handbuch ›Historische Bildungsforschung‹1 macht den Stand der deutschen und zum Teil internationalen Forschung, geordnet nach Konzepten, Methoden und Forschungsfeldern, komprimiert zugänglich. Der zeitliche Schwerpunkt liegt auf dem 18. bis 20. Jahrhundert. Die Leitperspektive auf den Gegenstand ist erziehungswissenschaftlich – nur zwei der 36 Autorinnen und Autoren sind Historiker. Behandelt werden sowohl das im engeren Sinne pädagogische Feld von Bildungssystem, Erziehungs- und Fürsorgeeinrichtungen als auch die historischen Verhältnisse von Bildung und Gesellschaft insgesamt, kollektive und individuelle Prozesse der Persönlichkeitsentwicklung in ihren institutionellen und nicht-institutionellen Kontexten. Historische Bildungsforschung sieht sich demnach als historische Sozialisations- und Institutionenforschung (von der Familie über die Schule und Universität bis zu den Peer Groups), als Professionsforschung zu pädagogischen Tätigkeiten und als Untersuchung der Lebensphasen von Kindheit, Jugend und Erwachsenenalter im historischen Wandel. Zu dem noch bis vor kurzem als ›Geschichte der Pädagogik‹ gelehrten Teilfach zählt darüber hinaus die Beschäftigung mit historischen pädagogischen Debatten, Programmatiken und Denkformen.
Das klingt nun sehr umfassend, und es stellt sich die Frage, was vor dem Hintergrund dieser Konzeption der Beitrag eines allgemeinhistorischen Zugangs zur Bildungsgeschichte sein kann. Es scheint, vergröbernd gesagt, den Erziehungswissenschaften diene der geschichtliche Kontext primär zur Erhellung von ›Bildung‹ und der mit ihr verbundenen Aspekte, während die Geschichtswissenschaft bei ihrer Frage nach Bildungszusammenhängen vorzugsweise auf historische Erkenntnisse in anderen Bereichen oder auf anderen Ebenen abziele. Tendiert deswegen die Historische Bildungsforschung dazu, mit einem eher normativen Bildungsbegriff und einem auf die Gegenwart hin teleologisch ausgerichteten Bildungsverständnis zu operieren, so fällt in der geschichtswissenschaftlichen Herangehensweise eine gewisse Unreflektiertheit oder – will man es positiv sehen – Offenheit des Bildungsbegriffes auf. Auch unter den Überschriften der Beiträge dieses Sammelbandes ist ja eine Vielzahl an Begriffen von ›Bildung‹ über ›Wissen‹ und ›Kunde‹ bis hin zu ›Ausbildung‹ und ›Kompetenzen‹ vertreten. Um den disziplinären Unterschied an einem Beispiel zu verdeutlichen: Die bildungsgeschichtliche Frage etwa nach der »Bedeutung staatlichen Handelns für den Gang der Schulentwicklung«2 würde aus allgemeinhistorischer Perspektive wohl umgekehrt formuliert, weil diese sich aus der Analyse von Schulgeschichte und der mit ihr verbundenen Institutionalisierungsund Professionalisierungsvorgänge z. B. Aufschluss über den Prozess staatlicher Machtakkumulation verspricht. Schulpflicht lässt sich eben, um es griffiger zu formulieren, nicht nur als Innovation zugunsten von Bildung, sondern auch als Repression zugunsten des Staates, als Beitrag zu Staatsbildung und intensivierter Staatlichkeit, beschreiben. Tendenziell also ist ›Bildung‹ dasZ i e ldes erziehungswissenschaftlichen, aber eher einem e t h o d i s c h eS o n d edes historischen Zugriffs auf freilich häufig dieselben Themen. Das stark von der Aufklärung geprägte Selbstverständnis der Pädagogik macht deren epochale Schwerpunktsetzung auf die Zeit seit dem 18. Jahrhundert plausibel, während Phänomene von Bildung im Mittelalter oder in der Antike eher von Historikern untersucht werden.
Der auf unserer Tagung praktizierte regionale Ansatz wiederum bringt in die Auseinandersetzung mit bildungsgeschichtlichen Themen speziell das Interesse am Raum ein. Die programmatische Beachtung räumlicher Zusammenhänge drängt sich im Falle der Bildungsgeschichte sogar in besonderer Weise auf. Denn die organisierte Vermittlung von Lesen, Schreiben und Rechnen ebenso wie die der darauf aufbauenden Kenntnisse und Fertigkeiten ist zunächst in den Anwesenheitsgesellschaften der Vormoderne notwendigerweisel o k a l i s i e r t ,geschieht also an konkreten Orten, von der Schul- oder Kirchenbank über das Schulhaus bis hin zu Seminar und Hörsaal, und wird organisiert in Klöstern, Städten und Ländern – ein Zusammenhang, der auch das Interesse der Architektur- und Baugeschichte weckt. Beispielhaft dafür kann eine vor kurzem publizierte Dissertation über Basler Schulhausbauten von 1845 bis 2015 im schweizerischen und internationalen Kontext stehen, in der Ernst Spycher der raumgeschichtlich zentralen Frage nachgeht: »Wie beeinflussen Reformen Formen?«3
Institutionalisierung von Bildung und Urbanisierung oder Territorialisierung gehören spätestens seit dem späten Mittelalter zusammen und erfahren reformations- und konfessionalisierungsbedingt eine deutliche Intensivierung. Bildungsvorgänge gehen mit Raumprägungen einher und besitzen gleichsam regiogenetische Potenz, so dass etwa von ›Schullandschaften‹ gesprochen werden kann, wie dies Helmut Flachenecker und Rolf Kießling 2005 in einem Altbayern, Franken und Schwaben vergleichenden Tagungsband taten.4 Als wichtigste Triebfeder für die von inhaltlicher wie räumlicher Expansion und Differenzierung gekennzeichnete Entwicklung des Bildungswesens in der Frühen Neuzeit erwies sich hierbei die Konfessionalisierung. In einer von konfessionellen und herrschaftlichen Gemengelagen in so beispielhafter Weise charakterisierten Landschaft wie Ostschwaben wirkte sich dieser Umstand deutlich erkennbar im Sinne fruchtbarer Konkurrenz aus. Parallel zur Territorialisierung der gymnasialen und universitären Bildung – verwiesen sei auf den neu entstehenden Typus der ›Landesuniversität‹ –, die durchaus Aspekte regionaler Engführung, ja Provinzialisierung erkennen lässt, entwickelten sich jedoch auch neue Verbindungen und Zusammenhänge von bisweilen geradezu globaler Dimension, denkt man etwa an den Austausch unter Universitäten und Akademien in den protestantischen Teilen des Reichs und im (lutherischen) Skandinavien oder an das weltweite Wirken des Jesuitenordens, der seine Lehre über nahezu zwei Jahrhunderte hinweg allerorten an der ›Ratio studiorum‹ ausrichtete.
Der räumlichen Konzentration und Abgrenzung nach außen standen und stehen also zugleich immer grenzüberschreitende, integrierende Aspekte der Bildung gegenüber, unmittelbar verständlich, sofern es deren Inhalte betrifft, deutlich auch bei den personellen Austauschprozessen, aber ebenso bei der Herausbildung und Frequenz von Institutionen, wie dies freilich schon der mittelalterliche Universitätsbesuch demonstriert. Diese Transfervorgänge negieren keineswegs die Räumlichkeit von Bildung, sie erfassen vielmehr die Bewegung im Raum. Auch die seit dem ausgehenden 15. Jahrhundert wachsende, nach dem Dreißigjährigen Krieg nochmals erheblich gesteigerte und dabei inhaltlich seit dem 18. Jahrhundert zunehmend diversifizierte Medialisierung von Wissen in Büchern, Kleinschriften, Journalen und Zeitungen, aber auch Briefen ist dieser räumlichen Metaebene zuzuweisen.
In diesem hier nur knapp skizzierten Kontext stehen die Beiträge des vorliegenden Tagungsbandes. Sie legen den Fokus ebenfalls auf die Fragestellung, inwiefern, wie, wo und warum räumliche Spezifika einerseits und Bildungsinhalte, -institutionen und -transfer andererseits in einer sich gegenseitig erhellenden Verbindung stehen. Untersuchungsraum ist vor allem Oberschwaben und der benachbarte Alpenraum (Tirol, Vorarlberg, St. Gallen) von der Frühen Neuzeit bis ins 20. Jahrhundert. Der Bildungsbegriff selbst wird nicht vorab definiert; er wird weit gefasst und reicht von der schulischen ›Ausbildung‹ bis zur durch Buchbesitz und Lektüre initiierten ›Selbstbildung‹. Aus Gründen der Überlieferung, aber auch um der strukturellen Vergleichbarkeit willen liegt dabei ein Schwerpunkt auf der Untersuchung von Institutionen, ein anderer auf dem Wissenstransfer im Bereich der Agrarwissenschaften sowie der Handwerker- bzw. Berufsausbildung. Die 15 Beiträge dieses Bandes sind in zwei Sektionen gegliedert, die sich an den beiden beschriebenen, für Schwaben und dessen benachbarte Regionen zentralen Strukturmerkmalen orientieren: dem Spannungsverhältnis zwischen Stadt und Land und den – davon teils mitbedingten – konfessionellen bzw. religiösen Grenzziehungen und Abgrenzungen zwischen Juden und Christen, Katholiken und Protestanten. Zwei Beiträge richten darüber hinaus den Blick speziell auf geschlechterspezifische Aspekte.
In der auf Besonderheiten und Beziehungen von ›Stadt und Land‹ konzentrierten Sektion I befasst sich eingangs STEFAN SONDEREGGER mit der Bedeutung von Handlungswissen für die berufliche Laufbahn im spätmittelalterlichen bzw. frühneuzeitlichen St. Gallen. In St. Gallen, seit dem Spätmittelalter Zentrum der Textilproduktion und des -handels, stießen Kenntnisse aus Wirtschaft, Recht und Verwaltung sowie Fertigkeiten auf herausgehobenes Interesse, die im beruflichen und administrativen Alltag des 14. und 15. Jahrhunderts besonders gebraucht wurden. Ebenfalls mit St. Gallen beschäftigt sich NICOLE STADELMANN, die jene Handwerkslehrlinge aus der Stadt in den Blick nimmt, die im 17. und 18. Jahrhundert ihre Ausbildung auf dem Land absolvierten, um sich so die nicht unerheblichen Ausbildungsgebühren bei den zünftischen Meistern in der Stadt zu sparen. Die Möglichkeit, sowohl in der Stadt als auch auf dem Land ein Handwerk zu erlernen, führte zur Entwicklung und Entfaltung eines breiten Spektrums an Ausbildungsorten für die Stadtsanktgaller Lehrlinge.
Periodika als Medien der Vermittlung ökonomischen Wissens in Süddeutschland im 18. Jahrhundert sind – so LOTHAR SCHILLING in seinem Beitrag – bislang noch wenig erforscht, obgleich sie eine wichtige Funktion für die Wissensvermittlung auch und vor allem an Erwachsene abseits der urbanen Zentren übernahmen. Sowohl die quantitative Auswertung ökonomischen Wissens in verschiedenen Periodika, wie Kalendern, gelehrten Schriften und Intelligenzblättern, als auch die Beschäftigung mit typischen Gattungen und deren Inhalten lassen jedoch den – vorläufigen – Schluss zu, dass sich Periodika im bayerisch-schwäbischen Raum weniger als anderswo mit konkreten Innovationen und Experimenten befassten und weniger lokal spezifisches Wissen weitergaben. Die Erforschung der Periodika in unserem Raum, darauf weist Schilling eindringlich hin, steckt dabei noch ganz in den Anfängen.
REGINA DAUSER zeigt am Beispiel des evangelischen Gymnasiums bei St. Anna in Augsburg auf, wie schwierig sich der Umbau einer auf den Universitätsbesuch vorbereitenden Ausbildungsstätte zu einer Stadt- oder Bürgerschule gestaltete. Hinter dem Versuch der Schaffung einer ›Real‹-Schule in den 1760er bis 1790er Jahren stand das reformerische Bemühen, künftigen Handwerkern und Kaufleuten eine breite, auch gewerbliche Basisbildung angedeihen zu lassen. Eingebettet in den zeitgenössischen Diskurs über Bildungsreformen, ließen sich die Anstrengungen aus vielerlei Gründen jedoch nur begrenzt umsetzen. Langfristig indes mündete das Aufbrechen herkömmlicher Schulstrukturen dann doch in den Aufbau von Bürgerschulen.
Während sich die genannten Beiträge stark auf wirtschaftlich-ökonomische Wissensvermittlung konzentrieren, gehen die folgenden intensiv auf das noch wenig erforschte allgemeinbildende Volksschulwesen im ländlichen Bereich ein. ANKE SCZESNY tut dies am Beispiel des schwäbischen Bezirksamtes Zusmarshausen im 19. Jahrhundert. Neben der Organisation des Schulwesens sowie der nicht unproblematischen Durchsetzung der Schulpflicht auf dem Land wird der Blick auf die Lehrerausbildung gelenkt, deren Qualität sich in der Wissensvermittlung an die Kinder niederschlagen sollte. Dass auch Klassenräume und Schulgebäude Einfluss auf das Lernverhalten der Kinder hatten, wird hier nur angedeutet, während sich der folgende Beitrag von ERICH MÜLLER-GAEBELE explizit mit der Entwicklung und den Veränderungen des Schulgebäudebaus vom 19. Jahrhundert bis hinein in die Gegenwart in Oberschwaben auseinandersetzt. Er veranschaulicht die zugleich bildungspolitische wie dörflich-soziale Dimension der Schule am Ort, aus deren Funktionsverlust oder gar Verschwinden sich gravierende Folgen für die Identität des ländlichen Raums ergeben haben und weiter ergeben werden.
GERHARD HETZER widmet sich Mundart und Hochsprache in den Volksschulen des 19. Jahrhunderts. Er führt aus, wie zunächst in den Lehrplänen und durch Lehrmittel die Abgrenzung der beiden Sprecharten erfolgte und Gelehrte wie Theodor Friedrich Niethammer oder Joseph Wiesmayr und zahlreiche andere um die richtige Vermittlung rangen. Letztlich setzte sich, parallel zur Formierung des Nationalstaates und der sukzessive fortschreitenden Normierung in Politik und Gesellschaft, der Unterricht des Hochdeutschen durch.
Eine spezifische Lehranstalt bzw. Schule stellt STEFFEN KAISER mit den Ackerbauschulen im Königreich Württemberg vor. Innovativ war hier die Schule in Hohenheim, die, ursprünglich für Waisen gedacht, finanzkräftigen Bauern- und Handwerkersöhnen eine dreijährige landwirtschaftliche Ausbildung ermöglichte und von der innerhalb kurzer Zeit weitere Schulgründungen angeregt wurden. Da nicht alle Bewerber über entsprechende Mittel verfügten, wich man für die ärmeren Schüler auf Winterschulen und abendliche Fortbildungskurse aus, was wiederum die Schultypen in Konkurrenz zueinander brachte.
WOLFGANG SCHEFFKNECHT leitet mit seinem Aufsatz zur Rekrutierung und Ausbildung von Priestern zu den Beiträgen in Sektion II über, die Aspekte von Religion und Konfession aufgreifen. Scheffknecht, der sich detailliert mit den Wegen der priesterlichen Ausbildung im frühneuzeitlichen Vorarlberg beschäftigt und sich den Kandidaten prosopographisch nähert, kann nicht nur klerikale Familientraditionen ermitteln, sondern auch regionale Netzwerke freilegen, die den angehenden Geistlichen systematisch Protektion gewährten. Familiale, kommunale und landesherrliche Förderung trugen entscheidend zum Fortkommen eines Priesters und zur Herausbildung von ›Priesterdynastien‹ bei.
Mit der Stiftung einer Lateinschule in der Fugger-Herrschaft Babenhausen 1554 stellt DIETMAR SCHIERSNER eine bemerkenswerte Bildungsinitiative aus humanistischer Tradition einerseits, aus dem Geist der sich entwickelnden katholischen Konfessionalisierung andererseits vor. Die im Gründungszusammenhang entstandene lateinische ›Institutio scholastica‹ wurde in der Forschung bislang nicht als außerordentlich frühes Beispiel einer Schulordnung katholischer Provenienz erkannt und gewürdigt. Stiftungsurkunde sowie Schulordnung werden hier deswegen in einer kommentierten Edition samt Übersetzung zugänglich gemacht.
Der noch viel zu wenig erforschten Mädchenbildung wenden sich Barbara Rajkay und Marieluise Kliegel zu. Ein weiteres Mal in der ehemaligen Reichsstadt Augsburg bewegt sich der Beitrag von BARBARA RAJKAY mit ihrer Untersuchung über die Errichtung von Mädchenschulen seit dem 16. Jahrhundert, wobei einzelne, vor allem protestantische Bildungsanstalten im Fokus stehen. Dass die Lernziele für die Mädchen in öffentlichen Schulen denen der Knaben entsprachen, wird ebenso herausgearbeitet wie die Bedeutung des Lernortes Familie. Sie nahm erst mit der Errichtung höherer Töchterschulen im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts ab, die indes zunächst mit finanziellen Schwierigkeiten und ideologischen Vorbehalten zu kämpfen hatten.
Mit gänzlich anderen Quellen zur Mädchenbildung befasst sich MARIELUISE KLIEGEL. Sozusagen weibliche textile Bildungsorte im 19. und frühen 20. Jahrhundert sind ihre Untersuchungsräume; und auch sie thematisiert die Verlagerung der Ausbildung aus privat-familiären Kontexten in den Bereich öffentlich-gesellschaftlich definierter Mädchenbildung. Dass dabei die Aufgaben der Ehe- und Hausfrau bzw. Mutter sowie – gerade für ärmere Bildungsschichten – der sparsame Umgang mit Ressourcen zentrale Gegenstände waren, ist wenig überraschend. Nichtsdestoweniger sollten sich aus solchen Bildungszusammenhängen ebenfalls Anstöße zur späteren emanzipatorischen Frauenbewegung entwickeln.
Im gesamten Kanon schulischer Ausbildung und institutioneller Wissensvermittlung werden jüdische Bildungseinrichtungen immer noch nur am Rande thematisiert. THOMAS ALBRICH kann hier aufzeigen, dass die jüdische Gemeinde in Hohenems das Toleranzpatent von 1781 erstaunlich schnell umsetzte und schon seit 1785 einen jüdischen Lehrer vor Ort unterrichten ließ. Allerdings rangen die Lehrer mit finanziellen Schwierigkeiten und zurückgehenden Schülerzahlen, da sich die Schulpflicht in Vorarlberg nicht konsequent durchsetzen ließ und Privatlehrer zu Lasten der öffentlichen Schulen an Attraktivität gewannen. Albrich zeichnet das Problemfeld anhand der Biographie des jüdischen Lehrers Lazar Levi detailliert nach.
CLAUDIA RIED nimmt, zeitlich daran anknüpfend, die bayerisch-schwäbischen Judengemeinden in den Blick, und zwar unter dem Vorzeichen des Bayerischen Judenedikts von 1813, das die jüdischen Akteure vor Ort vor die Aufgabe stellte, Elementarschulen zu gründen und die daraus resultierenden Auseinandersetzungen mit den christlichen Schulen zu bewältigen. Differenziert fragt sie nach den Intentionen des Judenedikts im Hinblick auf das jüdische Elementarschulwesen und nach dessen Umsetzung in den ländlichen Gemeinden und kommt zu dem Schluss, dass keineswegs von einem »staatlichen Erfolgsmodell« gesprochen werden könne.5
Der Aufsatz von DOMINIK BURKARD schließt die Sektion mit einer Analyse der württembergischen Schulpolitik in der Zeit des Nationalsozialismus nicht nur thematisch, sondern auch chronologisch ab. Vor dem Hintergrund des Spannungsfeldes von Kirche und Regime analysiert er anhand der ›Erinnerungen und Betrachtungen‹ des ehemaligen württembergischen Kultministers Christian Mergenthaler, einer retrospektiven und rechtfertigenden Schrift, und der Protestschreiben des Bischöflichen Ordinariats zwischen 1933 und 1945 gegen die Eingriffe in das kirchliche Schulsystem, die Schrittmacherfunktion Württembergs bei der Durchsetzung nationalsozialistischer Bildungspolitik ebenso wie die letztlich erfolglosen Versuche der Kirchenleitung, die Konfessionsschulen beizubehalten, um weiterhin christlichreligiöse Werte zu vermitteln.
1GERHARD KLUCHERT u. a. (Hg.), Historische Bildungsforschung. Konzepte – Methoden – Forschungsfelder, Bad Heilbrunn 2021.
2GERHARD KLUCHERT/RÜDIGER LOEFFELMAIER, Schule, in: G. KLUCHERT u. a. (Hg.), Historische Bildungsforschung (Anm. 1), S. 232–254, hier 242.
3ERNST SPYCHER, Bauten für die Bildung. Die Entwicklung der Basler Schulhausbauten im nationalen und internationalen Kontext, Basel 2019. Vgl. den Aufsatz von ERICH MÜLLER-GAEBELE im vorliegenden Tagungsband.
4HELMUT FLACHENECKER/ROLF KIESSLING (Hg.), Schullandschaften in Altbayern, Franken und Schwaben. Untersuchungen zur Ausbreitung und Typologie des Bildungswesens in Spätmittelalter und Früher Neuzeit (ZBLG 26), München 2005.
5CLAUDIA RIED in diesem Band, S. 407.
I. Stadt und Land
STEFAN SONDEREGGER
Schreiben, Rechnen, Buch führen. Handlungswissen als Schlüssel zum beruflichen Erfolg in einer internationalen Handelsstadt. St. Gallen im Übergang vom Mittelalter in die Frühe Neuzeit
Eine Methode, um Bildung in einer spätmittelalterlichen Stadt zu untersuchen, besteht in der Interpretation ihres schriftlichen Nachlasses. Im Falle St. Gallens ist dies besonders reizvoll. Beim mittelalterlichen St. Gallen kommt einem vor allem die Stiftsbibliothek mit ihren Büchern des frühen und hohen Mittelalters, die den Kern des UNESCO-Welterbes bilden, in den Sinn. Schriftlichkeit auf dieser Ebene ist Bildungswissen; Litterati aus Klöstern haben die dort überlieferten Bücher geschrieben und abgeschrieben. Zu dieser frühmittelalterlichen Entstehung und Weitervermittlung von Gelehrtenwissen kam im Hoch- und Spätmittelalter zunehmend eine andere Art von Wissen hinzu. Insbesondere mit der Entstehung und dem schnellen Wachstum von Städten seit dem 12. und 13. Jahrhundert wurden die Fähigkeiten, lesen, schreiben und rechnen zu können, im Lebensalltag immer wichtiger. Bildung in der städtischen Gesellschaft war verbunden mit der Ausbildung für die berufliche, administrative und politische Tätigkeit als Kaufmann, Handwerksfrau und -mann, Notar, Amtsinhaber und Ratsherr. Neben das gelehrte wissenschaftliche Wissen trat nun immer mehr das Handlungswissen. »Allmählich begann eine alte Gleichung an Wert zu verlieren, die für Jahrhunderte gegolten hatte: Der Litteratus war nicht mehr nur der Clericus und der Illiteratus nicht mehr nur der Laicus«.1
Im folgenden Beitrag werden Aspekte der Bildung in der städtischen Gesellschaft St. Gallens behandelt. Ausgehend von der Tatsache, dass die Stadt seit dem Spätmittelalter ein Zentrum der Textilproduktion und des -handels war, konzentrieren sich die Ausführungen auf die Bereiche Wirtschaft, Recht und Verwaltung. Von besonderem Interesse ist, welche spezifischen Fertigkeiten im beruflichen und administrativen Alltag des 14. und 15. Jahrhunderts gebraucht und wie diese vermittelt wurden. Informationen dazu finden sich in der sogenannten pragmatischen Schriftlichkeit, im vorliegenden Fall in Urkunden, Satzungen und Rechnungen. Es ist völlig unmöglich, einen die ganze Breite der Gesellschaft umfassenden Eindruck des Handlungswissens zu vermitteln. Die Untersuchung hat sich auf ausgewählte Akteure bzw. Akteursgruppen zu beschränken, die eine Funktion in der städtischen Administration und Politik sowie Wirtschaft hatten und zu denen deshalb schriftliche Informationen verfügbar sind. Hierzu werden Informationen zu Mandatsträgern wie Stadtschreibern und Ratsherren, die Aufgaben für die Stadt und städtische Institutionen erfüllten, ausgewertet.
1. St. Gallen
Einleitend soll kurz der Untersuchungsort vorgestellt werden.2 St. Gallen im Spätmittelalter bedeutete das enge Nebeneinander eines Reichsklosters und einer Reichsstadt. Das Kloster St. Gallen als herrschaftliches und kulturelles Zentrum der frühmittelalterlichen Bodenseeregion war schon früh ein Anziehungspunkt für Menschen, die sich in seiner Umgebung niederließen. Erste schriftliche Hinweise für eine langsam um die Abtei wachsende weltliche Siedlung finden sich für das 10. Jahrhundert. Im Laufe des 13., 14. und 15. Jahrhunderts gelang der Stadt St. Gallen, die bis in die 1450er-Jahre der Herrschaft des Klosters unterstand, die Emanzipation. Dies drückt sich beispielsweise in der ersten, auf deutsch geschriebenen sogenannten Handfeste von 1291 aus. Dabei handelt es sich um einen Ansatz städtischer Gesetzgebung mit der Definition des städtischen Hoheitsgebiets innerhalb von vier, auf alle Himmelsrichtungen verteilten Grenzkreuzen. Das war ein Gebiet von rund drei Kilometern von Osten nach Westen und zwei Kilometern von Norden nach Süden. Diese enge Begrenzung der Stadt innerhalb des äbtischen Territoriums sollte bis zur Auflösung des Klosters zu Beginn des 19. Jahrhunderts Bestand haben.
Dem Aufstieg der Stadt im 14. Jahrhundert stand eine eigentliche Krise des Klosters gegenüber. Die Schwäche des Klosters nutzte die erstarkende Stadt, um die bevorzugte Stellung einer Reichsstadt zu erlangen. Streng genommen hatte St. Gallen diese Position erst 1451 erreicht, weil ihr damals Friedrich III. neben der Maß- und Gewichtshoheit auch das Münzregal gewährte. Angesichts der bereits früher erlangten Freiheiten und der Verbindungen ins Reich kann St. Gallen aber schon ab der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts faktisch als Reichsstadt bezeichnet werden. Ausdruck der Reichszugehörigkeit sind Bündnisse mit anderen Reichsstädten seit 1312. Waren es anfänglich vier Partner (St. Gallen, Konstanz, Zürich und Schaffhausen), bestand der Schwäbische Städtebund in den 1380er-Jahren aus über 30 mehrheitlich deutschen Städten in einem Gebiet von Rothenburg ob der Tauber im Norden bis St. Gallen und Wil im Süden sowie Kaufbeuren im Osten bis Rottweil im Westen. Der Zweck dieser Städtebünde lag in der gegenseitigen Hilfeleistung bei Konflikten. Weiter stellten sie, modern gesprochen, Wirtschafts- und Rechtsabkommen dar. Bis kurz vor 1400 bestanden besonders enge Verbindungen St. Gallens zur Bischofsstadt Konstanz; von dieser hatte St. Gallen rechtliche und wirtschaftliche Regelungen übernommen.
1.1 Textilhandelszentrum seit Mitte des 15. Jahrhunderts
Die St. Galler und St. Gallerinnen lebten zu jener Zeit in einem territorial sehr engen, aber wirtschaftlich ungemein weiten Umfeld. Mit 3 bis 4.000 Bewohnern um 1500 war St. Gallen im europäischen Vergleich eine mittelgroße, geografisch hingegen eine kleine Stadt – aber mit einem internationalen Horizont, und dieser gründete auf der Wirtschaft. Die Herstellung von Leinentüchern war im Bodenseegebiet schon früh verbreitet, im ausgehenden Mittelalter erreichte St. Gallen die Spitzenposition im Handel und überflügelte damit Konstanz als zuvor führende Textilstadt im Bodenseegebiet. St. Gallens Handelsnetz reichte von Spanien bis Polen und von Norddeutschland bis Italien. Man beherrschte in St. Gallen Fremdsprachen, Auslandaufenthalte gehörten zur Karriere als Textilkaufmann.
1.2 Austausch über den Bodensee
Im Gegensatz zu heute bildeten Bodensee und Rhein bis ins 19. Jahrhundert keine Grenzen, sondern waren verbindende Transportwege. Kontakte über den See gehörten zum Alltag. Die engsten Beziehungen nach Süddeutschland bestanden im Bereich der Textilwirtschaft. Sowohl bei der Herstellung als auch im Vertrieb von Tuchen arbeiteten die Produktions- und Handelshäuser der Städte um den Bodensee zusammen. Es war beispielsweise verbreitet, Leinentücher aus Deutschland zur Veredelung nach St. Gallen zu bringen. Grund dafür war das hohe Ansehen, welches die St. Galler Qualitäts-Schau und damit Tücher, die mit dem St. Galler Schauzeichen versehen waren, genoss. Aus Geschäftsbeziehungen entstanden auch familiäre Verbindungen von St. Galler Familien mit solchen aus Konstanz, Ravensburg, Lindau, Isny und aus anderen Städten. Über einen eigenen Hafen in Steinach hatte die Stadt St. Gallen zudem direkten Seeanschluss. Diese Infrastruktur war wichtig, weil die Ostschweiz im Gefolge der Spezialisierung auf Vieh- und Textilwirtschaft im Spätmittelalter und in der Frühen Neuzeit den Ackerbau vernachlässigte. Häufigster Importartikel war denn auch schwäbisches Getreide, dieses diente der Versorgung der Stadt St. Gallen sowie der umliegenden Landschaft.3
1.3 Städtische Schulen
Schon früh gab es in St. Gallen im Kloster eine Lateinschule. Im 12. und 13. Jahrhundert wurde der Betrieb der Lateinschule in der Stadt aber nicht mehr von den Mönchen des nahen Klosters, sondern von Weltklerikern aufrechterhalten.4 Über die Anfänge der städtischen Schulen weiß man wenig. Es gab eine Deutsche Schule und eine daran anschließende Lateinschule; allerdings ist wenig zu den spätmittelalterlichen Lehrinhalten bekannt. Möglicherweise nahm die Stadtschule mit dem vom Rat Mitte des 14. Jahrhunderts angestellten Schulmeister Johann von Gaienhofen ihren Anfang. Es wurden vielleicht 40 Knaben in der Grundstufe und einige ältere Jahrgänge bis zur Hochschulreife unterrichtet. Die für die spätere berufliche Tätigkeit grundlegenden Lese-, Schreib- und Rechenfähigkeiten vermittelte die Deutsche Schule. Aufgabe der Lateinschule war die Vorbereitung zur Universität, nicht die Vermittlung von allgemeiner Bildung für einen praktischen Beruf. Reiche Bürger wie die Familie Zollikofer, die vor allem im Textilhandel tätig war, beschäftigten zudem wie Adlige eigene Hauslehrer.
Studienorte von St. Gallern waren um 1500 die Universitäten in Basel, Wien, Leipzig, Freiburg im Breisgau, Heidelberg, Erfurt, Tübingen, Wittenberg, Krakau. Nebst persönlichen Beziehungen spielten Netzwerke aus dem internationalen St. Galler Textilhandel – zum Beispiel im Falle von Krakau – eine Rolle bei der Wahl des Studienortes.5
2. Schriftgebrauch im Alltag
Im Zentrum dieses Beitrags steht das für den beruflichen Alltag notwendige Handlungswissen. Um von diesem einen Eindruck zu gewinnen, bietet es sich methodisch an, den Schriftgebrauch im Alltag zu untersuchen. Hierzu wird der im Stadtarchiv der Ortsbürgergemeinde verwahrte schriftliche Nachlass der mittelalterlichen Stadt St. Gallen beigezogen. Bis in die Zeit um 1400 bilden Urkunden den weitaus größten Teil der schriftlichen Überlieferung. Im frühen 15. Jahrhundert kommen serielle Reihen von Rechnungen (Steuerbücher, Säckelamtsbücher, Baurechnungen) und Briefe hinzu. Ratsprotokolle sind ab den 1470er-Jahren vorhanden.
Der Urkundenbestand ermöglicht Aussagen zum Schriftgebrauch in der rechtlichen und wirtschaftlichen Organisation der spätmittelalterlichen Gesellschaft. Nach 35 Jahren Neubearbeitung des aus dem 19. Jahrhundert stammenden ›Urkundenbuch der Abtei Sanct Gallen‹ ist die gesamte urkundliche Überlieferung nicht nur der Stadt, sondern auch der Region St. Gallen von 700 bis 1411 in einer neuen Volltextedition mit dem Namen Chartularium Sangallense greifbar. Nebst der Druckversion ist für die Zeit nach 1000 eine online-Version über monasterium.net, teils mit Faksimiles der Vorder- und Rückseite sowie der Siegel der edierten Urkunden, verfügbar. Dadurch ist es möglich, die urkundliche Schriftproduktion in dieser Region umfassend zu erforschen. Gegenüber dem alten Urkundenbuch umfasst das Chartularium Sangallense weit mehr Urkunden. Der Trend ist steigend; im 14. Jahrhundert macht der Anteil der neu erschlossenen Urkunden bis zu 40 Prozent aus. Der weitaus größte Teil dieser neu erschlossenen Urkunden besteht aus Privaturkunden, die in einem städtischen Bezug stehen. Dazu gehören Bündnisurkunden, Verkaufs- und Belehnungsurkunden, Urkunden zu Rentenkäufen, Urfehden sowie Urkunden, in denen der städtische Alltag fassbar wird (Baurechte, Nachbarschaftsstreitigkeiten usw.). Wie umfangreich die Zunahme der urkundlichen Überlieferung im Spätmittelalter ist, zeigt folgende Grafik, welche in Fünfzigjahresschritten die Zahl aller im Chartularium Sangallense edierten Urkunden von 1000 bis und mit 1399 wiedergibt.
Anhand der Grafik sind zwei Tatsachen deutlich zu erkennen: erstens die Zunahme der urkundlichen Überlieferung seit 1200 und zweitens die Beschleunigung der Zunahme nach 1350. Zweiteres zeigt sich darin, dass von den insgesamt 6.204 zwischen den Jahren 1000 bis und mit 1399 überlieferten Urkunden allein schon 2.915 Stücke auf die Zeit zwischen 1350 und 1399 fallen. Die erste Phase bis 1349 korrespondiert mit Beobachtungen von Roger Sablonier zur Schriftlichkeit im Gebiet der heutigen Ostschweiz, wo in der zweiten Hälfte des 13. und in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts eine rasche Zunahme des Schriftgutes nachgewiesen werden kann. Die zweite Hälfte des 13. Jahrhunderts ist in der heutigen Ostschweiz als Zeit einer erheblichen Dynamik und gleichzeitig einer starken Ausdehnung des Schriftgebrauchs zu sehen, die Sablonier mit einer ersten Phase der »Profanierung« von Schriftgebrauch in Zusammenhang bringt.6 Seine These bezieht sich auf Untersuchungen im Zusammenhang mit dem Schriftgebrauch des Adels.
Grafik 1: Zahl der überlieferten und im Chartularium Sangallense edierten Urkunden von 1000 bis 1399, in Fünfzigjahresschritten dargestellt.
Diese Aussagen lassen sich mit unseren, bereits an anderer Stelle7 publizierten Beobachtungen und statistischen Ergebnissen, die über die von Sablonier untersuchte Zeitspanne hinausreichen, ergänzen und erweitern.
2.1 Zunahme der städtischen Schriftproduktion
Die Zunahme des Schriftgebrauchs im weltlichen Bereich betrifft nicht nur den Adel, sondern noch weit mehr den städtischen Bereich. Die folgende Grafik weist deutlich in diese Richtung.
Grafik 2: Vom Kloster St. Gallen bzw. von der Stadt St. Gallen ausgestellte Urkunden 1282–1297 und 1382–1397.
In zwei Zeitschnitten im Abstand von 100 Jahren wurden alle Urkunden ausgezählt, die entweder vom Kloster oder von der städtischen Seite – das heißt von Bürgermeister und Rat, einer städtischen Institution wie dem Spital oder von einem Bürger – ausgestellt wurden. Während zwischen 1282 und 1297 erst drei Urkunden von städtischer Seite und demgegenüber 60 Urkunden vom Kloster ausgestellt worden waren, hatten sich hundert Jahre später die Verhältnisse völlig geändert. Ende des 14. Jahrhunderts wurden deutlich mehr Urkunden von städtischer Seite ausgestellt. Diese Stichprobe zeigt, dass die nochmals markante Zunahme der Urkundenüberlieferung seit 1350 in erster Linie mit der Zunahme der Schriftproduktion in der Stadt zusammenhängen muss. Die Gründe für diese Zunahme sind vielfältig und können hier nicht ausgiebig diskutiert werden; wenigstens drei Beobachtungen seien jedoch hervorgehoben. Einher mit der Loslösung der Stadt aus der Klosterherrschaft ging ihre Vernetzung mit anderen Städten im erweiterten Bodenseegebiet, die sich markant in der Zunahme der schriftlichen Kommunikation nach außen äußert. Davon zeugen die vielen Städtebundsurkunden seit der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts, sodann die Briefkorrespondenz (Missiven), die Ende des 14. Jahrhunderts einsetzt und im 15. und 16. Jahrhundert massiv zunimmt,8 und schließlich die in den städtischen Rechnungen dokumentierten Ausgaben für Briefboten und Gesandte.9 Hinzu kommt der Auf- und Ausbau einer schriftgestützten Verwaltung seit den 1350er-Jahren. Davon zeugen Einträge im ältesten, zu jener Zeit begonnenen und bis 1426 reichenden Stadtbuch, welches Abrechnungen zwischen der Stadt und dem Steuermeister, Baumeister und Säckelmeister der Stadt festhält.10 Die Zunahme der städtischen Schriftproduktion zeigt zum Zweiten auch die seit der Mitte des 14. Jahrhunderts nachweisbare Tätigkeit der Stadtschreiber. Einer Arbeit zur Urkundensprache ist zu entnehmen, dass fünf zu unterscheidende Schreiber der Stadt und des städtischen Spitals zwischen 1362 und 1416 etwa 300 Urkunden verfassten.11 Die Schreiber der Abtei schrieben gemäß dieser Studie zwischen 1350 und 1400 nur 199 Urkunden.12 Dass die Schreiberhände der ersten Stadtschreiber auch im ersten Stadtbuch aus der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts nachzuweisen sind, werte ich als Hinweis darauf, dass es sich bei diesen Schreibern um die Ratsschreiber handeln dürfte. Dies wiederum deutet auf die Anfänge oder zumindest die Vorformen einer städtischen Kanzlei hin, welche wesentlich am Auf- und Ausbau einer schriftgestützten Verwaltung und somit an der Zunahme der städtischen Urkundenproduktion beteiligt war. Diese regionale Situation nach der Mitte des 14. Jahrhunderts entspricht der Entwicklung in Mitteleuropa.13 Als dritter Grund für die Zunahme des Schriftgebrauchs kommt meiner Meinung nach der wirtschaftliche Aufstieg St. Gallens zu einer international vernetzten Handelsstadt dazu. Der spätmittelalterliche Textilhandel der Bodenseeregion setzte eine Kommunikation über weite Distanzen, das heißt vom Hauptsitz einer Handelsfirma zu den Filialen an anderen Orten in Europa, voraus. Auch wenn die schriftliche Überlieferung zum Fernhandel dünn ist,14 kann doch angenommen werden, dass in Wirtschaft und Handel der Schriftgebrauch seit Mitte des 14. Jahrhunderts zunahm und dadurch die Schriftproduktion in allen Bereichen gefördert wurde.
2.2 Stadtschreiber
Wie oben dargelegt, besteht der umfangreichste Archivnachlass bis Mitte des 15. Jahrhunderts aus Urkunden. Erst danach setzen Rechnungsserien und Briefe ein, die dann im Übergang zur Frühen Neuzeit rasch an Quantität zunehmen. Bei einem Großteil der Urkunden können die Schreiber identifiziert werden. Das ermöglicht es bis zu einem gewissen Grad, deren Aufgabenprofil, Ausbildung und beruflichen Werdegang zu ermitteln. Zwischen etwa 1350 und 1436 sind fünf Schreiber auszumachen.
Heinrich Garnleder war etwa von 1352 bis 1389 öffentlicher Notar und verfasste vor allem Urkunden. Hans Schmid weist ihm in seiner Untersuchung zur St. Galler Urkundensprache in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts 84 Stück zu, wobei zu erwähnen ist, dass Schreiberzuweisungen als Größenordnung und nicht als feste Zahl zu verstehen sind, da die Schreiber der Urkunden selten namentlich erwähnt sind und deshalb die Zuordnung über Handschriftvergleiche zu erfolgen hat. Weiter ist Garnleders Mitwirkung bei Abrechnungen des Ungelds der Stadt nachzuweisen, und zwar im ersten, Mitte des 14. Jahrhunderts beginnenden Stadtbuch. Ebenfalls in diesem Stadtbuch ist Heinrich Garnleders Schrift bei einzelnen Satzungen zu erkennen.
Der Erste, der eindeutig als eigentlicher Stadtschreiber bezeichnet werden kann, ist Johannes Zili. Hans Schmid weist seiner Hand 46 Urkunden zu. Im Stadtbuch ist seine Handschrift zwischen 1362 und 1389 nachweisbar. Johannes Zili hat die städtische Gesetzgebung, wie sie im Stadtbuch dokumentiert ist, am nachhaltigsten geprägt. 290 Seiten stammen laut der Editorin des Stadtbuches, Magdalena Bless-Grabher,15 von seiner Hand. Bei den Einträgen handelt es sich nebst Satzungen um Einträge zu Kreditgeschäften mit städtischen Liegenschaften, die zur Absicherung als Grundpfand hinterlegt werden mussten (Pfandversatzungen). Weiter ist – wie bei Garnleder – seine Mitwirkung bei Abrechnungen mit den Inhabern städtischer Administrationsstellen – Ungeldeinzieher, Steuer- und Baumeister – sowie bei Einbürgerungen im Stadtbuch nachweisbar.
Von 1388 bis 1416 ist Johannes Garnleders Handschrift im Stadtbuch bezeugt. Johannes war der Sohn vom oben erwähnten Heinrich Garnleder. Als Stadtschreiber ist er seit 1388 dokumentiert, im Stadtbuch stammen ca. 185 Seiten von seiner Hand, und Schmid weist ihm 117 Urkunden zu. Bezeugt ist seine Teilnahme an diplomatischen Missionen der Stadt. Nebst der Erstellung neuer Satzungen im Stadtbuch ist seine Redaktion von bestehenden zu erkennen, indem er die Satzungen mit Titeln ergänzte, wodurch die Benutzerfreundlichkeit stieg.
Nachfolger von Johannes Garnleder war Johannes Beck, dessen Hand im Stadtbuch ab 1410 auf ca. 37 Seiten zu identifizieren ist. Schmid weist ihm die Ausfertigung von 75 Urkunden zu. Beck war an grundsätzlichen Reformen der Stadtsatzungen beteiligt. 1426 eröffnete er ein neues, das zweite Stadtbuch, das die Zeit zwischen 1426 und 1508 umfasst. Dieses zweite Stadtbuch unterscheidet sich vom ersten, indem es weitgehend nur noch Satzungen und keine Abrechnungen, wie dies im ersten Buch noch der Fall ist, enthält. Als Neuerung finden sich zudem durchgehend Titeleien und ein Register. Das sind Hinweise auf eine Rationalisierung der städtischen Administration. Dazu passt, dass wenige Jahre vor der Anlage dieses zweiten Stadtbuches serielle Reihen wie Steuerbücher, Säckelamtsbücher und Baurechnungen einsetzen. Das ermöglichte die systematische Konzentration des neuen Stadtbuches auf den gesetzgeberischen Bereich.
Hans Golder ist von 1419 bis 1420 als Schreiber in der Stadtkanzlei nachweisbar. Im Stadtbuch sind seine Spuren spärlich, und Schmid weist ihm lediglich die Ausstellung von sechs Urkunden zu. Golder hatte eine ähnliche Schrift wie Johannes Beck; Bless vermutet, dass er eine Art Substitut des Stadtschreibers Beck war. Spätestens 1422 schlug er eine andere Laufbahn, nämlich als Säckel- und Steuermeister, ein.16
Stadtschreiber des Spätmittelalters und der Frühen Neuzeit verfügten über ein breites Anforderungsprofil. Eine Bildung mit Universitätsabschluss war nicht notwendig, und wie die Beispiele von St. Gallen zeigen, wohl eher die Ausnahme. Von den erwähnten fünf Schreibern scheint nämlich keiner eine Universität besucht zu haben, ihre Ausbildung erfolgte vielmehr im Sinne von ›learning by doing‹ in der Stadtkanzlei. Am Beispiel von Vater und Sohn Garnleder wird dies besonders augenfällig. Ihre Schrift lässt sich nur schwer voneinander unterscheiden. Sogar die Zeichen am Anfang und am Schluss der Urkunden sind identisch. Der einzige, durchgehende Unterschied konnte beim Buchstaben v ausfindig gemacht werden: Heinrich Garnleder, der Vater von Johannes Garnleder, begann das v von unten, Johannes hingegen von oben. (Abb. 1 und 2) Die weitgehend identische Schrift lässt sich nur dadurch erklären, dass der Sohn beim Vater in der Stadtkanzlei quasi in die Lehre ging und bei ihm das Schreiberhandwerk und alles andere, was zur Aufgabe als Stadtschreiber gehörte, erlernte. Bei Golder und Beck bestehen ebenfalls Ähnlichkeiten.
Das Ausstellen von Urkunden umfasste nicht nur die Schreibarbeit, sondern erforderte breite rechtliche Kenntnisse. Besonders augenfällig wird dies bei Lehensurkunden, in welchen eine städtische Institution – allen voran das kommunale Spital, das Siechenhaus und das städtische Frauenkloster St. Katharinen – Partei waren. In vielen Fällen tritt der Stadtschreiber als Rechtsvertreter (Träger) der jeweiligen städtischen Institution und zugleich als Verfasser der Lehensurkunde in Erscheinung. Dies hängt damit zusammen, dass die Institutionen Korporationen im kirchenrechtlichen Sinn waren und somit streng genommen nach kanonischem Recht nicht selbstständig Lehen übernehmen konnten.17 Spitäler und Siechenhäuser verfügten im Gegensatz zu Bürgern im Spätmittelalter häufig nicht über die Lehensfähigkeit, waren aber zur Aufrechterhaltung und zum Ausbau ihres Betriebes auf die Übernahme von Lehengütern angewiesen, und sie waren ökonomisch sehr aktiv.18 Die von Stadtschreibern verfassten Lehensurkunden für die städtischen Institutionen fallen durch ihre Ausführlichkeit auf. Unter anderem werden die von den Lehensnehmern zu entrichtenden Abgaben aufgelistet und Sanktionen bei Nichteinhaltung von Zahlungen erwähnt, weiter sind Umschreibungen der Lehensgüter, Folgen bei Vernachlässigung der Bewirtschaftung des Hofes und schließlich Regelungen bei der Vergütung von Investitionen, die durch Bauern auf den Lehenhöfen getätigt wurden, enthalten. In wenigen Fällen sind sogar Bestätigungen der Trägerschaft des Stadtschreibers vorhanden.19 Insgesamt gewinnt man den Eindruck, dass diese Ausführlichkeit der rechtlichen Absicherung der städtischen Institution, die der Stadtschreiber vertrat, diente.20
Rechtliche Kenntnisse waren auch in der städtischen Gesetzgebung, in der Protokollierung der Ratssitzungen sowie der Beratung des Rates in den Sitzungen und auf diplomatischen Missionen gefragt. Letzteres zeigt beispielsweise ein Eintrag im Ratsprotokoll von der Sitzung des Großen Rates der Stadt St. Gallen vom 29. November 1514. Der Rat delegierte den amtierenden Bürgermeister, den Unterbürgermeister und den Stadtschreiber nach Zürich. Diese hatten eine schwierige Aufgabe: 1513 war das Land Appenzell als 13. und letzter Ort in die Alte Eidgenossenschaft aufgenommen worden. St. Gallen bemühte sich laut diesem Ratseintrag offenbar ebenfalls um eine Aufnahme. In den Verhandlungen mit den Eidgenossen sollten die St. Galler Gesandten gemäß Auftrag von Bürgermeister und Rat aber darauf achten, dass man mit dem Kaiser und Rich ains were.21
Abb. 1: Von Johannes Garnleder, dem Sohn von Heinrich Garnleder, geschriebene, auf den 12. März 1376 datierte Urkunde.
Abb. 2: Von Heinrich Garnleder, dem Vater von Johannes Garnleder, geschriebene, auf den 19. Oktober 1357 datierte Urkunde.
Ihr Auftrag lautete also, das gute Verhältnis mit dem Reich auf keinen Fall zu gefährden. Dies versteht sich vor dem Hintergrund, dass der Tuchexport und umgekehrt der Import vor allem von Getreide aus Deutschland existentiell waren. Man könnte diese Haltung Politik mit Vorrang wirtschaftlicher Interessen nennen (was ja nichts Außergewöhnliches ist …). Solche Mandate verlangten Vertraulichkeit oder gar Geheimhaltung.22 Als Stadtschreiber kamen deshalb nur Vertrauensleute in Frage, die zudem angesichts der vielen Aufgaben und nicht zuletzt auch wegen diplomatischer Reisen effizient und wenn möglich körperlich robust waren.23 In der Frühen Neuzeit nahmen die Aufgaben der Stadtschreiber wohl noch zu. Dies zeigt sich beispielsweise an der steigenden Zahl brieflicher Korrespondenz, die in der städtischen Kanzlei erledigt werden musste. Weiter musste ein Stadtschreiber in der Lage sein, nebst lateinischen Briefen auch solche auf Französisch oder Italienisch zu verstehen und dem Rat sachlich fokussiert darzulegen.24
Schließlich hatten die Stadtschreiber eine zentrale Rolle inne bei der Abrechnung mit den Säckel-, Steuer- und Baumeistern sowie dem Einzieher des Ungelds. Das folgende Zitat aus dem ersten Stadtbuch bringt dies griffig zum Ausdruck: Anno 1383 widerrechnote ich Joh. Zili der Statschriber den Burgern alles, das ich von iro und der Stat wegen […] ingenommen hatt, es wär das Ungelt von dem 82. Jar, Stüran, Zins, Buossan, Anzalan oder dehainerlay ander Sach.25 Hier stellt sich die Frage, was die Stadtschreiber zu dieser wirtschaftlich wichtigen Position befähigte. War dazu ein spezielles Know-how auf dem Gebiet der Buchhaltung notwendig? Um dieser Frage nachgehen zu können, ist es erforderlich, aufgrund der vorhandenen Quellen einen Eindruck der konkreten Abrechnungsvorgänge zu erhalten.26
2.3 Die Ausgaben ›erzählen‹
Wie erwähnt, enthält ein großer Teil des Stadtsatzungsbuchs aus der Zeit zwischen Mitte des 14. Jahrhunderts und 1426 Abrechnungen. Die hier wiedergegebene Abrechnung der städtischen Delegation mit dem Steuer- bzw. Baumeister soll exemplarisch dazu dienen, Einblick in eine spätmittelalterliche Buchhaltung zu geben.
1388 widerrechnote Hug Ruopreht den Burgern die Herbststeuer des Jahres 1387, die er bis zum Abrechnungstag von der Bürgerschaft eingenommen hatte. Offenbar war ihm auch die Organisation des städtischen Bauens und die Aufsicht darüber anvertraut, denn er hatte in dieser Sache Rechnung abzulegen: Er saite ouch do dez selben Mals, er hetti verbuwen 56 Pfund, 15 Schillinge und 4 Pfennige […] er erzallte und bewiste aber nit von Stuk ze Stuk, wa und wem und wie und umb welherlay und von welherlay Büw wegen er den genannten Betrag verbaut hatte.27 In unserem Zusammenhang ist nicht die Tatsache relevant, dass der Steuer- und Baumeister offenbar nicht in der Lage war, seine Ausgaben darzulegen, sondern die Art der Rechnungsprüfung. Der Geprüfte ›erzählte‹ demnach Stück für Stück einer Rechnungsprüfungskommission, die namentlich erwähnt wird und der auch der Bürgermeister angehörte, die verschiedenen Ausgabenposten. Dabei dienten ihm vielleicht heute nicht mehr vorhandene Notizen als Rechnungsgrundlage und Gedächtnisstütze. Dieser Vorgang wurde ›widerrechnen‹ genannt, und zwar deshalb, weil die beiden Parteien – auf der einen Seite der Geprüfte und auf der anderen die Prüfer als Vertreter des Stadtrates und in der Regel zusammen mit dem Stadtschreiber – ›gegeneinander‹ (= wider) abrechneten. Das Stadtarchiv verfügte einst über eine ganze Reihe solcher Widerrechnungen, leider sind sie im 19. Jahrhundert im Zuge einer Archivrevision vernichtet worden. Hingegen sind im Spitalarchiv vereinzelte Widerrechnungen erhalten geblieben, die den Vorgang zu erklären helfen:
Abb. 3: Widerrechnung des Heiliggeistspitals 1446.
Item als ich den Ussermaister widerrechnot uff ain Mitwuchen nach sant Uolrichß tag Anno [14]46 mit Namen Cuonrat von Ainwill, Hans Ramsperg und Andres Vogelwaider, do ward uff mich geschriben ain Schuld in den Büecher, als hernach geschriben stat:
Item im grosßen Zinsbuoch ward uff mich geschriben ain Schuld 517 Pfund 3 Schillinge 1 Pfennige.
Item im Rintal Schuldbuoch ward uff mich geschriben, es sig in Höhst, in Bernang, in Marpach, in Altstetten ain Schuld 816 Pfund 13 Schillinge 7 Pfennige.
Item im Almisdorff Zinsbuoch ward uff mich geschriben ain Schuld 25 Pfund 19 Pfennige.
Item in Spaltistain ward uff mich geschriben ain Schuld 12 Pfund 14 Schillinge 10 ½ Pfennige.
Item im Vechbuoch ward uff mich geschriben ain Schuld 1496 Pfund 17 Schillinge 10 Pfennige.
Item im Schuldbuoch ward uff geschriben an Schuld 531 Pfund 17 Schillinge 3 ½ Pfennige.
Summa ain Schuld in den Büecher 3400 Pfund 8 Schillinge 3 ½ Pfennige.
Item so vindet es sich, das ich me ingnomen denn ußgen ain barem Gelt, als ich widerechnot, tuot 110 Pfund 3 ½ Pfennige uff ain Mitwuchen nach Uolrici [14]46, bin ich och schuldig zuo dem vordrigen.
Summa summarum 3510 Pfund 8 Schillinge 7 Pfennige.28
Diese Zeilen schildern den Rechnungsabschluss des Spitalmeisters vor den sogenannten Aussermeistern, der vom Rat bestellten Oberbehörde des Spitals, die hier in der Funktion der Rechnungsprüfer auftraten. Der Spitalmeister als Betriebsleiter hatte für das zu Ende gegangene Jahr Rechnung über Einnahmen und Ausgaben abzulegen. Der Stadtrat wurde durch die namentlich aufgeführten Aussermeister vertreten (Konrad von Andwil, Hans Ramsberg, Andres Vogelweider). Diese Behördenvertreter hatten die Aufgabe, mit dem Spitalmeister zu widerrechnen, dabei hatte der Spitalmeister für die Einnahmen und Ausgaben sowie die gewissenhafte Kassaführung einzustehen. Was hier als ›Schulden‹ des Spitalmeisters ausgewiesen wurde, waren Einnahmen aus verschiedenen Bereichen wie beispielsweise dem Weinbau in Höchst, Berneck, Marbach und Altstätten oder den Viehgemeinschaften mit Appenzeller Bauern.29 Die Formulierung, ward uff mich geschriben ain Schuld, bringt die allgemeine Auffassung zum Ausdruck, dass Finanzverwalter der Stadt oder von städtischen Einrichtungen für die Einnahmen als Schuldner – und umgekehrt für die Ausgaben als Gläubiger – für ihnen anvertrautes Vermögen betrachtet wurden.30
Den Vorgang kann man sich als Versammlung des Spitalmeisters und der Aussermeister um einen Rechentisch oder ein Rechentuch (Abacus) vorstellen. Es handelt sich dabei um die Methode des Rechnung-Legens auf Linien.31 Beim Rechnung-Legen können die Rechenoperationen visuell dargestellt werden, was den Vorteil hat, dass alle Anwesenden den Vorgang nachvollziehen können. Zuerst wurden die dem Spital zustehenden Beträge aus den verschiedenen, heute nur noch zum Teil erhaltenen Büchern32 zusammengezählt (Summa ain schuld in den Büecher 3400 Pfund 8 Schillinge 3 ½ Pfennige), nachher wurde ein Posten Bargeld (110 Pfund 3 ½ Pfennige) hinzugezählt.
Auch wenn der Ablauf des Widerrechnens des Spitalmeisters mit den Aussermeistern nicht bis ins Detail rekonstruiert werden kann, so wird doch klar, dass es sich um einen Vorgang handelte, bei dem die Mündlichkeit eine größere Rolle spielte als die Schriftlichkeit. Der Zweck der Notizen oder der Rechnungen – also der Buchhaltung – lag noch nicht darin, wie in einer voll ausgebildeten doppelten Buchhaltung schriftlich und ohne Beisein und Hilfe der Rechnungsführer den Geschäftsgang nachvollziehbar zu machen. Vielmehr sollten die Notizen oder Rechnungen die Grundlagen für den konkreten Rechnungsvorgang und vor allem eine Gedächtnisstütze bilden, welche es dem jeweiligen Amtsinhaber bei der Endabrechnung vor den Augen der Rechnungsprüfer ermöglichte, den Geschäftsgang vorzurechnen. Um dieser Anforderung zu erfüllen, genügte wenig Geschriebenes, das heißt im Wesentlichen die Auflistung der Ausgaben und Einnahmen, von Namen und knappen sachlichen Hinweisen, wie dies in den Abrechnungen im Stadtsatzungsbuch Ende des 14. Jahrhunderts der Fall ist. Dieses System galt auch noch im 15. Jahrhundert, als die Buchführung differenzierter wurde und sich in verschiedene Bereiche mit eigenen Büchern auffächerte. Für die Zeit nach 1400 lassen sich nämlich die ersten in den verschiedenen Ämtern entstandenen Bücher nachweisen, welche jährlich geführt wurden: Die Steuerbücher beginnen 1402, die Säckelamtsbücher 1401, die Bauamtsrechnungen 1419, die Jahrrechnungen 1425.33 Vom Rat delegierte Männer standen den Ämtern vor und führten die Rechnung.34 Diese Bücher sind so aufgebaut, dass sie Ausgaben bzw. Einnahmen der betreffenden Ämter auflisten. In den Bauamtsrechnungen werden die Ausgaben des Baumeisters aufgeführt; darunter befinden sich Ausgaben für Holzführen, Arbeiten am städtischen Kornhaus, Waldarbeiten, die Herstellung von Schindeln, Arbeiten in der Sand- oder Kalkgrube usw. Die Säckelamtsbücher halten in umfangreichem Ausmaß ganz unterschiedliche Ausgaben und Einnahmen des Stadtsäckels fest, und zwar in der Regel mit dem Datum. Dazu gehören Einnahmen von Zinsen, Steuern, Bußen, Waag- und Schaugeldern usw. sowie Ausgaben für Gesandte, Boten, Diener, Sitzungsgelder, Bauarbeiten etc.35 Ohne mündliche Erläuterungen der für die Einnahmen und Ausgaben verantwortlichen Personen waren diese Notizen unverständlich.
Was hier am Beispiel St. Gallens dargelegt wird, scheint keine Ausnahme, sondern vielmehr die Regel gewesen zu sein. Allein von der Tatsache, dass seit dem 14. und 15. Jahrhundert die Prinzipien der doppelten Buchhaltung bekannt waren, darauf zu schließen, dass sie auch angewendet wurden, wäre falsch. Franz Josef Arlinghaus bringt es in seiner Untersuchung zur schriftlichen Überlieferung des italienischen Kaufmanns Francesco Datini auf den Punkt, wenn er schreibt, dass bis in die jüngste Zeit hinein die Doppik für das kaufmännische Rechnungswesen weitgehend überschätzt wurde. »Erst ihre Anwendung, so meinte man, habe die Möglichkeit geschaffen, überhaupt gewinnorientiert zu wirtschaften. Mehr noch: Seit Sombart galt die doppelte Buchführung als Beleg für das Vorhandensein einer rational-kapitalistischen Wirtschaftsform, ja als Ausdruck von kapitalistischem Denken überhaupt. Wo Kapitalismus, da doppelte Buchführung, und wo doppelte Buchführung, da Kapitalismus.«36 Noch bis ins 19. Jahrhundert wurde auch in der Textilmetropole St. Gallen, einem Ort, wo kapitalistisches Denken und Handeln seit Jahrhunderten verbreitet war, die doppelte Buchhaltung nicht angewendet. In einem Protokoll aus dem Jahr 1836 der Spitalkommission mit dem Titel Gutachtliche Vorschläge an den Verwaltungsrat über den Rapport der Herren Rechnungsrevisoren wird festgehalten, man sei in Bezug auf die Einführung einer doppelten Buchhaltung nach langer Beratung zum Schluss gelangt, den bisherigen Modus beyzubehalten, um unnöthige Unkosten mit Anschaffung neuer Bücher und vergebliche Mühe und Arbeit mit Einrichtung derselben, die vielleicht späterhin wieder Abänderungen unterworfen seyn möchten, zu vermeiden.37 Was mit dem bisherigen Modus gemeint war, soll in der Folge dargelegt werden.
Die im schriftlichen Nachlass der stadtsanktgallischen Institutionen und Akteure nachweisbare Buchführung zeigt eine langsame Entwicklung von Aufzeichnungen in Fließtextform zu Zeilen pro Transaktion. Der unten wiedergegebene Auszug von 1388 aus dem ersten Stadtbuch betrifft den bereits genannten Abrechnungsvorgang mit der Erwähnung, dass die Rechnung erzählt wurde (linke Seite). Deutlich zu erkennen ist, dass es sich um einen aneinandergehängten Fließtext ohne Strukturierung in Zeilen und Spalten handelt.38
Abb. 4: Abrechnung 1388 im ersten St. Galler Stadtbuch.
Der Übergang von Fließtextaufzeichnungen zu solchen mit einzelnen Zeilen pro Transaktion lässt sich im Falle der Buchführung unter städtischer Leitung am Beispiel der sogenannten Rheintaler Schuldbücher des kommunalen Spitals zeigen. Dabei handelt es sich um eine Buchführung, die spezifisch die Tauschbeziehungen zwischen dem Spital und seinen Weinbauern im Sanktgaller Rheintal festhielt. Aufgelistet sind einerseits Waren- und Geldlieferungen des Spitals an die Bauern, die ihnen als Schulden belastet wurden, und andererseits Lieferungen von Wein der Bauern an das Spital, die dem Abbau ihrer Schulden dienten. Die Einträge zum Weinbauern Hans Nesler aus Berneck im St. Galler Rheintal beginnen im ersten Exemplar dieser Rheintaler Schuldbuchreihe im Jahr 1437 (links).39 Es handelt sich um einen Fließtext. Im zweiten erhaltenen Exemplar dieser Reihe (rechts) ist zur gleichen Person Nesler hingegen eine zeilenorientierte Buchungsform zu erkennen.40 Zuoberst findet sich ein Übertrag der Schulden auf Epiphanie 1444. Darunter folgen die Waren- und Geldbezüge des Bauern beim Spital. Dass sie als Schulden verbucht sind, zeigt sich an der Formulierung sol im Sinne von ›der Bauer soll einen Geldbetrag für die dafür beim Spital bezogene Ware‹ bezahlen. Auf der untersten Zeile, und zwar abgesetzt von den oberen Einträgen, erfolgt die Gegenlieferung des Bauern an das Spital in Form von Wein, die dem Abbau seiner Schulden diente und entsprechend mit der Formulierung das Spital sol im, das heißt, ›das Spital soll ihm gutschreiben‹ verbucht wurde. Ein weiteres Merkmal einer klareren Strukturierung des jüngeren Schuldbuches mit zeilenorientierten Einträgen gegenüber dem ersten Exemplar mit dem Fließtext findet sich ungefähr in der Mitte mit einer Zwischensummierung, die mit der Formulierung Restat die ausstehenden Schulden des Bauern bis zu diesem Zeitpunkt festhält. Dieses jüngere Exemplar lässt ganz eindeutig die Absicht nach mehr Übersichtlichkeit erkennen.
Abb. 5: Links das erste erhaltene Rheintaler Schuldbuch 1437, rechts das zweite Rheintaler Schuldbuch 1444 mit Abrechnungen mit dem Weinbauern Hans Nesler in Berneck, St. Galler Rheintal.
Die Spitalverwaltung in St. Gallen begann Ende der 1430er-Jahre zudem damit, eine Parallelschriftlichkeit mit Urbaren und Zinsbüchern zu führen. Die Urbare halten nach Höfen geordnet die Abgabenforderungen an die Bauern in Naturalien und Geld fest. Ein solcher Hof ist die Schoretshueb westlich der Stadt St. Gallen. Der entsprechende Eintrag im Urbar, unterste Zeile, lautet:
Abb. 6: Urbar des Heiliggeistspitals St. Gallen, Ende der 1430er-Jahre.
Der hof ze Schorantzhuob gilt 24 malter Korn, 3 lb d, 10 hüenr, 200 ayer und 2 kloben werch [= Flachs].41
Aus der gleichen Zeit stammt ein Zinsbuch; in den ersten beiden Zeilen des Zinsbuches sind entsprechend dem Urbar die Abgabenforderungen des Spitals an die Bewirtschafter des Hofes Schoretshueb festgehalten.42 Der ganze Eintrag im Zinsbuch lautet:
Abb. 7: Pfennigzinsbuch des Heiliggeistspitals St. Gallen 1442 und 1443.
1 Schorantzhuob der hof git jaerlich 24 malter baider korn [= Fesen und Hafer] Celler mess,
2 3 lb d und 10 hüenr und 200 ayer und 2 kloben werch.
3 Samen 12 malter vesen, 8 malter haber daz sol uff dem hof beliben.
4 Hans Rütiner sol 1 lb d ratione sabato post pasce 1442. Dedit ayer de 1442.
5 Dedit hüenr de 1442. Dedit 2 kloben werch de 1442.
6 Dedit 12 malter 2 fiertel vesen uff den ersten tag octobris 1442.
7 Dedit 30 s d gab Uoli Hafner Martini 1442.
8 Dedit 3 malter 3 fiertel haber Otmari 1442.
[9 Zeile gestrichen.]
10 Dedit 3 malter 1 mut haber Katherine 1442.
11 Dedit 3 malter haber uff Nicolai 1442.
12 Dedit 30 s d Anthonii 1443.
13 Sol 9 mut 3 fl haber ratione uff 13 tag aberellen 1443.
14 Dedit ayer de 1443. Dedit hüenr de 1443.
15 Dedit 1 malter haber uff Philippi et Jacobi 1443.
16 Restat 5 mut 3 fiertel haber.
17 Item de anno 1443 ist etwas ungewaechst
18 da gewesen, dafür gat im ab
19 2 malter korn.
Mit der Erwähnung von samen in Zeile 3 ist Saatgut gemeint. Offenbar hatte das Spital zu einem früheren Zeitpunkt dem Bewirtschafter der Schoretshueb zwölf Malter Fesen und acht Malter Hafer als Saatkörner zur Verfügung gestellt. Mit der Anweisung, diese sollten auf dem Hof bleiben, wird ausgedrückt, dass bei einem allfälligen Wegzug der Bauernfamilie diese Investition dem Spital zurückzuzahlen war.
Aus Zeile 4 des Zinsbuches erfahren wir, wer den Hof bewirtschaftete. Das war 1442 ein Hans Rütiner, mit dem man nach Ostern (post pasce) abgerechnet hatte und der dem Spital damals ein Pfund schuldig blieb. Dass die Abrechnung zwischen der Spitalleitung und Hans Rütiner stattgefunden hatte, ist aus dem abgekürzten lateinischen Wort ro für ratio im Sinn von ›Rechnung, Abrechnung‹ zu schließen.
Die nun folgenden, mit dedit (= gab, das heißt, der Bewirtschafter Hans Rütiner gab dem Spital) beginnenden Zeilen sind besonders aussagekräftig. Während sowohl im Urbar als auch im sogenannten Grundeintrag dieses Zinsbuchs auf den ersten beiden Zeilen die Rechtsansprüche des Spitals vermerkt wurden, geben die Zeilen 5 bis 12 sowie 14 und 15 im Zinsbuch die effektiv geleisteten Abgaben des Bauern an das Spital wieder. Dies bedeutet eine enorme Informationserweiterung gegenüber normativen Angaben, wie sie in Urbaren vorkommen.
Dank dieser Buchführung mit verschiedenen, parallel geführten Büchern, mit der Notiz von Abgabeforderungen gegenüber Lehenbauern, Waren- und Geldlieferungen, Schulden und Schuldenabzahlungen sowie Saldierungen und Überträgen in ein neues Rechnungsjahr war das Spital bestrebt und durchaus in der Lage, seine finanzielle Situation zu überblicken bzw. zu kontrollieren. Dazu genügte eine erweiterte einfache Buchhaltung, die in der Führung der ›Nebenbücher‹ mit Personenkonten (Pfennigzinsbücher, Rheintaler Schuldbücher, Pfrundbücher, Dienstbücher) besteht. Diese ermöglichten es den Spitalbehörden, den aktuellsten Stand – vor allem die Abgabenpflichten und Schulden der Bauern – jederzeit zu kontrollieren. Zwar machte dies teilweise eine doppelte Buchung erforderlich, und zwar einerseits in diesen ›Nebenbüchern‹ und andererseits in den noch vorhandenen Jahrrechnungen, jedoch wurde nicht das System der doppelten Buchhaltung angewendet; eine Bestandskontrolle für Warenein- und -ausgänge fehlte beispielsweise.43
Die bisherigen Ausführungen betrafen die städtische Administration und mit dem Spital einen städtischen Betrieb; es stellt sich die Frage, ob sich deren Buchführung von einer privaten unterschied. Das interessiert im Falle St. Gallens besonders, da angesichts der hohen wirtschaftlichen Bedeutung dieser Stadt in der Textilproduktion und im Textilhandel seit dem 15. Jahrhundert Privat- und Firmenarchive zu erwarten wären, die einen Blick in deren Buchführung gewähren würden. Dem ist leider nicht so. Es sind kaum Quellen bekannt, die Einblick in die Kapital- und Gewinnverhältnisse sowie die Buchführung der großen St. Galler Fernhandelsunternehmen erlaubten. Aber auch wenn nur Weniges erhalten ist, kann davon ausgegangen werden, dass der schriftliche Verkehr zwischen der Zentrale und den Niederlassungen im Ausland wohl umfangreich war. Für St. Gallen sind jedoch nur vereinzelte Briefe überliefert. Diese zeigen, dass die Teilhaber über die Preise bzw. die Marktsituation für Leinwand genau zu berichten hatten.44 Einigen Prozessakten und Briefen von Angestellten oder Teilhabern, die von auswärts an den Hauptsitz in St. Gallen geschrieben wurden, ist zu entnehmen, dass am Sitz der Firma von Zeit zu Zeit Gesellschaftstage abgehalten wurden. 45





























