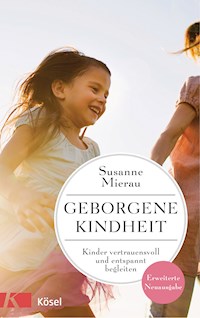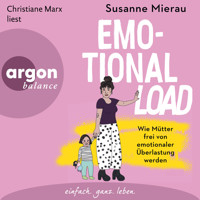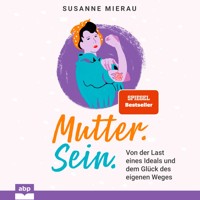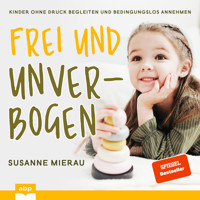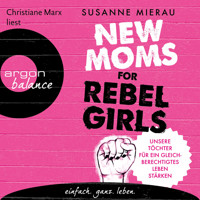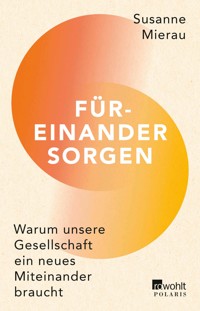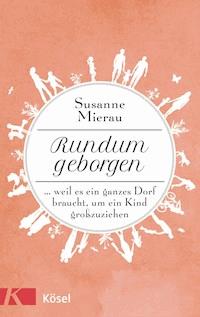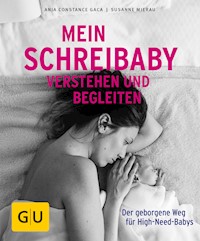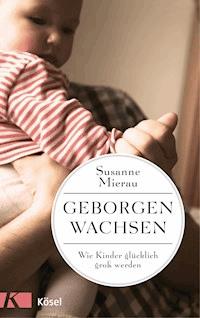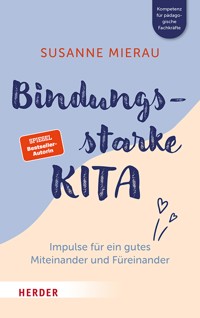
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Herder
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Deutsch
Die Beziehungsqualität, die Kinder erleben, gilt wissenschaftlich erwiesen als Fundament für eine gelingende ganzheitliche, kindliche Entwicklung. Erstmalig aufbereitet für die Kita zeigt Susanne Mierau, wie pädagogische Fachkräfte einen Alltag gestalten können, der die Beziehungsgestaltung mit den Kindern in den Mittelpunkt der pädagogischen Arbeit stellt. Mit fundiertem Fachwissen und Praxisinhalten gibt sie konkrete Impulse, wie gelingende Beziehungen zwischen pädagogischer Fachkraft und Kind, zwischen Kind und der umgebenden Gruppe und auch zwischen Kind und Familie gelingend gestaltet und begleitet werden können. Das Konzept der Bindungsgbegleitung der erfolgreichen Autorin Susanne Mierau erstmals für die Kita und pädagogische Fachkräfte aufgearbeitet.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 200
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
SUSANNE MIERAU
Bindungsstarke KITA
Impulse für ein gutes Miteinander und Füreinander
© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2025
Alle Rechte vorbehalten
www.herder.de
Umschlagkonzeption und -gestaltung: Gestaltungssaal
Satz: Sabine Hanel, Gestaltungssaal
Illustrationen im Innenteil: © Charunee Yodbun - shutterstock, Gwens Graphic Studio - shutterstock, © HORIACHEV - shutterstock, © Polina Tomtosova - shutterstock, © TongSur - Getty Images
Herstellung: Graspo CZ, Zlín
E-Book-Konvertierung: Newgen Publishing Europe
ISBN (Print) 978-3-451-39844-5
ISBN E-Book (EPUB) 978-3-451-83548-3
ISBN E-Book (PDF) 978-3-451-83537-7
Inhalt
Einleitung
1 Beziehungen sind die Basis für Entwicklung
Eine kleine Wiederholung zur Bindungstheorie
Die Chemie sozialer Beziehungen
Gehirn, Bindung und Motivation
Erziehungsstile und Bindungssicherheit
Bindung konkret: So werden gute Interaktionskreisläufe gestaltet
Der Kreis der Sicherheit
Bindungserfahrungen und Selbstbild
Impulse zur Selbstreflexion
2 Beziehungsgestaltung im pädagogischen Alltag
Bindungsrelevante Aspekte nach Altersgruppenzugehörigkeit
Soziale Kompetenz wird über das Miteinander gelernt
Jedes Kind ist anders: Temperamentsdimensionen auf der Spur
Die Chemie des Temperaments
Ich sehe dich, wie du bist
Vielfalt leben
Eingewöhnungen: Den Bindungsaufbau individuell gestalten
Impulse zur Selbstreflexion
3 Beziehungsgestaltung unter Kindern
Ausbau der Sozialkompetenz im Miteinander
Neurodivergente Kinder und sozial-emotionale Kompetenz
Freundschafts- und Beziehungsgestaltung im Verlauf der Kindheit
Streit und Mobbing – Wenn das Miteinander nicht funktioniert
Impulse zur Selbstreflexion
4 Mit den Eltern ein Team bilden
Miteinander im Gespräch von Anfang an
Herausforderung: Erziehungsstil der Eltern
Wenn das Kindeswohl in Gefahr ist …
Familienkonflikte wirken auf das Kind und auf die Gruppe
Trennungen im Kitaalltag begleiten
Alltägliche Übergänge gestalten
Gemeinsamer Zielfokus bei Problemen im Kindergarten
Elternmiteinander unterstützen
Großeltern einbeziehen
Impulse zur Selbstreflexion
5 Den Übergang in die Schule bindungssicher gestalten
Worte überdenken, Gefühle zulassen
Elternarbeit am Übergang
Abschied nehmen
Ent-bindung?
Impulse zur Selbstreflexion
6 Bindungsstarke Sicherheit für Fachkräfte
Ein Blick auf meine Bedürfnisse
Bedürfnisse im Schatten der eigenen Vergangenheit betrachten
Psychohygiene praktizieren
Selbstfürsorge im Alltag
Stressbewältigung mit dem ABC-Schema
Mein Unterstützungsnetz im beruflichen Feld
Impulse zur Selbstreflexion
Ausblick
Literatur
Über den Autor
Über das Buch
Einleitung
Bindungsstarke Kitas wissen um die Bedeutung, die Bindung für uns alle hat, und sehen Bindung nicht nur auf das Kind bezogen, sondern systemisch: Wir alle sind miteinander verbunden und wirken aufeinander ein – Kind, Eltern, weitere Familie, pädagogische Fachkräfte, Schule und weitere Unterstützungsangebote. Deswegen geht es nicht „nur” darum, Kindern sichere Orte, gute Eingewöhnungen und fördernde Lernimpulse zu geben, sondern wir müssen Kinder als Teil eines Systems sehen, in dem sie wachsen und das als Gesamtes möglichst unterstützend und stärkend sein muss. Wir sollten sehen, dass das wohlwollende Annehmen der Bezugspersonen auf die Sicherheit des Kindes wirkt und auch das Wohlergehen der Fachkräfte für das Wohl der anvertrauten Kinder bedeutsam ist. Wir müssen in den Blick nehmen, dass das Miteinander und Füreinander gelernt wird und wir es unterstützen können bei den Kindern, aber vor allem auch durch unser Vorbildverhalten: Wie wir als Erwachsene mit den Bezugspersonen der Kinder umgehen, im Team miteinander agieren und uns gegenüber Kindern verhalten, beeinflusst ihren Blick auf das Miteinander und wird hinausgetragen in die Welt, wenn sie die Kita verlassen.
Unsere Gesellschaft braucht ein gesünderes Miteinander. Ein Füreinander, das die Vielfalt von Menschen als Ressource wertschätzt. Bindungsstarke Kitas können dazu beitragen, diese Botschaft in die Welt hinauszutragen. In diesem Buch möchte ich Sie mitnehmen auf eine Erkundungstour, wie Bindungsstärke im pädagogischen Alltag aussehen kann. Auch wenn wir Bindung systemisch sehen sollten, können Sie in diesem Buch nach Bedarf einzelne Bereiche separat voneinander betrachten: die Beziehung zwischen Fachkraft und Kind, die Beziehungen von Kindern untereinander, das Miteinander mit Eltern und weiterer Familie, das Miteinander mit Schulen und auch die Teamarbeit – jedem Bereich ist ein Kapitel gewidmet. Und jedes ist ein bedeutsamer Baustein auf dem Weg zu einem gesünderen, achtsameren Miteinander, das in Zusammenhang mit den anderen steht, aber bereits für sich allein wertvolle Impulse liefert.
Gerade in diesen für junge Menschen und Familien herausfordernden Zeiten können sichere Bindungen und starke Beziehungen die psychische Widerstandsfähigkeit stärken und Sicherheit und Vertrauen in einer ungewissen Welt schenken. Tagespflege, Krippe und Kita sind Bestandteile eines großen Netzes an Beziehungserfahrungen, die Kinder im Laufe ihres Lebens machen. Im Gegensatz zu privaten Räumen der Beziehungsgestaltung finden sich hier jedoch Fachpersonen zusammen, die die Entwicklung der Beziehungsfähigkeit, des Miteinanders und Eingebettetseins als Ressource in ihren fachkundigen Blick nehmen. Sie können diese gezielt weiter unterstützen, wenn es bereits positive Entwicklungen gibt, oder im Falle von Defiziten gezielt fördern. Dies geschieht durch:
Angebote vor Ort, bei denen pädagogisches Fachpersonal Kinder begleitet,
Vernetzung mit anderen Fachpersonen, um Unterstützung zu bieten,
durch gezielte Arbeit mit den Eltern, um die Entwicklung des Kindes zu fördern.
So wird ein gezieltes und professionelles Handeln möglich, das auf die individuellen Bedürfnisse der Kinder eingeht. Pädagogische Fachkräfte werden zu Bindungs- und Beziehungsbegleiter*innen, die die Bindungs- und Beziehungserfahrungen der ihnen anvertrauten Kinder beeinflussen durch
die eigene Beziehungsgestaltung zum Kind,
die Regelung der Gruppendynamiken und Freundschaftsbeziehungen im pädagogischen Alltag, und
durch Einwirken auf das emotionale Klima in der Familie über die Zusammenarbeit mit den Eltern.
So haben die Fachkräfte großen Einfluss auf die Entwicklung psychischer Widerstandsfähigkeit der Kinder. Sie tragen dazu bei, dass Kinder lernen, wie wichtig das Miteinander für ihr Wohlbefinden ist und sie erkennen, dass wir Hilfe, Unterstützung, Wohlbefinden und Kraft für den Alltag aus dem Miteinander beziehen können. Ein Wissen, das einen unschätzbaren Wert für das gesamte weitere Leben haben kann.
Kinder lernen Bindung und Beziehung zunächst in ihrer Familie. Dort erfahren sie, ob und wie auf ihre Bedürfnisse reagiert wird und bilden so ein erstes Empfinden über ihr Selbst, ihren Wert und ihre Position in der Gruppe aus. Wenn sie in eine neue Beziehungssituation wie die außerfamiliäre Betreuung kommen, wird erworbenes Wissen und Fühlen auf den Prüfstand gestellt. Muster, die in der Familie erworben wurden, werden in die neue Gruppe eingebracht. Das Wissen darum, wie das Verhalten in der Gruppe durch frühe Beziehungserfahrungen und Interaktionsprozesse geprägt wird, ist deswegen besonders bedeutsam, um ein gutes Gruppenklima zu schaffen und ggf. ausgleichend zu arbeiten.
Bindung neu betrachten
Wenn wir an Bindung denken, dann stellen wir uns oft ein Gummiband vor, wie es so häufig in Fachbüchern zu lesen ist. Oder wir denken an Hormone wie Oxytocin, Dopamin und körpereigene Opiate. All das ist zweifelsfrei richtig, aber manchmal doch etwas stark vom pädagogischen Alltag entfernt. Wir wollen in diesem Buch daher unseren Blick ganz praktisch auf Bindung und Beziehung lenken und erkunden, wie Bindung aus Interaktionsprozessen entsteht und wie diese Interaktionsprozesse nicht nur bewirken, welche Art von Bindung theoretisch vorliegt, sondern wie sie das Verhalten des Kindes beeinflussen: Wie, wann und warum lernt ein Kind, besonders laut sein zu müssen? Oder sich zurücknehmen zu müssen? Welches Bild von sich hat dieses Kind und was braucht es, damit die prägenden Erfahrungen nicht zu einem Hindernis für spätere Beziehungsaufnahme werden? Bindung bedeutet schließlich nicht nur, wie wir uns in Beziehungen verhalten, sondern auch, wie wir auf andere Menschen überhaupt erst zugehen, wie unser Blick auf andere gestaltet ist, ob wir offen sind oder verschlossen. Damit prägt Bindung unseren Zugang zu Gemeinschaft und unseren Blick auf Gesellschaft. Ein Blick, der Interaktionen als Basis für Bindungen betrachtet, ermöglicht uns einen maximal praxisorientierten Fokus auf den Bindungs- und Beziehungsaufbau.
Wertschätzender Blick auf Kinder und Eltern
Wenn wir kindliches Verhalten als Produkt von Bindungs- und Beziehungserfahrungen verstehen, fällt es uns leichter, einen wertschätzenden und auch ressourcenorientierten Blick auf Kinder und die ihnen zugehörigen Elternteile zu gewinnen. Kindliches Verhalten ergibt Sinn, wenn wir es als Ausdruck für den Wunsch nach Bedürfnisbefriedigung verstehen, wobei dieser Ausdruck eines Kindes schon durch bestimmte Erfahrungen geprägt ist, die es im Laufe seines bisherigen Lebens gemacht hat. Diese Erfahrungen stehen wiederum in Zusammenhang mit den Erfahrungen, die die Eltern gemacht haben. Wenn wir Verhalten als Ausdruck von Erfahrungen verstehen, nehmen wir es weniger persönlich und können objektiver und auch ressourcenorientierter auf Kinder blicken. Diesen objektiven und auch analytischen Blick wollen wir in diesem Buch gemeinsam entwickeln.
Was wir im Alltag sehen und erleben, ist das Verhalten des Kindes. Wenn wir hinter das konkrete Verhalten eines Kindes blicken, ist dieses Verhalten der Ausdruck von Gefühlen und Bedürfnissen. Wie ein Bedürfnis ausgedrückt wird, ist wiederum abhängig von verschiedenen Temperamentsdimensionen, auch genetischen Aspekten und den bisher gemachten Beziehungserfahrungen. Gerade wenn Kinder Verhaltensweisen zeigen, die den Zugang zu einer Gruppe erschweren oder auch den Aufbau einer Beziehung zur Bezugsperson in der Gruppe, lohnt es sich, hier genauer auf die Spur zu gehen, warum sich ein Kind wie verhält, um dann die Beziehungen durch dieses Wissen stärken zu können.
Selbstreflexion ist das A und O der Beziehungsarbeit
Dieser analytische, wertschätzende und ressourcenorientierte Blick hilft allerdings nicht nur, das aktuelle Verhalten von Kindern zu verstehen, sondern er kann auch helfen, uns selbst in den Blick zu nehmen und zu verstehen, wie wir mit einzelnen Kindern umgehen und warum wir vielleicht auch Unterschiede machen. Die Selbstreflexion und Arbeit an verinnerlichten Mustern ist gerade in Bezug auf Bindungsmuster essentiell, um Kinder wertschätzend und ressourcenorientiert begleiten zu können. In diesem Buch werden wir daher auch den eigenen verinnerlichten Mustern nachspüren, die unseren Blick auf Beziehungen und das Miteinander prägen: Bei jedem Themenbereich werden wir daher auch den eigenen Blick hinterfragen, schärfen und entzerren – am Ende eines jeden Kapitel gibt es Fragen zur Selbstreflexion.
Alle Impulse zur Selbstreflexion stehen im A4-Format als Download zur Verfügung – für eigene Notizen.
Schnell kann es passieren, dass wir das Verhalten eines Kindes bewerten und auf sein Tun reagieren. Stattdessen können wir ergründen, welche Gefühle und Bedürfnisse dem Verhalten zugrunde liegen und wie wir dort nachhaltiger ansetzen können. Wir dürfen auch prüfen, ob unsere eigene Wahrnehmung ein Teil des Problems sein könnte und wir durch eine bewertende, nicht ausreichend informierte oder erschöpfte Brille blicken – auf eigentlich normales kindliches Verhalten.
1 Beziehungen sind die Basis für Entwicklung
Wir haben Erfolg falsch definiert. Er besteht nicht aus Geld oder Titeln, sondern aus funktionierenden sozialen Beziehungen”, erklärt die Neurowissenschaftlerin Maren Urner (2024). Das Bindungssystem ist der Kern unseres menschlichen Seins und bestimmt unser Leben vom Anfang bis zum Ende. Am Anfang des Lebens ist das Kind auf das Bindungssystem als Sicherheitssystem für das Überleben angewiesen (Brisch 2010, S. 21), im weiteren Verlauf des Lebens bestimmen immer wieder Begegnungen mit anderen Menschen und das Eingebundensein in Gruppen, wie wir uns sehen, wie sicher wir uns fühlen, wie wir uns entwickeln können. Glücksforscher haben längst bestätigt, was der Psychoanalytiker Erich Fromm schon 1976 in seiner berühmten Schrift „Haben oder Sein: Die seelischen Grundlagen einer neuen Gesellschaft” beschrieben hat: Es gibt einen generalisierbaren Faktor, der für ein glückliches Leben bedeutsam ist: gute Beziehungen.
Was das nun mit der frühkindlichen Bildung und Betreuung in außerfamiliären Settings zu tun hat? Sehr viel: Wir haben nämlich in den vergangenen Jahrzehnten zu viel auf das falsche Pferd gesetzt: Leistungsförderung, fachliche Bildung, individuelle Leistung und auch Wettbewerbsgedanken sind in den Fokus gerückt. Dabei ist der Wert guter Beziehungen, des Miteinanders und sicherer Bindungen – eigentlich das Zentrum jeder Pädagogik – aus dem Blick geraten. Die Qualität der außerfamiliären Betreuung wird in der fachwissenschaftlichen und -politischen Diskussion meist entlang von fünf verschiedenen Dimensionen gemessen (Strehmel 2008): Prozessqualität (Kommunikation, Interaktion), Strukturqualität (Fachpersonal-Kind-Schlüssel, Raumgestaltung etc.), Orientierungsqualität (Leitbild, Werte etc.), Organisations- und Managementqualität (Leitung, Bewirtschaftung, Personalführung), Ergebnisqualität (Entwicklungs- und Bildungsergebnisse) –, wobei das Bindungssystem als wesentliches Verbindungsglied funktioniert: Unsere Beziehungen wirken auf Kommunikation und Interaktion, der Betreuungsschlüssel hängt mit Sicherheit, Vertrauen und Bindung zusammen, das Leitbild hängt von unserem Blick auf Beziehung und Bindung ab, Beziehungen zwischen Fachpersonen wirken in das Management hinein. Bindung und Beziehung stehen somit im Zentrum der Qualitätsdimensionen, interagieren mit ihnen.
Während die Strukturqualität frühpädagogischer Angebote in Deutschland stark geregelt ist und überprüft wird, stehen Bindung und Beziehung weitaus weniger im Fokus. Die Entwicklungspsychologin Margarita Stolarova, Mitarbeiterin des Deutschen Jugendinstituts, beschreibt die Situation: „Die strukturelle Qualität wird in Deutschland streng geprüft. Aber im Unterschied zu anderen Ländern kontrolliert niemand systematisch, was wirklich in den Kitas passiert und inwiefern die Kinder tatsächlich von der angebotenen Betreuung und Bildung profitieren, obwohl das entscheidend ist.” In der Tat: Was nützen bestens ausgestattete Kitas mit gutem Betreuungsschlüssel, wenn die Beziehungen nicht von Wärme und Respekt geprägt sind? Eine gute Qualität von Bindung und Beziehung aber ist die Basis für das Wohlbefinden. „Das Wohlbefinden des Kindes ist eine notwendige Voraussetzung für das Lernen. Kinder, die sich wohlfühlen, sind aufgeschlossen, Neues zu erfahren und zu entdecken. Sie können sich einbringen, sich als selbstwirksam erleben und dadurch auch weiterentwickeln”, führt Stolarova (2019) weiter aus. Sie knüpft mit diesem Befund an Untersuchungen des Bindungsexperten Karl Heinz Brisch an, der betont, dass es für „alle Bildungs- und Lernvorgänge [...] eine grundlegende Voraussetzung [ist], dass Kinder sich bindungssicher fühlen. Damit Kinder also von ihren Eltern, in der Krippe, im Kindergarten oder in der Schule lernen, neue Bildungsangebote aufnehmen und auch für sich in ihren inneren Welten verarbeiten können, müssen sie sich emotional sicher fühlen” (Brisch 2010, S. 27f.).
Bindung vor Bildung!
Die Formel „Bindung vor Bildung” wurde vom Bindungsexperten Karl Heinz Brisch geprägt. Sie ist mehr als nur ein einprägsames Statement: Es gibt verschiedene Studien, die gerade im Bereich der Schule nachweisen konnten, dass eine gute Beziehung zur Lehrperson ermöglicht, dass insbesondere neue Informationen – unabhängig vom Lehrstoff – besser aufgenommen werden können. Je mehr sich Schüler*innen mit ihren Lehrpersonen verbunden fühlen, desto mehr arbeiten ihre Gehirne in einer Art Gleichklang (Synchronizität). Durch diese Verbindung versteht man sich leichter, hat einen gemeinsamen Aufmerksamkeitsfokus und es fällt leichter, Inhalte aufzunehmen und zu lernen (Strüber 2024, S. 203f.). Dies gilt natürlich nicht nur für schulische Bildung, sondern auch für alltägliches Lernen.
Wie kann Bindung – als Basis von Bildung – in der außerfamiliären Betreuung verantwortungsvoll gestaltet werden? Brisch gibt hier einen ganz entscheidenden Hinweis, wenn er vor den negativen Auswirkungen warnt, die es haben kann, wenn die Bindungsqualität des pädagogischen Fachpersonals nicht ebenfalls in den Blick genommen wird. „Ist eine Krippenerzieherin, die zur Bindungsperson wird, selbst traumatisiert und hat diese traumatischen Erfahrungen aus ihrer eigenen Vergangenheit nicht verarbeitet, dann besteht eine große Gefahr, dass das Kind mit ihr eine desorganisierte Bindung oder gar eine Bindungsstörung entwickelt, vor allem, wenn es Gewalt oder emotionale Deprivation erfährt. Damit die Krippenerzieherin zu einer gewünschten und sehr gezielt ausgewählten sekundären Bindungsperson werden und damit als weitere Bindungsressource für das Kind dienen kann, muss sie alle Voraussetzungen für eine gute Pflegeperson erfüllen: Sie muss möglichst selbst Bindungssicherheit haben, muss emotional verfügbar sein und feinfühlig und prompt auf die Signale des Kindes eingehen” (Brisch 2022, S. 90). Was Brisch hier mit Bezug auf die Krippe formuliert, gilt auch für andere außerfamiliäre Settings der frühkindlichen Bildung und Betreuung: Die Reflexion der pädagogischen Fachkräfte auf eigene Bindungserfahrungen ist ein wichtiger „Faden“ in einem komplexen Bindungs- und Beziehungsnetz. Bindungen und Beziehungen sind durchaus schwerer zu evaluieren als Raumausstattungsmerkmale, Öffnungszeiten oder Personalschlüssel, aber es ist theoretisch möglich und vor allem praktisch bedeutsam, dass wir unseren Arbeitsfokus auf diesen Bereich verschieben.
Neben der Selbstreflexion der pädagogischen Fachkräfte sowie den Bindungen und Beziehungen zwischen Fachperson und einzelnem Kind gehören weitere Bindungen zum „Beziehungsnetz“: auch jene zwischen Kindern untereinander, aber auch die Strukturen zwischen Elternteilen und Kindern. Es ist wichtig, auch diese Beziehungen in den Blick zu nehmen – nicht nur, um Eltern bei Bedarf gezielte Unterstützung für eine sichere Bindungsgestaltung anbieten zu können, sondern auch, um die Bedeutung der Bindungsqualität im Kindergarten als Ergänzung und mögliche Stabilisierung zu verstehen. Dies ist besonders relevant, wenn die elterliche Bindung von Unsicherheit geprägt ist und das Kind im pädagogischen Setting verlässliche und sichere Beziehungen als Ausgleich erfahren kann. In einer kleinen Untersuchung an 60 Kindern in Sachsen-Anhalt konnte nachgewiesen werden, dass die Kinder der Untersuchungsgruppe aus sozial benachteiligten Familien Defizite in der Bindungsbeziehung zu ihren Müttern hatten, während sie jedoch gute Beziehungen zu ihren Bezugserzieherinnen hatten, die sich positiv auf das kindliche Verhalten in der Kita auswirkten und Aggressionen und Aufmerksamkeitsprobleme minderten (Eckstein-Madry et. al. 2016).
Eine kleine Wiederholung zur Bindungstheorie
Wenn wir davon sprechen, dass sich Kinder „bindungssicher“ fühlen sollen, wie Karl Heinz Brisch es formuliert, ist damit gemeint, dass sie in ihren Bezugspersonen ein sicheres Gegenüber finden, auf dessen Fürsorge und Schutz sie vertrauen können. Diese Art der Bindungsqualität wird mit zahlreichen Vorteilen in Verbindung gebracht. Wie oben bereits beschrieben, können Lern- und Entwicklungsangebote in bindungssicheren Beziehungen besonders gut angenommen werden. Zudem sind Kinder mit sicheren Bindungsbeziehungen widerstandsfähiger gegenüber psychischen Belastungen, leben eher in freundschaftlichen Beziehungen, schließen sich häufiger Gruppen an und verhalten sich in Konflikten prosozialer, weniger aggressiv und lösungsorientierter (Brisch 2010, S. 53). Die Direktorin des Staatsinstituts für Frühpädagogik, Fabienne Becker-Stoll, erklärt die vielfachen positiven Effekte einer sicheren Bindung folgendermaßen: „Dass eine sichere Bindung mit so vielen positiven Entwicklungsergebnissen zusammenhängt, lässt sich (…) dadurch erklären, dass sie die Grundlage schafft, um auf Anforderungen und Schwierigkeiten des Lebens flexibel und angemessen zu reagieren. So kann ein Kind mit sicheren Bindungserfahrungen beispielsweise besser um Hilfe bitten und diese auch annehmen, wenn es in eine missliche Lage geraten ist – angefangen von Streitereien im Kindergartenalter bis hin zu Sinnkrisen in der Pubertät” (Becker-Stoll et. al. 2018, S. 45).
Bindungssicherheit entsteht allerdings nicht in einem luftleeren Raum. Im Gegenteil: Wo von Sicherheit gesprochen wird, kann es auch den anderen Pol der Unsicherheit geben. Der Begründer der Bindungstheorie, John Bowlby, entwickelte zunächst entgegen der zu seiner Zeit vorherrschenden psychoanalytischen Triebtheorie die These, dass es zwischen einem Kind und seiner nahen Bezugsperson ein unsichtbares Band gäbe, das für die Entwicklung des Kindes bedeutsam ist und über die Zeit relativ konstant bleibt. Seine Beobachtungen zu Interaktionen und besonders auch den Folgen von langen Trennungen zwischen Mutter und Kind in den 1940er-Jahren bestätigten seine These. Die Psychologin Mary Ainsworth konnte sie mit Studien weiter untermauern und belegen, dass es verschiedene Typen von Bindung gibt. Die sichere Bindung wurde als Typ B beschrieben: Das Kind kann darauf vertrauen, dass seine nahe Bezugsperson sich um seine Bedürfnisse verlässlich kümmert. Gerade in schwierigen Situationen, die das Bindungsverhalten aktivieren, wie Angst oder anderer Stress, kann das Kind sicher darin sein, dass die Bezugsperson angemessen und verlässlich reagiert. Sie bietet sowohl Nähe und Schutz als auch Raum zur Selbstständigkeit und Erkundung. Es gibt allerdings auch Kinder, die erfahren, dass sich ihre Bezugspersonen nicht verlässlich um sie kümmern, auf ihre Gefühle nicht eingehen. Dieser Bindungstyp wird als Typ A beschrieben: die unsicher-vermeidende Bindung. Darüber hinaus gibt es noch einen weiteren Bindungstyp: Typ C, die unsicher-ambivalente Bindung, quasi eine Mischform der beiden anderen, da das Kind unterschiedliche Rückmeldungen zu seinen Bedürfnissen erhält und mal liebevoll, mal ablehnend, vielleicht auch mal ignorierend behandelt wird. Eine Studentin von John Bowlby und Mary Ainsworth, Mary Main, erweiterte später das System zur Bestimmung des Bindungstyps um eine weitere Kategorie: Typ D, die desorganisierte Bindung von Kindern, die starke Traumatisierung erfahren haben.
Die Bindungstheorie wurde im Laufe der Zeit weiterentwickelt, und ihr Schwerpunkt hat sich von der primären Erforschung der Mutter-Kind-Bindung auch anderen Bereichen zugewendet wie der Vater-Kind-Bindung, Bindungen in queeren Familien, Geschwisterbeziehungen und Großelternbeziehungen. Aus der Kritik an Bowlbys Fokus auf die Mutter-Kind-Beziehung und der Ausrichtung am westeuropäischen Kleinfamilienmodell haben Wissenschaftler*innen auch interkulturelle Aspekte von Bindung eingebracht, um die ursprünglichen Ansätze zu erweitern und zu verfeinern (Keller 2019).
Sicherheit und Vertrauen entwickeln sich aus der Interaktion mit Bezugspersonen in der Familie, in der außerfamiliären Betreuung, im Freundeskreis. Im Verlauf des Lebens können wir viele verschiedene Bindungsbeziehungen zu unterschiedlichen Menschen eingehen. Während Babys in den ersten Monaten noch bereitwillig Zuwendung und Fürsorge von allen Menschen annehmen, bildet sich in vielen Familien hierzulande um den siebten Monat die Präferenz für eine primäre Bezugsperson heraus (hierzulande häufig die Mutter, da sie mehr Sorgearbeit erbringt), und Primärbindungen entstehen. Das Kind bildet eine Hierarchie aus an Personen, an die es sich im Bedarfsfall wendet. Oft steht oben wie beschrieben die Mutter, dann der andere Elternteil, Großeltern und andere nahestehende Personen. Wie lang die Liste der Bezugspersonen sein kann, ist allerdings höchst unterschiedlich. Bindungsforscherin Mary Ainthworth stellte bei Untersuchungen in Uganda fest, dass auch Nachbarn Bindungspersonen eines Kindes werden können (Powell et al. 2013, S. 72). Zu jeder dieser Bezugspersonen kann die Bindungsbeziehung eine andere Qualität haben – je nachdem, welche Erfahrungen das Kind mit eben dieser Bezugsperson macht. Auch pädagogische Fachkräfte können Teil der Hierarchie werden.
Gehen pädagogische Fachkräfte Bindungen oder Beziehungen ein?
Vor dem Hintergrund der Bindungstheorie nach Bowlby und Ainsworth wird immer wieder diskutiert, ob pädagogische Fachkräfte in der außerfamiliären Betreuung nun Bindungen oder „lediglich“ Beziehungen zu den anvertrauten Kindern eingehen. Heidi Keller beschäftigt sich in zahlreichen Publikationen mit einem interkulturellen Blick auf Bindung und schreibt zur Bindungsfrage in ihrem Buch „Mythos Bindungstheorie” (2019, S. 97): „Diese ganze Diskussion mag vielleicht auch kulturspezifisch sein? Mir sind solche Diskussionen aus der internationalen Fachliteratur nicht bekannt. [...] Die Bedeutung, die der Unterscheidung zwischen Bindung und Beziehung in der Kitaarbeit gegenwärtig beigemessen wird, ist sicher mit moralischen Implikationen verknüpft. Erzieherinnen würden durch ein Beziehungskonzept von der Bürde entlastet, Bindungspersonen mit all den möglichen Konsequenzen für das Leben der Kinder zu sein. [...] Anstatt sich weiterhin in definitorischem Wirrwarr zu verzetteln, wäre es für die Situation von Erzieherinnen hilfreicher, wenn sie besser auf Beziehungen in und mit Kindergruppen vorbereitet würden, statt auf die dyadisch exklusive Erwachsenen-Kind-Beziehung zu fokussieren.”
Die Chemie sozialer Beziehungen
Gute Beziehungen und soziales Miteinander sind nichts, was sich unsichtbar zwischen uns entwickelt. Es gibt eine Chemie von sozialen Beziehungen sowie konkrete Vorgänge und Auswirkungen sozialen Handelns in unserem Körper: Beziehungen und Miteinander sind auch chemische Prozesse, die in unseren Körpern Einfluss nehmen auf unser Befinden. Im Zusammenhang mit der Chemie des Miteinanders wird das Hormon Oxytocin besonders oft genannt. Dieses „Bindungshormon” beeinflusst nicht nur den Aufbau von Bindungsbeziehungen ganz wesentlich, sondern wirkt auch darauf, wie wir soziale Situationen erleben und darin agieren. Die Neurowissenschaftlerin Nicole Strüber bezeichnet es daher auch als „Sozialhormon“ (2024, S. 20f.): Ausgeschüttet wird Oxytocin in unserem Gehirn beim Kuscheln und in anderen positiven Körperkontakten, im Miteinander und Spiel. Durch dieses Hormon wird ein Gefühl der Verbundenheit hervorgerufen. Gleichzeitig aktiviert Oxytocin auch das Dopaminsystem: Dopamin ist Teil des Belohnungssystems und vermittelt uns das Wissen, was gut für uns ist. Wir spüren nicht nur, dass wir zusammengehören, sondern dass wir dieses Zusammensein herstellen wollen. Zusätzlich werden auch noch körpereigene Opioide ausgeschüttet wie die Endorphine, die uns die Situation – sofern sie angenehm ist und alles zusammenpasst – auch noch genießen lassen und uns spüren lassen, dass wir uns in dieser sozialen Situation gut fühlen. Wir verinnerlichen: Wir gehören zusammen, ich mag dieses Zusammensein und möchte mehr davon genießen.
Trösten – die Chemie der sozialen Beziehungen nutzen
Oxytocin hemmt die Stresshormonfreisetzung und vermittelt Trost, Beruhigung und Entspannung. In Situationen der Angst, nach einer akuten Wutsituation, bei Trauer kann Oxytocin helfen, Kinder zu beruhigen: durch das Erleben eines positiven Miteinanders, durch respektvollen und angenehmen Körperkontakt oder körpernahe, verständnisvolle Interaktion. Trösten ist also auch eine Form der Chemie sozialer Beziehungen. Wir können positiven Körperkontakt bewusst einsetzen, um Kinder zu beruhigen und mehr noch: Oxytocin hilft zusätzlich auch dabei, die Gefühle anderer besser zu verstehen (Strüber 2024, S. 29). Kinder nach Streitsituationen zu trösten und dann mithilfe des freigesetzten Oxytocins in ein Gespräch über die Gefühle des anderen Kindes zu gehen, ist eine hilfreiche Strategie, die sich das Wissen um die Chemie der Beziehungen zunutze macht.
Die Chemie der Beziehungen sorgt nicht nur dafür, dass wir Verbindungen genießen und von positiven Verbindungen mehr haben wollen, sondern sie sorgt auch dafür, dass wir uns in Gruppen zusammenfinden und diese nach Möglichkeit nicht mehr verlassen wollen. Weil Gruppen und das Miteinander für uns Menschen so bedeutsam sind, verursacht der Ausschluss aus dem Miteinander soziale Schmerzen. Wir alle kennen Situationen, wenn Kinder in einer Gruppe traurig sind, weil ein Kind nicht mit ihnen spielen möchte oder sie sogar gänzlich aus einer Spielgruppe ausgeschlossen wurden. Solche Situationen weisen darauf hin, wie bedeutsam schon in jungen Jahren das Miteinander ist – und wie wichtig ein guter pädagogischer Blick auf Gruppenstrukturen im Alltag.