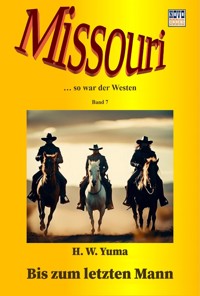
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: vss-verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Missouri
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Für den Bruchteil einer Sekund wurde Pike Caxton vom grellen Mündungsfeuer geblendet. Er spürte gleichzeitig wie ihm die Flasche entrissen wurde und vernahm den scharfen Knall, als das Glas in tausen Scherben zerbarst. So rasant wie er beginnt, geht der spannende Western des bekannten Autors H. W. Yuma bis zur letzten Zeile weiter. Ein besonderer Roman in unserer Reihe Missouri.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 131
Ähnliche
Bis zum letzten Mann
Heft
Bis zum letzten Mann
Bis zum letzten Mann
Hal Warner
Impressum
Copyright: Novo-Books im vss-verlag
Jahr: 2024
Lektorat/ Korrektorat: Franz Groß
Covergestaltung: Hermann Schladt
Verlagsportal: www.novobooks.de
Gedruckt in Deutschland
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie.
Das Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verfassers unzulässig
Für den Bruchteil einer Sekunde wurde Pike Caxton von grellem Mündungsfeuer geblendet. Er spürte gleichzeitig, wie ihm die Flasche entrissen wurde, und vernahm den scharfen Knall, als das Glas in tausend Scherben zerbarst.
Caxton stand betroffen und starrte auf den Flaschenhals, den er noch in der Hand hielt. Das Echo des Schusses pflanzte sich im Canyon fort und verhallte irgendwo zwischen den Felswänden.
„Sie haben schon wieder getrunken!“, rief eine scharfe Stimme. „Ohne den Fusel können Sie wohl nicht auskommen, wie?“
Ohne den Sprecher gesehen zu haben, wusste Caxton, dass er es mit Corporal Faulkner zu tun hatte. Caxton drehte den Kopf und starrte wütend auf den dicklichen Mann mit dem kalten, wachsamen Gesicht, der seine Faust um einen großkalibrigen Frontier-Colt klammerte.
Er hatte Faulkner nie gemocht, und er machte auch kein Hehl daraus. Jetzt musste er sich sogar mächtig beherrschen, um nicht zu vergessen, dass der andere sein Vorgesetzter war.
„Das habe ich mir ja gedacht“, fuhr Faulkner in derselben scharfen Tonart fort, als er vor Caxton stehenblieb. „Ihre Tricks kenne ich schon lange! Als Sie sagten, Sie wollten nach den Pferden sehen, wusste ich gleich, was Sie im Sinn hatten. Ich werde dafür sorgen, dass Sie nach unserer Rückkehr dort landen, woher Sergeant Weaverly Sie holte!“
„Meinetwegen“, knurrte Caxton. „Das macht mir nichts aus. Wenn ich im Gefängnis geblieben wäre, hätte ich es jetzt besser." Wütend schleuderte er den Flaschenhals zu Boden und wischte sich das Blut vom Gesicht, wo ihn die spitzen Glassplitter getroffen und die Haut geritzt hatten. Dann ging er an dem Corporal vorbei, bog um den großen Pittsburgh-Frachtwagen und lief zum Feuer, das zwischen dem Wagen und einer Felswand brannte. Faulkner folgte ihm wie ein bösartiger Hund.
Die Soldaten am Feuer waren aufgesprungen und sahen den beiden forschend entgegen. Unter ihnen war eine junge, blondhaarige. Frau, die eine Decke um die Schultern geschlungen hatte.
„Was ist los?“, rief Sergeant Weaverly ungehalten.
„Caxton hatte unter dem Wagensitz eine Whiskyflasche versteckt“, berichtete Faulkner. „Ich habe ihn dabei ertappt, wie er…“
„Deshalb brauchten Sie doch keinen Schuss abzugeben“, unterbrach ihn Weaverly ärgerlich. „Denken Sie an die Indianer, Faulkner! Falls zufällig welche in der Nähe sind, ist unser Platz jetzt verraten!“
Faulkner schnitt ein sauers Gesicht. Er hatte sich von seiner Meldung ein anderes Ergebnis erhofft. Außerdem war er viel zu ehrgeizig, um eine Rüge verdauen zu können, zumal, wenn diese in Anwesenheit von Untergebenen erfolgte.
„Wichtig ist vor allem die Moral“, versuchte er einzulenken. „Wenn sich die Leute nicht an die Anordnungen halten, kommen wir nie an unser Ziel. Captain Craig hat heute morgen vor der Abfahrt befohlen, dass wir keinen Alkohol mitnehmen dürfen. Oder stimmt das etwa nicht?“
Der grauhaarige, lederhäutige Unteroffizier nickte. „Doch, Faulkner. Ich weiß, was der Captain gesagt hat. Trotzdem war es ein Fehler, Caxton die Flasche aus der Hand zu schießen. Wenn die Apachen den Schuss gehört haben, haben wir sie spätestens morgen auf dem Hals.“
„Möglich“, gab Faulkner zu und holsterte nun endlich seinen Colt. „Aber wir werden von den Roten so oder so nicht unbemerkt bleiben. Außerdem sollen sie in letzter Zeit ziemlich friedlich gewesen sein.“
„Das kann man bei den Chiricahuas nie wissen“, versetzte Weaverly. „Die verkaufen einem heute ein Pferd und jagen einem am anderen Tag einen Pfeil zwischen die Rippen.“
„Der Sergeant hat recht“, sagte Corporal Sealy, ein schlanker, sehniger Mann, der bis dahin schweigend zugehört hatte. „Cochises Horden streifen ständig durchs Land, und niemals haben sie gute Absichten. Wenn sie erst herausbekommen, dass wir eine Frau bei uns haben, können wir unser Testament machen!“
Faulkner warf Sealy einen feindseligen Blick zu und schwieg.
Weaverly ergriff wieder das Wort. „Begehen Sie kein zweites Mal eine solche Dummheit, Faulkner! Verstanden?“
„Jawohl, Sergeant!“, entgegnete Faulkner mürrisch. Er drehte sich um und wollte zum Feuer gehen, blieb aber nochmals stehen und fragte: „Caxton haben Sie gar nichts zu sagen, Sergeant?“
„Doch“, versicherte Weaverly, „Bei mir kommt eins nach dem anderen. Ich vergesse nichts. — Caxton!“
„Sergeant?“
„Sie haben schon wieder getrunken! Dabei wissen Sie genau, dass ich auf dieser Fahrt keine betrunkenen Männer gebrauchen kann.“
Caxtons anfängliche Wut war bereits verraucht. Er war ein starker und mutiger Mann, aber er war dem Alkohol verfallen. Er konnte nicht dagegen an und versuchte es auch gar nicht mehr.
Nun grinste er breit und sagte: „Ich kann eine Menge vertragen, Sergeant.“
Weaverly nickte. „Ich weiß, Caxton. Aber als ich Sie aus dem Gefängnis holte, haben Sie mir versprochen, dass ich mich auf Sie verlassen könnte. Da habe ich vom Alkohol gesprochen!“
Caxton kratzte sich verlegen hinter dem Ohr und zog es vor, die Antwort schuldig zu bleiben.
Faulkner knurrte: „Wenn ich an Ihrer Stelle gewesen wäre, hätte ich den Kerl gar nicht herausgeholt, Sergeant. Ein Trinker hält nie sein Wort.“
„Ich vertraue Caxton immer noch“, erwiderte Weaverly. „Und nur wenige in unserer Garnison verstehen so gut wie er, einen Wagen zu lenken. Caxton war früher Frachtwagenfahrer. Deshalb habe ich ihn auch diesmal mitgenommen.“
Faulkner biss sich auf die Lippen. Dass Caxton ausgerechnet jetzt eine Anerkennung zu hören bekam, wurmte ihn gewaltig.
Um den Eindruck eines Lobes zu verwischen, sprach Weaverly seine nächsten an Caxton gerichteten Worte in etwas schärferem Ton. „Ich hoffe, Sie enttäuschen mich nicht mehr, Caxton. In dem Wagen dort befinden sich drei Gatling-Geschütze, die wir heil in Fort Apache abliefern müssen. Wenn wir das nicht schaffen, brauchen wir dem Captain nicht mehr unter die Augen zu treten. Jeder Einzelne von uns hat nur an unseren Auftrag zu denken. Ist das klar, Caxton?“
Caxton entblößte wieder grinsend seine weißen Zahnreihen und war froh, so billig davongekommen zu sein. „Jawohl, Sergeant!“, sagte er laut, dann ging er zum Feuer und ließ sich dort nieder.
Faulkner sah Weaverly an. „Ich bin davon überzeugt, dass noch einige Leute Whisky bei sich haben“, sagte er mit einem dünnen Lächeln. „Wir sollten dafür sorgen, dass die Flaschen eingesammelt werden, Sergeant.“
„Sie können recht haben“, brummte Weaverly. „Wer welchen hat, soll ihn sofort abgeben.“ Er blickte zum Feuer und rief: „Wer von euch hat noch Schnaps mitgenommen?“
Auf diese Worte hin herrschte Schweigen. Einige Männer räusperten sich. Und Weaverly wusste schon jetzt mit ziemlicher Sicherheit, wer die Anordnung des Captains missachtet hatte.
„Was glotzt ihr so dämlich?“, brüllte Faulkner plötzlich los. „Wollt ihr etwa warten, bis ich eure Sachen durchsuche? Ich fange gleich damit an, wenn ihr das Zeug nicht freiwillig abliefert! Wenn ich dann was finde, kann derjenige Gift drauf nehmen, dass ich ihn beim Captain melde!“
Weaverly hob beschwichtigend die Hand „Seid vernünftig und gebt den Schnaps heraus“, sagte er ruhig. „Dann will ich ein Auge zudrücken.“
Da erhoben sich die Soldaten. Einer nach dem anderen öffnete seine Satteltasche, und mehr oder weniger große Whisky- und Brandyflaschen kamen zum Vorschein.
Faulkner sammelte die Flaschen ein und ließ den Inhalt mit einem schadenfrohen Grinsen auslaufen.
Die Männer beobachteten mit ausdruckslosen Gesichtern, wie der Schnaps in der sandigen Erde versickerte. Pike Caxton fluchte leise in sich hinein.
Eine halbe Stunde später herrschte im Lager Ruhe. Die Soldaten hatten sich in ihre Decken gerollt und bildeten um das niedrig gehaltene Feuer einen sternförmigen Ring. Kate Asquitt, die blondhaarige Frau, lag im Wagen, wo man eine Ecke für sie freigehalten hatte.
Corporal Lorn Sealy schlief noch nicht. Er dachte über die Sache mit dem Whisky nach und über andere Dinge. Nicht zuletzt beschäftigten sich seine Gedanken auch mit der Aufgabe, die sie bewältigen mussten. Er und seine neun Kameraden.
Er wusste, dass sie keine großen Chancen hatten, wenn es zu Reibereien mit den Apachen kommen sollte.
Es war vorgestern gewesen, als der Captain Sergeant Weaverly den Auftrag gegeben hatte, die drei Schnellfeuergeschütze nach Fort Apache zu bringen. Die dazu gehörige Munition sollte vorsichtshalber ein andermal befördert werden. Zwar wussten die Indianer mit Gatling-Geschützen nichts anzufangen, aber in den Bergen gab es starke Banden weißer Banditen, die sich keine bessere Beute wünschen konnten. Mit Gatlings ausgerüstet, würden ihre Festungen uneinnehmbar werden. Das war der Grund, warum die Munition für die Geschütze in Fort McDowell zurückgeblieben war.
Dafür war den Soldaten eine zusätzliche Aufgabe übertragen worden, an der sie nur wenig Freude hatten. Im letzten Moment hatte der Captain dem alten Sergeant erklärt, dass Kate Asquitt, die in Fort McDowell als Sängerin aufgetreten war, beabsichtigt, in Fort Apache neu zu beginnen, Warum, wusste niemand.
Sealy hätte es besser gefallen, wenn Kate alt und hässlich gewesen wäre. Aber sie war jung und auffallend hübsch, und nichts war gefährlicher, als eine Frau wie sie mit durch das Apachenland zu nehmen. Vor allem dann, wenn die Mannschaft so klein war wie in diesem Fall, aber Captain Craig hatte nicht mehr Leute entbehren können.
Heute morgen waren sie aufgebrochen. Sie hatten bereits ein Fünftel der Wegstrecke geschafft. Wenn nichts dazwischenkam, mussten sie bis Dienstagabend Fort Apache erreichen. Noch hundert Meilen lagen von ihnen, aber auf jeder einzelnen Meile konnten Tod und Verderben lauern.
Als leise Schritte ertönten, drehte Lorn Sealy den Kopf. Ein riesengroßer Schwarzer tauchte aus der Finsternis und trat in den matten Schein des Feuers. Das Gesicht unter dem Hut war dunkel wie poliertes Ebenholz. Fast weiß leuchteten die Augen. Er beugte sich über Dudley Hood und rüttelte ihn an der Schulter. „Aufstehen, Dud! Du bist jetzt dran“, sagte er leise.
Hood erhob sich, packte seine Springfield-Rifle und trat aus dem Feuerschein, um für die nächsten zwei Stunden vom Rand des Lagers aus die Schlucht zu beobachten.
Der Schwarze legte Holzstücke auf die Glut, und bald flackerten die Flammen wieder etwas höher empor und verbreiteten eine angenehme Wärme. Obwohl dieses Land bei Tag fast in Hitze erstarrte, war es in den Nächten empfindlich kühl. Das rührte von den Felsen und dem Sand her, die die Sonnenwärme schnell aufsogen.
Neben Sealy rollte sich der Schwarze in seine Decken. Er merkte, dass Sealy noch wach war, und fragte leise: „Was war vorhin los? Wer hat geschossen?“
Der Corporal erklärte es ihm kurz. Er sprach dabei mit gedämpfter Stimme, tun die anderen nicht zu stören.
„Schlaf jetzt, Bosworth“, sagte er dann. „Wer weiß, ob wir in den nächsten Tagen noch viel zum Schlafen kommen werden.“
Der Schwarze drehte sich auf die andere Seite, und bald schnarchte er regelmäßig.
Sealy, der noch geraucht hatte, zerdrückte den Rest seiner Zigarette und zog dann den Hut übers Gesicht. Er schlief ein, obwohl jetzt die Kojoten im Canyon um die Wette heulten.
*
Die Sonne hielt sich hinter dem Ostrand des Canyons versteckt, als Otis Cockerell, der die letzte Wache hatte, seine Kameraden aus dem Schlaf rüttelte.
„War alles ruhig?“, fragte Weaverly, der als einer der Ersten auf den Beinen stand.
„Ja, Sergeant“, antwortete Cockerell. „Auch die Kojoten haben endlich zu heulen auf gehört.“
„Haben Sie einen davon zu Gesicht bekommen?“
„Keinen einzigen.“
„Hm“, meinte Weaverly und kratzte sich am Kinn. „Irgendwie gefällt mir das nicht.“
„Sie glauben, dass es keine richtigen Kojoten waren?“
„Möglich“, sagte der Sergeant nachdenklich.
„Wenn Apachen in der Nähe wären, hätten sie längst angegriffen“, behauptete Corporal Faulkner. „Besonders gern tun sie das bei Morgengrauen. Da es aber still bleibt, waren es echte Kojoten, die das nächtliche Konzert veranstaltet haben. Dass die Wachen keins von den Tieren zu Gesicht bekamen, ist kein Beweis für die Anwesenheit von Indianern.“
Niemand antwortete. In kleinen Gruppen eilten die Soldaten zum nahen Bach, um sich zu waschen und zu rasieren. Lorn Sealy hielt am Ufer sorgfältig nach Spuren Ausschau, fand aber weder einen Fußabdruck noch sonst irgend etwas, das auf Indianer hingewiesen hätte.
Als Sealy zum Feuer zurückkehrte, hielt Chad McDuff einen großen Topf schwarzen Kaffees bereit. In einer Pfanne brutzelten Speckscheiben. Kate Asquitt war McDuff bei der Zubereitung des Frühstücks behilflich.
Die Männer holten ihre Becher und schöpften sie mit Kaffee voll. McDuff verteilte Brot und Speck.
„Beeilt euch mit dem Essen!“, sagte Weaverly. „Wir wollen weiter, bevor die Sonne kommt.“
Lorn Sealy hockte sich wie die anderen auf seinen Sattel. Während er sein Frühstück verzehrte, verfolgte er, wie Kate in den Wagen kletterte und mit einem Kleiderbündel und einigen Toilettengegenständen wieder herauskam.
„Entfernen Sie sich nicht zu weit“, rief ihr Weaverly zu. Als sie ein paar Schritte weg war, sagte er zu den anderen: „Keiner von euch geht jetzt zum Bach!“
Die Männer grinsten und kauten schweigend weiter.
Als die Soldaten mit dem Essen fertig waren, sattelten sie sofort ihre Pferde. Es waren alles hochbeinige, gut gepflegte Tiere. Caxton spannte die Zugtiere vor den Wagen.
Plötzlich ließ ein spitzer Schrei die Männer zusammenfahren. Sealy, der eben den Sattelgurt strammgezogen hatte, riss seinen Colt aus der Holster und rannte bereits los, ehe die anderen begriffen hatten.
Mit Riesensprüngen hetzte er zum Bach und auf den Busch zu, hinter dem Kate Asquitt verschwunden war. Sealy sah schon im Geiste, wie eine Apache Kate den Mund zuhielt.
Mit einem Satz erreichte er den Busch und rannte um ihn herum. Außer Kate war niemand da.
„Entschuldigen Sie“, sagte er verwirrt. „Aber ich dachte…“
„Es ist nichts“, versicherte die Sängerin. „Ich habe nur geschrien, weil…“
„Sie bluten ja an der Hand!“, unterbrach sie Sealy.
Kate lächelte. „Es war ein Krebs, Corporal. Als ich ins Wasser griff, hat er mich gezwickt. Aber es ist nicht weiter schlimm.“
Hinter Sealy nahten nun eilige Schritte. Nacheinander kamen seine Kameraden heran und machten verdutzte Gesichter, als sie Sealy und Kate so friedlich beisammen stehen sahen.
„Es sind keine Apachen da“, sagte Sealy. „Verschwindet, Jungs! Kate braucht eure Hilfe nicht. Ein Krebs hat sie erschreckt.“
Grinsend zogen die Männer wieder ab. Als der Corporal ins Lager zurückkam, war alles schon aufbruchsbereit.
Als Kate fertig war, gab Sergeant Weaverly den Befehl zum Aufsitzen. Binnen einer Minute hatte sich die kleine Abteilung formiert. Sergeant Weaverly und Corporal Sealy bildeten die Spitze. Hinter den beiden hockten Dudley Hood und der stets mürrische Arch Bucknell reitfertig im Sattel. Dann kam der Wagen, in dem die Gatling-Geschütze verladen waren. Auf dem Bock saßen Pike Caxton, der bärenstarke Schwarze Eugene Bosworth und Kate Asquitt. Sicherheitshalber befand sie sich zwischen den beiden Männern.
Einige Yards hinter dem Wagen warteten Cockerell und McDuff auf ihren Pferden. McDuff hatte es noch immer nicht verwunden, dass er mit nach Fort Apache musste. Vor einiger Zeit hatte er den Abschied von der Armee eingereicht. Es waren nur noch zehn Tage, die er viel lieber in Fort McDowell verbracht hätte. Doch Sergeant Weaverly bestand darauf, McDuff mitzunehmen, weil er für diesen gefährlichen Auftrag gute Leute brauchte. Er hatte dem jungen Iren versichert, dass sie spätestens in neun Tagen wieder nach Fort McDowell zurückkommen würden. Er konnte die Uniform noch rechtzeitig ausziehen. Das aber war nur ein schwacher Trost für den jungen Soldaten.
Corporal Faulkner und ein Soldat namens Whisner bildeten die Nachhut.
„Vorwärts!“, kommandierte Weaverly.
Die Reiter trieben ihre Pferde mit Schenkeldruck an. Caxton knallte mit der Peitsche. Die Zugtiere legten sich in die Riemen. Der schwere Wagen ächzte. Die Räder begannen sich zu drehen.
Vor den Soldaten weitete sich der Long Canyon mit seinen zerklüfteten Felswänden. Eiskalt und kristallklar floss der kleine Creek dahin. Der Boden war sandig und mit Steinen übersät. Überall wuchsen Sykomoren, dornige Josuahbäume und Yuccas mit ihren leuchtend roten Blüten. Zwischen den Steinen und am Bachufer zeigte sich blaugrünes Hartgras.





























