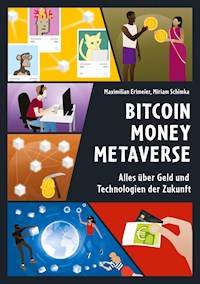
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Was hat Bitcoin mit der teuersten Pizza der Welt zu tun? Warum waren plötzlich überall bunte NFT Affen zu sehen? Weshalb ist finanzielle Inklusion so wichtig? Aufbauend auf den Grundlagen von Geld und Wirtschaft führt das Buch 'Bitcoin Money Metaverse' Jugendliche ab 12 Jahren sowie Einsteiger jeden Alters in aktuelle Themen rund um Kryptowährungen, Blockchain, NFT bis hin zum Metaverse ein. In Erzählform erklären die Autoren in lockerer Sprache, was es mit diesen Phänomenen auf sich hat und blicken gemeinsam in die Zukunft: Erleben wir hier gerade die nächste große Revolution nach dem Internet? Zahlreiche Illustrationen, Info-Kästen und ein Glossar tragen zur Anschaulichkeit bei. Am Buchende wird das White Paper des Bitcoin Erfinders Satoshi Nakamoto einfach erklärt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 92
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für Elias und Lilith
INHALT
Münzen, Mining, Metaverse
Geld ist Vertrauenssache
Geldumlauf, Inflation und Baklava
Ein Interview mit Satomi Nakamoto
Die Blockchain-Technologie und wie man Sicherheit schafft
Bitcoin, Bäume und die Blockchain
Von Deutschland nach Venezuela
Ziemlich Smarte Contracts und eine Riesenmenge Geld
Zocken unter Freunden
NFTs, Pokémon und teure kleine Affen
Meta, Meta, Meta!
YouTube und mehr
Satoshi Nakamotos White Paper
Glossar
MÜNZEN, MINING, METAVERSE
Am Abend des letzten Ferientages lehnte Oskar sein Fahrrad an die Mauer des Supermarkts. Kurz darauf hatte er drinnen gefunden was er suchte, legte eine Tüte Chips aufs Band und zückte an der Kasse sein Handy, auf dem eine Kreditkarte hinterlegt war. Es piepste, als er es an das Kartenlesegerät hielt. Auf dem Handy Display war ein großer grüner Haken zu sehen: Bezahlt.
Wenig später stand er mit dem Einkauf vor der Tür seines besten Freundes und klingelte. Mo machte nach einiger Zeit mit einem Schwung die Tür auf und grinste: „Was zu essen mitgebracht? Komm rein, die Playstation wartet schon auf uns.“ Oskar wedelte als Antwort nur mit der Chipstüte und folgte ihm ins Wohnzimmer.
Am nächsten Tag ging die Schule wieder los. Die Schülerinnen und Schüler der 10b kamen langsam ins Klassenzimmer geschlendert. Oskar war noch müde, sie hatten bis 2 Uhr morgens gespielt. Er setzte sich auf seinen Platz und nickte Mo zu, der auch noch nicht ganz frisch aussah. Herr Mener saß schon vorne am Pult und räusperte sich. „Ruhe bitte, die Stunde geht los.“ Endlich wurde es etwas stiller und der Lehrer begann zu sprechen. „Im ersten Halbjahr haben wir in unserem Wirtschaftskurs ja schon einiges an Theorie gelernt. Das wollen wir nun gemeinsam in die Praxis umsetzen. Ich habe euch einige sehr aktuelle Themen herausgesucht, die ihr in Gruppen bearbeiten sollt.“ Er klickte an seinem Laptop herum und folgende Punkte erschienen auf dem Whiteboard:
Entstehung von Geld Geldumlauf und Inflation Bitcoin Blockchain Finanzielle Inklusion Smart Contracts Non Fungible Token (NFT) Metaverse
„Wie ihr seht“, sagte Herr Mener, „wollen wir eine Reise durch die Geschichte des Geldes machen. Wir fangen beim Tauschhandel an und arbeiten uns dann zu neuen Erscheinungsformen wie Bitcoin und Smart Contracts vor, bis wir im Metaverse ankommen. Es klingt zwar abgedroschen, aber Geld regiert die Welt und es ist wichtig, dass ihr euch damit auskennt. Wo und wie es zum Einsatz kommt, hat sich außerdem in den letzten Jahren stark verändert.“
Sofort schnellte ein Finger in die Höhe, es war der von Luca. „Wie sollen wir das umsetzen?“ fragte er. Die Augen der Klasse waren auf den Lehrer gerichtet.
„In Form von Präsentationen. Ich gebe euch nur die Rahmenbedingungen vor. Es sollen mündliche Vorträge sein und ich werde euch in Dreier-Gruppen einteilen. Wie ihr die Vorträge gestaltet, bleibt euch überlassen. Aber ihr wisst ja: Ich finde es gut, wenn es nicht langweilig ist.”
Louis verdrehte die Augen. Er war kein Fan von „kreativer” Gruppenarbeit. Zumindest nicht in der Schule. Trotzdem schaffte es der Lehrer, Louis mit seinem nächsten Satz für sein Projekt zu interessieren: „Vielleicht interessiert es euch zu hören, dass euer Projekt in die Endnote einfließt?“
Nicht nur Louis, sondern die ganze Klasse spitzte jetzt die Ohren, um die Details der Projektarbeit nicht zu verpassen.
„Ihr bekommt jeweils 30 Minuten Zeit für den Vortrag und danach diskutieren wir. Wie ihr an der Gliederung schon sehen könnt, sollten alle Themenbereiche einen wirtschaftlichen Bezug haben. Bitte denkt auch daran, dass ihr euch etwas einfallen lasst, um eure Vorträge anschaulicher zu machen. Zum Beispiel mit Grafiken, einem Poster, Videos, von mir aus auch mit einem Gast. Ich habe mir übrigens auch etwas überlegt, wenn ihr unter euren Stühlen schaut, findet ihr einen Zettel. Da ist eine Zahlenkombination drauf. Die müsst ihr entschlüsseln, dann findet ihr eure Partner und mehr will ich auch gar nicht verraten.“
Hannah, die bisher nur mit halbem Ohr zugehört hatte, griff unter ihren Stuhl und fand ihren Zettel auf dem die Zahlen 5 – 14 – 20 standen.
Sie zog ihre rechte Augenbraue hoch. Erst addierte sie die Zahlen, dann multiplizierte sie, doch irgendwie kam nichts dabei raus, was ihr richtig einleuchtete. Dann hörte sie, wie Maja, die eine Reihe hinter ihr saß, sagte: „Also bei mir kommt S-T-E-H raus, wenn ich die Zahlen in Buchstaben übersetze. Was soll das bedeuten?“
Da fiel bei Hannah der Groschen. Sie drehte sich lächelnd zu Maja um: „Ich glaube, wir haben gemeinsam das erste Thema, ich habe E-N-T. Fehlt nur noch U-N-G. Hat das jemand?”
„Ja ich!”, antwortete jemand aus der letzten Reihe. Es war Paul. Die Gruppe war komplett.
Das Rätsel, das sich Herr Mener ausgedacht hatte, war die einzelnen Buchstaben durch Zahlen zu verschlüsseln, also eine einfache Form von Kryptographie. Die Schülerinnen und Schüler mussten einfach die Zahlen in Buchstaben umwandeln, um ihre Gruppe zu finden.
GELD IST VERTRAUENSSACHE
Am nächsten Freitag war es dann so weit: Showtime! Hannah, Maja und Paul hatten sich gut vorbereitet und mit Herrn Mener abgesprochen. Sie hatten sich die Arbeit aufgeteilt.
Hannah und Paul würden sprechen, während Maja das Ganze grafisch an der Tafel begleitete.
Hannah begann zu sprechen.
„Geld gibt es schon sehr lange. Die ersten Münzen hat der lydische König Krösus vor gut 2650 Jahren in Umlauf gebracht. Vorher haben die Menschen anderes Geld benutzt, zum Beispiel Muscheln oder Schmuck.“
Maja zeichnete schnell ein paar Muscheln, während Hannah durch die Geschichte des Geldes führte.
„Da Krösus so viel Geld angehäuft hatte, gibt es auch heute noch das Sprichwort „Reich wie Krösus sein.” Doch bevor die Menschen begonnen haben Muschelgeld zu benutzen, haben sie einfach Waren gegeneinander getauscht. Wenn zum Beispiel ein Bauer besonders viel Getreide hatte, konnte er das was er selbst nicht benötigte, gegen etwas anderes tauschen, vielleicht gegen Milch von seinem Nachbarn. Allerdings hat das mit der Tauschwirtschaft irgendwann nicht mehr so gut funktioniert.”
„Das liegt am Prinzip von Angebot und Nachfrage. Denn wenn unser Getreidebauer zu viel hat, sein Nachbar aber nicht gerade Tonnen von Brot backen will, steht er erstmal doof da. Da wird dann Geld nützlich. Denn so kann er das Getreide, das er nicht mehr braucht, gegen Geld wechseln und sich damit kaufen, was immer er gerade benötigt. Irgendwann haben die Menschen angefangen, sich zum Handeln zu treffen, etwa auf Märkten oder Börsen. Das war die Weiterentwicklung des Tauschhandels.”
„Geld ist also vor allem deswegen so praktisch, weil Nachfrage und Angebot nicht immer zusammenpassen. Deshalb war es bei den frühen Formen von Geld besonders wichtig, dass man es gut tauschen kann. Jede Muschel oder Münze sollte also gleich viel wert sein. Dass jede Einheit untereinander austauschbar ist, ist heute noch eine wichtige Eigenschaft von Geld. Man sagt auch, dass es fungibel ist.“
Hannah ordnete kurz ihre Notizen, betrachtete die Münzen, die Maja gemalt hatte und holte tief Luft. Dann sprach sie weiter.
„Das erste Papiergeld gab es im Jahr 993 in China. Rebellen belagerten damals die Stadt Chengdu und die Menschen dort hatten bald zu wenig Münzen, um sich gegenseitig weiterhin zu bezahlen. Irgendjemand kam dann auf die Idee, einfach Zahlen auf Papier zu schreiben. Das war eine Ergänzung zu den Münzen aus Metall, die schon im Umlauf waren.“
„Hat das funktioniert?“, unterbrach Finn den Vortrag.
„Ja, das hat es!“, bestätigte Hannah, die kurz aus dem Konzept gebracht worden war.
„Heute spricht man hier von Fiatgeld“, fuhr sie fort, „Fiat kommt aus dem Lateinischen und bedeutet so viel wie Es werde oder auch Es geschehe. Denn Papiergeld ist eigentlich nur ein Tauschmittel. Im Gegensatz zu den alten Münzen, die aus Eisen oder auch aus Gold bestanden, ist Papier eigentlich nichts wert. Nur eben das Versprechen, dass wir nachher etwas für das Papier bekommen.“
Hannah sah, dass einige aus der Klasse die Stirn runzelten.
„Also nochmal“, versuchte sie es weiter, „zuerst gab es Münzen aus Gold oder Eisen. Die haben beide an sich schon einen eigenen Wert. Denn aus Eisen kann man etwas schmieden, aus Gold kann man zum Beispiel Schmuck machen. Die alten Münzen hatten einen eigenen Wert, man spricht hier auch von intrinsischem Wert. Aus Papier kann man höchstens Hütchen oder Papierflieger basteln. Maja ergänzte „oder es als Klopapier benutzen.“ Die Klasse lachte. Hannah wartete kurz, fuhr dann aber fort „daher muss man darauf vertrauen, dass man nachher etwas für sein Papier bekommt. Deswegen nennen wir es Fiatgeld. Das hat auch damit zu tun, dass Herrscher und Staaten das Geld wie aus dem Nichts erschaffen. Den Menschen bleibt nichts anderes übrig, als darauf zu vertrauen, dass es etwas wert ist.“
Zögerliches Nicken in der Klasse. Jetzt übernahm Paul den Vortrag.
„Das war allerdings nicht immer so. Früher gab es mal den so genannten Goldstandard, den die Menschen 1871 eingeführt haben. Das bedeutete, dass alle Länder, die dabei mitmachten, sich dazu verpflichteten, dass es stabile Wechselkurse gibt. Alle Währungen waren an Gold gebunden. So konnte man sich immer darauf verlassen, dass man für eine bestimmte Menge Geld eine bestimmte Menge Gold bekam. Als der erste Weltkrieg begonnen hatte, hat man den Goldstandard vorerst aufgelöst. Im Jahr 1944 führten verschiedene Länder dann das Bretton-Woods-System ein. Das funktionierte nach einem ähnlichen Prinzip. Alle Länder, die daran teilnahmen, einigten sich darauf, den US-Dollar als gemeinsame Leitwährung zu nutzen.”
Paul fuhr er fort.
„Die USA verpflichteten sich im Gegenzug dazu, dass man bei der US-Notenbank zu jeder Zeit 35 US-Dollar gegen eine Feinunze Gold tauschen könnte. Das Versprechen konnten sie aber nicht lange halten und den Forderungen irgendwann nicht mehr nachkommen. Das führte dazu, dass das Bretton-Woods-System im Jahr 1973 aufgelöst worden ist. Im Nachhinein haben die ehemaligen Mitgliedsländer auch ihre Bindung an den US-Dollar gelöst. Eine Garantie, für einen bestimmten Preis eine bestimmte Menge Gold zu bekommen, gab es somit nicht mehr. Umso mehr waren die Menschen dann darauf angewiesen, ihren Regierungen und Banken zu vertrauen, dass sie für ihr Geld etwas bekommen würden und dass diese keinen Unfug mit ihrem Geld treiben.”
Maja hatte inzwischen einige Goldbarren gezeichnet. Als Paul vom Ende des Goldstandards erzählt hatte, hatte sie beides mit einem fetten Kreuz durchgestrichen und einen traurigen Smiley daneben gemalt.
„Den Menschen blieb also nicht viel anderes übrig, als ihren Staaten und Banken Vertrauen zu schenken. Zu diesem Vertrauen gehört es auch, dass die Zentralbanken dafür sorgen, dass man das Geld nicht fälschen kann. Sonst könnte jeder kommen und sagen, dass sein Papier etwas wert ist. Wenn ihr heute auf die Euroscheine schaut, findet ihr auch immer Wasserzeichen und noch ein paar weitere versteckte Sicherheitszeichen. Ich zeig es euch.“
Paul holte einen Fünfzig-Euro-Schein aus der Tasche und hielt ihn gegen das Licht. Als er ihn bewegte, konnte die Klasse die Wasserzeichen erkennen. Er gab ihn Finn in die Hand, der am Tisch ganz vorne saß: „Probiere es gerne mal aus und gib ihn dann bitte weiter.”
Er ging zurück nach vorne, während der Geldschein durch die Klasse gereicht wurde und hielt einen Schein in die Höhe.
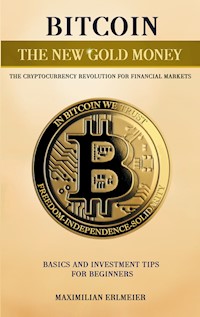














![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)













