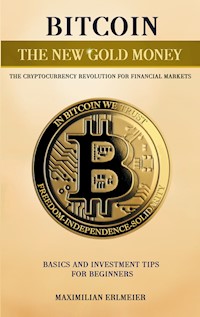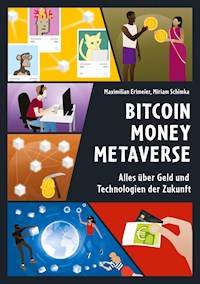Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Bitcoin und die Blockchain: Eine Zukunftstechnologie oder doch mehr Schein als Sein? Dieses Buch räumt mit Vorurteilen auf und bietet einen leicht verständlichen und doch fundierten Einstieg in die Materie. Es vermittelt die wichtigsten Grundlagen rund um Bitcoin und zeigt auf, warum Bitcoin nicht nur "digitales Gold" ist, sondern eine digitale Revolution ankündigt. Autor Maximilian Erlmeier, selbst erfolgreicher Unternehmer und Krypto-Investor gibt wertvolle Hinweise, was man benötigt, um die nächste technologische Revolution nicht zu verpassen. Ohne sich in technische Details zu verlieren erklärt er, warum Bitcoin das Potential hat, die Gesellschaft und die globale Verteilung des Vermögens von Grundauf zu verändern.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 137
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für meine Enkel Lilith und Elias
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
1.
Geld regiert die Welt
Gold als unbestechlicher Geldanker
Fazit: Unser Geld- und Finanzsystem ist krank
2.
Problem und Lösung: Die nächste große Revolution?
Satoshi Nakamoto und der Siegeszug des Bitcoins
Der Wert des Bitcoins
Das digitale Gold
Bitcoin versus Gold
"Bitcoin regelt das!" – Was die Kryptowährung einzigartig macht
Große Ideen – Mächtige Feinde
Die entscheidenden Fragen
3.
Wissen, Facts & Figures
Der Siegeszug der Distributed-Ledger-Technologien
Grundbegriffe. Kurz und knapp.
Blockchain hui, Bitcoin pfui?
Bitcoin – keine anonyme digitale Währung
Bitcoin, Proof of Work und der Energieverbrauch – ein unlösbares Problem?
Fazit
4.
Satoshi Nakamotos "White Paper" – Die Lösung für die Kernfragen einer soliden Finanzwirtschaft
5.
Blockchain-Technologie: Das "neue Internet"
Blockchain-Technologie: Ein Game-Changer
Der Gartner-Hype-Zyklus
Fazit zur Blockchain-Technologie
6.
Ethereum und andere Kryptoprojekte
Vitalik Buterin – ein weiteres Blockchain-Genie
Was ist Ethereum?
Smart Contracts und ihre Anwendung
Proof of Stake
Initial Coin Offerings – Neue Coins auf Knopfdruck
Decentralized Finance (DeFi)
Non fungible Token (NFT)
Security Token Offerings (STOs)
Fazit zum ersten Teil: Auf dem Weg zur Revolution
7.
Bitcoin und Krypto-Investments: Die große Chance
Spekulation oder Investment?
Investment 1x1
Antizyklisches Investieren
Cost-Dollar-Average: Der Bitcoin-Sparplan
Die Bitcoin-Zyklen: Garantie für Kursanstiege?
Krypto-Lending: Zinsen auf Kryptowährungen
Staking
Was ist der Bitcoin wert?
Spekulationsblasen am Krypto-Markt
Fazit
8.
Finanzielle Freiheit
Erste Schritte: Was Sie brauchen
Online-Wallet: Die "heiße" Variante
Cold Wallet: Die sichere Variante
Was für Profis: Paper Wallet
9.
Risiken und Chancen
Das Bitcoin-Verbot
Energieverbrauch und Umweltbewusstsein
Quantencomputer
Volatilität
Kryptokonkurrenz
Keine staatliche und institutionelle Überwachung
Inflationsschutz und Reservewährung
Digitale Knappheit
Der neue Goldanker
10.
Meine Investitionen
Von Gier und ruhigen Händen – was ich gelernt habe
Meine Prognose: Bitcoin Quo Vadis?
Investitionen - mein Zukunftsplan
Epilog: Gesellschaftliche Auswirkungen und humane Marktwirtschaft
"Inflation ist ein Übel" – wie die Humane Marktwirtschaft und Bitcoin zusammenpassen
Danksagung
Disclaimer
Anhang: Das Bitcoin White Paper
Quellen und weiterführende Literatur
Vorwort
Am 03. Januar 2009 war es so weit. Eine neue Technologie erblickte das Licht der Welt: Ein digitales, dezentrales Geldsystem. Doch was bedeutet das für die Gesellschaft? Und warum ist es so wichtig, hier den Anschluss nicht zu verpassen? Diesen Fragen wird dieses Buch nachgehen.
Aber eins vorweg. Dieses Buch will nicht belehren, während es sich in technische Details verstrickt. Ziel ist es, Ihnen dabei zu helfen, sich selbst ein Urteil zu bilden. Ist was dran an dieser Bitcoin- und Blockchain-Revolution? Oder haben wir es, wie Starinvestor Warren Buffett einmal sagte, doch nur mit "Rattengift" zu tun?
Auf dieser Lesereise werden wir gemeinsam der Frage nachgehen, ob Bitcoin und die Blockchain-Technologie das Potential haben, gesamte Wirtschaftsbereiche und -Abläufe besser, schneller, effizienter und preiswerter zu machen. Außerdem werden wir einen Blick auf Ethereum werfen – die zweitgrößte Kryptowährung nach Bitcoin. Anschließend werden wir abwägen, ob es sinnvoll ist, in diesen Bereichen als Investor einzusteigen. Vielleicht finden wir ja gemeinsam – im Investment-Sinne – das neue Amazon oder Google?
Fest steht: Die Blockchain-Technologie ermöglicht schon heute den weltweiten Austausch von Geld, Wert und Verträgen. Nichts Neues, denken Sie? Doch! Denn mit der Blockchain-Technologie funktioniert dieser Austausch, ohne, dass man von Dritten und Mittelsmännern abhängig ist. Davon können Menschen auf vielen Ebenen profitieren; von der Privatperson bis hin zu großen Unternehmen.
Grund genug, in dieses Gebiet einzutauchen. Und zwar in einfacher und verständlicher Sprache. Ohne Schnickschnack, aber nicht ohne Informationsverlust.
Denn die Dezentralisierung kann Menschen ein Stück ihrer Freiheit und Selbstbestimmung zurückgeben - und zwar von Konzernen, Staaten und Banken. Eine Chance, die man ergreifen sollte.
Allen, die diese Chance nachher als Investment nutzen wollen, soll dieses Buch helfen. Mit praktischen Tipps für den Einstieg in die Welt der Kryptowährungen und dem nötigen Hintergrundwissen, um bei der nächsten technologischen Revolution nicht abgehängt zu werden.
Denn gerade bei neuen und komplexen Technologien gilt wie immer die "Goldene Investoren-Regel": Investiere NIE in Geschäfte, von denen Du nicht wenigstens die Grundbegriffe verstehst. Jeder muss sich über die Chancen und Risiken ein eigenes Bild machen, bevor er oder sie Geld in die Hand nimmt!
Übrigens: Weil wir es hier mit einer so neuen und stets im Wandel befindlichen Technologie zu tun haben, wird die elektronische Version dieses Buch regelmäßig aktualisiert. Und da sehr viele Fachbegriffe, Artikel und Berichte in Englisch sind, werden Sie beide Sprachen in diesem Buch vorfinden.
Nun aber erst einmal: Viel Freude mit der Lektüre!
Ihr
Maximilian Erlmeier
1. Geld regiert die Welt
Ob man es hat oder nicht, man kommt nicht drum herum: Geld. Es ist der Kitt, der die Welt zusammenhält. Allerdings ist dieser Kitt weder gerecht noch besonders zuverlässig. Während die Reichen und Mächtigen das Vermögen und den weltweiten Reichtum unter sich aufteilen, bekommt ein Großteil der Menschen nur ein ganz kleines Stück vom Kuchen ab! Die Ungleichverteilung des weltweiten Wohlstands führt zwangsweise zu Armut und Ausbeutung von Vielen zu Gunsten des Luxus und Reichtums von einigen wenigen.
Die Zahlen sprechen für sich. In einer Studie aus dem Jahr 2017 hat man herausgefunden, dass circa 1 Prozent der Weltbevölkerung in etwa die Hälfte des weltweiten Vermögens besitzt und die ärmere Hälfte dagegen nur 1 Prozent dieses Vermögens. Das bedeutet, dass einige wenige Menschen mehr Geld in den Händen halten, als sie in ihrem ganzen Leben ausgeben können.
Im September 2021 gilt etwa Jeff Bezos, Gründer von Amazon, mit einem geschätzten Vermögen von 189,2 Milliarden US-Dollar als reichster Mann der Welt. Er beschäftigt allein in Deutschland 18.000 Arbeiter und Arbeiterinnen. Und die verdienen als Einstiegsgehalt zwischen 11,30 und 12,70 Euro brutto pro Stunde. Ein durchschnittlicher Arbeiter müsste also 1,7 Millionen Jahre ohne Unterbrechung und Schlaf arbeiten, um auf das Vermögen seines obersten Bosses zu kommen.
Dieser kleine Einblick in die Taschen des reichsten Mannes der Welt zeigt die Absurdität des Geldsystems gut: Das Geld dieser Welt ist unfair verteilt.
Aber das liegt nicht nur an der Gewinnmaximierung der Schönen und Reichen. Es hat auch zu einem guten Anteil damit zu tun, dass die wenigsten Menschen noch einen Überblick darüber haben, wie Geld überhaupt entsteht und verteilt wird, wer die Macht darüber hat und wie Entscheidungen getroffen werden.
Denn die Zentralbanken dieser Welt können in Zusammenarbeit mit den Staaten beinahe ungehindert Geld drucken und damit die Menge an Geld, die sich im Umlauf befindet, relativ willkürlich erhöhen.
Ebenso die Banken, die durch Kreditvergabe Geld aus dem Nichts schöpfen können. Das wiederum hat zur Folge, dass das Geld durch Inflation immer weiter an Wert verliert. Die Folgen sind bekannt: Die Preise steigen, die Löhne aber oft nicht im selben Maße.
Welche fatalen Folgen eine solche Geldpolitik haben kann, können wir im südamerikanischen Venezuela beobachten. Dort betrug die Inflationsrate im Jahr 2020 2.355 Prozent. Im August 2021 beschlossen die Währungshüter im Land, bei allen Preisen sechs Nullen zu streichen, da die vielen Nullen die Buchhaltung im Land massiv erschwerten.
Die wirtschaftlichen Folgen dieser hohen Inflation sind fatal. Da der venezolanische Bolívar ständig weiter entwertet wird, können Menschen sich nicht sicher sein, dass ihr Geld am Ende des Tages noch das wert ist, was sie dafür vielleicht noch am Morgen bekommen hätten.
Die Inflation ist in Venezuela so stark, dass das Geld so schnell an Wert verliert, dass es vielleicht schon am Ende der Woche nur noch ein Bruchteil dessen wert ist als zu Wochenbeginn.
Sparen wird damit unmöglich, das Leben zunehmend härter. Nahrung, Benzin oder bezahlbare Medikamente werden immer seltener. In ihrer Verzweiflung greifen die Menschen wieder auf den Tauschhandel zurück, denn hier haben sie noch mehr Sicherheiten als bei der kaputten Staatswährung. Wer kann, rettet seine wenigen Besitztümer oder gar Vermögen ins Ausland, ehe es nichts mehr wert ist. Einige Menschen dort haben auch bereits das "digitale Gold" Bitcoin für sich entdeckt. Obwohl die Kryptowährung in ihrem Wert selbst noch nicht stabil ist, ist sie für viele attraktiver als der Bolívar.
Doch bevor wir erkunden, warum Bitcoin in Venezuela zur immer attraktiveren Geld-Alternative wird, müssen wir uns fragen: Wie konnte es soweit kommen?
Geld – Das Kernelement einer funktionierenden Gesellschaft
Tauchen wir also ein in die Geschichte des Geldes, um zu verstehen, was uns jeden Tag durch die Finger rinnt und womit wir eigentlich unsere Brötchen, Kaffee und unsere Vergnügungen bezahlen.
Die ältesten Vorläufer des Geldes reichen bis in die tiefste Menschheitsgeschichte zurück. Bereits unsere Vorfahren benutzten verschiedene Waren – etwa Muscheln, Zähne oder auch Stoff – um sie gegen andere Waren zu tauschen. Bereits vor 20.000 Jahren sollen die Westeuropäer mit kleinen Steinbeilen gezahlt haben, um von anderen Stämmen etwas Fleisch zu kaufen.
Vor knapp 4.000 Jahren begann man in Afrika damit, Kauri-Schneckengehäuse als Tauschmittel zu verwenden. Überlieferungen zufolge wurde das "Kaurigeld" auf der halben Welt verwendet und anerkannt. Dadurch verliehen ihm die Menschen die wichtigste Funktion von Geld: Es konnte Wert aufbewahren. Denn die Menschen vertrauten darauf, dass sie für eine bestimmte Anzahl der Muscheln eine bestimmte Menge einer Ware bekommen konnten. Damit erfüllte das Kaurigeld die wichtige Geldfunktion als "Wertspeicher".
Zudem waren sie fälschungssicher – nur die Muscheln, die auf den Malediven und rund um den Golf von Thailand gesammelt wurden, wurden auch als Kauri anerkannt. Auch wurden sie als Recheneinheit verwendet, man bekam für eine bestimmte Menge an Muscheln eine bestimmte Menge an Waren.
Das Kaurigeld gilt als eine der ersten Formen des Geldes. Die Gehäuse der Kaurimuscheln erfüllten dabei bereits wichtige Eigenschaften. Sie wurden als Recheneinheit verwendet, dienten als Wertspeicher und waren relativ fälschungssicher.
Dennoch waren die dekorativen Muscheln kein seltenes Gut, denn wer es sammelte, wurde auch fündig. So ereilte das Kaurigeld dasselbe Schicksal, das auch Jahrhunderte später den venezolanischen Bolívar ereilen sollte.
Die Menschen sammelten mit der Zeit so viele Muscheln, dass es zu einer Inflation kam. Das Kaurigeld wurde immer wertloser, da es nicht wirklich knapp war, zumindest nachdem die Transportmöglichkeiten besser geworden waren und sich damit die kleinen Muscheln auf der ganzen Welt verbreiten konnten. Schließlich hörte man in Südasien im 19. Jahrhundert, in Westafrika zu Beginn des 20. Jahrhunderts, auf, die Muscheln als Zahlungsmittel zu nutzen.
Von Muscheln zu Münzen – Geld wird veredelt
Praktikabler war da schon das Münzgeld. Im 7. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung begannen die Menschen in Ionien und Lydien in Kleinasien damit, eine Legierung aus Gold und Silber in Form von Klumpen zu pressen und sie mit Bildern zu schmücken. Die ersten Münzen, die aus reinem Gold oder Silber bestanden, entstanden in der Mitte des 6. Jahrhunderts unter König Kroisos aus Lydien. In der Folge wurde es unübersichtlich, alle möglichen Könige begannen damit, ihre eigenen Münzen zu prägen.
Das Gespenst der Inflation
Das erste Papiergeld entstand schließlich im China des zehnten Jahrhunderts. In der Region Sichuan hatte man bisher Münzen aus Eisen verwendet. Doch diese waren zu schwer und ihre Herstellung zu aufwändig, das Metall und die Arbeit war höher als der Tauschwert. Im Jahr 933 kam es außerdem durch eine Belagerung dazu, dass die Münzen langsam knapp wurden. Also entschlossen sich einige Händler, Papiergeld herauszugeben. Anschließend übernahm die Stadt die Regulierung die Ausgabe des Papiergeldes, bis im Jahr 1016 schließlich der chinesische Staat die Ausgabe von Banknoten übernahm. Die erste Verstaatlichung von Papiergeld war vollzogen. Doch es ließ nicht lange auf sich warten, dass Herrschende Schindluder mit dem Papiergeld trieben. Verschiedene Kaiser haben nach Belieben immer wieder Geld gedruckt, ohne darauf zu achten, dass die Kaufkraft erhalten blieb. Durch diese Erhöhung der Geldmenge entwerteten sie die Kaufkraft, es kam immer und immer wieder zu massiven Inflationen.
Gold als unbestechlicher Geldanker
Noch während des zweiten Weltkrieges begannen insgesamt 44 Nationen, darunter China, die damalige UDSSR und Großbritannien unter der Schirmherrschaft der USA an einem System zu feilen, das es zum Ziel hatte, eine internationale Währungsordnung mit dem US-Dollar als Leitwährung zu schaffen.
Beim so genannten Bretton-Woods-Abkommen wurde schließlich der "Goldstandard" beschlossen. So wurde festgelegt, dass jede Unze Gold 35 US-Dollar wert ist. Damit konnten sich alle Währungen am US-Dollar orientieren und darauf vertrauen, dass für das Papier, auf dem scheinbar willkürliche Zahlen gedruckt sind, auch tatsächlich etwas hinterlegt ist: Gold!
Das gab eine unschätzbare Sicherheit: Es sollte nicht mehr möglich sein, unbegrenzt Geld zu drucken, ohne sich an einem festgelegten hinterlegten Wert, nämlich dem des Goldes, zu orientieren. Dieses ist schwer zu schürfen, begrenzt, knapp und nur schwer manipulierbar - wichtige Eigenschaften für einen Geldanker!
Durch das Bretton-Woods-Abkommen wurde Gold als Geldanker festgelegt, um einen einheitlichen "Goldstandard" zu schaffen.
Die Federal Reserve Bank, die Zentralbank der Vereinigten Staaten, versprach feierlich, Gold zu dem festgelegten Preis in jeglicher Höhe zu kaufen. Die anderen Mitgliedstaaten verpflichteten sich im Gegenzug dazu, die Schwankungen ihrer Währungen gering zu halten.
Um das Ganze zu überwachen, riefen die Staaten unter anderem den Internationalen Währungsfonds (IWF) ins Leben. Gemeinsam mit der internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (IBRD) sollten die Organisationen dafür sorgen, dass die beschlossenen Regeln eingehalten wurden.
Die Idee schien zunächst genial: Das Edelmetall Gold wurde zum unbestechlichen Geldanker, an dem sich die wichtigsten Währungen der Welt orientierten, allen voran der US-Dollar als Weltleitwährung. Doch das Buch, das sie gerade lesen, wäre vielleicht nie nötig gewesen, wenn die Idee Bestand gehabt hätte. Es kam, wie es kommen musste: Das Bretton-Woods-Abkommen scheiterte und der Goldstandard zerbröselte zu Staub.
Das Ende des "Goldgeldes"
Im Jahr 1969 wurde dann deutlich, dass das System nicht mehr funktionierte. Zu diesem Zeitpunkt wollte Frankreich seine US-Dollar in Gold eintauschen. Aber die USA hatten nicht genug Gold vorrätig, um ihr Versprechen einzuhalten. Also kündigten die Vereinigten Staaten zwei Jahre später ihre Verpflichtung, das System brach zusammen. 1973 wurde Bretton Woods dann komplett eingestellt. Fortan sollte es keine festen Währungskurse mehr geben, es gab keine Garantie mehr, um sein Geld zu abgesicherten Preisen eintausche zu können.
Im Zuge dessen bekam auch Gold eine neue Funktion im globalen Finanzmarkt. Das Edelmetall wurde zu einer neuen Anlageklasse, die wichtige Funktionen mit sich brachte. Unter anderem sollte es vor Inflation schützen und dem Vermögensaufbau dienen. Denn vor allem gegenüber dem US-Dollar zeigte sich Gold als beständig. Während die Inflation in Amerika in den folgenden Jahren auf ungeahnte Höhen stieg, wurde die Leitwährung nach und nach wertloser.
Der Preis einer Unze Gold stieg auf der anderen Seite zwischen den Jahren 1970 und 1979 auf über 500 Prozent seines vorigen Wertes.
Nachdem der Goldpreis nicht mehr an den US-Dollar gebunden war, wurde er gegenüber dem US-Dollar mit der Zeit wertvoller. Das Edelmetall wurde zu einer eigenen Anlageklasse.
Das brachte für viele Menschen die Erkenntnis mit sich, dass man Probleme nicht mit der Geldpresse lösen kann. Die USA hatte es versucht – durch unkontrolliertes Drucken neuer Scheine sollte die Wirtschaft einen ordentlichen Schub bekommen. Doch die Inflation stieg an und Gold, das im Gegensatz dazu nicht unendlich vermehrt werden kann, wurde immer wertvoller.
Vertrauen – die härteste Währung der Welt
Wer diese Seiten bisher aufmerksam gelesen hat, dem wird es dämmern: Die Grundlage von Geld ist Vertrauen. Vor 4.000 Jahren vertrauten die Menschen darauf, dass sie für eine Handvoll Muscheln eine Mahlzeit bekamen. Später wurde dieses Versprechen, Geld für etwas eintauschen zu können, auf Papier gekritzelt und mit dem US-Dollar in Gold aufgewogen.
Wir vertrauen darauf, dass der Schein oder die Münze, die wir in der Hand halten, einen Gegenwert hat. Wenn wir sie umtauschen wollen, bekommen wir etwas dafür. Wir können damit zum Bäcker gehen, um einen Kaffee zu trinken oder ins Restaurant, um etwas zu essen. Wir können uns Dienstleistungen oder auch ein Auto davon kaufen.
Das Problem an der Sache: Das Vertrauen in Geld und die Institutionen, die dafür verantwortlich sind, wurde immer wieder enttäuscht und wird auch jetzt wieder nach und nach verspielt.
Erinnern wir uns an das Jahr 2008. Die USA stand vor einer wirtschaftlichen Katastrophe. Die Immobilienblase – ausgelöst durch faule Kredite – platzte. Daraufhin folgte ein Banken-Crash auf den nächsten. Denn das Geld, dass die Banken in der Zeit zuvor so großzügig verliehen hatten, konnte ihnen nicht mehr zurückgezahlt werden. Die Finanzkrise gipfelte schließlich darin, dass die Investmentbank Lehman Brothers am 15. September 2008 Bankrott anmeldete.