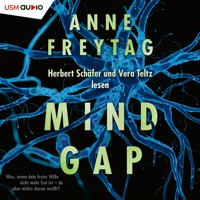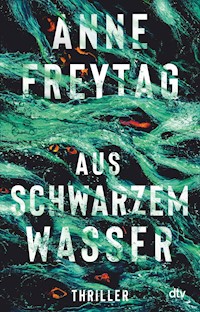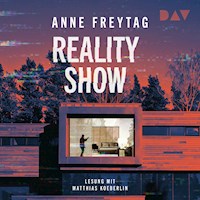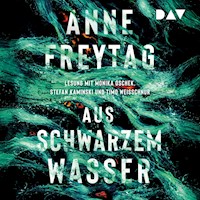Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Als Ferdinand von einem »Sommer auf dem Meer« sprach, hatte Nora etwas anderes im Sinn: weniger abgelegen, weniger beruflich. Auch Franziska ahnte nicht, worauf sie sich einließ, als ihr Mann Kilian einen Urlaub zu siebt ankündigte: mit seinem Chef Walter Bronstein, Ferdinand Mattern, seinem größten Konkurrenten, den drei Ehefrauen und Walters Sohn David. Auf der luxuriösen Superyacht in den Philippinen mangelt es ihnen an nichts, es könnte eine entspannte Zeit sein, aber die Gäste ahnen: Bei diesem Trip geht es um mehr, um etwas Großes. Nur worum genau, das scheint keiner zu wissen. Wieso hat Walter die beiden Kontrahenten und ihre Frauen eingeladen? Zwei Paare in den Vierzigern, die Kinder aus dem Gröbsten raus, die Eigenheime abbezahlt, die Karrieren steil – die der Männer, versteht sich. Alle zeigen sich von ihrer besten Seite. Es wird strahlend gelächelt und gekonnt konversiert. Eheleute, wie man sie sich nicht glücklicher ausmalen könnte. Aber nichts ist, wie es scheint. Sie alle spielen eine Rolle in dieser Inszenierung. Aber für wen? Und wer führt Regie? Anne Freytag beobachtet präzise und deckt schonungslos auf, was sie sieht. Sie erzählt mit großer Dringlichkeit von stillschweigenden Übereinkünften, die aufgekündigt werden, Erwartungshaltungen und Enttäuschungen, Bedürfnissen und Begierden, Konventionen und Geheimnissen.
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Anne Freytag
Blaues Wunder
Roman
Kampa
IWONDERHOWMANYPEOPLEI’VELOOKEDAT
ALLMYLIFEANDNEVERSEEN.
JOHNSTEINBECK
Für Anna, ohne die es diesen Roman nicht gäbe.
Zu Beginn war es nur die Ahnung von etwas. Wie Wind, der aufzieht und Gewitterwolken vor sich hertreibt. Ein Gefühl wie Elektrizität in der Luft.
Mit dem, was dann folgte, habe ich nicht gerechnet.
NoraEin mittelalter Mann und das Meer
Wir sind seit zwei Tagen auf dieser Yacht, Ferdinandund ich, umgeben von Fremden, mit denen wir Ausflüge machen und frühstücken und zu Abend essen. Drei Paare, die sich kaum kennen, ein erwachsener Sohn und Gespräche ohne Inhalt – irgendwo zwischen Boracay, El Nido und Coron.
Das Boot der Bronsteins ist riesig. 72,8 Meter lang, Höchstgeschwindigkeit 28 Knoten. Was schätzungsweise schnell ist, andernfalls hätte Walter es wohl nicht erwähnt. Männer prahlen selten mit der Langsamkeit ihrer Boote. Und dann wäre da noch der wenig subtile Name: Predator. Ich wette, den hat er ausgesucht. Beim Interieur dagegen war Rachel die treibende Kraft. Ja, das stimmt, räumte Walter auf meine Nachfrage hin ein. Meine Frau verfügt über exzellenten Geschmack. Er schaffte es, das wie ein Kompliment an sich selbst klingen zu lassen.
Die Ausstattung der Yacht ist minimalistisch und modern, alles vom Feinsten. Die Bodenbeläge, das Beleuchtungskonzept, das Dekor der Suiten, die Badezimmer – Naturstein, gedeckte Farben, schwarze Akzente.
Die Predator verfügt neben einer Mastersuite im vorderen Bereich des Bootes über vier Gästesuiten, jede mit eigenem Jacuzzi auf der privaten Sonnenterrasse. Glaselemente sorgen dafür, dass man nicht über Bord geht, ohne die Aussicht zu beeinträchtigen: endloser Ozean, Inseln mit Palmen, ab und zu Fischerboote, die aussehen wie riesige Wasserläufer.
Man hat uns mit einem Helikopter hergeflogen – denn natürlich gibt es einen Landeplatz an Bord, genau genommen gibt es sogar zwei. Außerdem einen Pool, ein Fitnessstudio und ein Kino.
Als Ferdinand von einem Sommer auf dem Meer sprach, hatte ich etwas anderes im Sinn. Weniger weit weg, weniger beruflich. Im Nachhinein stellt sich die Frage, warum ich so dachte. Immerhin ist Ferdinand seit jeher mehr mit seiner Arbeit verheiratet als mit mir. Die wenigen Urlaube, die es gab, waren schnell gebucht und genauso schnell vergangen. Ferdinand hat am Strand gelegen und gelesen, oder er war genervt: von mir, von unserer Tochter, von der Hitze, vom Hotelpersonal, vom Sand überall, von der Mittelmäßigkeit des Essens, vom Service, der seinen Ansprüchen nicht genügte. In manchen Nächten haben wir miteinander geschlafen, nicht oft, nicht der Rede wert. Eine Flasche Wein, ein paar Cocktails, Kingsize-Betten mit weißen Laken, gebräunte Haut, ein Orgasmus – seiner –, gefolgt von einem ermatteten Lächeln gemischt mit jener Scham, die nur Verheiratete kennen, die sich ewig nicht mehr nackt gesehen haben. Die Familienurlaube waren Zugeständnisse an unsere Tochter, und Ferdinand hat sich dann kaum um sie gekümmert. Wann komme ich denn schon mal dazu, mich zu erholen? Der arme Mann. So viel um die Ohren.
Doch diesmal ist er anders. Sein bestes Selbst. Gut gelaunt und charismatisch, geistreich, humorvoll – eine Reminiszenz an den Mann, den ich geheiratet habe. Etwas älter zwar, doch es steht ihm. Ferdinand geht auf in seiner Rolle als Familienoberhaupt, als Mann, als Vater. Obwohl Antonia nicht dabei ist. Ebenso wenig wie die Dannenberg-Zwillinge, Franziskas ganzer Stolz. Sie sind im Internat. Kinder, die gewollt und dann abgegeben wurden. Was so nicht ganz stimmt. Es ist eine der besten Schulen des Landes, ein Türöffner für St. Gallen. Hätte Walter nicht seine Beziehungen spielen lassen, hätte man unsere Tochter nie in Betracht gezogen.
Es ist schön, wie Ferdinand über sie spricht, auch wenn die Sätze einstudiert wirken. Als hätte er sie heimlich vor dem Spiegel geübt. Ferdinand will gewinnen, das weiß ich – nur was, weiß ich nicht. Er hat diesen Blick, ein beständiger Hunger, den ich dort lange nicht gesehen habe. Mein Mann verfolgt ein Ziel, etwas, wobei ich von Nutzen sein kann, sonst wäre ich nicht hier, Teil einer Strategie, in die er mich nicht eingeweiht hat. Andererseits hat er das nie getan, mich eingeweiht. Er sagt, ich bin am besten, wenn ich improvisiere. Als wäre unser Leben ein Scheißtheaterstück. Und irgendwie ist es das. Eine Inszenierung, eine Farce, und doch muss ich zugeben, dass ich den Schein mag, ihn und das Licht, in das er mich rückt. Seit wir auf den Philippinen angekommen sind, verhält Ferdinand sich männlich dominant – etwas, das ich immer mochte. Es macht mich klein und gleichzeitig an. Mir ist klar, dass das nicht für mich spricht, es gibt vieles, das nicht für mich spricht. Und doch bin ich gern seine Frau.
Ferdinand streicht über meinen Arm, liebevoll, geistesabwesend, als wäre das völlig normal. Als könnte er selbst nach sechzehn Jahren Ehe nicht die Finger von mir lassen. Doch das kann er – meist monatelang. Meine Haut zieht sich unter seiner Berührung zusammen, die Härchen richten sich auf, als wollten sie seine Hände noch ein bisschen länger festhalten, als würden sie flehen: Bitte hör nicht auf. Es ist armselig und erregend. Als hätte ich vergessen, wie sich das anfühlt, wie es ist, von einem Mann angefasst zu werden. Ich frage mich, weshalb er es tut, was dahintersteckt. Bei diesem Trip geht es um etwas Großes. Etwas, das jeder ahnt, aber keiner zu wissen scheint. Bis auf Walter. Und Rachel vielleicht.
Ich schaue von meinem Platz aus über die Reling, das Meer ist ruhig wie ein Dorfteich. Glasklar und türkis, am Grund nichts als Sand. Mein Haar ist nass vom Schwimmen im Pool, es klebt in rostroten Strähnen an meinen Schultern, an meinem Nacken. Ferdinand legt den Arm um mich, zieht mich näher an sich heran. Als ich seinen nackten Oberkörper an meinem spüre, beginnt mein Herz schneller zu schlagen. Vielleicht, weil es mir gefällt, vielleicht, weil ich mich benutzt fühle.
Mein Blick streift seinen Handrücken, seine Haut ist bereits gebräunt, meine hat noch immer jenen fahlen Ton zwischen grau und Aprikose, den ich so schwer loswerde. Und Sommersprossen, die überall. Ich war immer hell und kühl, mit Augen, die meine Gedanken verschleiern. Früher hat Ferdinand mich angesehen und gefragt: Was denkst du, Nora? Was sagst du mir nicht? Und ich habe gelächelt und geschwiegen, weil ich es mochte, ihn im Dunkeln zu lassen, weil es schön war, ein Rätsel für ihn zu sein – ein Geheimnis, das er um jeden Preis lüften wollte.
Mein Mann weiß bis heute nicht, was ich denke.
Irgendwann hat es ihn nicht mehr interessiert. Und mir war es egal – meistens jedenfalls.
NoraScheinheilig
Es ist 18:29 Uhr, 32 Grad. Eine junge Frau bringt dienächste Runde kühler Erfrischungen. Sie stellt volle Gläser vor uns ab und sammelt die leeren ein. Ich sehe zu, wie sie eins nach dem anderen auf ihrem Tablett platziert. Als ich mich bei ihr bedanke, sieht die Frau mich einen Moment irritiert an, direkt in die Augen, gefolgt von einem kurzen Nicken, wie ein Danke dafür, dass ich sie wahrgenommen habe. Dann geht sie von Deck und ich zurück in meine Rolle.
Ich spiele sie überzeugender als Franziska Dannenberg, die andere Ehefrau. Vielleicht, weil ich besser aussehe, weniger verbraucht, weniger beige. Ich habe mich gut gehalten, war diszipliniert, habe Sport getrieben, mich gesund ernährt, mir dreitausend Dinge verboten und es nach außen hin einfach aussehen lassen. Was ich …? Nein, ich vermisse keine Schokolade. – Nein danke, ich möchte kein Eis. – Das letzte Stück Pizza? Nimm es nur, ich habe keinen Hunger. Ich hatte immer Hunger. Ich wollte immer ein Eis. Dafür ist mein Körper noch straff. Nur die Brüste sind seit Antonia nicht mehr so, wie sie mal waren, aber auch die könnten schlimmer sein. Bis auf die vereinzelten Fältchen um meine Augen sehe ich nicht viel älter aus als Mitte dreißig. Ich habe sieben Jahre weggecremt mit Tiegeln und Tuben, die ein Vermögen kosten, mit Gesichtsmasken und -behandlungen und Ölen und Gels, mit Kardio- und Krafttraining. Und Hungern. Immer wieder Hungern. Ich habe gegen die Zeichen der Zeit angekämpft, weil Ferdinand das von mir erwartet hat, er und die Gesellschaft. Er musste das nicht sagen, es versteht sich von selbst. Ein Mann seiner Stellung braucht die passende Frau. Gut aussehend, gut gekleidet, gut gelaunt. Kultiviert und klug. Eine Frau, die weiß, wann sie den Mund zu halten hat und wann Zeit für Small Talk ist. Die es versteht, Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen oder sich bedeckt zu halten, je nachdem, was die Situation verlangt – sie oder der Ehemann. Es ist ein Deal, über den wir nie gesprochen haben, ein stillschweigendes Übereinkommen: Ferdinand sorgt dafür, dass es Antonia und mir an nichts fehlt, im Gegenzug sorge ich dafür, dass er bei seinem Gegenüber gut ankommt. Dabei spielt es keine Rolle, wer das Gegenüber ist: ein Politiker, ein Investor, ein Lobbyist. Ich unterstreiche Ferdinand, bin sein Accessoire, stets an seiner Seite. So wie jetzt. Ich lache an den richtigen Stellen, höre gebannt zu und nicke interessiert, selbst dann, wenn mich die Themen zu Tode langweilen. Wir sind ein Team, mein Mann und ich. Wir sind es seit Jahren, sind es immer gewesen.
Jeden Moment wird Walter sich erheben. Das ist der Startschuss.
Es beginnt zu dämmern, der Himmel sieht aus, als hätte er etwas Dunkles übergezogen, ein Abendkleid. Die Sonne geht hier früher unter als zu Hause. Um sieben ist sie weg. Die Nächte auf dem Boot sind endlos.
Ferdinand streicht erneut mit dem Zeigefinger über meinen Arm, dieselbe verliebte Geste. Wir spüren beide den Alkohol, ich erkenne es an der Art, wie er mich ansieht, gläsern und anzüglich, wir lächeln. In den vergangenen sechzehn Jahren waren wir nie ohne Antonia im Urlaub. Es ist schön ohne sie. So still.
Nicht mehr lang, und wir verabschieden uns alle in unsere Zimmer. Erst werden Walter und Rachel sich entschuldigen, kurz darauf Franziska und Kilian, und dann werden auch wir gehen, um uns das Salz von der Haut zu waschen und in unsere Abendgarderobe zu schlüpfen. Was völlig sinnlos ist, weil uns sonst niemand darin sehen wird.
Wir sind allein mitten auf dem Meer – wir und der Schein, den wir wahren.
NoraKurz Schluss
Wir gehen den schmalen Gang hinunter. Franziskaund Kilian folgen uns, ihre Kabine liegt gegenüber von unserer. Ferdinand hält meine Hand in seiner, mit der anderen gibt er mir einen Klaps auf den Po, und ich kichere wie auf Knopfdruck. Das Spiel geht weiter. Ich frage mich, was passieren wird, wenn wir allein sind, wenn in ein paar Sekunden die Tür hinter uns ins Schloss fällt und uns niemand mehr sieht. Ferdinand öffnet sie und schiebt mich ins Zimmer.
»Bis gleich«, sagt er zu Kilian und Franziska. Seine Stimme klingt heiser.
»Bis gleich«, erwidert Franziska mit einem verkrampften Lächeln. Verkniffene Mundwinkel – neidische Mundwinkel. Wir machen unsere Sache gut.
»Treibt es nicht zu bunt, ihr zwei«, sagt Kilian und zwinkert Ferdinand zu. Es ist ein Zwinkern unter Männern.
»Wir doch nicht«, antwortet Ferdinand und schließt die Tür.
Danach ist es still. Ein paar Sekunden lang glaube ich das Knistern noch zu spüren, den Moment, der sich sexuell immer weiter auflädt. Ich warte darauf, dass es weitergeht, dass wir weitergehen, nur ein paar Schritte, warte auf seine Hände, die mich ausziehen, warte darauf, dass er mich anfasst, atme unruhig in die angespannte Stille. Dann ist Ferdinand hinter mir, er riecht nach Sonne und Salz, ich spüre die Wärme seiner Haut, dann seinen Atem, als er fragt: »Willst du erst duschen, oder soll ich?«
Mit diesem Satz geht unsere Inszenierung in die Pause.
FranziskaBlue Eyes
Lange ertrage ich sein blödes Gesicht nicht mehr. Nurnoch ein paar Wochen, dann ist es endlich vorbei. Ich stehe unter der Dusche. Kilian ist nebenan und schaut fern – Kilian ist immer nebenan und schaut fern. Oder er ist weg. Im Büro. Auf Geschäftsreisen. Beim Fitness. Anfangs dachte ich, es wäre eine Midlife-Crisis, jetzt wünschte ich, es wäre so. Alles wäre mir lieber als die Wahrheit.
Ich sollte uns nicht nachtrauern, aber ab und zu passiert mir das. So wie mich manchmal Werbung zu Tränen rührt: irgendwelche Slogans und kitschige Musik.
Als Kilian und ich geheiratet haben, hatte ich eine genaue Vorstellung davon, wie mein Leben aussehen soll. Bis hin zu den Vorhängen. Und jetzt stehe ich kurz davor, es zu demontieren. Ich hätte nicht gedacht, dass es mal so weit kommt. Dass ich es so weit kommen lasse. Dass ich die Lawine auslöse.
In schwachen Momenten sehe ich alte Fotos an. Wir als Paar und später als Familie. Hochzeitsbilder, die Zwillinge nach der Geburt, wir zu viert, im Urlaub, Kilian und ich bei Veranstaltungen. Damals habe ich noch enge Kleider und roten Lippenstift getragen. Jetzt ist er beige.
Ich greife nach dem Shampoo. Ein Volumen-Shampoo, das keinen Unterschied macht. Meine Haare sind dünn und fransig. Egal mit welchem Shampoo. Es ist keine Frisur, es sind bloß blonde Haare. Früher habe ich sie mir zu wichtigen Anlässen waschen und föhnen lassen, um zwischen den anderen Frauen nicht unterzugehen. Jetzt weiß ich, dass es nicht an der Frisur liegt, wenn das passiert. Es gibt effektivere Waffen als Volumen. Humor, Aufmerksamkeit, Raffinesse.
Ich wasche mir das Shampoo aus den Haaren, stelle das Wasser ab und steige aus der Duschkabine. Der Spiegel ist beschlagen, ich wische mit einem Handtuch darüber. Und da bin ich. Eine mittelalte Frau, die mich mürrisch ansieht. Früher bin ich nur älter geworden, eine Kerze mehr auf dem Kuchen. Aber mittlerweile sieht man es. Falten um die Augen, auf der Stirn, um den Mund. Negative Gedanken, der Alltag und mein Hass darauf.
Früher dachte ich, Kilian und ich wären glücklich. Ich dachte, ich kenne meinen Mann. Ein Fehler, wie sich herausgestellt hat. Einer, der zu mir passt. Einer, den ich vermutlich verdient habe. Ich wollte den Mann zum Angeben, das protzige Haus, die Kinder, um die mich andere beneiden. Schätzungsweise, weil ich selbst ein neidischer Mensch bin. Kilian war wie ein neuer Anstrich für etwas, das marode und kaputt ist. Das Außen war meinen Eltern immer das Wichtigste. Der erste Eindruck, für den es keine zweite Chance gibt. Ich schätze, das hat auf mich abgefärbt. Unter meiner mittelalten Fassade bin ich ein siebenjähriges Mädchen, das die Welt durch die Augen seiner Eltern sieht. Ich habe drei Geschwister – zwei Brüder, eineiige Zwillinge, und eine Schwester –, und alle drei sind auf ihre Art besser als ich. Stefan ist Chirurg, Mathias Architekt, Kathi Anwältin. Und ich: Ehefrau. In Selbsthilfebüchern steht, dass man sich auf sich konzentrieren soll, sich nicht vergleichen. Bei mir ist das die Werkseinstellung. Wie bei einem Chamäleon, das aufgrund seiner Physiognomie ausschließlich nach rechts und links schauen kann.
Stefans Frau kann keine Kinder bekommen, ich habe zwei. Immerhin eine Sache, in der ich ihm überlegen bin. Mathias ist seit eineinhalb Jahren geschieden. Anfangs hat er darunter gelitten. Aber jetzt hat er nach Feierabend und jedes zweite Wochenende frei, wie er es nennt. Sobald Maximilian bei seiner Mutter ist, vögelt mein Bruder seine neue Freundin: im Bett, unter der Dusche, im Wohnzimmer, auf dem Designersofa seiner Ex-Frau. Neulich am Telefon meinte er: Franzi, der Sex mit ihr ist eine Offenbarung. Keine Ahnung, wie sich das anfühlt. Im Licht der Wahrheit scheint sowieso alles gelogen, was Kilian und mich betrifft. Mathias und ich stehen uns nah – oder er mir, wie man es nimmt. Wenn wir telefonieren, erzählt er mir aus seinem Leben, und ich lüge aus meinem. Weil ich es einfach nicht fertigbringe, laut auszusprechen, was passiert ist, ohne mich dafür zu schämen. Dass ich geblieben bin. Dass ich es nicht gemerkt habe.
Wie konnte ich es nicht merken?
Ich rücke näher an mein Spiegelbild heran, dann ziehe ich meine Haut nach hinten, so fest, bis die Falten weg sind und ich mir nicht mehr ähnlichsehe. Als ich loslasse, erkenne ich mich wieder. Dann creme ich mich ein.
Mit meiner kleinen Schwester Kathi habe ich so gut wie nichts zu tun. Vielleicht, weil sie die Jüngste ist, vielleicht, weil wir am wenigsten gemeinsam haben. Wir treffen uns bei Familienfeiern und führen freundlichen Small Talk. Sie arbeitet in einer der Top-Anwaltskanzleien des Landes – unser Vater wird nicht müde, das zu betonen. Eine Top-Anwaltskanzlei, nicht nur eine Anwaltskanzlei. Anfang des Jahres hat man sie als Partnerin vorgeschlagen, vermutlich ist sie es jetzt. Katharina Brenner, Partnerin bei Soundso und Associates. Kathi wollte nie Kinder, lieber namhafte Klienten und eine Affäre mit ihrem Chef. Beides hat sie bekommen – das weiß ich nicht von ihr, sondern von Mathias. Er hält uns alle zusammen.
Manchmal stelle ich mir die Leben meiner Geschwister vor wie Schuhe, die ich anziehen kann. In Gedanken schlüpfe ich hinein. Aber sie passen nicht. Als wären sie eine Nummer zu groß für mich. So hat es sich auch schon mit meinen Freundinnen an der Uni angefühlt. Sie hatten die besseren Noten und die besseren Männer, den besseren Stil und den besseren Sex. Bevor ich Kilian kennengelernt habe, bin ich neben ihnen in meiner Mittelmäßigkeit untergegangen. Eine Tatsache, um die ich immer wusste. Ich war das dritte von vier Kindern. Die Zwillinge, dann ich und dann die Kleinste. Hätte es mich nicht gegeben, es hätte niemand bemerkt. Ich war eben da. Ein liebes kleines Mädchen, das nicht weiter auffiel, mit guten Noten und wasserblauen Augen.
Das ist heute nicht viel anders. Nur dass ich kein kleines Mädchen mehr bin. Und weniger blauäugig.
FranziskaGedankengut
Das Leinenkleid hängt an mir wie an einem Kleiderbügel. Keine Ahnung, ob es am Kleid liegt oder an mir. Kilian kommt nackt aus dem Bad und rubbelt sich das Haar trocken. Seit wir vorhin unsere Kabine betreten haben, haben wir kein Wort miteinander gesprochen. Als hätten wir die gute Laune an der Tür abgegeben wie Mäntel im Theater. Wenn wir gleich an Deck gehen, werden wir sie wieder an uns nehmen – unsere Arbeitskleidung für den Abend.
Kilian setzt seine Brille auf und guckt in meine Richtung.
»Das willst du anziehen?«, fragt er und legt das feuchte Handtuch aufs Bett. Er legt immer seine feuchten Handtücher aufs Bett, und ich räume sie dann weg.
»Ich will es nicht nur anziehen«, sage ich, »ich habe es bereits an.« Mit diesem Satz durchquere ich den Raum, greife nach dem Handtuch und werfe es auf den Boden.
»Die Matterns liegen vorn«, sagt Kilian trocken.
»Und du denkst, das liegt an meiner Garderobe?«
»Deine Garderobe ist jedenfalls keine Hilfe.« Als ich nicht reagiere, fügt er hinzu: »Nora macht ihren Job besser, so viel steht fest.«
»Nora ist auch mit Ferdinand verheiratet und nicht mit dir.«
Kilian stellt sich hinter mein Spiegelbild.
»Dieses Kleid sieht aus wie ein Sack«, sagt er.
»Du auch«, antworte ich.
Für den Bruchteil einer Sekunde ist da ein Lächeln in seinem Blick. Dann ist es weg. Genau wie wir.
Als ich für diese Reise gepackt habe, dachte ich, dass auf so einer Yacht allerhand passieren kann. Jemand kann über Bord gehen oder auf einer Insel vergessen werden. Es könnte ein Unwetter aufziehen, das so stark ist, dass man jemanden erschlagen könnte und dann behaupten, er sei unglücklich gestürzt. Ich habe neulich noch davon gelesen: Mindestens ein Toter bei Untergang von Luxusyacht vor Sizilien. Die Bohlen auf so einem Boot sind oft recht rutschig – vor allem, wenn sie nass sind. Dazu starker Seegang, hohe Wellen … Doch hier ist nichts rutschig. Die Böden der gesamten Yacht sind mit Antislipstruktur versehen. Das fällt also schon mal flach. Bleibt noch das Unwetter. Oder das Überbordgehen.
Wie kann ich so was nur denken? Er ist der Vater meiner Kinder.
NoraAuf enger Flur
Ferdinand steht pfeifend unter der Dusche. Ich crememich ein – ein leichtes After-Sun-Fluid, das meine Haut gierig aufnimmt. Als die Lotion vollständig eingezogen ist, gehe ich zum Schrank und sehe meine Kleider durch. Am Ende entscheide ich mich für das lange dunkelblaue, das Ferdinand mir vor ein paar Monaten für ein Geschäftsessen gekauft hat. Denen werden die Augen rausfallen, meinte er, als ich aus der Umkleide kam. Ich schlüpfe hinein, der glatte Stoff umschmeichelt meinen Körper. Dann betrachte ich mich im Spiegel: den tiefen Rückenausschnitt, den hohen Schlitz am Bein, die kaum sichtbaren Träger. Früher hat es Ferdinand fast wahnsinnig gemacht, wenn ich keine Unterwäsche getragen habe. Inzwischen fällt es ihm nicht mal mehr mal auf. Wie eine selektive Blindheit, die mein Frausein betrifft.
Ich öffne die Schatulle, in der ich meinen Schmuck aufbewahre, und nehme die Perlenstecker heraus. Mein Großvater hat meiner Großmutter zur Geburt jedes Kindes ein Schmuckstück geschenkt. Für die Jungs gab es Diamantringe, passende Ohrstecker und Armbänder, für die Mädchen Rubine und Saphire, jedenfalls am Anfang. Je mehr Kinder es wurden, desto weniger wertvoll der Schmuck. Meine Mutter – das neunte Kind und das sechste Mädchen – war ihm nur noch diese Perlenstecker wert.
Ich lege sie an und betrachte mich, doch sie sind zu viel. Lieber nur das Kleid. Nackte Haut, sonst nichts. Minimal getuschte Wimpern, Lippenöl, feuchtes Haar. Ich lege die Stecker zurück und sehe auf die Uhr. Hier ist es 19:23 Uhr, in Deutschland 13:23 Uhr. Antonia hat Mittagspause. Ich war damals dagegen, sie aufs Internat zu schicken. Ferdinand dafür. Es ist eine Eliteschule, beharrte er. Was ohne Zweifel stimmt. Doch das bedeutet auch, dass wir sie kaum zu Gesicht bekommen. Ab und zu an den Wochenenden, sonst nur in den Ferien. Entsprechend wollte ich, dass Antonia mitkommt, als Ferdinand von Walters Einladung auf die Philippinen erzählt hat. Jetzt bin ich froh, dass sie nicht dabei ist. Zum einen, weil das bedeutet, dass ich die Dannenberg-Zwillinge nicht ertragen muss – Nathan ist in Ordnung, Valerie die Pest –, zum anderen, weil unsere Tochter auf die Art nicht mitbekommt, wie sehr wir uns für Walter zum Affen machen.
Antonia mag Valerie, sie schaut zu ihr auf. Ich kenne solche Mädchen von früher. Die nach außen hin brav tun und ansonsten, wonach ihnen der Sinn steht. Valerie ist eine, die nichts auslässt. Hellblondes Haar, eisblaue Augen, ellenlange Beine. Ein Körper voller Reize, die sie einzusetzen weiß. Sie ist kein Umgang für Antonia, aber wen interessiert schon, was ich denke.
Ich verlasse die Kabine. Ferdinand braucht nicht zu wissen, dass ich sie anrufe. Die Yacht schaukelt hin und her, meine Knie gleichen es aus. Das Gefühl, das in mir aufsteigen will, ist alt und unangenehm. Eine Mischung aus Anspannung und Schwindel. Ich drücke es wieder nach unten, schiebe es zurück in die Dunkelheit, in der ich es vor Jahren begraben habe. Ein schwarzer Raum für unliebsame Gedanken. Wenn sie hochkommen, ist es, als wären sie nie weg gewesen, konservierte Wut und Ohnmacht, die mich lähmend umklammern.
Mir ist das Festland lieber. Für viele Menschen ist ein Boot gleichbedeutend mit Freiheit. Ich verstehe nicht, wieso. Wir treiben auf den Launen des Meeres umher, ausgeliefert in paradiesischer Kulisse. Als ob der Mensch den Ozean bezwingen könnte.
Und doch hat es auch was, das Endlose, die Weite, der Himmel, der in glasklares Wasser übergeht. Sonnenuntergänge, kitschig und rosa mit dramatischen Wolken, die Sterne bei Nacht, die hinter dem Horizont verschwinden. Lange Sandbänke, die dann und wann auftauchen wie blasse Walrücken. Wenn man dort steht, ganz klein im Nirgends, nur ein paar Menschen auf etwas Sand, umgeben von Blau und Türkis, eine Unwirklichkeit, die sich so immens anfühlt, dass man auf das zusammenschrumpft, was man ist – dann fühlt sich das ungekannt leicht an. Wasser, das einen trägt, Füße, die im Sand versinken … Aber nicht diese Yacht. Die hat mit Freiheit nichts zu tun. Dieses luxuriöse Ding mit den zu engen Fluren und schmalen Türen. Eine Nussschale mit Sterneküche.
Als zu meiner Linken eine Tür aufgerissen wird, zucke ich zusammen und bleibe stehen. Das Boot wankt, David steht da und mustert mich. Auf den ersten Blick sieht er seinen Eltern nicht ähnlich. Auf den zweiten tut er es doch – er hat Rachels Augen. Und den Gesichtsausdruck von jemandem, dem die Welt gehört und den alles ankotzt. David ist Anfang zwanzig und auf eine schwelende Art wütend. Ich kenne diese Wut. Sie ist wie ein Deckel, den man auf etwas drückt.
David trägt ein Hawaiihemd mit Blumen und Hula-Tänzerinnen. Zwischen der offenen Knopfleiste ist eine filigrane Halskette zu sehen. Sie glänzt silbern auf seiner gebräunten Haut, hebt sich ab von den tiefschwarzen Tätowierungen. Als ich wieder hochschaue, sehe ich, wie Davids Augen über meinen Körper wandern. Ihm fällt auf, dass ich nichts darunter trage, das erkenne ich am minimalen Zucken seiner Augenbrauen.
Ich sollte seinem Blick ausweichen, doch ich erwidere ihn. Helle Augen, eine Mischung aus Grau und Grün, mittelbraunes Haar, der Anflug einer Denkerfalte.
Seit wir vor zwei Tagen in See gestochen sind, hat er kein Wort gesagt. Kein Hallo, kein Gute Nacht. Er sitzt mit uns am Tisch, als hätte er seinen Körper zum Essen geschickt und sein Wesen im Zimmer gelassen. Ein stiller Protest, den er mehrmals täglich wiederholt.
Rachel meinte in einem Nebensatz, ihr Sohn sei schwierig. Doch bislang ist er nur schweigsam. Ein Schatten von einem Menschen, ein Beobachter mit einem Ausdruck im Gesicht, der verrät, dass ihm nichts entgeht. Ich weiß so gut wie nichts über ihn, nur, dass er zu viel raucht – und dass ich jedes Mal, wenn er sich eine Zigarette anzündet, auch eine will.
David lächelt mich an. Sein Lächeln ist entwaffnend. Dann macht er eine Handbewegung, die sagt: Bitte, nach Ihnen. Er selbst sagt nichts. Ich nicke und gehe an ihm vorbei.
Als ich mich noch einmal umdrehe, ist er weg.
Abendessen
NoraWer zu spät kommt …
Ferdinand bringt mich zu Tisch. Ich spüre seine Handauf meinem Rücken, ganz unten, knapp über dem Po. Das Spiel geht weiter.
Mein Mann zieht einen der Stühle zurück, galant und höflich, alte Schule – etwas, das Walter gefallen dürfte. Ich setze mich, lächle in seine und Rachels Richtung, dann schaue ich zu David. In ein Gesicht wie eine Wand. Ferdinand nimmt neben mir Platz.
Kilian und Franziska fehlen.
Ein Punkt für uns.
Walter hat nie explizit gesagt, dass er zu spätes Erscheinen nicht ausstehen kann. Aber das war auch nicht nötig. Männer wie Walter Bronstein dünsten ihre Erwartungen aus wie einen Geruch. Minimale Änderungen in Gestik und Mimik, subtile Aufforderungen, die einen, wenn man sie nicht zu deuten weiß, schnell aus dem engsten Kreis verdrängen. Walter spricht Bände, ohne den Mund aufzumachen. Es ist eine Kunst, die ich verabscheue.
Ein Kellner bringt den Aperitif. Der Farbe nach ist es derselbe Feinbitter wie gestern Abend. Extrakte von Kräutern, Zitruspflanzen und herbe Beeren. Ein exquisiter Appetitanreger, wie Walter ihn nannte.
Als die Gläser verteilt sind, lehnt Ferdinand sich zu mir und küsst mich auf die Wange. Eine scheinbar beiläufige Geste, bei deren Anblick Rachel lächelt. Der Kuss galt nicht mir, sondern ihr. Es war meine Wange, mehr nicht, ein probates Mittel zum Zweck. Ich spüre, wie Ärger in mir aufsteigt, und senke den Blick. Mein Ärger hat hier nichts zu suchen. Als ich wieder aufschaue, sehe ich, wie David mich mustert. Er sitzt mir gegenüber, die obligatorische Zigarette in der Hand, das Hemd noch immer offen, zwischen uns flackert eine Kerze. Es sind Augen, die mehr als nur schauen. Als würde er nicht nur an meiner Fassade kratzen, sondern sie wegreißen wie ein Stück abstehende Tapete. Schwere Lider, ein dunkler Blick, anziehend.
Mein Mann berührt mich an der Hand, ich wende mich ihm zu, dann flüstert er lächelnd: »Du siehst phantastisch aus.« Er sagt es gerade so laut, dass man ihn hören kann, gerade so laut, dass sein Kompliment keines ist. Er hätte es vorhin schon sagen können, in unserer Kabine oder auf dem Weg hierher, aber da hätte es niemand mitbekommen. Ferdinand verschwendet keine Worte, er platziert sie.
Ich spüre Davids Blick noch immer auf mir. Er ist körperlich und irgendwie zu viel. Ein Teil von mir will, dass er aufhört, der andere bekommt Gänsehaut.
»Ich werde mich nie daran gewöhnen, wie früh es hier dunkel wird«, sagt Rachel. »Es ist noch nicht mal acht.«
Ferdinand nickt zustimmend, Walter sagt etwas, ich schaue aufs Meer. Vereinzelte Lichter am Horizont erinnern daran, dass es außer uns noch andere Menschen gibt. Davon abgesehen sind da nur Schwärze und Sterne. Es könnte durchaus romantisch sein – der Nachthimmel, der Schein der Kerzen, die Klaviermusik, das Gluckern des Wassers am Bug des Bootes –, aber es ist nicht romantisch, es ist ein Geschäftsessen.
Walter sieht auf die Uhr. Sein Gesicht zeigt keinerlei Regung, er scheint völlig entspannt. Doch seine Halsschlagader verrät ihn. Sie und etwas in seinen Augen, das fast nicht da und doch präsent ist.
Wieso hat er Ferdinand und Kilian eingeladen? Sie und ihre Frauen? Ein ziemlich langes Assessment-Center. Vielleicht ist es ein Test. Einer, der nicht nur unseren Ehemännern gilt.
Bei diesem Gedanken schiebe ich meinen Stuhl zurück und stehe auf. Alle sehen mich an, Ferdinands Gesichtsausdruck befiehlt mir, mich zu setzen. Die Stirn gerunzelt, strenge blaue Augen. Es gibt Männer, denen Zornesfalten stehen. Ferdinand gehört dazu. Die senkrechte Linie zwischen seinen Brauen verleiht ihm etwas Ernsthaftes, das er als junger Mann nicht hatte. Wie ein Gütesiegel der Nachdenklichkeit. Ich mag diese Falte.
»Stimmt etwas nicht?«, fragt Walter.
»Ich wollte nach Kilian und Franziska sehen.« Kunstpause. »Nicht, dass etwas passiert ist.«
Natürlich ist das Blödsinn – was sollte schon passiert sein? –, doch meine List geht auf, denn Walter nickt. Es war ein simpler Satz, doch er macht deutlich, wie pünktlich wir waren und dass sie es nicht sind – und mich mitfühlend und aufmerksam. Etwas, das bei Männern wie Walter grundsätzlich gut ankommt. Feminin, empathisch.
Er würde mich niemals selbst nach den beiden sehen lassen, er wird jemand anders schicken, jemanden von der Crew. Es ging lediglich um die Geste. Das Bemerken. Das wohlwollende Angebot.