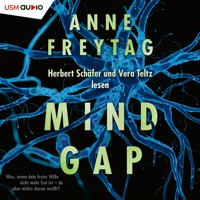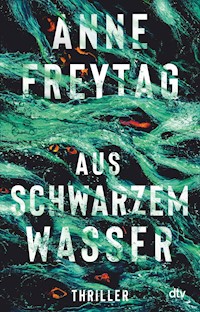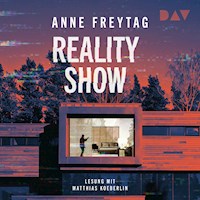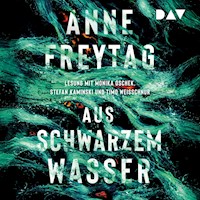11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Wann du die große Liebe triffst, kannst du dir nicht aussuchen
Tessa hat immer gewartet – auf den perfekten Moment, den perfekten Jungen, den perfekten Kuss. Weil sie dachte, dass sie noch Zeit hat. Doch dann erfährt das 17-jährige Mädchen, dass es bald sterben muss. Tessa ist fassungslos, wütend, verzweifelt – bis sie Oskar trifft. Einen Jungen, der hinter ihre Fassade zu blicken vermag, der keine Angst vor ihrem Geheimnis hat, der ihr immer zur Seite steht. Er überrascht sie mit einem großartigen Plan. Und schafft es so, Tessa einen perfekten Sommer zu schenken. Einen Sommer, in dem Zeit keine Rolle spielt und Gefühle alles sind …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 417
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
DAS BUCH
»Tes?«, flüstert Oskar und drückt meine Hand.
Ich schaue ihn an. »Was?«
»Hör endlich auf zu denken.«
Aufhören zu denken? Ich weiß nicht mal, wie das geht.
Er dreht sich auf die Seite und stützt sich auf dem Ellenbogen ab. Die Art, wie er mich ansieht, lässt mich schlucken.
»Mach die Augen zu.«
»Aber …«
»Mach. Sie. Zu.«
Und dann tue ich es. Ich lasse mich fallen …
Wer will schon etwas mit einer 17-jährigen Jungfrau ohne Führerschein zu tun haben, die noch dazu bald sterben wird? Niemand. Davon zumindest ist die schüchterne Tessa überzeugt und verbarrikadiert sich seit Wochen in ihrem Zimmer. Tessa ist schwer krank – jeder Schlag ihres Herzens könnte ihr letzter sein. Das macht sie traurig und wütend. Wütend, weil sie ihr Leben nicht mehr leben, nie das Abi feiern oder in eine WG ziehen kann. Tessa wird nie in Oxford ans Konservatorium gehen oder einen Jungen küssen. Doch dann taucht plötzlich Oskar auf. Und er lässt nicht locker. Auch nicht, als Tessa ihn wegzustoßen versucht. Und so findet sich Tessa plötzlich mit Oskar und seinem klapprigen Volvo in Italien wieder und stellt fest, dass jeder Tag, jede Stunde das pure Glück bedeuten kann, wenn du sie mit dem Menschen verbringst, der dich so liebt, wie du bist …
DIE AUTORIN
ANNE FREYTAG, geboren 1982, hat »International Management« studiert und für eine Werbeagentur gearbeitet, bevor sie sich ganz dem Schreiben widmete. Sie veröffentlichte bereits mehrere Romane für Erwachsene, teilweise unter ihrem Pseudonym Ally Taylor. Mein bester letzter Sommer ist ihr erstes Jugendbuch.
Die Autorin liebt Musik, Serien sowie die Vorstellung, durch ihre Geschichten tausend und mehr Leben führen zu können. In diesem Leben lebt und arbeitet sie in München – wenn sie nicht gerade in ferne Länder und fremde Städte reist, um ihrer Neugier auf Menschen und neue Geschichten nachzugehen. Manchmal auch nur in Gedanken.
ANNE FREYTAG
Roman
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2016 by Anne Freytag
Copyright © 2016 dieser Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München.
Redaktion: Martina Vogl
Umschlaggestaltung: Eisele Grafik-Design, München, unter Verwendung einer Illustration von © Isabel Klett und eines Fotos von © Liliia Rudchenko/Bigstock
Gestaltung Karte, Playlist und Innenillustrationen: Das Illustrat, München
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN: 978-3-641-16452-2V004
www.heyne-fliegt.de
Diese Geschichte ist der Liebe gewidmet.
Und Michael – dem Oskar meines Lebens.
Prolog
Die großen Kopfhörer liegen weich auf meinen Ohren und verschlucken die Außenwelt. Sie sind wie ein Verstärker, ein Mikroskop für mein Innenleben. Ich höre nur noch meinen rasenden Puls und meinen flachen Atem, die sich mit dem Klang der Musik vermischen. Das bin nicht ich. Dieses starrende Wesen, das die Augen nicht von ihm losreißen kann. Die mit den zitternden Fingern und den weichen Knien. Meine Hände umklammern noch immer das Buch, in dem ich vor ein paar Sekunden gelesen habe – als ich noch ich war und die Geschichte fesselnd. Hör endlich auf, ihn anzustarren. Komm schon, Tessa, schau weg. Aber ich kann nicht. Weder wegsehen noch denken. Als wäre mein Verstand zu Boden gegangen und ich gefangen in einem fremden Körper, der herrlich seltsame Dinge tut. Meine Fingerkuppen sind taub, meine Hände eiskalt und mein Magen fährt Karussell.
Die U-Bahn ist brechend voll, weil sich niemand diesem grimmigen Februar und seinem schneidenden Wind aussetzen will. Im gesamten Wagen drängen sich Menschen in dicken Jacken und Wollschals, mit großen Taschen und Aktenkoffern, Frauen mit Kinderwägen und Männer auf dem Weg zu wichtigen Terminen. Die meisten starren auf ihre Smartphones, tippen irgendwelche Nachrichten oder hören Musik. So wie ich. Wir sind alle in unserer eigenen Welt, ganz dicht beisammen. Isoliert in dieser Nähe, die keiner wirklich will, aber jeder stillschweigend erträgt. Wir schotten uns ab, senken mal den Blick, lassen ihn mal schweifen. Ich versuche, seinem auszuweichen, versuche mich loszureißen, aber meine Augen gehorchen mir nicht. In diesem Meer aus Gesichtern sehe ich nur noch seines. Ich tauche ein in die Art, wie er mich ansieht, in diesen Blick, der jeden Muskel in meinem Körper anspannt. Sein schiefes Lächeln wird zu einem Sog, der mich mitreißt und alles, was übrig bleibt, ist der wohlige Schauer, der mir langsam über den Rücken läuft und jedes noch so kleine Härchen an meinem Nacken aufrichtet.
Für einen Moment fallen meine Augen zu, dann erinnern sie sich an ihn und finden ihn in der Menge, in dieser Festung aus Körpern, die mich umgibt. Ihre Hitze liegt wie feuchter Nebel auf den Scheiben. Meine Arme und Beine kribbeln, während die U-Bahn unaufhaltsam durch die Dunkelheit rast. Die Luft ist abgestanden, fast tropisch. Wie ein Stück Regenwald mitten im Großstadtdschungel. Ich spüre, wie sich ein dünner Film auf meiner Haut ausbreitet. Wie mir das Herz bis in die Schläfen hämmert. Ich zittere innerlich. Überall. Jake Buggs Stimme begleitet den Moment, und das Lächeln in meinem Gesicht tut, was es will. Es ist, als würden sich unsere Blicke unterhalten, sich erkennen, wie aus einem anderen Leben. Ich lausche weiter dem Lied, während ich mich in seinen Augen verliere. In ihren strahlend blauen Tiefen und in dem, was dahinter schimmert.
Doch die Realität läuft weiter. Sie donnert meiner Haltestelle entgegen, während meine Welt stehen geblieben ist. Ich sehe nur noch ihn. Versinke in diesem Blick, der mich berührt wie Hände. Ich schlucke angestrengt, weil mein Mund so trocken ist, und atme, als würde ich rennen, obwohl ich mich nicht bewege. Alles in mir kribbelt wie Kohlensäure, die in einer Flasche perlt. Die Sekunden dehnen sich aus. Wie im Film. Da sind nur noch wir und unser Augenblick in der Seifenblase, die jeden Moment platzen wird. Seine Augen, die mich durchschauen – durch mich hindurch und über alles hinweg.
Die U-Bahn wird langsamer, schleppt sich ihrem Ziel entgegen, und das kalte Licht der Neonröhren durchbricht die Dunkelheit. Ich schiebe mich an den anderen Fahrgästen in ihren dicken Daunenjacken und Wintermänteln vorbei, spüre ihre Wärme und wünschte, es wäre seine. Ich dränge mich in Richtung der Türen, aber meine Augen bleiben bei ihm. Bei dem Muttermal auf seiner Wange, das sichtbar wird, weil er mir nachblickt, und bei diesem schiefen Lächeln, das ich als Rumoren in meinem Magen spüre. Ich muss aussteigen, aber ich kannnicht. Meine Beine sind zu schwer, und etwas tief in meinem Inneren will mich davon abhalten. Dieses Etwas will bis zur Endstation und wieder zurück. Mit einem sanften Ruck kommen wir schließlich zum Stehen, und die Türen öffnen sich. Er beugt sich ein Stück nach vorne und sieht mich an. Das Adrenalin rauscht durch meine Adern, und eine Kombination aus Anspannung und Angst lässt mein Herz unvermittelt stolpern. Der plötzliche Schmerz bringt mich in die Realität zurück.
Der Termin! Ich muss zu diesem Termin! Sein Blick begleitet mich, während ich den Traum verlasse. Diesen unwirklichen Moment. Ich setze einen Fuß vor den anderen. So, als wäre ich in Trance. Meine Beine tragen mich gegen meinen Willen. Ich steige aus. Die letzten Züge des Fahrtwinds wehen mir die abgestandene U-Bahn-Luft entgegen. Menschenscharen strömen auf den Bahnsteig und fließen an mir vorbei, aber ich kann noch nicht gehen. Nicht, ohne ihn noch einmal angesehen zu haben. Und in der Sekunde, als sich die Türen mit einem schrillen Piepen langsam schließen, weiß ich, dass es ein Fehler war. Ich spüre ihn überall. Aber Jake Bugg singt einfach weiter, als wäre nichts gewesen, so, als gäbe es keinen Fehler, so, als wäre das alles nie wirklich passiert. Mein Blick sucht seinen hinter beschlagenen Scheiben, während der Kloß in meinem Hals sich immer weiter ausbreitet und die Verzweiflung meinen Brustkorb zusammenzieht. Der Bahnsteig leert sich. Jeder geht weiter seines Weges. Bloß ich nicht. Ich stehe nur da und warte. Und ich weiß noch nicht einmal worauf. Auf ein Wunder? Darauf, dass die Türen wieder aufgehen und er aussteigt?
Das wird er nicht. Das hier ist kein Film, es ist das echte Leben. Und im echten Leben schließen sich die Türen, und die U-Bahn verlässt den Bahnhof. Ich sehe ihm nach. Und irgendwie fühlt es sich so an, als würde in diesem Moment ein Teil von mir in der Dunkelheit dieses Tunnels verschwinden.
Sterben
Ich dachte, sterben ist einfach. Ich dachte, es geht schnell. Wie geboren werden, nur rückwärts. Aber die Wahrheit ist, ich hatte keine Ahnung. Mein ganzes Wissen ist nichts wert. Man lernt in der Schule nicht, wie sterben geht. Man lernt es nicht in Filmen oder Büchern. Wenn es darum geht, ist man allein. Ich bin siebzehn Jahre alt und werde niemals achtzehn werden. Irgendwie warte ich darauf, es zu verstehen. Wirklich zu begreifen, was das bedeutet. Früher dachte ich immer, es wäre gut zu wissen, wie viel Zeit man noch hat, aber da bin ich auch davon ausgegangen, dass es viele Jahre sein werden. Ich habe ein Verfallsdatum. Okay zugegeben, letztlich hat jeder eines, aber zu wissen, dass die meisten Konservendosen in unserer Speisekammer länger hier sein werden als ich, ist hart. Die Wahrheit ist, dass ich nicht weiß, was ich verpassen werde. Ich habe zu wenig gelebt. Und vor allem viel zu kurz. Ich werde als siebzehnjährige Jungfrau sterben. Als Musterschülerin ohne Führerschein. Ich werde nie ausziehen und eine eigene Wohnung haben. Ich werde sterben, ohne jemals einen Jungen nackt gesehen zu haben – und damit meine ich nicht im Fernsehen oder im Internet. Ich meine einen echten Jungen mit einer echten Erektion, die er im besten Fall meinetwegen hätte.
Ich trockne mich ab, lege das Handtuch zur Seite und binde mir das feuchte Haar zusammen. Die Reflexion im noch leicht beschlagenen Badezimmerspiegel zeigt mir eine junge Frau, gefangen im Körper eines dürren Mädchens. Sie starrt mich nur an mit ihren großen grünblauen Augen und diesem Blick, als wären sie und ich nicht dieselbe Person. Unter der weißen Haut zeichnen sich meine Knochen ab. Das Becken und die viel zu spitzen Hüften, die Schlüsselbeine und Rippenbögen. Nein, bei diesem Anblick bekäme kein Junge eine Erektion. Obwohl, vielleicht, wenn er wirklich kurzsichtig ist? Vermutlich nicht mal dann. Ich war schon immer schlank, aber inzwischen bin ich nur noch ein blasser Schatten. Meine Augen wandern weiter über meinen klapprigen, nackten Oberkörper und bleiben zwischen meinen kleinen Brüsten hängen. Diese Narbe anzusehen ist wie eine seltsame Sucht. Etwas, das mich unendlich anwidert und abstößt, dem ich mich aber einfach nicht entziehen kann. Als bräuchte ich den Ekel. Wie bei einem Unfall. Man will wegsehen, aber es geht nicht.
Ich strecke zaghaft die Finger aus und berühre vorsichtig das seltsam weiche, vernarbte Gewebe. Das Gefühl unter meinen Fingerkuppen treibt mir sofort einen eisigen Schauer über den Rücken. Meine Augen wandern über die Narbe, die meinen gesamten Oberkörper in Rechts und Links teilt. Die zeigt, wie oft ich offen dalag. Mein Vater hat mal zu mir gesagt, dass ich das gute Herz meiner Großmutter geerbt habe, aber das stimmt leider nicht. Verborgen unter fahler Haut schlägt eine tickende Zeitbombe ihren letzten Sekunden entgegen.
Als es neben mir an der Tür klopft, zucke ich zusammen und greife schnell nach dem Bademantel. Ich schlüpfe hinein und verstecke mich und die Narbe im weichen Frottee, dann öffne ich die Tür.
»Was ist?«
»Tessa, Liebes, alles okay?«, fragt meine Mutter. Ich nicke. »Hast du heute schon deine Medikamente genommen?«
»Was geht es dich an?«
»Hast du?«, bohrt sie.
»Es sind meine Schmerzen.« Meine Mutter sieht mich nur wartend an, mit diesem Blick, dem ich nicht ausweichen kann. Schließlich verdrehe ich genervt die Augen und antworte: »Ja, ich habe sie genommen, zufrieden?«
»Morgens und mittags?« Ich nicke genervt. »Gut«, sagt sie und lächelt mich an. »In eineinhalb Stunden erwarten wir Besuch. Kommst du dann bitte runter?«
»Was für ein Besuch?«
»Ein Studienfreund deines Vaters.«
»Und was hat das bitte mit mir zu tun?«
»Jetzt komm schon, Süße, es wird dir guttun, mal rauszukommen.«
»Rauszukommen? Das Esszimmer ist wohl kaum rauskommen«, antworte ich patzig.
»Es ist ein Anfang.« Sie hat recht. Ich gehe gar nicht mehr raus. »Bitte, Tessa.«
»Wozu? Ich werde bald tot sein.«
»Sag das nicht.«
»Aber es ist doch so.«
»Liebes, du bist noch nicht tot.«
»Na ja, vielleicht übe ich ja …«
Ihr Blick verändert sich, und hinter einer wütenden Maske entdecke ich Tränen. »Du wirst runterkommen, verstanden? Dieses Wiedersehen ist für deinen Vater sehr wichtig. Karl war während des Jurastudiums sein bester Freund, und sie haben sich seit Jahren nicht gesehen.« Ich frage mich noch immer, warum ich da dabei sein muss, sage aber nichts. »Außerdem wird es dir nicht schaden, auch mal etwas Vernünftiges zu essen.« Das macht garantiert einen riesigen Unterschied. Ein paar Vitamine und Ballaststoffe sind bestimmt die Lösung. »Ich habe den ganzen Tag in der Küche verbracht und gekocht.«
»Ganz sicher nicht meinetwegen.«
»Hör zu, Tessa, es ist eine Sache, mir nicht zu helfen, aber ich finde, es ist wirklich nicht zu viel verlangt, dass du nach unten kommst.« Ich will gerade widersprechen, da hebt sie nur die Hände und sagt: »Du wirst mitessen. Keine Widerrede. Und bitte zieh dir zur Abwechslung mal etwas Schönes an, ich kann diese schreckliche Jogginghose langsam nicht mehr sehen.« Mit diesem Satz wendet sie mir den Rücken zu und geht wütend die Stufen hinunter.
Einen Moment lang bleibe ich in der Tür stehen und starre ins Leere, an die Stelle, wo sie eben noch stand. Ich kann mich nicht bewegen, fast so, als würden meine Gedanken mich in den Schwitzkasten nehmen. Das war das erste Mal seit Wochen, dass meine Mutter laut geworden ist. Egal wie ich mich aufführe, sie lächelt. Immer. Aber ich will nicht, dass sie lächelt. Ich will, dass sie mich in Ruhe lässt, und sie weiß noch nicht einmal warum. Sie hat keine Ahnung, wieso ich so gemein zu ihr bin. Sie denkt, es liegt am Sterben. Aber das ist es nicht. Zumindest nicht direkt. Ich denke an den Ordner in der Garage, und die Wut zieht meinen Magen zusammen.
Ich benehme mich andauernd daneben, aber niemand sagt etwas. Ich glaube, wenn man stirbt, hat man immer das letzte Wort. Man bekommt einen Freifahrschein. Vielleicht weil die Leute sich davor fürchten, dass ich mitten im Streit plötzlich tot umfalle und sie keine Chance mehr haben, sich zu entschuldigen. Sie lassen einem alles durchgehen, auch wenn es falsch oder gemein ist. Sie tun es, weil sie wissen, dass es nur auf Zeit ist und weil sie insgeheim froh sind, dass es dich trifft und nicht sie. Die Einzige, die mich genauso behandelt wie immer, ist meine kleine Schwester. Und auch wenn sie mich fast zu Tode nervt, rechne ich ihr das hoch an – was ich natürlich niemals zugeben würde. Bis auf Larissa sind alle so bemüht. Mit diesem Lächeln, das nicht bis in ihre Augen dringt, und diesem Blick, in dem sich Mitleid spiegelt.
Deswegen habe ich mich auch seit drei Wochen nicht mehr bei Tine oder Alex gemeldet. Und die Wahrheit ist, ich glaube, sie sind eigentlich beide ganz froh darüber. Sie wollen nicht ans Sterben denken. Und sie wollen sich nicht darüber klarwerden, wie endlich alles ist. Darüber, dass uns jeder Moment umbringen könnte. Das Problem ist nur, dass ich fast ausschließlich darüber nachgrüble. Über alles, was noch kommt. Oder eben auch nicht. Ich passe nicht mehr in ihr Leben. Früher habe ich das. Da waren wir wie ein dreibeiniges Stativ. Wir waren verflochten wie ein Zopf. Jetzt, wo ich sterbe, werden wir wieder zu drei losen Enden.
Ich kann verstehen, dass so ein sterbender Schwan der absolute Stimmungskiller ist, und vielleicht würde ich mich auch meiden. Trotzdem ist es hart, dass ihr Leben einfach weitergeht. Ohne mich. Es ist hart, dass sie bald Abi machen werden. Zusammen ins Ausland gehen. Und sich verlieben. Alex hat seit ein paar Tagen einen neuen Freund. Aber das weiß ich nicht von ihr, das weiß ich von Facebook. Wie hatte das passieren können?
Ich denke kurz an den Beitrag, den Tine neulich bei Facebook gepostet hat, und höre mich abschätzig schnauben. Die Tine, die ich kannte, hätte so etwas nie geschrieben. Diese Tine war nicht taktlos. Aber ihr blöder Post war es. Es war ein Foto von aufgeschlagenen Abi-Trainern, bunten Markierstiften und unleserlichen Notizen. Ich habe ihre Schrift sofort erkannt. Daran erinnert zu werden, dass ich nie meinen Abschluss machen werde, hat wehgetan, aber das war nicht das Problem. Das wirklich Geschmacklose war die Beschreibung zu dem Bild: Boah, diese verdammten Abi-Vorbereitungen bringen mich noch um!
Ernsthaft?
Bin ich überempfindlich oder ist es daneben, so etwas zu schreiben? Immerhin bin ich nicht irgendeine entfernte Bekannte. Ich bin ihre beste Freundin. Na ja, zumindest war ich es mal. Und bald bin ich tot.
Ich gehe in mein Zimmer, und mein Blick fällt auf die schlabbrige Jogginghose auf meinem Bett, die irgendwann einmal eng war und jetzt nur noch traurig an mir hängt wie eine schlaffe Leinwand. Ja, ich trage sie gern. Und oft. Sie passt zu mir, auch wenn sie mir nicht mehr passt. Ich sehe einfach keinen Sinn darin, mich schön zu machen, nur damit ich gut aussehe, falls ich beim Abendessen einen Herzstillstand habe. Man kann mich auch gerne in etwas Gemütlichem in den Sarg legen und einäschern. Und trotzdem gehe ich zu meinem Schrank hinüber und suche in meiner Kleidung nach etwas Passendem, weil irgendetwas ganz tief in mir meine Mutter nicht enttäuschen will, obwohl sie mich enttäuscht hat.
Ich betrachte die vielen Sommerkleider. Sie fühlen sich an wie aus einem anderen Leben, obwohl ich die meisten von ihnen erst letztes Jahr gekauft habe. Ich lasse meine Hand über die Stoffe gleiten und seufze. Sie sind alle so wie ich: sehr hübsch und langweilig.
Manchmal wünschte ich, ich hätte mehr in den Tag hinein gelebt. So wie Larissa. Sie würde nicht als Jungfrau sterben. Sie war immer lebendig, und ich habe hauptsächlich nur geatmet. Ich war viel zu sehr damit beschäftigt, auf die perfekten Augenblicke zu warten, nur dass sie mir nie perfekt genug waren. Bis auf die Begegnung in der U-Bahn vor fünf Monaten. Das war er, der perfekte Moment – zumindest bis ich ausgestiegen bin.
Kontrolle ist besser
Ich wünschte, ich könnte mich vorbereiten. Ich meine aufs Sterben. So wie auf eine Prüfung in der Schule. Ich wünschte einfach, es gäbe ein Handbuch oder einen Leitfaden, in dem ich nachschlagen kann. Es gibt doch Ratgeber für alles. Wie geht man bitte in Würde, wenn man Todesangst hat? Wenn man so wütend ist? Auf alle, aber vor allem auf sich selbst? Sterben ist eben nicht wie geboren werden, nur rückwärts. Es ist das Gegenteil. Und zum Leben gibt es kein Gegenteil. Man existiert einfach nicht mehr, und genau das macht mir Angst.
Wenn man es genau nimmt, habe ich keine Ahnung, ob geboren werden so einfach war, ich kann mich nur nicht mehr daran erinnern. Vielleicht war es grauenhaft. Wenn ich es mir jetzt vorstelle, so eng und dunkel und plötzlich zieht sich alles um dich zusammen und presst dich durch einen schmalen Kanal und überall ist Blut und Schleim. Nein, ich bin froh, dass ich nichts mehr davon weiß. Irgendwann war ich einfach da. Und vielleicht dachte ich deswegen auch, dass es mit dem Tod genauso funktioniert. Dass man eben einfach verschwindet, ohne es wirklich zu merken. Aber in meiner Vorstellung hatte ich auch silbrig weißen Flaum auf dem Kopf und tiefe Falten, die lange Geschichten über ein ausgefülltes Leben voller perfekter Augenblicke erzählen. Ich dachte, ich würde eines Nachts aus dem Tiefschlaf direkt in den Tod begleitet, von einem schönen Traum, der mich wie ein alter Freund bei der Hand nimmt. Ich dachte, auf der anderen Seite wartet der Mann, mit dem ich einen Großteil meines Lebens verbracht habe, mit einem verschmitzten Lächeln auf den Lippen.
Stattdessen beschäftige ich mich jetzt mit Organspenden und informiere mich über Einäscherung. Nach meiner Diagnose haben sie mir zu psychologischer Hilfe geraten. Mehrfach. Ich bin meinen Eltern zuliebe auch hingegangen, habe es aber mir zuliebe dann ganz schnell wieder sein lassen. Das hatte viele Gründe. Einer davon war die Gruppenleiterin. Die hat mir doch tatsächlich Sterbebegleitung ans Herz gelegt. Genau so hat sie es gesagt. Ich finde ja, man könnte das anders formulieren, wenn man mit jemandem spricht, der einen Herzfehler hat. Aber vielleicht bin ich da auch kleinlich. Ich habe letzten Endes beides abgelehnt. Die psychologische Hilfe war mir keine, und das mit der Sterbebegleitung brauche ich auch nicht. Was soll das bitte bringen, wenn man den entscheidenden Schritt dann doch alleine machen muss?
Also habe ich das getan, was ich immer tue: eine To-Do-Liste geschrieben und einen Punkt nach dem anderen abgearbeitet. Ich habe meiner Fahrschule geschrieben, dass ich keine weiteren Stunden brauchen werde und meine Mitgliedschaft bei den Münchner Stadtbädern gekündigt. Ich habe alle privaten Dinge, die niemand je finden soll, von meinem Laptop gelöscht. Und ich muss unbedingt daran denken, meinen Vater darum zu bitten, den Schredder aus dem Büro mitzubringen, damit ich meine Tagebücher vernichten kann. Ich werde nie Töchter haben, die sie lesen könnten. Wen könnten die naiven Träume und Gedanken eines pubertierenden Teenagers bitte sonst interessieren? Vielleicht ist es ja makaber, aber ich habe mir gestern online eine Urne bestellt. Meine Urne. Früher habe ich mein Leben totorganisiert. Jetzt organisiere ich eben meinen Tod.
Ja, ich bin ein Kontrollfreak. Daran kann auch der Tod nichts ändern. Ich bin nicht gut, wenn es um Überraschungen geht, weil die meisten scheiße sind. Ich habe immer gewartet – wie es sich jetzt herausstellt zu lange. Auf die Liebe, auf das Leben. Als wäre es ein Karussell. Ich wollte mit, aber ich stand immer nur am Rand und habe gezögert. Ich wollte den perfekten Augenblick, und vielleicht ist es an der Zeit einzusehen, dass ich ihn verpasst habe. Ich hatte Pläne. Ich habe alles richtig gemacht, immer alles gegeben. Ich habe eine Klasse übersprungen und trotzdem einen Einserschnitt, ich spiele Klavier und Geige, bin Betreuerin in einer Kinderfreizeit und bis vor sechs Monaten vier Mal die Woche schwimmen gegangen – weil das gesund ist. Ich mache ein abschätziges Geräusch. Das ist alles so ein Witz. Es ist nicht zu fassen, dass sie es wussten. Das werde ich ihnen nie verzeihen, auch wenn das nicht viel heißt, weil es schon in ein paar Wochen keine Rolle mehr spielen wird.
Ich ziehe frische Wäsche und ein weißes hochgeschlossenes Kleid aus dem Schrank. Nein, ich habe nie Ärger gemacht, kein Alkohol, keine Drogen, kein Sex auf dem Rücksitz – und auch sonst nirgends. Ich war nie auf wilden Partys, habe nie irgendwelche Drogen genommen – nicht einmal weiche. Und geklaut habe ich auch noch nie. Ich bin nie mit Freunden nackt schwimmen gegangen oder habe mit einem Jungen in einem Bett geschlafen – nicht mal angezogen. Ich habe mir das alles lediglich vorgestellt. Und gereist bin ich praktisch nur in meiner Fantasie. Mein gesamtes Leben bestand aus dem ersten Gang, weil ich irgendwie dachte, dass ich für den zweiten noch genug Zeit habe. Weil ich dachte, dass ich dafür noch zu jung bin. Aber offensichtlich findet Gott, dass es zum Sterben reicht.
Bis auf die riesige Narbe gehe ich makellos. Eine Haut wie Milch und ohne Falten. Ich bin wie ein unbeschriebenes Blatt, das der Wind vor seiner Zeit davonträgt. Es ist so eine Verschwendung, wenn man es sich mal genauer überlegt. Morgen bekomme ich meine Tage. Ich weiß das so genau, weil mein Zyklus so exakt ist wie ein Schweizer Uhrwerk. Es ist fast, als lebte mein Körper in dem Irrglauben, dass wir irgendwann einmal Kinder bekommen. Meine Regelschmerzen erinnern mich einmal im Monat daran, dass alles in mir einwandfrei funktioniert. Alle Organe arbeiten weiter – na ja, zumindest fast. Ich wollte gerade losleben, da geht es zu Ende. Das ist so absurd. Alles, wovor ich mich einmal gefürchtet habe, ist auf einmal so lächerlich. Meine Angst vor der Uni, vor Prüfungen, vor dem ersten Mal, davor, verletzt zu werden. Jetzt wünschte ich, da wäre jemand, der mich verletzen könnte – und damit meine ich jemanden, der nicht mit mir verwandt ist.
Plötzlich scheint alles so lächerlich. Jede Angst, jede böse Vorahnung. Ich hätte mich gerne tätowieren lassen, aber ich habe mich nicht getraut, weil ich viel zu große Angst davor hatte, dass es schrecklich wehtun könnte. Und ich weiß, was es bedeutet, Schmerzen zu haben. Bei dieser Erkenntnis höre ich mich bitter lachen. Ich mache den Verschluss des BHs zu und ziehe den Slip an. Na ja, immerhin fürchte ich mich nicht mehr vor Nadeln. Ein Tattoo wäre überhaupt kein Problem mehr. Und eine Heroinsucht auch nicht.
Ich will nicht wütend sein und vor allem nicht auf meine Mutter, aber ich bin es. Zumindest ein Teil von mir. Ich wünschte, ich könnte einfach geduldig auf den Moment warten, in dem mir mein Herz das Leben nimmt, aber ich schaffe es nicht. Ich sehe dieses Leben, das ich niemals haben werde, es zieht in Bildern an mir vorbei, und dieser Anblick tut noch mehr weh als alles, was ich durchstehen musste – auch wenn das schwer zu glauben ist. Dieser wütende Teil in mir hasst meine Mutter. Ich wünschte, es wäre nicht so. Ich wünschte, ich könnte ihr verzeihen. Aber ich schaffe es nicht. Ich hasse sie für ihr Schweigen. Und die Lügen. Aber zur selben Zeit will ich nicht sterben, solange das so ist. Sollte ich ihr verzeihen? Oder kann es mir egal sein, weil ich dann schließlich weg sein werde? Ich schlüpfe in das Kleid und mache den seitlichen Reißverschluss zu. Und in der Sekunde, als der Leinenstoff die Narbe endlich bedeckt, fällt mir das Atmen wieder leichter.
Ich will gerade die Tür aufmachen und noch mal kurz ins Bad gehen, als jemand sie plötzlich energisch aufstößt und ich erschrocken zusammenzucke. War ja klar: meine beschissene Schwester.
»Kannst du nicht anklopfen?«, fahre ich sie an.
»Wozu? Als ob in diesem Zimmer jemals etwas passieren würde, weswegen eine Tür nötig wäre.«
Dieser Satz ist wie eine Ohrfeige. Vielleicht, weil er wahr ist. Als würde es nicht reichen, dass sie schon jetzt mehr gelebt hat als ich. Als würde es nicht reichen, dass sie Sex hat. Und einen Freund. Und ein Tattoo.
»Los, sag schon, was du hier willst, und dann verschwinde.«
»Mama hat gesagt, ich soll dich holen.«
»Und seit wann bitte machst du, was sie dir sagt?«
»Halt einfach die Klappe und geh runter.«
Ich sehe sie an. Ihr tief ausgeschnittenes Top und den kurzen Rock. »Das lässt du doch nicht etwa an, oder?«
»Den Jungfrau-Maria-Look kauft mir keiner ab.«
Ich schaue einen Moment an mir selbst hinunter und spüre, wie Tränen in meine Augen steigen. Aber bevor Larissa sie sehen kann, dränge ich mich an ihr vorbei, gehe ins Bad und werfe die Tür hinter mir zu. Kurz stehe ich einfach nur da. Ich atme ein und aus.
Jungfrau Maria. Damit trifft Larissa es auf den Punkt. Ich schiebe den Gedanken weg und greife nach dem Föhn. Die heiße Luft vermischt sich mit der schwülen Abendluft, die sich träge durch die offenen Fenster schiebt. Als ich den Kopf nach unten fallen lasse, um mir das Haar zu trocknen, jagt ein stechender Schmerz durch meine Brust, und ich lasse den Föhn fallen. Ich ringe nach Luft, halte mich am Waschbecken fest, aber jeder Atemzug ist wie ein stumpfes Messer, das sich immer tiefer zwischen meine Rippen bohrt. Ich spüre die Tränen und das Adrenalin. Sie flüstern mir zu, dass ich noch lebe. Alles in mir verkrampft sich. Jeder Muskel. Aber vor allem mein Herz. Ich greife mir an die Brust, drücke gegen meine Rippen, während ich bete, dass diese schrecklichen Schmerzen nachlassen. Ich traue mich nicht zu atmen, bewege mich nicht, starre nur auf meine nackten Füße und den türkisgrünen Mosaikboden, den meine Mutter vor knapp zwei Jahren unbedingt haben musste. Die Farben verschwimmen, bis die Tränen schließlich über meine Wimpern rollen und auf den Boden fallen. Meine Muskeln lassen plötzlich locker, und mein Herz schlägt weiter, als wäre nichts gewesen. Einen Moment lang bleibe ich noch stehen. Ich zwinge mich, ruhig zu atmen, ein und aus, ganz langsam, dann schließlich greife ich mit zitternden Fingern nach dem gummierten Griff des brummenden Föhns.
Davor hatte ich immer am meisten Angst, wenn ich ans Sterben dachte. Dass es wehtun wird. Vor dem Schmerz. Die Medikamente halten ihn inzwischen immer schlechter in Schach. Und es wird noch schlimmer, meint der Arzt. Ohne Vorwarnung. Und wenn es passiert, wird es die Hölle. Er will mir da nichts vormachen, hat er gesagt. Das Einzige, was er dann noch für mich tun kann, ist, es mir so erträglich wie möglich zu machen. Im Klartext, mich mit Schmerzmitteln vollzupumpen. Wenn es soweit ist, wird sich das Leben klammheimlich von mir verabschieden. Ich werde meinen letzten Atemzug der Bedeutungslosigkeit schenken. Aber ich nehme an, das ist besser als der Schmerz. Und vielleicht begleitet mich ja eine Halluzination ins Nichts. Das ist doch fast genauso gut wie ein Traum.
Die warme Luft wirbelt mir durchs Haar und brennt in meinem Gesicht. Es ist schon seltsam. Ich wollte immer alles. Also für mein erwachsenes Ich. Jetzt wäre ich schon mit etwas mehr Zeit zufrieden. Das Leben wird nicht definiert von den Momenten, in denen du atmest, sondern von denen, die dir den Atem rauben.
Dieser Satz hat nie Sinn für mich ergeben, bis zu der Sekunde, als ich in einem Meer aus gelangweilten Gesichtern seines gesehen habe. Ich weiß, dass ich ihn nie vergessen werde. Weder die Art, wie er mich angesehen hat, noch wie ich mich gefühlt habe – wie es war, wirklich gesehen zu werden. Ich denke, jeder braucht etwas, an das er sich klammern kann, und bei mir waren es diese paar Sekunden. Der Gedanke daran, dass es ihn gibt, hat mir die Angst genommen. Seit diesem eiskalten Tag im Februar haben sie mich drei Mal aufgeschnitten. Und jedes Mal habe ich an ihn gedacht. Ich habe die Augen geschlossen und sein Gesicht gesehen. Dieses Muttermal auf seiner Wange. Seine wachen Augen und dieses schiefe Lächeln. Ich habe immer wieder dieses Lächeln gesehen und unwillkürlich zurückgelächelt. Ich habe taggeträumt und bin abgetaucht in eine Welt, in der ich mit gebräunter Haut und ohne Narbe neben ihm aufwache und alles, was ich rieche, ist salzige Seeluft und Sonnenmilch. Stattdessen lag ich benommen im Aufwachraum und habe erfahren, dass mir auch diese OP wieder nur etwas mehr Zeit verschaffen konnte. Aber für jemanden, der im Sterben liegt, ist Zeit die kostbarste Währung.
Ich schalte den Föhn aus und ziehe einen Mittelscheitel. Mein blondes Haar fällt in weichen Wellen über meine Schultern. Wie fließende Vanille. Das hat Tine immer gesagt. Sie meinte, meine Haare wären zu schön, um echt zu sein. Wenn ich ehrlich bin, verstehe ich nicht, was sie gegen ihre eigenen hatte. Sie waren vielleicht nicht so voll wie meine, aber dafür haben sie im Sonnenlicht geglänzt wie schwarze Seide. Ich streiche mir das Haar aus der Stirn. Jetzt könnte ich es ihr vermachen.
Während ich mich kämme, denke ich an die unzähligen Male, in denen Tine, Alex und ich auf dem Vordach vor meinem Fenster saßen und über unsere Zukunft geredet haben. Über all die Dinge, die wir noch zusammen machen wollten. Vergangenes Jahr um diese Zeit haben wir unsere Traummänner aus Knete geformt. Ich erinnere mich noch genau an Tines ansteckendes Lachen und an ihre tiefbraunen Augen, die in der Dunkelheit fast schwarz ausgesehen haben, während sie mein rotes Knetmännchen begutachtet hat. Der Kopf war zu groß und die Beine zu kurz, aber die Frisur ist mir gelungen. Ich blinzle – irgendwie fühlt es sich gerade so an, als wäre das nie wirklich passiert. Als wäre das die Geschichte von jemandem, den ich mal kannte.
Ich tusche mir die Wimpern, lege etwas Parfum auf und verstecke mein sterbendes Ich hinter einem Hauch von Rouge. Als ich gerade etwas Gloss auf meine Lippen tupfe, höre ich auch schon die Stimme meiner Mutter.
Kostümfilm
»Tessa, Liebes?«
Ich mache die Tür auf. »Was?«, rufe ich nach unten.
»Kommst du bitte mal? Ich brauche dich kurz.«
Mein Gott, das ist doch nicht mein verdammter Besuch. Ich sehe noch einmal in den Spiegel, dann verlasse ich das Badezimmer.
»Teeeessaaaaa?«
»Ist ja gut, ich komme schon!« Ich verkneife mir, was ich wirklich sagen will, gehe leise fluchend die Stufen hinunter und finde meine Mutter in ihrem Element. Alles blitzt und blinkt. Der Duft von Essen schlängelt sich durch die Luft, und mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Unser Haus ist gewappnet für einen Staatsbesuch. Überall stehen frische Schnittblumen, kein Staubkorn hat den morgendlichen Putzanfall meiner Mutter überlebt, und das ausladende Esszimmer erinnert mich mit seinen Kerzenleuchtern zusätzlich zu unserem riesigen Lüster an einen britischen Kostümfilm.
Im Ernst, würde in diesem Augenblick Elizabeth Bennett an mir vorbeigehen, es würde mich nicht wirklich wundern, wobei ich zugeben muss, dass mich der Anblick eines Mr. Darcys doch noch ein bisschen mehr freuen würde. Wie auch immer. Das Tafelsilber schimmert streifenfrei im Kerzenschein, die Champagnerkelche und Weingläser glänzen wie geschliffene Diamanten, und die schneeweißen Stoffservietten stehen gestärkt und kunstvoll gefaltet auf dem teuren Service. Im Hintergrund plätschert »Between Shades of Grey« von Gavin Mikhail vor sich hin. Ich habe das früher immer für meine Mutter gespielt. Damals als mein Leben noch vor mir lag, zumindest als ich das dachte.
Mein Blick streunt über die lange Tischplatte und die vielen kleinen Blumengestecke, die zwischen dem perfekten Weiß der Tischwäsche hervorleuchten. Für den vollkommenen Stilbruch sorgen die schwarz-weiß gemusterten Kissenbezüge auf den Designerstühlen. Ja, es ist makellos. Genau wie meine Mutter. Sie hat eindeutig zu viel Zeit. Ich sterbe, und sie stärkt Servietten. Zugegeben, es sieht absolut fantastisch aus, aber wenn sich nicht gerade Mr. Darcy oder ein Team von der Schöner Wohnen inklusive Topfotograf zum Essen angesagt hat, ist es völlig übertrieben. Ich stehe im Türrahmen und sehe zu, wie meine Mutter kleine Salz- und Pfefferstreuer auf dem Esstisch verteilt. Sie sieht aus wie ein schwedisches Model, das für einen Katalog posiert, und ich bin so eindeutig ihre Tochter, dass es mich kurz aufseufzen lässt. Dieselben grünblauen Augen, die langen blonden Haare, die Stupsnase und die vollen Lippen. Und mit unseren weißen, schmalgeschnittenen Sommerkleidern sehen wir fast so aus, als hätten wir unsere Outfits für eine anstehende Homestory abgestimmt.
Ich wollte immer sein wie sie. Sie war mein Vorbild. Die Person, zu der ich insgeheim aufgeschaut habe. Und jetzt ist sie der Mensch, der mich am meisten enttäuscht hat.
»Ah, Tessa, Schatz, da bist du ja … Könntest du deine berühmte Karamellsauce für die Nachspeise machen?«
»Dafür brauchst du mich?«, frage ich kühl. »Für die Karamellsauce?«
»Na ja, ich dachte…« Sie sieht mich vorsichtig an, als würde sie jeden Augenblick einen Wutanfall erwarten. »Du und ich, wir haben doch immer gerne zusammen gekocht und gebacken.« Das stimmt. Das haben wir. Die gute alte Zeit. »Es war vielleicht eine blöde Idee«, sagt sie schließlich und schluckt.
»Hast du die Zutaten?«
»Ja«, antwortet sie. »Ich habe auch schon alles vorbereitet.« Ihr Lächeln ist so vertraut und liebevoll, und ich spüre, wie meine Mundwinkel darauf antworten wollen. »Ich kann es natürlich auch machen, aber deine Karamellsauce ist einfach besser als meine.« Damit hat sie mich, auch wenn ich genau weiß, warum sie das sagt. »Irgendwann musst du mir wirklich verraten, was dein Geheimnis ist.«
»Vielleicht sage es dir lieber jetzt, ich meine, nur für den Fall, dass ich heute beim Essen tot umfalle und wir nicht mehr die Chance dazu haben.« Sie zieht scharf die Luft ein, um etwas zu sagen, aber ich schüttle nur den Kopf. »Ich nehme einen Löffel Meersalz und anstelle der Sahne Kokosmilch. Aber nimm unbedingt die cremige.«
Die Sauce ist gerade fertig, als mein Vater zu uns in die Küche kommt und meine Mutter von hinten in die Arme nimmt. Ich beobachte die beiden aus den Augenwinkeln, und etwas Schwermütiges legt sich eng um meinen Brustkorb. Genau das wollte ich auch irgendwann. Einen liebevollen und gut aussehenden Mann, der mich auf diese Art ansieht und der dieses ganz besondere Lächeln hat, das er nur mir schenkt. Einen Mann, der weiß, wer ich wirklich bin und der mich trotzdem liebt. Oder vielleicht gerade deswegen?
»Hallo, meine Süße.« Er gibt mir einen Kuss auf die Wange, und ich spüre seine große warme Hand auf dem Rücken. »Du siehst sehr schön aus.«
»Danke«, flüstere ich und sehe ihn von unten an. Ich habe wirklich versucht, meinen Vater zu hassen, aber ich schaffe es nicht. Ich meine, ich gehe davon aus, dass er auch Bescheid wusste, weil meine Eltern sich alles sagen. Zumindest glaube ich das. Wenn ich ehrlich bin, weiß ich es nicht genau. Fakt ist: Ich habe ihn nie gefragt.
»Mein Gott, das riecht einfach fantastisch«, sagt er und sieht wieder zu meiner Mutter. »Du bist unglaublich, weißt du das?« Sie lächelt verlegen mädchenhaft, etwas, das bei meinem Vater seit jeher funktioniert. »Was hast du denn dieses Mal gezaubert?«
»Also zur Vorspeise gibt es eine leichte Brennnesselschaumsuppe mit Croûtons, als Hauptgang Lammkarree, dazu Prinzessbohnen im Speckmantel und Rosmarinkartoffeln. Alternativ habe ich eine vegetarische Lasagne gemacht, nur falls jemand kein Fleisch essen möchte, und dann zum Nachtisch eine Apfeltarte à la Parisienne mit selbst gemachter Vanilleeiscreme und Tessas berühmter Karamellsauce.«
In der Sekunde, als sie ihr Menü in der Tonlage des Küchenchefs eines sündhaft teuren Sternelokals zu Ende vorgetragen hat, klingelt es an der Tür, und für einen Augenblick fühlt sich mein Leben wieder so an, wie es einmal war. Ich folge meinen Eltern durch den Flur, beobachte, wie sie sich ansehen, und es ist wie damals, als ich klein war, als mein Todesurteil zwar bereits gefallen war, aber als ich davon noch nichts wusste. In dem Moment, als meine Mutter die Haustür öffnet, kommt Larissa die Stufen herunter – etwas genervt, wie immer, wenn es um Anlässe dieser Art geht. Und mit dem Ausdruck in ihren Augen implodiert das schöne Gefühl in meiner Brust und wird wieder zur Realität. Einer Realität, in der ich bald tot bin und meine Mutter mich mein Leben lang belogen hat.
Schmaus
Karl Salzmann sieht aus, als wäre er eben aus dem Manager Magazin geklettert, und plötzlich ergibt es irgendwie Sinn, dass meine Mutter unser Esszimmer zur Kulisse einer Homestory hat werden lassen. Sein Gesicht ist zu gleichen Teilen verschmitzt und ernst. Wenn ich ihn mir so ansehe, kann ich mir ziemlich gut vorstellen, wie mein Vater und er auf der Uni waren. Wie viel Spaß sie zusammen hatten. Aber gleichzeitig will ich nicht darüber nachdenken, weil es für mich so ein Wiedersehen niemals geben wird. Ich sehe zu seiner Frau hinüber. Sie hat etwas so Elfenhaftes und Zerbrechliches an sich, dass sie vermutlich in jedem Mann, dem sie begegnet, augenblicklich einen Beschützerinstinkt auslöst. Ich weiß, wovon ich spreche. Kleine, zarte Frauen mit großen Augen sind hilflos. Zumindest übersetzen Männer das so. Nicht, dass ich viel Erfahrung hätte – okay, ich habe gar keine –, aber nicht aus Mangel an Möglichkeiten. Na ja, zumindest gab es sie, bevor ich so aussah wie jetzt. Ich glaube, ich war immer zu wählerisch … Wie auch immer. Es besteht kein Zweifel, Bettina Salzmann ist eine von diesen Frauen. Mit diesen braunen Rehaugen würde sie vermutlich sogar problemlos mit einem kaltblütigen Mord davonkommen.
Neben dem perfekten Erscheinungsbild wirken die beiden nett. Wie Leute mit viel Geld, denen man aber anmerkt, dass sie bodenständig geblieben sind. Das Gegenteil von neureich. Während alle noch reden und viele freundliche Floskeln austauschen, gehe ich ins Esszimmer. Zum einen weil ich Hunger habe, und zum anderen weil ich mich fehl am Platz fühle. Früher hatte ich kein Problem mit Oberflächlichkeit, jetzt ertrage ich sie nicht mehr, ganz einfach weil das Leben zu kurz ist für Worthülsen und aufgesetzte Freude.
Ich stütze mich auf dem Fensterbrett ab und schaue nach draußen. Der Himmel ist für diese Uhrzeit viel zu dunkel. Er versteckt sich hinter einer bedrohlichen Decke aus Grün und Grau, und der Hagel liegt wie eine Drohung in der Luft. Lange wird es nicht mehr dauern. Die Schwüle wartet darauf, sich endlich zu entladen. Und nicht nur sie, auch ich warte auf den Wind und den reinigenden Regen. Die Ruhe vor dem Sturm erfüllt die Luft, die Blätter an den Laubbäumen bewegen sich nicht, nichts bewegt sich. Als wären die Welt und ich plötzlich Teil eines erschreckend echten Gemäldes. Im Garten werfen die Buchsbüsche bedrohliche Schatten auf den Rasen, und die Wasseroberfläche des Pools ist wie ein Spiegel für die Wolken, die sich träge und zäh über den Himmel schieben.
»Setzt euch doch bitte, ich bringe gleich die Vorspeise.«
»Meine Güte, Greta, das sieht ja wundervoll aus«, höre ich Bettina Salzmanns ehrfürchtige Stimme, als sie das Esszimmer betritt. »Karl, sieh dir nur das Service an …«
»Ja, das ist wirklich elegant«, antwortet er.
»Und es steckt voller Erinnerungen«, sagt meine Mutter mit einem inszenierten Seufzen, und ich warte nur auf die Geschichte, wie ihr Vater und seine Brüder, als sie klein waren, das gute Porzellan vor den Nazis verstecken mussten, weil man ihnen einfach alles genommen hat. Alles. Als sie gerade Luft holen will, drehe ich mich um, deute in Richtung Küche und frage: »Während du erzählst, könnte ich ja schon mal die Vorspeise holen.«
»Danke, Liebes, aber das brauchst du nicht«, antwortet sie lächelnd.
»Ich weiß, aber wenn ich es nicht tue, muss ich schon wieder die Nazi-Geschirrgeschichte ertragen, und ich weiß wirklich nicht, ob ich das noch mal aushalte.«
Ich höre meinen rasenden Herzschlag und spüre die Wut, die mich plötzlich das laut aussprechen lässt, was ich früher nur gedacht hätte. Wer weiß, vielleicht hätte ich es nicht einmal gedacht. Die Luft knistert, und bis auf das Klavierstück im Hintergrund ist alles still. Nur die Blicke sprechen Bände.
So muss es sich anfühlen, Larissa zu sein. Bis vor ein paar Wochen hat nur sie solche Dinge gesagt, aber heute bin ich ihr zuvorgekommen, und ihr erstaunter Blick verrät mir, dass sie damit nicht gerechnet hat. Normalerweise ist sie die Schlagfertige von uns beiden, die, die das letzte Wort und die besten Argumente hat. Aber in diesem Moment ist sie mundtot, und ich schwelge in diesem Anblick. Ich wünsche mir, dass ich diesen leeren Ausdruck in ihrem Gesicht niemals vergesse. Er ist wie ein kleines Abschiedsgeschenk.
»Was sollte das?«, zischt meine Mutter, als sie die Küche betritt.
»Was sollte was?«, frage ich.
»Du weißt ganz genau, was ich meine.« Ihre Augen funkeln mich wütend an.
»Ich kann die Geschichte eben nicht mehr hören.«
»Früher hast du nie so mit mir gesprochen«, sagt sie im Flüsterton, damit ihr Besuch die Realität nicht hören muss.
»Es ist nicht mehr früher«, antworte ich trocken und sehe sie an. »Es ist jetzt.«
»Ach, so ist das … Und wird das von nun an immer so sein?«
»Immer ist in meinem Fall ja nicht mehr so lang«, flüstere ich zurück. »Du hast es also bald hinter dir.«
Bevor sie antworten kann, greife ich nach der riesigen Suppenschüssel und lasse meine Mutter in der Küche stehen.
Ich gebe es ja nur sehr ungern zu, aber die Suppe ist großartig. Die Engel singen in meinen Ohren einen vierstimmigen Chor, und mein Magen liegt entspannt und friedlich unter meinem kranken Herzen. Die Gespräche gehen an mir vorbei. Mein Blick fällt einen Moment auf das unbenutzte Gedeck neben Larissa und auf ihren grimmigen Gesichtsausdruck. Vermutlich hatten sie und Bastian mal wieder Zoff. Ich glaube ja, dass sie sich deswegen so gerne streiten, weil ihnen die stundenlange Versöhnung im Anschluss so großen Spaß macht. Ich nehme noch einen großen Löffel Suppe, und ihr Geschmack blendet die schalen Unterhaltungen über Herrn Salzmanns Arbeit und wie die Kanzlei meines Vaters läuft aus. Ich ignoriere, dass Bettina Salzmann etwas über irgendwelche Reisen erzählt und bekomme nur am Rande mit, dass wohl auch bei Familie Salzmann nicht alles so rosig ist, wie es der Anschein glauben machen will. Aber wenn ich ehrlich bin, interessiert es mich nicht. Im Moment interessiert mich nur meine Suppe und dieses weiche cremige Gefühl, das sie auf meiner Zunge hinterlässt.
Chopins »Nocturne« begleitet das Gedicht in meinem Mund. Vielleicht bilde ich es mir ja ein, aber seit ich weiß, dass ich sterben werde, schmeckt das Essen noch besser – und ich habe wirklich immer gerne gegessen. Ich bin so in meiner Welt versunken, dass ich nicht bemerke, dass meine Mutter aufsteht, und auch nicht, dass sie im Flur verschwindet. Meine Gedanken ertrinken in diesem Genuss. Ich tunke gerade ein Stückchen Brot in die Suppe, stecke es mir in den Mund und schaue hoch, als meine Mutter ins Esszimmer zurückkommt. Anstatt zu schlucken, atme ich erschrocken ein und springe auf. Ich stoße gegen die Tischplatte, höre das Geschirr klirren. Ich spüre die Blicke aller im Raum auf mir und wie mir der Löffel aus der Hand gleitet. Er fällt mit einem lauten Scheppern zu Boden. Ich versuche zu husten, meine Lunge verkrampft sich und kämpft gegen das Stückchen Brot, das ich eingeatmet habe. Ich bekomme keine Luft, alles verschwimmt, und das Esszimmer pulsiert vor meinen Augen. Ich kann jetzt nicht ersticken. Nicht hier und nicht jetzt und vor allem nicht, wenn er mir dabei zusieht.
Er
Ich ringe noch immer nach Luft, Tränen laufen über mein Gesicht, und meine Hände zittern. Das Fast-Ersticken glüht in meinen Wangen, und mein Rücken brennt an der Stelle, an der die Hand meines Vaters mich immer und immer wieder getroffen hat. Alle stehen da, aufgebracht und nervös, aber ich sehe nur ihn.
»Geht es wieder?«, fragt Karl Salzmann, und ich bemerke erst jetzt, dass die Hand an meinem Arm seine ist. Ich räuspere mich und nicke verlegen. »Vielleicht ein Schluck Wasser?« Herr Salzmann will gerade nach meinem Glas greifen, aber er kommt ihm zuvor.
»Hier.«
Seine Stimme ist wie sein Blick, und meine Knie werden weich, als mir sein Duft in die Nase steigt. Waschpulver und ein bisschen Deo. Sonst nichts. Pur und sauber. Es ist ein Duft, in dem ich mich verkriechen will.
»Danke«, flüstere ich, bewege mich aber nicht. Meine Augen brauchen jede Faser meines Hirns, um ihn anzusehen. Für meine Hand ist nichts mehr übrig.
»Oskar, da ist doch fast nichts drin«, sagt jemand tadelnd, nimmt ihm das Glas aus der Hand und schenkt Wasser nach. »Hier, Tessa.«
Oskar. Meine Hand scheint wieder zu gehorchen, greift nach dem Glas und führt es an meine Lippen. Ich spüre, wie die kalte Flüssigkeit meine Kehle hinunterläuft. Während ich trinke, sehe ich ihn über den Glasrand hinweg an. Das ist einfach nicht möglich! Ich muss träumen! Aber ich träume nicht. Er ist hier. In dieser Sekunde. Er steht mir gegenüber und sieht mich an. Und es ist derselbe Blick wie damals. Dasselbe Funkeln und dieselbe Wärme. Er hat mich nicht vergessen.
Als das Glas leer ist, stelle ich es mit zitternden Fingern ab. Würde mein Herz gerade nicht so verzweifelt schlagen, wäre ich mir sicher, dass ich halluziniere. Aber der dünne Schweißfilm und die Tränen und meine weichen Gelenke fühlen sich viel zu echt an. Ich habe so oft von ihm geträumt, an ihn gedacht. Genau an die Art, wie er mich gerade ansieht. Die Wimperntusche brennt in meinen Augen, und trotzdem versinke ich in seinen. Etwas in ihren blauen Tiefen legt sich wie eine Faust um mein Herz.
»Komm schon, Süße, setz dich«, höre ich die Stimme meines Vaters und spüre seinen Atem an der Wange.
»Sie möchte sich vielleicht erst ein bisschen frisch machen, Schatz«, sagt meine Mutter lächelnd und nimmt meine Hand.
»Du hast recht«, antwortet er und schaut zu Karl und Bettina Salzmann hinüber. »Kann ich euch auf den Schreck einen Wein anbieten?«
»Larissa, räumst du bitte schon mal die Suppenteller ab.«
»Und du kannst ihr helfen, Oskar«, sagt Bettina Salzmann, und allein der Gedanke, dass meine Schwester ihm auch nur einen Meter zu nahe kommen könnte, lässt erneut alles in mir verkrampfen.
»Komm schon, Liebes«, sagt meine Mutter sanft, dann wendet sie sich Bettina zu. »Wir sind sofort wieder da.«
»Natürlich.«
Das Grünblau meiner Augen wirkt noch intensiver zwischen den vielen geplatzten Adern. Meine Wangen sind mehr als gesund gefärbt, und das weiße Kleid ist voller Flecken. Ich schaue kopfschüttelnd an mir hinunter. Das habe ich ja toll hinbekommen. Ich werde für immer die sein, die beinahe an einem Stückchen Brot erstickt ist. Die, die beim Husten die Suppe überall hingespuckt hat. Die mit dem verschmierten Gesicht und den knallroten Augen. Na ja, wenigstens wird er mich nicht vergessen. Ich atme tief ein und wische mit dem Abschminktuch über die schwarzen Schlieren in meinem Gesicht.
»Ist alles in Ordnung?«, fragt meine Mutter leise. Ich nicke. »Ehrlich?«
»Es geht mir gut.« Ihr Lächeln ist noch immer ein bisschen zu besorgt, aber sie versucht es sich nicht anmerken zu lassen. »Du musst nicht auf mich warten«, sage ich. »Geh du ruhig schon vor.«
»Und du brauchst sicher nichts?«
»Nein, ich brauche nichts.« Außer Oskar.
Sie legt mir kurz die Hand auf die Schulter, dann verlässt sie das Badezimmer. Ich bringe mein Gesicht in Ordnung, tusche mir die Wimpern neu und binde mir das Haar zu einem hohen Dutt zusammen. Rouge brauche ich keines. Mein Blick fällt auf ein Haargummi, das auf dem Fußboden liegt. Als ich mich danach bücke und es aufhebe, sehe ich mich, wie ich vor nicht einmal zwei Stunden genau hier stand und nicht mehr atmen konnte, weil der Schmerz mich fast umgebracht hätte. Das war vor Oskar.