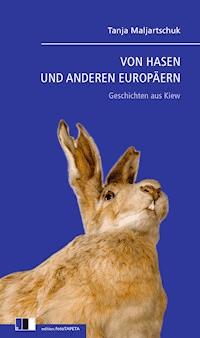12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Von der Bachmann-Preisträgerin Tanja Maljartschuk - ein Roman über den vergessenen ukrainischen Volkshelden Wjatscheslaw Lypynskyj, dessen Leben auf kunstvolle Weise mit dem der Ich-Erzählerin verknüpft wird: Sie sucht in dessen Vergangenheit nach Spuren, um besser mit ihrer eigenen Gegenwart zurechtzukommen. Eine Frau leidet, nach unglücklichen Beziehungen aus der Bahn geworfen, unter Panikattacken und verlässt monatelang die Wohnung nicht. Sie findet Orientierung und Halt in einer historischen Figur, die für die Geschichte der Ukraine eine große Rolle spielte: Wjatscheslaw Lypynskyj. Der leidenschaftliche Geschichtsphilosoph und Politiker entstammte einer polnischen Adelsfamilie, die in der Westukraine lebte. Schon früh identifizierte er sich mit der Ukraine und bestand auf der ukrainischen Form seines Namens. Nach dem Studium befasste er sich politisch und historisch mit dem zwischen Polen und Russland zerrissenen Land und forderte wie besessen seine staatliche Unabhängigkeit. Ein Kampf, der ihn durch verschiedene Länder führte und persönliche Opfer kostete. Ähnlich kränklich wie diese historische Figur und – wie er – auf der Suche nach Zugehörigkeit, folgt die Erzählerin diesem stolzen, kompromisslosen, hypochondrischen Mann, um durch die Erinnerung der sowjetischen Entwurzelung zu trotzen. Ein literarisch beeindruckender Roman, der zeigt, was es heißt, wenn die eigene Identität aus Angst, Gehorsamkeit und Vergessen besteht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 349
Veröffentlichungsjahr: 2019
Sammlungen
Ähnliche
Tanja Maljartschuk
Blauwal der Erinnerung
Roman
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Tanja Maljartschuk
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Tanja Maljartschuk
Tanja Maljartschuk, 1983 in Iwano-Frankiwsk, Ukraine geboren, studierte Philologie an der Universität Iwano-Frankiwsk und arbeitete nach dem Studium als Journalistin in Kiew. 2009 erschien auf Deutsch ihr Erzählband »Neunprozentiger Haushaltsessig«, 2013 ihr Roman »Biografie eines zufälligen Wunders« und 2014 »Von Hasen und anderen Europäern«. 2018 erhielt sie für den Text »Frösche im Meer« in Klagenfurt den Ingeborg-Bachmann-Preis. Die Autorin schreibt auf Deutsch regelmäßig Kolumnen für die Deutsche Welle (Ukraine) und für Zeit Online und lebt seit 2011 in Wien.
Maria Weissenböck, geboren 1980, Studium der Sprachwissenschaft und Slawistik in Wien und St. Petersburg. Seit 2004 arbeitet sie als freie Übersetzerin, vor allem aus dem Ukrainischen, dolmetscht im Kulturbereich und moderiert Lesungen. Sie übersetzte Werke u. a. von Taras Prochasko, Ljubko Deresch, Sofia Andruchowytsch, Maria Matios und Tanja Maljartschuk.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Eine Frau leidet, nach unglücklichen Beziehungen aus der Bahn geworfen, unter Panikattacken und verlässt monatelang die Wohnung nicht. Sie findet Orientierung und Halt in einer historischen Figur, die für die Geschichte der Ukraine eine große Rolle spielte: Wjatscheslaw Lypynskyj. Der leidenschaftliche Geschichtsphilosoph und Politiker entstammte einer polnischen Adelsfamilie, die in der Westukraine lebte. Schon früh identifizierte er sich mit der Ukraine und bestand auf der ukrainischen Form seines Namens. Nach dem Studium befasste er sich politisch und historisch mit dem zwischen Polen und Russland zerrissenen Land und forderte wie besessen seine staatliche Unabhängigkeit. Ein Kampf, der ihn durch verschiedene Länder führte und persönliche Opfer kostete. Ähnlich kränklich wie diese historische Figur und – wie er – auf der Suche nach Zugehörigkeit, folgt die Erzählerin diesem stolzen, kompromisslosen, hypochondrischen Mann, um durch die Erinnerung der sowjetischen Entwurzelung zu trotzen.
Ein literarisch beeindruckender Roman der zeigt, was es heißt, wenn die eigene Identität aus Angst, Gehorsamkeit und Vergessen besteht.
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
Titel der Originalausgabe: Забуття (Vergessenheit)
© 2016 Tanja Maljartschuk
All rights reserved
Aus dem Ukrainischen von Maria Weissenböck
© 2019, 2022, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Covergestaltung und -motiv: Nurten Zeren, zerendesign.com
ISBN978-3-462-31958-3
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
Hinweise
Widmung
I 2016
II 1931
III 1903
IV 2000
V 1905
VI 1906
VII 2003
VIII 1907
IX 1908
X 2009
XI 1910
XII 1914
XIII 0000
XIV 1918/2011
XV 1920
XVI 2011
XVII 1922
XVIII 2013
XIX 1929
XX 1930/1989
Personenverzeichnis
Die Arbeit der Übersetzerin am vorliegenden Text wurde vom Deutschen Übersetzerfonds gefördert.
Am Ende des Buches findet sich ein Personenverzeichnis.
Für Michael
I2016
Im Bauch des Blauwals
Wieso gerade er? Das ist die schwierigste Frage, auch für mich selbst. Wie bin ich darauf gekommen, über ihn zu schreiben? Was verbindet uns?
Meine Antwort ist: nichts.
Wir haben einander nie getroffen (eine Begegnung wäre rein physisch unmöglich gewesen), wir sind nicht verwandt, stammen nicht aus derselben Gegend, haben nicht einmal dieselbe Nationalität. Er ist Pole, ich bin Ukrainerin. Er ist Denker, als Politiker ein Philosoph, als Historiker ein Poet, ich hingegen bin ein Mensch ohne bestimmten Beruf, Manipulatorin von Worten und Ideen, ich kann schreiben und ich kann schweigen. Wir sind so verschieden, sind einander so fremd, dass keine Erzählung uns verbinden könnte, wäre da nicht meine irrationale Sturheit.
In unser beider Leben habe ich drei Berührungspunkte gefunden: zwei räumliche und einen zeitlichen. Das ist alles, mehr gibt es einfach nicht: Einmal verbrachte er ein paar Tage in meiner Heimatstadt. Der Krieg war eben zu Ende gegangen, er kam als Abgesandter des ukrainischen Staates, um an einem wichtigen Treffen teilzunehmen. Ich wiederum verbrachte ein paar Stunden in seinem Heimatdorf. Ich fuhr eigens dorthin. Ein Dorfbewohner namens Petro mit altmodischem Schnurrbart, der sich um das Familiengut kümmerte, zeigte mir alles bereitwillig und fragte ganz nebenbei:
»Sind Sie mit ihm verwandt? Wieso interessieren Sie sich für ihn? Für einen normalen Museumsbesucher wissen Sie ganz schön viel.«
Ich antwortete, dass ich mich einfach für ihn interessierte, es sei schwer zu erklären. Petro nickte, er verstand. Er gab mir seine raue, schwielige Hand. Ich verriet nicht, dass es noch etwas gab, das uns verband, ein seltsamer Umstand, auf den ich erst kurz zuvor gestoßen war und der mir als letzte Rechtfertigung meiner Hartnäckigkeit diente. Der zeitliche Berührungspunkt unser beider Leben: Wir wurden am selben Tag geboren, am 17. April. Er allerdings exakt hundert Jahre vor mir.
Nun denke ich oft über Zeit nach und erzähle allen, dass man erst mit der Zeit ein Gefühl für Zeit entwickelt. Je weiter man in ihr voranschreitet, desto sichtbarer wird sie. Je länger man lebt, desto mehr gibt es von ihr. Und alle anderen Zeiten, in denen ich nicht gelebt habe, aber von deren Existenz ich weiß, wachsen um das Körnchen meiner persönlichen Zeit, bilden Schichten, lagern sich ab. Deshalb scheint mir, als hätte ich schon unendlich viel gelebt, und das Ende müsste in Kürze kommen.
Das Ende kam tatsächlich, es kam als »Herz im Hals«. So nenne ich meine unberechenbaren Panikattacken, bei denen ich schreckliche Angst bekomme, und mein Herz – das wichtigste Organ des Körpers – plötzlich dröhnt und in meine Kehle drängt, als wollte es gleich hinausspringen. Ich versuchte, die Attacken in Worte zu fassen, sie sind meine Armee, schließlich bin ich Schriftstellerin, aber die Worte zerfielen, als hätte sie jemand gekocht und mit einem Holzlöffel umgerührt. Die Wörter hatten keine Bedeutung mehr. Das Ende, das ich erlebte, war das Ende aller Zeiten in mir und konnte nicht auf die gewohnte Art und Weise beschrieben werden. Ich brauchte neue Worte, eine neue Wahrheit, und die Suche danach beherrschte mein ganzes Denken.
Ich bin jung genug, um sagen zu können, dass ich meine gesamte literarische Karriere hindurch – und das sind sechs Bücher, die kaum jemand braucht – am Computer gearbeitet habe. Ich habe nie mit der Hand geschrieben, beherrsche es nicht, und muss ich doch etwas aufschreiben, kritzle ich und mache massenhaft Fehler, weil ich es nicht gewohnt bin. Der Computer dagegen ist mein Webstuhl. Früher erschien mir das Schreiben auf dem Computer wie das Weben eines Teppichs, ich wollte das Textwebwerk so farbenfroh wie möglich gestalten. Jetzt ist der Prozess des Schreibens eher wie Klavierspielen. Ich musiziere. Drücke virtuos die Tasten, wiege meinen Rumpf rhythmisch vor und zurück, meine Finger erstarren in der Luft, wenn ich eine Pause brauche, und landen danach artig wieder auf der Tastatur, bringen die richtigen Buchstaben zum Erklingen. Früher webte ich einen farbenfrohen Lebensweg, nun schreibe ich eine gnadenlose Musik des Endes. Ein Requiem auf mich selbst. Das heißt nicht, dass ich morgen sterben werde, ganz und gar nicht. Wenn man das eigene Ende erlebt und angenommen hat, kann man noch unbestimmt lange leben.
Das »Herz im Hals« war speziell bei den ersten Malen so unerträglich, dass ich mich aus dem Fenster gestürzt hätte, wenn ich mich in diesem Moment nur hätte bewegen können. Herzrasen, Schmerzen in Brust und Schläfen, Atemnot, Schwindel, Übelkeit. Doch das Schlimmste waren nicht die physischen Symptome, sondern die Verzerrung der Wirklichkeit, die mein ganzes Wesen durchdrang, ihre neue Wahrnehmung, wie von der anderen Seite, von wo es kein Zurück gibt. Es war nackte Todesangst, so denken die Lebenden über den Tod. Gleichzeitig erlebte ich den Verlust des Sinns in mir (oder war da nie einer gewesen?), des fundamentalen Sinns, von dem aus alles seinen Anfang nimmt. Die Frage nach dem Wieso überdeckte alle anderen Fragen. Nicht wer ich bin, war wichtig, sondern wieso. Nicht wann und wie spielte eine Rolle, sondern warum.
Und in einem dieser Augenblicke, als mich eine tiefe Leere quälte, begann ich plötzlich über die Zeit nachzudenken wie über etwas, das eine Kette sinnloser Ereignisse miteinander verbindet, und darüber, dass der Sinn nur in der Aufeinanderfolge dieser Ereignisse liegt und dass weder Gott noch die Liebe noch die Schönheit noch die Größe des Verstands unsere Welt bestimmen, sondern allein die Zeit, der Lauf der Zeit und das Vergehen des menschlichen Lebens in ihr.
Das menschliche Leben ist ihre Nahrung. Die Zeit verschlingt Millionen Tonnen davon, zerkaut und zermalmt sie zu einer gleichmäßigen Masse wie ein gigantischer Blauwal das mikroskopisch kleine Plankton – ein Leben verschwindet spurlos, um einem anderen, dem nächsten in der Kette, eine Chance zu geben. Mich bedrückte weniger das Verschwinden selbst als die Spurlosigkeit des Verschwindens. Ich dachte, dass ich mich bereits selbst mit einem Fuß dort befand, in der Vergessenheit. Der Prozess meines unabwendbaren Verschwindens hatte schon in der Minute meiner Geburt begonnen. Und je länger ich lebte, desto mehr verschwand ich. Meine Gefühle und Emotionen, mein Schmerz und meine Freude verschwanden, es verschwanden die Orte, die ich gesehen, und die Menschen, die ich getroffen hatte. Meine Erinnerungen und meine Gedanken verschwanden. Mein Verständnis von der Welt verschwand. Mein Körper verschwand, jeden Tag ein bisschen mehr. Die Welt in mir und um mich verschwand spurlos, und ich konnte nichts tun, um sie davor zu bewahren.
Damals begann ich, jede Menge alter Zeitungen zu lesen. Auf den verstaubten Seiten der Tagesblätter wurde am deutlichsten, wie winzig alles Lebendige vor dem Hintergrund der allmächtigen Zeit ist. Die Überschriften strotzten noch vor den Träumen und Ängsten ganzer Völker, Diskussionen wurden geführt, Skandale aufgedeckt, Gegendarstellungen abgedruckt, Apotheken, Buchhandlungen und Reiseagenturen platzierten ihre Werbungen, es wurden Spenden für im Krieg versehrte Landsleute gesammelt, ein Literaturabend wurde angekündigt, auf den letzten Seiten waren immer ein, zwei mittelmäßige Gedichte zu patriotischen Themen abgedruckt, für die Seele, und mit einem Mal wurde die brodelnde Gegenwart zur Vergangenheit, das offene Maul des Blauwals begann alles einzusaugen, der Herausgeber verkündete mit Bedauern, dass das Erscheinen der Zeitung aus finanziellen Gründen eingestellt würde. »Aber nicht für immer!« Danach gab es keine einzige Ausgabe mehr. Ende. Die Zeit hatte gesiegt. Der Blauwal war weitergeschwommen.
So war es mit der ersten ukrainischen Tageszeitung Dilo, die von 1880 bis 1939 in Lemberg erschien. Das Jahr 1939 bedeutete das Ende der viele Jahrhunderte andauernden Geschichte dieser Stadt: Der Einmarsch der Roten Armee führte sie in eine neue – die sowjetische – Epoche über, deren größte Leidenschaft darin bestand, das Vergangene zu vernichten und die Erinnerung daran zu verbieten.
Dasselbe passierte mit der zweiten wichtigen ukrainischen Tageszeitung Rada, die von 1906 bis 1914 in Kiew erschien. Ihr Herausgeber Jewhen Tschykalenko musste undenkbar hohe Summen aus eigener Tasche vorstrecken, um das weitere Bestehen der Zeitung zu sichern, da sie niemand abonnierte. Der Erste Weltkrieg löste dieses Problem auf radikale Weise, und Jewhen Tschykalenko atmete vor Erleichterung auf, denn sein Gewissen hatte es ihm nicht erlaubt, das Erscheinen der Zeitung einzustellen. Er sagte, die Zeitung sei wie eine Fahne: Solange sie weht, existiert die Ukraine.
Ein ganz anderes Schicksal erfuhr die Zeitung Swoboda, die von der ukrainischen Diaspora in New York seit 1893 herausgegeben wurde und bis heute erscheint. Die Swoboda wurde meine Lieblingszeitung, aber nicht weil sie die beste war, sondern weil sie alles sah und nichts vergaß. Hundertzwanzig Jahre, ohne Unterbrechung. Sechs Menschengenerationen lang, die sich in eine Chronologie fügen. Der Mord an Franz Ferdinand in Sarajevo und der Zerfall der Sowjetunion, der Brand in Husjatyn 1893 und die Geschichte von Anton, dem Hausschlachter von Bolechiw, der 1934 seiner Mutter mit einer Axt den Kopf abhackte. Oder am 20. Juni 1931: die Festnahme des Verbrechers Al Capone in Chicago. Einen Moment dachte ich über diese Information nach und versuchte mir vorzustellen, was im selben Jahr in einem anderen Teil der Welt geschah, in den Dörfern meiner Großväter und Großmütter, aber mir fiel nur ein, dass die Frauen in dieser Gegend damals keine Unterwäsche trugen, weil sie keine besaßen, und dass sie – wenn es sein musste – regelmäßig zu Hause blieben, damit niemand sah, wie das rituelle Blut an ihren Waden herunterrann.
Die großen schwarzen Buchstaben der Überschrift des Leitartikels, die das Interesse des gewissenhaften Lesers fesseln und ihn andere Nachrichten wie die Festnahme des Gangsters aus Chicago vergessen lassen sollten, erweckten erst später meine Aufmerksamkeit. Gerade einmal vier Wörter, in großen, fetten Lettern. Nicht zu übersehen. Ich las die Überschrift immer und immer wieder, bis ich nichts mehr verstand und fühlte. Immer und immer wieder.
Damals wusste ich nicht, wer er gewesen und wieso er gestorben war. Aber für irgendjemanden musste der Tod dieses Mannes von außergewöhnlicher Bedeutung gewesen sein, wenn sogar die Swoboda auf ihrer Titelseite darüber berichtete und so die Bedeutung des Schicksals von Al Capone und seinem New Yorker Kollegen Arthur Schultz schmälerte, der zur selben Zeit eingelocht wurde. Nicht einmal die Nachricht über die Aufnahme des russischen Schriftstellers Maxim Gorki in die Kommunistische Partei konnte die Todesnachricht an Wichtigkeit übertreffen, ebenso wenig der Selbstmord der Frau eines Rabbiners in Vilnius, der allem Anschein nach auf einen Nervenzusammenbruch zurückzuführen war. In dieser Ausgabe der Swoboda war nichts wichtiger als der Tod von Wjatscheslaw Lypynskyj. Im Gegensatz zur armen Frau des Rabbiners, deren Name nicht einmal erwähnt wurde, verlangte der Name Lypynskyj keiner Erklärung, andernfalls hätte man ihn nicht an eine Stelle gesetzt, die für Weltkatastrophen reserviert war, wie das verheerende Erdbeben in San Francisco 1906.
Ich las den Nachruf unter der schwarzen Überschrift. Ein wichtiger Historiker und Politiker. Er hatte angeordnet, ihm nach dem Tod das Herz zu durchstechen, aus Angst, lebendig begraben zu werden. Der Herzstich wurde im österreichischen Sanatorium Wienerwald durchgeführt, in dem ein paar Jahre zuvor der damals unbekannte Schriftsteller Franz Kafka erfolglos behandelt worden war. Lypynskyjs Tochter Ewa und sein Bruder Stanisław waren Zeugen der Prozedur.
Zur selben Zeit, im Juni 1931, feierte mein Großvater seinen fünften Geburtstag. Seine Mutter besaß keine Pferde und spannte sich selbst vor den Pflug, um ihren Hektar Land zu pflügen, und anstelle der Unterschrift machte sie ein Kreuz. Ihre Heimat, die Ukraine, genauer gesagt Ostgalizien, gehörte damals zu Polen.
Auch meine andere Großmutter war bereits auf der Welt. Ihre Mutter hatte die schönste Stimme in der Gegend, doch nur wenige konnten sich daran erfreuen, denn die Frau starb gleich nach der Geburt ihres Kindes. Der Witwer, einst ein wohlhabender Bauer, ließ seine Tochter auf den Stufen des Waisenhauses zurück und starb selbst 1933 an Hunger. Ihre Heimat – Kleinrussland, die russische Ukraine, die Große Ukraine, die Ukrainische Sozialistische Republik – war de facto ein Teil Russlands. Doch kann man ein Land, das tötet, als Heimat bezeichnen? Ich weiß es nicht. Ich befand mich im Bauch des Blauwals. Obwohl ich verschluckt worden war, hatte ich die Möglichkeit, meine Geschichte neu zu erleben. Meine und seine, die von Wjatscheslaw Lypynskyj. Meine Geschichte mithilfe seiner Geschichte. Ich musste nur so tun, als hätte niemand sein Herz durchstochen, als würde es immer noch schlagen. In meiner Kehle. Und ich beiße die Zähne zusammen, damit es ja nicht aus mir herausspringt.
II1931
Einatmen – Ausatmen
Mit einiger Verspätung berichtete die gesamte ukrainische Presse ohne Ausnahme über seinen Tod. Wjatscheslaw Lypynskyj ist tot. Lypynskyj verstorben. Was für ein Verlust. Höchste Zeit. Alle kannten Lypynskyj. Ohne ihn würde es schwieriger werden. Oder einfacher? Jedenfalls langweiliger, denn er hatte alle auf Trab gehalten. Mit Lypynskyj wurde die ukrainische Noblesse zu Grabe getragen. Er war ein verrückter Tuberkulosekranker. Ein Einsiedler. Jahrelang hatte ihn niemand gesehen. Doch alle lasen, was er schrieb. Und er schrieb viel. Manchmal zehn Briefe pro Tag. Wer konnte sein Gekritzel überhaupt entziffern? Wer verstand überhaupt, was er sagen wollte? Er war gefürchtet, weil er von allen menschliche Würde verlangte und darauf bestand, dass sie jedermanns Pflicht sei. Wer brauchte das schon? Ja, niemand mochte ihn, alle duldeten ihn. Und atmeten erleichtert auf, als er starb. Lypynskyjs Feinde schrieben rühmende Nachrufe. Sie hatten sie schon im Voraus verfasst, hatten sich gleichsam einen Vorrat an Nachrufen angelegt. Alle warteten auf seinen Tod. Seltsam, dass er nicht früher gestorben war.
Er wurde auf Händen hinausgetragen. Das Auto, das ihn ins Sanatorium bringen würde, wartete vor dem Haus.
»Ob ich das alles noch einmal sehen werde?«, fragte er sich mit einem Blick zurück.
»Aber sicher, Sie haben schon Schlimmeres überstanden«, antwortete Lypynskyjs Haushälterin Fräulein Julia Rosenfelden. Er sprach ukrainisch, sie sprach deutsch. In ihrem langjährigen Zusammenleben hatten sie sich perfekt aufeinander abgestimmt. Von allen Menschen verstand sie ihn am besten und konnte seinen jeweiligen Gesundheitszustand allein anhand der Tiefe und Geschwindigkeit seines Atems bestimmen. Lypynskyjs Atmung zu analysieren war ihre Leidenschaft, ihr Hobby, das die Haushälterin zur Vollendung gebracht hatte, neben der Hausarbeit, dem Reinigen der Kleidung und dem Putzen der Schuhe, die Lypynskyj seit Jahren nicht mehr trug. Alle nannten das Fräulein Fin Julí. Sie war fünf Jahre älter als ihr Dienstgeber, unverheiratet, eine ergraute Blondine, mit scharfer Zunge, aber zugleich gerecht und warmherzig. Sie pflegte zu sagen: »Wieso haben Sie es so eilig? Atmen Sie langsamer. Eiiins-Zweeei. (Einatmen-ausatmen.)« Lypynskyj winkte immer verärgert ab.
»Ich bin froh, dass ich überhaupt noch atme, lassen Sie mich in Ruhe.«
(Einatmen-ausatmen. Einatmen-ausatmen.)
Lypynskyj versuchte, die Kontrolle über seine Lunge wiederzuerlangen, zumindest über jenen Teil, der – wie er meinte – noch nicht völlig durchlöchert war. Dann öffnete Fin Julí weit die Fenster, und der kalte Gebirgswind fegte ins ordentlich aufgeräumte Zimmer, in dessen Mitte ein großes Bett stand. Das Bett diente Lypynskyj schon seit Langem als Arbeitsplatz. Durch das Fenster sah man schneebedeckte Alpengipfel. Lypynskyj schloss die Augen und atmete. Eiiins-zweeei. (Einatmen-ausatmen.) Zwei Stunden. Drei Stunden. Als schaukelte er in einer Wiege, die zwischen zwei Berggipfeln über einem tiefen Tal gespannt war. Sein nach wie vor tiefschwarzer Schnurrbart überzog sich langsam mit Raureif.
Vor dem Haus stand Lypynskyjs Tochter Ewa. Sie war eigens aus Krakau angereist, als sie vom Herzanfall ihres Vaters erfahren hatte. Der Herzanfall ereignete sich Ende Mai, der Arzt war sechs Stunden unterwegs gewesen, da in den Bergen fürchterliche Unwetter tobten, trübe Sturzbäche donnerten mit an den Felsen abgehobelten jungen Baumstämmen ins Tal, wuschen auch die guten Wege aus, von den Pfaden ganz zu schweigen. Lypynskyj war sehr nervös. Fin Julí stand am Fenster, wie ein Kind fragte Lypynskyj alle paar Minuten:
»Ist er schon da?«
»Noch nicht, aber bald.«
»In meinem Zustand«, rief er, »kann man nicht so lange auf den Arzt warten.«
Sie trafen die Entscheidung, Lypynskyj ins Sanatorium zu bringen. Lypynskyj verkaufte sein Archiv an Andrej Scheptyzkyj, den Metropoliten der ukrainischen griechisch-katholischen Kirche, um den teuren Aufenthalt im Sanatorium Wienerwald bezahlen zu können. Für das Archiv – Briefe, Handschriften, Notizen, unveröffentlichte Artikel und Unterlagen dazu – erhielt er ein paar Hundert Dollar. Das musste für die erste Zeit reichen.
Lypynskyj hatte sich von Kindheit an auf den Tod vorbereitet, als dieser aber im neunundvierzigsten Lebensjahr die Hand nach ihm ausstreckte, begann er sich mit aller Kraft dagegen zu sträuben. Er wollte nicht sterben. »Wenigstens noch ein paar Jahre«, murmelte er. Wenn er meinte, er sei unbeobachtet. Es wäre gut, das eine oder andere zu Ende zu schreiben, dies oder jenes zu sehen oder zu tun. Die politischen Feinde zu vernichten. Derer hatte Lypynskyj viele. Ein paar Tage mit seiner Tochter zu verbringen. Vielleicht mit ihr ans Meer zu fahren wie einst mit ihrer Mutter? Ein Jammer, dass ihm die Meeresbrise so schadete. Brisen und Böen – diese Bestien, seine Mörder. Der Wind hatte Lypynskyj zugrunde gerichtet. Am Geruch unterschied er die verschiedenen Arten von Wind. Am Geruch des Windes bestimmte er auch die Uhrzeit. Der Wind um fünf Uhr morgens riecht anders als jener, der eine Stunde später weht. Er riecht intensiver, irgendwie frischer, wie Morgenseife. Lypynskyj konnte sie alle voneinander unterscheiden, denn der Wind hatte ihn sein Leben lang angetrieben und am Ende zur Geisel eines kleinen Landes gemacht, in dem nach dem Zerfall der Monarchie niemand aus freiem Willen hätte leben wollen. Der kalte Nordwestwind vertrieb Lypynskyj aus Genf, wo er ein Jahr Soziologie studiert hatte, zusammen mit einem starken Westwind verjagte er ihn aus Wien, wo Lypynskyj beinahe ein Jahr Gesandter des ukrainischen Staates unter Hetman Pawlo Skoropadskyj gewesen war, und schließlich vertrieb er ihn auch aus Berlin, wo Lypynskyj – überzeugt, dass die »konstitutionelle Monarchie« die einzig mögliche Staatsform für die Ukraine sei – versucht hatte, Ruhe in die höfischen Intrigen zu bringen und den Exilkandidaten für das Amt des ukrainischen Monarchen an seine Hetman-Ehre zu erinnern. Genf, Wien, Berlin. Immer wenn ein Arzt seine Lunge abhörte, schüttelte er den Kopf und riet ihm, diesen Ort zu verlassen. Der Wind hatte Lypynskyj aus dem Leben vertrieben und ihn zur ewigen Gefangenschaft in diesen wunderschönen und zugleich verhassten österreichischen Bergen verdammt. Steiermark. Drei Kilometer bis zum nächsten Bahnhof. Eine halbe Stunde bis Graz. Fünf Zugstunden bis Wien. Postamt Tobelbad. Badegg.
Das Haus in Badegg – das »Sterbehaus«, wie er es selbst nannte – war nicht teuer gewesen, es hatte bloß fünftausendfünfhundert Schilling, also achthundert Dollar, gekostet, aber für Lypynskyj, der schon lange mit zwanzig Dollar im Monat auskommen musste, war auch das eine astronomische Summe. Unterstützung kam von einem Mäzen aus Kanada und von Lypynskyjs Bruder Stanisław. Im Gegenzug würde Lypynskyj keinerlei Ansprüche auf das elterliche Anwesen in der Ukraine, im Dorf Saturzi unweit von Luzk, erheben. Dort war nun Stanisław Hausherr, ein angesehener Fachmann in der Selektionszüchtung (vor allem für neue Weizen- und Kartoffelsorten). Lypynskyjs älterer Bruder Włodzimierz war Arzt und lebte in Luzk, er besaß das erste Automobil der Stadt. Doch war die Familie Lypynskyj – oder richtiger Lipiński – nicht sehr wohlhabend. Sie gehörte dem mittleren polnischen Adel an und hielt sich nur dank guter Ausbildung und geschickten Wirtschaftens über Wasser.
Auch Lypynskyjs Bruder Stanisław reiste an, als er von dem Herzanfall hörte. Er hatte etwas an Form verloren, ein Bäuchlein und weichere Gesichtszüge bekommen – eine normale Veränderung bei glücklich verheirateten Männern, zu denen er zweifellos zählte. Als er Lypynskyj auf Händen hinaustrug, sagte er zärtlich:
»Wacław, ich habe dir gesagt, dass es sich nicht lohnt, ein Haus in dieser Einöde zu kaufen. Wieso bist du nicht zu uns nach Saturzi gekommen? Wir haben genug Platz, wunderbare Natur, kaum Wind, Maria und die Kinder hätten sich gefreut, du weißt, wie sehr sie dich lieben …«
»Nenn mich nicht Wacław«, gab Lypynskyj röchelnd zurück. Sein Bruder und seine Tochter sprachen polnisch, Lypynskyj ukrainisch.
Der Satz »Nenn mich nicht Wacław« war mit nur neunzehn Jahren zu seiner Waffe geworden. Damals war er aus dem Kiewer Gymnasium in den Winterferien nach Saturzi gekommen. Die ganze Familie hatte sich um den Mittagstisch versammelt. Lypynskyj lauschte still den örtlichen Neuigkeiten, die Gymnasiumsuniform stand ihm ausgezeichnet, betonte seine wohlproportionierte, jedoch etwas gebeugte und allzu dürre Figur; sein dichtes pechschwarzes Haar war auf Gymnasiasten-Art nach hinten gekämmt.
»Wacław, wie gefällt es dir in der Schule?«, fragte ihn die Mutter, Klara Lipińska, schließlich. Alle schauten ihn an, und je länger das Schweigen dauerte, desto größer wurde das Interesse der Anwesenden. Wanda, Lypynskyjs Schwester, Stanisław und Włodzimierz beobachteten den Bruder aufmerksam. Nur der Vater Kazimierz Lipiński verzehrte mit der ihm eigenen Unbekümmertheit weiter sein Festtagskotelett. Lypynskyj räusperte sich unsicher.
»Wacław?« – Klara wartete noch immer auf eine Antwort. Da schoss Lypynskyj zum ersten Mal mit seiner neuen Waffe, die er später noch oft zum Selbstschutz aus dem Halfter holen sollte.
»Nennt mich nicht Wacław. Ich heiße Wjatscheslaw.«
Der Vater erstickte fast an seinem Kotelett. Der Mutter entfuhr ein Schrei. Die Brüder und die Schwester warfen einander stumme Blicke zu. Lypynskyj sprach überdies ukrainisch, und diese Sprache (dieser dörfliche Dialekt, denn die Mischung aus Polnisch und Russisch war doch keine Sprache) hatte die Familie Lipiński noch nie aus dem Mund eines gebildeten Menschen gehört, immer nur von der armen Landbevölkerung.
»Ist etwas vorgefallen, was wir wissen sollten?«, fragte Klara Lipińska, und es kostete sie viel Kraft, die Ruhe zu bewahren. Sie war keine große Frau, aber eine herrische.
»Ich betrachte mich als Ukrainer«, zischte der frischgebackene Wjatscheslaw leise, kaum hörbar. Seine Entschlossenheit nahm ein wenig ab. Seine Haltung wurde gekrümmter.
Nun konnte sich Klara Lipińska nicht mehr zurückhalten:
»Du willst Ukrainer sein?! Du bist Pole, mein Sohn! Wir alle sind seit eh und je Polen!«
Lypynskyj schwieg und hielt den Kopf gesenkt. Es war offensichtlich, dass er anderer Meinung war und nicht vorhatte einzulenken, doch noch hatte er nicht genug Argumente für den Konter. So machte er es immer: Er schwieg, um sich gut auf den Angriff vorbereiten zu können. Klara Lipińska kannte diese Eigenschaft ihres Sohnes so gut wie sonst niemand, und nun zitterte sie vor Zorn und Ratlosigkeit. Er war immer schon so gewesen, unverlässlich, kränklich, nervenschwach, und nun, bitte schön, hatte er endgültig den Verstand verloren.
Das festliche Mittagessen war hiermit beendet. Alle verkrochen sich in ihre Winkel, mürrisch und zornig. In der Nacht fiel ungewöhnlich viel Schnee. Lypynskyj lag in seinem Bett und starrte zur Decke, er fürchtete, das Dach könnte unter der Last des Schnees einstürzen und er würde von einem weißen Hügel zugedeckt, wie von Erde in einem frischen Grab. Noch oft ergriff ihn später das Gefühl, er läge ganz unten am Grund, wo es kalt und einsam wäre, und die Grube erschien noch tiefer als in Wirklichkeit, unendlich tief, als wäre da kein Boden, sondern ein endloser vertikaler Schacht – und Lypynskyj streckte verzweifelt die Hände nach oben aus, um irgendetwas zu fassen, einen unsichtbaren Griff, an dem er sich festhalten könnte.
Seine Entscheidung, trotz allem nach dem Gymnasium an der Fakultät für Agrarwissenschaften in Krakau zu studieren, löste die Anspannung in der Familie ein wenig. Zwar interessierte ihn die Bearbeitung von Grund und Boden nicht mehr als die Damenhutmode, doch eine agrarwissenschaftliche Ausbildung war für einen jungen Mann seiner Herkunft und seines Standes eine sehr rationale Wahl: Grundbesitzer mussten wissen, was sie mit ihren Hektaren anfangen sollten. Und wo studierte es sich für einen jungen Polen am besten, wenn nicht in Krakau? Das wächst sich aus, hoffte Klara Lipińska, Wacław ist ein schlauer Junge, er rebelliert bloß.
Sein Bruder Stanisław musste lachen, als er das bekannte und längst leidige »Nenn-mich-nicht-Wacław« hörte.
»Du hast recht«, sagte er, »aus dir ist definitiv kein anständiger Wacław geworden.«
Nun, im Jahr 1931, hatten die Weltanschauungskonflikte zwischen den beiden an Brisanz verloren. Stanisław nannte seinen Bruder absichtlich Wacław, im Scherz, um ihn zu ärgern. Als alle Kriege zu Ende und alle Schlachten verloren waren, als sich alles bereits ereignet hatte, waren Namen das Allerwenigste, was Bedeutung hatte. Die Brüder hatten keinen Grund mehr zu streiten. Nichts war geblieben, außer Löchern in der Lunge.
Eiiins-zweeei. (Einatmen-ausatmen.)
Sie stiegen in das Auto. Fin Julí fuhr mit ins Sanatorium, ohne sie konnte sich Lypynskyj seinen Alltag nicht vorstellen. Sie musste ihm die Kissen zurechtrücken, sich mit den Ärzten besprechen, ihm Zeitungen vorlesen, in der Nacht Wasser reichen, die Hand auf seine Stirn legen und sagen: »Alles in Ordnung, Sie haben kein Fieber.« Fin Julí musste seinem unregelmäßigen Atem lauschen und feststellen, ob er noch am Leben war. Manchmal zweifelte Lypynskyj selbst daran – dann genügte es, zu Fin Julí hinüberzuschauen, und die Haushälterin nickte beruhigend, als wollte sie sagen, keine Sorge, Sie sind am Leben.
Der Chauffeur ließ den Motor an. Es war sieben Uhr morgens. Die Fahrt würde vier bis fünf Stunden dauern. Auf der Holztreppe des Hauses stand Lypynskyjs treuer Gefährte, sein langjähriger Sekretär Sawur-Zyprijanowytsch. Er winkte zum Abschied. Der Mann mit dem roten Schnurrbart war ungefähr im selben Alter wie Lypynskyj. Er stammte irgendwo aus der Kiewer Gegend, in keiner Enzyklopädie wird man Details über seinen Geburtsort finden. Ein Schattenmensch. Er hatte die letzten elf Jahre bei Lypynskyj gelebt, nachdem er in einem Güterzug aus dem zum wiederholten Mal von den Bolschewiken eroberten Kiew nach Wien geflohen war. Dort war ihm nur eine Adresse bekannt gewesen: Hotel Bristol, Ringstraße 1, sowie dass sich der ukrainische Gesandte hier einquartiert hatte. Zyprijanowytsch kam und stellte sich im Foyer des Hotels ans Fenster, der Portier musterte den Fremden von Kopf bis Fuß.
»Ich komme zum Gesandten Lypynskyj«, verkündete Zyprijanowytsch, aber der Portier schüttelte den Kopf. Der Herr Gesandte habe sein Amt niedergelegt und sei dabei umzuziehen. Und außerdem sei er sehr krank – lassen Sie ihn doch in Frieden. Zyprijanowytsch war ratlos, aber er ging nicht, denn er wusste nicht, wohin. Der Portier wiederholte immer wieder: Lassen Sie ihn endlich in Frieden, gehen Sie, hier gibt es nichts zu holen, was krallen Sie sich fest wie ein Aasgeier.
»Und wer ist jetzt Gesandter der Ukraine?«, fragte Zyprijanowytsch verzweifelt.
Der Portier verlor die Geduld:
»Woher soll ich das wissen, werter Herr?! Da haben Sie den Richtigen gefunden für Ihre Fragen!«
Im selben Moment betrat Lypynskyj das Foyer: ein auf beiden Seiten spitz zusammenlaufender, gepflegter Schnurrbart, ordentlich gekämmtes dichtes schwarzes Haar, große Augen, überraschend lebendig für diesen abgemagerten Körper. Vor dem Eingang wurde Lypynskyj von einer Kutsche erwartet, die ihn ins Sanatorium bringen sollte. Fin Julí gab dem Kutscher Anweisungen.
»Herr Lypynskyj«, rief Zyprijanowytsch und verstummte gleich darauf erschrocken, denn er wusste nicht, was er weiter sagen sollte.
Lypynskyj blieb stehen und blickte Zyprijanowytsch fragend an.
»Wohin kann ich gehen, Herr Lypynskyj, haben Sie einen Rat für mich?«
»Wer sind Sie?«
»Mychajlo Petrowytsch Sawur-Zyprijanowytsch.«
»Ich habe ihm schon gesagt, dass es hier nichts zu holen gibt«, mischte sich der Portier ein.
Lypynskyj begann zu husten. Fin Julí reichte ihm ein weißes Taschentuch, auf dem in Rot »W. Lipiński« eingestickt war.
»Und was können Sie?«, fragte Lypynskyj plötzlich.
»Ich bin Sekretär«, murmelte der andere hoffnungslos. »Ich habe für die Regierung des Direktoriums gearbeitet, in der Kanzlei des Ministeriums für Bildung. Wir wurden vor einem Monat aus Kiew evakuiert.«
»Welche Sprachen beherrschen Sie?«
»Deutsch, Französisch und Russisch.«
»Und Ukrainisch?«
»Das ist meine Muttersprache.«
»Besuchen Sie mich in einem Monat im Sanatorium in Baden. Wenn wir uns einigen können, werden Sie mein Sekretär. Ich bin gerade auf der Suche.«
Zyprijanowytsch dankte, Tränen hündischer Ergebenheit traten ihm in die Augen, doch er verjagte sie mit den Ärmeln seines abgestoßenen Gehrocks.
Bereits bei der Tür fragte Lypynskyj noch:
»Haben Sie ein Quartier?«
»Nein, Herr Gesandter.«
»Ich bin kein Gesandter mehr, nennen Sie mich Wjatscheslaw Kasymyrowytsch« – er flüsterte dem Portier etwas zu, verließ das Hotel und setzte sich in die Kutsche.
»Du hast Glück«, brummte der Portier und bedeutete Zyprijanowytsch, ihm zu folgen, »er ist eben ein guter Mensch, und das nutzen alle aus. Ich würde solche wie dich zum Teufel jagen. Die sich festkrallen wie Aasgeier.«
Einen Monat später einigten sie sich, und Zyprijanowytsch trat sein Amt umgehend an. Er hatte unterschiedliche Aufgabenbereiche. Abgesehen von seinen engeren Pflichten als Sekretär, erledigte er schwere Arbeiten im Haus, holte bei Notfällen den Arzt (manchmal einige Male pro Nacht), nahm am Bahnhof Gäste in Empfang und brachte sie mit dem Fuhrwerk auf den Berg. Außerdem korrespondierte Zyprijanowytsch in Lypynskyjs Namen mit jenen, die Lypynskyj selbst uninteressant fand. Die Antworten setzte er aus früheren Briefen zusammen: So sehr es ihn auch juckte, er hatte kein Recht, seine Fantasie spielen zu lassen. Er traf sich in Wien mit Lypynskyjs alten Freunden, fragte sie über das gegenwärtige Leben aus und berichtete danach alles detailliert seinem Hausherrn. Manchmal flunkerte er ein bisschen, machte etwas besser oder verschwieg jemandes Tod. Zyprijanowytschs Gehalt betrug monatlich zwei Dollar plus Kost und Logis. Hin und wieder bot Lypynskyj ihm eine Prämie an, doch Zyprijanowytsch lehnte meist ab, denn er wusste, dass Lypynskyj selbst nicht genug für seine Behandlungen hatte. Zyprijanowytsch war gesund und genügsam. Sein einziges Problem waren seine kranken Zähne. Manchmal zahlte Lypynskyj dem Sekretär einen Besuch beim Dentisten, denn in ihrer Gegend übte diese Tätigkeit der gewöhnliche Arzt aus, der von Zähnen gerade so viel verstand, dass sie aufhörten zu schmerzen, wenn man sie herauszog.
Ihr Arbeitsmorgen sah folgendermaßen aus: Fin Julí kam ins Zimmer und öffnete das Fenster weit, damit Lypynskyj mit seinen Atemübungen beginnen konnte. Die sogenannte »Luftkur«. Zyprijanowytsch fragte geschäftig:
»Werden Sie heute selbst schreiben oder diktieren?«
Die Frage war überflüssig, denn Lypynskyj nahm schon lange keinen Stift mehr in die Hand. Sein Gekritzel konnte ohnehin niemand lesen, nicht einmal er selbst.
»Diktieren« – und Zyprijanowytsch holte sein Ein und Alles ins Schlafzimmer, seine Gottheit: die Schreibmaschine. Für sie wäre er gestorben. Die Schreibmaschine ernährte Zyprijanowytsch wie die Kuh den galizischen Bauern. Vorsichtig stellte er die Schreibmaschine auf den Tisch, setzte sich und knetete seine Hände wie ein Chirurg vor einer heiklen Operation.
»Ich bin bereit, Wjatscheslaw Kasymyrowytsch. Wie viele Briefe werden es heute sein?«
»Einer. Aber machen Sie eine zweite Abschrift. Und ich bitte Sie, Zyprijanowytsch, verdrehen Sie nicht, was ich Ihnen sage, korrigieren Sie keine vermeintlichen Fehler. Schreiben Sie einfach, was ich diktiere.«
»Aber das Wort ›Beendigung‹ schreibt man mit zwei ›e‹, das bestätigt Ihnen jeder, den Sie fragen.«
Lypynskyj winkte verärgert ab.
»Schreiben Sie es so, wie Sie meinen, zum Kuckuck, Sie machen es ja ohnehin auf Ihre Art. Meine Freunde erzählen mir, dass sich Ihre auf der Maschine geschriebenen Briefe von meinen handgeschriebenen unterscheiden und dass sie mich manchmal darin nicht wiedererkennen.«
Zyprijanowytsch hatte gelernt, auf solche Angriffe nicht zu reagieren. In all den Jahren seines Dienstes hatte er Lypynskyj weichherzig diverse verbale Auswüchse verziehen, die kein anständiger Sekretär je geduldet hätte. »Gauneritis« zum Beispiel. Was für ein Wort ist das denn?! Was soll es bedeuten?! »Gauneritische Gefahr« – das versteht kein Mensch. Oder »Ohneeigenstaatlichkeit«. Man hätte lachen und weinen mögen. Aber Zyprijanowytsch duldete alles, biss die Zähne zusammen und tippte sogar noch größere Unsinnigkeiten.
»An Iwan Krewezkyj«, Lypynskyj nannte den Namen des Adressaten und wartete, bis sein Sekretär den üblichen Briefkopf getippt hatte: Badegg, Postamt Tobelbad, Österreich. Durchs Fenster wirbelte Schnee herein, Lypynskyjs Bart und Augenbrauen wurden nach und nach weiß.
Einatmen-ausatmen.
»Sehr verehrter und lieber Herr Krewezkyj«, diktierte er langsam, »anlässlich der Weihnachtsfeiertage und für das neue Jahr wünsche ich Ihnen von Herzen alles Gute. Ich danke Ihnen meinerseits für die guten Wünsche und dafür, dass Sie an mich gedacht haben. Nur einen Ihrer Wünsche kann ich nicht verstehen: Rückkehr ins Heimatland? Wer braucht mich schon in dieser Heimat und wozu?«
Zyprijanowytsch wurde langsamer, auch er begann zu frieren.
»Nein, ich hoffe, dass mich der gütige Gott zumindest am Ende meines Lebens vom ukrainischen Volke erlöst, dem ich alles gab, was ich hatte, und das mir zum Dank den größten Affront bescherte, den es für einen ehrenhaften Menschen gibt. Nicht eine einzige Stimme erhob sich zu meinem Schutze, als man begann, mich mit Dreck zu bewerfen, der sich nun – auf den Ruinen der Ukraine und meines Lebens – in eine Lawine verwandelt und immer mehr unter sich begräbt. ›Lawine‹ schreibt man nicht mit ›ie‹.«
»Ich weiß, wie man ›Lawine‹ schreibt«, empörte sich Zyprijanowytsch, »das müssen Sie mir nicht erklären, Wjatscheslaw Kasymyrowytsch.«
»Verzeihen Sie, ich mache das aus Gewohnheit. Schreiben Sie weiter: Meine Ukraine ist tot. Ich habe nichts und niemanden, zu dem ich zurückkehren könnte. Signatur: Ein für die Verstorbenen Verstorbener.«
»Ein für die Verstorbenen Verstorbener. Was ist das für eine Unterschrift? Sie leben doch noch.«
»Schreiben Sie einfach, was ich Ihnen diktiere.«
Zyprijanowytsch fügte sich und sprach laut mit, was er tippte:
»Ein für die Verstorbenen Verstorbener. Datum: 30. Dezember. Soll ich Dezember oder Christmonat schreiben?«
»Schreiben Sie Dezember.«
»30. Dezember 1931. Hochachtungsvoll, Ihr Lypynskyj.«
Dann bat Lypynskyj, ihn allein zu lassen. Vom Flur konnte man hören, dass er weinte.
Als Zyprijanowytsch das für die Fahrt ins Sanatorium gepackte Auto verabschiedete, ahnte er nicht, dass er seinen Hausherrn zum letzten Mal sehen sollte. Sonst hätte er sich irgendwie auf diesen Moment vorbereitet. Hätte Lypynskyj vielleicht umarmt. Sie umarmten einander nie, lagen sich nur in den Haaren, obwohl sie einander achteten und ohne den anderen nicht auskamen. Nach einem wiederholten »Rechtschreib«-Streit war Zyprijanowytsch so in Rage geraten, dass er kündigte und demonstrativ nach Wien reiste, um sich eine neue Arbeit zu suchen. Nachdem er zwei Wochen bei ihrem gemeinsamen Bekannten Schuk zugebracht hatte, kehrte er, ohne Lypynskyjs Entschuldigungsbrief abzuwarten, zurück. Lypynskyj nahm ihn wortlos wieder auf. Den Entschuldigungsbrief hatte er tatsächlich geschrieben, doch nicht gewusst, an welche Adresse er ihn schicken sollte.
Es gibt ein Foto von den beiden. Lypynskyj in seinem immer gleichen Hausmantel. Und mit einem Gehstock in der Hand. Zyprijanowytsch in einem zweireihigen Flanellhemd im schrägen Karo, die Farben sind nicht zu erkennen, weil es eine Schwarz-Weiß-Aufnahme ist. Sie sitzen Schulter an Schulter vor dem Haus in Badegg, im Hintergrund sieht man Kinder, vielleicht die des Bruders Stanisław. Es ist warm. Die Terrasse ist voll von blühenden Blumentöpfen. Beide Männer haben an Größe eingebüßt, sind ausgemergelt, mit schmächtigen Oberkörpern. Lypynskyj schaut ins Objektiv, Zyprijanowytsch zur Seite. Sein Kopf ist eiförmig, der Hinterkopf bereits völlig kahl. Die Brauen zusammengezogen. Zyprijanowytsch ist ein Phantom. In keinem Lexikon findet man Angaben über sein weiteres Leben. Niemand weiß, was später mit ihm geschah. Als Lypynskyj starb, starb auch er.
Das Einzige, was Zyprijanowytsch hinterließ, ist eine kurze, aber detaillierte, beinahe physiologische Beschreibung der letzten Lebenstage seines Hausherrn. Ein Jahr nach dessen Tod wurde sie von einer Lemberger Zeitschrift abgedruckt. Zyprijanowytsch berichtete, dass die Fahrt ins Sanatorium gut verlief, dass Lypynskyj gut gelaunt und voller Hoffnung war. Im Sanatorium wurde sofort eine Campher-Behandlung durchgeführt. Am nächsten Tag, nach einer genauen Untersuchung, fragte Fin Julí den Arzt, ob es Hoffnung gebe, der antwortete kopfschüttelnd, dass Lypynskyj gekommen sei, um zu sterben. Die Haushälterin maß den Worten des Arztes nicht allzu viel Gewicht bei, denn sie hatte schon oft Ähnliches gehört. Bruder und Tochter reisten nach langen Beratungen ab. Lypynskyj richtete sich nur am Morgen auf, um sich im Sitzen zu waschen. Die Haushälterin las ihm deutsche Zeitungen vor. Er war die ganze Zeit über bei vollem Bewusstsein. Schlief mit offenen Augen. Wiederholte ständig, dass er noch ein paar Jahre leben müsse, sagte etwas von Meer und Salz, erinnerte sich an seine Frau, die er nach der Scheidung 1919 kein einziges Mal mehr gesehen hatte. Die Haushälterin ließ den Priester für die Beichte kommen, Lypynskyj war einverstanden, wunderte sich aber und beteuerte, dass er sich nicht so schlecht fühle. Um acht Uhr abends, nach einer weiteren Campher-Behandlung, klagte er über Müdigkeit und wollte schlafen. Die Haushälterin schüttelte seine Kissen auf. Er schlief ein. Er schlief mit offenen Augen. Atmete wie immer kurz und schnell. Fin Julí döste in einem Polstersessel daneben. Um etwa halb elf hörte sie ein tiefes Ausatmen. Sie zählte bis fünf. Ein Einatmen gab es nicht mehr.
III1903
Krakau
Akkurat gekleidet, frisch rasiert, gepflegte Fingernägel, ganz in Schwarz, sogar die Krawatte – so sah ihn der Ukrainistikprofessor der Krakauer Jagiellonen-Universität Bohdan Lepkyj zum ersten Mal in einer seiner Vorlesungen.
»Sind Sie aus Russland?«, fragte er. Lypynskyj bejahte. Aus Wolhynien. Zur Vorlesung der ukrainischen Sprache sei er zufällig gekommen, denn eigentlich studiere er Agronomie, doch er bereue es ganz und gar nicht, denn die Vorlesung habe sich als äußerst interessant erwiesen. Er sprach besser Ukrainisch als so mancher gebürtige Ukrainer. Professor Lepkyj war begeistert und lud ihn gemeinsam mit einem Freund sofort zu sich nach Hause zum Tee ein.
»Vielen Dank für die Einladung, Herr Professor, ich komme sehr gerne«, antwortete dieser, »aber ich habe eine Bitte: Nennen Sie mich Wjatscheslaw.«
»Ein Phänomen«, erzählte der Professor allen, »ein wahres Phänomen.«
Der Professor war ein außerordentlich großzügiger und ehrbarer Mensch, er rühmte sich seiner Gastfreundschaft sowie seiner braven Ehefrau, die die häufigen Gäste in ihrer Wohnung auf der Zielona-Straße in Krakau schweigend bewirtete. Nicht selten diente diese Wohnung ukrainischen »Künstlern und Literaten«, die ohne eine einzige Krone in der Tasche nach Krakau kamen, als Unterschlupf. Hier trieben sich ständig verdächtige ukrainischsprachige Elemente herum, in der Hoffnung auf ein Dach über dem Kopf oder zumindest auf drei Mahlzeiten täglich. Professor Lepkyjs brave Ehefrau hielt sie alle für Schurken. »Ein Stück Brot kann ich keinem Bedürftigen verwehren«, sagte Lepkyj zu ihr und stürzte sich stolz erhobenen Hauptes immer tiefer in Schulden. Diese naive Großzügigkeit und der romantische Glaube an die selbstlose Arbeit zugunsten der ukrainischen Idee machten sich für ihn aber stets vielfach bezahlt. Kaum jemand hörte auf Lepkyj, aber alle scharten sich um ihn. Das gab ihm ein Gefühl von Selbstverwirklichung. Von seinem umfangreichen Werk (Lepkyj schrieb historische Romane, dichtete, stellte Kalender zusammen, malte, war Herausgeber und Lektor) sollte die undankbare Nachwelt nur ein einziges, trauriges Gedicht im Gedächtnis behalten, über Kraniche, die in fremde Gegenden flogen und wussten, dass sie auf dem Rückweg sterben würden. Der Professor starb tatsächlich in der Fremde, jedoch eines natürlichen Todes und an Altersschwäche, was bei einem Menschen seiner Generation und seines Lebensweges ein großes Glück war.
Die materielle Situation der Familie verbesserte sich schlagartig, als Lepkyj eingeladen wurde, an der Jagiellonen-Universität ukrainische Sprache zu unterrichten. Die Einrichtung des Lehrstuhls stellte in Slawistikerkreisen eine antiwissenschaftliche Sensation dar, denn die Mehrheit hielt das Ukrainische für einen Dialekt des Russischen oder des Polnischen oder beider Sprachen zusammen. Das Studium eines Dialekts auf Universitätsniveau erschien völlig absurd. Im Russischen Reich bestand ein Druckverbot für Schriften in der »kleinrussischen Mundart«, das Verstecken eines der seltenen ukrainischen Wörterbücher kam revolutionärer Tätigkeit gleich und wurde mit Gefängnis oder Verbannung bestraft. Regelmäßige Durchsuchungen lehrten die Hüter von Wörterbüchern, diese beim allerkleinsten Verdacht auf eine neuerliche Razzia weiterzugeben. Für den Gebrauch des Ukrainischen im Alltag konnten aristokratische Familien ihre Privilegien einbüßen. Und nur wenige Familien verwendeten trotz der Gefahr nach wie vor den »Bauerndialekt«.