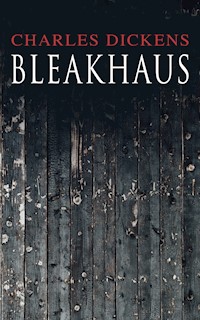
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: e-artnow
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dieses eBook: "Bleakhaus" ist mit einem detaillierten und dynamischen Inhaltsverzeichnis versehen und wurde sorgfältig korrekturgelesen. Esther Summerson wächst als Kind bei Miss Barbery auf, ohne zu wissen, dass diese ihre Tante ist oder wer ihre Eltern sind; sie erfährt nur, dass ihre Mutter große Schande über sich gebracht habe. Nach dem Tod ihrer Tante wird Esther von John Jarndyce aufgenommen, einem reichen und wohltätigen Mitglied der Oberschicht, der einer der Beteiligten an dem erwähnten Erbschaftsstreit Jarndyce gegen Jarndyce ist. Sie arbeitet dort als Haushälterin von Bleak House sowie als Gesellschafterin von Ada Clare und deren entfernten Cousin Richard Carstone, zwei weiteren Beteiligten im Rechtsstreit um das Erbe im Jarndyce-Fall, die John Jarndyce als Vormund in Bleak House aufnimmt. Charles Dickens (1812-1870) war ein englischer Schriftsteller.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1696
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bleakhaus
Inhaltsverzeichnis
Vorrede
Vor einigen Monaten war ein Kanzleigerichtsbeisitzer so liebenswürdig, bei einer öffentlichen Feier und in einer Gesellschaft von hundertfünfzig Damen und Herren, von denen man nicht gut annehmen kann, daß sie verrückt sind, die Behauptung aufzustellen, das Kanzleigericht sei eine fast fehlerlose Institution, wenn es auch das Lieblingsthema gewisser, in Vorurteilen befangener Leute bilde – bei welcher Äußerung besagter Richter mir einen Seitenblick zuzuwerfen geruhte –, sie herabzusetzen. Es habe vielleicht, gab er zu, kleine unbedeutende Mängel hinsichtlich Schnelligkeit, was Erledigungen beträfe, aber alles andere sei übertrieben und lediglich eine Folge der »Engherzigkeit und Knauserei des Publikums«. In Wirklichkeit hat nun aber das gerügte Publikum noch bis vor kurzem die allerentschiedenste Neigung an den Tag gelegt, die Zahl der Kanzleirichter zu vermehren, die anfänglich, wenn ich nicht irre, Richard II. – es kann geradesogut ein anderer gewesen sein – festgesetzt hat. Dieser Witz schien mir zu gut, um ihn in dieses Buch aufzunehmen, sonst hätte ich ihn Konversations-Kenge oder Mr. Vholes in den Mund gelegt. Ich hätte ihn recht passend mit einem Zitat aus Shakespeares Sonetten verbinden können:
– – – – – Ich werde dem Stoffe gleich, in dem ich arbeite, wie eines Färbers Hand, Beklag mich denn, und wünsche anders mich!
Da es immerhin von Belang ist, wenn das »engherzige und knauserige« Publikum erfährt, wie in dieser Hinsicht die Dinge standen und noch stehen, so stelle ich hier fest, daß alles, was in diesem Buch vom Kanzleigericht handelt, seinem Wesen nach wahr und keineswegs übertrieben ist. Der »Fall Grindley« unterscheidet sich in keinem wesentlichen Punkte von einem tatsächlichen Begebnis, das ein Unbeteiligter, der als Advokat das ganze unerhörte Unrecht von Anfang bis zu Ende kennenlernte, veröffentlicht hat.
Gegenwärtig liegt dem Gerichtshof ein Prozeß vor, der vor fast zwanzig Jahren angefangen hat, in dem einmal dreißig bis vierzig Advokaten bei einer Tagfahrt erschienen und dessen Kosten sich jetzt auf siebzigtausend Pfund belaufen. Er ist ein »Proformaprozeß« und, wie man mir versichert, seinem Schlusse nicht näher als zu Anfang. Noch ein anderer wohlbekannter Kanzleigerichtsprozeß, der vor Beginn des vorigen Jahrhunderts anfing und in dem die Kosten mehr als doppelt soviel verschlungen haben, ist heute noch in Schwebe. Wenn ich noch mehr Belege für »Jarndyce kontra Jarndyce« und »die Knauserei des Publikums« brauchte, so könnte ich Bände damit füllen.
Noch über einen andern Punkt möchte ich mir hier eine Bemerkung gestatten. Man hat seit dem Tode Mr. Krooks die Möglichkeit der sogenannten Selbstverbrennung geleugnet, und mein guter Freund Mr. Lewes (der irrtümlicherweise, wie er bald darauf entdeckte, in dem Glauben lebte, daß alle Autoritäten von Ruf die Sache hätten fallen lassen) schrieb seinerzeit einige geistreiche Briefe an mich, in denen er beweisen wollte, daß Selbstverbrennung ein Unding sei. Ich glaube nicht erst bemerken zu müssen, daß ich meine Leser nicht böswilliger-oder nachlässigerweise irreführe und, ehe ich jenen Todesfall beschrieb, Sorge trug, diesen Dingen nachzugehen. Man kennt ungefähr dreißig Fälle, deren berühmtesten, den der Gräfin Cornelia de Baudi, der Schriftsteller und Stiftsgeistliche in Verona, Signor Cesenate Guiseppe Bianchini, genau untersucht und beschrieben hat. Er veröffentlichte darüber im Jahr 1731 in Verona einen Bericht, den er später in Rom nochmals drucken ließ. Alle bei diesem Fall beobachteten Erscheinungen, die sich vernünftigerweise nicht bezweifeln lassen, sind dieselben wie die bei Mr. Krook geschilderten. Der nächst bekannteste Fall ereignete sich in Reims sechs Jahre früher und wurde von Le Cat, einem der berühmtesten Chirurgen Frankreichs, beschrieben. Es handelte sich dabei um eine Frau, deren Mann wegen angeblichen Mordes angeklagt und verurteilt wurde. Die nächsthöhere Instanz sprach ihn jedoch frei, da aus den Zeugenaussagen hervorging, daß die Frau an Selbstverbrennung gestorben war.
Ich halte es nicht für notwendig, diesen wohlbekannten Tatsachen und den Berichten der betreffenden Autoritäten noch die in verschiedenen Werken niedergelegten Ansichten und Berichte ausgezeichneter französischer, englischer und schottischer Gelehrter aus neuerer Zeit hinzuzufügen, und begnüge mich mit der Bemerkung, daß ich an der Richtigkeit der Tatsachen nicht eher zweifeln werde, als bis nicht auch hinsichtlich aller der Beweise, die Vorfälle im menschlichen Leben als glaubwürdig registrieren, eine umfassende Selbstverbrennung stattgefunden hat.
In Bleakhaus habe ich absichtlich die romantische Seite des alltäglichen Lebens hervorgehoben. Ich glaube, ich habe noch niemals so viele Leser wie bei diesem Buche gehabt. Auf Wiedersehen.
London, im August 1853
1. Kapitel
Im Kanzleigericht
London. Der Michaelitermin ist vorüber, und der Lordkanzler sitzt in der Lincoln’s-Inn-Hall. Abscheuliches Novemberwetter. Soviel Schmutz in den Straßen, als ob die Wasser des Himmels sich eben erst von der neugeschaffenen Erde verlaufen hätten und es gar nichts Wunderbares wäre, wenn man einem vierzig Fuß langen Megalosaurus begegnete, wie er gerade – ein Elefant unter den Eidechsen – Holborn-Hill hinaufwatschelt.
Der Rauch senkt sich von den Schornsteinen nieder, ein dichter schwarzer Regen von Rußbatzen, so groß wie ausgewachsene Schneeflocken, die in schwarzen Kleidern den Tod der Sonne betrauern wollen. Hunde, unkenntlich vor Schmutz, Pferde, nicht viel besser dran, bis an die Scheuklappen mit Kot bespritzt. Fußgänger drängen sich, von der allgemeinen Seuche übler Laune angesteckt, mit Regenschirmen aneinander vorbei und glitschen an den Straßenecken aus, wo bereits Zehntausende vor ihnen den trüben Tag über ausgerutscht sind und neue Schichten zu den Schmutzkrusten hinzugefügt haben, die an diesen Stellen zäh am Pflaster kleben und sich anhäufen mit Zinseszinsen.
Nebel überall, Nebel stromauf, wo der Fluß zwischen Buschwerk und Wiesen dahinfließt; Nebel stromab, wo er sich schmutzig zwischen Reihen von Schiffen und dem Uferunrat der großen, unsauberen Stadt durchwälzt. Nebel auf den Sümpfen von Essex und Nebel auf den Höhen von Kent. Nebel kriecht in die Kabusen der Kohlenschiffe; Nebel liegt draußen auf den Rahen und klimmt durch das Tauwerk; Nebel senkt sich auf die Deckverkleidung der Barken und Boote. Nebel dringt in die Augen und Kehlen der alten Greenwichinvaliden, die am Kamin in ihren Kämmerchen husten und keuchen, dringt in das Rohr und den Kopf der Shagpfeife des grimmigen Schiffseigners unten in seiner engen Kajüte und beißt grausam in Zehen und Finger des fröstelnden kleinen Schiffsjungen auf Deck. Passanten schauen von den Brücken herab über die Geländer in einen Nebelhimmel und sind rings von Nebel umgeben, als ob sie in einem Luftballon mitten in grauen Wolken hingen.
Gaslampen stieren in den Straßen trübäugig durch den Nebel wie draußen die Sonne wohl auf den durchweichten Feldern. Die meisten Läden haben zwei Stunden vor der Zeit angezündet, und das Gaslicht scheint es zu wissen, denn es sieht schmal und mürrisch aus.
Am rauhesten ist der Nachmittag; da ist der Nebel am dicksten, die Straße am schmutzigsten in der Nähe jenes dickschädligen steinernen Hindernisses, das so recht eine passende Zier für die Schwelle der dickschädligen alten Korporation – des »Tempels« – ist. Und dicht beim »Tempel« in der Lincoln’s-Inn-Hall, mitten im Herzen des Nebels sitzt der Lord-Oberkanzler in seinem hohen Kanzleigerichtshof.
Nie kann der Nebel zu dick, nie der Schmutz und Kot zu tief sein, um dem versumpften und verschlammten Zustand zu entsprechen, in dem sich dieser hohe Kanzleigerichtshof, dieser schlimmste aller ergrauten Sünder, an einem solchen Tage dem Himmel und der Erde präsentiert.
An einem solchen Nachmittag sitzt der Lord-Oberkanzler da mit einer Nebelglorie um das Haupt, eingehüllt und umgeben von Scharlachtuch und Vorhängen und vor sich einen dicken Advokaten mit starkem Backenbart, einer dünnen Stimme und endlosen Prozeßakten, der seine Blicke auf die Laterne an der Decke richtet, wo er nichts als Nebel sieht.
An einem solchen Nachmittag sitzen ein paar Dutzend Mitglieder des Barreaus, des hohen Kanzleigerichts, hier, beschäftigt mit einem der zehntausend Stadien eines endlosen Prozesses. Sie legen einander Schlingen mit schlüpfrigen Präzedenzien; knietief in technischen Ausdrücken watend rennen sie ihre mit Ziegen-und Pferdehaar geschützten Köpfe gegen Wälle von Worten und führen ein Schauspiel von Gerechtigkeit auf; Komödianten mit ernsthaften Gesichtern.
An einem solchen Nachmittag müssen die verschiedenen Solizitoren in einer Rechtssache, die zwei oder drei von ihren dabei reich gewordenen Vätern geerbt haben, in einer Reihe sitzen in einem mit Strohmatten ausgelegten Brunnen, auf dessen Grund man vergebens nach der Wahrheit suchen würde – zwischen dem roten Tisch des Registrators und den seidenen Talaren –, Repliken, Dupliken, Schlußworte, Dekrete, Eingaben, Informationen und Berge geldverschlingenden Unsinns vor sich aufgehäuft. Kein Wunder, daß der Saal trübe ist, nur hie und da von schmelzenden Kerzen spärlich erhellt, wenn Nebel schwer darin hängt, die bunten Glasfenster die Farbe verloren haben und kein Tageslicht hereinlassen; kein Wunder, wenn die Uneingeweihten auf der Straße, die durch die Glasscheiben in den Türen hereinblicken, sich von dem Eintritt abschrecken lassen durch den lichtscheuen, eulenhaften Anblick und das schläfrige Gesumm, das matt zur Decke hinauftönt von dem gepolsterten Baldachin, von wo der Lord-Oberkanzler zu der Laterne aufblickt, in der kein Licht ist, und wo die Perücken der beisitzenden Richter in Nebeldunst verschwimmen.
Das ist das Kanzleigericht, das Häuser hat verfallen machen und Äcker verwüstet in jeder Grafschaft, seine lebensmüden Wahnsinnigen hat in jedem Irrenhaus und seine Toten auf jedem Kirchhof, das seine Prozessierenden aussaugt, bis sie mit niedergetretenen Absätzen und abgeschabtem Rock bei allen, deren Bekanntschaft sie machen, reihum borgen und betteln gehen; das Kanzleigericht, das dem Reichen Mittel an die Hand gibt, das Recht müde zu hetzen. Das Geld, Geduld, Mut, Hoffnung so erschöpft, Köpfe verwirrt und Herzen bricht, daß kein Advokat, so er ehrenwert ist, anstehen wird zu warnen: »Lieber jedes Unrecht leiden als hierherkommen.«
Wer ist zufällig an diesem trüben Nachmittag in des Lordkanzlers Gericht außer dem Lordkanzler selbst, dem Advokaten in der zu verhandelnden Sache, zwei oder drei Rechtsanwälten, die niemals etwas zu tun haben, und dem eben erwähnten Brunnen voll Solizitoren? Der Registrator, im Range unter dem Richter, in Perücke und Talar, und die Pedelle und Säckelmeister in ihrer Amtstracht. Sie gähnen alle, denn kein Tropfen Witz ist von dem Rechtsfall Jarndyce kontra Jarndyce, der schon seit vielen, vielen Jahren trocken ausgequetscht ist, zu erwarten. Die Stenographen, die Gerichtsschreiber und Zeitungsberichterstatter entfliehen regelmäßig mit dem übrigen Personal, wenn »Jarndyce kontra Jarndyce« an die Reihe kommt. Ihre Plätze sind leer.
Auf einer Bank an der Seitenwand steht, um besser in das mit Vorhängen umschlossene Heiligtum blicken zu können, eine kleine verrückte alte Frau in einem zerdrückten Hut, die jeder Verhandlung von Anfang bis Ende beiwohnt und beständig irgendein unbegreifliches Urteil zu ihren Gunsten erwartet.
Einige sagen, sie sei wirklich Partei in einer Rechtssache oder sei es gewesen; aber niemand weiß es genau, weil sich niemand darum kümmert. Sie trägt in ihrem Strickbeutel ein kleines Paket mit sich herum, das sie ihre Dokumente nennt und das größtenteils aus Papierfidibussen und getrocknetem Lavendel besteht.
Ein blasser Gefangener unter Obhut eines Gerichtsdieners erscheint zum halbdutzendsten Male vor den Schranken, um sich persönlich gegen die Anschuldigung der Unterschlagung zu verteidigen, was ihm schwerlich jemals gelingen wird, da er als letztüberlebender Testamentsvollstrecker mit Rechnungen in Verwicklung geraten ist, von denen er wahrscheinlich nie etwas gewußt oder verstanden hat.
Unterdessen sind seine Aussichten im Leben vernichtet worden.
Ein anderer zugrunde gerichteter Prozessierender trifft periodisch von Shropshire ein und macht am Ende jeder Verhandlung krampfhafte Anstrengungen, den Kanzler anzureden; man kann ihn in keiner Weise überzeugen, daß der Kanzler, obgleich er ihm seit einem Vierteljahrhundert das Leben schwer gemacht hat, gerichtlich nichts von seiner Existenz weiß. Er hat sich einen guten Platz ausgesucht und wendet kein Auge von dem Richter, bereit, jeden Augenblick, wenn sich die Gelegenheit ergeben sollte, in klagendem Baß: »Mylord!« zurufen. Ein paar Advokatenschreiber und andere, die den Mann von Ansehen kennen, bleiben da in der Hoffnung, er werde vielleicht Anlaß zu einem Spaß geben und die Trübseligkeit des abscheulichen Wetters ein wenig unterbrechen.
»Jarndyce kontra Jarndyce« geht seinen schleppenden Gang. Dieses Ungeheuer von Prozeß ist im Verlauf der Zeit so verwickelt geworden, daß sich kein Mensch auf Erden mehr darin zurechtfinden kann. Die Parteien verstehen ihn am wenigsten, und nicht einmal zwei Kanzleigerichtsadvokaten können fünf Minuten davon sprechen, ohne nicht schon über die Vorfragen gänzlich uneinig zu werden. Zahllose Kinder sind in den Prozeß hineingeboren worden, zahllose junge Paare haben hineingeheiratet, zahllose alte Leute sind herausgestorben. Dutzende von Personen sind zu ihrem Schrecken auf einmal Partei in Sachen »Jarndyce kontra Jarndyce« geworden, ohne zu wissen, wie und warum; ganze Familien haben sagenhafte Stammesfeindschaft mit dem Prozeß geerbt.
Der kleine Kläger oder Beklagte, dem man ein neues Schaukelpferd versprochen, wenn »Jarndyce kontra Jarndyce« geschlichtet sein würde, ist darüber groß geworden, hat sich ein lebendes Pferd gekauft und ist in die andere Welt getrabt. Jugendfrische Mündel sind zu Müttern und Großmüttern verwelkt; eine lange Prozession von Kanzlern ist gekommen und gegangen; das Verzeichnis der Parteien in dem Prozeß ist zu einem langen Leichenzettel geworden; vielleicht leben nicht mehr drei Jarndyce auf der Erde, seitdem sich der alte Tom Jarndyce in einem Kaffeehaus in der Kanzleigerichtsgasse aus Verzweiflung eine Kugel durch den Kopf geschossen – aber »Jarndyce kontra Jarndyce« schleppt sich immer noch in unabsehbarer Länge vor dem Gerichtshof hin, und auf ein Ende ist nicht zu hoffen.
»Jarndyce kontra Jarndyce« ist zu einem Witzwort geworden. Das ist das einzig Gute, was jemals dabei herausgekommen ist. Der Fall hat vielen den Tod gebracht, aber den Juristen ist er ein Jux. Jeder Beisitzer des Kanzleigerichts hat darüber zu berichten gehabt. Jeder Kanzler hat, als er noch Anwalt war, darin plädiert. Blaunasige alte Advokaten mit plumpen dicksohligen Schuhen haben in auserlesenen Portweinsitzungen nach dem Essen in der Hall ihre Witze darüber gerissen. Anfänger auf der Juristenlaufbahn haben ihren Scharfsinn daran geübt. Als Mr. Blowers, der ausgezeichnete Advokat, einmal sagte: »Das oder jenes kann nur geschehen, wenn es Kartoffeln vom Himmel regnet«, hatte der letzte Lordkanzler verbessernd bemerkt: »Oder wenn wir mit ‘Jarndyce kontra Jarndyce’ fertig werden, Mr. Blowers!« – ein Scherz, über den besonders die Pedelle und Gerichtsdiener lachten.
Wie viele mag nicht schon die ansteckende Berührung des Falles Jarndyce kontra Jarndyce korrumpiert haben! Von dem Beisitzer, auf dessen Aktenschrank ganze Stöße von Erlassen in Sachen Jarndyce kontra Jarndyce in formlosen Haufen verstaubten, bis hinab zu dem Abschreiber in dem Bureau der »Sechsschreiber«, der Zehntausende von Kanzleifolioseiten mit dieser ewigen Überschrift kopiert hat, ist keines Menschen Herz dadurch besser geworden.
Aus Überlistung, Ausflüchten, Verschleppung, Ausbeutung und Verwirrung aller Art entspringen Einflüsse, die nie zu irgend etwas Gutem führen können.
Selbst die Laufburschen der Solizitoren, die den unglücklichen Prozessanten seit unvordenklichen Zeiten den Trost vorspiegelten, daß Mr. Chizzle, Mizzle oder sonst wer vormittags dringend beschäftigt wären, haben vielleicht durch den Fall Jarndyce kontra Jarndyce einen krummen Weg mehr gehen gelernt.
Der Sequestrator in der Sache hat ein schönes Stück Geld dabei verdient, aber seiner eignen Mutter mißtrauen und das ganze Menschengeschlecht verachten gelernt. Chizzle, Mizzle und wer sonst noch haben sich allmählich angewöhnt, ihr Gewissen mit dem unbestimmten Vorsatz einzulullen, diese oder jene Kleinigkeit zu regeln oder dies oder das für Drizzle, der unverantwortlich vernachlässigt worden, nachzuholen, bis die Sache »Jarndyce kontra Jarndyce« erledigt sei. Hinausschieben und Vertuschen in ihren mannigfaltig wechselnden Gestalten hat der unglückselige Rechtsstreit in zahllosen Fällen auf dem Gewissen, und selbst diejenigen, die unberührt von diesem Übel seine Geschichte verfolgt haben, sind unmerklich in Versuchung geraten, nie einzugreifen, das Schlechte seinen schlechten Weg gehen zu lassen und zu der Ansicht zu neigen, alles müsse in der Welt schief gehen, weil sie wahrscheinlich schlampigerweise dazu bestimmt sei.
So tagt inmitten dieser Verrottung und im Herzen des Nebels der Lord-Oberkanzler in seinem hohen Kanzleigerichtshof.
»Mr. Tangle«, sagt der Lord-Oberkanzler. – Der Redeschwall dieses gelehrten Herrn hat ihn ein wenig unruhig gemacht.
»Mlord!« sagt Mr. Tangle.
Er weiß mehr von »Jarndyce kontra Jarndyce« als irgend jemand sonst. Er ist deshalb berühmt, und es heißt, er habe nichts anderes gelesen, seitdem er aus der Schule ist.
»Sind Sie mit Ihrem Argument bald fertig?«
»Mlord, nein, – noch massenhaft Punkte –, halte es jedoch für meine Pflicht, mich Ew. Lordschaft Spruch zu unterwerfen«, flüstert Mr. Tangle ehrerbietig.
»Mehrere der Herren Rechtsanwälte wollen heute noch plädieren, glaube ich?« sagt der Kanzler mit einem kaum merklichen Lächeln.
Achtzehn von Mr. Tangles gelehrten Freunden, jeder mit einem kleinen Aktenauszug von achtzehnhundert Bogen bewaffnet, tauchen wie achtzehn Hämmer in einem Pianoforte empor, machen achtzehn Verbeugungen und tauchen wieder in die Dunkelheit auf ihren achtzehn Plätzen unter.
»Wir wollen die Sache Mittwoch über vierzehn Tage weiter hören«, sagt der Kanzler.
Es handelt sich nämlich heute nur um einen Kostenpunkt. Um eine bloße Knospe an dem zu einem ganzen Wald gewordenen Baum des ursprünglichen Prozesses.
Der Kanzler erhebt sich; das Barreau erhebt sich; der Gefangene wird eilig an die Schranken gebracht; der Mann aus Shropshire ruft: »Mylord!« Pedelle und Gerichtsdiener rufen entrüstet: »Still!« und messen den Mann aus Shropshire mit erzürnten Blicken.
»Was das junge Mädchen –« fährt der Kanzler, immer noch in Sachen Jarndyce kontra Jarndyce, fort, »betrifft –«
»Bitte Ew. Lordschaft um Verzeihung – den Knaben«, unterbricht Mr. Tangle voreilig.
»Was das Mädchen«, beginnt der Kanzler mit größerm Nachdruck von neuem, »und den Knaben – die beiden jungen Leute – betrifft –«
Mr. Tangle ist vernichtet.
»– die ich heute vorgeladen habe und die sich jetzt in meinem Privatzimmer befinden, so werde ich selbst mit ihnen sprechen und mich überzeugen, ob es angemessen erscheint, ihnen die Erlaubnis, bei ihrem Onkel zu wohnen, zu erteilen.«
Mr. Tangle erhebt sich wieder.
»Bitte Ew. Lordschaft – Verzeihung – ist tot.«
»Mit ihrem –«, der Kanzler buchstabiert mit seinem zusammengelegten Augenglas in den Papieren auf seinem Pult – »Großvater.«
»Bitte Ew. Lordschaft – Verzeihung – Opfer einer übereilten Tat. Kopf geschossen.«
Plötzlich erhebt sich ein ganz kleiner Advokat mit einer furchtbaren Baßstimme in den rückwärtigen Regionen des Nebels mit großer Wichtigkeit und sagt:
»Will Ew. Lordschaft mir gestatten? Ich vertrete den Mann. Er ist ein Vetter entfernten Grades. Ich bin in diesem Augenblick nicht vorbereitet, dem Gerichtshof Auskunft zu geben, in welchem Verwandtschaftsgrad er steht, aber er ist ein Vetter.«
Der sehr kleine Advokat läßt diese mit Grabesstimme gesprochene Anrede an dem Gebälk der Decke verklingen, taucht unter im Nebel, und weg ist er. Alle suchen ihn mit den Augen. Niemand kann ihn mehr entdecken.
»Ich will mit den beiden jungen Leuten sprechen«, sagt der Lordkanzler abermals, »und mich informieren, wie sich das mit dem Wohnen bei ihrem Vetter verhält. Ich werde die Sache morgen früh bei Eröffnung der Sitzung wieder zur Sprache bringen.«
Der Kanzler will sich gegen das Barreau verneigen, da wird der Gefangene vorgeführt.
Die Sache mit dem Angeklagten kann natürlich keine andere Folge haben, als daß der Mann wieder ins Gefängnis zurückgeschickt wird, was auch sehr rasch geschieht. Der Prozessierende aus Shropshire wagt noch ein bittendes: »Mylord!« aber der Kanzler hat die Gefahr erspäht und ist geschickt verschwunden. Alle übrigen Anwesenden verschwinden ebenfalls rasch. Eine Batterie von blauen Aktenbeuteln wird mit Papier geladen und von Schreibern fortgeschleppt. Die verrückte Alte trippelt mit ihren Dokumenten hinaus, und das Gerichtslokal wird zugeschlossen.
Wenn alle Ungerechtigkeit, die schon hier begangen wurde, und alles dadurch verursachte Elend mit hineingeschlossen und zu Asche verbrannt werden können, um so besser wäre es für alle Parteien, nicht nur für die im Falle Jarndyce kontra Jarndyce.
2. Kapitel
In der vornehmen Welt
Nur ein flüchtiger Blick in die feine Welt an diesem schmutzigen Nachmittag.
Sie ist dem Kanzleigerichtshof nicht so unähnlich, wie es vielleicht scheinen mag. Die vornehme Welt und das Kanzleigericht sind beide Kinder des Hergebrachten und eines heilig gewordenen Brauchs, verschlafene Rip van Winkles, die seltsame Spiele während langer Gewitterzeit gespielt haben, schlummernde Dornröschen, die der Ritter eines Tages erwecken wird, wenn alle stillstehenden Bratspieße in der Küche sich mit wunderbarer Emsigkeit zu drehen anfangen werden.
Die vornehme Welt ist keine große Welt. Selbst im Verhältnis zu unserer, die auch ihre Grenzen hat, wie selbst Seine Lordschaft finden würden, wenn sie rund um dieselbe herumzureisen und an dem Rande, wo sie zu Ende geht, stehen zu bleiben geruhten, ist sie nur ein kleines Stückchen. Es ist viel Gutes darin; es leben brave und ehrliche Leute in ihr; sie füllt ihren bestimmten Platz aus, aber das Schlimme an ihr ist, daß sie zu sehr in feine Baumwolle eingewickelt ist und die brausenden Wogen der größeren Welt nicht hören kann und nicht sehen, wie sie um die Sonne kreist. Es ist eine verdorrende Welt, und ihr Wachstum ist zuweilen behindert durch den Mangel an Luft.
Lady Dedlock ist auf einige Tage in ihre Stadtwohnung zurückgekehrt, ehe sie nach Paris reist, wo sie sich einige Wochen aufhalten wird. Wohin sie sich später zu begeben gedenkt, ist noch ungewiß. Die »fashionablen Nachrichten« verkünden es zum Troste der Pariser, und sie wissen alles, was in der vornehmen Welt geschieht. Etwas anderes zu wissen wäre unchic.
Mylady Dedlock kommt von ihrem Landsitz in Lincolnshire. Die Wasser sind über die Ufer getreten in Lincolnshire. Ein Brückenbogen im Park ist unterwaschen und eingesunken. Die nahe Niederung, eine halbe englische Meile breit, ist ein Sumpf geworden. Mit melancholischen Bäumen als Inseln darin und einer Oberfläche, die den ganzen Tag lang bei dem fallenden Regen wie punktiert aussieht.
Lady Dedlocks Landsitz ist sehr ungemütlich geworden. Das Wetter ist seit vielen Tagen und Nächten so naß gewesen, daß die Bäume bis unter die Rinde durchweicht sind und die feuchten Späne, wenn sie der Holzfäller abhaut, sich geräuschlos vom Stamme trennen und ohne Laut zu Boden fallen. Das Wild trieft und läßt Pfützen zurück, wohin es tritt. Der Schuß aus der Büchse verliert seinen scharfen Knall in der feuchten Luft, und der Rauch schwebt langsam in einer kleinen Wolke der grünen, buschgekrönten Höhe zu, die einen Hintergrund für den fallenden Regen bildet. Die Aussicht aus den Fenstern Lady Dedlocks ist eine Landschaft, abwechselnd in Bleizeichnung und in Tusche. Die Vasen auf der Terrassenmauer im Vordergrund fangen den Regen auf den ganzen Tag, und die schweren Tropfen fallen trip, trip, trip auf die breiten Sandsteinplatten des Ganges, der schon seit alter Zeit der »Geisterweg« heißt. Sonntags riecht die kleine Kirche im Park modrig; die Eichenkanzel bricht in kalten Schweiß aus, und ein Geruch und Geschmack liegt in der Luft, der an die Gräber der alten Dedlocks erinnert.
Lady Dedlock, die kinderlos ist, hat im frühen Zwielicht aus ihrem Boudoir einen Blick auf das Häuschen des Parkwächters geworfen; der Schein eines Feuers schimmerte durch die Jalousien, Rauch stieg aus dem Schornstein, und ein Kind, verfolgt von einer Frau, lief hinaus in den Regen, einem in eine Kapuze gehüllten Mann beim Parktor entgegen. Der Anblick hat die Gnädige in üble Laune versetzt. Sie sagt, sie habe sich tödlich gelangweilt.
Deshalb hat Lady Dedlock von ihrem Landsitz in Lincolnshire Abschied genommen und überläßt ihn dem Regen, den Krähen, den Kaninchen, dem Rotwild, den Rebhühnern und Fasanen. Die Bilder der Dedlocks entschwundener Zeiten sind aus purer Niedergeschlagenheit in den feuchten Wänden verschwunden, als der Kastellan durch die alten Gemächer ging und die Läden zumachte. Wann sie wieder erscheinen werden, kann der Berichterstatter der fashionabeln Nachrichten, der gleich dem bösen Feind die Vergangenheit wohl weiß und die Gegenwart, aber die Zukunft nicht, jetzt noch nicht sagen.
Sir Leicester Dedlock ist nur Baronet, aber es gibt keinen mächtigeren Baronet als ihn. Seine Familie ist so alt wie die Hügel von Lincolnshire, nur unendlich vornehmer. Er ist der Überzeugung, daß die Welt ganz gut ohne Hügel und Berge bestehen könnte, ohne Dedlocks jedoch zugrunde gehen müßte. Er gibt im allgemeinen zu, daß die Natur eine gute Einrichtung ist – ein wenig ruppig zwar, wenn sie nicht von einem Parkzaun umschlossen wird –, aber eine Einrichtung, die in ihrer Gestaltung ganz von den großen Familien der Grafschaft abhängt. Er ist ein Gentleman von strengster Gewissenhaftigkeit, verachtet alle Kleinlichkeit und Niedrigkeit und ist bereit, bei der geringsten Veranlassung eher jeden beliebigen Tod zu sterben als den kleinsten Flecken auf seinem Ruf zu dulden. Er ist ein ehrenwerter, halsstarriger, wahrheitsliebender, stolzer Mann voll krasser Vorurteile, und vollkommen unvernünftig.
Sir Leicester ist volle zwanzig Jahre älter als Mylady. Fünfundsechzig erlebt er nicht noch einmal, vielleicht auch nicht sechs-oder siebenundsechzig. Er hat von Zeit zu Zeit einen Gichtanfall, und sein Gang ist ein wenig steif. Er ist eine vornehme Erscheinung mit seinem grauen Haar und Backenbart, dem feinen Spitzenhemd, der tadellos weißen Weste und dem hochgeschlossenen blauen Frack mit den glänzenden Knöpfen. Er ist sehr förmlich, zu allen Zeiten gegen Mylady ausnehmend höflich und zollt ihren persönlichen Reizen die höchste Anerkennung. Seine Galanterie gegen die Gnädige ist sich seit dem Brautstande unverändert gleichgeblieben und bildet die einzige kleine Stelle Romantik und Poesie in ihm.
Er hat sie aus Liebe geheiratet. Man flüstert sich sogar zu, daß sie nicht einmal von »Familie« sei, aber Sir Leicester hatte für beide »Familie« genug, und sie besaß Schönheit, Stolz, Ehrgeiz, Arroganz und Verstand genug, um es mit einer ganzen Legion vornehmer Damen aufzunehmen. Reichtum und Rang mit diesen Gaben vereint setzten sie bald an die Spitze, und seit Jahren hat Lady Dedlock den Mittelpunkt der vornehmen Welt gebildet und in der Mode die Führung an sich gerissen.
Daß Alexander der Große Tränen vergoß, als er keine Welten mehr zu erobern hatte, weiß jedermann oder sollte es wenigstens wissen, denn der Umstand wird häufig genug erwähnt. Als Lady Dedlock ihre Welt eroberte, verriet ihre Temperatur mehr den Gefrier-als den Schmelzpunkt. Eine erschöpfte Gelassenheit, eine müde Ruhe, ein gelangweilter Gleichmut, die sich weder durch Interesse noch durch Befriedigung stören ließen, waren ihre Siegestrophäen. Sie ist durch und durch vornehm. Wenn sie morgen in den Himmel versetzt werden sollte, würde sie fraglos ohne die mindeste Verzückung emporschweben.
Sie ist immer noch schön, und wenn auch nicht mehr in der Blüte, so doch nicht in ihrem Herbst. Sie hat ein feines Gesicht; der Naturanlage nach sind ihre Züge eher sehr hübsch als schön zu nennen, aber der angelernte Ausdruck der vornehmen Weltdame verleiht ihnen etwas Klassisches. Ihre Figur ist elegant und macht den Eindruck von Schlankheit. Nicht, daß sie wirklich so ist, aber alle ihre Vorzüge sind gut herausgearbeitet, wie Bob Stables hochwohlgeboren wiederholt auf Eid versichert hat. Derselbe Gewährsmann bemerkt, daß sie tadellos aufgezäumt sei, und sagt lobend von ihrem Haar, sie sei die bestgestriegelte Frau im ganzen Gestüt.
Mit allen ihren Reizen ist Lady Dedlock von ihrem Landsitz in Lincolnshire, Schritt für Schritt von den Fashionabeln der Modezeitung verfolgt, eingetroffen, um einige Tage in ihrer Stadtwohnung zu verweilen, bevor sie nach Paris reist, wo sie einige Wochen zu bleiben gedenkt.
In ihrer Stadtwohnung stellt sich an diesem trüben Nachmittag ein altmodischer alter Gentleman ein, Attorney und Solizitor beim hohen Kanzleigericht, der die Ehre hat, Rechtsanwalt der Dedlocks zu sein, und viele eiserne Kästen mit diesem Namen darauf in seiner Kanzlei aufzuweisen hat. Durch die Vorhalle die Treppen hinauf, die Korridore entlang und durch die Zimmer, die in der Saison sehr glänzen und außer der Zeit sehr unwirtlich sind – ein Feenland für den Besucher und eine Wüste für den Bewohner –, führt den alten Herrn ein Merkur mit gepudertem Kopf zu der Gnädigen.
Der alte Herr sieht ein wenig verrostet aus, steht aber in dem Rufe, durch Heiratsverträge und Testamente für den Adel viel Geld erworben zu haben und sehr reich zu sein. Ein undurchdringlicher Nebel von Familiengeheimnissen, als deren stummen Bewahrer man ihn kennt, umgibt ihn. Es gibt adlige Mausoleen, die seit Jahrhunderten in abgelegenen Parkalleen unter uralten Bäumen und wucherndem Farnkraut stehen und vielleicht weniger Familiengeheimnisse bewahren, als in Mr. Tulkinghorns unter Menschen wandelnder Brust verborgen sind.
Er gehört der alten Schule an, das heißt, der Schule, die niemals jung gewesen ist, und trägt kurze Hosen, die an den Knieen mit Bändern befestigt sind, und Gamaschen oder Strümpfe. Die Eigentümlichkeit seiner schwarzen Kleider und Strümpfe, mögen sie von Seide oder Wolle sein, ist, daß sie nie glänzen. Stumm, verschlossen, ohne Antwort für ein neugieriges Licht, ist sein Anzug wie er selbst. Er unterhält sich nie, wenn man ihn nicht in Berufssachen zu Rate zieht. Man findet ihn zuweilen stumm, aber zwanglos und ganz zu Hause am Eck der Gasttafeln in vornehmen Landschlössern oder nicht weit von Salons sitzen, von denen die Modezeitung so viel zu reden hat. Jedermann kennt ihn dort, und der halbe Hochadel bleibt mit den Worten stehen: »Wie geht’s Ihnen, Mr. Tulkinghorn?« Er nimmt die Begrüßung mit Ernst entgegen und begräbt sie neben all dem übrigen, was er weiß.
Sir Leicester Dedlock ist in Gesellschaft der Gnädigen und schätzt sich glücklich, Mr. Tulkinghorn zu empfangen. Es liegt etwas Vorschriftsmäßiges in Mr. Tulkinghorns Benehmen, das Sir Leicester immer sehr angenehm berührt und ihn wie eine Art Tribut anmutet. Er findet auch an Mr. Tulkinghorns Anzug Gefallen und sieht auch darin eine Art Huldigung. Er ist ungemein respektabel geschnitten und hat etwas Sachwalterhaftes. Er ist fast wie die Livree eines Aufsehers der Rechtsmysterien oder eines juristischen Kellermeisters.
Ist sich Mr. Tulkinghorn selbst darüber klar? Es kann sein, kann aber auch nicht sein. Und doch ist diese Frage bei allem, was mit Lady Dedlock als der Führerin und dem Glanzstern der vornehmen Welt in Berührung kommt, von großer Bedeutung. Sie hält sich für ein unerforschliches Wesen, das weit über der Beurteilungssphäre gewöhnlicher Sterblicher steht. So kommt sie sich im Spiegel vor, in dem sie auch wirklich so aussieht. Dennoch kennt jeder kleine Stern, der sich um sie dreht, von der Kammerzofe an bis zum Direktor der italienischen Oper, ihre Schwächen und Vorurteile, ihren Hochmut, ihre Torheiten und Launen und richtet sich in seinem Verkehr mit ihr nach ihren Charakterzügen, wie die Putzmacherin nach ihren Körperproportionen. Je nachdem es gilt, eine neue Mode, einen neuen Kleidungsschnitt, eine neue Sitte, einen neuen Sänger, eine neue Tänzerin, einen neuen Schmuck, einen Zwerg, einen Riesen, eine Kapelle oder sonst etwas in Mode zu bringen.
Es gibt ehrerbietige Leute in Dutzenden von Berufen, von denen allen Lady Dedlock glaubt, sie lägen beständig auf den Knien vor ihr, und die dabei genau wissen, daß sie wie ein Kind zu leiten ist; – Leute, die ein ganzes Leben lang an nichts denken als wie man ihr schmeicheln kann und die sich stellen, als seien sie demütig und unbedingt gehorsam, dabei aber sie und ihr ganzes Gefolge im Schlepptau haben, mit ihr wie mit einem Köder angeln und sie führen, wohin sie wollen, wie Lemuel Gulliver die stattliche Flotte des Reichs Liliput nach Belieben dirigierte.
»Wenn man bei dieser Sorte reüssieren will«, sagen Blaze & Sparkle, die Juweliere – und sie verstehen unter »dieser Sorte« Lady Dedlock und ihren Anhang –, »so darf man nicht vergessen, daß man es nicht mit dem großen Publikum zu tun hat; man muß »diese Sorte« an ihrer schwächsten Seite fassen, und ihre schwächste Seite ist diese und diese.«
»Um Ihre Artikel abzusetzen, meine Herren«, raten Sheen & Gloß, die Tuchhändler, ihren Freunden, den Fabrikanten, »so müssen Sie zu uns kommen, weil wir die Leute der feinen Gesellschaft zu behandeln wissen und dadurch die Mode bestimmen können.«
»Wenn Sie diesen Kupferstich bei meiner hochgestellten Kundschaft anbringen wollen, Sir«, sagt Mr. Sladdery, der Kunsthändler, »oder wenn Sie diesen Zwerg oder Riesen zu deichseln wünschen oder für diese Unternehmung der Unterstützung meiner hohen Kunden bedürfen, so müssen Sie mir das überlassen, denn ich kenne die führenden Personen in diesen Kreisen, Sir, und kann Ihnen, ohne zu übertreiben, sagen, daß ich sie um den Finger wickeln kann«, – worin Mr. Sladdery, der ein ehrenwerter Mann ist, durchaus nicht übertreibt.
Wenn daher Mr. Tulkinghorn wirklich nicht wissen sollte, was gegenwärtig in der Seele der Gnädigen vorgeht, so ist doch auch das Gegenteil sehr leicht möglich.
»Myladys Angelegenheit ist also wieder vor dem Kanzler verhandelt worden, Mr. Tulkinghorn?« fragt Sir Leicester und reicht dem Anwalt die Hand.
»Ja, sie kam heute zur Verhandlung«, entgegnet Mr. Tulkinghorn und macht der Gnädigen, die auf einem Sofa am Kamm sitzt und das Gesicht mit einem Handschirm schützt, eine seiner stummen Verbeugungen.
»Es ist wohl nutzlos zu fragen, ob irgend etwas geschehen ist«, sagt Mylady, noch immer von der trüben Stimmung, die ihr der Landsitz in Lincolnshire verursacht hat, bedrückt.
»Es ist nichts geschehen, was Gnädigste erwähnenswert nennen würden.«
»Es wird nie etwas geschehen«, meint Mylady.
Sir Leicester hat gegen den endlosen Gang der Kanzleigerichtsprozesse nichts einzuwenden. Es ist eine langsame, kostspielige, echt britische, konstitutionelle Sache. Allerdings handelt es sich für ihn in dem fraglichen Prozeß nicht um Sein oder Nichtsein, sondern bloß um die geringfügige Mitgift, die ihm Mylady zubrachte, und er hat eine dunkle Ahnung, daß es ein höchst lächerlicher Zufall ist, wenn der Name Dedlock in einem Prozeß als Partei vorkommt. Er sieht in dem Kanzleigericht etwas, das im Verein mit andern Institutionen von der vollendetsten menschlichen Weisheit ersonnen wurde und in Beziehungen zur ewigen gesetzmäßigen Ordnung steht, wenn auch hie und da die Gerechtigkeit ein wenig nachhinkt und zuweilen Verwirrung zur Folge hat. Beschwerden darüber beizustimmen, hieße vielleicht irgend jemand der niedereren Klassen ermutigen, sich aufzulehnen – wie etwa Wat Tyler bösen Angedenkens.
»Da einige neue Zeugenaussagen zu den Akten gekommen«, sagt Mr. Tulkinghorn, »und überdies kurz gefaßt sind und ich nach dem etwas weitschweifigen Prinzip verfahre, meine Klienten um Erlaubnis zu bitten, ihnen alle neuen Schritte in Prozessen vorlegen zu dürfen«, – Mr. Tulkinghorn ist ein vorsichtiger Mann und übernimmt nie mehr Verantwortlichkeit, als unbedingt nötig ist – »und da die Herrschaften außerdem nach Paris reisen, so habe ich alles mitgebracht.«
Sir Leicester geht nämlich ebenfalls nach Paris, wenn auch der Glanzpunkt der Fashionablen die Gnädige ist.
Mr. Tulkinghorn zieht seine Akten aus der Tasche, bittet um Erlaubnis, sie auf ein goldenes Spielzeug von Tischchen neben der Gnädigen legen zu dürfen, setzt die Brille auf und fängt an, bei dem Schimmer einer Schirmlampe vorzulesen:
»Kanzleigerichtshof. In Sachen John Jarndyce kontra –«
Die Gnädige unterbricht ihn mit der Bitte, soviel wie möglich von dem technischen Formwuste wegzulassen.
Mr. Tulkinghorn blickt über die Brille und fängt tiefer unten von neuem an. Mylady findet es nicht der Mühe wert, ihm ihre Aufmerksamkeit zu schenken. Sir Leicester in seinem Lehnstuhl blickt ins Feuer und scheint ein stolzes Wohlgefallen an den juristischen Wiederholungen und Weitschweifigkeiten, die ihm wie nationale Bollwerke erscheinen, zu finden. Die Hitze ist zufällig groß, wo Mylady sitzt, und der Handschirm ist weniger nützlich als schön; er ist unschätzbar, aber klein. Mylady setzt sich anders und erblickt dabei die Papiere auf dem Tisch, – besieht sie näher, besieht sie noch näher und fragt impulsiv: »Wer hat denn das geschrieben?«
Mr. Tulkinghorn hält, verwundert über die Lebhaftigkeit und den ungewohnten Ton der Gnädigen, inne.
»Es ist das, was Sie eine Kanzlistenhandschrift nennen?« fragt sie, blickt ihn wieder in ihrer teilnahmslosen Weise an und spielt mit dem Schirm.
»Nicht so ganz. Wahrscheinlich hat sie den Kanzleicharakter erst angenommen, als sie schon ausgebildet war. Warum fragen Gnädigste?«
»Um eine Abwechslung in diese abscheuliche Einförmigkeit zu bringen. Bitte, fahren Sie fort.«
Mr. Tulkinghorn liest weiter.
Die Hitze wird größer. Die Gnädige bedeckt das Gesicht mit dem Schirm. Sir Leicester nickt ein, fährt plötzlich auf und ruft:
»He? Was sagten Sie?«
»Ich fürchte«, flüstert Mr. Tulkinghorn, der hastig aufgestanden ist, »Lady Dedlock befindet sich nicht wohl.«
»Ich fühle mich nur schwach«, lispelt Mylady mit weißen Lippen. »Weiter nichts; aber es ist wie die Schwäche des Todes. Sprechen Sie nicht mit mir. Klingeln Sie und lassen Sie mich in mein Zimmer bringen!«
Mr. Tulkinghorn zieht sich in ein anderes Zimmer zurück. Klingeln schellen, Schritte kommen und gehen, und Stille tritt wieder ein. Endlich bittet der gepuderte Merkur Mr. Tulkinghorn, wieder hereinzukommen.
»Es geht Mylady jetzt bereits besser«, sagt Sir Leicester und winkt dem Advokaten, Platz zu nehmen, um sich allein vorlesen zu lassen. »Ich bin sehr erschrocken. Ich kann mich nicht erinnern, daß Mylady jemals ohnmächtig geworden wäre. Aber das Wetter ist abscheulich, und sie hat sich auf unserm Gut in Lincolnshire wirklich tödlich gelangweilt.«
3. Kapitel
Die Geschichte einer Jugend
Es wird mir sehr schwer, den Anfang zu finden, um meinen Teil der Geschichte niederzuschreiben, denn ich weiß, daß ich nicht besonders gescheit bin. Ich wußte das immer. Schon als ganz kleines Mädchen pflegte ich zu meiner Puppe zu sagen, wenn wir allein beisammen waren: Liebe Puppe, ich bin nicht klug, du weißt es selbst und mußt mit mir Geduld haben, Herzchen. Und dann saß sie in einen großen Armstuhl gelehnt mit dem rot und weißen Gesicht und den rosigen Lippen da und starrte mich an – oder vielmehr ins Leere –, während ich emsig nähte und ihr alle meine Geheimnisse erzählte.
Meine liebe alte Puppe!
Ich war als Kind so in mich gekehrt und scheu, daß ich selten den Mund auftat und niemandem mein Herz auszuschütten wagte. Ich muß fast weinen, wenn ich daran denke, welcher Trost es für mich war, wenn ich aus der Schule nach Hause kam, hinauf in mein Kämmerchen laufen und sagen konnte: »O du gute treue Puppe, ich wußte, daß du mich erwartest.« Und dann setzte ich mich auf den Boden, stützte den Ellbogen auf ihren großen Lehnstuhl und erzählte ihr alles, was ich erlebt hatte, seit wir uns nicht gesehen.
Von jeher besaß ich einen Hang zu beobachten, aber ich faßte nicht rasch auf. Durchaus nicht. Ich beobachtete still, was vorging, und wünschte nur, ich könnte es besser verstehen. Ich war keineswegs scharfsinnig. Wenn ich jemanden gern habe, scheint mein Verstand klarer zu werden. Aber vielleicht ist das nur Eitelkeit und Einbildung von mir.
Mein Patin erzog mich, soweit ich mich zurückerinnern kann, wie eine der Prinzessinnen in den Feenmärchen; nur daß ich nicht so schön war. Ich wußte bloß, daß sie meine Patin war und eine gute, gute Frau. Sie ging dreimal am Sonntag in die Kirche und Mittwochs und Freitags zur Frühmesse und in die Betstunden, so oft welche gehalten wurden. Sie hatte ein schönes Gesicht, und wenn sie nur einmal gelächelt haben würde, so hätte sie wie ein Engel aussehen müssen; – aber sie lächelte nie. Sie war immer ernst und streng, aber immer so außerordentlich gütig, daß wohl nur die Schlechtigkeit anderer Menschen die Schuld trug, daß sie ihr ganzes Leben so finster war.
Ich kam mir so ganz anders geartet vor als sie, selbst wenn ich den Unterschied zwischen Kind und Erwachsener in Abzug brachte, kam mir so unbedeutend und armselig und ihr so fernstehend vor, daß ich niemals rechtes Vertrauen zu ihr fassen, ja, sie nicht einmal so lieben konnte, wie ich gewünscht hätte. Mir machte der Gedanke viel Schmerz, wie gut sie und wie unwürdig ich ihrer sei; und ich nährte in meinem Innern eine inbrünstige Hoffnung, mein Herz möge mit der Zeit besser werden. Und ich sprach darüber sehr oft mit meiner lieben Puppe. Aber ich liebte meine Patin eben doch nie so, wie ich hätte sollen und müssen, wenn ich ein besseres Kind gewesen wäre.
Da ich mir dies beständig vorhielt, wurde ich noch schüchterner und stiller, als ohnehin schon in meiner Natur lag; und meine einzige Freundin war die Puppe, bei der allein ich mich wohl fühlte. Aber, als ich noch ein ganz kleines Ding war, geschah außerdem noch etwas, was mich darin noch bestärkte.
Ich hatte nie von meiner Mutter sprechen hören. Ebensowenig von meinem Vater; aber meine Mutter interessierte mich sehr. Ich konnte mich nicht entsinnen, je ein Trauerkleid getragen zu haben. Man hatte mir niemals meiner Mutter Grab gezeigt und mir nie gesagt, wo es sei, mich auch nie für eine andere Verwandte als für meine Patin beten gelehrt. Mehr als einmal erwähnte ich diesen Gegenstand meines beständigen Grübelns gegen Mrs. Rachael, die immer mein Licht fortnahm, wenn ich zu Bette gegangen, und unsere einzige Dienerin war. Aber sie sagte jedes Mal nur: »Esther, gute Nacht!« und ging fort und ließ mich allein.
Obgleich sich sieben Mädchen in der nahen Schule befanden, wo ich Unterricht erhielt, und sie mich die kleine Esther Summerson nannten, so war ich doch bei keinem von ihnen je zu Besuch gewesen. Alle waren weitaus älter als ich, aber es schien noch eine andere Scheidewand zwischen uns zu bestehen außer dem Umstande, daß sie, älter und klüger als ich, mehr wußten. Eine von ihnen lud mich in der ersten Woche meiner Schulzeit, wie ich mich noch genau erinnere, zu meiner großen Freude zu einem kleinen Fest ein. Aber meine Patin schrieb einen steifen Absagebrief, und ich durfte nicht hingehen. Ich kam nie auf Besuch in andere Häuser.
Mein Geburtstag war wieder gekommen. Den andern bedeuteten Geburtstage Feiertage – mir niemals; die andern hatten bei solchen Gelegenheiten Festlichkeiten zu Hause, wie ich sie einander erzählen hörte; – ich niemals. Mein Geburtstag war die langen Jahre hindurch der trübste Tag meines Lebens.
Wenn mich meine Eitelkeit nicht täuscht, was wohl der Fall sein kann, denn so etwas weiß man nicht selber, so wird meine Fassungskraft mit meiner Zuneigung geweckt. Ich habe ein liebebedürftiges und weiches Gemüt, und vielleicht würde ich noch heute eine solche Wunde, wie ich sie damals an meinem Geburtstag empfing, wenn man sie mehr als einmal überhaupt erleiden kann, ebenso tief fühlen wie zu jener Zeit.
Das Mittagessen war vorüber, und meine Patin und ich saßen am Tisch vor dem Feuer. Die Uhr tickte, das Feuer knisterte, und kein anderer Ton war hörbar im Zimmer und im Hause –, ich weiß nicht, wie lange Zeit schon. Ich erhob zufällig die Augen schüchtern von meiner Näharbeit und sah, wie mich meine Patin über den Tisch hinweg trübe anblickte, als wollte sie sagen: Es wäre viel besser, kleine Esther, wenn du niemals einen Geburtstag gehabt hättest und niemals geboren worden wärest.
Ich fing an zu schluchzen und zu weinen: »Ach liebe Patin, sage mir, bitte, sage mir, starb Mama an meinem Geburtstag?«
»Nein«, war die Antwort. »Frage mich nicht weiter, Kind.«
»Bitte, sage mir etwas von ihr! Nur ein Wort! Ich bitte dich, liebe Patin! Was hab ich ihr getan? Wie hab ich sie verloren? Warum bin ich so verschieden von andern Kindern, und was kann ich dafür, liebe Patin? Nein, nein, nein, geh nicht fort! O sag es mir!«
Eine Angst, die größer war als mein Schmerz, hatte mich befallen, und ich hielt meine Patin am Kleide fest und kniete vor ihr nieder.
Bis jetzt hatte sie fortwährend gesagt: »Laß mich gehen«, aber plötzlich blieb sie stehen.
Der finstere Ausdruck ihres Gesichtes übte eine solche Gewalt auf mich aus, daß ich mitten in meiner Verzweiflung innehielt. Ich wollte mit meiner zitternden Hand die ihre fassen und von ganzer Seele um Verzeihung bitten, zog sie aber bei ihrem Blick schnell wieder zurück, und das Herz klopfte mir. Sie hob mich auf, setzte sich in ihren Stuhl und sprach in kaltem gedämpftem Ton zu mir – ich sehe sie mit gerunzelter Stirn und strafend erhobenem Finger noch heute vor mir –:
»Deine Mutter, Esther, ist deine Schande, und du warst ihre. Die Zeit wird früh genug kommen, wo du das besser verstehen und auch fühlen wirst, wie es nur ein Weib kann. Ich habe ihr verziehen« – das Gesicht meiner Patin zeigte nicht den geringsten Zug von Versöhnlichkeit- »ich habe ihr verziehen, was sie mir Böses getan hat, und spreche nicht mehr davon, obgleich ihr Unrecht größer war, als du jemals erfahren wirst oder irgend jemand außer mir, die ich davon betroffen wurde, ahnen kann. Was dich betrifft, unglückliches Kind, warst du verwaist und beschimpft vom ersten unseligen Geburtstag an; bete du täglich, daß die Sünden anderer nicht auf dein Haupt kommen mögen, wie es geschrieben steht. Vergiß deine Mutter und hindere nicht, daß die Menschen es tun; deinetwegen. Jetzt geh.«
Sie hielt mich, als ich wortlos gehen wollte – so bis ins Innere erstarrt war ich – noch einmal fest und setzte hinzu:
»Unterwürfigkeit, Selbstverleugnung, Fleiß sind die Wegzeichen für ein Leben, das mit einem solchen Flecken begonnen hat. Du bist anders als die andern Kinder, Esther, weil du nicht wie sie in gemeinsamer Sündhaftigkeit und im Zorne geboren bist. Du bist gezeichnet.«
Ich schlich in mein Kämmerchen hinauf und kroch ins Bett und legte das Gesicht meiner Puppe an meine tränennasse Wange, und mit dieser einzigen Freundin an der Brust weinte ich mich in Schlaf. So wenig ich mir auch über meinen Schmerz klar werden konnte, so wußte ich doch, daß ich zu keiner Zeit jemand eine Freude gewesen, und niemand auf Erden mich so lieb hatte wie ich meine Puppe.
Ach Gott, ach Gott, wie oft und lange wir später allein miteinander verbrachten und ich der Puppe die Geschichte meines Geburtstages erzählte und ihr anvertraute, wie sehr ich mich bemühen wollte, den Fehler, der mir mit meiner Geburt anhaftete, wieder gutzumachen und mich zu bestreben, mit den Jahren fleißig, zufrieden und freundlichen Herzens zu werden und mir eines Menschen Liebe zu gewinnen, wenn es mir gelingen sollte, und ihm alles nur mögliche Gute zu tun! Vielleicht ist es selbstgefällig, wenn ich bei dem Gedanken daran jetzt noch Tränen vergießen muß. Ich denke mit großer Dankbarkeit zurück und bin fröhlich, aber doch kann ich nicht verhindern, daß sie mir in die Augen treten.
– So! Jetzt hab ich sie weggewischt und kann wieder fortfahren.
Ich war mir der großen Kluft zwischen meiner Patin und mir seit jenem Geburtstag nur noch mehr bewußt und empfand so sehr, in ihrem Hause einen Platz einzunehmen, der leer hätte sein sollen, daß es mir schwerer wurde, mich ihr zu nähern als je, so innig verpflichtet ich mich ihr im Herzen auch fühlte.
Genau so empfand ich gegen meine Mitschülerinnen und gegen Mrs. Rachael, die Witwe war, und gegen ihre Tochter, auf die sie sehr stolz war und die sie einmal alle vierzehn Tage besuchte. Ich blieb sehr schüchtern und still und bemühte mich nach Kräften, fleißig zu sein.
An einem sonnigen Nachmittag, als ich eben mit meiner Mappe ans der Schule gekommen war und den langen Schatten neben mir beobachtete und wie gewöhnlich die Treppe hinauf in mein Kämmerchen eilen wollte, öffnete meine Patin die Wohnzimmertür und rief mich hinein. Bei ihr saß ein Fremder, was etwas sehr Ungewöhnliches war: ein behäbiger, wichtig aussehender Herr, ganz schwarz gekleidet, mit einer weißen Halsbinde, großen goldnen Petschaften an der Uhrkette, einer goldnen Brille und einem großen Siegelring am kleinen Finger.
»Das ist das Kind«, sagte meine Patin mit verhaltener Stimme zu ihm. Dann setzte sie mit ihrem gewöhnlichen ernsten Ton hinzu:
»Das ist Esther, Sir.«
Der Herr setzte seine Brille auf, sah mich an und sagte:
»Komm zu mir, liebes Kind!«
Er reichte mir die Hand und hieß mich den Hut abnehmen und betrachtete mich unablässig dabei. Als ich seinen Wunsch erfüllt hatte, sagte er: »Ah! Ja!« nahm seine Brille ab, steckte sie in ein rotes Futteral, lehnte sich in den Armstuhl zurück und nickte meiner Patin zu und spielte mit dem Etui. Darauf fing meine Patin wieder an:
»Du kannst hinaufgehen, Esther.« Ich machte dem Herrn meinen Knicks und ging.
Es muß zwei Jahre später gewesen sein, und ich war fast vierzehn Jahre alt, als ich an einem Abend, an den ich voll Entsetzen zurückdenken muß, mit meiner Patin vor dem Kamine saß. Ich las ihr vor. Ich war, wie immer, um neun Uhr heruntergekommen, um ihr aus der Bibel vorzulesen, und hielt gerade bei der Stelle im Evangelium Johannis, wo es heißt, daß unser Erlöser sich niederbückte und mit dem Finger auf die Erde schrieb, als sie die Ehebrecherin vor ihn brachten: Als sie nun anhielten, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen: Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie.
Ich hielt inne, denn meine Patin stand auf, legte ihre Hand an die Stirn und rief mit schrecklicher Stimme den Satz aus der Bibel: So wachet nun, auf daß er nicht schnell komme und finde euch schlafend. Was ich aber euch sage, das sage ich euch allen: wachet.
Sie stand vor mir und wiederholte diese Worte. Dann brach sie plötzlich zusammen. Ich brauchte nicht um Hilfe zu rufen; ihre Stimme war durch das ganze Haus gedrungen und bis auf die Straße gehört worden.
Man legte sie auf ihr Bett. Länger als eine Woche lag sie dort, äußerlich nur wenig verändert. Das alte schöne entschlossene Stirnrunzeln, das ich so gut kannte, war auf ihrem Gesicht erstarrt. Viele, viele Male bei Tag und bei Nacht legte ich meinen Kopf auf das Kissen neben sie, damit sie mein Flüstern besser verstünde, und küßte sie und dankte ihr, betete für sie, bat sie um ihren Segen und ihre Verzeihung und flehte sie an, mir nur ein einziges Zeichen zu geben, daß sie mich erkenne oder höre. Nichts, nichts, nichts! Ihr Gesicht blieb unbeweglich. Bis zuletzt. Und selbst dann wich der finstere Ausdruck nicht von ihrer Stirn.
Am Tag nach dem Begräbnis meiner guten Patin stellte sich der schwarze Herr mit dem weißen Halstuch wieder ein. Mrs. Rachael schickte nach mir, und ich fand ihn auf derselben Stelle, als wäre er niemals weggegangen.
»Ich heiße Kenge«, sagte er. »Merk dir den Namen, liebes Kind; Kenge & Carboy, Lincoln’s-Inn.«
Ich gab zur Antwort, daß ich mich erinnerte, den Herrn schon früher einmal gesehen zu haben.
»Bitte, setz dich – hier neben mich. Weine nicht, es nützt nichts. Mrs. Rachael! Ich brauche Ihnen, die Sie mit der seligen Miß Barbary Angelegenheiten bekannt waren, nicht erst zu sagen, daß ihr Einkommen mit ihrem Leben zu Ende ging und daß diese junge Dame jetzt nach dem Tode ihrer Tante -«
»Meiner Tante, Sir?«
»Es hat ja doch keinen Zweck, eine Täuschung aufrecht zu erhalten, die keinen Sinn mehr hat«, sagte Mr. Kenge besänftigend. »Tatsächlich war sie deine Tante, wenn auch nicht vor dem Gesetze. Aber weine doch nicht. Weine nicht! Beruhige dich! – Mrs. Rachael, unsere junge Freundin hat zweifellos gehört – von – der – hm – Sache Jarndyce kontra Jarndyce?«
»Nie«, sagte Mrs. Rachael.
»Ist es denn möglich«, fuhr Mr. Kenge fort und setzte seine Brille auf, »daß unsere junge Freundin – aber geh, weine doch nicht – niemals von ‘Jarndyce kontra Jarndyce’ gehört hat?«
Ich schüttelte den Kopf und hatte nicht die leiseste Ahnung, worum es sich handelte.
»Nichts von ‘Jarndyce kontra Jarndyce’?« wiederholte Mr. Kenge, blickte mich über die Brille hinweg an und liebkoste das Futteral mit den Händen. »Nichts von einem der größten aller bekannten Kanzleigerichtsprozesse, nichts von dem Fall ‘Jarndyce kontra Jarndyce’, – der für sich schon – hm – ganz für sich allein ein Denkmal in der Kanzleigerichtspraxis bedeutet? – In dem, möchte ich sagen, jede Schwierigkeit, jede Möglichkeit, jede Rechtsfiktion, jede Prozeßform, die bei diesem Gerichtshof bekannt ist, sich immer und immer wieder verkörpert? Es ist ein Rechtsfall, der nirgends als in unserm großen und freien Lande existieren könnte! Ich möchte behaupten, daß die Gesamtkosten in Sachen Jarndyce kontra Jarndyce – Mrs. Rachael – ich fürchte –« er wendete sich von mir ab, weil ich mich unaufmerksam zeigte – »sich gegenwärtig auf sechzig-bis siebzigtausend Pfund belaufen«, ergänzte Mr. Kenge, in seinen Stuhl zurückgelehnt.
Der Gegenstand war mir so gänzlich unbekannt, daß ich damals auch nicht das Allergeringste davon verstand.
»Und sie hat wirklich nie etwas von der Sache gehört? Höchst erstaunlich!«
»Miß Barbary, Sir«, erklärte Mrs. Rachael, »die jetzt unter den Seraphim weilt –«
»Das hoffe ich zuversichtlich«, unterbrach Mr. Kenge höflich.
»– wünschte, daß Esther nur lerne, was ihr von Nutzen sein könne. Und sie ist hier auch weiter nichts gelehrt worden.«
»Hm«, sagte Mr. Kenge. »Das ist im großen ganzen sehr richtig. Aber jetzt zur Sache!« fuhr er zu mir gewendet fort. »Miß Barbary, deine einzige Verwandte – tatsächlich nämlich – denn ich muß dir bemerken, daß du von Gesetzes wegen keine Verwandten hast –, ist jetzt tot, und da man natürlich von Mrs. Rachael nicht erwarten kann –«
»O Gott nein«, fiel Mrs. Rachael schnell ein.
»Sehr richtig!« – daß sie die Sorge für deinen Lebensunterhalt auf sich nimmt, so sehe ich mich veranlaßt, ein Anerbieten zu erneuern, das ich schon vor ungefähr zwei Jahren Miß Barbary zu machen beauftragt war und das damals abgelehnt wurde. Wir hatten uns jedoch dahin geeinigt, daß es für den Fall des Todes deiner Tante wiederholt werden sollte. Ich glaube nun, nicht im geringsten gegen die in meinem Berufe übliche Reserve zu verstoßen, wenn ich verrate, daß ich in Sachen Jarndyce kontra Jarndyce und auch in anderer Hinsicht einen sehr menschenfreundlichen, wenn auch zugleich sehr eigentümlichen Mann vertrete.« Mr. Kenge lehnte sich wieder in seinen Stuhl zurück und sah uns beide ruhig an.
Der Klang seiner eigenen Stimme schien ihn über die Maßen zu freuen. Ich sah darin nichts Wunderbares, denn sie war weich und wohlklingend und verlieh jedem Worte, das er aussprach, den Anschein großer Wichtigkeit. Er hörte sich mit sichtlicher Befriedigung zu und schlug manchmal zu seiner eigenen Musik mit dem Kopfe den Takt oder rundete einen Satz mit einer gefälligen Handbewegung ab. Selbst damals schon, als ich noch gar nicht wußte, daß er sich nach dem Muster des hohen Lords, der sein Klient war, herangebildet hatte und allgemein »Konversationskenge« genannt wurde, machte er einen großen Eindruck auf mich.
»Da Mr. Jarndyce«, fuhr er fort, »von der – ich möchte sagen, verzweifelten – Lage unserer jungen Freundin unterrichtet ist, so bietet er ihr an, sie in einer Anstalt ersten Ranges unterbringen zu wollen, wo ihre Erziehung vollendet, ihr gutes Auskommen gesichert, für alle ihre Bedürfnisse, soweit sie vernünftig und nötig sind, gesorgt und sie selbst endlich befähigt werden soll, ihre Pflicht in der Lebensstellung zu erfüllen, die ihr anzuweisen – darf ich wohl sagen, der Vorsehung – gefallen hat.«
Mein Herz war so tief ergriffen von dem, was er sagte, wie auch von der liebreichen Weise, in der er es tat, daß ich beim besten Willen kein Wort sprechen konnte.
»Mr. Jarndyce stellt keinerlei Bedingungen und spricht nur die Erwartung aus, daß unsere junge Freundin die fragliche Anstalt ohne sein Wissen und Zutun nicht verlassen und sich mit Fleiß der Erwerbung der Kenntnisse und Fertigkeiten widmen werde, durch deren Anwendung und Ausübung sie sich später soll erhalten können – und daß sie auf dem Pfade der Tugend und Ehre bleiben möge und – daß – hm – und so weiter.«
Ich konnte noch weniger sprechen als vorher.
»Nun, was sagt unsere junge Freundin?« fuhr Mr. Kenge fort. »Laß dir Zeit, laß dir Zeit. Ich warte auf deine Antwort. Laß dir nur Zeit.«
Was ich zu diesem Anerbieten zu sagen versuchte, brauche ich nicht zu wiederholen. Was ich wirklich sagte, ist kaum des Erzählens wert. Und was ich fühlte und bis zu meiner letzten Stunde fühlen werde, das könnte ich nicht in Worte bringen.
Diese Unterredung fand in Windsor statt, wo ich mein ganzes Leben zugebracht hatte, soweit ich zurückdenken konnte. Acht Tage später verließ ich, reichlich mit allem Notwendigen versehen, den Ort, um mit der Landkutsche nach Reading zu fahren.
Mrs. Rachael war zu gut, um beim Abschied bewegt zu sein. Aber ich war nicht so gut und weinte bitterlich. Ich dachte, daß ich sie nach so vielen Jahren eigentlich besser kennen und mich bei ihr so in Gunst gesetzt haben sollte, daß ihr der Abschied weh tun müsse.
Als sie mir einen so kalten Abschiedskuß auf die Stirne drückte, als ob ein großer Tropfen von dem Eise oben an dem steinernen Torgewölbe niedertaute, fühlte ich mich so elend und schuldbewußt, daß ich sie umarmte und ihr sagte, ich wisse wohl, es sei meine Schuld, daß ihr der Abschied von mir so leicht werde.
»Nein, Esther«, entgegnete sie. »Dein Unglück ist schuld daran.«
Die Kutsche stand vor der kleinen Gartenpforte – wir waren erst aus dem Hause getreten, als wir sie hatten kommen hören –, und so verließ ich Mrs. Rachael mit bekümmertem Herzen. Sie ging hinein, ehe noch mein Koffer auf die Kutsche gehoben worden, und machte die Türe zu.
Solange ich das Haus sehen konnte, blickte ich mit Tränen in den Augen aus dem Fenster zurück. Meine Patin hatte Mrs. Rachael ihr ganzes kleines Vermögen vermacht, und es sollte Auktion sein; ein alter Kaminteppich mit Rosen darauf, der mir immer als das Schönste auf Erden vorgekommen war, hing draußen in Frost und Schnee. Ein oder zwei Tage vorher hatte ich meine liebe Puppe in ihren Schal gewickelt und sie – fast schäme ich mich, es zu erzählen – im Garten unter dem Baum begraben, der das Fenster meines Kämmerchens beschattete. Ich hatte keinen Freund als einen Vogel, und den trug ich in seinem Käfig bei mir.
Als ich das Haus aus dem Gesicht verlor, setzte ich mich, den Käfig vor mir im Stroh, auf den niedrigen Vordersitz, um durch das Fenster hinauszuschauen auf die bereiften Bäume, die wie schöne Stücke Kalkspat aussahen. Die Felder hatte der Schnee in der Nacht glatt und weiß gemacht. Rot und kalt stand die Sonne am Himmel, und das Eis lag schwarz wie poliertes Eisen da, von den Schlittschuhläufern und Schlittenfahrern reingefegt.
Mir gegenüber saß ein Herr, der in einer Menge Umhüllungen sehr umfangreich aussah; aber er blickte zum andern Fenster hinaus und nahm keine Notiz von mir.
Ich dachte an meine tote Patin – an den Abend, wo ich ihr vorgelesen, an das erstarrte, zürnende Gesicht, mit dem sie auf dem Bette gelegen, an den fremden Ort, dem ich entgegenfuhr, an die Leute, die ich dort finden sollte, und wie sie wohl aussehen und zu mir sein würden, da machte mich eine Stimme in der Kutsche vor Schrecken auffahren.
»Warum, zum Teufel, weinst du denn!«
Ich erschrak so sehr, daß mir die Stimme versagte, und ich nur flüsternd fragen konnte:
»Ich, Sir?«
Natürlich konnte nur der Herr in den vielen Umhüllungen gesprochen haben, obgleich er immer noch zum Fenster hinaussah.
»Ja, du«, sagte er und drehte sich um.
»Ich wußte nicht, daß ich weinte, Sir«, stammelte ich.
»Aber du weinst. Sieh selbst.«
Er rutschte aus der andern Ecke des Wagens auf den Platz mir gegenüber, fuhr mir mit einem seiner großen Pelzaufschläge sanft über die Augen und zeigte mir dann, daß er naß war.
»Da! Jetzt weißt du’s. Nicht wahr?«
»Ja, Sir.«
»Und warum weinst du? Gehst du nicht gern dorthin?«
»Wohin, Sir?«
»Wohin? Nun dahin, wohin du eben gehst.«
»Ich gehe sehr gern hin, Sir.«
»Nun also! Mach doch ein freundliches Gesicht!«
Der Herr kam mir höchst sonderbar vor; wenigstens was ich von ihm sehen konnte, war sehr merkwürdig. Bis ans Kinn eingehüllt, verschwand sein Gesicht fast unter einer Pelzmütze mit breiten Pelzohrklappen. Ich hatte mich wieder gefaßt und fürchtete mich nicht mehr vor ihm. Ich sagte ihm, ich hätte wegen des Todes meiner Patin geweint, und weil Mrs. Rachael der Abschied von mir so leicht geworden sei.
»Der Kuckuck soll Mrs. Rachael holen!« brummte der Herr. »Soll sie beim nächsten Sturmwind auf einem Besenstiel wegfliegen!«
Ich fing jetzt an, mich doch wieder vor ihm zu fürchten, und betrachtete ihn mit größter Verwunderung. Aber er hatte freundliche Augen, wenn er auch fortfuhr, ärgerlich vor sich hinzubrummen und auf Mrs. Rachael zu schimpfen.
Nach einer kleinen Weile öffnete er seine oberste Hülle, die groß genug zu sein schien, um die ganze Kutsche damit zu bedecken, und fuhr mit dem Arm tief in seine Seitentasche.
»Da schau einmal!« sagte er. »In diesem Papier ist ein Stück von der besten Pflaumentorte, die für Geld zu haben ist – mit einem Zuckerüberguß, zolldick wie Fett auf einer Hammelkeule. Hier ist ein Pastetchen, ein Juwel an Größe und Beschaffenheit, aus Frankreich. Und woraus glaubst du wohl, ist es gemacht? Aus Leber von fetten Gänsen! Das ist eine Pastete! Wollen mal sehen, wie sie dir schmeckt.«
»Ich danke Ihnen bestens, Sir«, gab ich zur Antwort. »Ich bin Ihnen außerordentlich verbunden, aber, – ich hoffe, Sie nehmen es nicht übel – es ist zu schwer für mich.«
»Wieder einmal abgefahren!« sagte der Gentleman – ich verstand nicht, was er damit meinte – und warf beides zum Fenster hinaus.





























