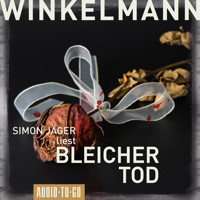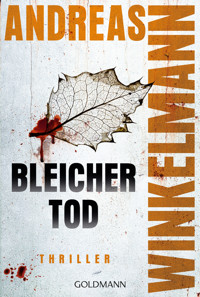
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Sie dachten, der Tod wäre das Schlimmste. Sie haben sich getäuscht
Ein junges Mädchen, allein, gefangen in der Dunkelheit. Sie ahnt, dass ihr Leben bald vorbei sein wird – nur um festzustellen, dass es schlimmere Dinge gibt als zu sterben ... Derweil erfährt Kriminalkommissarin Nele Karminter von einer erschreckenden Studie: Einer von fünfundzwanzig Menschen hat kein Gewissen, ist ein potentieller Psychopath. Eine Erkenntnis, die sich für Nele bald in blutige Praxis verwandeln wird. Denn kurz darauf wird sie zu einem Tatort gerufen – und zu der grausam entstellten Leiche eines jungen, seltsam bleichen Mädchens ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 485
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Buch
Als sie spätabends durch die vereiste Landschaft eines Moores fährt, gerät Miriam Singer auf einmal in Panik. Von starken Halluzinationen heimgesucht, bleibt ihr nichts anderes übrig, als anzuhalten. Plötzlich steht ein Fremder neben ihrem Auto, der ihr seine Hilfe anbietet. Und der Teil von Miriams ganz persönlichem Alptraum wird …
Am selben Abend besucht Kriminalkommissarin Nele Karminter ein Seminar bei der Psychologin Dr. Sternberg. »Vier von hundert«, enthüllt die Ärztin ihrem Publikum. »Einer von fünfundzwanzig Menschen hat kein Gewissen. Wir bezeichnen ihn als Soziopathen, geläufiger ist der Ausdruck Psychopath, und er kennt nur ein Ziel: Gewinnen!«
Für Nele Karminter wird aus Dr. Sternbergs beeindruckender Theorie nur allzu schnell grausame Praxis. Denn in einer verlassenen, einsam gelegenen Schweinemastanlage stößt ihre Kollegin Anouschka Rossberg nach einem Hinweis auf eine furchtbar zugerichtete Leiche. Ein Fund, der Neles gesamtes Team in Aufruhr versetzt.
Derweil untersucht der Privatdetektiv Alexander Seitz den Fall der verschwundenen Daniela Gerstein. Doch kaum hat er eine erste ernsthafte Spur gefunden, überschlagen sich die Ereignisse. Denn Alexanders Recherchen und Neles Ermittlungen haben mehr miteinander gemein, als es den Anschein hat, und ein hochintelligenter Soziopath par excellence wird ihnen zeigen, zu was er fähig ist …
Autor
Andreas Winkelmann, geboren im Dezember 1968, entdeckte schon in jungen Jahren seine Leidenschaft für unheimliche Geschichten. »Der menschliche Verstand erschafft die Hölle auf Erden, und dort kenne ich mich aus«, beschreibt er seine Faszination für das Genre des Bösen. Er lebt heute mit seiner Familie in einem einsamen Haus am Waldesrand nahe Bremen.
Von Andreas Winkelmann sind im Goldmann Verlag
außerdem lieferbar:
Tief im Wald und unter der Erde. Thriller (46955)
Hänschen klein. Thriller (47125)
Blinder Instinkt. Psychothriller (47338)
Andreas Winkelmann
Bleicher Tod
Psychothriller
Impressum
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Originalausgabe November 2011
Copyright © 2011 by Andreas Winkelmann
Copyright © dieser Ausgabe by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München.
Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, München
Th · Herstellung: Str.
Satz: omnisatz GmbH, Berlin
ISBN 978-3-641-06610-9V005
www.goldmann-verlag.de
Für
alle starken Frauen
dieser Welt
Seit Stunden lag sie auf einem Gitter aus eckigen Metallstreben, die ihr schmerzhaft ins Fleisch drückten. Darunter war ein Hohlraum, aus dem ekelerregender Gestank aufstieg. Sobald sie sich bewegte, rasselten die Ketten, mit denen sie an das Gitter gefesselt war, und das Geräusch hallte in einer scheinbar endlosen Halle gespenstisch wider. Die Ketten ließen ihr einigen Bewegungsspielraum, aber es tat weh, mit nackter Haut über das grobe Metall zu rutschen. Von vollkommener Dunkelheit umgeben, hatte sie die Abmessungen ihres Gefängnisses ertasten müssen. Oben, unten, rechts, links, überall hatte sie unter ihren Fingern und Zehen rauen Putz gespürt. Anscheinend war sie von Mauern umgeben, die sich nach oben hin in einen großen Raum öffneten.
Sie wusste weder, wie sie hierhergekommen war, noch wo sie sich befand. Sie wusste nur, dass ihre Träume vorbei waren, noch ehe sie begonnen hatte, sie zu leben.
Über das Schreien, Flehen, Weinen und das Gezerre an den Ketten bis zur Erschöpfung war sie längst hinaus. Die bittere Kälte setzte ihrem nackten Körper immer mehr zu, stahl ihre Kraft und ihre Hoffnung. Niemand hatte sie schreien hören und niemand würde ihr zu Hilfe eilen, das hatte sie verstanden, und trotzdem wollte sie sich nicht damit abfinden, hier sterben zu müssen.
Die Stille war entsetzlich. Wenn sie ganz ruhig war und den Atem anhielt, hörte sie absolut nichts. Sie ertrug diese Stille nicht mehr, ertrug es nicht, dass sich überhaupt nichts veränderte.
Warum kam er nicht zurück? Wenn sie nur mit ihm sprechen könnte, dann würde alles wieder gut werden.
Als er dann wirklich kam, bereute sie ihren Wunsch.
Dem feinen Sprühregen, der plötzlich auf sie niederging, konnte sie nicht entkommen, ganz gleich, wie hastig sie über die Metallstreben rutschte. Die kalten Tropfen überzogen ihre Haut mit einem gleichmäßigen Film, und als sie schon glaubte, das Schlimmste überstanden zu haben, bissen die Tropfen zu.
Freitag, 26. Februar 2010
Ihre zierliche Hand verharrte zur Faust geballt vor der Tür.
Vor dieser schweren, feuerfesten Metalltür, deren Klinke sie seit Monaten nicht mehr berührt hatte, weil es ihr verboten war, die Tür zu öffnen. Der Raum dahinter war schon immer allein sein Reich gewesen, und es hatte sie nie wirklich interessiert, womit er sich dort beschäftigte. Aber da er seit einigen Wochen immer mehr Zeit darin verbrachte, fragte sie sich jetzt doch, in was für eine Welt er verschwand, wenn sich die Tür mit einem lauten Donnern hinter ihm schloss.
Er hatte sich verändert, seitdem er seine wenige freie Zeit dort drinnen verbrachte. Einerseits war er ruhiger geworden, geradezu in sich gekehrt, dann aber auch wieder auf eine aggressive Art erregt, so als warte er auf etwas Bestimmtes und könne es kaum noch aushalten. Dann strahlten seine Augen wie die eines kleinen Jungen zu Weihnachten, mit dem Unterschied, dass es ein kaltes, selbstzufriedenes Strahlen war. Zweimal war er spätabends herausgekommen und hatte sie mit Aufmerksamkeit geradezu überschüttet. Aber so wie ein Hund seinem Herrn, der ihn einmal geschlagen hat, nie mehr wirklich vertraut, hatte auch sie dieser Verwandlung nicht getraut. Zu Recht, wie sie beide Male kaum einen Tag später zu spüren bekommen hatte.
Wenn sie allein im Haus saß und lauschte, hörte sie nichts. Was immer er dort tat, tat er absolut geräuschlos. Allerdings hatte er anfangs Verletzungen davongetragen. Nicht, dass er sie ihr gezeigt oder um Hilfe gebeten hätte, aber die weißen Mullverbände an seinen Händen waren kaum zu übersehen gewesen.
Sie hatte schon früh verstanden, wie wenig Sinn es hatte, ihm Fragen zu stellen. Er hatte eben seine Geheimnisse, damit musste sie sich abzufinden. Und warum auch nicht! Sie selbst besaß ja auch einen solchen Raum, nur dass ihrer tief in ihrem Inneren verborgen lag – und sie daher weder Türen noch Drohungen benötigte, um ihr einziges, unerhörtes Geheimnis zu bewahren.
Ihre trotzdem stets wachsende Neugierde, was er eigentlich dort drinnen tat, wurde von ihrer Angst in Schach gehalten. Nicht nur die Angst vor ihm, sondern auch die Angst vor der Antwort auf die Frage selbst. Nicola hatte längst beschlossen, es nicht wissen zu wollen.
Aber sie hatte davon geträumt, und das war schlimm genug gewesen.
Ein Alptraum, aus dem sie schweißgebadet aufgeschreckt war, völlig verängstigt von den Bildern, die sich wie der Rauch einer eben gelöschten Kerze nur sehr langsam auflösten. Kleine Kinder hatte sie gesehen, Jungen natürlich, kaum älter als ein paar Wochen. Mit ihren dicken Bäuchen und Babyspeck an den Ärmchen und Beinchen trieben sie wie menschliche Ballons in mit bläulich leuchtender Flüssigkeit gefüllten, großen Glasbehältern, in denen eigentlich Präparate konserviert wurden. Das dicke, gewölbte Glas wirkte wie eine Lupe und ließ sie unnatürlich groß erscheinen. Ihre Münder waren weit aufgerissen, und perlmuttfarbene Luftblasen lösten sich von ihren Lippen, stiegen empor wie Quallen. Darin gefangen waren ihre hilflosen Schreie, die auch dann stumm blieben, wenn die Blasen an der Oberfläche zerplatzten. Am entsetzlichsten aber waren die Augen; so riesig, so verzweifelt, mit einer einzigen Frage darin:
Warum?
Ihre immer noch vor der Tür schwebende Hand begann zu zittern. Sie nahm sie herunter, schloss die Augen und presste beide Handballen darauf. Die Traumfetzen waren hartnäckig, sie ließen sich nicht so einfach vertreiben. Nicht, wenn sie weiterhin hier herumstehen würde. Außerdem war das Essen fertig, seit fünfzehn Minuten schon, und der Hackbraten würde kalt werden, wenn sie sich nicht endlich traute zu klopfen. Kaltes Essen konnte er nicht ausstehen.
Nicola atmete tief ein und aus, und als sie eben die Hand wieder heben wollte, spürte sie einen kühlen Luftzug auf ihren Wangen.
Sie riss die Augen auf.
In der geöffneten Tür stand er groß und überwältigend vor ihr, und wie immer schrumpfte sie selbst zusammen unter seinem stechenden Blick. Sein rechtes oberes Lid zuckte einmal kurz – sie wusste nur zu gut, was das bedeutete.
Mit beiden Händen stieß er sie weg. Sie taumelte zurück, prallte hart gegen die Wand, schlug mit dem Hinterkopf dagegen und hörte ein trockenes Knacken durch ihren Kopf hallen. Den Schmerz nahm sie kaum wahr, denn in die Benommenheit drängte sich machtvoll ein Bild, das alles andere verblassen ließ.
Denn als er sie gestoßen hatte, war ihr ein Blick über seine linke Schulter hinweg in den Raum hinter ihm gelungen – die Garage lag tiefer als der Rest des Hauses, und er stand auf der unteren von zwei Stufen.
»Belauschst du mich etwa?«, schrie er, trat in den Flur, zog die Tür hinter sich zu und schloss ab. »Spionierst du mir etwa nach?«
Nicola wollte ihrem Mann antworten, ihm sagen, dass das Essen fertig war, doch sie war viel zu benommen und wie gelähmt durch den Anblick, der sich wie ein Abbild der Sonne auf ihren Augen festgebrannt hatte.
Was sie dort gesehen hatte, auf dem ausgeklappten Tapetentisch aus Aluminium … Nein, das konnte nicht sein!
Sie wünschte, nicht hingesehen zu haben.
Sie wünschte, sich getäuscht zu haben.
Ja! Sie hatte sich getäuscht. Ganz sicher!
Wolkenfetzen wischten am Nachthimmel entlang. Im Hintergrund strahlte ein nahezu runder Mond und ließ die zerfransten Ränder der Wolken messerscharf erscheinen. Sein Licht überzog den ansonsten pechschwarzen Straßenbelag mit der bleichen Farbe alter Knochen. Die Schatten kahler Bäume lagen wie Barrieren darauf, und Miriam Singer steigerte sich in die Wahnvorstellung hinein, ihr kleiner Wagen würde dagegen prallen, sich verformen, der Motorblock würde ihre Beine zerquetschen und sie töten. Alles in ihr sträubte sich dagegen weiterzufahren.
Sie nahm den Fuß vom Gaspedal, und der Wagen wurde langsamer. Nervös zuckte ihr Kopf hin und her.
Der Angriff kam überraschend und von allen Seiten. Die Bäume neigten sich zur Fahrbahn hin, riesige Hände griffen nach ihr und kratzten über das Dach des Wagens.
Ein kreischendes Geräusch schallte durch die Nacht, lauter noch als der Schrei, den Miriam selbst ausstieß. Die Fahrbahn platzte auf, und kleine Vulkane spuckten heißen Asphalt empor, der gegen die Windschutzscheibe klatschte. Risse entstanden, dann breite Klüfte. Verzweifelt riss sie am Lenkrad, versuchte, ihren Wagen zwischen diesen dunklen Löchern hindurchzumanövrieren.
Was in Gottes Namen passiert hier?
Kopfschmerz und Schwindel fielen über Miriam her, zusätzlich wurde ihr Gesichtsfeld immer enger, die Straße immer schmaler, bald war sie nicht mehr als ein Grat, zu dessen Seiten tiefe Abgründe lauerten. Ein unmenschliches Geräusch löste sich von ihren Lippen, bevor sie auf das Bremspedal trat und ihr kleines blaues Auto am Straßenrand stoppte. Als der Wagen stand, brach sie über dem Lenkrad zusammen. Weil sie nicht mehr sehen wollte, wie der Wald auf sie zustürzte, schloss sie die Augen. Sie fühlte, wie eine bleierne Müdigkeit sich ihres Körpers bemächtigte, und hatte plötzlich Angst, sterben zu müssen.
Miriam Singer schlug mit ihrer Stirn auf das Lenkrad, wieder und wieder. Die Müdigkeit musste weg, die Bilder mussten weg, das alles konnte doch nicht wirklich sein. Bäume besaßen keine Hände! Bäume konnten nicht nach einem Auto greifen, und Straßen verwandelten sich nicht in Vulkane.
Unvermittelt pochte es an der Seitenscheibe.
Hart und fordernd.
Miriam erschrak, riss den Kopf herum und wich so weit von der Scheibe zurück, wie es in der Enge des Wagens möglich war. Gleißend helles Licht explodierte im Wageninneren, fand ihr Gesicht und steigerte die Schmerzen in ihrem Kopf zu einem wahren Feuerregen heißer Nadelstiche.
Schützend hob sie einen Unterarm vor ihr Gesicht.
»Nein, nicht!«, schrie sie.
Es klopfte wieder, und das grelle Licht wurde zu einem matten Glimmen.
»Kann ich Ihnen helfen?«, fragte eine dumpfe und verzerrt klingende Stimme, die von allen Seiten gleichzeitig in entsetzlicher Lautstärke in ihren Kopf einzudringen schien.
Vorsichtig ließ sie ihren Arm sinken und spähte darüber hinweg, bereit, ihn sofort wieder hochzureißen, sollte sie abermals geblendet werden. Doch obwohl eine weitere Lichtexplosion ausblieb, konnte sie nicht viel sehen. Auf beiden Pupillen pulsierten grelle Lichtflecken.
Die Fahrertür wurde aufgezogen, und ein Schwall kalter Luft schlug Miriam entgegen.
»Geht es Ihnen nicht gut?«
Hinter der Taschenlampe zeichnete sich ein großer Schemen ab, der alles hätte sein können: Mann, Frau, Monster, Dämon. Und da in ihrem Kopf alles drunter und drüber ging, glaubte sie an Letzteres.
»Ich … Ich …«, stotterte sie.
Der Fremde beugte sich ins Auto. »Ich wollte Sie nicht erschrecken, ich dachte nur … Mein Gott! Sie sehen aus, als hätten Sie einen Herzanfall gehabt. Soll ich einen Rettungswagen rufen?«
Er klang besorgt, ehrlich besorgt, und Miriams Misstrauen begann zu schmelzen.
Sie schüttelte den Kopf.
»Nein … Ich weiß auch nicht … Ich kann mich nicht bewegen.«
Sie konzentrierte sich auf das Gesicht, doch es blieb ein undeutlicher heller Fleck im Dunkel. Lichtpunkte tanzten noch immer auf ihren Pupillen, und Tränen verschleierten den kümmerlichen Rest ihrer Sehkraft.
»Kommen Sie! Steigen Sie aus, und atmen Sie tief durch. Ich helfe Ihnen, kommen Sie!«
Er löste den Gurt und kam ihr dabei ganz nah. Sie konnte teures, intensives Parfum riechen. Schlagartig wurde Miriam etwas klar: Dies war jetzt der Moment, vor dem sie sich schon immer gefürchtet hatte, für den sie Woche für Woche das harte Training auf sich nahm. Sie war die Beste, der Liebling ihres Trainers, sie war gewappnet und musste sich nicht fürchten … Was für ein Selbstbetrug, was für eine billige Täuschung. Ein plötzlicher Schwächeanfall, eine Erkrankung, was auch immer, und sie war wieder das kleine schutzlose Mädchen, so wie früher.
Da sie ihre Hand nicht bewegte, griff er einfach zu, umschloss ihr Handgelenk und zog daran.
»Keine Angst. Ich tue Ihnen nichts.«
Ein kräftiger Ruck, und schon stand sie neben ihrem Wagen. Der Mann lehnte sie gegen die hintere Tür. Er stand jetzt ganz dicht bei ihr, so dicht, dass sie seinen Atem spüren konnte. Außerdem drückte er sein Becken gegen ihres, vielleicht, damit sie nicht umkippte.
Vielleicht.
Miriam wischte sich mit dem Handrücken über ihre Augen, und als sie sie wieder öffnete, zuckte sie zurück. Plötzlich hatte der Mann ein Gesicht! Eines, das ihr vage bekannt vorkam. Aber das konnte nicht sein! Wieso sollte ausgerechnet er …
»Geht’s wieder?«, fragte der Fremde.
Das Gesicht verschwand, zurück blieb ein weites, leeres Nichts, das sich mit Schwärze zu füllen begann.
»Ich … muss mich hinsetzen«, flüsterte Miriam und sank zu Boden. Noch bevor sie den Asphalt berührte, hatte sie das Bewusstsein verloren.
»Vier von hundert!«
Die Dozentin, Frau Doktor Barbara Sternberg, legte eine Kunstpause ein. Sie griff nach dem Wasserglas auf dem Tisch vor sich, nippte daran und ließ den anwesenden Zuhörern und Zuhörerinnen genügend Zeit, sich mit dieser Zahl vertraut zu machen.
»Vier von hundert«, wiederholte sie dann unnötigerweise und, wie Nele Karminter fand, etwas effektheischend.
Aber es verfehlte seine Wirkung nicht. Große, fragende Augen, Kopfschütteln, Tuscheln und hastiges Notieren sprachen Bände. Nele ließ ihren Blick durch den Raum schweifen. Darin saßen fünfundzwanzig erfahrene und hartgesottene Polizistinnen und Polizisten. Letztere waren in diesem Fortbildungskurs klar in Unterzahl: sechs von fünfundzwanzig, wie Frau Doktor wohl gesagt hätte. Sie alle wühlten tagtäglich in den dunkelsten Abgründen menschlichen Verhaltens, und sie alle waren schockiert von dieser banalen Zahl.
Nele Karminter selbst war es auch gewesen, nachdem sie sie vor ein paar Wochen zum ersten Mal gehört hatte. Auch heute fühlte sie sich bei der Vorstellung alles andere als wohl. Diese Zahl besagte nämlich nichts anderes, als dass sie den Krieg schon verloren hatten. Nicht jeden einzelnen Kampf, auf keinen Fall, dann würde sie nicht nach Feierabend hier sitzen. Aber einen finalen, alles entscheidenden Sieg würde es nicht geben. Nicht gegen diese Legion.
»Ich weiß, was jetzt in Ihren Köpfen vorgeht, meine Damen und Herren. Ich weiß es sehr gut, glauben Sie mir. Doch so unvorstellbar Ihnen diese Zahl auch vorkommen mag, sie ist wissenschaftlich belegt. Sie ist Fakt. Vier von einhundert Menschen haben kein Gewissen. Wir Psychologen bezeichnen das als antisoziale Persönlichkeitsstörung und solche Menschen als Soziopathen, geläufiger ist jedoch der Ausdruck Psychopath. Vier von hundert, meine Damen und Herren. Man könnte auch sagen: einer von fünfundzwanzig.«
Barbara Sternberg war eine schlanke, hochgewachsene Frau von circa eins achtzig. Der Schnitt ihres brünetten, nicht ganz schulterlangen Haares wirkte etwas altmodisch, passte aber perfekt zu ihrer seriös-eleganten Kleidung. Sie trug eine weiße Bluse zu einem schmal geschnittenen, schwarzen Hosenanzug, einzig das violette Halstuch bildete einen farbigen Kontrast. Nele schätzte sie auf Mitte vierzig. Sie hatte Lachfalten um die weit auseinanderstehenden Augen, und dass sie lachen und scherzen konnte, hatte sie in der bereits vergangenen Stunde des Seminars bewiesen. Jetzt aber behielt sie ihren ernsten Gesichtsausdruck bei, und Nele brauchte ein paar Sekunden, bis sie darauf kam, weshalb.
Natürlich!
Nicht einmal die Teilnehmerzahl dieses Seminars, das die Landesregierung ihren Beamten und Beamtinnen außerhalb der regulären Dienstzeit sponserte und das den Titel »Der unerkannte Soziopath« trug, war zufällig. Zeitgleich mit Nele erkannten auch einige andere, worauf Dr. Sternberg hinauswollte. Eine Frau mit rotem Haar lachte lauthals auf. Sie hatte ein kehliges, fast schon männliches Lachen und zog damit die Blicke auf sich.
»Sie haben es erkannt, nicht wahr?«, sagte Dr. Sternberg. »Nach dem heutigen Wissensstand befindet sich unter uns ein Psychopath oder eine Psychopathin.«
Gelächter. Stuhlbeine scharrten über den Fußboden. Jemand hustete.
»Sehen Sie sich um, meine Damen und Herren. Sehen Sie Ihren Nachbarn oder Ihre Nachbarin an. Sie alle haben sich im Laufe Ihrer Dienstzeit immense Menschenkenntnis angeeignet. Sie spüren schon im Ansatz, ob Ihnen jemand die Wahrheit sagt oder nicht. Also, wer ist es? Wer von Ihnen hat kein Gewissen? So ein eklatanter Mangel müsste uns doch von der Stirn des Betroffenen entgegenschreien.«
Plötzlich war es mucksmäuschenstill, und keiner traute sich, jemand anderen anzuschauen. Die Blicke richteten sich auf die Tür, den Tisch, die eigenen Finger oder den Kugelschreiber, der dazwischen tänzelte.
»Zeig dich!«, rief Doktor Sternberg plötzlich laut, und sogar Nele erschrak.
Alle Ernsthaftigkeit verschwand aus dem Gesicht der Psychologin, und sie lächelte offen und herzlich.
»Da jetzt alle wach und auf der Hut sind, schlage ich vor, wir legen eine Pause von fünfzehn Minuten ein. Stärken Sie sich, und schnappen Sie frische Luft. Nach der Pause wollen wir herausfinden, wie wir den Psychopathen unter uns entlarven können – denn freiwillig oder auf Zuruf wird er oder sie sich nicht zeigen. Danke!«
Der Applaus war mehr als angemessen. Länge und Lautstärke spiegelten wider, wie die Teilnehmer des Kurses sich fühlten: Sie waren aufgewühlt. Frau Dr. Sternberg hatte sie direkt bei ihren eigenen Ängsten gepackt.
Während sich alle anderen erhoben – am schnellsten die Raucher –, blieb Nele sitzen und beobachtete. Jetzt, in dem allgemeinen Durcheinander, machten heimlich abschätzende Blicke die Runde. Der Samen war bereits aufgegangen: Man suchte nach einem Verdächtigen, jeder für sich.
Nele hatte sich bereits vor drei Monaten für diese Fortbildung angemeldet. Allerdings war sie gerade in den letzten beiden Wochen kaum einmal zum Ausschlafen gekommen, geschweige denn zum Sport oder ins Kino, und schon heute früh beim Aufstehen hatte sie sich darüber geärgert, nach Feierabend noch zum Seminar zu müssen. Sie war urlaubsreif. Die Überlastung machte sich bereits in andauernder Müdigkeit bemerkbar, und das war nicht gut. Jetzt allerdings bereute sie es nicht mehr, diese zusätzlichen zwei Stunden investiert zu haben. Die Frau war wirklich gut, und ihre sympathische Ausstrahlung machte es Nele leichter, eine Entscheidung zu treffen, die sie schon seit Monaten vor sich herschob.
Als der Raum sich geleert hatte, erhob Nele sich, ging zum Pult hinüber und streckte ihre Hand aus.
»Nele Karminter, Hauptkommissarin bei der Kripo Lüneburg. Haben Sie vielleicht eine Minute Zeit für mich?«
Frau Sternberg ergriff ihre Hand und sah Nele fragend an. »Außerhalb des Seminarthemas, nehme ich an?«
Nele nickte. »Es geht eher um etwas Privates. Ich bräuchte den Rat einer Expertin, ohne eine aufsuchen zu müssen … Wenn Sie verstehen, was ich meine.«
Dr. Sternberg lächelte und schüttelte den Kopf. »Nicht so richtig, aber Sie werden es mir erklären, denke ich. Dauert es lang?«
»Eine halbe Stunde.«
»Nun, das bekommen wir in der Pause nicht hin, und nach Ende des Seminars wird es mir zu spät, da habe ich schon etwas vor.« Sie dachte einen Moment nach. »Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Wie wäre es, wenn wir uns morgen Vormittag treffen? Ich bin noch übers Wochenende in der Stadt und könnte es einrichten.«
Innerlich stöhnte Nele auf. Morgen war ihr erster freier Samstag seit drei Wochen, und sie hatte sich darauf gefreut. Noch länger aufschieben wollte sie die Sache aber auch nicht.
»Okay«, sagte sie. »Aber nur, wenn es Ihnen wirklich nichts ausmacht.«
Sie verabredeten sich für neun Uhr in dem Café gleich gegenüber dem Präsidium.
Nele bedankte sich und wandte sich ab, um den Seminarraum zu verlassen.
»Soko Schranke, nicht wahr?«, rief Frau Dr. Sternberg ihr nach.
Den Begriff hatte Nele schon länger nicht mehr gehört, doch immer noch sorgte er dafür, dass sie zusammenfuhr.
»Richtig«, sagte sie, ohne sich umzudrehen, verließ eilig den Raum und folgte den anderen Teilnehmern in die Lobby.
Dort herrschte ein ordentlicher Lärmpegel. Die, die nicht vor der Tür rauchten, standen mit einem Kaffeebecher in der Hand in Gruppen herum und führten angeregte Gespräche. Nele holte sich ebenfalls einen Kaffee und stopfte sich dabei einige Schokoladenkekse in den Mund – sie hatte mal wieder das Abendessen verpasst und spürte ein unangenehmes Ziehen im Bauch.
Kauend gesellte sie sich zu einer Gruppe Kollegen, in der sie zwei Gesichter kannte; woher, fiel ihr auf die Schnelle nicht ein. Entweder waren ihr die junge Frau und der ältere Mann bei irgendeiner Ermittlung oder aber in dem riesigen Gebäude der Polizeiinspektion Lüneburg über den Weg gelaufen.
»Wir rätseln natürlich eifrig, wer unter uns der Psychopath ist«, sprach die junge Frau sie an.
»Oder die Psychopathin«, vervollständigte ein Kollege, den Nele nicht kannte. Er war groß und dick. Speckfalten stauten sich über seinem blauen Hemdkragen. Schmale Augen in einem feisten Gesicht taxierten sie, in ihrer Unhöflichkeit noch unterstützt von einem anzüglichen Lächeln. »Wie sieht’s aus, Frau Kollegin? Sie haben doch schon Erfahrungen gesammelt. Wie erkennt man einen Psychopathen?«
Nele trank von dem schlechten Kaffee und spülte die letzten Kekskrümel hinunter. Sie blickte etwas länger als notwendig in die Tasse. Es war klar, worauf der Dicke hinauswollte, und der kaum versteckte Vorwurf in seiner Stimme sollte alle daran erinnern, dass sie den Psychopathen damals eben nicht erkannt hatte. Zumindest nicht, bevor er ihren Kollegen Tim Siebert getötet hatte.
Schließlich sah sie dem Dicken direkt in die Augen. »Wenn er Sie tötet, dann wissen Sie es genau.«
Dem Kollegen gefror sein arrogantes Lächeln. Er hielt Neles Blick noch einen Moment stand, dann wandte er sich ab, um woanders ein Gespräch zu beginnen, in dem er den Ton angeben konnte.
»Ich glaube, er ist es«, flüsterte die Kollegin, stellte sich als Tanja Schildknecht vor und streckte Nele die Hand entgegen.
Nele ergriff sie und betrachtete die junge Frau. Sie war höchstens achtundzwanzig, einen Kopf kleiner als sie selbst, trug ihr Haar zu einem Pferdeschwanz gebunden und blinzelte ihr aus wachen braunen Augen zu. Über ihr Kinn zog sich der helle Strich einer Narbe.
Plötzlich wusste sie auch wieder, wo sie die beiden hinstecken sollte.
»Sie gehen bei häuslicher Gewalt vor, oder?«
Tanja Schildknecht nickte. Ihr Kollege streckte ebenfalls die Hand aus und stellte sich als Hartmut Siek vor. Ein Mittvierziger mit vollem, dunkelblondem Haar, Dreitagebart und mürrischem Gesichtsausdruck.
»Wie gefällt es Ihnen bisher?«, fragte Nele.
»Super! Die Sternberg macht das echt gut. Da bleibt jede Info haften.«
»Ich kann mir vorstellen, dass Sie es in Ihrem speziellen Bereich mit einigen Psychopathen zu tun bekommen.«
Tanja schüttelte den Kopf, und ihr Pferdeschwanz schwang eifrig mit, als wolle er die Geste unterstreichen.
»Die meisten sind nur echt verzweifelte Menschen, richtig arme Säue, wenn Sie verstehen, was ich meine. Die haben nie gelernt, ihre Probleme durch Kommunikation zu lösen, also prügeln sie. Das rechtfertigt natürlich nicht ihr Verhalten, aber es ist zumindest eine Erklärung. Aber so einen richtig eiskalten Typen, der seine Frau schlägt, weil es ihn befriedigt … Das ist selten. Ich hatte bisher nur einen solchen Fall. Die Meyers … Weißt du noch, Hartmut?«
Hartmut Siek nickte, schien zu dem Gespräch aber nichts beitragen zu wollen.
»Aber der Schrankenmörder, der war doch ein Psychopath, oder?«, fragte Tanja leise.
Und wieder wurde Nele an Karel Murow erinnert, der auf die eine oder andere Art wohl immer Bestandteil ihres Lebens bleiben würde. Er hatte ihre Lebensgefährtin Anouschka Rossberg damals in die Katakomben von Eibia tief im Wald und unter der Erde verschleppt und schwer verletzt. Sie hatte mit viel Glück überlebt, aber der Schrecken verfolgte sie bis heute.
Nele hatte versucht, die Erinnerung zu verdrängen, doch das war nicht möglich. Nicht in diesem Umfeld.
Sie schüttelte den Kopf. »Ehrlich gesagt … Ich weiß es bis heute nicht. Keine Ahnung, was er war. Deshalb bin ich ja hier. Um diese Menschen besser verstehen und einschätzen zu können.«
Tanja nickte. »Ich auch. Aber manchmal frage ich mich, ob ich diese Leute überhaupt verstehen will.«
Nele sah der jungen Frau in die Augen. Sie entdeckte darin die gleiche Angst, die sie in sich selbst spürte.
Die Angst vor der Bestie Mensch.
Zwei Stunden lang hatte Alexander Seitz konzentriert eine Mail nach der anderen gelesen, und trotzdem hatte er noch nicht einmal ein Drittel des Postfachs geschafft. Jetzt hatte er die Schnauze voll von dem Kinderkram, außerdem tat ihm der Rücken weh, seine Augen brannten, und das Verlangen nach Alkohol wurde immer stärker.
Er lehnte sich nach hinten und streckte die Arme über den Kopf. Mit einer raschen Bewegung ließ er die Halswirbel laut knacken. Dann drehte er sich um, weil er meinte, hinter sich eine Bewegung wahrgenommen zu haben. Natürlich hatte er sich getäuscht. Er war allein in seiner Hütte, wie meistens.
Er brauchte dringend einen Whisky!
Alex griff nach dem leeren Glas vor sich. Dabei blieb sein Blick an dem Teller hängen, auf dem von seinem natürlich vor dem PC eingenommenen Abendessen noch eine mit Käse belegte Scheibe Brot übrig geblieben war, deren vertrocknete Ränder sich nun nach oben bogen. Alex nahm den Teller mit und kippte das Brot in den Mülleimer, aus dem ihm ein Schwall üblen Gestanks entgegenschlug. »Scheiße!«, fluchte er und klappte schnell den Deckel wieder zu. Dann schnappte er sich den Eimer und brachte ihn hinaus auf die Terrasse. Es war bitterkalt. Die paar Sekunden nur im T-Shirt reichten für ein unangenehmes Frösteln.
Zurück in der Küche entschied er sich spontan gegen einen weiteren Drink, tat stattdessen einen großen Löffel Instantkaffee in eine Tasse und setzte Wasser auf. Während er wartete, dass es kochte, dachte er darüber nach, was er bisher erreicht hatte.
Er gab es nicht gern zu, aber eigentlich war das so gut wie nichts. Der Rechner des Mädchens war total zugemüllt und unstrukturiert. Es würde noch Tage dauern, allein die Mails zu sichten, dabei kotzte ihn das belanglose Palaver jetzt schon an. Wer liebt wen, wer hasst wen, welche Promis ficken zusammen. Als ob die Welt keine anderen Probleme hätte.
Aber gut, er bekam eine Stange Geld dafür, also musste er da durch. Und wenn er etwas machte, dann richtig. Er würde keine einzige Mail auslassen, weil jede die Information enthalten konnte, nach der er suchte.
Das Wasser kochte. Alex übergoss das Kaffeepulver und kehrte mit der Tasse in der Hand ins Wohnzimmer zurück.
In seiner kleinen Hütte, die als Wochenendhäuschen gebaut worden war, war dies der größte Raum, und er nutzte ihn als Büro, Wohn- und Esszimmer zugleich. Ansonsten gab es nur noch ein Bad und ein winziges Schlafzimmer, in dem man nicht aus dem Bett fallen konnte, weil es zwischen Wänden eingepfercht stand. Aber die Enge störte ihn nicht, denn sobald er die Hütte verließ, erstreckten sich zwei Hektar unbebaute Naturlandschaft vor seinen Augen – Platz genug, um durchzuatmen
Er ließ sich in den Drehstuhl fallen, trank von dem noch viel zu heißen Kaffee und öffnete die nächste Mail.
Sie stammte von einem gewissen Indigo15, natürlich ein Nickname, also konnte sowohl Weiblein als auch Männlein dahinterstecken. Der Schreibstil ließ darauf keinen Rückschluss zu – insofern man überhaupt noch von Schreibstil sprechen konnte. Eher war es eine Anhäufung von Kürzeln, unvollständigen Sätzen oder so unglaublich falsch geschriebenen Wörtern, dass es schon an Körperverletzung grenzte. Wie in den hundertvierzig anderen Mails, die er bisher gelesen hatte, ging es auch hier wieder nur um Musik und die nächsten geilen Partys. Typischer Teenagerkram.
HDGDL Bye Indi!
»Du mich auch«, sagte Alex und klickte die Mail weg.
Die achtzehnjährige Daniela Victoria Gerstein, wohnhaft in dem kleinen Nest Beckedorf am südlichen Rand der Heide, war seit einem Monat verschwunden. Aufgewachsen in gut situiertem Haus, hervorragende Schulnoten, beste Aussichten fürs Abi, scheinbar keine schwerwiegenden Probleme. Während seines ersten Gesprächs mit den Eltern, Siegfried und Elke Gerstein, hatte Alex erfahren, dass von Seiten der Polizei das übliche Programm abgespult worden war. Die Beamten hatten natürlich ebenfalls den PC des Mädchens sowie ihr Zimmer durchsucht und Freunde und Bekannte befragt. Viel mehr war nicht drin, wenn eine Volljährige verschwand, auch wenn sie gerade erst achtzehn geworden war. Streng genommen konnte Daniela frei entscheiden, wo sie sich aufhalten wollte.
Außerdem verschwanden in Deutschland täglich zwischen einhundertfünfzig und zweihundertfünfzig Menschen, viele davon Jugendliche, und die meisten tauchten nach ein paar Tagen wieder auf, um sich doch wieder von Mama bekochen zu lassen. Weitere achtzig Prozent aller Vermisstenfälle erledigten sich binnen eines Monats.
Bei Daniela war es anders.
Der magische Monat war abgelaufen, und es gab keine Spur. Man hatte versucht ihr Handy zu orten, doch das war ausgestellt. Einen eigenen Wagen, nach dem man hätte fahnden können, besaß sie nicht. Kein Anruf, keine Karte, kein Lebenszeichen, nur eine Mutter, die fühlte, dass ihrer Tochter etwas passiert sein musste.
Also hatten die Eltern einen Privatdetektiv engagiert. Einen, der in dem Ruf stand, jeden zu finden. Sie hatten Alex bereitwillig den PC ihrer Tochter überlassen und den üblichen Vorschuss von zweitausend Euro bezahlt.
Das war vorgestern gewesen. Aber einen Hinweis, wo er mit der Suche ansetzen sollte, hatte Alex noch nicht. Er war an der Schule gewesen und hatte mit Freunden und Freundinnen geredet. Sie hatten ihn abblitzen lassen und gemeint, Daniela hätte schon ihre Gründe und man solle sie in Ruhe lassen, vor allem ihre spießigen Eltern.
Alex hegte den Verdacht, ein paar von denen wussten, wo Daniela sich aufhielt, würden es ihm jedoch genauso wenig verraten wie der Polizei. Im Moment sah es danach aus, als sei das Mädchen tatsächlich vor ihren Eltern geflüchtet. Dafür sprachen auch die Informationen, die Alex von ihrem Klassenlehrer am Gymnasium bekommen hatte.
Nach dessen Einschätzung war Daniela ein introvertiertes, sehr intelligentes Mädchen, das sogar selbst Geschichten verfasste. Die, die er im Rahmen seines Unterrichts beurteilt hatte, waren sehr gut gewesen, und in einem kurzen Gespräch hatte sie ihm von ihrem Traum erzählt, Schriftstellerin zu werden. Ein Wunsch, den der Vater als pubertäre Spinnerei abtat.
Alex hatte davon erst nach dem Gespräch mit den Eltern erfahren und sie darum noch nicht darauf ansprechen können, aber so, wie er Siegfried Gerstein, der von Beruf Finanzbeamter war, einschätzte, war es für ein stilles, künstlerisch begabtes, sensibles Mädchen in dem Haushalt nicht einfach. Zuspruch dürfte sie für ihre Leidenschaft nicht gefunden haben. Also hatte sie höchst wahrscheinlich woanders danach gesucht. Wo, das durfte er jetzt herausfinden, und wenn er es herausgefunden hatte, hatte er auch das Mädchen.
Alex trank erneut einen Schluck Kaffee und wollte zur Abwechslung gerade einen Ordner mit der Bezeichnung »Rechnungen« öffnen, als es an der Haustür klopfte.
Misstrauisch zog er die Augenbrauen zusammen.
Kaum jemand wusste, dass er hier lebte, und spontane Besuche bekam er so gut wie nie, schon gar nicht um diese Uhrzeit. Die Wege hier raus waren dunkel, einsam und sehr kurvig.
Er stand auf, durchquerte das Wohnzimmer, betrat den winzigen Flur und schaltete die Außenbeleuchtung ein. Die Haustür hatte einen Glaseinsatz, und dank der spärlichen Beleuchtung zeichnete sich darin ein merkwürdig deformierter Körper ab.
Es klopfte erneut.
Alex drehte den Schlüssel herum und öffnete die Tür.
Jördis stand davor und lächelte ihn an. Trotz der späten Stunde strahlte sie wie immer vor Energie. Ihre grau-grünen Augen leuchteten im Licht der Lampe. Sie trug enge Bluejeans sowie ein graues Oberteil aus Wolle, das ihr bis über die Hüfte reichte und in der schmalen Taille von einem braunen Ledergürtel gerafft wurde. Über ihrer rechten Schulter hing eine große Sporttasche – was die Deformation erklärte.
»Störe ich den alten Herrn zu so später Stunde?«, fragte sie.
Alex warf einen demonstrativen Blick auf seine Armbanduhr.
»Ich hatte Essen auf Rädern erwartet oder die nette Dame vom Pflegedienst … Aber was soll’s, die Putzfrau tut’s auch.«
Sie kam ganz dicht heran. Er konnte ihren warmen Atem spüren, der nach Alkohol roch.
»Pass auf, was du sagst, Alter, so ein junges Küken wie mich bekommst du nicht nochmal.«
Jördis war zweiundzwanzig – und damit dreizehn Jahre jünger als er –, sah aber aus wie achtzehn. Sie hatte eine knabenhafte Figur und trug ihr blondiertes Haar sehr kurz. Mit ihren eins achtundsiebzig war sie nur zwei Zentimeter kleiner als Alex, und das machten die hohen Absätze ihrer Stiefel mehr als wett, sodass sie sich Auge in Auge gegenüberstanden. Sie war nicht mehr nüchtern, und diese laszive, enthemmte Stimmung, in der sie sich befand, machte sie noch reizvoller als ohnehin schon.
»Warum hast du nicht angerufen? Ich hätte dich vom Bahnhof abgeholt.«
»Dann wäre es ja keine Überraschung mehr gewesen … Außerdem hat mich schon jemand abgeholt.«
»Wer?« Klang das ein bisschen zu forsch?, fragte Alex sich.
»Carla. Wir haben auf ihre bestandene Prüfung angestoßen.«
»Wow! Und das nach nur fünfhundert Fahrstunden.«
Endlich erreichten ihre Lippen seine, und sie küssten sich in der geöffneten Tür.
»Lässt du mich rein?«, fragte Jördis.
Alex löste sich nur widerwillig von ihr, trat zurück und ließ sie ins Haus. Noch auf dem Flur ließ sie die schwere Sporttasche zu Boden fallen.
»Was hast du da drin, deinen Hausstand?«
»Was dagegen, wenn ich ein paar Tage bei dir bleibe?«
»Auf keinen Fall.«
Mit einem Ruck drehte sie sich um, presste ihn gegen die Tür und küsste ihn leidenschaftlich. Sie selbst schafften es gerade noch bis ins Schlafzimmer. Ihre Kleider nicht mehr.
Das bleiche Antlitz des Mondes lauerte riesenhaft hinter der schwarzen Armee der Bäume. Immer noch waren sie hinter ihr her, streckten ihre Äste nach ihr aus und versuchten sie zu fangen. Ein unheimliches Geräusch ging von ihnen aus. Ein zunächst unterschwelliges Raunen, das sich aber schnell zu dem wütenden Knurren eines hungrigen Wolfes steigerte. Es war ganz dicht bei ihr, drang in sie ein, sie schwebte auf dem dunklen Timbre der tiefen Stimme und sah das weit aufgerissene Maul mit den Fangzähnen vor sich.
In diesem Moment erwachte Miriam Singer, und das Knurren des Wolfes verwandelte sich in das gleichmäßige Brummen eines Automotors.
Sie lag auf der Rückbank, die Beine angewinkelt, den Kopf nach rechts gedreht. Speichel lief ihr aus dem Mundwinkel. Jemand hatte eine muffig riechende Decke über sie ausgebreitet, doch die war von ihrem Gesicht gerutscht, sodass sie etwas sehen konnte.
Das bläuliche Licht der Armaturen ließ den Fahrzeughimmel über ihr gespenstisch schimmern. Es reichte aus, um die Hand zu erkennen, die oben auf der Rückenlehne des Beifahrersitzes lag. Eine kräftige, gebräunte Hand mit einem goldenen Ring auf dem Ringfinger. Ganz ruhig und entspannt lag diese Hand dort, einen Finger um den metallenen Stab der Nackenstütze geschlungen. Miriam bewegte vorsichtig ihren Kopf und erhaschte einen Blick auf die Silhouette des Fahrers. Dessen Haar war dunkel und voll und glänzte bläulich. Er hatte kräftige Kiefer, mehr konnte sie aus ihrer Position nicht erkennen.
Die Gedanken wirbelten ihr nur so durch den Kopf.
Sie war entführt worden. Sie würde vergewaltigt und ermordet werden, es sei denn, sie konnte flüchten.
Wo war ihr Handy?
Wo hatte sie es nach dem Training gelassen?
Sie sah sich im Umkleideraum auf der Bank vor den Spinden sitzen, sah sich die Wasserflasche aus der Sporttasche nehmen und einen großen Schluck trinken. Sie war völlig ausgelaugt gewesen, so wie immer. Hatte sie das Handy aus der Tasche genommen? Dieser Automatismus, nach einem Anruf oder einer SMS zu sehen, entzog sich oft der Erinnerung, aber Miriam meinte, genau das getan zu haben. Und danach? Wahrscheinlich war das Handy wieder in der Tasche gelandet.
Oder doch in der Trainingsjacke?
Miriam bewegte die rechte Hand. So langsam, dass es ihr wie eine Ewigkeit vorkam, bis sie endlich die seitlich an der Trainingsjacke angebrachte Tasche erreichte. Die Enttäuschung hätte nicht größer sein können. Das Handy war nicht da. Sie wiederholte die Prozedur auf der linken Seite mit demselben Ergebnis.
Was nun?
Denk nach, denk nach, denk nach! Frauen sterben, weil sie den Kopf verlieren, weil sie nicht ruhig bleiben, weil sie in solchen Situationen nicht strukturiert denken, du weißt das!
Nicht in Panik geraten war das erste und wichtigste Gebot.
Waren die hinteren Türen verriegelt?
Miriam wagte es, hob den Kopf ein klein wenig an, konnte aber keinen Verriegelungsknopf sehen. Wahrscheinlich war es ein neuerer Wagen, bei dem nur noch kleine rote Lämpchen anzeigten, ob die Türen verschlossen waren. Egal. Solange er so schnell fuhr, konnte sie ohnehin nicht hinausspringen.
Sie ließ den Kopf wieder sinken, blinzelte aus halb geschlossenen Lidern zum Dach empor und bemühte sich, nicht in Panik zu verfallen. Obwohl sie so angespannt war, schlug ihr Herz auffallend langsam. Außerdem schwitzte sie nicht; sogar ihr Mund war völlig ausgetrocknet, die Lippen klebten aneinander. Irgendetwas stimmte nicht mit ihr. Vorhin dieser alles überwältigende Alptraum, von den Bäumen angegriffen zu werden, nur noch auf einem schmalen Grat zu fahren, und dann … Sie musste das Bewusstsein verloren haben, denn sie konnte sich nicht daran erinnern, wie sie in diesen Wagen gekommen war.
Plötzlich verschwand die Hand vom Beifahrersitz. Der Mann drehte den Kopf, warf ihr einen Blick zu, sah dann sofort wieder nach vorn, betätigte den Blinker und schaltete die Gänge herunter. Hatte er bemerkt, dass sie wach war? Miriam glaubte es nicht. Dafür war es hier hinten zu dunkel und sein Blick war zu flüchtig gewesen. Es konnte nur von Vorteil für sie sein, wenn er weiterhin glaubte, dass sie ohne Bewusstsein war.
Der Wagen wurde langsamer. Das zuvor gleichmäßige Summen der Reifen auf Asphalt wurde abgelöst von Knirschen und Holpern. Er hatte die Straße verlassen und war auf einen unbefestigten Weg abgebogen. Miriams Magen zog sich zusammen. Ein unbefestigter Weg konnte nur bedeuten, dass sie sich fernab der Stadt und fernab irgendwelcher Häuser befanden. Auf sich aufmerksam machen war das zweite Gebot, doch das konnte sie vergessen, wenn es in der Nähe niemanden gab, der ihre Schreie hören würde.
Blieb nur noch das dritte und letzte Gebot: Nicht zum Opfer werden!
Obwohl die Angst in ihr immer mehr Raum einnahm, wollte Miriam sich unbedingt an die Gebote ihres Trainers halten und alles dafür tun, damit der Fremde kein leichtes Spiel mit ihr haben würde.
Der Wagen hielt, der Motor erstarb.
Sie hörte, wie der Zündschlüssel abgezogen wurde, dann kehrte Stille ein. Der Mann saß einfach nur da, schien nicht einmal mehr zu atmen. Auf was wartete er? Beobachtete er die Umgebung, um sich davon zu überzeugen, dass er allein war?
Miriam drückte sich schmerzhaft die Fingernägel in die Handballen und presste die Kiefer fest aufeinander, versuchte so, das Zittern zu unterdrücken.
Immer wenn das Mondlicht die zerrissene Wolkendecke durchbrach, wurde es etwas heller im Wagen, und sie hätte die Chance gehabt, einen Blick auf den Fremden zu werfen. Doch sie traute sich nicht, ihre Augen mehr als nur einen schmalen Spalt zu öffnen.
Der Mann bewegte sich und brachte den Wagen ins Schaukeln. Sie spürte ihn ganz nahe, konnte seinen leisen Atem hören. Er starrte sie an, wollte herausfinden, ob sie noch bewusstlos war.
Ruhig, ganz ruhig, hier im Auto wird er dir nichts tun …
Miriam konzentrierte sich, ließ ihren Atem ruhig und gleichmäßig fließen. Stoisch ertrug sie seinen nicht enden wollenden Blick. Eine Minute lang fraß er sich in ihre Eingeweide, und währenddessen meinte sie sogar, den Hass zu spüren, den er für sie empfand.
Dann wandte er sich ab, stieß die Tür auf und stieg aus.
Miriam wagte einen schnellen Blick. Sie sah nur den Umriss des Mannes neben dem Wagen, wo er wieder minutenlang stehen blieb, während die Panik immer stärker wurde in ihr.
Du schaffst das, du schaffst das, er ist dir nicht gewachsen, wiederholte sie in Gedanken immer wieder. Ein Mantra zu haben war wichtig, hatte ihr Trainer Cem gesagt. Ein Mantra ließ keinen Raum für Zweifel und Angst, keinen Raum für destruktive Gedanken, motivierte das Unterbewusstsein und lenkte den Fokus auf ein bestimmtes Ziel. Boxer gingen auch so vor, hatte er behauptet.
Er tauchte an der hinteren Tür auf, öffnete sie und beging damit genau den Fehler, auf den Miriam gehofft hatte.
Erst als er sich ins Wageninnere beugte und eine Hand auf ihren Unterschenkel legte, hob sie den Kopf, orientierte sich kurz und stieß dann mit aller Kraft zu. In ihren Oberschenkelmuskeln steckte eine Menge Kraft. Drei Mal die Woche zehn Kilometer laufen hatte harte Muskeln geformt.
Sie trat ihm mit voller Wucht gegen die Brust.
Mit einem Ächzen verschwand er aus dem Wageninnern.
Auch sie robbte hinaus.
Lang hingestreckt lag er neben dem Wagen und rührte sich nicht. Ob sie ihn ernsthaft verletzt hatte, konnte Miriam nicht erkennen, aber für den Moment war er kampfunfähig, und das musste sie ausnutzen.
Weg!
Sofort!
Doch da trat er schon nach ihr und erwischte sie am Schienbein. Er trug Stiefel mit harter Sohle, der Tritt war äußerst schmerzhaft.
Miriam schrie auf, laut und gellend. Ihr Schrei hallte ein paar Mal wider, so als befände sie sich zwischen Gebäuden. Sie taumelte ein paar Schritte von ihm weg und schrie um Hilfe. Vielleicht lebten ja doch Menschen hier!
Der Mann kam nur mühsam auf die Knie, schaffte es aber aufzustehen. Er war groß, seine Haltung signalisierte Kraft und Entschlossenheit. Obwohl Miriam wusste, dass sie längst hätte abhauen sollen, hatte sie plötzlich nur noch Augen für ihn. Sie fühlte sich in seinem Blick gefangen wie eine Maus in dem einer Schlange. Seine Augen leuchteten, als schlügen Flammen aus seinen Pupillen.
Nein, nein, nein, das bildest du dir nur ein.
Unvermittelt stürzte er auf sie zu, aber Miriam hatte mit dem Angriff gerechnet und konnte jetzt die Techniken abrufen, die sie in unzähligen Trainingseinheiten erlernt hatte, die zu einem Automatismus geworden waren. Mit einer schnellen Bewegung stellte sie sich seitlich zu ihm, packte seinen ausgestreckten rechten Arm, nutzte seinen Schwung aus und schleuderte ihn zu Boden. Sofort setzte sie nach, denn wer aus Mitleid abwartete, hatte schon verloren. Ihr erster Tritt traf ihn in den Bauch. Der zweite seinen Oberschenkel, und das tat ihr wahrscheinlich mehr weh als ihm.
»Du Wichser!«, schrie sie ihre Wut und Angst hinaus. »Das hast du dir so gedacht, du erbärmlicher Feigling!«
Den nächsten Tritt platzierte sie in seine Weichteile und legte all ihre Kraft hinein. Diesmal gab er ein lautes Stöhnen von sich und rollte sich zusammen.
Miriam wollte gar nicht wissen, wie schwer sie ihn verletzt hatte. Sie drehte sich um und lief.
»Sie haben ihn in der Pause nicht ausfindig machen können und erwarten jetzt, dass ich den Soziopathen enttarne, richtig?«
Im Seminarraum hätte man eine Stecknadel zu Boden fallen, hätte wahrscheinlich sogar noch den Hall hören können. Frau Dr. Sternberg stand mit vor der Brust verschränkten Armen an das Pult gelehnt da und ließ ihren Blick schweifen.
»Wissen Sie, ich halte diese Art von Vortrag zwölf Mal im Jahr. Nicht immer vor Beamten wie Ihnen. Ich halte ihn auch vor Gruppen von Frauen, die Opfer eines Psychopathen geworden sind. Warum kommen diese Frauen in mein Seminar? Was meinen Sie?«
»Damit es ihnen nicht noch einmal passiert«, schlug jemand vor.
»Sollte man meinen. Und diesen Grund geben die Frauen auch an, doch das ist nicht die ganze Wahrheit. Natürlich würden sie von mir gern ein Patentrezept an die Hand bekommen, das sie in Zukunft vor solchen Menschen schützt. Wer würde das nicht wollen? Wenn das aber nicht der wirkliche Grund dafür ist, dass diese Frauen meine Seminare besuchen, welcher ist es dann? Kann sich das jemand von Ihnen vorstellen?«
Niemand sagte etwas.
»Absolution«, rief Nele in die Stille hinein.
Sofort ruckten alle Köpfe in ihre Richtung.
Dr. Sternberg warf ihr ein Lächeln zu und nickte.
»Dieses Wort hätte ich nicht gewählt, aber es trifft den Nagel auf den Kopf. Absolution. Lassen wir den religiösen Charakter einmal beiseite. Absolution ist hergeleitet vom lateinischen absolvere und bedeutet loslösen, freisprechen.«
Dr. Sternberg trat von ihrem Pult zurück und ging auf und ab.
»Diese Frauen erwarten, dass ich sie von einer Schuld freispreche. Sie fühlen sich schuldig. Finden Sie das nicht merkwürdig? Sie sind Opfer eines Psychopathen geworden, und Opfer tragen doch keine Schuld. Woher also dieser Wunsch?«
»Ich kann mir vorstellen, worauf sie hinauswollen«, sagte Tanja Schildknecht.
»Na, dann raus damit.«
»Sie sprechen von Frauen, die an der Seite von Psychopathen gelebt haben, oft jahrelang, ohne es zu merken. Die glauben echt, sie seien selbst schuld, weil sie sich haben täuschen lassen. So wie es auch uns gehen würde, wenn so ein Typ neben uns sitzt.«
»Genau! Aber es geht noch darüber hinaus. Viele dieser Frauen haben nicht nur passiv an der Seite eines Gewissenlosen gelebt, nein, sie haben ihn auch noch aktiv unterstützt, haben sich vor seinen Karren spannen lassen, sich schützend vor ihn gestellt, ihm Mitleid gespendet. Auch als sie erkannten, dass mit ihrem geliebten Partner etwas nicht stimmt, machten sie weiter – weil der Gewissenlose es ihnen einfach machte. Psychopathen sind ausnahmslos hervorragende Lügner und Schauspieler. Selbst wenn man die Anzeichen kennt oder wenn man schon etwas ahnt, so wie diese Frauen, kann man sich nicht sicher sein. Vielleicht verheimlicht der Psychopath Ihnen gerade das, worauf Sie zu achten gelernt haben.«
»Also kann man sie gar nicht erkennen?«, fragte ein Teilnehmer.
»Doch, man kann. Es gibt Methoden, einen Gewissenlosen zu erkennen. Diese zu vermitteln, Sie dafür zu sensibilisieren, dafür habe ich dieses Seminar ins Leben gerufen. Die Gewissenlosen machen uns anderen, die wir ein Gewissen haben, die wir Mitleid empfinden, jeden Tag aufs Neue das Leben schwer. Und ich denke, es ist an der Zeit, etwas dagegen zu tun. Finden Sie nicht auch?«
»Das würden wir nur zu gern«, sagte ein Beamter mit Vollbart und dickem Bauch. »Aber ich glaube trotzdem, es ist, wie eine Kollegin vorhin in der Pause gesagt hat: Man erkennt ihn erst, wenn man sein Messer im Rücken hat.«
»Ein anschauliches Bild«, sagte Dr. Sternberg. Ihr Blick glitt zu Nele hinüber und verharrte einen Moment bei ihr, bevor sie sich dem letzten Sprecher zuwandte.
»Aber so weit müssen wir es nicht kommen lassen. Nicht in jedem Fall.«
Sie schaltete den Laptop ein. An der weiß getünchten Stirnwand des Seminarraums tauchte ein einziges Wort auf.
Gewinnen.
Sie ließ das Wort zunächst auf die Anwesenden wirken.
»Soziopathen wollen um jeden Preis gewinnen. Sie wollen mit uns spielen und gewinnen. Sie wollen unser Geld, unseren Stolz, unser Mitleid, unsere Kraft, manche wollen auch unser Leben, aber das sind die wenigsten. Ein überdurchschnittliches Bedürfnis nach Stimulation treibt sie an, lässt sie niemals ruhen. Sie können und wollen sich nicht um andere Menschen kümmern, bauen keine Beziehungen um der Emotionen willen auf. Das Einzige, was den Gewissenlosen bleibt, ist der Sieg. Gewinnen um jeden Preis.«
»Aber will das nicht jeder?«, fragte Tanja Schildknecht.
Frau Dr. Sternberg sah sie an. »Sie haben vorhin, als es in die Pause ging, den anderen die Tür aufgehalten und sind aus diesem Grund wahrscheinlich zuletzt am Kaffeeautomaten gewesen, haben in Kauf genommen, keinen mehr zu bekommen. Sie wollten nicht die Erste sein, wollten nicht gewinnen.«
»Aber das sind doch Banalitäten!«
»Im Banalen finden sich häufiger soziopathische Grundzüge als in auffälligem Verhalten. Die wenigsten Soziopathen sind Serienmörder. Die allermeisten spielen kleinere Spiele, die wir anderen nicht bemerken. Aber auch dabei finden sie ihre Opfer, und die leiden nicht weniger, nur weil sie mit dem Leben davonkommen. Achten Sie zukünftig gerade auf die banalen Zeichen.«
»Und welche sind das?«
Frau Dr. Sternberg ließ ihren Blick über die Seminarklasse gleiten.
»Mitleid«, sagte sie schließlich laut und deutlich. »Psychopathen wollen bemitleidet werden.«
Laufen!
Du musst laufen, so schnell du kannst!
Links und rechts duckten sich niedrige Gebäude, doch Miriams anfängliche Hoffnung, sich in bewohntem Gebiet zu befinden, zerschlug sich schnell. Das waren keine Häuser, sondern so etwas wie Lagerhallen. Also lief sie in die einzige Richtung, in der kein Gebäude stand, und erreichte schnell die Teerstraße, von der sie vorhin abgebogen waren. Dank der Schneereste und des immer wieder hervorbrechenden Mondes konnte sie einigermaßen sehen. Sie befand sich auf einer Anhöhe. Irgendwo dort vorn, in einer schwer einzuschätzenden Entfernung, schwebten winzige Lichter in der Dunkelheit.
Dorthin musste sie!
Lichter bedeuteten Leben!
Nach ein paar Minuten bog sie von der Teerstraße auf einen Schotterweg ab, weil die Lichter sich nach links verschoben. Der Weg wurde schnell schmaler und führte als Trampelpfad in ein tiefer gelegenes Waldstück.
Miriam blieb stehen. Sie war außer Atem, aber längst nicht am Ende ihrer Kraft. Dafür war sie viel zu gut trainiert. Was sie jetzt tat, entsprach nicht Cems Anweisungen. Wenn man sich für die Flucht entschieden hatte, sollte man auch flüchten, und zwar, ohne zu stoppen und ohne sich umzusehen. Nur laufen, so schnell man konnte, dabei ein Ziel anvisieren, möglichst belebte Plätze oder zumindest eine befahrene Straße.
Aber so etwas gab es hier draußen nicht.
Miriam drehte sich im Kreis.
Wohin?
Sie entschied sich für den Wald. Nicht nur, weil sie sich darin besser verstecken konnte, sondern auch weil auf dessen anderer Seite die Lichter lagen. Ein kleines Dorf, ein Gehöft vielleicht, völlig egal, solange dort Menschen lebten, die ihr helfen würden.
Die Sporthose aus schwarzem Funktionsmaterial war dünn und schützte nicht vor den Brombeerranken, die wie große Krallen in den Weg hineinragten. Die Dornen verhakten sich in dem Material, rissen Löcher hinein, und schon nach wenigen Metern spürte sie, wie sie auch Löcher in ihre Haut rissen. Es tat weh, aber nicht so sehr, wie es wehtun würde, wenn der Typ sie erwischte.
Der Weg wurde immer abschüssiger und rutschiger. Über ihr schlossen sich die laublosen Kronen der Erlen und Pappeln zu einem löchrigen Dach, das nicht mehr viel vom Mondlicht hindurchließ. Die Sicht wurde schlechter. Dünne Zweige schlugen ihr ins Gesicht. Sie befürchtete, einen Ast ins Auge zu bekommen, und wurde langsamer. Schließlich blieb sie abermals stehen und hielt sich an einem Baumstamm fest.
Sie lauschte, aber leider waren ihr eigener Atem viel zu laut und ihr Herzschlag zu heftig.
Plötzlich ein lautes Knacken irgendwo über ihr. Also war er ihr doch auf den Fersen, wollte sie nicht einfach so entkommen lassen.
Miriam ließ den Baum los, setzte zum Spurt an, glitt aber aus, bevor sie den ersten Schritt tun konnte. Sie fiel auf den Hintern und rutschte den steilen Weg hinab. In Panik griff sie wild in die Dunkelheit hinein und erwischte einen der unteren Äste eines Strauches. Daran klammerte sie sich wie eine Ertrinkende in einem reißenden Fluss, meinte sogar, Wasser rauschen zu hören.
Über ihr flammte eine Taschenlampe auf. Der Lichtstrahl ging zunächst in die Kronen der Bäume hinauf, wanderte dann abwärts und suchte den Boden ab. Der Mann war vielleicht dreißig Meter entfernt und befand sich halb links von ihr.
Miriam ließ den Ast los und rutschte weiter den Hang hinab. Etwas stach ihr in den Oberschenkel und schrammte schmerzhaft an ihrem Bauch entlang. Schließlich spürte sie eiskaltes Wasser an ihren Füßen, und ihre Rutschpartie war beendet. Sie stand bis über die Fußgelenke in fließendem Wasser, schräg mit dem Oberkörper gegen das lehmige Ufer gelehnt.
Über ihr durchbohrte der Lichtstrahl die Dunkelheit.
Miriam ließ sich weiter ins Flussbett hinab. Sie hielt den Atem an, als ihr Becken ins Wasser geriet. Für ihren von der Flucht erhitzten Körper war die Temperatur ein Schock. Auf Händen und Knien schob sie sich eng ans Ufer gepresst im Bachbett voran, bis sie eine Stelle entdeckte, an der sie sich unter das überspringende Ufer ducken konnte. Es war nur eine flache Nische, in die sie kaum hineinpasste, aber da der Mann von oben kam, würde er sie nicht entdecken, auch nicht mit seiner Taschenlampe. Dazu müsste er schon in den Bach steigen – was er hoffentlich nicht tun würde.
Die Kälte schlug gnadenlos zu, als Miriam kaum eine halbe Minute in ihrem Versteck hockte. Sie begann unkontrolliert zu zittern, zog die Knie eng an ihren Oberkörper und umschlang sie mit den Armen. Über ihr ragten Wurzeln aus dem Lehmboden. Wasser perlte daran herab, tropfte auf ihr Haar, in den Nacken, zwischen die Brüste. Ihre vom Wasser umspülten Füße wurden rasch taub.
Miriam wusste, sie durfte dieses Versteck nicht verlassen, bevor der Mann nicht verschwunden war. Sie biss die Kiefer fest aufeinander, um das verräterisch laute Klappern ihrer Zähne zu unterdrücken. Aus weit aufgerissenen Augen versuchte sie etwas von dem Licht der Taschenlampe zu erhaschen.
Plötzlich tauchte die flache Scheibe des Lichtkegels im Bachbett auf, schwamm ein paar Meter rechts von ihr auf dem Wasser, zuckte dann hin und her und tastete das jenseitige Ufer ab. Er suchte nach Spuren. Über sich konnte sie die schweren Schritte des Mannes spüren. Zweige knackten. Er stand jetzt praktisch über ihrem Kopf. Sie hörte ihn atmen.
Hoffentlich hält das Ufer, hoffentlich hält das Ufer!
Lehmbrocken fielen herab, landeten auf ihren Schultern und platschten ins Wasser. Sofort zuckte der Lichtkegel dorthin. Wenn sie die Hand ausstreckte, würde sie in den hellen Strahl hineinfassen, so nah war er.
Nach ein paar Minuten verschwand das Licht, und Miriam hörte, wie er sich entfernte.
Er hatte aufgegeben!
Sie wartete noch ab, bis sie lange Zeit weder ein Licht gesehen noch ein Geräusch gehört hatte. Als sie sich schließlich bewegte, waren ihre Füße und Unterschenkel taub von der Eiseskälte des Wassers. Mühsam stakste sie zum anderen Ufer hinüber, konnte dabei aber kaum das Gleichgewicht halten und stolperte ein ums andere Mal.
Auf allen vieren erklomm sie den Hang, zog sich dabei an Ästen und Sträuchern hoch und hielt erst inne, als am Rande der Senke der Wald endete. Dort ließ sie sich zu Boden fallen. Ihr Atem raste, ihre Finger schmerzten. Sie brauchte einen Moment Pause, wusste aber, dass sie keine Zeit verlieren durfte. Vielleicht kannte er sich hier aus und wusste, wo er sie abpassen konnte.
Nach einer halbe Minute kämpfte Miriam sich wieder auf die Beine und lief in einer tiefen, hart gefrorenen Traktorspur weiter.
Nicht aufgeben.
Nur noch ein paar Hundert Meter, dann hast du es geschafft.
So sehr sie sich auch zu motivieren versuchte, Miriam wurde doch immer langsamer. Sie hatte keine Kraft mehr, ihre Akkus waren leer, außerdem fühlte sie sich, als stecke sie im Körper einer alten Frau.
Schließlich erreichte sie eine Straße. Sie verlief in einem weiten Bogen um die Hügelkuppe auf die Lichter zu.
Die Hände um den Oberkörper geschlungen, humpelnd und vor Kälte und Erschöpfung zitternd, setzte Miriam in gleichmäßigem Rhythmus einen tauben Fuß vor den anderen. Der Mond schien ihr in den Rücken, und ihr Schatten fiel lang voraus auf die Straße. Sie konzentrierte sich darauf, versuchte den Schatten einzuholen, ließ sich von ihm ziehen, so wie sich ein Langstreckenläufer von einem Sprinter ziehen ließ. Dabei geriet sie in Trance, spürte ihre Lider immer schwerer und ihre Gedanken immer träger werden.
Das Auto bemerkte sie erst, als es direkt neben ihr scharf abbremste.
Gegen zweiundzwanzig Uhr parkte Nele Karminter ihren Wagen am Straßenrand vor dem roten, viergeschossigen Gebäude, in dem sie ihre Mietwohnung hatte.
Im Radio lief gerade »Chasing Cars« von Snow Patrol, ein Lied, das sie besonders mochte, weil es ihr das Gefühl vermittelte, über den Dingen zu schweben, besonders wenn sie mit dem Auto unterwegs war. Mit geschlossenen Augen blieb sie so lange sitzen, bis der letzte Ton verklungen war, erst dann stieg sie aus.
Der fast volle Mond schwebte über dem Dachfirst des Hauses. Sein silbriges Licht floss die Pfannen hinab und verwandelte sie in eine metallene Haut. Auf den Scheiben der anderen Fahrzeuge in der Straße hatte sich längst wieder eine Frostschicht gebildet, in der es kristallen funkelte.
Nele musste an ihre Mutter denken, die die Zeit um den Vollmond »Bleiche Tage« nannte. Vor fast zwei Wochen hatten sie zuletzt miteinander telefoniert, und ein Besuch war längst überfällig – wie so vieles andere auch. Den Friseurtermin hatte sie bereits zweimal abgesagt, und sie fühlte sich unwohl mit ihrem blonden Haar, das in den Ansätzen dringend nachgefärbt werden musste, weil es grau zu werden begann.
Nele ging langsam zum Haus hinüber und genoss dabei die kalte Luft auf ihren Wangen. Sie hatte nichts gegen den Winter, der in diesem Jahr scheinbar gar nicht enden wollte. Für Sonntag war sogar ein Blizzard angekündigt. Verrücktes Wetter!
Im Hausflur nahm sie die Post aus dem Kasten und sah sie durch, während sie die Stufen in den dritten Stock hinaufging. Nur Werbung und die Gehaltsabrechnung für den vergangenen Monat. Natürlich dieselbe Summe wie immer, dabei hätte es doppelt so viel sein müssen angesichts der Überstunden, die sie abgerissen hatte.
Ihre Wohnung war zwar warm, fühlte sich aber verlassen und unbewohnt an. Nele verbrachte nur noch wenig Zeit allein darin. Meist war Anou entweder schon da, oder sie kamen gemeinsam nach Hause. Allerdings hatte Neles Lebensgefährtin bis Samstagabend Bereitschaft, weswegen sie auch nicht zu dem Seminar mitgekommen war.
Nachdem Karel Murow damals in Anouschkas Wohnung eingebrochen war und sie daraus entführt hatte, konnte Anou dort nicht mehr allein sein. Sie war für zwei Monate ganz bei Nele eingezogen, bis sie eine andere Wohnung gefunden und sich dort eingerichtet hatte. Weiterhin zusammenzuleben, vielleicht sogar für immer, das hatte nie im Raum gestanden, und jetzt, während Nele in die ihr so leer scheinende Wohnung starrte, fragte sie sich, warum eigentlich nicht. Wer von ihnen beiden war noch nicht so weit?
Sie schob die Frage fort, ging in die Küche, nahm eine Flasche Mineralwasser aus der Kiste, lehnte sich gegen die Arbeitsfläche und trank die Ein-Liter-Flasche in kurzer Zeit beinahe ganz leer. Das musste an der großen Menge Kaffee liegen, die sie über den Nachmittag verteilt und auch noch während des Seminars getrunken hatte. Von Kaffee bekam sie immer Durst, richtig wach zu halten schien er sie aber schon lange nicht mehr.
Sie fühlte sich leer und ausgelaugt, sehnte sich nach einer heißen Dusche und wollte dann nur noch ins Bett. Sie ging ins Bad und zog sich aus. Ihr Spiegelbild war an diesem Abend kein Kompliment. Die blauen Augen wirkten müde, die Lachfalten in den Augenwinkeln schienen besonders tief zu sein, außerdem wirkte ihre Haut insgesamt grau und schlaff.
Sie brauchte Sonne, unbedingt!