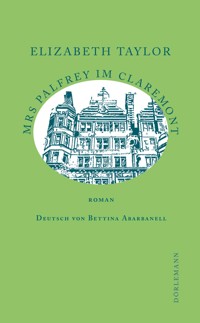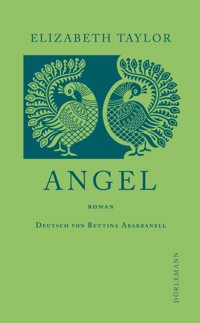19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Dörlemann
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Als eine der meist unterschätzten Schriftstellerinnen des zwanzigsten Jahrhunderts schreibt Elizabeth Taylor mit einer wunderbaren Präzision und Anmut. Ihre Welt ist absolut faszinierend.« Antonia Fraser Es herrscht das sechste Jahr des Krieges im englischen Hafenstädtchen Newby. Die Zeit vergeht ereignislos. Jeder kümmert sich um seinen Nächsten, nichts geschieht unbemerkt, auch wenn die Wahrung des schönen Scheines allen zur zweiten Natur geworden ist.Die schöne Tory hat heimlich ein Verhältnis mit ihrem Nachbarn Robert, unbemerkt von seiner Frau Beth, ihrer besten Freundin, die über dem Verfassen ihrer Romane die Umwelt nicht wahrnimmt. Ihre Tochter Prudence ist entsetzt über den Verrat, der vor ihren Augen geschieht. Die alte Mrs Bracey starrt, an den Stuhl gefesselt, unentwegt aus dem Fenster auf den Hafen und hält einen Tratsch mit allen, die vorbeikommen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 430
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Elizabeth Taylor
Blick auf den Hafen
Roman
Aus dem Englischen von Bettina Abarbanell
DÖRLEMANN
Die Originalausgabe »A View of the Harbour« erschien 1947 beim Verlag Peter Davies in Großbritannien. eBook-Ausgabe 2013 Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten Copyright © 1947 The Estate of Elizabeth Taylor Copyright © 2011 Dörlemann Verlag AG, Zürich Portrait: Elizabeth Taylor, The Estate of E.T. Umschlaggestaltung: Mike Bierwolf unter Verwendung einer Photographie von Aleksej Vasic Satz und eBook-Umzusetzung: Dörlemann Satz, Lemförde ISBN 978-3-908778-30-1www.doerlemann.com
Elizabeth Taylor
Kapitel eins
Wenn die Schleppnetzfischer den Hafen zur Teezeit verließen, begleiteten die Möwen sie nicht, wie sie es später bei der Rückkehr der Flotte tun würden; gleichmütig hockten sie auf dem kabbeligen Wasser entlang den Rändern kleiner Boote und schaukelten mit jeder Welle auf und nieder. Wenn sie sich erhoben und ihre Flügel ausbreiteten, zeichneten sie sich strahlend weiß, so weiß wie der Leuchtturm, gegen das grüne Meer ab.
Für die Männer auf den Booten sah der Hafen zuerst ärmlich und vertraut aus, eine Reihe von Gebäuden – Läden, Fischlokal, Wirtshaus –, mit abblätterndem aprikosenfarbenen und himmelblauen Anstrich; doch sobald ihre Boote jenseits der Hafenmündung zielstrebig in See stachen, kamen terrassenförmig ansteigend weitere Häuserzeilen in Sicht, zwischen den Dächern ragte der Kirchturm auf, die Schrift auf den Läden verblasste und das Schäbige wurde pittoresk.
Unterdessen blieb der Blick für Bertram, der an einer Mauer beim Leuchtturm lehnte, gleich. Bertram schien zwischen Meer und Land postiert zu sein; Wasser schwappte quecksilbrig zu beiden Seiten der Mole, auf der er sich befand. Er schaute über die Boote und die Möwen hinweg zum Wirtshaus an der Promenade.
Wenn er dort am Morgen aufstand und an eines der meerseitigen Fenster trat, um seine Atemübungen zu machen, bot sich ihm der umgekehrte Blick. Dreh- und Angelpunkt war dann der Leuchtturm, und die Hafengebäude, die Mole, das Meer bewegten sich unablässig darum herum und gruppierten sich neu, sodass man ihn kaum je vor demselben Hintergrund sah. Die Mole etwa dehnte sich entweder aus oder schnurrte auf fast nichts zusammen. ›Ideal für einen Künstler‹, dachte Bertram, holte sein Skizzenbuch heraus und zog in der Mitte eines Blatts eine waagerechte Linie. Die Gebäude zeichnete er als Quadrate und Rechtecke ein, beginnend mit dem größten an einem Ende, dann das Wirtshaus, das Fischlokal Mimosa, den Altkleiderladen, den Vergnügungspavillon, die Seemannsmission, das Wachsfigurenkabinett, die Rettungsstation. Darüber skizzierte er noch einige Dächer sowie den Kirchturm.
Jetzt sah er, wie die Tür des schmalen Hauses, das zwischen dem großen Gebäude und der Wirtschaft eingezwängt war, sich öffnete und eine Frau mit schwarzem Schal um den Kopf heraustrat, einen weißen Krug in den Händen. Tief darübergebeugt, ging sie raschen Schrittes zum Nachbarhaus, in dem der Arzt wohnte. Schon ein paarmal hatte Bertram zur Teezeit beobachtet, wie sie sich mit einem weißen Krug dorthin begab; zu anderen Zeiten schlug sie die entgegengesetzte Richtung ein, dann hatte sie einen rosafarbenen Krug dabei.
Bertram steckte das Skizzenbuch wieder in die Jackentasche und holte seine Pfeife heraus. Er war kein großartiger Künstler, auch wenn er eine sehr gute Methode gefunden hatte, Wellen im Moment des Brechens zu zeichnen, weiß und realistisch. Kaum hatte er seinen kleinen Entwurf aufs Papier gebracht, packte ihn die Neugier, denn eine Frau – nein, ein Mann mit Schürze schrieb jetzt mit Weiß etwas an die Fensterscheibe des Lokals, nachdem er das ›Spiegeleier, Chips und Tee 1/3‹, das Bertram auf dem Weg zum Leuchtturm aufgefallen war, abgewischt hatte. »Schöne gebratene Fischfilets, hoffe ich«, murmelte Bertram, »und bitte nicht Bohnen auf Toast oder falsch buchstabierte Frikadellen.«
Als er mit der Beschriftung, wie immer sie nun lautete, fertig war, ging der Mann hinein. Der Schauplatz war wieder leer, abgesehen von den Männern, die Rollen rostigen Stacheldrahts (es hatte einen Krieg gegeben) vom Ufer aufsammelten.
»Das Licht schwindet«, sagte Bertram zu sich selbst.
Während seines ganzen Lebens auf See hatte er sich vorgestellt, seinen Ruhestand auf diese Weise zu verbringen: ein Zimmer in irgendeiner Hafenwirtschaft zu mieten und jene Aspekte der See zu malen, die, wie er glaubte, dreißig oder vierzig Jahre lang seiner Würdigung geharrt hatten. »Das wäre ein schönes Bild«, hatte er bei jedem Sonnenuntergang, jedem Mondaufgang, jedem Sturm, jeder juwelenbesetzten Küste gesagt und nicht die Szene selbst gesehen, sondern ihre Kristallisation oder Essenz; das mittels seiner Phantasie vollendete Bild davon. ›Bertram Hemingway, der fabelhafte Maler von Meeres- und plage-Motiven.‹ Doch auf dem Papier, mit Wasserfarben, wurden die Grüntöne zu Schlamm, die Vögel, reglos über den Wellen klebend, erzeugten nicht die mindeste Illusion möglicher Bewegung, und die Wellen selbst würden niemals brechen. ›Ölfarben vielleicht‹, dachte er. ›Immer diese Probleme mit dem Medium. Den Medien vielmehr. Wenn man in ein Hafenlokal geht, rechnet man nicht damit, dass einem Dosenlachs aufgetischt wird.‹
Die Wachsfigurenausstellung schien geschlossen zu haben – die Fenster waren mit grauer Spitze verhängt; der Altkleiderladen gleich daneben bekam gerade einen neuen Anstrich, dessen erste Schicht, lachsrosa, die abgelegten, im Schaufenster hängenden Sachen rahmte; die Rollläden des Vergnügungspavillons waren heruntergelassen; einer der Männer hatte sich von den Stacheldrahtschlaufen gelöst und war in das Lokal gegangen, jetzt kam er mit einer Tasse in der Hand an die Tür und rief seinen Kameraden, die andere Hand muschelförmig um den Mund gelegt, etwas zu. Seine Stimme drang von fern über den Hafen zu Bertram herüber.
Ja, das Licht schwand. Als Bertram sich umdrehte, sah er die weit über den Horizont verteilten Schleppnetzfischer. Einsamkeit überkam ihn. Er schlug seine Pfeife gegen die Mauer und machte sich auf den Rückweg über die geschwungene Mole. ›Bertram Hemingway, R.N., i.R., der berühmte …‹ ›Auch andere Männer haben erst spät begonnen‹, unterbrach er sich selbst. ›Denk an …‹ Doch selbst wenn ihm ein Beispiel eingefallen wäre, bemühte er sich nicht weiter, denn da war die Frau wieder, jetzt in der anderen Richtung unterwegs, und verschwand in ihrem Haus, dieses Mal mit erhobenem Kopf, eine weiße Hand auf dem dunklen Schal um ihren Hals. Kein Krug. Anscheinend nahm sie ihn nie mit zurück. Es sei denn, sie kam aus der Wirtschaft. Dann ging sie langsam und vorsichtig wie ein kleines Mädchen.
Jetzt fuhr vor dem Haus, das sie gerade verlassen hatte, dem Haus des Arztes, ein Wagen vor. Er selbst stieg aus, schlug die Tür zu und hielt einen Augenblick inne, um die Fischerflotte zu betrachten (das taten die meisten), ging dann mit seinem Koffer in der Hand zum Haus, klopfte, wartete, wurde verschluckt.
Bertram schlenderte die Promenade entlang. ›Ja, ich habe eine oder zwei Skizzen gemacht‹, probte er für das Gespräch mit dem Wirt, ›die Silhouette eingefangen … interessante kubistische Effekte, diese Häusergruppen … aber dann schwand das Licht.‹
Im Fenster des Wachsfigurenkabinetts hing ein Schild, das in schattenhafter Schrift für die jüngste Attraktion warb – Der Herzog und die Herzogin von Windsor; ausgeblichenes, zerknittertes Papier lag ebenfalls dort und ein bisschen Mäusedreck.
Als er durch den Farbgeruch hindurchging, war ihm auf einmal, als bebte und verharrte die Luft, und tatsächlich – der Lichtstrahl vom Leuchtturm schwenkte kühn herüber … ein Blitzen, ein Zwinkern, eine Pause … und bestätigte, was der Künstler bereits entschieden hatte: dass der Tag zu Ende war.
»Frisch gebratene Gardinen–«, las Bertram laut vom Fenster des Lokals ab, stutzte dann ungläubig – »Ach so! Sardinen!« Er lachte und wandte sich zum Wirtshaus.
Der Hafen wiederum beobachtete Bertram. Es waren schon öfter Künstler hier gewesen, aber mit Staffeleien und im Halbkreis von Kindern umstanden, und kaum je, bevor die Saison begann. Dieser Mann weckte ein wenig ihren Argwohn. Er hatte nicht die üblichen Attribute. Sein Bart war ein Seemannsbart, nicht der eines Bohemiens. Sie spähten hinter Laden- und Zimmergardinen hervor, und auch Mrs Wilson vom Wachsfigurenkabinett blickte aus ihrem Fenster im ersten Stock und überlegte, ob er ein Spion sei, nicht bedenkend, dass der Krieg vorbei war. Als sie den Lichtkegel über das Wasser schweifen sah, spürte sie Furcht und Verzweiflung angesichts des langen Abends, durch den sie sich würde lotsen müssen – mithilfe etlicher Tassen Tee und eines Briefs an ihren Bruder in Kanada oder der Strickarbeit, die sie auf den Boden hatte fallen lassen, als sie sich gegen die Scheibe lehnte, um Bertram zu beobachten, die Wange am kratzigen Stoff der Vorhangspitze, deren baumwollähnlicher, staubiger Geruch ihr durch und durch ging.
Tory Foyle wickelte sich den schwarzen Chenille-Schal vom Kopf. Mit ihrem rosigen Gesicht, dem hellen Haar und den wahrhaft veilchenblauen Augen war sie das, was man einst als typische englische Schönheit betrachtete.
»Edward hat mir geschrieben.« Sie holte ein kleines liniertes Blatt Papier aus der Tasche und strich es glatt.
Beth schenkte Tee ein und wartete ab, bereit, sich zu Tränen rühren zu lassen.
»Liebe Mummy«, las Tory. »Wie geht es dir, mir geht es gut. Bitte schick mir Briefumschläge. Hier ist es nicht sehr schön. Und Briefmarken. Ich habe Halsschmerzen. Andere Jungs haben Honig. Es gefällt mir hier prima. Viele Grüße. Dein Sohn Edward.«
»Ach je«, sagte Beth. »Sie denken einfach nicht nach. Sie schreiben, was sie buchstabieren können. Ich weiß noch, wie mir Prudence einmal, als sie verreist war, schrieb: ›Ich leide ganz schrecklich. Ich kann Dir nicht sagen, was es ist.‹ Als ich sie anrief, stellte sich heraus, dass sie nicht wusste, wie man Diarrhöe buchstabiert – wer weiß das schon? – und dass es ihr längst besser ging, bevor der Brief bei mir eintraf. Du solltest dir keine Sorgen machen.«
»Wenigstens Honig kann ich ihm ja schicken.«
»Ja, sie messen unsere Zuneigung daran, was mit der Post kommt.«
Beths jüngere Tochter, Stevie, stand am Tisch, eine Hand in die Hüfte gestemmt, und trank in langen, gleichmäßigen Zügen die Milch, die Tory ihr mitgebracht hatte. Während des Trinkens verschwamm ihr Blick. Beth und ihre Töchter hatten große, wunderschöne, aber astigmatische Augen.
»Stell deinen Becher ab und zwinkere.«
Stevie tat wie geheißen. Sie stand mit einem sahnigen Milchbart da und zwinkerte.
»Das soll die Muskeln entspannen, habe ich in einem Buch gelesen«, sagte Beth und schob die Brille auf ihrer kleinen Nase hoch. Sie sah sehr jungfräulich aus, dachte Tory, nicht die Spur eines Kusses auf ihrem Mund.
»Das heilige gedruckte Wort«, sagte Tory.
»Du kannst jetzt wieder aufhören zu zwinkern.«
Das Kind holte tief Luft und trank weiter.
»Wo ist Prudence?«
»Sie macht den Katzen die Ohren sauber. Ich hatte heute eine wunderbare Idee. Ich dachte mir, ich könnte Geoffrey Lloyd fragen, ob er für ein Wochenende herkommen möchte.«
»Ich kenne keinen Geoffrey Lloyd.«
»Müsstest du aber. Erinnerst du dich an Rosamund Dobson, von der Schule?«
»Nur allzu gut. Als wir ungefähr zwölf waren, hat sie mir erzählt, wenn man ein Baby bekomme, platze einem der Bauch auf« – Tory verwarf die Hände – »und müsse hinterher wieder zusammengenäht werden.«
»Nun, Geoffrey ist ihr Sohn.«
»Dann will ich hoffen, dass er ganz normal zur Welt gekommen ist. Sie muss froh und überrascht gewesen sein.«
»Ich dachte mir, er könnte Prudence Gesellschaft leisten. Er ist bei der Air Force. Seine Einheit ist gleich hinter der Stadtgrenze stationiert.«
»Wozu noch weiter Luftstreitkräfte unterhalten, wenn doch alles vorbei ist?«
Tory stand auf und begann, sich den Schal um den Kopf zu wickeln.
»Weil es wieder losgehen könnte, nehme ich an.«
»Nur, wenn du so redest«, sagte Tory, ihrer Freundin eine große Verantwortung aufbürdend. »Bitte ihn erst einmal zum Tee, um zu sehen, wie er ist. Ich bin sicher, er taugt nichts.«
»Er ist doch bloß ein junger Mann. Und Prudence hat keine Freunde.«
»Ich lasse den Krug bis morgen früh hier.«
»Danke, meine Liebe … Ich weiß nicht, was Stevie machen würde …«
»Nicht der Rede wert. Ich hasse Milch. Wenn ich sie behielte, würde ich mir nur das Gesicht damit waschen. Ich glaube, du willst sie verkuppeln, Beth.« Sie wandte sich ab. »Finde jemanden für mich.«
»Liebe Tory, ich wünschte, das könnte ich. Ich kenne keine Männer. Und wenn ich welche kennen würde, wären sie nicht gut genug.«
»Ich muss gehen.«
Dabei gab es gar keinen Grund für sie, nach Hause zu gehen, außer dem, Beths Ehemann nicht über den Weg zu laufen.
Sie verließ das große, unordentliche Haus und betrat ihr eigenes schönes, nach Hyazinthen duftendes. Dort setzte sie sich an das Erkerfenster ihres Schlafzimmers und kämmte sich vor dem Spiegel das Haar. Sie nahm es ganz herunter und steckte es wieder hoch, aber es war niemand da, der das Ergebnis hätte würdigen können.
Mrs Bracey wusste einen derben Spaß zu schätzen, anders als die Mädchen. In dem Zimmer hinter dem Altkleiderladen machte Iris sich für die Arbeit fertig und hielt ein Paar Strümpfe vor das Feuer. Sie drehte sie schamhaft herum. Dampf stieg von ihnen auf. Ihre Mutter, die (von der Hüfte abwärts gelähmt) auf dem Bett an der Wand lag, schüttete sich aus vor Lachen. »Ja«, wiederholte sie gerade und wischte sich die Tränen vom Gesicht, »›Jetzt werd mal nicht gleich so verdammt vertraulich‹, hat er gesagt. ›Du und deine Küsserei!‹ Und dabei war er es doch, der die ganze Zeit …«
»Es ist gut, Mutter«, sagte Maisie, die aus der Küche hereinkam. »Ich finde, wir hatten jetzt für einen Abend genug von diesem Wort.«
»Was soll denn bitte schön vertraulicher sein als das, frag ich euch?«, fuhr Mrs Bracey, immer noch lachend, fort. »Na ja, kommt wohl drauf an. Verfluchte Klassenunterschiede selbst bei … ist ja gut, ist ja gut. Du bist spät dran, Iris«, fügte sie scharf hinzu.
»Wem sagst du das!« Sie zog sich vorsichtig die Strümpfe an.
»Schon fünf vor sechs. Du wirst vom Rheumatismus geplagt werden, bevor du vierzig bist«, sagte ihre Mutter in zufriedenem Ton.
Iris zwängte die Füße in ihre Schuhe und verschwand.
»Wiedersehen!«, rief ihre Mutter, bekam aber keine Antwort. »Mit niemandem kann man sich hier mal anständig amüsieren«, seufzte sie. »Was machst du da mit der Uniformjacke, Maisie?«
»Ich bügle sie ein bisschen auf. Mrs Wilson von den Wachsfiguren hat gesagt, sie würde mir fünf Schillinge dafür geben, für die Herzogin von Kent.«
»Ist nicht prachtvoll genug für das Königshaus. Probieren wir sie doch mal an. Wo hast du sie her?«
»Aus dem Pfarrhaus. Die Köchin hat sie gebracht, mit einem Haufen anderer Sachen.«
»Dann würde ich sie nicht haben wollen. So behandelt man doch keinen Samt. Du musst die Unterseite bügeln, damit der Dampf durch den Flor nach oben dringt.«
»Und dabei soll ich wohl noch auf dem Kopf stehen.«
Mrs Bracey faltete die Hände und seufzte mit aufgesetzter Geduld. Gelangweilt war sie, verdrossen; nicht nur ihr Körper, sondern auch ihr Geist, ihre lebhafte, breit gefächerte, eigenwillige Phantasie. Früher hatte sie an Sommerabenden gern draußen vor dem Eingang zum Laden auf einem Stuhl gesessen und zugesehen, wie die Boote hinausfuhren, hatte mit den Leuten geplaudert, die aus dem Anchor kamen oder dorthin unterwegs waren, den Fischern Anzüglichkeiten zugerufen und sich in die Streitereien der Kinder eingemischt. Jetzt war aller Glanz, aller Tratsch aus ihrem Leben verschwunden. Wenn Iris vom Anchor zurückkam, würde sie sich auf einen Stuhl plumpsen lassen, eine ihrer Fortsetzungsgeschichten zur Hand nehmen und, Füße aus den Schuhen, darauf warten, dass Maisie ihr den Kakao brachte.
›Da war sie nun fast fünf Stunden draußen in der Welt unterwegs und bringt mir nicht den kleinsten Krumen davon mit‹, würde ihre Mutter denken und rastlos auf den Leckerbissen warten, der nie kam.
›Wer war heute Abend da, Iris?‹, würde sie endlich, gereizt und doch demütig, fragen.
›Ach, die Üblichen‹, würde Iris sagen und eine Seite umblättern.
›Keinen Krumen gibt sie ab. Hält mich für neugierig. Soll sie nur warten, bis sie selbst an der Reihe ist.‹
Mrs Bracey wartete voller Zuversicht darauf, dass andere an der Reihe wären.
›Diese Mädchen heutzutage‹, dachte sie, während sie Maisie so ruhig arbeiten sah. ›Woran glauben sie eigentlich? An nichts in ihrem Leben.‹ Insgeheim ärgerte sie sich immer, dass ihre Gotteslästerung die Mädchen ungerührt ließ. ›Verfluchte kleine Atheistinnen. Glauben ja nicht mal, dass Sex Spaß macht. Werden zu früh aufgeklärt, bevor sie überhaupt den Witz daran verstehen. Diese ganze sogenannte Biologie. Nimmt der Sache die Würze, macht sie uninteressant. Ach, Herr, warum hast Du mein Leiden nicht zum Beispiel dieser Mrs Wilson auferlegt? Sie will doch gar nichts anderes als drinnen sitzen und aus dem Fenster gucken. Ich hätte sie auch immer besucht, sehr gut wäre ich zu ihr gewesen. Guten Morgen, Mrs Wilson, ich wollte nur mal eben nachsehen, ob Sie irgendwas brauchen. Ich hab Ihnen ein paar Löffel von meiner Kalbsbrühe mitgebracht – und dabei hätte ich die Tasse auf den Kopf gedreht, damit sie sieht, wie fest und reichhaltig das Gallert ist –, die mach ich Ihnen schnell heiß. Einer trage des andern Last, wie Gott der Herr gesagt hat. Was ist Religion denn wert, verflucht noch eins, wenn alle immer bloß reden, aber nichts tun? Während Sie das trinken, bleib ich einfach hier sitzen und wir plaudern ein wenig. Nein, ich hab’s nicht eilig. Hab drüben im Anchor einen guten Witz gehört, von einem Herzog und einer Kammerzofe …‹
»Worüber grinst du, Mutter?«, fragte Maisie, die jetzt die Samtjacke ausschüttelte.
»Meine Gedanken.« Es war ein Schlag, sich in ihrem eigenen Bett liegend wiederzufinden, statt an dem von Mrs Wilson zu sitzen. ›Es ist eine verdammte Schande, Herr. Kein Zweifel, dass ich’s auf die oder jene Art verdient hab, aber doch nicht mehr als die anderen. Hättest Du ein paar von diesen stumpfsinnigen kleinen Atheistinnen niedergestreckt, anstatt eine Deiner Dienerinnen, die sich draußen in der Welt noch hätte nützlich machen können. Vorm Haus auf dem Stuhl sitzen zum Beispiel und die Nase in fremde Angelegenheiten stecken oder ein schönes gezapftes Bass in der Schenke trinken‹, fügte sie hinzu, denn eine Schwindlerin war sie nicht. ›Ich krieg meine Belohnung im Himmel. Wird mir ein herrlicher Trost sein, wenn der Spieß umgedreht wird und sich zeigt, dass ich mir meine Erlösung schon hier unten verdient hab, mit Schmerzen. Darauf warte ich gerne, was Iris für ein Gesicht machen wird, wenn Unser Herr zu ihr sagt: Was hast du Gutes getan? Du hast doch nur Abend für Abend dagesessen und deine geschwätzige kleine Frauenzeitschrift gelesen, ohne ein vernünftiges Wort in deinem Kopf. Und wenn ich im Todeskampf liege, liest sie bestimmt erst die aktuelle Folge zu Ende, bevor sie losläuft, um Doktor Cazabon zu holen.‹ Sie zupfte mit den Händen am Saum der Bettdecke, während ihre Gedanken weiter rasten.
»Ja«, sagte Bertram, »ich habe einen Entwurf von der Stadtsilhouette gezeichnet, nur eine Skizze, wissen Sie.«
Sie tranken ein leichtes Ale am Tresen. Iris nahm einen Schluck Guinness und wischte sich mit einem Spitzentaschentuch die Lippen ab.
»Im Winter hatten wir noch nie einen Maler hier«, sagte Mr Pallister. »Den einen oder anderen wohl mal während der Saison, aber das war vor dem Krieg. Sie sind auf alles aus, was alt ist. Ich denke immer, die Neustadt hinter der Landzunge, die müsste doch ein hübsches Bild abgeben, mit der Seebrücke und allem, oder die italienischen Gärten. Wenn wir den Hafen nicht hätten, wären wir längst erledigt. Wie Mrs Wilson mit ihren Wachsfiguren über die Runden kommt, ist mir ein Rätsel; noch dazu, wo sie ihren Göttergatten im Krieg verloren hat. Was wirft das Kabinett schon für sie ab? Die Leute gehen doch bloß aus Neugier rein, wollen sich drüber lustig machen. Wie lange kann das noch gut gehen? Und dann der Pavillon. Der ist freilich verrammelt. Jeden Sommer frage ich mich wieder, ob sie kommen werden oder nicht. Protzige Leute aus London, gehören nicht hierher. Mrs Wilson schon. Ihr Mann hat das Geschäft von seinem Vater übernommen, so wie ich meins von meinem alten Herrn. Damals war das hier noch ein Ferienort, mit Badekarren an der Hafenmole. Und einmal hatten wir sogar eine Wandertruppe hier. Weißt du noch, Iris? Erinnerst du dich an den Burschen mit dem rosa-weiß gestreiften Blazer und dem Strohhut? Hab seinen Namen vergessen.«
»Da war ich doch noch ein Kind, Mr Pallister«, sagte Iris erstaunt. Aber Bertram konnte sehen, dass sie sich durchaus erinnerte, ja dass der rosa-weiß gestreifte Blazer zu jenen Eindrücken zählte, die die kindliche Phantasie angeregt hatte, und dass sie auch den Namen noch wusste.
»Aber das ist alles vorbei«, sagte Mr Pallister. »Heute haben die Leute nicht mehr viel für Fischgeruch übrig. Sie sind Seemann, das ist etwas anderes.«
»Ich weiß nicht, was die Marine mit Fischen zu tun haben soll«, warf Iris ein. »Außerdem war Mr Hemingway Offizier.«
»Man kann dem Geruch nicht entkommen«, sagte Mr Pallister. Er legte ein Holzscheit auf das Feuer, und als er es mit der Stiefelspitze verrückte, schossen rundherum grüne Flammen empor. Rote Sergevorhänge verhüllten die Fenster, gelber Firnis schimmerte klebrig. Die Möglichkeit der Niederlage ziehen wir nicht in Betracht, verkündete eine schief
über dem Tresen angebrachte schmuddelige Karte.
»Ruhig heute Abend«, fuhr Mr Pallister fort. Das sagte er fast jeden Abend, nur samstags variierte er es ein wenig: »Ruhig für einen Samstag.« Er schaffte es immer noch, dabei überrascht zu klingen.
»Schauen Sie, das kleine Bild hier«, sagte er jetzt und nahm etwas in einer dunklen Ecke vom Haken. »Ein Ölgemälde«, erklärte er ehrfurchtsvoll, als er es Bertram reichte. »Hätte gern mal eine Expertenmeinung dazu. Ein Mr Walker hat es vor ein paar Jahren gemalt. Wohnte damals hier, hatte dasselbe Zimmer nach vorne raus wie Sie, und als er wieder abgereist ist, hat er mir dieses Bild geschenkt.«
»Blick auf den Hafen«, las Bertram unten von der Leinwand ab.
Da waren der Leuchtturm, die Mole, die Rettungsstation, alles in Saucenbraun gemalt. Als er genauer hinsah, konnte er ein sepiafarbenes Boot und einen Vogel ausmachen. Die Wellen, draußen auf dem offenen Meer, erhoben sich in dicken, behäbigen Reihen.
»Ja«, sagte Bertram und gab ihm das Bild zurück. »Ich muss Ihnen einen kleinen Gefährten dafür malen.« ›Leim und Mulligatawny‹, dachte er und sah sein eigenes Bild vor Licht schimmern. ›Ein kleines Juwel von Bertram Hemingway.‹ »Wer ist die Dame mit dem Krug?«, fragte er.
»Er meint Mrs Foyle«, sagte Iris.
»Ah, Mrs Foyle von nebenan. Kommt gern gegen Abend vorbei, um ein Bier zu trinken. Eine Dame mit schwarzem Schal?«
»Ja.«
Ein kleines Schweigen senkte sich über sie. Iris, die am blätternden Lack ihrer Fingernägel kratzte, blickte auf. »Schöne Augenfarbe«, fügte sie, im Gedanken an Tory, unbestimmt hinzu. Gott, wie trübsinnig das Leben war! Wenn doch plötzlich die Tür aufgehen und Laurence Olivier hereinmarschieren würde, der vielleicht hier unten drehte … ›Denn was sonst sollte ihn jemals hierherlotsen‹, dachte sie verbittert.
Der Lichtkegel hielt kurz vor dem Land jäh inne. Er schwang weit über das Meer, er harkte den Himmel. Sieh da!, sagte er und war verschwunden. Prudence kniete im Dunkeln an ihrem Fenster, die Arme auf dem staubigen Sims. Yvette und Guilbert, ihre Siamkatzen, schmiegten die Köpfe ekstatisch an ihre Knie, unentwegt schmeichelnd, bebend, schnurrend. Prudence’ Gesicht unter dem schweren Trilby-Pony war wie ein Blatt Papier im Schein des Mondes, der die Vorderseite des Steinhauses und die spröden Gipsfassaden entlang dem Hafen beleuchtete. Unten verströmten verschiedene Quellen ihr Licht über das Kopfsteinpflaster, die Lampe über der Tür dieses Hauses, in dem der Arzt mit seiner Familie wohnte, und die mit Serge verhängten Fenster des Anchor, unter denen der Asphalt rötlich glänzte; nahe der Mole warfen die Lampen grünliche, schwarz umschlossene Lichtkreise auf den Boden. Und immer war da jenes Geräusch, das Prudence gar nicht mehr hörte, weil sie es von Anfang an gehört hatte: Wasser, das unregelmäßig gegen Steine schwappte, trunken heraufbrandete, gebremst, gebrochen wurde und wieder zurückwich.
Draußen auf dem Kai standen zwei alte Männer unter einer Laterne und unterhielten sich über ein Boot. Das Licht bemalte die Falten ihrer dunklen Strickjacken mit Silber. Eine Zeitungsseite wurde vom Wind aufgehoben und tanzte träge davon, bis sie von einer Rolle Stacheldraht aufgehalten wurde und zitternd daran hängen blieb. Als die Tür des Wirtshauses sich öffnete, ergoss sich ein gelber Fluss über das Kopfsteinpflaster. Bertram blieb einen Moment lang darin stehen, bevor er die Tür hinter sich schloss. Prudence beobachtete ihn, beugte sich ein wenig vor, die nackten Arme auf dem rauen Stein des Fenstersimses. Ließen ihre Gedanken ihn aufblicken? Denn sie sah, wie er das Gesicht in ihre Richtung hob, sah auch seinen Bart und, als er fortging, einen kleinen blassen Ring an seinem Hinterkopf, dort wo das Haar sich lichtete. Er gesellte sich zu den beiden Männern unter der Laterne, fügte seine Stimme den ihren hinzu. Vermutlich fragte er sie nach ihr, und sie würden mit den Schultern zucken und sagen: ›Die Älteste des Arztes‹ oder etwas in der Art, denn sie bedeutete ihnen nichts, war nur ein Kind, das unter ihren Augen aufgewachsen war. Doch Bertram (sie kannte seinen Namen nicht) hatte genau in dem Moment heraufgeschaut, als sie aufhörte, ein Mädchen zu sein, und – ihr schwindelte von ihrer Macht – zur Frau wurde. Er war zwar ein alter Mann, doch das spielte keine Rolle; was zählte, war, dass sie zum ersten Mal mit der Macht experimentierte, die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken.
»Prudence!«, rief ihr Vater – seine Stimme wand sich die Treppe herauf –, denn sie litt an Bronchitis und durfte sich abends nicht aus dem Fenster lehnen und all die Feuchtigkeit in ihre Lungen hereinlassen.
›Ich bin zwanzig‹, dachte sie, ›und noch nie in Liebe geküsst worden!‹
»Prudence!« Die Stimme drang jetzt deutlicher an ihr Ohr. Er hatte den ersten Stock erreicht. Sie schlich auf Zehenspitzen zur Tür und schaltete das Licht ein, ging dann zum Treppenabsatz und beugte sich über das Geländer, um in den Kern des Hauses hinabzublicken:
»Ja, Vater?«
Er blieb, einen Fuß auf der untersten Stufe, stehen.
»Halt dich nicht so lange in deinem kalten Zimmer auf. Es ist Zeit fürs Abendessen.«
»Ich habe mir die Haare gemacht.« Sie hob die Hand und glättete sich den Pony.
»Du bist nicht weit gekommen«, stellte er fest und fragte sich, warum seine beiden Kinder solche Lügnerinnen waren. ›Beth und ich‹, dachte er, während er wieder hinunterging. ›So geradeheraus, so wahrhaftig. Woher haben sie das? Wo haben wir versagt?‹
Über irgendetwas sorgte er sich immer und dies hielt ihn beschäftigt, bis er im Esszimmer war, wo das Feuer in den gebrochenen Rippen des Gaskamins ungleichmäßig bullerte und die Zeitschriften vom großen Tisch geräumt worden waren, damit das Abendessen dort gedeckt werden konnte. Doch auch wenn die Zeitschriften nicht mehr da waren, saßen die Geister der Patienten noch auf dem lederbezogenen Sofa und warteten, dass sie an die Reihe kämen. Das Zimmer war voll von ihnen.
Beth saß am Tisch und wartete ebenfalls, die Hände im Schoß, der Blick leicht verträumt. Er küsste sie auf die Stirn und legte die Hand auf ihr kurzes, lockiges Haar, das so weich war, so unordentlich. Die Geste bedeutete ihnen beiden nichts.
»Kommt Prudence gleich?«
»Gesagt hat sie es.«
Beth hoffte, dass die Krabben die Sauce vielleicht weniger klumpig erscheinen lassen würden, als sie war.
»Hast du etwas geschrieben?«
»Ach, Robert, es kam immer wieder etwas dazwischen. Zweimal habe ich mich hingesetzt und das Telefon hat geklingelt, und dann kam Stevie früher aus der Schule nach Hause und ich musste Tee machen und Tory kam herüber …«
»Tory!« Er schüttelte seine Serviette aus dem Ring, fasste sie an einer Ecke und entfaltete sie mit einem Schwung aus dem Handgelenk.
»Was wollte sie?«
»Sie hatte mehr Milch, als sie brauchte, und hat uns welche für Stevie gebracht …«
»Aber das Kind bekommt genug Milch, siehst du das nicht? Ihr Appetit ist schlecht, weil sie so viel davon trinkt.«
»Sie liebt Milch«, sagte Beth, ohne zu überlegen. »Ich werde stattdessen heute Abend weiterschreiben müssen.« Aber sie war froh bei dem Gedanken, im Innersten froh, sich mit ihren Büchern bis ein, zwei Uhr in der Nacht einzuschließen.
»Ich hatte gedacht, wir könnten vielleicht ins Kino gehen.«
»Tory hat gesagt, sie geht wahrscheinlich hin.«
Er aß seinen Fisch, ohne zu antworten.
»Willst du sie nicht begleiten?«
»Das kommt gar nicht infrage.«
»Ich wünschte, du wärst imstande, sie zu mögen. Es gibt so vieles, was wir für sie tun könnten, und sie ist einsam. Wir haben ja uns.«
›Tory ist frivol‹, dachte er. ›Sie ist dermaßen frivol.‹ Er sah seiner Frau in das ernsthafte kleine Gesicht. »Verdammt noch mal, wo bleibt Prudence denn?«, und er sprang auf und rief erneut ins Treppenhaus hinauf, zorniger auf seine Tochter als gerechtfertigt.
Prudence kam, die Katzen immer um ihre Fersen, die Treppe heruntergerannt, sodass die Ponyfransen auf ihrer Stirn hüpften und ihre Brüste unter dem Pullover kühn und anmaßend auf und ab hopsten. Doch ihre Eile führte einen Hustenanfall herbei; unten im Flur musste sie innehalten, mit dunkelrot angelaufenem Gesicht, sodass ihre Augen im Kontrast dazu hellgrün leuchteten, und an ihrer Schläfe trat eine dicke Vene hervor.
»Langsam, Prue«, sagte ihr Vater und führte sie zu ihrem Stuhl, den Arm um ihre Schultern gelegt und ohne auch nur ein Wort über das kalt werdende Essen zu verlieren.
Bertram hatte Prudence an ihrem Fenster gesehen und war beim Anblick ihres weißen Gesichts erschrocken; hatte sich gewundert, dass sie in einem dunklen Zimmer am Fenster saß. Wie sie richtig vermutete, hatte er die Fischer nach ihr gefragt. Lächelnd hatten sie sich an die Stirn getippt, aber nichts sagen wollen.
Als er nun vor dem Schlafengehen den Kai entlangschlenderte, sann er weiter darüber nach. ›Das Leben bahnt sich mit Gewalt seinen Weg‹, dachte er. ›Unablässig bereitet es einem seine Schmerzen, und nun, da das Alter bevorsteht‹ – und in seinem Geist stand es immer nur bevor, würde ihn nie erreichen – ›erwartet man, dass Frieden einkehrt, dass die Neugier sich legt und von ruhiger Betrachtung abgelöst wird, von leichten Zerstreuungen und Arbeit. Ich hatte gedacht, abgeschnitten von allem, was ich kenne, an einem fremden Ort könnte ich schaffen, was ich mir schon als junger Mann erträumt und vorgenommen hatte, den an jeder Ecke Liebe, Hass, ja die ganze Welt bestürmte, unentwegt eingespannt, vom Leben selbst beansprucht und gefordert. Dann, hatte ich geglaubt, wäre ich frei. Doch auch hier kriecht nach nur wenigen Tagen die Flut heran und beginnt, gegen mich anzubranden, und mir dämmert, dass es im Leben keinen Frieden gibt‹ – er hatte jetzt die Rettungsstation erreicht und blieb stehen, um auf das schwarze, glitzernde Wasser hinabzuschauen – ›ehe es nicht für immer mit mir fertig ist.‹ Da er ein großes Ego und nur geringe Hoffnung auf Unsterblichkeit hatte, war seine Angst vor dem Tod überwältigend, und er beschloss, ihn zu ignorieren und stattdessen an das Leben zu denken, an die Frau mit dem Krug zum Beispiel oder die Gestalt, die sich dort oben über dem Wachsfigurenkabinett, in einem grünlich erleuchteten Zimmer, hinter Spitzengardinen regte.
Iris kam aus dem Anchor und ging, dicht an die Häuserwände gedrückt, rasch heimwärts.
›Ich muss zurück‹, dachte er. ›Der alte Pallister wird schon dabei sein, die Uhr aufzuziehen, eine Handvoll Wurfpfeile in ein Gefäß auf dem Regal räumen und sagen: ›»War ruhig heute Abend, aber müde bin ich trotzdem.«‹
Er machte kehrt, sodass er den Wind jetzt im Rücken hatte. Der Arzt trat aus seinem Haus, barhäuptig, ohne Mantel. Er ging zu seinem Wagen, der am Bordstein parkte, blieb einen Moment dort stehen und blickte zum Nachbarhaus, in dem kein Licht brannte; dann stieg er in den Wagen und fuhr um das Haus herum zu seiner Garage.
Kaum war Bertram vor dem Anchor angelangt, kam der Arzt wieder zurück, den Kopf gegen den Wind gesenkt, die Hände in den Jackentaschen. Auf den Stufen vor seiner Tür hantierte er mit seinem Schlüsselbund und verschwand nach einem weiteren raschen Blick auf die dunklen Fenstern nebenan im Haus.
Mr Pallister stand mit den Pfeilen in der Hand im Schankraum. »Noch ein letztes Bier?«, fragte er.
»Nein, danke. Ich gehe schlafen.«
»Wenn Sie kein Seemann wären, würde ich sagen, die Meerluft hat Sie müde gemacht. Das stellen die Gäste hier immer fest. Das und den Appetit.« Er war ein blasser, ungesund aussehender Mann, der selten vor die Tür ging.
Als Bertram sich gerade ins Bett legen wollte, hörte er das schnelle Geklapper hoher Hacken auf dem Pflaster, ging zum Fenster und spähte hinter dem Vorhang verborgen hinaus. Es war Tory, die allein aus dem Kino nach Hause kam.
›Was für ein ständiges Kommen und Gehen‹, dachte er gereizt, während er sich zwischen die rauen Laken legte. Er blickte auf den geronnenen, dickmilchigen Himmel. Sieh da!, sagte der Leuchtturm und schwenkte seinen Lichtstrahl durchs Zimmer. Der bemalte Wasserkrug auf der Waschkommode trat kurz hervor und verschwand wieder. Bertram dachte an die Fischerflotte, weit draußen auf dem dunklen Wasser zusammengekauert. ›Und ich an Land, in einem Bett schlafend, wie eine Frau.‹
»Wer war heute Abend da, Iris?«, fragte Mrs Bracey endlich.
»Niemand Besonderes«, sagte Iris, die vor dem Spiegel stand und sich die Haare hochsteckte. Sie sprach undeutlich, weil sie eine Reihe von Haarnadeln zwischen den Lippen hatte. Sie wollte nicht unfreundlich zu ihrer Mutter sein, doch vor ihrem inneren Auge öffnete sich immer wieder die Tür zum Schankraum und Laurence Olivier trat herein. Sobald er sich Iris näherte und zu sprechen anfing, wurde er unscharf und löste sich auf, denn ihr fiel nichts ein, was er zu ihr sagen könnte. Da brachte Maisie ihr schon den Kakao.
Mrs Wilson schloss vor der gespenstischen Gesellschaft im Erdgeschoss ihre Schlafzimmertür ab. Als Bob noch lebte, hatten sie ihr nichts ausgemacht; jetzt war ihr stets bewusst, wie sie in Gruppen dort unten standen, reglos, mit funkelnden Augen, wenn der Lichtstrahl vom Leuchtturm sie anblinkte, die Arme unnatürlich gebeugt oder die Knie in immerwährender Lässigkeit leicht eingeknickt, ein allmählich zerfallender Handschuh zwischen königlichen Fingern drapiert, die unbekannten Gesichter vergessener Mörder der Tür zugewandt, Mrs Dyer, die Kinderpflegerin, mit Staub auf dem Rücken ihrer Hände.
Sie lag frierend in dem muffigen Bett, ganz auf einer Seite, so als ob Bob jeden Moment hereinkommen und sich neben sie legen würde, und betete, der Schlaf möge sie wohlbehalten bis zum Morgen tragen.
Kapitel zwei
Beth saß inmitten ihrer Zeitungsausschnitte beim Frühstück. »Ihre Beobachtungsgabe«, las sie, »ihre große Menschlichkeit.« Sie hielt, während sie ihren Kaffee trank, die Papierstreifen in die Höhe, recht zufrieden mit dem Bild, das hier von ihr entworfen wurde.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!