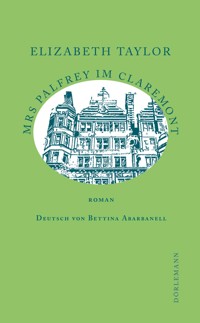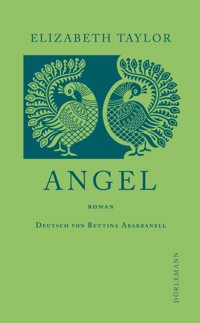
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Dörlemann eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Angelica Deverell wächst Anfang des 20. Jahrhunderts in einer englischen Kleinstadt auf. Ihr Leben über dem Lebensmittelladen der Mutter empfindet sie als trostlos: Niemand erkennt, dass sie zu Größerem berufen ist. Schrei bend fantasiert sie sich in das prächtige Anwesen Paradise House und träumt von einer Karriere als Autorin. Als ein Verlag tatsächlich ihr überbordendes Manuskript annimmt, wird ihr märchenhafter Mädchentraum war.Auf der Höhe ihres Triumphes kauft sie Paradise House – doch Ruhm ist vergänglich und Angel verliert zunehmend den Bezug zur Realität.Mit sprachlicher Eleganz und subtilem Witz gelingt Eli zabeth Taylor das zugleich komische und zutiefst tragische Porträt einer ungeheuerlichen Schriftstellerin.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 443
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Elizabeth Taylor
Angel
Roman
Aus dem Englischen von Bettina Abarbanell
DÖRLEMANN
Die Originalausgabe »Angel« erschien 1957 bei Davies in London. eBook-Ausgabe 2018 Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten © The Estate of Elizabeth Taylor © Dörlemann Verlag AG, Zürich Umschlaggestaltung: Mike Bierwolf unter Verwendung einer Graphik von mmalkani/shutterstock Porträt: © The Estate of Elisabeth Taylor Satz und eBook-Umsetzung: Dörlemann Satz, Lemförde ISBN 978-3-03820-952-2www.doerlemann.com
Inhalt
Elizabeth Taylor
Erster Teil
i
»›in die unermessliche Leere des Empyreums‹«, las Miss Dawson. »Und kannst du mir auch verraten, was ›Empyreum‹ heißt?«
»Es heißt«, sagte Angel. Sie fuhr sich mit der Zunge über die Lippen und blickte aus dem Klassenzimmerfenster zum Himmel jenseits der kahlen Bäume. »Es heißt ›die höchsten Himmelssphären‹.«
»Himmel, ja«, sagte Miss Dawson argwöhnisch und gab Angel das Schreibheft zurück. Sie stand vor einem Rätsel. Es war bekannt, dass das Mädchen oft schwindelte, und Miss Dawson hatte diesen seltsamen Aufsatz – »Sturm auf hoher See« – mit wachsender Unruhe gelesen, besorgt, dass sie ihn irgendwoher schon kannte oder jedenfalls kennen müsste. Einen Abend lang hatte sie aufgeregt in Pater, Ruskin und anderen nachgeblättert. Zwar missbilligte sie solche verschnörkelte Prosa, solche Crescendi und Alliterationen, doch bevor sie den Stil als blumig und vulgär abkanzelte, hoffte sie doch erst einmal herauszufinden, wer sein Urheber war.
Sie hatte sich der Direktorin anvertraut, die ebenfalls fand, dass Vorsicht geboten sei. Für ein fünfzehnjähriges Mädchen sei der Aufsatz erstaunlich, meinte sie – wenn er denn von einem fünfzehnjährigen Mädchen stamme.
»Hat sie so etwas schon öfter geschrieben?«
»Noch nie. Ein, zwei mit Tinte bekleckste Zeilen.«
»›Blitze schnürten und äderten den Himmel‹«, las die Direktorin. »Haben Sie bei Oscar Wilde nachgesehen?«
»Ja, und Walter Pater.«
»Sie müssen sie ins Gebet nehmen. Es wäre nicht das erste Mal, dass sie uns zum Narren hält.«
Wenn Angel sich langweilte, wurde sie mitunter schwach, und einmal hatte sie überall herum erzählt, sie sei eines Winternachmittags auf dem Heimweg von der Schule durch die mit Gaslaternen beleuchteten Straßen verfolgt worden. Einem Polizisten gegenüber hatte sie allerdings später eingeräumt, dass sie sich auch getäuscht haben könnte.
Nachdem die anderen Mädchen nach Hause gegangen waren, stellte Miss Dawson sie zur Rede. Sie glaubt nicht, dass ich es geschrieben habe, dachte Angel und blickte verächtlich auf die wuschige kleine Frau mit dem ewig herunterrutschenden Kneifer und der Vogelnestfrisur. Was meint sie denn, wer es sonst geschrieben hat? Wer das überhaupt könnte? Was für eine Art, sein Leben zu verbringen – sich mit Unterrichtsstunden abplagen, den ganzen Rock voller Kreide, und abends in sein möbliertes Zimmer gehen, um den Shakespeare für den nächsten Tag zu bearbeiten – hier etwas kürzen, da etwas kaschieren, damit wir bloß das Wort ›Schoß‹ nicht zu lesen bekommen.
Sie blickte sich in dem trostlosen, allmählich dunkler werdenden Klassenzimmer um, sah die langen Bank- und Pultreihen und all die vertrauten Landkarten und religiösen Bilder. Früher war es ein Schlafzimmer in einem Privathaus namens Die vier Zedern gewesen, das jetzt diese so ziellos geleitete Schule für die Töchter der ortsansässigen Kaufleute abgab. Während öder Stunden malte Angel es sich oft wieder als Schlafzimmer aus, mit dicken zugezogenen Stoffvorhängen, einem Feuer im Kamin, einem weißen Satinnachthemd über dem Stuhl, und mittendrin sie selbst, die gerade von einer Zofe in ihr Korsett geschnürt wurde.
»Nun, ich hoffe, du hältst das durch«, sagte Miss Dawson zweideutig. Sie tauchte einen Füllfederhalter in rote Tinte und schrieb ›Sehr schön‹ unter den Aufsatz.
»Liest du viel, Angelica?«
»Nein, nie.«
»Aber warum denn nicht?«
»Ich finde es nicht interessant.«
»Wie schade. Und was machst du stattdessen in deiner freien Zeit?«
»Meistens spiele ich Harfe.«
Das glaubt sie mir auch nicht, dachte Angel, als sie sah, wie jener argwöhnische Ausdruck wieder Miss Dawsons Gesicht verspannte. Dass sie ihr das mit der Harfe nicht glaubte – was tatsächlich nicht stimmte –, ärgerte sie genauso sehr wie die Sache mit dem Aufsatz, den sie sehr wohl selbst geschrieben hatte, noch dazu mühelos und schnell, einfach bloß, weil ihr der Sinn danach stand.
Als Miss Dawson sie gehen ließ, machte sie einen kleinen federnden Knicks, wie es von ihr erwartet wurde, und lief hinunter in die Garderobe. Im Treppenhaus war es sehr düster. Nur aus einer offenen Tür jenseits des Korridors kam etwas Licht. Das Gewächshaus mit seinen Palmen und Eukalyptusbäumen wirkte grau und gespenstisch. Alle anderen Mädchen waren schon nach Hause gegangen.
Die Garderobe war früher eine große Spülküche gewesen. Sie war mit Haken ausgestattet, an denen jetzt nur Schuhbeutel hingen und ganz hinten in der Ecke Angels Kapuzenumhang. Oft liefen Schaben über den rissigen Steinfußboden, die Wände waren feucht, die Fenster vergittert; zu dieser Tageszeit war es unheimlich dort. Die Mädchen benutzten die Hintertür, wo zwischen den Farnen Abstreifroste waren, eine Reihe Mülltonnen, ein Haufen Kohle und immer sehr viele hellgelbe Schnecken.
Von dem Pfad an der Seite des Gebäudes und dem Lieferanteneingang aus konnte man die Rasenflächen, die Einfahrt, die erleuchteten Fenster und auch die vier Zedern sehen. Hier, zwischen den Lorbeeren, warteten zwei kleine Mädchen, jünger als Angel. Sie hatte die Aufgabe, die beiden sicher zur Schule und von der Schule wieder nach Hause zu begleiten. Ihre Eltern waren Kundinnen im Lebensmittelgeschäft ihrer Mutter.
Die beiden kleinen Mädchen, Gwen und Polly, hatten sich dort in der Dunkelheit gefürchtet. Der Lampenanzünder war längst vorbei, und der Himmel hatte einen dunkelblauen Ton angenommen. Die Luft roch nach Abend, rauchig und beunruhigend.
»Ich musste noch dableiben und mir mein Loblied anhören«, sagte Angel. Während sie den Gehweg entlangeilte, streifte sie sich ihre Wollhandschuhe über. Gwen und Polly trabten neben ihr her. Sie liefen den Berg hinunter, vorbei an terrassen- und halbmondförmigen Straßen mit georgianischen Villen und dunklen Gärten voll wispernder toter Blätter.
»Wenn du im Paradise House bist«, fragte Polly, »gehst du dann manchmal im Dunkeln allein in den Garten?«
»Ich nehme meinen Hund mit, Trapper. Wir laufen überall auf dem Gelände herum. Bei den Ställen ist es ziemlich gruselig – allein schon, wie die Pferde schnauben und stampfen.«
»Sind es deine eigenen Pferde?«
»Später, wenn ich erbe, ja.«
»Aber wer kümmert sich jetzt um sie?«
»Stallmeister und Stallburschen. Alles wird gut gepflegt, genauso wie das Haus. Wir haben Staubdecken im Wohnzimmer und Teppichschoner, aber die Haushälterin sorgt dafür, dass an dem Tag, an dem ich dort einziehen kann, alles blitzt und blinkt.«
»Aber es ist doch schade, dass du warten musst«, sagte Polly. »Warum kannst du nicht jetzt schon einziehen?«
»Meine Mutter hat ihr Erbe verloren, weil sie unter ihrem Stand geheiratet hat. Sie kann nie mehr dorthin zurückkehren, deshalb dürft ihr niemandem vom Paradise House erzählen, auf keinen Fall.«
»Natürlich nicht«, flüsterten sie rasch, wie immer. »Aber warum nicht?«, fragte Gwen.
»Weil es meiner Mutter das Herz bricht, davon zu hören. Wenn ihr zuhause auch nur ein Sterbenswörtchen darüber verliert und es ihr zu Ohren kommt, kann ich für nichts garantieren.«
»Wir verlieren kein Sterbenswörtchen«, sagte Polly. »Erzählst du uns weiter von den weißen Pfauen?«
Jeden Tag lauschten sie den Geschichten vom Paradise House. Sie waren lebendiger für sie als die ärmlichen Gassen, zu denen die Halbmond- und Terrassenstraßen sich mehr und mehr verengten, je näher sie ihrem eigenen Zuhause kamen. In kleinen Eckläden brannten nackte Gasflammen, doch die Reihen gelber Backsteinhäuser waren dunkel: In deren nach vorne gelegenen Stuben, hinter den Farnsimsen und Pflanzenkübeln, brannte nur sonntags Licht. Kohlenwagen und Bierkarren ratterten vorbei, aber Kutschen fuhren hier nicht. Den üblen Geruch der nahen Brauerei nahmen die Mädchen gar nicht wahr, damit waren sie aufgewachsen.
»Erzählst du uns morgen noch mehr?«, fragte Polly, als sie am Zaun ihres kleinen Vorgartens angekommen waren.
Oft erschrak Angel, wenn die Mädchen so an ihrem Gartentor stehen blieben, zum einen, weil sie die beiden vergessen hatte, zum anderen, weil sie sich zu plötzlich vom Paradise House in diese ärmliche Gegend mit ihren Lagerhäusern und Fabriken und dem großen, brütenden Gasspeicher zurückversetzen musste.
»Vielleicht«, sagte sie achtlos. Sie öffneten das Tor und verabschiedeten sich von ihr, aber sie war schon weitergegangen, fest in ihren Umhang gehüllt, und eilte die Straße entlang, wieder mit ihren eigenen, seltsamen Gedanken beschäftigt.
Auf halbem Weg die Volunteer Street hinunter gab es eine Reihe von Geschäften: einen Fish-and-Chips-Imbiss, aus dem Kinder mit heißen, fettigen Päckchen gelaufen kamen; einen Zeitungshändler; eine Apotheke, aus der ein schwaches Licht durch drei Glasflaschen voll roter, grüner und violetter Flüssigkeit schien und die mit Sennesfrüchten und Schwefel gefüllten Schalen im Schaufenster färbte. Hinter dem Textilgeschäft und damit das letzte in der Reihe war das Lebensmittelgeschäft; hier packte Eddie Gilkes, der Lieferjunge, gerade eine Warenbestellung ein und wog Zucker in rosa Tüten ab. Neben ihm auf dem Ladentisch lag ein mit den Abdrücken seiner dreckigen Finger übersätes Stück Käse. Das Sägemehl auf dem Boden war jetzt, am Ende des Tages, ganz verwischt und zertreten.
Angel ignorierte Eddies Gruß und ging durch den Laden nach hinten. Kisten stapelten sich auf dem dunklen Flur jenseits der Tür. Am Fuß der Treppe standen Gläser mit eingelegten Gurken und ein Essigfass. Der Geruch von Speck und Seife durchzog die oberen Zimmer, Angels kaltes, stickiges kleines Schlafzimmer und das helle Wohnzimmer, wo Mrs. Deverell sich gerade zum Feuer vorbeugte und Brot toastete.
Über der grünen Tischdecke aus Chenille lag eine Häkeldecke, und das Licht schien auf die Tassen und Untertassen herab. Das Zimmer war zu vollgestellt; zwischen dem Tisch und den anderen Möbeln, dem Rosshaarsofa, der Chiffonnier-Kommode, der Tretnähmaschine und dem Harmonium, kam man kaum noch hindurch. Auf jeder freien Fläche standen Fotos. Der Kaminaufsatz war mit Kugelfransensamt bedeckt, und ein Perlenvorhang verbarg den weißglühenden Gasstrumpf.
Mrs. Deverell schützte ihr Gesicht mit einer Hand vor dem Feuer, aber ihre Wangen waren dennoch rosig. Es war sehr warm im Zimmer. »Du bist spät dran«, sagte sie.
»Ich hatte es nicht eilig.«
»Du hast deine Tante Lottie verpasst. Du weißt, wie sie sich immer darauf freut, dich zu sehen. Ich hatte dir doch gesagt, dass heute ihr Mittwoch ist.«
Angel teilte den Vorhang und legte die Stirn ans beschlagene Fenster.
»Meine Güte, ist es warm hier drinnen. Wie hältst du das bloß aus.«
Sie sehnte sich danach, in der kalten Luft und Dunkelheit spazieren zu gehen. Die Wirklichkeit dieses Zimmers brachte sie zur Verzweiflung; mit dem Rücken zu ihr schloss sie die Augen. Sich auch noch die Finger in die Ohren zu stecken, um die Stimme ihrer Mutter auszusperren, traute sie sich nicht. Sie hatte den Besuch ihrer Tante vergessen und war froh, ihm entgangen zu sein. In Gegenwart der Schwester ihrer Mutter fühlte sie sich immer, als würde sie bebrütet, so durchdringend waren ihre Blicke und so nachdrücklich befragte sie sie, vor allem über die Schule, deren Gebühren die Tante bezahlen half. Die beiden Schwestern waren maßlos beeindruckt, dass Angel der Volksschule an der Ecke entkommen war. »Sag mal etwas auf Französisch«, drängten sie sie. Schroff und muffelig gehorchte Angel. Sie wussten nicht, dass sie einen schauderhaften Akzent hatte – den sie ihr Leben lang behalten würde.
Allons, enfants de la patrie!
Le jour de gloire est arrivé.
Contre nous de la tyrannie
L’étendard sanglant est levé.
»Fabelhaft, nicht wahr?«, sagten sie dann, begeistert, dass sie für ihr Geld so viel bekamen. Angel war nicht ganz klar, warum sie sich dadurch schlecht behandelt und gedemütigt fühlte. Sie versuchte, die Neugier ihrer Tante abzuwehren, äußerte sich unbestimmt und ausweichend, und wenn sie endlich in Ruhe gelassen wurde, kniete sie sich aufs Sofa und schaute auf die Straße hinunter, zu den Kindern, die dort Himmel und Hölle spielten und über Seile sprangen, die sie an Laternenpfähle banden; zu dem Milchmann, der Milch in Krüge schöpfte, dem Leierkastenmann mit seinem Affen.
Irgendwann vergaßen die beiden Schwestern sie, und Angel lauschte ihrer Unterhaltung, den Geschichten vom Paradise House, wo Tante Lottie Kammerzofe war. Häufig, wie auch an diesem Abend, sah sie die Straße gar nicht, weil die prächtige Vision jenes Herrenhauses alles andere ausblendete. Sie erkundete die Zimmer und Emporen, lief auf den grasbewachsenen Pfaden zwischen Eiben und Statuen entlang.
»Sie hat diesen fettigen Kuchen von der Köchin mitgebracht«, sagte Mrs. Deverell jetzt. Sie nahm ihn, glänzend und mit Korinthen gespickt, aus dem Ofen. »Das zeigt, wie viel sie von ihr halten.«
Angel ließ die Vorhänge fallen und ging zum Tisch.
Ihre Mutter holte den Toast und die Teekanne. Sie stellten sich hinter ihre Stühle. »O Gott, von dem wir alles haben, wir danken Dir für diese Gaben«, sagte Mrs. Deverell. »Ich könnte dir ein gekochtes Ei machen, wenn du möchtest. Deine Tante hat mir ein paar vom Gärtner mitgebracht, frisch gelegt.«
»Nein, danke, ich habe keinen Hunger«, sagte Angel. Sie stupste die Katze vom Stuhl und setzte sich.
Nach dem Tee ging Mrs. Deverell nach unten in den Laden. Es gab zwischen ihnen die stillschweigende Übereinkunft, dass es zwecklos wäre, Angel auf die Privatschule zu schicken, wenn sie sich nach Schulschluss hinter der Theke erniedrigen müsste. Also blieb sie allein oben sitzen. Ihre Mutter hatte ihr ein Unterkleid zum Festonieren gegeben, aber sie kam damit von einem Wochenende zum anderen kaum voran. Nach ein, zwei Stichen hielt sie sich den Batist dicht vor die Augen, allerdings nur, wenn sie allein im Zimmer war. Sie war kurzsichtig und fest entschlossen, es zu verbergen. Lieber wollte sie sich alle möglichen Fehler vorhalten lassen, als den Grund dafür zu nennen und zu riskieren, dass man sie zum Tragen einer Brille zwang.
Sie gefiel sich mit ihrem seltsamen Äußeren, und in der Tat waren ihre Farben, die grünen Augen, das dunkle Haar und der helle Teint, markant und dramatisch; doch ihre Gesichtszüge hatten schon jetzt, obwohl sie erst fünfzehn war, etwas erschreckend Adlerartiges; ihre Zähne standen vor, und die astigmatischen Augen fokussierten manchmal nicht richtig. Ihre Hände fand sie außergewöhnlich schön, und bisweilen, wie an diesem Abend, betrachtete sie sie minutenlang, spreizte, drehte und wendete sie hin und her, um sie aus jedem Blickwinkel anzuschauen und sich Granatarmbänder an ihren Handgelenken vorzustellen.
»Madams Granate würden Angel gut stehen«, hatte Tante Lottie einmal gesagt und hinzugefügt: »Ich würde Granate jederzeit Rubinen vorziehen.«
»Ich glaube, Angels Stein ist eher der Smaragd«, sagte Mrs. Deverell. Angel spielte diesen Wortwechsel später noch häufig durch. Manchmal wählte sie Smaragde, zu ihren Augen passend; an diesem Abend Granate, um ihre Haut zum Leuchten zu bringen.
Im Paradise House gab es eine andere Angelica, Madams Tochter, deren Name nie abgekürzt wurde. Vor Bewunderung für ihre Herrin und alles, was sie tat, hatte Tante Lottie diesen Namen bei Angels Geburt längst parat gehabt. Über einen Jungennamen wurde nie nachgedacht, denn Madam hatte keine Söhne. Bis Angel zur Schule kam und es richtig lernte, hatten sie ihren Namen immer mit zwei ›l‹ geschrieben.
Die Angelica, deren Name sie kopiert hatten, war einen oder zwei Monate älter als Angel, aber nicht so groß wie sie, betonte Tante Lottie. Ein eigensinniges kleines Fräulein sei sie, mollig und rosig weiß. Die Granate wären an sie verschwendet. Bei ihrem faden Aussehen und den Händen, die vom vielen Reiten und Hundewaschen rau wie Jungenhände seien, verdiene sie vielmehr eine Saatperlenkette, meinte Tante Lottie. Angel mochte dieses Mädchen nicht, das sie noch nie gesehen hatte, aber so gut kannte, und betrachtete eitel Form und Blässe ihrer eigenen Hände.
Wenn Kunden kamen und gingen, hörte sie unten die Ladentür klingeln. So viele Frauen hoben sich ihren Einkauf für den Abend und ein Schwätzchen auf, wenn ihre Ehemänner im Garibaldi oder im Volunteer waren. In dem behaglichen Geschäft wurden Vertraulichkeiten ausgetauscht, während Mrs. Deverell zerbröckeltes Gebäck wog oder den Draht säuberlich durch den Käse zog. »Das soll nicht heißen, dass ich froh wär, wenn es noch weitergeht.« Mrs. Deverell kannte das alles meistens schon. Sie habe es doch so gewollt, sagte sie dann, oder er; in einer Welt, in der Ehen nicht von Mrs. Deverell geschlossen wurden – wer konnte da erwarten, dass es anders endete als mit Ehefrauen, die behaupteten, gegen den Schrank gestoßen zu sein, wenn sie ein Veilchen hatten, oder versprachen, nächste Woche einen Teil ihrer Schulden abzubezahlen, um dann jeden Dienstag mit ihrem Bügeleisen zum Leihhaus zu rennen und es am darauffolgenden Montag unter ihrem Umhang verborgen wieder abzuholen.
Mrs. Deverells eigenes Eheleben war kurz und im Rückblick makellos gewesen. Ihr Mann hatte sich bloße anderthalb Jahre lang durch ihr Eheglück gehustet. Angel kannte nur ein Foto von ihm. Die Erinnerung an ihn war stärker verblasst als dieses Bild, das eine Wachsfigur von einem Mann mit gelocktem Bart und schlecht sitzenden Kleidern zeigte. Angel wollte nichts mit ihm zu tun haben. Ihre forsche, mutige, lebhafte Mutter hatte ihn längst vergessen. Sie hatte ihre Schwester und ihre Nachbarn, und sie hatte Angel, mit der sie ihnen gegenüber prahlen konnte. ›Dieser Engel‹, wurde das Mädchen folglich genannt. Sie war einsam, ohne es zu merken.
Schlaff und träge träumte sie sich durch die Abende, die Augen geschlossen, um die Dunkelheit zu erzeugen, in der das Paradise House Gestalt annehmen konnte – mit Wandelgängen und Kuppeln, Torbögen und Treppenfluchten jeden Tag schöner und größer, als ihre Tante es je beschrieben hatte. Habgierig fügte sie ein Detail nach dem anderen, von Fotografien und Zeichnungen in Geschichtsbüchern abgeschaut, hinzu. Dieses passt gut ins Paradise House, war eine zwanghafte Formel, die ihr zur täglichen Gewohnheit wurde. Die weißen Pfauen würden passen; und in der Städtischen Kunsthalle gab es Porträts, die passend wären; ebenso wie die Zedern auf dem Schulgelände. Je plastischer das Haus, umso schattenhafter die Menschen darin. Angel selbst eignete sich Madams Schmuckkasten an, ihr Bett und ihren Ehemann. Allein diese andere Angelica hemmte sie in ihrer Fantasie, mit ihrem hübschen Aussehen und all ihren Hunden und Pferden ein ärgerliches Hindernis. Wenn Angel durch die Flure und Gärten wandelte, stieg vor ihrem inneren Auge wieder und wieder das Bild dieses Mädchens auf, das in ihren Träumen keinen Platz hatte und sie bremste. Der Traum selbst, der keine Belanglosigkeit war, sondern die ganze Kraft ihrer Konzentration forderte, löste sich dann auf, sie öffnete die Augen und blickte auf ihre Hände, spreizte die Finger und drehte die Handgelenke hin und her.
Manchmal befielen sie auch Ahnungen der Wahrheit. In solchen Momenten wurde ihr Herz wie durch einen plötzlichen Trommelwirbel in Alarm versetzt, und sie sprang auf, bedrängt von der Wirklichkeit des Zimmers, ihres eigenen Gesichts im Spiegel – nicht schön, das sah sie – und der gewöhnlichen Geräusche im Laden unter ihr. Dann wusste sie, sie war in ihrer eigenen Umgebung und hatte keinen Grund zu der Annahme, dass sie jemals woanders sein würde; wusste auch, dass sie nicht über die Möglichkeit verfügte, sich selbst zu retten, weder über die Intelligenz noch die Schönheit, dank derer andere junge Frauen entkamen. Sie blickte in ihr panisches Gesicht, bemühte sich verzweifelt, ihre Identität zu leugnen und sich langsam von der Wahrheit wegzuhätscheln. Sie lernte, über die Wirklichkeit zu triumphieren, und die Wahrheit war schon auf dem besten Weg, sie in Frieden zu lassen.
Auch dieser Abend ging vorüber, ohne dass sie merkte, wie die Zeit verstrich. Sie streifte gerade durch mondbeschienene Rosengärten, als sie hörte, wie ihre Mutter den Laden schloss, rasselnd die Ketten vor die Tür legte und langsam die Treppe heraufkam.
Angel sah aus wie das Gemälde eines anmutig über ihrer Näharbeit eingeschlafenen Mädchens, mit der ebenfalls schlafenden Katze zu ihren Füßen. Das Feuer war fast ganz heruntergebrannt, gerade als Mrs. Deverell gerne den Rock gehoben und sich ein, zwei Minuten die Fußgelenke gewärmt hätte.
»Oh, ich bin eingedöst«, sagte Angel und gähnte wohlig.
»Das passiert doch immer. Du tätest besser daran, ins Bett zu gehen.« Mrs. Deverell rührte mit dem Schüreisen zwischen den Stäben des Kaminrosts herum und nahm den Blasebalg zur Hand.
»Miss Little war da, um Brause zu kaufen. Sie hat mir erzählt, dass die alte Mrs. Turner letzte Nacht an Wassersucht gestorben ist.«
»Wie ekelhaft!«, sagte Angel und gähnte, bis ihr die Tränen kamen. Das erste Gähnen war gestellt gewesen; jetzt konnte sie nicht mehr damit aufhören.
Ihre Mutter stellte einen kleinen Topf Milch auf die Herdplatte und ein paar Tassen und Untertassen auf ein Tablett. Die Idee, aufzustehen und ihr zu helfen, kam Angel nicht.
Am nächsten Morgen warteten Gwen und Polly nicht wie sonst am Gartentor, und als Angel zögernd dastand, sah sie die Mutter der beiden, die sie in der Dunkelheit hinter den Spitzengardinen beobachtete. Als Angel zu ihr hinschaute, trat sie vom Fenster weg. Der dunkle Stoff ihres Kleids verband sich mit dem schattigen Raum, und nur ihr farbloses Gesicht war auszumachen.
Angel drückte das eiserne Tor auf. Als die Frau es in den Scharnieren quietschen hörte, kam sie schnell ans Fenster, klopfte mit den Knöcheln dagegen und schüttelte den Kopf. Ihr Gesicht war vor Argwohn und Missbilligung ganz verkniffen, und als Angel die Straße hinunterging, fragte sie sich, warum sie das Gefühl hatte, verächtlich gemacht worden zu sein. Ein wenig besorgt eilte sie weiter, um nicht zu spät zu kommen, bis sie andere Mädchen vor sich trödeln sah.
Sie hatte nie besonders enge Freundinnen gehabt, und die meisten Menschen kamen ihr unwirklich vor. Wegen ihrer Unnahbarkeit und vermeintlichen Eitelkeit war sie unbeliebt, und doch gab es Zeiten, in denen sie aus Unsicherheit den dringenden Wunsch verspürte, sich zu behaupten; sich einen Namen zu machen; von gleich zu gleich zu reden, so nannte sie es bei sich. Doch da sie sich anderen nie gleich gefühlt hatte, verfiel sie von der Herablassung in die Anbiederung, indem sie ›persönliche Bemerkungen‹ machte, wie die anderen Mädchen sagten, und ihnen mit flapsigen Schmeicheleien zu nahe trat.
Wenn sie sich näherte, verstummten oft die Gespräche; so auch an diesem Morgen, als sie Ellie und Beattie eingeholt hatte, zwei Mädchen ihres Alters. Sie traf auf ein hartnäckiges Schweigen, dem anzumerken war, dass die beiden hofften, sie würde schnell weitergehen.
»Sind wir spät dran?«, fragte sie gespielt atemlos.
»Dachten wir eigentlich nicht«, sagte Ellie.
»Aber wenn du meinst, dass du zu spät kommst, lauf ruhig vor«, sagte Beattie.
Sie passte sich ihrem Tempo an und ging neben ihnen her. Sie fing an, über die Schule zu reden, bekam aber keine Antwort von den beiden. Es war nicht halb so interessant wie das Thema, das sie gerade fallen gelassen hatten.
Als Ellie am Geländer stehen blieb, um sich einen Schuh neu zu binden, schaute Angel zu und machte ihr ein Kompliment zu ihren kleinen Füßen.
»Sie sind nicht kleiner als deine«, sagte Ellie schroff.
Angel blickte auf ihre Füße hinunter und schien überrascht zu sehen, dass dem so war.
»Du meinst wohl, du findest sie klein für mich«, sagte Ellie, und Beattie lachte auf.
Nach längerem Schweigen sagte Beattie nachdenklich: »Und dann hat sie sich also für die cremefarbene Merinowolle entschieden?«
Angels Anwesenheit, hieß das wohl, war gleichgültig für das Gespräch, das sie vorher geführt hatten, und so setzten sie es fort, mit geheimnisvollen Andeutungen, so dass Angel sich nicht daran beteiligen konnte. Sie hatten im Übrigen über die Hochzeit von Ellies Schwester gesprochen, wenngleich mit intimeren Mutmaßungen als solchen, die sich auf die Aussteuer bezogen.
»Weißt du, ich habe dir doch erzählt, was Cyril über den grauen Umhang gesagt hat …«
»Ja.«
»Tja …« Sie senkte die Stimme, und beide Mädchen lachten. Angel versuchte, von ihrer Unterhaltung unbeeindruckt zu wirken. Sie verachtete ihre Aufregung über so eine selbstgestrickte Aussteuer, konnte sich das jämmerlich schamhafte Benehmen der Braut und aller ihr Nahestehenden vorstellen, die Hochzeit in der scheußlichen Congregational Church und das kleine, mit tölpelhaften Verwandten überfüllte Haus danach. Ellie und Beattie kamen zwar aus besseren Verhältnissen als sie, doch sie beurteilte sie nach anderen Maßstäben.
Ellie und Beattie waren jetzt freudig dazu übergegangen, sich ihre eigenen Hochzeitskleider auszumalen und zu überlegen, ob sie in ihren Flitterwochen nach Folkestone oder zum Lake District fahren sollten. So bald wie möglich verheiratete Frauen zu sein, war anscheinend der Gipfel ihres Ehrgeizes – zu einem möglichst frühen Zeitpunkt zu bekommen, was sie vom Leben wollten, und sich danach nichts mehr zu wünschen, sondern für den Rest ihrer Tage in diesem Zustand zu verharren.
»So aufregend! Findest du nicht, Angel?«, fragte Beattie verschlagen.
»Was ist aufregend?«
»Na ja, zu heiraten natürlich!«
»Das kommt ganz drauf an, wen«, sagte Angel.
»Du handelst dir bloß Ärger ein, wenn du deine Sätze mit Fragefürwörtern beendest«, sagte Beattie.
»Ich beginne und beende meine Sätze so, wie ich will.« Sie wollte sich nicht länger bei ihnen einschmeicheln. »Und wie kann man sich darauf freuen, jemanden zu heiraten, den man noch überhaupt nicht kennt?«
»Keine Sorge«, sagte Ellie ärgerlich. »Ich glaube kaum, dass wir lange warten müssen.« Um sich von Angel abzusetzen, hakten sie und Beattie sich ein, was gegen die Schulregeln verstieß.
»Wenn ihr euch verliebt«, sagte Angel, »was spielen Hochzeiten dann für eine Rolle? Was haben all die Kleider und Torten und Geschenke damit zu tun?«
Sie hatte diese Diskussion angefangen, um die Begeisterung der beiden kleinzureden und sich zu rächen, doch jetzt brachte das Thema selbst sie in Fahrt. Bislang dachte sie voll düsterer Abneigung an die Liebe. Sie wollte die Welt beherrschen, nicht einen einzelnen Menschen.
»Ach, wie schlau du bist«, sagte Ellie, vor Wut regelrecht keuchend. Mit hoch erhobenem Kopf und leuchtend roten Wangen drängte sie sich vor Angel durch das Schultor. Sie hatte jenen verächtlichen Blick, den Angel noch oft bei Frauen sehen würde, die aus lauter Angst vor der Unzulänglichkeit zornig werden, wenn sie sich durch unkonventionelle Menschen in ihrer Ruhe bedroht fühlten; und Ellies Zorn kam urplötzlich, in einem großen Schwall, so dass sie sich am liebsten auf der Stelle umgedreht und Angel ins blasse Gesicht geschlagen hätte. »Ja, klar«, rief sie aus. »Natürlich denkst du so. Wer würde auch erwarten, dass du an den heiligen Bund der Ehe glaubst? Das wäre schon sehr merkwürdig.«
Sie eilte auf das Schulgebäude zu, und Beattie, die ziemlich verängstigt wirkte, lief schnell hinter ihr her.
Jetzt entdeckte Angel auch Gwen und Polly; wie Mäuse huschten sie in die Garderobe, als sie sie sahen. Sie erinnerte sich an den Gesichtsausdruck ihrer Mutter, als sie am Morgen ans Fenster getreten war, und fühlte sich angegriffen und verunsichert. Sie dachte über Ellies Worte nach, drehte und wendete sie in ihrem Kopf hin und her, während sie ganz langsam zur Garderobe ging, obwohl die anderen Mädchen schon drinnen waren. Sie war die Letzte, und eine Glocke begann zum Gebet zu läuten.
Der Tag schleppte sich so dahin. Im Klassenzimmer wurde ein Ölofen angezündet, doch die Mädchen, die am Fenster saßen, zitterten trotzdem und rieben sich die Frostbeulen. Während eine langweilige Stunde auf die nächste folgte, blieben sie an ihren Pulten sitzen, es sei denn, sie wurden aufgefordert, aufzustehen und ein paar lahme Übungen zu machen, etwa die Hände über dem Kopf zusammenzuschlagen oder die Arme zu schwingen. Stunde um Stunde mussten sie Dinge auswendig lernen, französische Vokabeln, Psalmen, geschichtliche Daten und die Namen von Flüssen, bis ihre Köpfe so gerammelt voller Fakten waren, dass Gedanken sich darin nicht mehr bewegen konnten. Wenn sie Aufzählungen lernten, brummten sie sie im Chor. In der Zeichenstunde wurden abgegriffene Drucke ausgeteilt, die sie kopieren sollten. Es gab nie neue, und Angel hatte schon ein Dutzend Mal dieselbe Windmühle abgezeichnet. In Handarbeiten machten sie Kettenstichmuster auf Rohleinenstücken, die nach Klebstoff rochen.
Über Mittag blieben nur ein paar Mädchen in der Schule. Sie packten ihre Brote aus. Niemand sprach mit Angel, die an ihrem Pult saß, ihr Mittagessen auswickelte und es hungrig aß, den Blick unverwandt aus dem Fenster gerichtet.
Gegen Nachmittag radierte ein weißer Nebel die gewaltigen, mehrstufigen Äste der Zedern nach und nach aus, und der Himmel wurde zusehends bleicher; gegen vier Uhr hatte er die Farbe von Schnupftabak. Der Tag war ihr endlos erschienen.
Verträumt ging Angel nach Hause. Da Gwen und Polly nicht am Tor auf sie warteten, hatte sie niemanden, mit dem sie sprechen, niemanden, den sie mit ins Paradise House nehmen konnte, und so fehlte der einzig reale Teil ihres Tages. Langsam wanderte sie durch die nebligen Straßen, und zuhause ging sie gleich nach oben ins Wohnzimmer. Ihre Mutter saß wie üblich am Feuer und machte Toast, blickte sich aber nicht um und begrüßte Angel auch nicht. Sie wartete, bis das Brot golden war, drehte es an der Gabel herum und sagte dann scharf, um das Zittern ihrer Stimme zu verbergen: »Ich möchte mit dir sprechen, junge Dame.«
»Ja?«, sagte Angel misstrauisch. Sie wappnete sich gegen einen irgendwie gearteten Schock. Obwohl sie sich nicht denken konnte, worum es ging, hatte sie sich schon den ganzen Tag bedroht gefühlt, so als bringe jeder Moment sie einem Erlebnis näher, das sich als absolut katastrophal für sie erweisen könnte. Sie beobachtete ihre Mutter dabei, wie sie den Toast von der Gabel nahm und ihn vorsichtig butterte, mit gefurchter Stirn, so als suchte sie angestrengt nach einem Weg, mit ihrer Beschwerde zu beginnen. Da sie keinen fand, stürzte sie sich irgendwo jenseits des Anfangs in die Geschichte, sodass Angel sie zunächst nicht verstand.
»Du kannst dir vorstellen, wie ich mich gefühlt habe … so etwas habe ich nicht mehr erlebt, seit dein Vater gestorben ist. ›Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, Mrs. Watts‹, habe ich gesagt. Die Köpfe ihrer Gwen und Polly mit einem solchen Haufen von Lügen vollzustopfen, ich konnte es nicht fassen. Niederträchtige Dinge über deine eigene Mutter zu sagen. Ich habe also eine schlechte Partie gemacht, ja? Ich will dir mal Folgendes sagen, mein Fräulein, wenn dein Vater das Geschäft nicht so aufgebaut hätte, wie es ist, wären wir längst in der Gosse gelandet. Noch dazu war er so ein guter Mann; ich bin froh, dass ihm erspart geblieben ist, was ich heute erleben musste.«
Sie fing an zu weinen, und inzwischen hatte Angel eine Ahnung, wovon sie sprach, und erstarrte zu Eis. Vor ihr breitete sich Leere aus, Verzweiflung, und weil sie keinen anderen Ausweg sah, sehnte sie sich nach dem Tod.
»Du böses, böses Mädchen!« Ihre Mutter stellte das Schluchzen ein und begann wieder zu schimpfen. Sie war noch lange nicht fertig. »All diese Lügengeschichten über einen Ort, an dem du noch nie warst und wohl auch nie sein wirst; aber zu reden, als hättest du einen Anspruch darauf. Und diesen unschuldigen Kindern davon zu erzählen, Tag für Tag, haben sie gesagt. Dich so aufzuspielen. Dir dergleichen anzumaßen. Oh, das war vielleicht schön für mich, das kann ich dir sagen, mir all das anhören zu müssen. Dabei war sie immer eine gute Kundin. Und eine Freundin. Aber jetzt hoffe ich bloß, dass ich sie nie mehr wiedersehe, solange ich lebe. Wie soll ich denn noch den Kopf hoch tragen, wenn ich weiß, was sie den Nachbarn alles erzählen wird! Keiner hat so ein Mundwerk wie sie. Ich kenne sie. Ich weiß noch, wie ich mit ihr im Kirchenchor war. Ich werde nie vergessen, was sie da über meine Schwester gesagt hat. Aber du!« Ihr Ärger gewann wieder die Oberhand über ihren Kummer. Sie beugte sich zu Angel vor und ohrfeigte sie. »Lieber hätte ich dich tot zu meinen Füßen liegen sehen, als mir solche Schande von dir machen zu lassen.« Als sie den Abdruck ihrer Hand auf Angels Wange sah, trat sie beschämt einen Schritt zurück.
Angel hatte die ganze Zeit kein Wort gesagt. Sie drehte sich einen Moment weg, bis sie wieder ein wenig Kraft in den Beinen spürte, und schaffte es dann, aus dem Zimmer zu gehen.
Ihre Mutter lief hinter ihr her und trommelte, als Angel sich in ihrem Zimmer eingeschlossen hatte, mit den Fäusten gegen die Tür, denn sie hatte noch nicht gehört, was sie hören wollte: eine Erklärung. »Warum hast du das getan? Warum?«, schluchzte sie.
Es gab keine Erklärung, und Angel stand auf der anderen Seite der Tür in dem dunklen, kalten Zimmer und schwieg. Sie war seltsam empört, so als hätte ihre Mutter sie beleidigt.
Sie hatte keine Streichhölzer, um das Gas anzuzünden, und begann sich im Dunkeln auszuziehen, schnürte die Stiefel auf, streifte ihre schwarzen Wollsocken ab und ließ alles in einem Haufen auf dem Boden liegen. Sie glaubte, dass ihre Mutter nach unten in den Laden gegangen war, wollte aber nicht riskieren, die Tür zu öffnen. »Wie kann sie es wagen!«, flüsterte sie wieder und wieder, als sie in ihrem Zimmer hin und her stolperte und sich die Haare flocht.
Kein bisschen Licht kam ins Zimmer. Es gab keine Straßenlaternen, die hätten hereinscheinen können, denn das Zimmer lag auf der Rückseite des Hauses, und das Fenster ging zu einem Hof hinaus, in dem sich Kisten stapelten. Angel zog den Rahmen herunter und ließ etwas neblige Luft herein. Alles fühlte sich klamm an, auch die Bettwäsche, in die sie sich legte. Zitternd lag sie da und wartete darauf, dass der Abend vorübergehen würde und dann die Nacht. Ihre Gedanken wussten nicht, wohin, der Fluchtweg war ihnen versperrt, ihr Rückzugsort verseucht. »Wie kann sie es wagen!«, flüsterte sie erneut.
Nach einer langen Zeit hörte sie ihre Mutter die Treppe heraufkommen, vor ihrem Zimmer innehalten und die Klinke herunterdrücken. Dann klopfte sie an die Tür und sagte: »Angel! Du musst mir antworten. Du hast noch nichts gegessen.«
Sie hatte viel an Essen gedacht, als könnte es ein Trost sein, etwas in den Magen zu bekommen, doch jetzt starrte sie in die Dunkelheit und sagte nichts. Sie registrierte, dass sich die Stimme ihrer Mutter verändert hatte – Sorge dämpfte jetzt den Zorn –, doch es kümmerte sie nicht.
Bevor sie einschlief, war ihr, als gäbe es einen Trost – einen anderen als Essen –, wenn sie sich nur daran erinnern könnte, wo er zu finden war. Irgendetwas hatte sie einmal glücklich gemacht, aber was es gewesen war, fiel ihr nicht mehr ein.
Mitten in der Nacht wachte sie auf und wusste, dass sich etwas verändert hatte, sich fremd anfühlte; dann überwältigte sie die Erinnerung. Ihre Lage schien ihr so schrecklich wie zuvor, doch nun war der nächste Tag näher – oder schon angebrochen –, und sie hatte keine Ahnung, wie sie damit umgehen sollte. Sie konnte ja nicht für immer in ihrem Zimmer eingeschlossen bleiben.
Sie stand auf und schlich über den Flur, um sich ein Glas Wasser zu holen. Im Nebenzimmer hörte sie ihre Mutter murmeln und sich im Bett umdrehen. Angel ließ ihre Tür unverriegelt, legte sich wieder hin und zog die Decke fest um sich, damit ihr warm wurde. Ich gehe nie wieder zur Schule, schwor sie sich. Diese hinterhältigen kleinen Biester, Gwen und Polly, haben mich den ganzen Tag beobachtet, sie wussten genau, was mir blühen würde, wenn ich nach Hause käme; und hatten Angst, weil ihnen klar war, dass sie mich verraten hatten.
Sie zog die kalten Füße unters Nachthemd. In Panik erkannte sie jetzt mehr von den Möbeln und sah, dass die Wände heller wurden. Bald waren Schritte auf der Straße zu hören, Fabriksirenen heulten, und am Ende der Volunteer Street rumpelte ein Auto über das Kopfsteinpflaster des Butts, wie der alte Marktplatz genannt wurde.
Es war, als ich den Aufsatz geschrieben habe, dachte sie plötzlich. »Sturm auf hoher See.« Da war ich glücklich.
Sie freute sich, dass es ihr wieder eingefallen war, wurde ruhiger und schlief ein.
Wie durch ein Wunder wurde sie vor den Verletzungen des nächsten Tages bewahrt. Ihre Mutter wachte früh auf und dachte im Bett darüber nach, wie sie und Angel ihr Dasein fortführen könnten, so zusammengepfercht, in so dicker, von Befangenheit beschwerter Luft. Es geht darum, wie man wieder ins Alltägliche zurückfindet, dachte sie, so wie Hinterbliebene es tun. Ihr Zorn war verraucht, aber sie glaubte nicht, dass sie mit Angel je wieder ungezwungen umgehen könnte oder es schaffen würde, ihr Unbehagen zu verbergen. Frühere Schwierigkeiten, so wie Unzufriedenheit und schlechte Laune, hatte sie mit ihrer Spontaneität überwunden; jetzt war sie sicher, dass sie nie mehr spontan sein oder auch nur ein einziges Wort verwenden könnte, das sie nicht vorher abgewogen hatte; so wie auch jetzt, an diesem Morgen, bevor sie mit Angel zusammentraf.
Als es Zeit wurde, zog sie sich an und ging in die Stube, um das Feuer zu schüren und den Frühstückstisch zu decken. Es war noch gar nicht richtig hell, doch ein paar Leute gingen schon zur Arbeit, und bald hörte sie Eddie an der Tür und öffnete ihm. Sie schnitt ein paar Scheiben Speck fürs Frühstück ab und ging wieder nach oben. Es war Zeit, Angel zu rufen, und von der Verwirrung in ihrem Inneren wurden ihre Wangen ganz rot, sodass sie noch immer empört aussah.
Das Mädchen schlief. Ihr einer Arm, der bis zum Ellbogen entblößt über der Bettdecke mit dem Wabenmuster lag, war tiefrot, ebenso ihr Hals und ihre Stirn. Mrs. Deverell vergaß alle Verlegenheit und einstudierten Reden und trat näher ans Bett. Angel drehte im Schlaf den Arm herum, rieb ihn an der Decke; dann öffnete sie die Augen und starrte ins Zimmer. Noch im Halbschlaf begann sie sich zu kratzen, zuerst den einen, dann den anderen Arm, und zog dabei verwirrt die Stirn kraus.
»Liebes, was hast du denn? Was ist los?«, fragte ihre Mutter und legte ihr die Hand auf die brennende Haut, die mit Schwielen und Flecken übersät war.
Binnen weniger Sekunden nach dem Aufwachen hatte Angel die Lage erkannt. Ihre Ängste lösten sich auf, und das Verhalten für diesen Tag war geklärt. Sie war krank und damit gerettet. Als sie sich rieb und kratzte, entzündete sich ihre Haut noch heftiger, und das freute sie. Wenn sie es schlau anstellte, könnte tagelang nichts anderes zu ihr gesagt werden als: »Wie geht es dir?« oder »Was möchtest du?« So schlau zu sein wäre ein Leichtes für sie, und sie fing sofort damit an, murmelte unverständliches Zeug und schaute durch ihre Mutter hindurch, als sähe sie sie nicht.
Mrs. Deverell füllte eine Kruke mit heißem Wasser, wickelte sie in ein altes Leibchen und legte sie Angel an die Füße. Dann ging sie ins Wohnzimmer, nahm einen Band von dem Stapel Bücher auf dem Harmonium und begann, über Krankheiten nachzulesen. Nach einer Weile geriet sie in Panik, unsicher, ob es sich um Scharlach oder Wundrose handelte, und entschloss sich zu einem extremen Schritt – sie bat Eddie, auf der Stelle zu Doktor Foskett zu laufen.
In dem Medizinband hatte Wundrose noch einen anderen, dramatischeren Namen, Antoniusfeuer, und als der Arzt kam, hatte Mrs. Deverell es so eilig mit der Diagnose, dass die gängige Bezeichnung ihr nicht mehr einfiel und sie diese andere verwendete. Angel hatte sich seit dem Aufwachen nicht gerührt, außer um sich die Arme zu reiben und die Entzündung zu verschlimmern. Als ihre Mutter ihr eine bange Frage nach der anderen stellte, hatte sie das Gesicht ins Kissen gedreht, doch der Name dieser so seltsam klingenden, mystischen Krankheit erfüllte sie mit Ehrfurcht und Neugier. Sie öffnete die Augen, schaute den Arzt an und sah, dass er versuchte, nicht zu lachen, während er sich vorbeugte und ein Stethoskop aus seinem Gladstone-Koffer holte.
Solange er ihre Brust abhorchte, lag Angel still da. Sie war dabei, sich zu erholen, ihre Wunden zuzudecken, wie eine Auster es macht. Lügen konnte sie widerstandsfähig machen, und die Erniedrigung, die sie erlitten hatte, war gut versteckt. »Als ich krank war«, so nannte sie es später bei sich und erwartete, dass andere es ihr gleichtun würden. Sie war dazu erzogen worden, den Arzt zu fürchten. Groß und bärtig, mit einem Gehrock bekleidet, schien er ihr so angsteinflößend, so geheimnisvoll wie Gott. »Du willst doch nicht, dass ich den Arzt hole, oder?«, hatte ihre Mutter oft gesagt, wenn sie sich weigerte, etwas zu essen, das angeblich gut für sie war, Haferschleim oder heiße Milch mit Zucker oder einen widerlichen Eggnogg, den sie zur Schlafenszeit bekam, damit sie »groß und stark« würde. Jetzt erkannte sie, dass er bloß ein beschäftigter, womöglich reizbarer Mann war, der sein heimliches Vergnügen am Verhalten seiner Patienten fand. Sie schwor sich, niemals zu diesem Vergnügen beizutragen, und empfand Verachtung für ihre Mutter, die so unsinniges Zeug daherplapperte und sich seinen Beobachtungen auslieferte.
»Nun, ich glaube nicht, dass es – was war noch gleich Ihre Vermutung – ach ja, also, dass es Antoniusfeuer ist«, sagte der Arzt. »Nein, ich denke, das können wir ausschließen. Was hast du gegessen?«, fragte er Angel.
»Nichts«, sagte sie teilnahmslos.
»Sie wollte nichts«, sagte ihre Mutter schnell.
»Hast du Schellfisch gegessen?«
»Also bitte, das würde ich sie niemals anrühren lassen.«
»Oder Schmalzfleisch?«
»Nein, Herr Doktor.« Mrs. Deverell klang entsetzt.
»Dann bleibt es ein Rätsel. Hast du Stuhlgang gehabt?«, fragte er Angel und wusste nicht recht, ob sie so geringschätzig die Augen niederschlug, weil sie welchen gehabt hatte oder weil sie sich zu keiner Antwort herablassen wollte.
Mrs. Deverell schien skeptisch. Den Kopf zur Seite geneigt, schlug sie Lakritzpulver vor und redete dies und jenes vor sich hin, während Dr. Foskett seine Gerätschaften wieder einpackte. Er schien nicht daran interessiert, Angels Speiseplan für den Tag zu diskutieren, hieß alles gut, was Mrs. Deverell nannte, und sagte dann, es könne auch nicht schaden, ganz auf Essen zu verzichten. Angel hörte das voller Entsetzen. Sie hatte schrecklichen Hunger. Aber sie sprach sich Trost zu; es ist besser, krank zu sein als gesund, dachte sie. Es ist besser, zu verhungern, als mit meiner Mutter sprechen oder zur Schule gehen zu müssen.
Als der Arzt gegangen war und Mrs. Deverell so ratlos wie zuvor, aber erleichtert zurückließ, schien Angel wieder eingeschlafen zu sein, und der Ausschlag auf ihren Armen wirkte blasser. Mrs. Deverell ging in den Laden hinunter, wo Eddie sich bestimmt gerade mit Zuckerwaffeln bediente.
Angel überlegte, wie sie heimlich aufzustehen und sich etwas zu essen holen könnte, doch die Gefahr, als nicht so krank entlarvt zu werden, wie sie sich gestellt hatte, schien ihr zu groß, also blieb sie liegen. Sie döste, wachte auf und kratzte sich, damit der Ausschlag schlimmer wurde, besorgt, dass er ganz verschwinden könnte. Mrs. Deverell fand Zeit, ein Schollenfilet zu dünsten, und als sie es ihr brachte, seufzte Angel undankbar und starrte auf das Tablett, als sei der bloße Anblick ihr schon zu viel. Sie wartete darauf, dass ihre Mutter wieder ging. Sie wollte allein sein, wenn sie aß, und das nicht nur, weil sie ihren Appetit verbergen musste. Seltsamerweise war sie beim Essen gern allein, fast so, als wäre sie ins Essen verliebt und zöge Trost daraus. Es störte sie, bei den Mahlzeiten zu reden.
»Möchtest du es nicht essen?«, fragte ihre Mutter. Sie waren beide immer noch auf der Hut, doch Angels Krankheit machte eine Unterhaltung möglich.
»Ich versuch’s.«
Das Essen wurde kalt, und als Angel Messer und Gabel aufnahm, zitterten ihr vor Verzweiflung die Hände.
»Na, dann tu dein Bestes. Ich muss wieder nach unten.« Mrs. Deverell trank hinter der Theke eine Tasse Fleischbrühe, und wann immer sie Hunger bekam, nahm sie sich einen Keks aus einer der Dosen oder eine Handvoll Rosinen.
So langsam sie konnte, aß Angel den ganzen Fisch und die beiden dünnen Scheiben Brot mit Butter und trank etwas Milch. Als ihre Mutter zurückkam, stand das Tablett auf dem Boden, und der Teller war so sauber, als wäre er poliert worden.
»Alles aufgegessen? Das ist gut.«
»Das war leider die Katze.«
»Die Katze?«
»Ich hab’s dann doch nicht geschafft, und das Tablett war so schwer auf meinen Beinen, also habe ich es auf den Boden gestellt, und die Katze hat sich drüber hergemacht. Aber ein bisschen habe ich auch gegessen.«
»Aber ich hatte die Katze doch ausgesperrt!«
»Du hast sie eingesperrt.«
»Und wo ist sie dann jetzt?«
»Ich bin aufgestanden und habe sie rausgelassen.«
»Nein, wie ärgerlich! Und so teuer, wie der Fisch war! Ich hatte so gehofft, du würdest es schaffen. Gibt es denn nichts, was dich reizen könnte, zum Tee?«
Angel hätte so vieles nennen können, pochierte Eier, Käsetoast, geräucherten Schellfisch mit viel Butter; aber sie schüttelte den Kopf.
Als es Abend wurde, hatte sie sich entsetzlich zu langweilen begonnen. Obwohl sie sich nicht krank fühlte, litt sie unter einer geistigen Schlaffheit, einer großen Dumpfheit im Herzen. Sie sehnte sich nach einem anderen Leben: möglichst erwachsen, schön und reich zu sein; Macht über viele verschiedene Arten von Männern zu haben. Zum Zeitvertreib fing sie an, sich so ein Leben vorzustellen, eine Szene nach der anderen, ganz plastisch. Mit Geschichten oder Erklärungen hielt sie sich nicht auf. Sie war, in ihren Träumen, einfach nur der Mittelpunkt jeder Szene, noch weitgehend sie selbst, mit ihren grünen Augen und ihrem schwarzen Haar, und nur wenigen Änderungen; von ihrer Nase, die ihr für romantische Abenteuer zu lang schien, nahm sie eine Nuance weg.
Als ihre Mutter ihr etwas Brot und Milch zum Abendessen brachte, war sie gerade in Osborne, in roten Samt gekleidet, und kehrte, sobald sie gegessen hatte, schnell dorthin zurück. Sie senkte den Kopf und machte einen tiefen Knicks, bei dem ihr Rock sich wie eine Blume um sie ausbreitete. Ihre Granate waren ein dunkles Feuer auf ihrer weißen Haut. Dann tat die alte Queen etwas Unerwartetes, Anmutiges, und ein Raunen ging durch die Menge: Sie beugte sich vor und küsste Angel auf die Stirn.
Als Mrs. Deverell die Bettdecke glattgestrichen, ordentlich Luft hereingelassen und es ihr für die Nacht bequem gemacht hatte, wie sie es nannte, blieb Angel im Dunkeln allein und widmete sich wieder ihren Traumbildern. Eins setzte sie sogar im Paradise House in Szene, doch ihre Fantasie war schneller geheilt als ihr Herz, und der Schmerz, den sie sich damit zufügte, ließ sie zusammenzucken.
Sie war nicht müde und dachte sich, im Bett liegend, stundenlang romantische Triumphe aus. Das Einzige, was der Glaubwürdigkeit des Ganzen im Weg stand, war ihre Mutter. Sie brachte es nicht über sich, sie zu vernichten, war zu abergläubisch, um so mit ihr zu verfahren, wie sie es mit einem Stück ihrer Nase getan hatte, und so war Mrs. Deverell in allen Szenen eine lästige Figur im Hintergrund. Nach einer Weile fiel Angel eine Lösung ein. Sie könnte meine Zofe sein, dachte sie. So wie Tante Lottie Madams Zofe ist.
Am nächsten Tag gab es keine sichtbaren Symptome ihrer Krankheit mehr. Der Ausschlag war verschwunden. Stattdessen klagte sie nun über Übelkeit und Kopfschmerzen, und ihre Mutter brachte ihr weiterhin Tabletts mit magerer Krankenkost – ein gekochtes Ei zum Mittag, eine einzelne Kammmuschel zum Abend – und nahm ihr das Buch weg, das sie gerade las.
Gefangen, hungrig und gelangweilt lag sie den ganzen Tag im Bett. Sie hatte ein Übermaß an Tagträumen gehabt und war verwirrt von zu vielen Bildern, die, sobald sie die Augen schloss, in Bruchstücke zerfielen, ein verstörendes Durcheinander. Sie hatte sich zu viel vorgestellt.
Ihre Mutter hatte das einzige Buch im Zimmer mitgenommen, und Angel traute sich nicht, über den Flur zu gehen, um es zu suchen. Die Zeit spulte sich furchtbar langsam ab. Als es dunkel wurde, dachte sie voller Angst an den langen Abend, der vor ihr lag, ohne dass sie etwas anderes würde tun können als dösen, träumen und auf die Ladentür horchen, die unten klingelte, die fernen Stimmen und das Blubbern und Trällern der Gasbrenner. Kurz dachte sie an Gwen und Polly, die ohne sie von der Schule nach Hause kämen. Als sie versuchte, rasch ihre Gedanken davon loszureißen, wurde ihr bewusst, wie eingeengt sie bei all ihren täglichen Verrichtungen war: In jeder Richtung lauerten Verletzungen, und die Langeweile war ein Feind, der sie mit einem Elend nach dem anderen konfrontierte.
Ihre Mutter brachte ihr den Tee, und Angel betrachtete missmutig die beiden kleinen Löffelbiskuits auf dem Teller. Morgen, beschloss sie, würde sie auf keinen Fall über Übelkeit oder Kopfschmerzen klagen; sie fragte sich, ob sie bei Problemen mit dem Herzen wohl ungehindert essen und lesen dürfte. Sie hatte sich nie viel aus Büchern gemacht, weil sie nichts mit ihr zu tun zu haben schienen, lieber würde sie selbst eins schreiben, nach einem von ihr gewählten Vorbild und über ein schönes junges Mädchen mit verblüffend weißer Haut, eine Erbin großen Grundbesitzes, die in Osborne weißen Pikee und in Balmoral Taft mit Schottenmuster trug.
Als sie ihren Tee ausgetrunken hatte, und das ging sehr schnell, stand sie auf und nahm ein altes Schulheft aus dem Regal, riss ein paar Seiten heraus, auf denen sie Landkarten gezeichnet hatte, und begann, ohne zu zögern, mit dem ersten Kapitel. »Im Jahr 1885«, schrieb sie. Das war das Jahr ihrer Geburt.
Die Wörter strömten nur so, den ganzen Abend lang, und sie war wie in Trance. Sobald sie ihre Mutter die Treppe heraufkommen hörte, schob sie das Heft unters Bett, legte sich hin und schloss die Augen. »Du siehst aus, als ob du wieder Fieber hättest«, sagte ihre Mutter verzweifelt. »Fühlst du dich noch krank?«
»Im Moment nicht. Nur schwach.«
»Ich weiß wirklich nicht weiter. Der Arzt schien ja nicht der Meinung zu sein, dass er noch einmal nach dem Rechten schauen müsste. Und dieses schlechte Wetter hilft auch nicht. Bei dem Nebel heute Abend sieht man die Hand vor Augen nicht. Halsentzündungen grassieren, erzählen mir die Kunden. Heute Morgen wurde Mrs. Bakers Vera wegen Diphtherie abgeholt. So ein hübsches kleines Mädchen.«
Angel war ziemlich ungerührt. Solche Sachen interessierten sie nicht. Wie üblich wartete sie nur darauf, dass ihre Mutter wieder ging.
Als es Zeit wurde zu schlafen, war sie so aufgeregt wie erschöpft. Ihr rechter Arm und ihre rechte Schulter taten weh, ihre Finger waren verkrampft. Sie hatte kaum eine Pause eingelegt, weder um nachzudenken, was sie schreiben sollte, noch um zu prüfen, was sie schon geschrieben hatte. Das Tagträumen hatte ihr den Weg bereitet. Sie wusste, wie die Zimmer und das ganze Anwesen von Haven Castle aussahen, und konnte die Gewänder und den Schmuck der Herzogin im Detail beschreiben. In der Nacht, als Irania geboren wurde, spazierten weiße Pfauen über die mondbeschienene Terrasse. Die Geburt erstreckte sich über mehrere Seiten. Dann wurden auf der Südseite des Hauses alle Jalousien heruntergezogen, und wie durch Zauberhand erschien das Personal, mit schwarzem Trauerflor. Von keiner Mutter belastet, blickte die Heldin in die Zukunft.
Angel, die noch nie eines Menschen wegen betrübt gewesen war und keinen Anteil daran nahm, dass Mrs. Bakers kleine Vera mit Diphtherie ins Krankenhaus gekommen war und womöglich sterben würde, brannten nun wegen der Frau in ihrer Geschichte die Augen. Bei der Beerdigung trauerte sie, nicht zusammen mit den Hausbewohnern, noch nicht einmal mit der Familie, sondern von einer anderen Warte aus: der Warte Gottes vielleicht.
Als ihre Mutter das Licht gelöscht und ihr gute Nacht gesagt hatte, lag sie friedlich auf dem Rücken und starrte in die Dunkelheit. Sie dachte an das Heft unter ihrem Kissen, das dort fürs erste Morgenlicht bereitlag. Es war, dachte sie, der glücklichste Tag ihres Lebens.
Der nächste Tag war ein Sonntag, und da der Laden geschlossen hatte, saß Mrs. Deverell in Angels Zimmer am kleinen Feuer und machte ihre Buchhaltung. Die Glocken der alten Kirche auf dem Butts klangen in der nebligen Luft gedämpft. Es schien ein vom Rest der Woche abgeschotteter Tag zu sein. Schon am frühen Nachmittag begann es dunkel zu werden.
»Was wünschst du dir zu Weihnachten?«, fragte Mrs. Deverell. Angel, die den ganzen Tag kaum ein Wort gesprochen hatte, lag wutschnaubend da, schwer verärgert über die Störung ihrer Privatsphäre.
Ausnahmsweise einmal wusste sie nicht, was sie sich wünschen sollte. Es war nur eine Frage der Zeit, bis sie alles hätte, was sie brauchte. Als berühmte Schriftstellerin würde sie sich sowohl Granate als auch Smaragde kaufen können, einen Chinchilla-Umhang, einen Zobelmuff, eine eigene Kutsche. Alles, was sie von solchen Reichtümern trennte, war die Zeit, die sie brauchen würde, um das, was in ihrem Kopf war, auf die Seiten ihres Heftes zu übertragen – Zeit, die ihre Mutter im Moment unklugerweise verplemperte.
Plötzlich erkannte sie, dass sie kühn und skrupellos sein musste, wenn sie Erfolg haben wollte. Sie konnte es sich nicht leisten, weiter heimlich zu tun oder sich um die Meinung anderer zu scheren. Sie zog das Schreibheft unter ihrem Kissen hervor und hielt es hoch, damit ihre Mutter es sah. »Davon wünsche ich mir ein halbes Dutzend«, sagte sie rasch. »Außen marmoriert wie dieses hier, bitte. Ich schreibe einen Roman, und ein Heft wird nicht reichen.« Mit ruhiger Miene schlug sie es auf, zog die Knie an, um eine Unterlage zu haben, und schrieb weiter.
Ihre Mutter errötete und warf ihr einen kurzen, argwöhnischen Blick zu. Dann runzelte sie die Stirn und arbeitete mit fest aufeinandergepressten Lippen weiter. Sie wusste nichts zu sagen. Das Schweigen im Zimmer empfand sie als so bedrückend, dass sie nach dem Spülen des Teegeschirrs ihren kleinen Federhut aufsetzte, das schwarze Cape mit Seidenrand anzog und wieder zu Angel ging. Sie hatte ein Gesangbuch in der Hand. »Wenn es dir nichts ausmacht, eine Weile allein zu sein, gehe ich jetzt in die Kirche. Dann kann ich mal frische Luft schnappen«, sagte sie.
Angel nickte.
»Möchtest du heute Nachmittag ein wenig aufstehen?«, fragte ihre Mutter sie am nächsten Tag.
Angel befürchtete, dies könnte der erste Schritt sein, sie wieder zur Schule zu schicken, und beschloss, dass sie noch zu krank war. Mit außerordentlichem Verdrängungswillen hatte sie den ursprünglichen Grund, warum sie nicht zur Schule gehen wollte, vergessen. Jetzt war sie zu beschäftigt. Nie wieder, dachte sie, könnte sie die Zeit erübrigen.
»Mein Herz ist noch nicht besser«, klagte sie. Sie blieb bei ihren Herzproblemen, weil das Essen besser geworden war, seit sie nicht mehr behauptete, ihr sei übel. »Manchmal tut es weh, und es scheint zu flattern und ab und zu auszusetzen.«
»Ich muss doch den Arzt noch einmal rufen«, sagte Mrs. Deverell mit besorgter Stimme.