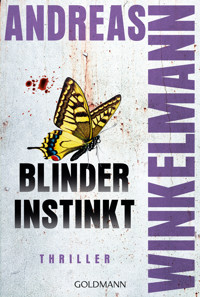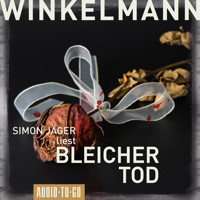Buch
Kriminalkommissarin Franziska Gottlob verbringt gerade ein ruhiges Wochenende bei ihren Eltern auf dem Land, als sie der Anruf erreicht: Aus einem Heim ist ein junges Mädchen verschwunden. Mitten in der Nacht hat der Täter die kleine Sarah entführt. Niemand hat etwas gehört, niemand sah ihn kommen – auch Sarah selbst nicht, sie ist blind. Franziska eilt sofort zurück in die Stadt und nimmt die Ermittlungen auf.
Derweil steht Boxchampion Max Ungemach im Ring. Vor ihm liegt der wichtigste Kampf seiner bisherigen Karriere. Doch Max ist unkonzentriert. Auf seiner Schulter spürt er eine kleine, unsichtbare Hand, die an ihm zu zerren scheint: die Hand seiner kleinen Schwester Sina. Seit sie vor ungefähr zehn Jahren an einem Sommertag spurlos verschwand, kämpft Max mit der Erinnerung an sie. Zwar gewinnt er auch diesen Boxkampf, doch die neu aufgeflammte Erinnerung an Sina lässt ihn nicht mehr los. Und so ist Max geradezu erleichtert, als ihn wenige Tage später eine junge, rothaarige Kriminalkommissarin namens Franziska Gottlob um ein diskretes Gespräch bittet. Sie hat Parallelen zwischen ihrem aktuellen Fall und dem von Max’ Schwester Sina festgestellt und hofft auf seine Hilfe. Was sowohl Max als auch Franziska völlig unterschätzen, ist, mit wem sie es zu tun haben: einem hochintelligenten Psychopathen, der nicht nur seine Opfer auf perfide, kaum vorstellbare Art zu quälen versteht, sondern auch für seine Jäger ein paar ganz besondere Überraschungen bereithält …
Autor
Andreas Winkelmann, geboren im Dezember 1968, entdeckte schon in jungen Jahren seine Leidenschaft für unheimliche Geschichten. Als Berufener hielt er es in keinem Job lange aus, war unter anderem Soldat, Sportlehrer und Taxifahrer, blieb jedoch nur dem Schreiben treu. »Der menschliche Verstand erschafft die Hölle auf Erden, und dort kenne ich mich aus«, beschreibt er seine Faszination für das Genre des Bösen. Er lebt heute mit seiner Familie in einem einsamen Haus am Waldesrand nahe Bremen.
Von Andreas Winkelmann sind im Goldmann Verlag
außerdem lieferbar:
Impressum
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © 2011 by Andreas Winkelmann
Copyright © dieser Ausgabe by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München.
Covergestaltung: UNO Werbeagentur GmbH
Th · Herstellung: Str.
Satz: omnisatz GmbH, Berlin
ISBN 978-3-641-04101-4V007
www.goldmann-verlag.de
Andreas Winkelmann
Blinder Instinkt
Thriller
Goldmann
Für Alexandra,
die zusammenführte, was zusammengehört,
Lauf schon los,ich zähl bis zehn,dann werde ich dich suchen gehen.
Versteck dich ruhig,ich find dich doch,schaue auch ins kleinste Loch.
Meinem Blickentgehst du nicht,
Prolog
Mit jeder schwingenden Bewegung der Schaukel rieben sich die groben Seile tiefer in den Ast des Kirschbaums. Ihr Knarren und Ächzen war das einzige Geräusch an diesem Nachmittag im Sommer. Warme Luft glitt an ihrem Gesicht entlang, rauschte in ihren Ohren, ließ ihr langes rotes Haar wehen und ihr weißes Sommerkleid flattern. Bei jedem Schwung nach vorn, die Füße zum Himmel gestreckt, kostete sie ein kleines Stück süßer Schwerelosigkeit, und als sie berauscht war davon und ihr schwindelig wurde, ließ sie die Schaukel ausschwingen.
Aus der einsetzenden Stille schälte sich die Erkenntnis:
Da ist jemand!
Sie musste ihn nicht sehen, um das zu wissen, denn sie spürte seine Anwesenheit. Spürte deutlich, wie sich die zuvor sichere und geordnete Umgebung veränderte, so als schöbe sich etwas unsagbar Böses in ihre Welt, das allein durch seine Präsenz Chaos auslöste. Die geräuschlosen Bewegungen hinter ihr lösten kleine, wellenartige Schwingungen in der Luft aus, in denen sich die feinen Härchen in ihrem Nacken aufstellten und zu vibrieren begannen. Wer sich dort anschlich, wusste nicht, dass man sich ihr nicht unbemerkt nähern konnte. Wer sich dort anschlich, kannte sie nicht und hatte hier nichts zu suchen!
Ihre Gedanken rasten.
Mama und Papa schliefen noch, ihr Bruder war fort und würde so schnell auch nicht zurückkehren. Das Haus lag abseits des Dorfes, und Besuch verirrte sich so gut wie nie hierher.
Wer also schlich sich da an?
War da überhaupt jemand, oder täuschte ihre übersteigerte Wahrnehmungsfähigkeit sie? War es am Ende nur der Sommerwind, der durch die Äste der hohen Bäume über ihr strich und die Blätter zum Flüstern brachte?
Diese Hoffnung wurde im Keim erstickt, als sie das Geräusch hörte: Rascheln im Laub. Die letzten Zweifel verflogen. Ihre Wahrnehmung war eine Sache, ihr Gehör eine andere – es täuschte sie niemals.
»Wer ist da?«, fragte sie. Ihre Stimme klang nicht so mutig, wie sie es gern gehabt hätte.
Das Laub verstummte, und eine besonders heftige Wellenbewegung der Luft verriet ihr, dass der Fremde stehen geblieben war. Plötzlich setzte die Angst ein! Ihre Hände schlossen sich fest um die Seile, mit den Füßen stoppte sie die leichte Bewegung der Schaukel.
Lauf ins Haus. Sofort!, rief eine Stimme in ihrem Inneren. Sie tat es nicht. Für normale Menschen wäre es die richtige Reaktion gewesen, nicht aber für sie. Der Weg zum Haus war zu weit, zu uneben. In ihrer Panik würde sie stürzen.
»Mein Papa ist in der Garage, soll ich ihn rufen?«, sagte sie stattdessen und fand das sehr schlau. Wer auch immer sich ihr näherte, musste dadurch doch gewarnt sein.
Plötzlich ging alles sehr schnell.
Die zuvor sanften Wellenbewegungen steigerten sich zu einem Sturm, der eine kurze, aber harte Brandung gegen ihren Körper schmetterte und sie quasi von der Schaukel stieß. Sie riss den Mund auf und wollte schreien, doch eine große Hand legte sich auf ihr Gesicht, drückte schmerzhaft ihre Lippen gegen die Zähne, verdeckte auch die Nasenlöcher, so dass sie nicht mehr atmen konnte. Die Hand roch und schmeckte nach Fisch. Ein Arm schlang sich von hinten um ihren Brustkorb und riss sie zurück. Sie strampelte mit den Beinen, trat gegen die Schaukel, dann in die Luft, während sie hochgehoben und aus ihrer Welt gerissen wurde.
Luft! Sie bekam zu wenig Luft!
Sie wand sich, spürte ihr Kleidchen reißen, rutschte nach unten und landete in der weichen Laubschicht.
Laufen und schreien! Du musst laufen und schreien!
Teil 1Zehn Jahre später
1
In den Zimmern verloschen nach und nach die Lichter. Eben noch durch bunte Vorhänge farbenfroh erhellte Fenster wurden zu toten Augen. Zeitgleich verschwanden die hingeworfenen hellen Rauten auf dem gestutzten Rasen vor dem Gebäude eine um die andere, wie bei einem übergroßen Memoryspiel, dessen Spieler unsichtbar blieben. Der Rasen wurde schwärzer, die Nacht fester. Auch die leise Symphonie der Geräusche – hier und da ein helles Lachen, gedämpfte Rufe, Klappern, Scharren von Stuhlbeinen -, die aus den gekippten Fenstern drang, verhallte in einem perfekten Diminuendo, und als das letzte Fenster geschlossen wurde, kehrte Ruhe ein.
Die Mädchen und Jungen, die auf den drei Etagen des langgestreckten Gebäudeflügels lebten, schliefen aber nicht sofort ein. Vereinzelt flammten Lichter wieder auf und erloschen erneut. In der dritten Etage, ganz links außen, brannte eines länger als alle anderen. Dort gab es keine Vorhänge, denn das Fenster bestand aus Milchglas. Es war der Duschraum der Jungen, und wahrscheinlich hatte einer vergessen, hinter sich das Licht zu löschen. Die Nachtaufsicht holte es mit zehnminütiger Verspätung nach.
Plötzlich war alles schwarz. Seine ans Licht gewöhnten Augen benötigten einen Moment, um sich darauf einzustellen, und während dieser Zeit hörte er überdeutlich jedes Rascheln und Knacken. Eine Gänsehaut lief seinen Rücken hinab. Er sah über seine Schulter zurück, konnte aber nichts erkennen.
Dunkler Wald allein machte ihm keine Angst, ganz im Gegenteil. Er konnte sich darin verstecken, war vor Blicken sicher, gleichzeitig bot er ihm die Möglichkeit, das Gebäude über einen längeren Zeitraum unbemerkt zu beobachten. Hier gab es keine Sicherheitsmaßnahmen außer einem zwei Meter hohen Maschendrahtzaun, und es würde ein Kinderspiel sein, da ein Loch hineinzuschneiden. Die Drahtschere dafür trug er in der Jackentasche bei sich.
Die verebbende Angst wurde nach und nach von Aufregung abgelöst, und diese sorgte für ein unangenehmes Kribbeln in seinen Beinen. Er hasste dieses Gefühl, es stahl ihm seine Ruhe, brachte die eben noch sortierten Karten durcheinander. Oft wurde er gerade nachts davon heimgesucht, und wenn es mal wieder so weit war, wenn selbst das Ablegen der Damen, Buben und Könige nicht half, dann konnte er einfach nicht ruhig sitzen oder liegen bleiben.
Auch jetzt nicht!
Also sprang er auf von dem umgestürzten Baumstamm, auf dessen harter Borke er die letzte Stunde reglos verbracht hatte. Er vertrat sich die Beine, die durch das lange Sitzen steif und ein wenig taub geworden waren. Das alte, trockene Laub des letzten Jahres raschelte unter seinen Füßen. Er hob den Arm, schob den Ärmel der Jacke etwas zurück und warf einen Blick auf seine Digitaluhr, deren Anzeige auf Knopfdruck blau leuchtete. Von jetzt an, da sämtliche Lampen in dem Wohnheim erloschen waren, würde er genau eine Stunde warten. Bis nach Mitternacht. Eine gute Zeit!
Natürlich erforderte es Geduld, eine Stunde tatenlos verstreichen zu lassen, und Geduld war leider nicht erlernbar, sie kam und ging. An einem Tag war sie sein Freund, am nächsten kannte sie ihn nicht mal mehr. Und er hatte weiß Gott versucht, sie zu domestizieren, übte sich immer noch darin. Leider meist vergeblich.
Sein großer Vorteil war, dass er Zeit hatte. Noch drängte es nicht. Sollte es heute Nacht nicht passen, dann würde er morgen wiederkommen oder nächste Woche oder in der Woche darauf. Er konnte jedes Risiko umgehen, wenn er sich nicht selbst unter Druck setzte, das war ihm klar.
Er riss den Kopf herum, als hinter einem der Fenster in der zweiten Etage Licht aufflammte – es war ihr Fenster!
Sein Mädchen verfügte über eine besonders ausgeprägte Sensitivität, das wusste er. Spürte sie die Gefahr? Lag sie dort oben in ihrem Bettchen, angespannt, die Decke bis zum Kinn hochgezogen? Sicher nahmen ihre Ohren jedes noch so feine Geräusch wahr, filterten sogar elektrische Schwingungen aus der Luft, die ihre Kopfhaut kribbeln ließen.
Die Vorstellung des zitternden Mädchens dort oben, das ihn zwar spüren, aber nicht sehen konnte, erregte ihn ungemein.
Während er auf das erleuchtete Fenster starrte, öffnete er Gürtel, Knopf und Reißverschluss, schob Hose und Unterhose hinunter. Schnell wurden seine Bewegungen hektisch, und gerade als dort oben das Licht erlosch, ließ er sich mit einem unterdrückten Grunzen auf die Knie fallen.
Plötzlich erklangen das laute Schlagen von großen Flügeln und der Ruf einer Eule. Er fuhr hoch, sah sich hektisch um. Sofort stopfte er alles in seine Hose zurück und zog sich an. Allein die Vorstellung, das Tier könnte ihn beobachtet haben, berührte ihn peinlich und ließ das Blut heiß in seinen Kopf schießen. Verstohlen sah er sich um, bevor er sich wieder auf dem Baumstamm niederließ. Er schlug die Beine übereinander, steckte die Hände in die Taschen seiner dunklen Jacke, machte den Rücken krumm, sackte in sich zusammen und tat, als sei nichts gewesen. Überall waren Augen, überall wurde er gesehen. Er sehnte sich zurück in seine Welt, in der er ganz allein bestimmte, wer sehen durfte und wer nicht. Dort konnte er unsichtbar sein, wenn er es wollte.
Wie satt er es doch hatte, angeglotzt zu werden!
Er fror. Die Nacht war kühl, Bewegungslosigkeit und Müdigkeit taten das Ihrige dazu. Die Warterei ließ seine Motivation schwinden. Zweifel machte sich breit. Hatte er wirklich an alles gedacht? War es so einfach und sicher, wie er es sich vorstellte? Vielleicht sollte er es besser noch einmal verschieben, sich mit dem abfinden, was er hatte.
Als er wegen der Kälte zu zittern begann, war die Wartezeit vorbei. Trotzdem gab er noch mal zehn Minuten drauf, allein schon, um seine Geduld zu trainieren. Dame zu Dame, Bube zu Bube, König zu König, zehn Minuten lang, und sie fügten sich, glitten leise und geschmeidig aufeinander, die Kanten in exakter Linie, nahezu perfekt!
Schließlich erhob er sich von dem Baumstamm, machte ein paar Dehnübungen, atmete tief ein und aus und schritt dann leise auf den Waldrand zu. Wo Büsche und Bäume zurückwichen und er seine Deckung aufgeben musste, blieb er stehen und holte die Drahtschere aus der Jackentasche. Mit ruhigen Bewegungen machte er sich ans Werk. Ein Draht nach dem anderen.
2
Die letzten fünf Minuten vor einem Kampf mochte er besonders. Dies war allein seine Zeit. Sein Trainer Konrad Leder, von ihm und einer Handvoll guter Freunde kurz Kolle genannt, verließ den Raum und schloss die Tür. Damit war er allein, und so musste es sein, denn nur dann konnte er seine Gedanken fokussieren, sich auf diese eine bestimmte Sache konzentrieren.
Diese fünf Minuten verbrachte er in einer Welt, in der es nur ihn und seinen Gegner gab. Manchmal jedoch tauchte auch Sina auf. Sina hatte Zugang zu allen Welten, dagegen konnte Max sich nicht wehren, selbst wenn er es gewollt hätte, und diese Wehrlosigkeit rief oft ein bedrückendes Gefühl der Machtlosigkeit in ihm hervor. Es gab kein Entrinnen, und diese Last wog mitunter schwer genug, um seine Seele am Atmen zu hindern.
Auch heute spürte er ihre kleine Hand auf seiner Schulter, die dünnen Finger leicht in seine Nackenmuskulatur gekrallt, damit sie nicht abrutschten. Früher, als sie noch wirklich dort gelegen hatten, war es immer ein angenehmes Gefühl von Wärme und Verbundenheit gewesen. Er war der Starke, der Beschützer, der Wegweiser. Und wenn sie dann noch diesen einen besonderen Satz gesagt hatte, war er sich stets unbesiegbar vorgekommen.
»Der sicherste Platz auf der Welt ist hinter dir, Max!«
Allein die Erinnerung daran genügte, sich heute wieder so zu fühlen. Unbesiegbar!
Somit war der größte Fehler seines Lebens gleichzeitig auch die Quelle seines Erfolges.
Mit locker hängenden Armen, die Füße schulterbreit auseinandergestellt, blieb Max in der Mitte des Raumes stehen. Er ließ seinen Blick umherwandern. In dieser Kabine sah es aus wie in den meisten anderen Kabinen auch: weiße Farbe auf unverputztem Mauerwerk, Neonröhren in Plastikkästen, deren Licht so hart war, dass es greifbar schien. Eine Wandseite zugestellt mit Metallspinden, an der hinteren Stirnseite eine Massagepritsche, die schon bessere Zeiten gesehen hatte. Schweiß hatte das Kunstleder porös werden lassen und ausgeblichen, an mehreren Stellen quoll die Schaumstofffüllung hervor. An der anderen Wandseite hing ein hoher, sehr breiter Spiegel, zu dem Max jetzt frontal Stellung bezog. Er stand seinem Spiegelbild gegenüber, und je länger er die mittelgroße, muskulöse Gestalt in blauen Shorts mit gelben Streifen dort betrachtete, desto weniger nahm er sie wahr. Er begann, den mit Lumpen gefüllten Boxsack zu bearbeiten. Zuerst ein paar leichte Schläge mit der Linken, zwischendurch die Rechte, ein wenig härter, aber nicht viel, und jeder Schlag ließ die Visualisierung vor seinen Augen realer werden. Beinahe war es wie Wahrsagen, mit dem Unterschied, dass er die Zukunft beeinflusste – es zumindest versuchte.
Die vierte Runde war diesmal sein Ziel. In der vierten, kurz vor dem Gong, würde er seinen Gegner zu Boden schicken. Ein Sieg nach Punkten kam nicht in Frage. Die Menschen da draußen hatten Karten für einen Kampf im Schwergewicht gekauft, der Königsklasse des Boxsports. Sie erwarteten eine klare Entscheidung, die nicht durch irgendwelche Ringrichter und das Zählen von Punkten herbeigeführt wurde, sondern durch das donnernde Aufschlagen eines schweren Körpers auf dem Ringboden. Am Ende musste einer stehen und einer liegen, dann waren die Show perfekt und die Zuschauer zufrieden.
Sollen sie haben, dachte Max, und von mir aus noch ein wenig Blut dazu.
Er schickte seine Fäuste aus, ließ seine Beine einen Tanz aufführen, den sie blind beherrschten, und sah dabei den Hünen von La Spezia zu Boden gehen, schwer getroffen von seinen harten Schlägen. Die Handschuhe klatschen gegen den Boxsack, regelmäßig, links links, rechts, links links, rechts – seine Variante eines Metronoms, dessen Klang ihn zu hypnotisieren vermochte. Er fühlte sich locker, ruhig und überlegen.
Als seine fünf Minuten vorüber waren, kurz bevor Kolle an die Tür klopfte, stellte Max sich vor den Boxsack, legte die bandagierten und in seine blauen Handschuhe verpackten Hände an die Seiten und die Stirn gegen das weiche Leder. Er bildete sich ein, in dem Sack ein Pulsieren zu spüren, hervorgerufen durch seine Schläge. Ein paar Sekunden in dieser Stellung, das letzte visualisierte Bild, das seinen Gegner ausgeknockt am Boden zeigte, noch einmal heraufbeschwören und es in die andere Kabine schicken, damit der schon mal wusste, was auf ihn zukam.
Aber das Bild erschien ihm nicht. Stattdessen sah er Sina. Sah sie so, wie er sie für alle Zeiten in Erinnerung behalten würde. Als wäre sie nur eine Fotografie, kein realer Mensch, welcher den Zwängen der Zeit unterworfen war – und auf eine grausame Weise stimmte das ja auch. Nur Farbe auf Papier, statisch, unfähig zur Veränderung. Ihr rundliches Gesicht mit der Stupsnase, von deren Flanken in einem schwungvollen Bogen Sommersprossen bis unter die graugrünen Augen verliefen, darüber die hellen Wimpern, nicht rot wie ihr Haar, sondern je nach Lichteinfall durchsichtig, weizengelb oder mit dem Hauch einer zartrosa Schattierung.
Sina!
Sie lächelte nicht. Sie schien sich auch nicht sicher zu fühlen in seinem Rücken, so wie sonst immer. Ihr Gesicht hatte einen erstaunten, vielleicht sogar ängstlichen Ausdruck – und sie sprach auch nicht den Zaubersatz!
Dann klopfte es an der Tür und sie war weg. Mit ihr verschwand seine Konzentration und Fokussierung auf das Ziel des heutigen Abends. Das war nicht gut, überhaupt nicht gut!
Obwohl er nicht »Herein« gesagt hatte, öffnete Kolle die Tür und betrat die Kabine.
»Alles in Ordnung mit dir?«, fragte er.
Max, noch immer abgelenkt, hörte das Stirnrunzeln seines Trainers in dessen rauchiger Stimme, ohne es sehen zu müssen.
»Max?«
Erst jetzt drehte er sich um. »Ja … alles klar, von mir aus kann’s losgehen.«
Kolle trat vor ihn hin, hob seine Hände an und überprüfte noch einmal den perfekten Sitz der Handschuhe. Er war mit seinen eins siebzig einige Zentimeter kleiner als Max und sah ihm von unten herauf in die Augen. Seine grauen Pupillen, in die sich neuerdings feine weiße Splitter mischten, fixierten ihn, stellten wortlos Fragen und bekamen aus Max’ Augen ebensolche Antworten.
Schließlich schien er zufrieden zu sein. Er nickte leicht und hob seine Hände, die offenen Handflächen Max zugewandt.
»Dann lass uns gehen. Die anderen sind schon draußen.«
Kolles Stimme klang noch heiserer als sonst. Sie hatten viel und hart trainiert für diesen Abend, er hatte viel geschrien und seine Stimmbänder schienen beleidigt zu sein.
3
Dunkelheit und Stille hatten sich zeitgleich über das Haus am See gelegt. Ohne Mondlicht waren die mächtigen Stämme der Douglasien da draußen vor dem Fenster nichts weiter als verkohlte Finger, die gen Himmel wiesen.
Unheimlich!
Franziska wandte sich vom Fenster ab, schritt durch ihr Kinderzimmer, öffnete die Tür und lauschte. Sie hatte sich nicht getäuscht. Rücksichtsvoll leise gestellt lief unten im Wohnzimmer der Fernseher. Ein bisschen was von seinem fahlblauen Licht fand den Weg die Treppe hinauf, versickerte aber auf halbem Wege.
Sie könnte ins Bett gehen!
Sie könnte sich einfach hinlegen und einschlafen. Müde genug war sie, der Tag war anstrengend gewesen. Sich heute nicht mehr um das kümmern, was sie schon so lange vor sich herschob, war eigentlich genau, was sie wollte, und auf eine oder zwei Wochen kam es doch gar nicht an!
Aber Franziska ahnte, dass es darauf sehr wohl ankam, denn Zeit stand jetzt nicht mehr ausreichend zur Verfügung. Bis vor kurzem hatte sie nicht gewusst, was es wirklich bedeutete, keine Zeit mehr zu haben, auch wenn sie, wie fast alle, diese Floskel tagtäglich gebrauchte. Im Grunde lernte sie gern etwas hinzu, aber auf dieses spezielle Wissen hätte sie lieber noch eine Weile verzichtet.
Nein! Aufschieben war keine Option mehr, und wahrscheinlich würde sich kein so perfekter Zeitpunkt mehr finden wie heute Abend. Vor einer Stunde hatte Franziska sich ins Bett verabschiedet, aber das war nur ein Vorwand gewesen, um ihre Mutter ebenfalls ins Bett zu locken. Und es hatte funktioniert: Mutter schlief längst tief und fest – sie konnte sie leise im Nebenraum schnarchen hören. Gut so – für ein vernünftiges Gespräch musste sie mit ihrem Vater allein sein. Er hatte angekündigt, länger aufbleiben zu wollen, um sich den Boxkampf anzuschauen.
Franziska trat auf den Flur hinaus und kam sich dabei vor, als zöge auch sie in einen Kampf. Warum fiel es ihr so verdammt schwer? Solche Gespräche sollten doch zu dem Normalsten gehören, was Vater und Tochter miteinander tun konnten!
Die Geräusche des Fernsehers wurden mit jeder Stufe, die sie hinunterstieg, lauter. Der kurze Weg vom Ende der Treppe bis zur Wohnzimmertür war eine Zeitschleuse. Jeder Schritt führte sie in die Vergangenheit. Plötzlich war sie die kleine Franzi, kaum zehn Jahre alt, die barfuß und auf Zehenspitzen durch einen endlos langen Korridor schlich, die Händchen zu Fäusten geballt an die Wangen gedrückt, krampfhaft darum bemüht, ja kein Geräusch zu machen. Sie sollte längst schlafen, schon seit Stunden, aber weil sie irgendwas bedrückte oder sie Angst hatte, war sie aufgestanden in der Hoffnung, Papa allein vor dem Fernseher oder an seinem Schreibtisch zu finden.
Franziska trat unter den Türrahmen und sah zu ihrem Vater hinüber. Er bemerkte sie sofort, hatte sie wahrscheinlich längst gehört, und wandte ihr sein Gesicht zu. Ein Gesicht voller Furchen, mit Tränensäcken, Altersflecken und schütterem weißen Haar. Immer noch ihr Papa, immer noch dieses ehrliche Lächeln, aber die Kraft und Sicherheit, die es immer ausgestrahlt hatte, war verschwunden. Ein Teil war mit dem Ende ihrer Kindheit aus diesem Haus ausgezogen, den Rest vertrieb nun die Krankheit.
»Hey, Franzi«, sagte er mit rauer Stimme, »was ist los? Kannst du nicht schlafen?«
Sie nickte, ging hinüber und ließ sich neben ihm auf die Couch fallen.
»Ich bin eigentlich todmüde, kann aber nicht einschlafen.«
»Das kenne ich. Wir haben am späten Nachmittag einfach zu viel Kaffee getrunken.«
So war er! Immer eine Erklärung parat, die einleuchtend klang und keinen Anlass zu weiterer Sorge gab.
»Bleib doch noch ein wenig bei mir. Wir können uns den Kampf zusammen anschauen. Früher hast du Boxen geliebt.«
Dass er den letzten Satz mit einem gewissen Unterton sagte, verstand sich von selbst. Von ihrem zwanzigsten Geburtstag an war sie sieben Jahre mit Boris zusammen gewesen, einem Amateurboxer, der den Aufstieg in die Profiliga verpasst und sich selbst dafür mit Drogen und anderen Frauen belohnt hatte. Ihr Vater hatte ihm vom ersten Tag an nicht vertraut, aber wer hört bei der ersten großen Liebe schon auf den Rat seines Vaters!
Franziska rollte mit den Augen. »Früher war ich vor Liebe blind. Soll ich uns ein Bier holen?«, blockte sie das Thema ab.
Er überlegte einen Moment, wog die Verlockung des Moments gegen die Warnungen ab.
»Klar!«, sagte er schließlich. »Allein hätte ich keins getrunken, aber mit dir zusammen … auf jeden Fall.«
»Okay.« Franziska lief in die Küche, holte zwei Dosen Bier aus dem Kühlschrank und kehrte schnell ins Wohnzimmer zurück. Auf der Couch schlug sie die Beine unter und machte es sich bequem. Sie rissen die Dosen auf, prosteten sich zu und tranken. So gut hatte Dosenbier Franziska lange nicht mehr geschmeckt.
Ihr Vater deutete mit der Dose auf den Fernseher. »Die haben natürlich Verspätung, wie immer. Es läuft noch ein Vorkampf. Uninteressant, aber nicht zu vermeiden. Deine Mutter schläft?«
»Tief und fest … Zumindest klingt es so.«
Er lächelte. »Tja, wenn sie älter werden, schnarchen die Frauen genauso wie die Männer.«
»Reiner Selbstschutz«, sagte Franziska.
»So, meinst du?«
Sie nickte. Dann saßen sie schweigend da, tranken von ihrem Bier, sahen dem langweiligen Vorkampf zu, und Franziska genoss das Gefühl, ein klein bisschen wieder Kind sein zu dürfen. Mit ihrem Vater zu schweigen hatte Franziska immer als angenehm empfunden – doch diesmal funktionierte es nicht. Sie war heute vor dem Mittagessen eingetroffen. Sie hatten den ganzen Nachmittag und Abend gehabt, um über fast alles miteinander zu sprechen, so dass es jetzt eigentlich nichts mehr zu sagen gab. Aber eben nur fast und eigentlich, und deshalb veränderte sich das Schweigen mit jeder Minute, forderte Franziska heraus, forderte ihren Mut heraus.
»Spuck’s schon aus«, sagte ihr Papa plötzlich.
Franziska war überrascht. »Was?«
Er betrachtete weiterhin den Bildschirm. »Dir liegt doch was auf der Seele, meine Kleine. Ich kann es praktisch schreien hören, und ich müsste schon ziemlich blöd sein, um nicht zu wissen, was es ist. Also raus damit, und zwar bevor der eigentliche Kampf losgeht.«
Jetzt sah er sie doch an. Seine Augen waren feucht, aber das waren sie dieser Tage immer.
Franziska öffnete den Mund, doch Worte wollten einfach nicht hinaus. Dafür aber Tränen, die ihr plötzlich aus den Augenwinkeln rannen.
Ihr Vater nahm ihre Hand und drückte sie. »Pass mal auf, meine Kleine. Ich sag dir jetzt etwas, und es ist genau so, wie ich es dir sage, und wenn sich daran demnächst etwas ändern sollte, erfährst du es als Erste. Einverstanden?«
Sie konnte nur nicken. »Ich befinde mich gerade mitten in der Behandlung, also kann niemand, auch kein Arzt, zu diesem Zeitpunkt sagen, in welche Richtung es geht – und das bleibt auch noch mindestens vier Wochen so. Aber ich fühle mich gut. Und weil ich es tief in mir spüre, weiß ich, dass ich noch genug Kraft habe, um mit dieser Scheiße fertig zu werden. Ich bin optimistisch, und du solltest es auch sein. Okay?« Er sah sie aus seinen feuchten Augen an, führte seinen Handrücken an ihre Wange und wischte die Tränen fort. »Okay, meine Kleine?«
Franziska nickte wieder. Jetzt war sie ganz Kind, jetzt steckte jede Faser von ihr in der Zeitschleuse, und all die Fragen, die sie ihrem Vater hatte stellen wollen, standen ihr plötzlich nicht mehr zu, weil sie ja erst zehn Jahre alt war.
»Oh, verdammt, es geht los!«, rief er plötzlich aus und wandte sich dem Fernseher zu.
4
»Gute Nacht, Sarah«, rief Frau Lange von der Tür aus. »Und wenn noch irgendwas ist, dann klingelst du einfach wieder. Okay?«
»Okay«, antwortete Sarah leise. »Gute Nacht.«
Die Tür wurde geschlossen, und augenblicklich war das Gefühl wieder da.
Jemand beobachtete sie!
Die Dunkelheit hatte Augen bekommen, und die starrten sie an.
Sarah hatte nach Frau Lange geklingelt und Kopfweh vorgetäuscht, weil sie zehn Minuten nach dem Zubettgehen plötzlich Atemnot bekommen hatte. Hervorgerufen durch ein schweres Gewicht auf ihrer Brust und eben diesen Blick, der sie aus den Mauern und Möbeln des Zimmers heraus anzustarren schien. Das war natürlich alles Blödsinn, Kleinmädchen-Ängste, aus denen sie doch rausgewachsen sein sollte, doch sich das einzureden hatte nicht geholfen. Seit vier Nächten schlief Sarah allein in ihrem Zimmer, denn Judith, mit der sie sich so gut verstanden hatte, war zu ihren Eltern zurückgezogen. Sie würde nicht lang allein bleiben, das hatte Frau Lange schon angekündigt, es gab ein Mädchen, das bereits auf einen Platz wartete.
Aber jetzt war sie allein, ausgerechnet jetzt! Die vergangenen Nächte waren ganz okay gewesen, natürlich vermisste sie die Gespräche vor dem Einschlafen und Judiths leise Atemgeräusche, doch Sarah hatte bislang trotzdem keine Angst gespürt.
Heute aber schon!
Heute war alles anders, und sie konnte sich nicht erklären, warum.
Sie lag auf dem Rücken, hatte die weiche Decke bis zum Kinn gezogen, Arme und Hände darunter versteckt und rührte sich nicht. Sie atmete so flach wie möglich, hielt die Augen geschlossen und konzentrierte sich auf ihr Gehör. So still, wie es mittlerweile auf dem Flur geworden war, würde sie jedes noch so leise Geräusch hören.
Doch es blieb still.
Und was auch blieb, war der fast schon schmerzhafte Eindruck, angestarrt zu werden.
Schon tastete Sarahs Hand wieder nach dem Klingelknopf, der an einem Kabel von der Decke über ihrem Bett baumelte. Sie ergriff ihn, befühlte ihn, drückte aber nicht drauf. Ihn da oben zu wissen beruhigte sie ein wenig. Sie konnte aber nicht schon wieder nach Frau Lange klingeln, das wäre peinlich. Wahrscheinlich ahnte ihre Lieblingsschwester ohnehin, dass ihr Kopfweh nicht so schlimm war, wie Sarah behauptet hatte.
Also schloss sie die Augen, faltete die Hände unter der Decke und versuchte es zum zweiten Mal an diesem Abend mit dem Gebet. Die Worte beherrschte sie auswendig, doch auch wenn sie es diesmal zu Ende brachte, war es stumpf dahergesagt, ohne den notwendigen Glauben. Statt sich darauf zu konzentrieren, durchforstete sie die Dunkelheit des Zimmers erneut nach Geräuschen.
Darüber schlief sie irgendwann ein.
Und erwachte ruckartig, als sie tatsächlich etwas hörte. Die Tür! Sie war ganz sacht ins Schloss gedrückt worden. Sie war nicht mehr allein! Jemand befand sich mit ihr im Zimmer!
Sarah streckte die Hand nach dem Klingelknopf aus. Jetzt war es ihr egal, ob sie Frau Lange störte oder nicht, denn da war jemand, schlich auf ihr Bett zu, setzte sich behutsam auf die Matratze. Sie spürte ganz deutlich, wie die Matratze am Fußende tief einsank unter dem Gewicht dieses Jemand. Das war ganz gewiss keine Einbildung. Auch nicht die leisen Atemgeräusche ganz dicht vor ihrem Gesicht!
5
Zu den Klängen von Bonnie Tylers »Holding out for a hero« betrat Max hinter Kolle die Arena. Augenblicklich brandete eine Welle aus Geschrei und Gestampfe auf. Unglaublich schnell schwoll sie an, schwappte an den Rängen der Halle empor, überschlug sich, wurde ohrenbetäubend, beinahe schmerzhaft.
Max war erstaunt. Zwar ging es hier um die europäische Krone im Schwergewicht, aber mit diesem Erdbeben hatte er trotzdem nicht gerechnet. Beinahe schien es so, als wollten die Zuschauer ihn mit der Kraft des Schalls zurück in die Katakomben zwingen.
Rasch näherten sie sich dem Ring. Das Licht wurde intensiver, die Hitze der Scheinwerfer ebenfalls. Als der breite Gang sich teilte, wandten sie sich nach links und stiegen die hölzernen Stufen zu seiner Ecke empor. Kolle hielt ihm die Ringseile auseinander, er stieg hindurch, tänzelte ein wenig, streckte die Arme empor und präsentierte sich. Und obwohl es kaum möglich war, schien das Gebrüll noch infernalischer zu werden.
Kolle legte ihm eine Hand auf die Schulter und zog ihn in seine Ecke zurück.
»Kannst du es hören? Sie ahnen schon, was heute passieren wird, und sind verrückt vor Hilflosigkeit.«
Max nickte und ließ die Arme pendeln. Bizeps und Trizeps fühlten sich locker an, überhaupt schien heute nicht ein einziger Muskel an seinem Körper verspannt zu sein. Beste Voraussetzungen also, wäre da nicht … Aber nein, er musste Sina für die nächsten zwanzig Minuten einfach aus seinem Kopf verbannen. Er würde das schon schaffen!
Der Ringsprecher begann mit seiner Ansage. Max kannte den Mann mit dem langen schwarzen Haar und den dunklen Augen von früheren Kämpfen.
»Und in der linken Ecke … Einhundertzwei Kilo … Eins zweiundachtzig groß … Sechsundzwanzig Kämpfe … Keine Niederlage … Zweiundzwanzig gewonnen durch K. O. …«
An dieser Stelle war es wie immer, wenn er außerhalb Deutschlands boxte: Die Menge, wenn sie nicht ohnehin schon stand, erhob sich, warf mit Popcorn und Pappbechern und begann in der jeweiligen Landessprache »Schiebung, Schiebung« zu skandieren.
»… Der amtierende Europameister im Schwergewicht … Der Titelverteidiger … Der ungeschlagene Meister … Max Uuuuuuuuungemaaaaaaaaaach.«
Er ging zur Ringmitte, tat dabei so, als würde er sich langweilen, war aber hellwach und angespannt. Während er die Arme abermals noch oben reckte und sich im Kreis drehte, wurden die Pfiffe und Buhrufe schon leiser. So waren sie, die italienischen Fans: heißblütig, aber schnell verkocht. Tausende Augenpaare starrten ihn an. Männer, Frauen, auch ein paar Kinder. Max sah sie alle und doch keinen, eine wogende Masse ohne Gesichter und Namen.
Aber da vorn, in der ersten Reihe, verdammt, war das nicht …?
Nein! Nein, er hatte sich geirrt. Aber für einen Augenblick hatte er wirklich gedacht … Was war nur los heute Abend? Das war ihm doch noch nie während eines Kampfes passiert!
Er konzentrierte sich auf seinen Gegner. Der hockte auf seinem Schemel, die langen Beine weit auseinandergestellt, die ebenfalls langen Arme locker auf die mittleren Ringseile gelegt. Salvatore de Martin, der Hüne von La Spezia. Und groß war er wirklich, selbst sitzend!
Dann zitierte der Ringrichter beide Kämpfer in die Ringmitte. Auge in Auge stellten sie sich auf. De Martin überragte Max um Haupteslänge. Die Muskeln des Italieners waren sehnig und hart, nicht solche dicken Pakete, wie Max sie mit sich herumschleppte. Reglose, dunkle Augen blickten auf Max hinab.
Er drückte seine Handschuhe gegen die des Italieners, wandte sich ab, ging in seine Ecke zurück und ließ sich dort auf den hölzernen Schemel fallen. Kolle schob ihm den Gebissschutz zwischen die Kiefer.
»Pass bloß auf seine Auslage auf. Der Kerl kann ja fast von einer Ecke in die andere schlagen!«
Max nickte.
Und schon ertönte der Gong.
Der Italiener ging mit perfekter Deckung auf ihn los. Max ließ ihn kommen, wich zurück, tänzelte nach rechts und machte seine Runde durch den Ring. De Martin versperrte ihm den Weg, also lief er in die andere Richtung, lockte den großen Jungen hinter sich her.
Plötzlich schnellte dessen Führhand zum ersten Mal vor. Max hatte nicht damit gerechnet, dass sie ihn erreichte, war aber trotzdem bereit, und sie blieb an seiner Deckung hängen. Kein besonders harter Schlag, der Junge probierte ihn nur aus, spionierte, vermaß seine Länge. Max ließ ihn gewähren, blieb vorerst hinter seiner Deckung, wich schnell und geschickt aus und bewegte sich ohne Pause durch den Ring.
Aus der Ecke des Italieners ertönte ein spitzer Schrei, den Max trotz der lärmenden Zuschauer hören konnte. Als sei es ein Startsignal für ihn, ging der Hüne von La Spezia auf ihn los. Mit gesenktem Oberkörper, die Deckung immer noch perfekt vor dem Brustkorb, preschte er durch den Ring. Die Führhand zuckte vor, ging ins Leere, zuckte wieder, schrammte an Max’ Schulter entlang.
Seine Chance!
Ein schneller Ausfallschritt, rechts abtauchen und die Linke explodieren lassen. Aber de Martin hatte aufgepasst. Schnell war er außer Reichweite, so dass Max nur noch dessen Unterarm traf.
Schon standen sie sich wieder gegenüber, belauerten sich, suchten ihre Chance. De Martin schien so früh schon alles auf eine Karte setzen zu wollen. Jetzt ging er auf Max los wie ein Scheunendrescher, schwang die Arme, landete Schlag auf Schlag gegen seine Deckung und trieb ihn in die Ecke. Max ließ es zunächst geschehen. Beim nächsten Schlag, wenn sich eine Lücke auftat, würde er …
»Max!«
Ein einziges Wort nur, sein eigener Name, der wie ein Donnerschlag durch seinen Kopf hallte. Es war Sinas Stimme, und sie klang, als wäre sie in Gefahr.
Max’ Konzentration war dahin. Er bekam einen Schlag gegen die rechte Gesichtshälfte. Viel Dampf steckte nach der wilden Drescherei nicht mehr dahinter, genug jedoch, ihn rückwärts in die Ecke taumeln zu lassen. Die Seile warfen ihn prompt zurück. Instinktiv tauchte er unter einer harten Rechten des Italieners weg und brachte sich mit einem schnellen Schritt hinter ihn.
Das Publikum war außer sich! Für sie musste es so ausgesehen haben, als hätte ihr Held ihn wirklich in Bedrängnis gebracht. In Bedrängnis war er auch gewesen, doch das war nicht de Martins Verdienst. Max spürte, dass er noch nicht wieder so weit war, einen Gegenangriff zu starten. Bis zum Ende dieser Runde musste er sich den Italiener vom Leib halten, danach würde seine Konzentration wieder stehen.
Sina … Mein Gott, Sina!
In Vorfreude auf einen schnellen Sieg ließ de Martin die Führhand sinken, holte für einen Uppercut aus. Das war dumm und auffällig. Max wich aus, versetzte seinerseits dem Jungen einen Schlag gegen die Deckung und klammerte ihn dann. Für einen kurzen Moment, bevor der Ringrichter sie trennte, roch er den Schweiß seines Gegners und spürte dessen rasenden Atem an seinem Ohr. Dann war er weg, und der Gong beendete die erste Runde.
Max ließ sich auf den bereitgestellten Schemel fallen. Bob, ihr Cutman, entfernte ihm den Mundschutz.
»Was ist los?«, fragte Kolle, und spritzte ihm ein isotonisches Getränk in den Mund, das Max gierig schluckte, bevor er antwortete.
»Nichts, es ist nichts.«
»Schau mich an!«
Kolles Gesicht war keine zehn Zentimeter von seinem entfernt. Sein Trainer schien durch seine Augen kriechen zu wollen, um in seinem Kopf nach dem Rechten zu sehen.
»Du wirkst unkonzentriert«, sagte er.
»Ist vielleicht nicht mein Abend …«
»Okay«, sagte Kolle und drückte ihm die Trinkflasche abermals in den Mund, »dann warte nicht bis zur vierten Runde. Schick ihn auf die Bretter. Vielleicht hast du einen Infekt.«
Dagegen hätte Max widersprechen können, doch er tat es nicht. Der Mundschutz wurde ihm wieder zwischen die Zähne gesteckt. Kolle rieb Vaseline auf seine Augenbrauen und Wangenknochen, sah ihn dabei fest an.
»Mach es einfach! Hörst du?«
Max nickte. Und warum auch nicht? Warum sollte er etwas riskieren? Das würde ihm später niemand danken, und für dieses Publikum, das ihn sowieso hasste, musste er keine perfekte Show hinlegen. Je eher er aus diesem Hexenkessel herauskam, desto besser.
Der Gong ertönte. Max federte in den Ring, als sei nichts gewesen. In seinem Kopf aber herrschte noch immer Verwirrung. Von der Konzentration, zu der er sonst fähig war, war er meilenweit entfernt. Wenn das nur gut ging!
De Martin war wieder etwas vorsichtiger geworden, besann sich seiner perfekten Deckung, doch er war in der Pflicht, musste den ersten Schritt tun, seine Fans verlangten es von ihm. Lautstark feuerten sie ihn an. Also startete er einen Angriff.
Max hatte damit gerechnet.
Er ließ ihn kommen, wich einem halbherzigen Schlag aus und legte dann alle Kraft in seine ohnehin gefürchtete Rechte. Seine Faust schoss vor, krachte gegen die erhobene Deckung de Martins, schüttelte ihn ordentlich durch und warf ihn gegen die Seile. Max setzte nach, schickte eine schnelle Kombination hinterher, von der ein Schlag an de Martins Schläfe explodierte. Er war nicht hart genug, um den Hünen zu fällen, reichte aber aus, dessen Deckung erneut zu öffnen.
Da war er. Der Solarplexus.
Als gäbe es eine geheimnisvolle Verbindung, fand Max’ rechte Faust ihren Weg dorthin. Sie traf den Jungen zwei Zentimeter unterhalb des Brustbeins. De Martin gab ein lautes »Uff« von sich, so als würde ihm sämtliche Luft aus der Lunge gedrückt, dann taumelte er zurück und krümmte sich zusammen.
Normalerweise hätte Max jetzt gewartet, den Kampf noch ein wenig hinausgezögert, doch nicht heute. Die nächste Rechte traf den Italiener ungeschützt am Kopf. Es war ein fürchterlicher Schlag, den niemand einfach so wegsteckte. Wie in Zeitlupe sah Max, was nun passierte.
Der Kopf des Jungen wurde zur Seite geschleudert. Blut spritzte aus einem Cut unter dem linken Auge. De Martin wurde für einen Moment stocksteif, verdrehte die Augen und ließ die Arme fallen. Während ein ungläubiges Raunen durch die Menge ging, sackte der Hüne auf die Knie und schlug dann der Länge nach vornüber.
Der Ringboden erzitterte unter Max’ Füßen.
Der Ringrichter schob ihn weg. Dann begann er, den Italiener anzuzählen.
»Eins … zwei … drei … vier …«
6
Die noch unbenutzte, scharfe Spitze des feinen Skalpells drang mühelos in ihre Augenhöhle ein. Er spürte keinerlei Widerstand, selbst dann nicht, als er den Sehnerv durchtrennte. Es war eine Sache von wenigen Minuten, ihr die Augen herauszuschneiden. Sie fielen direkt auf das doppelt gefaltete Stück Küchenkrepp vor ihm auf dem Tisch. Natürlich zappelte sie dabei, versuchte sogar ihn zu beißen, aber ihre Zähne drangen nicht durch den derben Stoff des Arbeitshandschuhs, den er zum Schutz trug.
Im Laufe der Zeit hatte er eine gewisse Routine und Kunstfertigkeit darin entwickelt, ihnen die Augen zu entfernen. Die ersten Versuche damals waren kläglich gescheitert. Er war mit dem Skalpell viel zu tief in die Augenhöhle eingedrungen, hatte dabei ihr Gehirn verletzt, und sie waren auf eine abstoßende Art verendet. Hatten sich verkrampft, gepinkelt und gekotet und wie kleine Zombies gezappelt, bis es nach weniger als einer Minute vorbei war. Ein paar Mal war das zwar interessant gewesen, aber alles andere als zielführend, deshalb hatte er begonnen, seine Technik und sein Werkzeug zu verfeinern. Das Skalpell, welches er nun benutzte, war in der Spitze so fein, dass man einen Grashalm damit spalten konnte. Außerdem nahm er jedes Mal ein neues. Diese unglaublichen Klingen wurden leider auch unglaublich schnell stumpf. Gut, die Instrumente kosteten eine Kleinigkeit, aber das spielte nur eine untergeordnete Rolle. Um ein Profi zu werden, das hatte er schon frühzeitig erkannt, benötigte es zweierlei: Übung, Übung, Übung und die richtige Ausrüstung – und das traf im Grunde auf alle Bereiche des Lebens zu.
Er betrachtete sich mittlerweile als Profi, und als solcher war es ihm wichtig, sie nicht unnötig zu quälen. Vor allem aber durften sie nicht sterben, denn tot nützten sie ihm gar nichts. Wenn sie ihm Freude bereiten sollten, mussten sie lebendig und möglichst vital sein, sonst lieferten sie ihm nicht die Reaktionen, die er erwartete. Er brauchte sie mit hellwachen Sinnen und geschärften Instinkten!
Er erhob sich und ging hinüber zu dem großen Terrarium, welches die komplette Stirnseite des Raumes in Anspruch nahm. Zweieinhalb Meter hoch, vier Meter breit und scheinbar unendlich tief. Er selbst hatte es gebaut. Vor die vorhandene Mauer hatte er einfach eine zweite Leichtbauwand aus Holz eingezogen und verkleidet. Den oberen Teil, den er aufgrund der Höhe nur mit Hilfe eines kleinen Tritts erreichen konnte, nutzte er als Regal für seine umfangreiche Fachliteratursammlung. Vom Boden bis auf Stirnhöhe aber erstreckte sich eine Panoramaglasscheibe. Sie war eingefasst von edlem Mahagoniholz, dessen warmer, roter Ton einen starken Kontrast zu der grünen Welt darstellte, die hinter dem dicken Glas in künstlichem Licht schimmerte. Der ansonsten nur zweckmäßig eingerichtete Raum wurde beherrscht von dem Terrarium, und immer wenn er durch die Tür trat, übermannte ihn der Eindruck, tatsächlich einen Dschungel zu betreten. Was zu einem nicht unwesentlichen Teil an der Audiodatei lag, die in Endlosschleife auf dem PC lief und über hochwertige Lautsprecher die Geräuschkulisse eines Regenwaldes wiedergab.
Perfektion war ihm wichtig. Er hatte sich große Mühe gegeben und viel Geld investiert, das er eigentlich gar nicht besaß, um dendroaspis viridis einen Lebensraum einzurichten, der dem natürlichen in den tropischen Regenwäldern Westafrikas glich. Da sie ein Baumbewohner war, musste das Terrarium eine gewisse Höhe und Ausstattung aufweisen. Mit Hilfe von einigen exotischen und auch seltenen Pflanzen, die er über seinen Großhändler original aus den fernen Ländern der Welt importieren ließ, hatte er den Ausschnitt eines Regenwalddaches nachgebildet, das von künstlichem Sonnenlicht durchflutet wurde. Die Temperatur von 25-28 Grad Celsius wurde ebenso wie die konstant hohe Luftfeuchtigkeit ständig vom PC überprüft und in einem Diagramm dargestellt. Eine Zeitschaltuhr steuerte Sprühschläuche an der Decke des Terrariums an, die alle sechs Stunden einen Schauer über der kleinen, künstlichen Welt niedergehen ließen.
Vor der Panoramascheibe blieb er stehen und suchte den Urwald dahinter ab, fand dendroaspis viridis allerdings nicht. Irgendwo in dem dichten grünen Blattwerk hielt sie sich verborgen. Egal! Sobald ihr Opfer nervös und orientierungslos am Boden umherkrabbelte, würde sie sich schon zeigen.
Er ging zum Tisch zurück und nahm die nun blinde Wüstenrennmaus aus dem eckigen Glaskasten. Sie am Schwanz tragend stieg er auf einen Schemel und öffnete in einer Höhe von fast zwei Metern eine kleine hölzerne Schiebetür. Sie befand sich oberhalb der Panoramascheibe, aber längst nicht außerhalb der Gefahrenzone. Die grüne Mamba war eine der schnellsten und gefährlichsten Giftschlangen und ihr Biss absolut tödlich, wenn er nicht in kürzester Zeit behandelt wurde. Vorsicht war also angeraten!
Er steckte seine Hand in das Terrarium, ließ die Maus fallen, zog die Hand schnell zurück und schloss die Schiebetür. Die Wüstenrennmaus fiel durch das Blätterdach bis auf den Boden, der mit Holzstreu, Blättern und Sand ausgelegt war. Sie landete auf den Beinen, blieb kurz sitzen und rannte dann los. Verletzt und panisch wie sie war, nützten ihre Tasthaare ihr nichts; sie stieß gegen Steine, Baumstümpfe und die Glasscheibe, wurde dabei immer hektischer. Er hoffte, dass sie keinen Herzinfarkt bekam, bevor die Mamba sie bemerkte! Das war schon öfter passiert und hatte ihn jedes Mal richtig wütend gemacht.
Er ging zwei Schritte rückwärts und ließ sich in den gemütlichen Fernsehsessel fallen, seinen Logenplatz vor dem Terrarium.
Die Show konnte beginnen!
Doch zunächst tat sich nichts.
Die Maus wurde langsamer, ihre Kraft verließ sie. Vielleicht glaubte sie aber auch nur, sie wäre der Gefahr entronnen. Die Vorstellung gefiel ihm! Da saß sie und schöpfte Hoffnung, fand sich mit ihren Verletzungen ab und war dankbar, noch am Leben zu sein, während der eigentliche Feind sie längst mit seinen schwarzen Augen von oben fixierte.
Er blieb reglos sitzen und versank in den Regenwald. Spürte, wie die hohe Temperatur und Luftfeuchtigkeit da drinnen seinen Körper umgaben, wie es ihm den Schweiß aus den Poren trieb, lauschte den fremdartigen Geräuschen, diesem ständigen Singsang aus Vogelgezwitscher, Fiepen, Rascheln, Surren, Kreischen und Zischen, nahm die imaginären Gerüche auf, diesen süßen Duft von Verwesung und Wiedergeburt, den Kreislauf des Lebens, dem alles unterworfen war. Und wie immer, wenn er dort saß, verließ er seinen Körper, dieses ungeliebte Gefäß, das alle anderen sehen konnten. Er schwebte durch den Regenwald, erkundete die fremde, organische, vor Lebendigkeit zuckende Welt, ohne sich über Gefahr und Tod zu sorgen. Es war ein Ritt auf den Wolken, ein Freiflug vom Leben, eine transzendentale Erfahrung von unfassbarer Schönheit.
Leider zwang ihn seine zunehmende Müdigkeit zurück auf den Boden.
Die Nacht war anstrengend gewesen. Er hatte die Neue zuerst sicher unterbringen und dann noch den langen Rückweg in Kauf nehmen müssen. Gern hätte er sich mit ihr beschäftigt, aber die Sedierung würde noch bis in den Vormittag anhalten, also musste er mit diesem Schauspiel hier vorliebnehmen.
Etwas regte sich im Blätterdach!
Die Mamba!
Hatte sie also doch Hunger!
Zunächst bewegten sich nur einzelne Blätter, vibrierten und erstarrten wieder. Er konnte den Körper nicht sehen, nur dessen Auswirkungen auf seine Umwelt. Er richtete sich auf, brachte sein Gesicht näher an die Scheibe und riss die Augen weit auf.
Wo bist du?
Zeig dich, Baby!
Plötzlich glitt ihr schlanker Kopf geräuschlos aus dem Blätterdach. Die dunklen Augen starrten zu Boden, fixierten die Maus, die schon eine ganze Weile auf der Stelle saß. Und diese schien zu spüren, dass nun doch wieder Gefahr drohte. Sie hob das Köpfchen, als wolle sie nach oben schauen, hatte vielleicht vergessen, dass ihre Augen nicht mehr da waren. Die feinen Härchen an der Nase und die Nase selbst vibrierten, sie schnüffelte wie von Sinnen, versuchte, ihre Blindheit olfaktorisch wettzumachen.
Ach, wie er diesen Moment liebte, in dem die Maus begriff, dem Tode geweiht zu sein und gar nichts daran ändern zu können. Er liebte und fürchtete ihn zugleich, war hin und her gerissen und geradezu magisch angezogen. In diesem Moment verspürte auch er diese tiefsitzende Urangst; die Angst der Kreatur vor dem Stärkeren, dessen Nahrung sie war. So einfach und schlicht, eine ewig währende Wahrheit.
Wieder begann die Maus hektisch umherzurennen. Wieder stieß sie gegen alles, was im Wege stand. Die Schlange über ihr blieb völlig ruhig. Ihre glanzlosen Augen bewegten sich nicht. Er konnte nur den Kopf und ein kleines Stück des schlanken grünen Körpers sehen, der Rest verbarg sich noch im Blätterdach.
Ohne Vorwarnung ließ die Mamba sich fallen.
Der zwei Meter lange Körper landete sanft auf dem Holzstreu und bildete sofort einen Kreis um die Maus. Die Maus blieb heftig zitternd sitzen, hob wieder den Kopf an, als hoffte sie, mit ihren blinden Löchern doch noch etwas sehen zu können.
Schon zuckte der Kopf der Schlange vor. Eine wuchtige und doch elegante Bewegung. Die leicht nach hinten gebogenen Zähne gruben sich tief in den Körper der Maus.
»Ja!«, rief er und klatschte in die Hände.
Gebannt beobachtete er das Schauspiel. Die Wüstenrennmaus zuckte noch ein paarmal, unternahm aber keinen Fluchtversuch.
Erst als die Maus sich nicht mehr rührte, begann die Schlange zu fressen. Sie hakte ihren Unterkiefer aus dem Gelenk und schob ihn unter den reglosen kleinen Körper. Nach und nach und eigentlich enervierend langsam verschwand die Maus mit dem Kopf voran im Inneren der Schlange. Zwei Meter sich windendes, grünes Muskelgewebe sog seine Beute mit peristaltischen Bewegungen, aber scheinbar ohne große Anstrengung, in sich hinein. Durch die Ausbuchtung konnte er genau sehen, wo die Maus sich befand.
7
Am frühen Sonntagmorgen war der Himmel wieder klar. Auffrischender Westwind hatte die Wolken des gestrigen Abends vertrieben. Gegen den Himmel wirkte der See geradezu dunkel und unheimlich.
Franziska Gottlob hatte ihre dicke alte Strickjacke übergezogen, die sie nur noch trug, wenn sie zuhause war. Trotzdem fröstelte sie, als sie auf den Holzsteg hinausschlenderte. Sie schlang Arme und Jacke fester um ihren Oberkörper. Es war kühl für einen Junimorgen, zehn Grad zeigte das Thermometer am Bootshaus an, dazu der leichte Wind, doch das war es nicht allein. Ein bisschen war auch das Wasser des Sees schuld an ihrem Frösteln. Vom Wind aufgeraut und angetrieben, plätscherte es gegen die Eichenpfähle, die den Steg seit vielen Jahren trugen. Die bewegte Oberfläche wollte ihr einfach keinen Blick zum Grund gewähren.
Am Ende des Steges blieb Franziska stehen, lehnte sich gegen den Wind, der ihr langes rotes Haar hinter ihrem Kopf flattern ließ, und sah rüber zum anderen Seeufer.
Wieder einmal spürte sie, wie wohltuend diese Umgebung auf sie wirkte. Alles hier war das genaue Gegenteil zu ihrem unruhigen, von Gewalttätigkeiten geprägten Leben in der Stadt. In diesem Haus am See war sie von ihrem siebten Lebensjahr an aufgewachsen. Ihre Eltern hatten es gekauft, nachdem die Romane ihres Vaters erstes gutes Geld eingebracht hatten. Ihre Seele war hier zuhause, das wusste Franziska, und sie fragte sich abermals, ob es richtig gewesen war, sich einen anderen Lebensmittelpunkt zu suchen.
Sie spürte die Vibration von Schritten im Holz und drehte sich um. Ihr Vater kam den Steg entlang. Er trug eine grüne Baumwollhose, dazu einen gefütterten Windbreaker, dessen flauschiger Kragen hochgestellt war. Die beiden Kleidungsstücke besaß er seit vielen Jahren, sie waren unverwüstlich, aber heute schien er darin zu versinken. Er war kleiner und schmaler geworden, und Franziska ahnte, dass nicht nur das Alter ihn Substanz kostete.
Ihr Lächeln wollte nicht so recht gelingen, als er sie erreichte.
»Guten Morgen, meine Kleine«, sagte er und umarmte sie. Er hatte sich noch nicht rasiert und kratzte. »Deine Mutter macht das Frühstück. In einer halben Stunde wird sie nach uns rufen«, sagte er und wandte sich zusammen mit seiner Tochter wieder dem See zu.
»Der Kampf war kurz, aber klasse, oder?«
Franziska nickte. »Obwohl er gleich in der ersten Runde unkonzentriert wirkte.«
»Ach was«, winkte ihr Vater ab, »das war nur Show. So leicht lässt der sich den Gürtel nicht wieder abnehmen.«
Dann schwiegen sie und sahen einem Entenpaar zu.
»Papa, ich …«
»Warte«, unterbrach er sie und griff in die Innentasche seiner Jacke. Er holte ein gefaltetes Blatt Papier heraus, faltete es auseinander und reichte es ihr. »Da, diese Stelle«, sagte er und wies mit dem Finger auf eine mit gelbem Marker umkringelte Zahl.
»Was ist das?«, fragte Franziska, die den Zettel nicht verstand. Es war irgendein Laborbefund, so viel war klar, und damit per se schon verwirrend.
»Diese Zahl benennt den aktuellen PSA-Wert zu Beginn der Bestrahlung. Er liegt bei 6,8.«
»Was ist ein PSA-Wert?«
»Prostata-spezifisches Antigen … lässt sich im Blut feststellen. Je höher der ist, umso schlechter. Ab einem Wert von zehn wird es wirklich kritisch. Ich zeige dir diesen blöden Wisch, weil ich dich gut kenne, weil ich weiß, wie wichtig für dich Zahlen und Fakten sind, alles, was sich überprüfen und vergleichen lässt. Ich weiß, dass meine Antwort gestern Abend dich nicht wirklich beruhigt hat. Merk dir den Wert. 6,8. Ein paar Wochen nach der Bestrahlung wird er noch mal gemessen, und wenn er dann deutlich niedriger ist, war die Behandlung erfolgreich.«
Franziska sah von dem Blatt Papier zu ihrem Vater auf. »So einfach?«
Er nickte. »So einfach. Auch Krebs lässt sich in Zahlen ausdrücken. Meine Schicksalszahl kennst du nun. Und ich möchte dich darum bitten, es solange darauf beruhen zu lassen, bis ich eine neue bekomme.« Er sah sie von der Seite her an. »Ist das in Ordnung für dich?«
Sie gab ihm den Zettel zurück. »Ja, ist es. Danke, Papa.«
Eigentlich wollte sie noch viel mehr sagen, aber ihr Vater, der sein ganzes Leben lang immer nur so viel geredet hatte, wie nötig war, hatte ihr gerade deutlich zu verstehen gegeben, dass diese seine Maxime auch für den Krebs in seinem Körper galt. Mehr gab es zurzeit nicht zu sagen. Punkt!
Er deutete mit ausgestrecktem Arm auf den See hinaus.
»Der schönste Ort der Welt, nicht wahr?«, sagte er.
Franziska nickte.
Weil Schweigen das Einzige war, was jetzt Sinn machte, schwiegen die beiden miteinander und ließen die Natur sprechen. Ließen sie ungestört schwappen, gurgeln, plätschern, rauschen, wispern und singen.
Das Läuten ihres Handys beendete diesen besonderen Moment.
Teil 2
1
Sarah erwachte in einer anderen Welt. Dass um sie herum nichts mehr so war, wie sie es kannte, spürte sie sofort, aber in den ersten Sekunden überwogen die Signale, die ihr Körper aussendete: Sie hatte einen ekligen, bitteren Geschmack im Mund, in ihrem Bauch rumorte es, ihr Kopf schmerzte ziemlich stark, diese Art von Kopfweh, die von tief drinnen nach außen zog und sogar in den Augenhöhlen pochte. Sie fühlte sich krank.
Dann setzte die Erinnerung ein und die Schmerzen verblassten.
Harte, kratzige Haare unter ihren Fingern, Atem auf ihrem Gesicht, ein schweres Gewicht am Fußende ihres Bettes. Statt des Klingelknopfes hatte sie in ein Gesicht gefasst, kein menschliches, ganz bestimmt nicht, es hatte sich … hässlich angefühlt.
Was dann?
Was war geschehen?
Ab dem Zeitpunkt hatte sie keine Erinnerung mehr, nur noch Dunkelheit und Leere. Bis jetzt.
Sie konzentrierte sich auf ihre Umgebung. Sie lag nicht mehr auf ihrer weichen Matratze, spürte auch keine kuschelige Decke auf ihrem Körper, und der Duft ihrer Bettwäsche nach einem bestimmten Waschmittel war auch nicht mehr da. Außerdem trug sie ihren Schlafanzug nicht. Sie war nackt!
Das Verlangen, aufzuspringen und wegzulaufen, wurde dadurch noch verstärkt, trotzdem blieb sie zunächst reglos liegen. Sie hatte gelernt, diesen Fluchtimpuls zu unterdrücken. Auf jeden Fall war es immer besser, erst einmal die Umgebung zu erkunden, statt sie panisch zu verändern.
Sie blähte die Nasenflügel und sog die unbekannten Gerüche auf. Nichts von dem, was dabei in ihre feine, äußerst sensible Nase geriet, gehörte zu ihrer gewohnten Umgebung. Sie erkannte den Geruch von modrigem Waldboden, auf dem Blätter verfaulten, um dann selbst zu Waldboden zu werden. Dieser Geruch überlagerte alles andere. Die meisten Menschen hätten das, was sich darunter befand, nicht wahrgenommen, doch ihre Nase filterte auch die feinen Nuancen heraus. Einiges davon konnte sie nicht zuordnen; sie hatte es schlicht und einfach noch nie gerochen. Aber da war auch der Geruch von warmem Regen, von Baumrinde, aus der Harz troff, zusätzlich mischte sich ein versteckter, aber trotzdem strenger tierischer Geruch darunter.
Wo war sie nur?
Der Impuls zur Flucht wurde noch stärker, und obwohl sie um Hilfe rufen wollte, damit jemand käme und sie rettete, sie vielleicht auch nur aus einem dummen Traum weckte, tat sie es nicht. Sie war schließlich nicht dumm. Wer auch immer sie aus ihrem Zimmer in diesen Wald verschleppt hatte, wollte bestimmt nicht, dass sie schrie.
Also tat sie weiterhin so, als schliefe sie. Jetzt, da ihr Kopf nicht mehr damit beschäftigt war, die Gerüche zu sortieren, konnte sie sich voll und ganz auf ihr Gehör konzentrieren. Darin war sie sehr gut. Aber auch die Geräusche waren fremdartig. In einem Wald war sie schon gewesen, und auch dort hatte es allerlei verschiedene Geräusche gegeben, aber völlig andere als hier. Dieses feine Zirpen und unterschwellige Glucksen, dazwischen immer wieder eine Art zischelndes Zucken, aber nur ganz wenig Gesang und Gepiepe, das alles wollte so überhaupt nicht zu der Art von Wald passen, den sie kannte. Ihr Wald war hoch und weit, Vogelgesang hallte darin lange nach. Geräusche ließen sich ganz klar in ein Oben und ein Unten einteilen, hier aber war alles durcheinander, außerdem klang es dumpf, so als fehlte die Weite und Höhe.
Ihre Angst nahm zu, entsandte prickelnde Hitze auf ihre Wangen und die Stirn. So viel Platz beanspruchte die Angst, dass ihre Blase plötzlich heftig drückte und sie meinte, sofort zu müssen. Ganz fest presste sie die Kiefer aufeinander und die Beine zusammen.
Nein, sie konnte nicht mehr still bleiben! Sie musste sich bewegen. Also streckte sie den rechten Arm aus und begann zu tasten. Ihre Fingerkuppen, vom vielen Tasten zwar hart, aber trotzdem äußerst sensibel, bewegten sich in kleinen Schritten vor, und alles, was sie dabei spürten, begann sie sofort zu analysieren.
Das Weiche und Lockere, worauf sie lag, waren ganz eindeutig Laub und Rinde. Aber es waren nur kleine Stücke, und genauso wie das Laub fühlten sie sich feucht an. Hatte es gerade geregnet? Wenn ja, warum war sie selbst dann nicht nass? Lag sie etwa unter einem Dach? Drangen die Waldgeräusche deshalb so seltsam gedrückt zu ihr? Sie legte den Kopf in den Nacken und reckte ihr Kinn nach oben. Wenn sie sich in geschlossenen Räumen befand, konnte sie fühlen, wie weit die Decke entfernt war. Es war wie eine Art menschlicher Ultraschall, aber hier funktionierte es irgendwie nicht richtig. Zwar fühlte sie, dass irgendwas schwer auf der Umgebung lastete, aber einordnen oder gar als Zimmerdecke erkennen ließ es sich nicht.
Großer Gott! Hier war wirklich nichts so, wie sie es kannte. Absolut nichts!
2
Franziska Gottlob stand in der Eingangshalle des Helenenstifts, einem Wohnheim für behinderte Kinder und Jugendliche, und war für den Moment gefangen vom Anblick des riesigen Aquariums, das sich an der Wand gegenüber der Eingangstür befand. Es war an die zwei Meter lang und anderthalb Meter hoch. Die Halle war freundlich und farbenfroh ausgestattet, aber angesichts dieses gläsernen Meeresausschnittes verblasste alles ringsherum.
Für einen Moment blendete es sogar die hektische Betriebsamkeit aus, die in der Eingangshalle und auf dem Parkplatz davor herrschte. Die Spurentechniker ihrer Abteilung gingen mit der gewohnten Ruhe und Akribie vor, aber alle anderen, das Pflegepersonal, die Kinder, einige besorgte Eltern, waren durch den Vorfall in heller Aufregung. Es war schwer, sie in ihren Zimmern oder dem Speisesaal zu halten, damit sie die Arbeit der Beamten nicht störten.
»Frau Gottlob?«