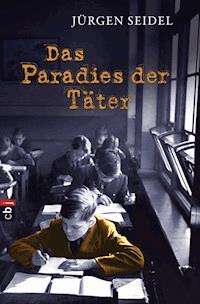Inhaltsverzeichnis
Titel
Inschrift
Vorwort
ERSTER TEIL – Haus Ulmengrund
Lambarene
Die Gemeinschaft
Flausen im Kopf
Wunderbare Menschen
Weltfriedensfest
Neuyork
Klipp und klar
Rhönfalke
Hausmeister Kiank
Das Wunder
Ein heiliges Versprechen
Der Brief aus Hamburg
Das Geheimnis
Wellblech
Der Sensenmann
ZWEITER TEIL – Tausendschön
Die fremde Mutter
Minenleger U 64
Die Kunst des Segelfliegens
Das Liebesfieber
Schwarzerden
Nächtliche Erzählungen
Im Strafzimmer
Herr Brot-Korff
Glückskind
Rattendreck
Die Dichterin
Liebste Gräfin
Berlin ist nur der Anfang
DRITTER TEIL – Mädchenblüten
Der Entschluss
Die Wegwartenfeier
Hochverehrter Doktor Schweitzer
Verknallt
Nächtliches Meer
Schöne Ordnung
Der Ball auf der Treppe
Everything okay
Die neue Freundin
Die Dame mit der federleichten Schleife
Die grün-blaue Frau
Die Sehnsucht
Der Kuss
Purpurroter Lippenstift
Der Mann im Lift
Die Soiree
Nachspiel
Glossar
Copyright
Now let him go to sleep with history.
LEONARD COHEN (Flowers for Hitler)
Vorspiel
Hitze und Stille liegen wie staubige Tücher über allem. Jede Bewegung der drei Mädel im Hof des Pensionats erscheint zu langsam, jedes ihrer Worte klingt gedämpft. Die hölzernen Wände des Stalls und die Steine der Hausfassade werfen kaum ein Echo zurück, wenn die drei miteinander flüstern. Der heiße Wind bewegt von Zeit zu Zeit die Wipfel der Ulmen. Bussarde drehen darüber ihre Kreise, ohne einen Flügelschlag, werden kleiner, bis sie kaum mehr zu erkennen sind.
Die Mädchen gehören zu den Jüngsten in Haus Ulmengrund, und Geheimnisse zu haben, ist schön. Im Schatten des Laubs hocken die drei um ein Geviert aus rötlichem Ölpapier, das in ihrer Mitte auf den Steinen liegt und nicht größer ist als ein Taschentuch. Fünf Zaubertütchen aus Papier liegen darauf. Drei sind aufgeschlagen und bannen ihre Blicke.
Das erste Tütchen zeigt sechs winzige, bleiche Hornschnipsel. Auf dem zweiten Umschlag liegt eine Haarlocke, mit Zwirn umwunden, für alle Zeit fixiert. Im dritten offenen Briefchen liegt nur ein Häufchen Sand und Erde. Aber der Sand ist wertvoller als alle Edelsteine Afrikas.
Das erste Mädel sagt: »Mein Cousin hat den Sand vor einer Steintreppe in Berlin aufgewischt, an der Stelle, wo das Auto des Führers immer hält und er aussteigt.«
Die anderen hören mit roten Gesichtern zu.
»Mein Cousin hat sich hinter einer Litfaßsäule versteckt«, erzählt das Mädel weiter, »und als der Führer oben auf der Treppe war, ist er schnell hingerannt. Diese Erde hat die Stiefelsohlen des Führers berührt!«
Die Mädchen fühlen einen Schauer über ihre Rücken laufen.
»Das Haar habe ich aus Finsterwalde mitgebracht«, berichtet das zweite Kind. »Meine Tante arbeitet dort in einer Uniformenfabrik. Sie machen auch Schirmmützen und sogar die Schirmmützen für den Führer. Ab und zu kommt er dorthin und lässt Maß nehmen, probiert neue Mützen an und lässt die getragenen liegen. Die Haare hat meine Tante mit einer Pinzette vom Stoff gelöst und gesammelt.« Das Mädchen sieht die anderen an und zeigt auf die dunkle Locke. »Das ist das Haar des Führers.«
Sie rufen leise Ah und Oh.
»Ein Schulfreund meines Onkels«, erzählt das dritte Mädel, »ist Leibdiener des Führers, wenn er mit seinem Sonderzug auf Reisen ist. Er bringt ihm Brot, Milch und Salat, und manchmal hört er ihn durch die Wand leise beten, dass es dem deutschen Volk in Zukunft besser gehen soll. Die Fingernägel lässt sich der Führer von seiner Sekretärin schneiden, die die Reste niemals auf den Boden wirft. Sie lagen auf der Untertasse, als der Leibdiener den Kaffee abräumte.« Das Mädchen schweigt einen Moment und wechselt mit den anderen Blicke. Dann sagt es: »Es sind die Fingernägel unseres Führers.«
Die Kinder berühren den Schmutz, die Locke und die Hornschnipsel mit ihren Fingerspitzen und schütteln sich vor Glück.
Das ferne Böllern eines Motorrads dringt in die Stille. Die Mädchen horchen auf.
»Der Brot-Korff, der Verrückte«, sagt eines.
Sie falten die drei offenen Tütchen zusammen und wickeln alle fünf ins Ölpapier, legen das Päckchen in eine Blechdose und tragen sie zu einer kleinen Kapelle an der Straße, wo sich ihr Versteck befindet.
Das Motorenknattern wird lauter. Schließlich biegt ein Gespann in den Hof und macht eine ordentliche Staubwolke. Der Lärm erstickt, der Staub verweht. Ein Mann steigt ab, zieht seine Ledermütze und grüßt. Er öffnet die schwarze Schürze des Beiwagens und winkt die Mädchen zu sich. Sie helfen ihm, ein Dutzend Brotlaibe über den Hof ins Haus zu tragen.
»Euch ist klar, dass ich weiß, was ihr gerade gemacht habt, bevor ich kam«, sagt der Mann.
»Wir haben nichts gemacht, Herr Korff.«
»Glaubt ihr etwa, dass ich euer Versteck nicht kenne?« Er nickt zu der Kapelle.
»Niemand kennt es.«
Korff lacht. »Die Bernsteinkapelle kennt jeder. Da solltet ihr vorsichtiger sein.«
Ein Mädel entgegnet: »Wer das Versteck verrät, dem wächst die Hand aus dem Grab, wenn er tot ist, oder er muss für immer durch die Welt fahren wie der Ewige Jude.«
»Meine Eltern sind schon lange mausetot«, sagt Korff, »und Jude bin ich auch nicht. Gott sei Dank in dieser Zeit.«
»Werden Sie uns denn verraten?«
Er schüttelt den Kopf.
Sie legen die Brote drinnen auf den Küchentisch und gehen wieder in den Hof hinaus. Der Mann beugt sich zu dem Beiwagen hinunter. Als er sich aufrichtet, hat er drei neue, kleine bunte Tüten in der Hand.
»Bourbonische Vanille!«, sagt er und reicht jedem der Mädchen eine Tüte. Sie machen artige Knickse. Jedes öffnet gleich sein Briefchen und saugt den Duft ein.
»Den Tüten, die ihr da habt, denen trau ich nicht so ganz, seid mir nicht böse«, erklärt er und deckt den Beiwagen wieder ab, zieht seine Lederkappe auf und steigt auf das Motorrad. »Wisst ihr nicht, dass es jedem einzelnen Haar wehtut, wenn man es abschneidet? Fingernägel bluten, auch wenn man es nicht sieht. Und Sand und Kieselsteine schreien, wenn man auf sie tritt. Da muss man nur die Ohren spitzen.«
Die Mädchen kichern.
»Ihr wisst ja gar nichts«, ruft er freundlich. »Möchte nur mal wissen, wer euch solche Tüten gibt. Aber ich hab es eilig. Sagt der Frau Pensionatsleiterin bitte, dass sie das Brot auch nächstes Mal bezahlen kann.«
Er tritt das Motorrad an. Es lärmt und qualmt.
Die Mädel winken mit den neuen Tütchen. Der Mann lenkt das Gespann in einem weiten Bogen über den Hof und verschwindet laut böllernd in einer gelben Wolke, die hinauf zum sommerblauen Himmel steigt.
ERSTER TEIL
Haus Ulmengrund
Lambarene
Mein Vater ist Arzt, meine Mutter Krankenschwester«, erzählte Reni flüsternd. »Sie arbeiten in Afrika und heilen Neger von seltenen Krankheiten, deshalb haben sie keine Zeit für mich und darum lebe ich hier mit euch zusammen in Haus Ulmengrund. Ich finde das nicht schlimm. Das Urwaldspital von Doktor Schweitzer1 ist hundertmal wichtiger als ich.«
Mit diesen Sätzen begann sie fast jede ihrer Geschichten, nachdem eine der Erzieherinnen allen Mädchen eine Gute Nacht gewünscht und im Saal das Licht ausgeknipst hatte.
Reni redete so leise, dass nur ihre Freundinnen es hörten: Karin in dem Bett gleich über ihr, Janka und Friederike im linken, Monika und Hilde im rechten Etagenbett. Die anderen schliefen fest.
»Im Moment ist Doktor Schweitzer auf Reisen«, fuhr sie fort. »Er benötigt dringend ganz viel Wellblech, weil es überall hereinregnet. Die Dächer der Hütten sind aus Schilf. Mein Vater hat die Leitung des Spitaldorfs übernommen, solange der Oganga fort ist, so nennen die Neger den Urwalddoktor. Papa steht kurz vor der Entdeckung eines Mittels gegen eine heimtückische Durchfallkrankheit, die man bekommt, wenn man bestimmte Urwaldbeeren isst.«
»Die Neger wissen doch bestimmt, dass diese Beeren giftig sind«, wandte Friederike von links oben ein.
»Ja, aber die Beeren werden von Tieren gefressen und die Neger essen eben diese Tiere.«
»Au weia«, sagte Janka im Bett unter Friederikes viel zu laut. Man konnte im Dunkeln hören, wie sie sich auf den Mund schlug.
»Mein Vater meint«, erzählte Reni weiter, »dass auf den Beeren Bazillen leben, die die schlimmsten Feinde in Lambarene sind. Weil es in Afrika keinen Winter gibt, werden sie nie von der Kälte abgetötet, sondern vermehren sich immer weiter.«
»Und was ist mit den Blättern und dem Laub?«, fragte Monika von rechts.
»Die bleiben in Afrika immer an den Zweigen, Dummerchen«, sagte Hilde über ihr. »Das hat uns Reni doch gestern erklärt. Wahrscheinlich bist du wieder eingeschlafen.«
»Überhaupt nicht!«, zischte Monika.
»Reni, erzähl uns von der schwarzen Bubenschule, bitte«, flüsterte Karin herunter. »Wie furchtbar schwarz die Negerjungen alle sind.«
»So kohlrabenschwarz«, sagte Reni, »dass man sie in der Nacht nicht sieht, selbst wenn sie im Dunkeln ganz nah an einem vorüberschleichen.«
»Aber sie stinken doch«, vermutete Janka.
»Nicht mehr als du, wenn du morgens gähnst«, zischte Hilde herunter.
Die Mädchen lachten.
»Sie stinken, weil sie eine fremde Rasse sind, das weiß doch jeder«, erklärte Monika.
»Und weil sie dort keine Wasserhähne haben, so wie wir«, fügte Reni hinzu. »Es gibt für alle nur einen einzigen tiefen Brunnen und das Flusswasser.«
»Drüben auf dem Schlömerhof gibt es für das Gesinde auch nur einen Brunnen«, sagte Karin. »Deshalb stinkt dein Jockel ja auch wie ein Neger.«
»Er ist nicht mein Jockel«, versetzte Reni und lenkte das Interesse schnell wieder auf das Urwaldspital. »Papa sagt, dass es die Neger viel länger auf der Erde gibt als uns. Natürlich sind sie primitiver, das sieht man ja sofort.«
»Man sieht auch, dass sie viel an der Sonne sind«, tuschelte Janka. »Jockel ist fast genauso schwarz, findest du nicht?«
»Halt lieber deinen Mund, Janka«, schimpfte Reni. »Sonst merken die anderen, dass du bloß eifersüchtig bist.«
»Pah!«, machte Janka.
Die andern tuschelten.
»Ihr seid so laut, dass wir morgen eine Strafe kriegen«, drohte Friederike von oben. »Nächsten Monat ist Musik im Dorf und wir werden wieder nicht hindürfen.«
»Dann schlafen wir jetzt eben«, sagte Reni.
»Nein, bitte!«, flehte Hilde von rechts oben. »Ich bin ganz munter und kann noch nicht schlafen.«
»Weil du an Jockel denkst«, meinte Karin.
Hilde schoss ein scharfes »Ziege!« gegen sie zurück.
»Erzähl noch was, Reni!«, bettelte Friederike. »Noch eine einzige Minute, noch eine klitzekleine Sekunde …«
»Die Negerbuben schlafen alle zusammen in einem großen Haus aus Lehm und Stroh«, erzählte Reni weiter. »Sie tragen nur Lappen um die Hüften und besitzen nicht einmal Hemden. Meine Mutter erklärt ihnen jeden Tag, wie man sich die Hände waschen muss, aber sie tun es nicht.«
»Pfui«, sagte Hilde.
»Sie waschen die Hände mit Sand«, ergänzte Reni.
»Mit Sand?«
»Natürlich. Es gibt nur Sand in der Wüste«, flüsterte Janka.
»Es ist ein Urwaldspital, kein Wüstenspital«, wandte Friederike ein.
Reni quietschte mit den Federn ihres Bettes. »Es gibt nur Lehm und Stroh für die Dächer der Häuser. Meine Eltern haben schon ein Dutzend neue Häuser bauen müssen, weil jedes Haus beim nächsten Regen einfach zerfließt. Es gibt auch keine Steine. Außerdem müssen die armen Neger oft Schlangen und Skorpione essen. Es herrscht die reinste Not.«
»Igitt!«, rief Karin.
»Die Steine sind vor langer Zeit zersprungen, weil alle Neger nachts so laut schnarchen wie Monika«, flüsterte Hilde.
Tatsächlich hörte man ein leises Schnaufen und Prusten. Das Lachen der Mädchen hörte nicht auf.
»Wenn wir einmal tanzen dürften zur Musik im Dorf, Reni, mit wem würdest du am liebsten …?«, fragte Karin von oben herunter.
Janka kam Reni mit der Antwort zuvor: »Natürlich mit dem krummen Dietrich aus Abtsroda. Sie sagen, er kann mit der Hand Fische aus dem Teich fangen. Mir wären die zu glitschig.«
»Sie will nur mit dem Führer tanzen, wo sie doch so kluge und gebildete Eltern in Afrika hat«, sagte Hilde und gluckste vor Lachen.
»Du musst dich gerade lustig machen«, entgegnete Reni. »Du träumst doch jede Nacht von ihm. Am liebsten würde sie mittags mit den Mädchen im Hof spielen und die falschen Haarsträhnen und Fingernagelschnipsel des Führers anhimmeln.«
»Hexe!«, zischte Hilde.
»Er würde keine von uns auch nur einmal ansehen«, sagte Janka ernst. »Nicht mal dich, Tausendschön.«
»Oh, vielen Dank, Fräulein Janka«, flüsterte Reni. »Jetzt schlafen wir wirklich.«
»Nein.«
»Doch.«
»Erzähl uns noch ein bisschen!«
»Morgen, beim Kartoffelschälen.«
»Versprichst du es?«
»Dumme Gans!«
»Schwör es uns, Reni! Sonst holt dich der krumme Dietrich aus Abtsroda und schleppt dich in den Wald …«
»O nein! Ich schwöre es!«
Die Gemeinschaft
Seltsam, dachte Waltraut Knesebeck, dass es Gesichter gibt, die jeder beim ersten Anblick ungewöhnlich schön, harmonisch und anziehend findet. Ihr gefiel das Gesicht der Greta Garbo sehr oder das von Errol Flynn, aber das verriet sie niemandem. Vor einem Jahr war sie bei einem Besuch in Kopenhagen in einem Kintopp gewesen und hatte die Garbo als Mata Hari* gesehen, wie sie als Geliebte des russischen Generals Schubin Spionage betreibt.
Reni Anstorm war vor ein paar Wochen erst fünfzehn Jahre alt geworden, aber sie hatte ein Gesicht und eine Anmut, die jeden sofort fesselten. Die großen blauen Augen standen im richtigen Abstand zueinander, die Höhe der Wangenknochen stimmte, Schwung und Farbe ihrer Lippen, die Nase fügte sich in alles, die Zähne waren gerade gewachsen, regelmäßig, weiß, die Stirn, das Kinn … alles harmonierte. Wie bei Mata Hari oder Flynn. Was für ein ungewöhnliches Geschenk!
Reni lebte seit ihrem elften Lebensjahr im Heim. Sie war von der Behörde hergebracht worden, kurz nachdem sie, Waltraut, selbst erst einundzwanzig Jahre alt, die Stelle als Erzieherin angetreten hatte und in Haus Ulmengrund eingezogen war.
So schön wie ihr Gesicht war auch Renis Haar, dessen Glanz und ungewöhnliche Länge Waltraut zu Tränen rühren konnten. Selbstverständlich ließ sie sich nichts anmerken.
Reni trug das Haar geflochten und zu einem großen Nest zusammengesteckt. Das Flechten der Zöpfe fand jede Woche statt, wenn sich Reni das Haar wusch. Alle Mädchen wollten daran flechten und wechselten sich ab. Es dauerte. Reni hielt still und summte Lieder. Wenn sie so draußen auf dem breiten Korbstuhl in der Sonne saß und die Augen geschlossen hatte, empfand Waltraut Lust, an ihrem Haar zu riechen.
Diese Gefühle waren heimlich und geheimnisvoll und tief in ihr verborgen. Reni durfte unter keinen Umständen auch nur das Geringste davon ahnen. Waltraut wurde zuweilen absichtlich ein bisschen streng mit ihr. Aber leicht fiel es ihr nicht. Reni war nicht nur schön, sondern auch gescheit; sie war eine gute Schülerin, hatte ein freundliches Benehmen, war hilfsbereit. Ein Engel eigentlich.
Waltraut verließ ihr Zimmer. Im Speisesaal wurde gefrühstückt.
Es waren einundsechzig Mädchen zwischen sieben und fünfzehn Jahren. Spätestens mit sechzehn verließen sie das Pensionat, arbeiteten in der Stadt als Dienstmagd, gingen auf eine Haushaltsschule oder nahmen an Feld- und Ernteeinsätzen teil.
Die Mädchen flüsterten, klirrten mit den schweren, altweißen Tassen und Tellern und dem Besteck. Einige der Mädel waren Waisen. Auch Reni kannte ihre Eltern nicht. Aufgewachsen war sie bei einer Tante, bis zu deren Tod. Weitere Angehörige gab es nicht.
Alle wussten, dass Reni gerne Rollen spielte, dass sie viel Fantasie hatte. Vielleicht zu viel Fantasie, das tut ja auch nicht gut. Waltraut ließ Reni nie aus den Augen. Sie war ihr Kind, wie eine Tochter.
Waltraut betrat den Speisesaal. Die Mädchen grüßten sie. Sie war beliebt. Die Kinder mochten sie, weil sie von allen Erzieherinnen die freundlichste, geduldigste, die »modernste« war. Sie hatte einmal zufällig mitgehört, wie einige der Mädel das Wort über sie geflüstert hatten.
»Guten Morgen. Und was gedenken die jungen Damen am heutigen Sonntag zu unternehmen?«, fragte sie quer über den Tisch, an dem Reni mit ihren Freundinnen saß.
Friederike zog die Augenbrauen hoch und strich sich vornehm mit Zeige- und Mittelfinger über die Wange. »Wir geruhen zu lesen, Mademoiselle Knesebeck. Leider ist die Vorleserin außer Haus. Ach, nun ja, da muss man eben selbst einmal einen Blick in die Seiten tun, nicht wahr?«
Alle lachten.
»Und was werden Sie lesen?«
»Oh, wir neigen zu Adalbert Stifter.«
»Bunte Steine?«
»Ich denke, ja«, sagte Friederike und prustete heraus. Sie bedeckte ihr Gesicht mit beiden Händen und schüttelte den Kopf. »Nein, wie schrecklich! Stifter! Wie kann man nur so etwas lesen? Es ist langweilig und es passiert nie etwas Interessantes.«
»Sei nicht ungerecht«, wandte Waltraut ein.
Karin meldete sich. »Sie liest heimlich Stefan Zweig.«
»Stimmt das, Friedel?«
»Nachdem Karin mich verraten hat, kann ich es nicht mehr leugnen«, sagte Friederike. »Ist es unverzeihlich, Fräulein Knesebeck?«
Waltraut lächelte. »Ich bin nicht sicher, ob Frau Misera davon begeistert wäre, wenn sie es erfahren würde.«
Reni blickte vom anderen Tischende herüber. »Brennendes Geheimnis.«
»Oh!«, machte Waltraut.
»Und Monsieur Stendhal, De l’Amour«, fügte Reni mit ihrer warmen, weichen Stimme hinzu.
»Sieh an, so gebildet sind wir also«, stellte Waltraut fest und schob erstaunt die Unterlippe vor. »Woher habt ihr solche Bücher?«
»Wir haben sie gar nicht«, antwortete Reni und lächelte gespielt traurig. »Wir hätten sie aber gerne. Wir haben sie in der Schulbücherei gesehen, aber sie stehen wie Giftflaschen in einem verschlossenen Glasschrank.«
»Aha.«
»Wir möchten wissen, warum man sie vor uns verschließt«, sagte Karin. »Es ist doch interessant, dass sie verschlossen werden, oder?«
Waltraut pflichtete ihr bei. Sie wusste nur nicht, wie sie erklären sollte, was zu erklären sich anbot.
»Das Buch vom Doktor Schweitzer gehört am Ende auch dazu«, sagte Reni. »Glauben Sie, es ist gefährlich, diese Bücher zu lesen?«
»Du denkst an Werther und die vielen jungen unglücklichen Leser, die ihm nacheiferten.« Waltraut liebte den Werther, aber auch Stefan Zweigs Erzählungen, in denen sich Menschen zu Gefühlen bekannten, die man für gefährlich halten konnte, die es womöglich waren, die aber dennoch als ehrliche, reine Empfindungen ihrem Herzen entsprangen.
»Wenn man die Kindheit hinter sich lässt, ist vieles gefährlich«, sagte sie und ärgerte sich über ihre Feigheit. Anstatt stolz zu sein, dass die Mädchen sich ihr anvertrauten, wich sie aus und schielte nach der Flurtür, ob nicht die Pensionatsleiterin hereinkam und womöglich schon von draußen gehört hatte, worüber sie redeten.
Was nicht ungefährlich wäre.
Erst vor ein paar Wochen war eine Micky Maus Zeitung aufgetaucht, die keine Besitzerin zu haben schien. Frau Misera hatte nicht gezögert, in ihrer Eigenschaft als Leiterin eine Art Kriegsgericht einzuberufen, um herauszufinden, wer »diesen Schund eingeschleust« hatte. Das betreffende Mädchen kroch erst zu Kreuze, nachdem die Leiterin damit gedroht hatte, allen Kindern die diesjährige Adventfahrt nach Fulda zu versagen, wenn sich die Übeltäterin nicht binnen dreier Tage zu erkennen gebe. Es wurden sechs lange Wochen Stubenarrest über sie verhängt, und die Gemeinschaft hatte einen schneidigen Vortrag anzuhören, warum diese Art amerikanischer Unkultur junge Menschen verrohe und ihr sittliches ebenso wie ihr ästhetisches Empfinden auf das Niveau von Negergesellschaften herabsinken lasse.
Als Waltraut Knesebeck sich um die Stelle beworben hatte, war ihr klar, dass sie es nicht mit einem katholischen Provinzwaisenhaus zu tun hatte, ganz zu schweigen von einem der entsetzlichen Fürsorgeheime für »Unerziehbare« oder »erbkrankverdächtige Zöglinge«. Haus Ulmengrund war mit seinen sechzig Mädeln eine weltvergessene, fast klösterliche Oase, eine von sehr wenigen, die einzige vielleicht im ganzen Land.
Das Haus hatte sich in Jahrzehnten einen unter Pädagogen guten Ruf geschaffen und ihn sogar über die Not der Weimarer Jahre hinweg erhalten können. Finanziert von rheinischen Industriellen, die im Hintergrund blieben, war das Haus seit Anfang des Jahrhunderts ein Sammelpunkt fortschrittlicher Erzieher und Reformer geworden, die der Auffassung waren, dass die Verwahrlosung verwaister Kinder nicht ausschließlich erblich bedingt sei. Damit war Haus Ulmengrund freilich immer ein exklusives Experiment geblieben. Durchaus zum Glück.
Die Zukunft erschien Waltraut indes ungewiss. Man hörte dies, man hörte das, und wenn sie ehrlich war, machte sie sich seit ein paar Monaten Sorgen, ob die sich wandelnde Zeit nicht auch in Ulmengrund ihre Spuren hinterließ.
»Unsere Welt verändert sich«, sagte sie vorsichtig. »Die Älteren von euch werden das selbst beobachten.«
»Es gibt weniger Not, Fräulein Knesebeck«, sagte Hilde.
»Und wieder Arbeit für alle«, fügte Friederike hinzu. »Das haben wir dem Führer zu verdanken.« Sie hatte ein kleines, spitzes Gesicht, eine piepsende Stimme und erinnerte Waltraut an ein putziges Tier mit Samtpfötchen und winzigen Ohren.
»Jeder hofft, dass sich die Dinge zum Besseren wenden«, sagte Waltraut. »Überhaupt glaube ich fest, dass die meisten Menschen guten Willens sind. Jeder will das Glück finden, und es gibt viele Denker, die diese Meinung teilen würden …« Sie schaute zur Flurtür. »Nur würden manche Philosophen einwenden, dass die Menschen nicht immer gute Absichten hegen, sobald sie in Gruppen handeln.«
»Dabei ist die Gemeinschaft doch das Wichtigste«, stellte Karin fest.
Waltraut hätte ihr gerne recht gegeben. »Der einzelne Mensch ist vielleicht nicht immer derselbe, der er zu sein scheint.«
»Das verstehe ich nicht, Fräulein Knesebeck«, sagte Friederike. »Und was hat das mit den eingeschlossenen Büchern zu tun?«
Die Mädchen sahen sie an.
Sie lächelte unsicher. »Wenn es so einfach zu erklären wäre …«
Die hinteren Mädchen beugten sich neugierig vor, um Waltraut zuzuhören.
Waltraut bereute es für einen Augenblick, sich in das Thema vorgewagt zu haben. Wieder schaute sie zum Flur, weiterhin zornig über ihre Angst, die Leiterin könnte hereinkommen. Es gab, wie Waltraut fand, einen dünnen Riss zwischen dem Ruf des Hauses und seiner jetzigen Führung. Aber der Spalt war so schwer auszumachen, dass es Vorkommnisse wie den Ärger wegen der Micky Maus Zeitung hatte geben müssen, um ihn sichtbar werden zu lassen.
Sie sagte: »Jeder Mensch verändert sich und der Geist einer Gemeinschaft muss dem Rechnung tragen … Du zum Beispiel, Reni. Wer bist du?«
»Ich bin ich, Fräulein Knesebeck.«
Waltraut war gerührt von dieser Antwort. Sie merkte plötzlich, dass sie nicht mehr sicher war, was sie erklären wollte. »Entschuldige bitte, Reni. Ich wollte nur sagen, dass wir uns alle andauernd verändern. Aber es tut nicht immer gut, die eigene Veränderung wahrzunehmen.« Sie zögerte, weil sie jetzt merkte, dass die Mädchen nicht verstanden, was sie meinte. Eigentlich hatte Reni nur wissen wollen, ob es gefährlich sei, gewisse Bücher zu lesen. Und dann hatte sie, Waltraut, sich in die These verrannt, dass das Handeln der Gemeinschaft oder eines Volkes keineswegs immer das Patentrezept war, mit dem eine Nation in eine bessere Zukunft marschiert – während ganz Deutschland momentan nichts anderes zu tun erklärte! Auch Frau Misera übrigens, als Leiterin von Haus Ulmengrund.
Waltraut sah wieder flüchtig zum Flur. Mitten in ihre zunehmende Beklemmung hinein sagte Reni plötzlich: »Sie meinen bestimmt, dass jeder das ist, was er sein möchte oder was er glaubt zu sein.«
Hilde kicherte, wurde aber gleich wieder ernst.
Waltraut starrte Reni an und musste sich zwingen, den Blick zu senken. Sie war oft gefangen von der Schönheit dieses Mädchens und fragte sich zuweilen, ob die Gefühle falsch und übertrieben waren.
Endlich sagte sie: »Ich hätte es nicht treffender sagen können, Reni. Vielleicht erfindet sich ja auch jeder ein bisschen selbst, wenn …«
»Wenn was?«
Waltraut fuhr herum.
»Wenn was, Fräulein Knesebeck? … Ich höre.« Frau Misera war nicht durch den Flur in den Speisesaal gekommen, sondern von der anderen Seite, aus der Küche. Sie lächelte auf ihre sonderbare Art. Ihre Stimme klang stets weinerlich; als Leiterin und Mensch war sie jedoch robust.
Waltraut fühlte sich wie gelähmt. Und Frau Misera hörte nicht zu lächeln auf. Sie wartete auf eine Antwort. Waltraut wäre am liebsten hinausgelaufen.
»Glauben Sie nicht, dass Sie die Kinder überfordern?«, fragte Frau Misera. »Ich möchte Sie sehr bitten, gewagte Betrachtungen wie diese in Zukunft zu vermeiden. Oder seien Sie konsequent.«
Waltraut verstand nicht, was sie meinte, und sah sie fragend an.
»Wenn man sich selbst erfindet«, fuhr die Misera fort, und der beißende Unterton war nicht zu überhören, »so etwas meinen Sie doch, nicht wahr? Wenn man sich selbst erfindet, muss man auch konsequent sein. Jeder hat bei solcher Freiheit auch die Pflicht, die sozialen Folgen dieses Eigensinns zu beachten.« Sie machte eine Pause, während der sie in die Gesichter der Mädchen blickte. »Die Gemeinschaft kann dabei verloren gehen, bitte bedenkt das! Wenn ich nur auf mich selbst schaue, verliere ich die Bindung zu den anderen.« Sie sah Waltraut an, wartete aber keine Reaktion ab, sondern fügte hinzu: »Nach dem Frühstück, meine Damen, gibt es Dienste in der Küche, vergesst das bitte nicht.« Ohne ein weiteres Wort verließ sie den Speisesaal.
»Entschuldigt, Kinder. Ich …« Waltraut flüchtete, ging der Misera nach. Ihre Augen brannten, und sie fühlte sich, als würde ihre Stimme gleich versagen.
Flausen im Kopf
Der Schlömerhof lag eine halbe Fußstunde westlich der Wasserkuppe. Er gehörte zu den Ländereien von Gut Haardt. Der Besitz und seine Nutzflächen erstreckten sich von Maiersbach über Schwarzerden bis vor die Ausläufer des Rhöngipfels, dessen baumloser Saum vom winzigen Scheunengiebelfenster aus in der Ferne zu sehen war.
Die Wasserkuppe war ein hoher, glatter Wiesenhelm, über dem sich der Himmel erhob, im Winter weißlich, im Sommer oft stahlblau. Dann konnte Jockel auch die Segelflieger sehen, vor allem wenn der Wind von Osten wehte. Es sah friedlich aus.
Das Giebelfenster in der Scheune gehörte Jockel ganz allein. Er hatte sich vor Zeiten aus alten Brettern ein Gerüst gebaut, das breit genug war, um bequem darauf zu sitzen. Seine Knie berührten die raue Giebelwand, die Hände konnte er auf den von Spinnweben verzierten Rahmen legen. Der Wind sang und surrte durch die Ritzen, aber das störte überhaupt nicht, denn es war das gedämpfte Dröhnen der Motoren und die Erde lag tief unter ihm und das Fensterglas gehörte zur Kanzel seiner Fokker 36.
Er fragte sich, was passieren würde, wenn er »desertierte«, wenn er einfach weglief zu den Segelfliegern. Was würde der Vater tun? Würde er ihn suchen lassen und fast zu Tode prügeln? Denkbar war es.
Wann er die Segelflieger das erste Mal gesehen hatte, wusste Jockel nicht. Sie waren schon immer dort gewesen und gehörten in den Himmel wie die Bussarde und Weihen, die über den Feldern ohne einen Flügelschlag ihre lautlosen Kreise drehten und klagend zu ihm herunterriefen. Klagend, obwohl ihr schwebender Flug das Schönste war, das er sich vorstellen konnte.
Als er noch nicht zur Schule ging und am Nachmittag in den Ställen und auf den Feldern bis in den Abend hatte mitarbeiten müssen, war er tausendmal alleine nach Schwarzerden und weiter gelaufen, hatte den Hang erklommen, sich ins Gras gesetzt und zugesehen, wie die älteren Jungen der Flugschule ihre Schulgleiter aus dem Tal die Wiese hinauf bis zum Gipfel schoben. Oben stieg einer von ihnen in den offenen Sitz, legte sich die Gurte um und wurde von den anderen an zwei langen dehnbaren Seilen über die Wiese nach unten gezogen.
Das Flugzeug rutschte übers Gras, wurde schneller und schneller und schließlich schwebte es. Es segelte, es flog! Das Seil fiel aus dem Haken, die »Gummihunde« ließen sich im Rennen fallen und blickten dem Flieger hinterher, der nun den Berg hinuntersegelte, ein paar flache Kurven flog und in der Tiefe, recht klein geworden, landete. Eine Flügelspitze kippte auf die Seite, und der Pilot kletterte heraus und winkte, bestimmt froh und stolz, dass alles heil geblieben war.
Jockel war nun fünfzehn Jahre und damit alt genug, um mitzumachen. Aber er hatte keine Zeit. Die Schule und die Arbeit und der Vater sowieso! Dabei kannte er nur diese eine Sehnsucht. Von jeher schien ihm, dass er keine Arme, sondern Flügel hatte, und das Fliegen, Schweben, die stillen Vogelkreise waren wie ein Geist darin versteckt. Manchmal, wenn er, todmüde von der Feldarbeit, den Weg nach Hause lief, stieß er den hohen Raubvogelruf hervor und hatte Grund zu klagen, weil er wusste, dass ihn der strenge Vater niemals zu den Segelfliegern lassen würde.
Jockel verstand die Eltern, die seinen Bruder Helmuth und ihn zwangen, bei der vielen Arbeit mitzuhelfen. Einerseits. Es ging nicht anders und war erforderlich, damit sie wohnen und essen konnten.
Helmuth, der Ältere von ihnen, träumte davon, zur See zu fahren. Aber auch er durfte beim Essen nie darüber sprechen. Die Mutter hatte es verboten, weil sonst der Vater wütend wurde. »Wenn wir mal irgendwann Fleisch auf dem Teller haben, dann gibt’s dazu auch Flausen«, pflegte er zu sagen.
Fleisch gab es fast nie. An Ostern ein Karnickel, Weihnachten ein Stück Geflügel. Der Bauer Schlömer war geizig und die Eltern waren nun mal seine Knechte; der Gutsherr, er war ein Graf, war vornehm und wechselte kein Wort mit dem Gesinde, wenn er im Monat einmal kam und nach dem Rechten sah. Er, Jockel, war sogar einmal von ihm getreten worden, weil er im Weg gestanden hatte.
Die Arbeit war sehr hart. Die Familie stand wie alle Knechte und Mägde um fünf Uhr auf. Jockel half bis halb sieben in den Ställen mit, dann ging er nach Gersfeld in die Schule, kam mittags zurück, aß etwas, ging in die Felder oder schlug Holz klein, half den Knechten an der Bandsäge, brachte neue Zaunpfähle auf die Weiden, trieb das Milchvieh hinaus oder herein, mähte Gras, sammelte Fallobst an den Wegen und Chausseen oder ging der Bäuerin im Hausgarten zur Hand. Mit zwölf Jahren hatte er gelernt, Körbe zu flechten, und wusste längst, welche Handgriffe der Hufschmied von ihm verlangte, wenn er auf den Hof kam, um die Pferde zu beschlagen. Im Sommer wurde das Heu in die Scheunen gebracht, und Jockel musste darauf achten, dass am Ostgiebel ein schmaler Gang frei blieb und sich der Bauer nicht über sein Sitzbrett am Fenster ärgerte. Die Bäuerin machte alle zwei Wochen Butter und Jockel kurbelte dann das Fass.
Er war längst kein Kind mehr, nicht mal mehr ein Junge mit seinen fünfzehn Jahren, was die Statur betraf. Als Arbeitskraft war er den Erwachsenen fast ebenbürtig und damit unverzichtbar. Er war ganz und gar gefangen wie sein Bruder, gebunden an die Eltern und den Schlömerhof, an die bäuerliche Tätigkeit. Es gab für ihn keinen anderen Beruf.
Im Frühjahr war er das letzte Mal aus der Schule gekommen und hatte ein gutes Zeugnis mitgebracht. Die Eltern hatten sich gefreut. Aber nicht über die Noten, sondern weil er nun den ganzen Tag mitarbeiten konnte, nicht nur am Nachmittag und in den Ferien.
Der Vater des Vaters war Knecht gewesen und dessen Vater ebenfalls. Die Familie der Mutter dagegen stammte aus der Schweiz, aus einem entlegenen Tal. Dort floss anderes Blut. Die Mutter hatte Jockel von einem Onkel erzählt, der eigentlich Bergbauer gewesen war und außerdem ein Wirrkopf und Erfinder.
In den Bergen lagen die Wiesen in höchsten Höhen und waren in Frühjahr und Herbst der Nässe wegen kaum erreichbar. Der Onkel habe getüftelt, geschreinert, geschmiedet, gebaut, so lange, bis ihm eine überaus nützliche Erfindung gelungen war, mit der er nach Zürich gereist sei, um sie beim Patentamt zu melden.
Das sei 1914 gewesen, bei Ausbruch des Weltkriegs, und als die Patentbeamten die Erfindung sahen, hätten sie eine druckfrische Zeitung auf den Tisch gelegt. Darauf sah man englische Panzerfahrzeuge mit Kettenrädern, die jeden Morast bezwangen.
Der Onkel habe verstanden und sei auf seinen Berghof zurückgekehrt. Seine Erfindung war also ein »Kettenfahrzeug« gewesen, wenn auch nur eine primitive Karre, die, von Ochsen gezogen, viel leichter zu den höchsten Wiesen kam und nicht mehr stecken blieb. Jetzt fuhr man in den Krieg damit und tötete.
Jockel fragte sich, was aus der Erfahrung des Schweizer Onkels zu lernen war. Gab es ein Schicksal, das Lebenspläne zielgenau durchkreuzte? Oder gab es umgekehrt ein Glück im Leben, das aber genauso mutig herausgefordert werden musste? Der Onkel hatte einfach Pech gehabt. Wäre er ein paar Jahre früher mit seiner Erfindung nach Zürich gefahren, wäre er reich geworden, weil eine Fabrik ihm die Idee abgekauft hätte. Reich, aber vielleicht auch unglücklich, überlegte Jockel. Am Ende wäre das Patent nach England verkauft worden, um daraus Panzer zu bauen, mit denen man Menschen totschießt.
Was also würde geschehen, wenn er, Jockel, sein Schicksal herausforderte und ohne das Einverständnis des Vaters zur Wasserkuppe lief, um sich zum Piloten ausbilden zu lassen?
Er spielte mit dem Gedanken, die Mutter zu fragen. Aber er hatte nicht den Mut, und wenn er ehrlich war, fehlte ihm das Vertrauen, ob die Mutter ihn nicht an den Vater verraten würde und er eine neue Tracht Prügel bekam angesichts solcher Ideen und Pläne. Der Vater hatte eine lose und harte Hand.
»Unsereins hat keine Pläne und Ideen zu haben«, hatte er erklärt, als er vor langer Zeit die Erzählung der Mutter hörte. »Geschah deinem Schweizer Onkel ganz recht, dass ihn die Herren auf dem Patentamt ausgelacht haben.«
»Sie haben ihn nicht ausgelacht«, hatte die Mutter entgegnet.
Der Vater hatte sie finster angeschaut. »Ich hätte ihn ausgelacht. Er ist ein Bauer und kein Ingenieur.«
Jockel schlug Zaunpfähle ein, spannte Draht, reparierte das Scheunendach, fütterte Schweine und Ziegen, half in den Feldern bei der Kartoffelernte. Mittendrin hob er plötzlich den Kopf, machte gekonnt den Greifvogelruf nach und blickte nach Osten, wo in der Ferne der Kamm des hohen, kahlen Berges lag: die Wasserkuppe.
Wunderbare Menschen
Mein Papa ist Arzt, meine Mama Krankenschwester. Sie arbeiten in Afrika im Urwaldspital von Doktor Schweitzer. Leider haben sie keine Zeit für mich, weshalb ich hier mit euch zusammenleben muss. Aber so ist es nun mal.« Reni blickte in die Dunkelheit des Schlafsaals. Einige der Mädchen lauschten, die meisten schliefen.
»Vor ein paar Tagen«, flüsterte sie, »wurde ein kleiner Junge aus Samkita ins Spital gebracht. Er hatte schreckliches Bauchweh und Fieber. Sein Vater hat ihn auf dem Rücken zum Fluss getragen und mit einem winzigen Boot den Ogowe hinab bis nach Lambarene gebracht. Papa hat den Jungen sofort untersucht. Dazu gehört natürlich auch immer, dass er etwas Blut abnimmt und es unter dem Mikroskop betrachtet.«
Im Schlafsaal war es jetzt so still, dass die Mädchen glaubten, die Zikaden und Grillen von Lambarene zirpen zu hören.
»Vater ging zu dem Schrank, in welchem das Mikroskop stand, machte die Tür auf und kriegte einen furchtbaren Schreck. Das Instrument war nicht mehr da.«
»Sag bloß, jemand hat es geklaut«, zischelte Friederike.
»Der Schrank war leer. Papa machte sich sofort auf die Suche. Der kleine Junge hatte Schmerzen und sein Vater war schon ganz verzweifelt. Aber das Mikroskop war nirgendwo zu finden. Da hatte Mama einen Einfall. Sie ließ den großen Gong schlagen, und das bedeutet, dass sich alle im Spitaldorf versammeln müssen, alle Ärzte, Krankenschwestern, Helfer, Arbeiter, sogar die Kinder.«
»Kinder?«, fragte Hilde von oben herunter.
»In Afrika müssen alle Kinder mitarbeiten, das ist ganz normal«, flüsterte Friederike. »Reni, erzähl weiter!«
Aber Reni war einen Moment abgelenkt und dachte an ihre Tante Magda, bei der sie groß geworden war und für die sie ebenfalls bereits als Kind hatte arbeiten müssen. Die Tante hatte eine kleine Schneiderei geführt, drei Näherinnen hatte sie beschäftigt, und Reni hatte schon mithelfen müssen, als sie erst sechs oder sieben Jahre alt gewesen war. Viel weiter reichte ihre Erinnerung nicht zurück …
»Als alle im Urwalddorf versammelt waren und in einer langen Reihe nebeneinander standen, wusste meine Mutter gleich, was passiert war. Sie ging schnurstracks auf Taschenmesser zu und stellte ihn zur Rede.«
»Auf Taschenmesser?«, fragte Monika ungläubig.
»Die Neger haben andere Namen als wir, du Dummerchen«, flüsterte Hilde. »Sie heißen Grießbrei, Kochlöffel oder Schnürsenkel, wusstest du das nicht?«
Reni fuhr fort: »Mama ging auf Taschenmesser zu und fragte ihn: ›Wo hast du das Mikroskop versteckt?‹ Aber Taschenmesser tat, als hätte er sie gar nicht verstanden. Dabei konnte man mit ihm reden fast wie mit einem Menschen …«
»Wieso?«, fragte Karin aus dem Bett über ihr.
»Weil er ein Schimpanse ist«, antwortete Reni und lachte leise. »Er klaut alles, was nicht niet- und nagelfest ist.«
»Und warum heißt er Taschenmesser?«, murmelte Monika im Halbschlaf.
Hilde lachte sie aus. »Na, weil er wahrscheinlich als Erstes ein Taschenmesser geklaut hat.«
»Genau«, bestätigte Reni. »Nämlich das vom Doktor Schweitzer, als er das Urwaldspital vor dem Krieg gegründet hat.« Dann erzählte sie weiter. »Mama jagte Taschenmesser einfach aus der Reihe, in die er sich zusammen mit den anderen gestellt hatte, und folgte ihm. Prompt führte er sie zu einem kleinen Schuppen, wo Medikamente und Verbandszeug gelagert waren. Das Mikroskop thronte wie ein Wetterhahn oben auf dem Kistenturm.« Reni horchte, ob im Flur alles still blieb. »Papa untersuchte schnell das Blut des kranken Jungen und bereitete eine Medizin zu. Am nächsten Tag ging es ihm schon viel besser. Wenn mich meine Eltern an Weihnachten besuchen, werden sie Taschenmesser mitbringen, dann stelle ich ihn euch vor. Er gibt jedem die Hand und kann seinen Namen schreiben.«
»Nein!«, rief Janka leise.
»Doch!«, erwiderte Hilde. »Ich will auch, dass er seinen Namen schreiben kann, und die Eltern sollen wirklich herkommen und ihn mitbringen. Ja, bitte!«
Reni schwieg.
Es gab Augenblicke, in denen ihr die Erzählungen ganz nah und vollkommen wahr erschienen. Dabei wusste sie natürlich, dass alles erfunden war. Es gab keine Eltern, es hatte nur Tante Magda gegeben. Und eines Morgens hatte die Tante reglos in ihrem Bett gelegen. Reni war genau einen Tag vor ihrem elften Geburtstag hier in Haus Ulmengrund eingetroffen, und niemand hatte am Folgetag an ihren Geburtstag denken können, weil sich Herr Kiank, der Hausmeister, frühmorgens ein Bein gebrochen hatte und die hellste Aufregung herrschte, bis er endlich ins Krankenhaus gebracht worden war.
»Reni, erzähl weiter!«
»Ja, gleich …«
Sie hatte anfangs nicht viel geredet in Ulmengrund.
Als Tante Magda gestorben war, hatte sie es nicht gleich verstanden und fest geglaubt, dass sie wieder aufwachen würde. Bis Mittag hatte sie die Zimmer und den Balkon sauber gemacht, dann war sie zu den Nachbarn gelaufen und hatte geklingelt. Aber dort war keiner. Also war sie zurückgegangen und hatte gewartet. Sie hatte Zwiebeln und Kartoffeln geschält und die Wäsche zusammengelegt. Tante Magda rührte sich noch immer nicht, und da hatte Reni verstanden, dass sie gestorben war. Sie hatte Angst bekommen.
Als es draußen dämmrig wurde, ging sie wieder zu den Nachbarn, aber sie waren immer noch nicht da. Reni drehte den Schlafzimmerschlüssel um, setzte sich in die Küche und sah auf die Straße hinaus. Dort liefen Passanten vorbei, sie trugen Regenschirme. Ein Auto knatterte vorüber, dann polterte ein Pferdefuhrwerk, die Eisenräder schlugen auf das Pflaster. Eine Frau schob einen Kinderwagen. Die Angst fühlte sich jetzt an wie ein verschluckter Katzenkopfstein. Im Dunkeln traute sich Reni nicht mehr vor die Haustür. Sie war die ganze Nacht am Küchenfenster sitzen geblieben und hatte von Zeit zu Zeit zur Schlafzimmertür geguckt und gehorcht, ob irgendwas zu hören war.
»Wir schlafen jetzt lieber«, sagte sie leise.
Die Mädchen protestierten.
Was für ein Unikum!, war Tante Magdas Lieblingsausruf gewesen. Sie sagte ihn, wenn sich eine besonders fette Fliege auf den frisch gebackenen Pflaumenkuchen setzte oder wenn der Mann von der Post ein dickes Paket an die Tür brachte, auf dessen Ankunft die Tante gewartet hatte. Aber sie hatte es auch gesagt, als sie und Reni zum ersten Mal die Stimme des Führers im Rundfunk gehört hatten. Da war Reni ihr ein bisschen böse gewesen. Heimlich. Voller Trotz und genauso heimlich hatte Reni von da an jede noch so kleine Fotografie des Führers aus der Zeitung ausgeschnitten und ganz hinten im Keller ein gutes Versteck dafür gefunden.
Eine hübsche Sammlung von Führer-Zeitungsbildern war entstanden, die sie natürlich ins Pensionat mitgenommen und zwischen ihren Hemdchen und Leibchen verborgen hatte. Die Bilder sollte niemand sehen. Manchmal, bis vor einiger Zeit jedenfalls, hatte sie Kopfschmerzen vorgetäuscht, sich zurückgezogen und die Schachtel aus dem Versteck geholt. Dann hatte sie den Führer, diesen stolzen, großen Mann mit seinem vogelscharfen Blick, betrachtet und geträumt.
Ihn und Doktor Schweitzer bewunderte sie von allen Menschen am meisten und wusste, dass die Welt gut und friedlich wäre, wenn es nur reine, schöne Seelen wie die ihren gäbe. Sie glaubte nicht, dass die meisten Menschen guten Willens waren, so wie Fräulein Knesebeck es tat. Einmal hatte sie Herrn Kiank, den Hausmeister, beobachtet, wie er eine Katze quälte, und eine Erzieherin (sie war mittlerweile nicht mehr im Hause) hatte einmal eines der Mädchen gezwungen, morgens im Schlafsaal vor allen anderen einzugestehen, dass sie »ein abscheuliches Ferkel« sei. Den Grund für die Bestrafung hatte Reni nicht erfahren.
Oder der Herr Graf, der Besitzer von Gut Haardt, dem auch die Gebäude von Haus Ulmengrund gehörten … Man erzählte sich, er habe den krummen Dietrich aus Abtsroda, als der ein Kind gewesen war, mit einer Reitgerte so geschlagen, dass er kaum mehr laufen konnte. Es gab so viele böse Menschen; war es da nicht dringend nötig, sich Vorbilder zu wählen, die den armen Negern in den Urwäldern Afrikas halfen oder das ganze deutsche Volk endlich aus Hunger, Not und Elend führten?
Die Arbeiten, die Reni in der Schneiderei von Tante Magda hatte verrichten müssen, waren nicht schwer gewesen. Kleider zusammenlegen, Knöpfe annähen, Stoffrollen sortieren, ausfegen. Später bereitete sie das Wasserbad für die Henkelmänner der Näherinnen vor, und seit sie acht Jahre alt geworden war, hatte sie frühmorgens vor der Schule in der kleinen Werkstatt den Ofen angemacht. Mit neun lehrte die Tante sie das Zuschneiden und Reni war darin sehr geschickt. Die Scheren waren zwar viel zu groß für ihre Hände, und sie hatte anfänglich Blasen, aber das Schneidern gefiel ihr besser als die Schulaufgaben. Sie trauerte der Schneiderei genauso nach wie der Tante selbst, die ihre Mutter hätte sein oder wenigstens so tun können, wenn sie nicht immer wieder darauf bestanden hätte, dass sie es nicht war und Reni sich dahingehend bitte keine Illusionen machen dürfe.
Was für eine Tante war sie denn aber gewesen? Die Schwester des Vaters? Oder der Mutter? Oder nur eine Freundin oder gar Bekannte, die irgendwann den kindlichen Ehrentitel erhalten hatte? Tante Magda hatte das Geheimnis mit ins Grab genommen, und es stellte sich heraus, dass diese Ungewissheit als eine tiefe Verletzung in Renis Seele zurückgeblieben war. Nichts über ihre Herkunft zu wissen, tat ihr weh.
»Bist du noch wach, Fräulein Anstorm?«, fragte Friederike leise.
»Ja.«
»Ich kann nicht einschlafen. Mir geht die ganze Welt durch den Schädel … Hast du das auch gemerkt, das Gewitter zwischen der Knesebeck und der Misera?«
»Sie hat mir leidgetan«, flüsterte Reni.
»Wenn die Knesebeck geht, haue ich ab.«
»Wohin?«
»Egal.«
»Darüber musst du dir jetzt Gedanken machen, nicht wenn es zu spät ist«, sagte Reni. »Wenn ich abhauen würde, wüsste ich genau, wo ich unterkommen könnte.«
»Und?«, fragte Friederike.
»Ich will ja nicht abhauen.«
»Feigling.«
»Selber Feigling.« Sie kicherten kaum hörbar. Die anderen waren eingeschlafen.
Tante Magda hatte Reni für ihre Arbeit in Form von Liebe und Büchern entschädigt, die sie aus der winzigen Leihbücherei einer Nachbarin mitnahm, wenn sie vom Kleiderholen und -bringen nach Hause kam.
Reni mochte die langen, dunklen Reihen der speckigen, schief gelesenen Romane mit Titeln wie Ruhe ist die erste Bürgerpflicht oder Aus Wald und Heide. Am Abend, wenn auf dem Herd das Wasser summte, saßen die Tante und sie still beieinander, lasen die Romane, manchmal sogar Rolf Torring’s Abenteuer oder andere Schmöker, blickten in vergangene Intrigen, Verschwörungen und Schlachten. »Tante«, hatte sie einmal gesagt. »Wir kommen aus der Ewigkeit.« Die Tante nickte und erwiderte: »Und gehen in die Ewigkeit.«
In Reni gab es vage Erinnerungen an eine andere Wohnung als die der Tante. Ihre frühesten Eindrücke umrissen nur wenige Dinge: eine rötliche, mit Stroh gefüllte Stoffpuppe, die sie, wie die Tante behauptet hatte, irgendwann vollständig aufgegessen hätte; es seien nur noch ein paar Strohkrümel übrig geblieben. (Wo aber hatte sich die Spielzeugtragödie zugetragen, bei den Eltern noch oder bereits in der Obhut der Tante?) Das Zweite war ein Geldschein, mit dem sie noch heute ein unumstößliches Gesetz verband: Geld nimmt man nicht in den Mund! Weil es Bazillen gibt, das sind unsichtbare, aber sehr gefährliche Tiere, die einen Menschen töten können.
Im Gegensatz zu der verspeisten Puppe gab es den Geldschein noch. Er lag zuunterst in der versteckten Schachtel mit den Zeitungsfotografien, und manchmal las Reni sich die magischen Worte noch einmal laut vor. Fünfzig Milliarden Mark zahlt die Reichsbankkasse gegen die Banknote dem Einlieferer. Lange war ihr der Satz wie eine Zauberformel erschienen.
Sie blickte in die Dunkelheit des Schlafsaals.
Tante Magda buk sonntags Berliner, bestrich sie liebevoll mit glänzendem Zuckerguss und rief: Die funkeln wie Judeneier im Mondschein!
Die Bedeutung dieser Worte war Reni genauso rätselhaft gewesen wie die Zauberformel auf dem Geldschein, bis sie vor gar nicht langer Zeit unfreiwillig die vertrauliche Unterhaltung zweier Mädel mitgehört hatte. Es ging um Jungen, um Männer, vor denen Angst zu haben es berechtigte Gründe gebe. Da hatte sie an diesen Jockel denken müssen, den sie gar nicht kannte. Sie wusste nur, dass er auf dem Schlömerhof lebte. Er war nicht älter als sie selbst und sah doch fast erwachsen aus. Sie waren sich bei der Feldarbeit begegnet. Er hatte dagestanden und sie angesehen und gelächelt. Dass er Jockel hieß, hatte sie von den anderen erfahren, und er war ihr nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Aber das verriet sie nicht.
Reni fühlte, dass sie nun doch müde war, die Augen wurden schwer.
»Was willst du einmal werden, Reni?«, flüsterte Friederike.
»Ärztin.«
»Wie deine Eltern?«, fragte Friedel.
Meine ausgedachten Eltern, dachte Reni. Und sie antwortete: »Ich weiß nichts über meine Eltern. Du hast deine wenigstens gekannt, bis sie gestorben sind.«
»Sieben Jahre lang. Davon musst du aber drei abziehen, als ich zu klein war. Wirst du nach Afrika fahren, wenn du Ärztin bist, zum Oganga? Ich glaube auch, dass der Doktor Schweitzer ein guter Mensch ist.«
»Der Doktor Schweitzer«, sagte Reni, »der heilige Franz von Assisi, Friedrich der Große, das sind wunderbare Menschen, Friedel, glaub mir, und unser Führer gehört auch dazu. Er hat ja ein Geheimnis, er isst kein Fleisch und keinen Fisch, weil er nicht will, dass wegen ihm ein Tier getötet wird. Das musst du dir mal vorstellen. Da kommt er mir fast vor wie Jesus.«
»Er ist der einzige Grund«, flüsterte Friederike, »warum ich nicht sofort weglaufe von hier. Weil wir alle zusammenhalten müssen, damit es besser wird. Ich liebe ihn einfach …«
»Ich renne weg, wenn ein Prinz kommt und sich in mich verliebt«, sagte Reni. »Albern, oder?«
»Dein Prinz heißt Jockel.«
»Der ist nur ein Knecht.«
»Aber ein hübscher Knecht.«
»Wenn schon.«
»Denkst du nie an ihn?«
»Doch.«
»Wie ich dich beneide. Er wird dich bestimmt wieder ansprechen. Er denkt an dich, ganz sicher.«
»Aber er ist ein Knecht«, wandte Reni ein. »Oh, ich bin dünkelhaft, nicht wahr? Ich bin eingebildet und undankbar, sag es ruhig. Ich verachte mich ja selbst. Aber ich muss doch Angst haben vor ihm, wenn wir uns treffen würden. Wer weiß, was er mir sagen wird. Nein, er soll gar nichts sagen.«
»Doch.«
»Ich ekele mich aber. So ein Mann …«
Sie glucksten.
Nach einer kurzen Weile hauchte Friederike: »Jockel ist kein Mann, er ist ein Junge.«
Aber da war Reni eingeschlafen.
Weltfriedensfest
Damit wir uns nicht missverstehen, Fräulein Knesebeck«, sagte Frau Misera und bot Waltraut einen der Besuchersessel an. »Ich habe Sie zu diesem Gespräch in mein Arbeitszimmer gebeten, nicht weil ich Sie maßregeln möchte. Als Leiterin dieses Hauses trage ich nicht nur die Verantwortung dafür, dass unsere Kinder Kleidung und gesundes Essen erhalten. Ulmengrund hat, wie Sie wissen, eine pädagogische Tradition, für deren Fortführung ich unseren Geldgebern gegenüber ebenfalls verantwortlich bin. Eine Erziehung zur Selbstständigkeit ist ein großes Ziel, das in unsere Zeit passt und auf die Zukunft gerichtet ist.«
Sie brach unerwartet ab, nachdem sie sich selbst gesetzt hatte und ihr ausladendes Kleid ordnen musste. Es hatte Plusterärmel und wirkte zu mädchenhaft für ihr Alter. Sie ist bestimmt so alt wie meine Mutter, dachte Waltraut, während sie merkte, dass ihr die Hitze ins Gesicht stieg. Frau Misera hatte eine Art zu sprechen und zu blicken, die Waltraut jedes Mal das Gefühl gab, in einem Netz gefangen zu sein. Sie musste die Hände übereinander legen, damit man nicht die Unruhe sah.
»Dieses Gespräch heute Morgen im Speisesaal«, fuhr die Leiterin fort. »Wie bereits gesagt, würde ich mich freuen, wenn Sie sehr behutsam wären mit den Mädchen. Die Seelen dieser Kinder sind noch sehr weich und formbar. Ich weiß, dass ein Mädel wie Reni intellektuell ziemlich reif ist. Aber was ist mit den anderen, Monika Otten, Janka Nieß, das sind wirklich noch Kinder, Fräulein Knesebeck. Oder Hilde Fechner.«
Sie sah Waltraut eindringlich an. Das Gesicht der Leiterin war kantig, fast männlich, und die weinerliche, hohe Stimmlage passte nicht dazu.
»Sie wissen genauso gut wie ich, dass jedes dieser Mädel heimlich daran denkt, aus dem Heim zu verschwinden, um die Welt kennenzulernen. Wir sind kein Gefängnis. Das einzige Mittel, sie hierzubehalten, ist unser erzieherisches Geschick.«
Waltraut fand nicht die geringste Lücke, selbst etwas anzumerken.
»Wir sind unter uns, Waltraut«, sagte die Misera etwas leiser. »Denken Sie etwa, mir gefällt es, wie sich die Welt seit ein paar Jahren verändert? Ich telefoniere wöchentlich mit dem Rheinland. Auch die Direktoren sind verstört und unsicher geworden. Natürlich sagen sie mir: Lassen Sie sich ja nicht einschüchtern, wir stehen hinter Ihnen, Ulmengrund muss Ulmengrund bleiben und so weiter. Aber kann man diesen Herren in die Seele blicken? Wir sind eine private Einrichtung, noch, denn Sie wissen ebenso wie ich, dass die staatlichen Gesetze auch für uns Gültigkeit haben. Es gibt Sachzwänge und man hat natürlich längst ein Auge auf uns geworfen.«
Waltraut nickte.
Ihr Verhältnis zur Leiterin war bislang unauffällig gewesen. Die Misera hatte Anweisungen gegeben, wenig Kritik geübt, hatte eine zurückhaltende Freundlichkeit an den Tag gelegt und nicht die geringste Privatheit durchscheinen lassen. Man arbeitete miteinander, lebte jedoch nebeneinander her. Waltraut redete öfter und länger mit den Kindern als mit ihren beiden Kolleginnen oder gar mit Frau Misera.
Der Tagesablauf war festgelegt. Aufstehen um sechs Uhr, Morgengebet und Frühstück, während der Schulzeit Abmarsch mit dem Bus nach Fulda, nachmittags Hausaufgaben, Pflichten im Haus, freiwillige Landwirtschaftseinsätze in der näheren Umgebung, Abendessen um achtzehn Uhr dreißig, danach manchmal Musizieren oder Vorlesen, abschließend Zubettgehen und um einundzwanzig Uhr Nachtruhe.
»Ich glaube«, sagte Waltraut, »Reni ist ein außergewöhnlich begabtes Kind. Sie will Medizin studieren und hat umrissene Vorstellungen von diesem Beruf. Sie erfindet für die Mädel charmante Geschichten, in denen der Negerarzt Schweitzer eine Rolle spielt.«
»Wer?«
»Doktor Albert Schweitzer. Er hat vor dem Krieg im afrikanischen Urwald ein Krankenhaus gebaut.«
Die Misera schüttelte erstaunt den Kopf.
»Wenn ich mir vorstelle, Reni wäre nach dem Tod ihrer Tante in eines der üblichen Fürsorgeheime gekommen«, fügte Waltraut hinzu.
»Diese Dame war nicht einfach ihre Tante«, sagte die Leiterin. »Das sind nun hochvertrauliche Mitteilungen, Fräulein Knesebeck, und mehr darf ich Ihnen dazu nicht sagen. Das Mädel hat Zukunft, glauben Sie mir, und zwar weil es eine Herkunft hat.« Sie machte eine Pause, bevor sie fortfuhr. »Ich werde Ihnen jetzt etwas sagen, das Sie bitte ebenfalls für sich behalten, so lange, bis ich es für richtig erachte, unsere Gemeinschaft davon in Kenntnis zu setzen.« Sie holte Luft und atmete aus, es klang wie ein Seufzer. »Das ist der eigentliche Grund unserer Unterredung. Ich vertraue Ihnen, Waltraut.«
Waltraut fühlte sich weiter unwohl. Es gelang ihr nicht, zu entscheiden, ob sie auf die angebotene Nähe eingehen durfte oder nicht.
»Sie wissen«, fuhr die Misera fort, »dass am ersten August, also sehr bald, in Berlin die elften Olympischen Sommerspiele eröffnet werden. Der Führer und Reichskanzler verbindet damit einen überaus wichtigen Auftritt vor der Weltöffentlichkeit. Es kommen Sportler aus neunundvierzig Ländern. Die Regierung verspricht sich von dieser Veranstaltung natürlich viel, wie Sie sich denken können. Es wird sozusagen ein Weltfriedensfest, und wir haben in diesem Zusammenhang die Möglichkeit, das Ansehen unseres Hauses in den Augen der Berliner Regierung auf ein stabiles Fundament zu stellen, verstehen Sie? Unsere industriellen Geldgeber im Rheinland und Ferdinand Graf Haardt haben mit höchsten Kreisen in Berlin vereinbart, dass eines unserer Mädchen dem Führer im Rahmen der Eröffnungsansprache einen hübschen Blumenstrauß überreichen wird.«
Waltraut wusste sofort, welchen Namen die Misera gleich nennen würde.
»Es trifft doch zu, dass Reni von den anderen Mädchen manchmal Tausendschön genannt wird, oder nicht?«, fragte die Leiterin. Ohne ein Ja oder Kopfnicken von Waltraut abzuwarten, fügte sie hinzu: »Sehen Sie mal, solche Details haben zuweilen das Ruder der gesamten Weltgeschichte herumgeworfen.« Sie lächelte milde und eigentlich ehrlich. »Reni ist nun mal außergewöhnlich schön. Jeder, der sie sieht, ist tief beeindruckt. Zuweilen macht mir das auch Sorgen, wenn ich an die Zukunft dieses Kindes denke. Umso größer ist unsere Verantwortung, nicht wahr? Vielleicht ist diese Schönheit auch ein Zeichen.«
Waltraut merkte, dass ihr Misstrauen schwächer wurde, obwohl sie die letzte Bemerkung nicht verstand. Die Misera erwartete gewiss, dass sie etwas entgegnete, also sagte sie: »Das wird Unruhe in unseren Ferienalltag tragen, glaube ich.«
»Aus genau diesem Grund werden wir die frohe Botschaft so lange zurückhalten, wie es geht. Allerdings habe ich mir ein paar Punkte überlegt, die wir doch vorbereiten sollten. Wir müssen Reni die Befangenheit und Angst ein wenig nehmen, damit nichts schiefgeht, Sie verstehen. Ein paar Tage vor der Begegnung werden ausreichen. Bis dahin vermeiden wir Gefühle wie Neid und Missgunst, denken Sie nicht auch?«
Waltraut bejahte.
»Ich weiß, dass wir uns einig sind, Fräulein Knesebeck: Wir sind beide freudig erschreckt und denken, das ist großartig für das Kind, diese Erfahrung zu machen. Und zugleich schleichen sich Zweifel heran … ob so ein Erlebnis für eine Fünfzehnjährige …« Sie stockte. »Nein, ich sollte das nicht sagen. Aber vielleicht verstehen Sie mich …«
»Natürlich«, sagte Waltraut. Welche Zweifel waren denn gemeint? Dass es Reni überfordern könnte, weil sie noch ein Kind war? Oder waren es politische Bedenken? Waltraut würde lieber nicht auf die Frage antworten wollen, ob sie selbst eine solche Begegnung gewinnend erleben würde oder nicht.
»Ich meine, wenn wir selber dort …«, sagte die Leiterin prompt. »Was würde unsereins empfinden?«
Unsereins. Als würden sie einmal pro Woche gemeinsam Tee trinken und über Gott und die Welt plaudern.
»Oh, das weiß ich wirklich nicht«, antwortete Waltraut. Für einen Moment dachte sie an eine Falle, die ihr gestellt wurde. Aber das war sicher Unsinn!
»Bestimmt erschrecke ich Sie mit diesen Dingen, es tut mir leid«, sagte die Misera und bot Waltraut Kaffee an. Er sei fertig gebrüht.
Waltraut dankte etwas steif, beinah ermüdet. Sie fühlte sich auf sonderbare Weise besiegt. Die Leiterin stand lächelnd auf, um das Tablett zu holen.
Neuyork
Der Vater stach die Gabel in eine der gekochten Kartoffeln auf seinem Teller, drehte sie in der dünnen braunen Soße und führte sie zum Mund. Biss ab und kaute. Er stierte Jockel an.
»Da, dein Bruder!«, sagte er mit vollen Backen. »Der spinnt genauso mit seiner Seefahrt, obwohl er älter ist als du und eigentlich vernünftig sein müsste. Schlag dir das mit dem Fliegen aus dem Kopf!«
Jockel schaute zu Helmuth über den Tisch. Der blickte nicht hoch, sondern stocherte in seinem Teller, ohne zu essen.
»Soll er doch abhauen«, schimpfte der Vater weiter. »Aber dann soll er sich nie wieder hier blicken lassen, sonst steck ich ihm nämlich höchstpersönlich die Mistgabel in seinen Wanst.« Er sah seine beiden Söhne an. »Ich schwöre es beim Grab meiner Eltern.«
»Hermann!«, flüsterte die Mutter.
»Sei du still!« Er aß weiter.
Jockel schielte zur Mutter. Sie hatte Angst vor dem Alten. Helmuth, der schon neunzehn war, bewegte keinen Muskel im Gesicht. Er war längst größer als der Vater und bestimmt viel stärker. Aber er hatte trotzdem Schiss vor ihm.
Sie schwiegen.
Draußen kläfften die Hunde wie wild. Das Geräusch klang durch das halb geöffnete Küchenfenster und erstickte unter der niedrigen, verrauchten Dielendecke. Zwischendurch klackte das Besteck auf den Steinguttellern. Jockel sah auf die von der Sonne gebräunten, ledernen Hände des Vaters, die ihn so oft geschlagen hatten.
»Der Mann, der die Segelflieger ausbildet, heißt Doktor Georgii und ist von der Universität«, sagte Jockel, obwohl er wusste, dass es Ärger geben würde.
Der Vater sah ihn an. Eigentlich nicht böse, aber mürrisch.
»Man kann von dort sogar zum Militär«, fuhr Jockel fort. »Zu den Fliegern. Da werden bald viele gebraucht.«
»Zum Totschießen, was sonst?«, brummte der Vater. »Wenn du wüsstest, was du sagst. Dieser sogenannte Friedenskanzler ist auch nur ein Schwätzer wie alle anderen. Wahrscheinlich hält er die Hand auf und die hohen Herren legen ihr Almosen hinein, damit er den Welterlöser spielen kann. Alles Verbrecher.«
»Hermann!«, sagte die Mutter wieder.
»An der Schwarzerdener Hecke werden heute Nachmittag die Kohlrabi und Mohrrüben gejätet. Der Bauer hat die Mädel aus dem Heim angefordert, vielleicht sind sie schon dort. Nach dem Essen geht ihr beide rüber und helft mit. Ich muss mit Schlömer zum Grafen.«
»Mit dem Bauern zum Herrn Grafen?«, fragte die Mutter erschrocken. »Ist was?«
Der Vater aß die letzten zerkleinerten Kartoffeln auf seinem Teller und schmiss die Gabel hin.
Jockels Stimmung war umgeschwenkt. Er sah sofort das Mädchen vor Augen, das er vor anderthalb Wochen auf dem Feld gesehen hatte. Bestimmt hatte sie sich erschreckt, weil er nur dagestanden hatte und gestarrt. So ganz dämlich. Sie glaubte sicher, er sei nicht ganz bei Trost. Sie hatte einen braunen Kittel für die Feldarbeit getragen, aber auf dem Kopf ein breites blondes Haarnest unterm Tuch. Alles an ihr hatte ihm sofort gefallen. Sehr sogar. Besonders ihre Augen, das Gesicht. Freilich hatte er was zu ihr sagen wollen, aber vor Schreck war ihm nichts eingefallen. Er hatte auch ein bisschen Angst gehabt. Seltsam, dass er sie noch nie gesehen hatte bei den vielen Feldeinsätzen während der Ferien. Er hatte nur so dagestanden und geglotzt. Dann war er schnell wieder zu seiner Furche zurückgerannt, um weiterzuarbeiten, weil der Vater in der Nähe war.
Diesmal würde der Alte nicht dort sein, überlegte Jockel. Er nahm sich vor herauszufinden, wie sie hieß, und später, auf dem Weg zu den Feldern, würde er sich überlegen, was er Gescheites zu ihr sagen könnte. Bestimmt ging sie in Fulda aufs Gymnasium.
»Hast du mir zugehört? Ich sage das bestimmt nicht noch mal: Schlag dir die Wasserkuppe aus dem Kopf, hast du verstanden!« Der Vater stand auf und verließ die Küche.
Jockel half der Mutter beim Abräumen. Helmuth blieb am Tisch sitzen, als hielte ihn jemand auf seinem Stuhl fest.
»Ich hasse ihn«, sagte er und blickte zur Mutter, die Wasser aus einem Eimer in das Steinbecken schüttete. Sie ging zum Herd, nahm den großen Kessel und ließ heißes dazulaufen, prüfte mit der Linken die Temperatur. Dann trug sie den Kessel zurück.
Plötzlich blieb sie stehen. »Wenn du von hier weggehst, habe ich doch niemanden mehr und bin allein mit ihm.«
»Und ich?«, fragte Jockel.
»Du bist erst fünfzehn«, antwortete sie.
Helmuth sagte: »Dann gehst du eben auch weg, Mutter.«
»Ach, du glaubst, dass das so einfach ist, ja? Eine Frau alleine. Wo soll ich denn hin? Auch nach Hamburg auf einen Dampfer und ab in die große, weite Welt?« Sie weinte. Legte die Teller und das Besteck in das dampfende Wasser. Fingerte mit zittrigen Händen etwas Laugenpulver aus einem Einweckglas und streute es dazu. »Dein Vater hat gar nicht unrecht. Wir sind Landarbeiter und Knechte und gehören hierher. Wir haben zu essen, Kleidung und ein Dach über dem Kopf. Wenn ihr unbedingt die ganze Welt sehen müsst, dann wartet, bis wir tot sind.« Sie schniefte.
Jockel ging zu ihr und legte eine Hand auf ihren Arm. »Es ist aber nicht mehr alles wie früher, Mutter. Du siehst doch auch, dass sich etwas verändert. Da muss eben jeder tüchtig mithelfen und etwas tun. Überall, auf Dampfern auf dem Meer und bei den Fliegern …«
»Wir tun genug.«
»Ja, aber alles entwickelt sich weiter, die Technik …«
»Wir brauchen hier keine Technik und das Meer ist weit weg. Wenn man Kinder hat, die groß geworden sind, ist man froh, dass jemand da ist, wenn man nicht mehr kann. Davor hat Vater Angst und das wisst ihr genau.«
Sie hatte natürlich recht. Hinzu kam, dass ihr das Fliegen schreckliche Angst machte, und es passierte ja auch viel.
Helmuth stand ebenfalls vom Tisch auf und gab seinem Bruder ein Zeichen. Sie gingen in den Hof, holten zwei Unkrautstecher und füllten einen Krug mit abgekochtem, kaltem Wasser. Die Mutter schaute traurig zum offenen Fenster heraus, als sie durch das Tor gingen. Aber sie hatte wenigstens wieder trockene Wangen. Jockel winkte zurück.
Am Himmel standen vereinzelte Quellwolken. Jockel wusste, dass sie für die Segelflieger ein Hinweis waren, sich von warmen Aufwinden in die Höhe tragen zu lassen. Dazwischen fiel die Luft herab und ließ auch das Flugzeug sinken. Wenn man geschickt war, konnte man sich von Wolke zu Wolke hangeln und ein schönes Stück über das Land fliegen.
Sie gingen schweigend.
Es roch nach frisch gemähtem Heu. Über dem Weg standen flatternde Lerchen und sangen, als sei nichts passiert. Unter den Stiefelsohlen knirschte der Sand. Die weite Stille dahinter tat gut. Beide hatten sie noch Vaters Stimme im Ohr, die man nicht leicht hinter sich lassen konnte.
»Warum hauen wir nicht beide ab?«, sagte Helmuth.
Jockel hatte befürchtet, dass er so etwas sagen würde. Er hatte Angst davor und war zugleich stolz, dass Helmuth ihn nicht mehr wie einen kleinen Jungen behandelte.
»Wir laufen nach Fulda«, fuhr der Ältere fort, »und sehen zu, dass wir einen Güterzug erwischen. Hamburg. Geschieht dem Alten recht. Siggi hat mir wieder einen Brief geschrieben. Er sagt, wir können kommen, es gibt im Hafen jede Menge Arbeit. Und Mädchen überall …«
»Und Mutter?«, sagte Jockel.