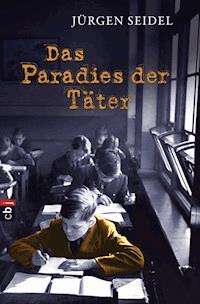2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: cbj
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Mitreißend – bewegend – erschütternd: Eine tragische Liebe in den Wirren des Kriegsendes
Aachen, November 1944: Die Partisanengruppe »Werwolf« soll den von den Aliierten eingesetzen Oberbürgermeister Franz Corneli ermorden. Zu dem SS-Mordkommando gehört auch die 19-jährige Heidrun. Als sie Cornelis Haus auskundschaftet, bekommt sie Gewissensbisse – erst recht, als sie den anziehenden Manfred kennenlernt. Ohne zu ahnen, dass er Cornelis Sohn ist, beschließt sie, sich von den Partisanen loszusagen. Doch die »Werwölfe« spüren Heidrun auf, und sie verrät ihnen Cornelis Adresse – sein Todesurteil. Heidrun wird mit dieser Schuld kaum fertig, Zugleich fühlt sie sich immer stärker zu Manfred hingezogen – bis sie erfährt, wessen Sohn er ist ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 566
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
DER AUTOR
Jürgen Seidel wurde 1948 in Berlin geboren. Nach einer handwerklichen Ausbildung lebte er drei Jahre lang in Australien und Südostasien, bevor er nach Deutschland zurückkehrte, das Abitur nachmachte und ein Studium der Germanistik und Anglistik mit der Promotion abschloss. Jürgen Seidel veröffentlichte Erzählungen, Hörspiele, Rundfunkbeiträge, literaturwissenschaftliche Publikationen – und zahlreiche Jugendromane. Er zählt zu den vielschichtigsten, interessantesten und literarischsten deutschen Jugendbuchautoren.
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Der Pilot drosselt die Motoren. Heidrun ist als Vierte an der Reihe. Wenzel springt zuerst, dann muss der Junge ran. Schalk ist Nummer drei.
Einer der Helfer vom Hildesheimer Fliegerhorst hangelt sich nach vorne und öffnet die Sprungluke. Eiskalter Sturm faucht in den dunklen Flugzeugrumpf, der Lärm ist unerträglich. Wenzel stapft zwei Schritte auf die Luke zu, die eine schwarze Hölle ist. Da unten muss irgendwo die Erde sein, es ist kurz nach Mitternacht.
Der Hildesheimer guckt auf seine Armbanduhr und zählt mit den Fingern die Sekunden. »Ab damit!«, brüllt er. In der Mitte des Rumpfs stürzt die Versorgungsbombe durch den Schacht ins Nichts. Fast gleichzeitig federt Wenzel einmal zurück und ist im nächsten Augenblick verschwunden. Als hätte es ihn nie gegeben, denkt Heidrun. Sie ist nah daran, zu lachen, stattdessen jucken Tränen in den Augen.
Der Junge ist der Nächste. Bevor er springen kann, gibt Schalk ihm einen Tritt und wirft sich hinterher. Dieses Schwein! Heidrun starrt ins Schwarze, atmet nicht mehr. Die Zeit soll stehen bleiben, bitte!, fleht sie. Sie fühlt die beiden Belgier hinter sich, sie darf nicht zögern. Sie muss es tun, jetzt muss sie zeigen, was sie ist und was sie kann. Spring, Heidrun!, befiehlt sie sich. Aber die Beine wollen nicht, sie wollen stehen bleiben, die Hände wollen halten, greifen, fühlen.
Ihr Herz steht still, dann rumpelt und kollert es bis in den Kopf. Ein dummer Klumpen Angst. Dann endlich holt sie Luft – so tief, als wollte sie den ganzen Eissturm aus dem Rumpf in ihre Lungen pressen – und lässt sich in die Leere fallen. Sie schreit und kann den eigenen Schrei nicht hören. Es ist, als blähte sich ihr Körper auf, ins Riesenhafte, größer als die unsichtbare Welt, das Universum. Planetenschwer und flockenleicht ist sie. Das ist der Tod, sagt sie im Kopf und hört, wie die Maschine über oder hinter oder unter ihr davonbraust, leiser wird und nur noch surrt. Dann faucht und knallt der Fallschirm und reißt die Beine, Arme und den Kopf in hundert Stücke.
Die Kälte zerschneidet ihr Gesicht, ihr Hals ist zugeschnürt vor Angst. Sie sieht nichts, pendelt wehrlos durch die Luft. Was ist dort unten? Wald, Wiesen, Häuser? Oder schon der Feind? Vielleicht hört er sie ja schon. Im schwarzen Himmel. Wie sie niedergleitet. Das Knarzen der Leinen, das trockene Schmatzen der Schirmseide, das Trommeln ihres Herzens.
Wenn ich da unten Schüsse höre, bin ich gleich tot. Nein, denkt sie, falsch. Schneller als der Schall sind die Geschosse. Das hast du doch gelernt! Aber wenn sie nur die Beine treffen, das Gesicht, den Mund, die Augen? Die Gurte schneiden durch den Drillich in die Haut. Sie will nicht flennen, nicht ausgerechnet hier und jetzt! Nicht, bevor sie unten ist. Bevor es richtig losgegangen ist, bevor sie und die anderen den Verräter ausgeschaltet haben …
ERSTER TEIL
Unternehmen Karneval
Heidrun
Heidrun schlief seit einer Stunde nicht mehr. Sie hörte Lene drüben regelmäßig atmen. In ein paar Minuten würde der Scharführer auf dem Flur losbrüllen. Noch war es ruhig im Schloss, kein Licht fiel durch die Schlitze der Verdunkelung. Nur das ferne Grollen drang durch die Fenster aus der Kälte in das ungeheizte Zimmer. Anfang März.
Lene pennt mit einem Stoffhasen! Unfassbar.
Den hielt sie unter ihrer Bettdecke versteckt und glaubte, niemand hätte eine Ahnung. Heidrun hatte es zufällig entdeckt, das süße, weiche Häschen. Weil Lene es jeden Morgen vor dem Aufstehen heimlich in ein Tuch einwickelte. Irgendwann lugte ein Zipfel aus ihrem Bett hervor.
Irgendwo im Haus rauschte ein Wasserklosett. Weit und tief dahinter, in der Ferne, böllerte die Westfront. Heidrun dachte an den Bunkerbau in der Eifel, gleich nach der Ausbildung im Wehrmachtshelferinnenkorps. Das war im letzten Sommer. Dort hatte der Krieg Tag und Nacht gepoltert. Der Westwind hatte das trockene Puffen und Grollen der Geschütze über Kilometer herangetragen. Auf den Baustellen schufteten fronterfahrene Männer, keine dummen Schüler, keine erwachsenen Drückeberger wie die Kerle hier im Schloss. Die Männer hatten frische, rötlich leuchtende Narben an den Armen, Schultern, im Gesicht, auf ihren breiten Rücken. Ehrenmale. »Meine Gezeichneten«, hatte Heidrun sie genannt.
Schloss Hülchrath dagegen hatte sie bislang enttäuscht. Heidrun merkte es daran, dass sie zu viel zweifelte. Und sie zweifelte beinah an allem. Leider. Sie zweifelte, ob ihre Gefühle wahrhaftig waren, ob die Ausbilder und Offiziere etwas taugten oder ob sie, Heidrun, im Einsatz Tapferkeit und Nerven zeigen würde. Sie zweifelte an Lene, an den Schülern, aus denen man Soldaten machen wollte, also auch an Erich, an der Ehrlichkeit der Rundfunksender … Sie hatte manchmal sogar Zweifel, ob der Führer noch derselbe Führer war, dem treu zu dienen sie geschworen hatte.
»Lene?«, rief sie leise.
»Lass mich schlafen!«
»Lutter brüllt sowieso gleich los. Noch zehn Minuten, höchstens.«
»Zehn Minuten Ruhe«, brummte Lene.
»Findest du es gut, dass sie uns gegeneinander antreten lassen?« , fragte Heidrun. »Das hier ist doch kein Wettrennen. Sie hetzen uns wie Hunde aufeinander los.«
»Weil sie die Besten suchen.«
»Aber die wollen doch, dass wir bei den Einsätzen verlässlich zusammenarbeiten«, wandte Heidrun ein. »Wettstreits schüren doch bloß Unruhe und Misstrauen.« Sie stand auf, machte Licht und suchte ihre Sachen zusammen. Das Fenster war verhängt. Kriegsverdunkelung.
Lene warf ihre Bettdecke zurück. Heidrun hörte, wie sie wuselte. Bestimmt wickelte sie den Stoffhasen in das Tuch, um ihn verschwinden zu lassen.
»Wie kommst du darauf, dass wir Mädchen auch mit um die Wette kämpfen müssen?«, fragte Lene. »Frauen werden dort eingesetzt, wo sie sich auskennen. Du in Aachen, ich vielleicht in Euskirchen.«
»Wer hat das gesagt?«
»Leutnant Wenzel.«
Heidrun fiel aus allen Wolken. In den vergangenen Wochen war kein Tag vergangen, an dem sie nicht erpicht gewesen war, jedes Gerücht aufzuschnappen. Es verwirrte sie ein bisschen, dass Lene besser informiert war als sie selbst.
»Wenzel hat gesagt, dass ich nach Aachen soll?«
»Er hat nicht deinen Namen genannt«, sagte Lene. »Nur dass wir Mädchen als Ortskundige dabei sein werden, wenn die Aktionen losgehen. Kommt außer dir noch eine aus Aachen? Nein.«
Heidrun setzte sich auf die Bettkante und fühlte sich mit einem Mal so erschöpft, als hätte sie in der Nacht kein Auge zugetan. Ihr Mund war trocken.
Plötzlich hörte sie sich sagen: »Ich weiß, dass du diesen Hasen hast.« Sie deutete auf Lenes Bett. »Ich sag es niemand. Hat er einen Namen?« Bestimmt hatte er einen Namen. Lampe oder Löffelchen.
Lene blickte sie an, als hätte Heidrun ihr eine Ohrfeige gegeben. Sie zog das Stoffbündel aus dem Bett hervor und hielt es Heidrun entgegen.
»Da, bitte sehr!«, keifte sie los. »Geh zu Wenzel oder Klaff und sag ihnen, dass ich eine feige Schrulle bin, die Angst hat, im Einsatz von irgendeinem Ami abgeknallt zu werden. Hier, los, nimm schon!« Sie streckte die Hand mit dem Hasen weiter vor.
Heidrun schüttelte den Kopf. »So meine ich das nicht, Lene.«
»Gib ruhig zu, dass du dich heimlich kranklachst.«
Heidrun fühlte, wie sie rot wurde.
Lene sagte leise: »Ich kann eben nicht die Heldin spielen.«
Heidrun war erleichtert. »Ehrlich gesagt, ich auch nicht. Ich finde die Angeberei der Kerle zum Kotzen.«
Im Flur schrie Rottenführer Lutter alle aus den Betten.
»Der ist auch noch ein halbes Kind«, fügte Lene hinzu. »Das kommt mir hier manchmal vor wie auf einem Schulausflug.«
Sie wusch sich als Erste am Becken und stieß kleine Schreie aus, weil das Wasser eisig war. Heidrun hörte draußen Schritte näher kommen. Sie hob ein Handtuch auf und hielt es vor Lene als Sichtschutz in die Luft. Die Zimmertür flog auf, der Rottenführer brüllte: »Weiber, aufstehen!«
Lene griff nach einem Schuh und zielte auf die Tür. Der Junge flüchtete. Heidrun warf die Tür zu und ging zum Fenster, zog die Verdunkelung einen Spaltbreit weg. Es war stockfinster draußen. Sie hörte, wie das Tauwasser von der Traufe in den Hof klatschte.
»Hast du einen Freund?«, fragte Lene plötzlich.
Heidrun war überrascht. Sie schüttelte den Kopf. Waldemar fiel ihr ein. Aber er war nicht ihr »Freund«. Er war in sie verknallt, aber sie überhaupt nicht in ihn. Und sie war nicht sicher, dass es Liebe war, wovon er redete. Er war zu alt für sie. Und nicht nur das. Als Sekretär irgendeines Bonzen hatte man ihn vom Kriegsdienst freigestellt. Er kam ihr sogar manchmal feige vor und dann konnte sie seine Attraktivität gar nicht mehr spüren.
»Nein«, antwortete sie.
Sie bewegte sich, als hinge sie an Fäden. Sie war überhaupt nicht sicher, ob sie mit Lene über so ein Thema reden wollte. Lene war erst vor zwei Wochen nach Hülchrath gekommen, sie, Heidrun, schon im Januar. Jetzt war der Februar vorbei.
Als sie mit Wenzels Ausbildungsgruppe von einem elend langen Fußmarsch zurückgekehrt waren, hatte Lene in der Toreinfahrt zum Hof auf ihrem Koffer gegessen und mit piepsiger Stimme gefragt, wohin sie sich wenden müsse, um beim Werwolf-West dabei zu sein.
Lene hatte wirklich eine hohe Kinderstimme. Jetzt sagte sie: »Die meisten meiner Freundinnen haben ihre Verlobten im Feld verloren. Ich bin froh, dass ich nicht verlobt bin.«
Heidrun zog die Drillichhose an. Der Stoff roch muffig. Waldemar roch immer ein bisschen nach Schweiß, das störte sie. Allerdings genoss sie es, von ihm verehrt zu werden. Selbst wenn er log. Er war seit acht Jahren verheiratet, hatte zwei Mädel und einen Jungen und eine Frau, deren Stimme Glas zerschneiden konnte. Er und Heidrun hatten sich im Zug kennengelernt und festgestellt, dass sie beide aus Aachen stammten. Mal bedauerte sie, dass er sich nicht fürs Verloben eignete, mal war sie ganz erleichtert. Es war ein blödes Hin und Her.
»Verlobte wollen einem bloß an die Wäsche«, sagte sie. »Hast du schon die richtige Erfahrung?«
»Um Himmels willen«, sagte Lene. »Ich spare mich auf, darauf kannst du wetten.«
Heidrun behielt die Zimmertür im Auge. Draußen wurde es lauter.
Vor etwa einem Jahr hatte Waldemar frechweg erklärt, dass sie sich jetzt lange genug kennen würden und dass es Zeit wäre, einmal eine Nacht zusammen zu verbringen. Oho! Das war schon eine Überraschung gewesen. Natürlich hätte sie sich niemals darauf eingelassen. Ungeachtet dessen war sie dennoch stolz auf seinen Antrag. Auch wenn es ziemlich unanständig war. Waldemar war nicht hässlich, aber er roch nun mal nicht gut. Er hatte blaue, verführerische Augen, ein bisschen wie Hans Albers. Und hätte er nicht eine Familie gehabt, wäre sie womöglich schwach geworden. Sie mit ihren neunzehn Lenzen. Er war über dreißig. Meine Güte!
»Ist in Frankreich gefallen«, sagte Lene unerwartet. »Der, mit dem ich die richtige Erfahrung hatte. Ich hab vorhin gelogen. Wir waren nicht verlobt. Leichtsinnig waren wir. Er war noch leichtsinniger als ich. So sind die Männer, oder? Er hat gewusst, dass er am nächsten Morgen an die Front muss. Er hat mir vorgelogen, dass er bei einer Gebirgsjägerkompanie ist, dabei war er Pionier.« Lene setzte sich auf einen Stuhl. »Das Schlimmste ist, dass er mir gefallen hat.« Sie schaute Heidrun an. Dann sagte sie: »Es war nicht so, wie immer alle sagen. Es hat nicht wehgetan.«
Heidrun wurde neidisch, und der Neid brannte ihr im Herzen, weil sie sich nach der richtigen Erfahrung sehnte, vielleicht sogar mit Waldemar. Wenn es bloß nicht wehtut!
»Wie hieß er?«, fragte Heidrun.
Lene schüttelte den Kopf. »Er ist beim Brückenbau ertrunken. Nicht mal den Heldentod.«
»Na sag mal!«
»Er ist nicht im Kampf gegen den Feind gefallen.«
»Es gibt viele, die nicht an der Front kämpfen und trotzdem Helden sind.« Heidrun war nah daran, vom Bunkerbau zu erzählen, ließ es aber lieber sein. Sie dachte wieder an Waldemar und versuchte sich vorzustellen, wie es mit ihm wäre. Aus Neugier, nicht aus Liebe, und das störte sie. Wie es wäre, ihm so nah zu sein. Einem Mann überhaupt. Schon in der Eifel. Ein nagendes Gefühl, diese Neugier auf einen Mann. Sie sehnte sich nach rauer Haut, starken, schönen Händen. Sie fühlte oft überdeutlich, wie bereit sie war und wie erwachsen. Längst eigentlich.
»Erzähl doch mal!«, sagte sie.
Lenes Nein echote im Zimmer. »Es gehört sich nicht.«
»Aber du hast mich doch gefragt, ob ich einen Freund habe«, wandte Heidrun ein.
»Von dem du mir aber nichts erzählst. Stattdessen lügst du mir vor, du hättest keinen.« Lene zog sich an, baute schweigend ihr Bett.
Heidrun musste ihr Erstaunen darüber, so leicht durchschaut worden zu sein, erst einmal abschütteln. Sie erledigte ihre Sachen für den Morgenappell. Draußen geisterten die Jungenstimmen durchs Haus, Schritte, Rufe, Befehle der Vorgesetzten, ein Pfiff, fernes Geschirrklappern, Hundegebell unten im Hof.
Im Zimmer war es so kalt, dass der Atem wölkte.
»Sie werden uns mit einem Flugzeug hinter die Linie bringen«, sagte Heidrun. »Hast du vor dem Fliegen Angst?«
»Ich weiß nicht«, sagte Lene. Sie zog die Stiefel an und schnürte sie zu.
Heidrun war fast fertig.
»Wir sind richtig ineinander versunken dabei«, sagte Lene plötzlich leise.
Heidrun hörte Stolz heraus. Wie sehr sie Lene beneidete! »War er zärtlich?«
»Mehr als zärtlich.«
»Die ganze Nacht?«
»Keiner von uns hat auch nur eine Minute geschlafen.«
»Habt ihr euch irgendwo versteckt?«, fragte Heidrun.
»Wieso?« Lene war mit einem Schlag verändert, ihre Augen blitzten. »Wenn du so in mich dringst, kriege ich Angst, dass du es doch jemandem verrätst.« Sie ging zur Tür.
»Was hast du denn, Lene?«
»Ich kenne dich nicht gut genug. Es ist saudumm von mir, dass ich dir das erzähle.« Lene drückte die Türklinke. »Wir werden zu spät runterkommen.«
Der Lärm polterte herein, Stiefelschritte auf den Treppen. Heidrun nahm ihre Sachen und folgte Lene in den Flur.
»Du lügst doch bloß!«, rief sie ihr hinterher. »Warum schwindelst du mich an?«
Lene drehte sich kurz um. »Weißt du überhaupt, wie unanständig du bist?«
»Ich?«
Sie wurden von ein paar Jungen überholt, die neugierig zurückschielten.
Heidrun rief: »Ich wette, du hast überhaupt nichts erlebt. Du willst bloß angeben!« Sie holte Lene vor der Treppe ein und zischelte: »Du bist genauso noch Jungfrau wie ich. Gib es doch zu!«
Kurz vor der Treppe blieb Lene stehen. Sie hatte Tränen in den Augen. »Ich bin nicht mehr Jungfrau, ganz sicher nicht.« Sie lief die Treppe hinunter. Heidrun folgte ihr mit einem komischen Gefühl im Bauch.
Manfred
Manfreds Vater, Franz Corneli, spielte den Verteidiger und war auch im richtigen Leben mit Leib und Seele Jurist. Manfred war der Angeklagte, die Mutter sprach für die Anklage, sie war die Sittenpolizei! Gerichtsstand war die Küche.
Manfred sagte nichts, er ließ die Mutter reden. Dasselbe, was sie immer sagte. Dass Grete viel zu alt für ihn wäre, und überhaupt sei sonnenklar, welches Ziel sie verfolge, wenn sie sich als fast zwanzigjährige Haushaltshilfe an den Sohn der Familie heranmache …
»Siebzehn«, korrigierte Manfred lässig.
»Wie bitte?«
»Grete ist siebzehn, genau wie ich.«
»Ach, hör doch auf! Du weißt genau, was ich meine«, rief die Mutter empört. Sie sah den Vater an. Der hob leider nur seine Juristenaugenbrauen.
Manfred schwieg.
Zwischen Grete und ihm war überhaupt nichts. Jedenfalls nicht das, woran die Mutter dachte. Grete war nett zu ihm, und sie gefiel ihm, weil sie hübsch war mit ihren warmen braunen Augen. Er war kein Kind mehr, also wirklich! Aber das hier und jetzt zu wiederholen, verletzte seinen Stolz. Er schob die Unterlippe vor, faltete die Hände vor sich auf dem Tisch und blickte stoisch geradeaus.
»Da siehst du es!«, schimpfte die Mutter. »Er will nicht hören, was ich sage!« Sie hätte den Vater jetzt am liebsten angestoßen – wie einen Esel, der nicht weiterlaufen will.
Der Herr Anwalt holte Luft. »Was soll der Junge denn tun, Elisabeth? Soll er sich Asche auf sein Haupt streuen?«
Die Mutter sah ihn einen Moment entgeistert an. Vermutlich merkte sie, dass sie die Schwächere bleiben würde.
»Jedenfalls wünsche ich nicht, dass die beiden hier alleine im Haus bleiben, wenn wir nicht daheim sind«, erklärte sie und wirkte plötzlich verletzlich.
Manfred verkniff es sich, zu sagen, dass er keine Angst habe, von einer Siebzehnjährigen verführt zu werden.
»Er ist wirklich schon siebzehn, Elisabeth«, stellte der Vater ruhig fest.
»Ach, und da hat er natürlich Erfahrung im Umgang mit solchen Frauen!«
»Mit welchen solchen Frauen?«, fragte Manfred. Das ging zu weit! »Erstens weiß ich, was zwischen Mann und Frau passieren kann. Und zweitens entscheide ich selbst, wann und wie es mir passiert. Und mit wem!«
Die Mutter sah ihn an. Ihm war klar, dass sie es gut meinte. Mütter eben!
»Du bist noch Schüler, Manfred«, sagte sie. Als ob diese Feststellung jetzt das geringste Gewicht hätte. Er war seit fünf Monaten in keiner Schule mehr gewesen. Es herrschte Krieg!
Der Vater lächelte mühsam. »Und er ist auch alt genug, um mit mir in die Stadt zu fahren.«
»Aber das muss doch nicht sein«, sagte die Mutter, plötzlich wieder mit überraschend weicher Stimme. Manfred hätte ihr gerne den Gefallen getan, nicht in die Stadt zu fahren. Sozusagen in den Krieg. Aber es ging nun mal nicht anders.
»Ich muss, Mama«, sagte er leise.
Der Vater unterstützte ihn. »Er läuft ja nicht in der Stadt umher, Elisabeth. Er bleibt in der Kommandantur oder in meiner Nähe.«
Ihre Augen hatten einen traurigen Glanz. Dabei war sie ungeheuer stark. Alle drei, vier Tage machte sie sich alleine auf den Weg nach Belgien, besuchte Bauernhöfe und sammelte Lebensmittel ein, alte Kleider, alles, was man dort entbehren konnte. Karrte es nach Aachen zurück, um es in den Notquartieren zu verteilen. Für die vielen, die nun in die Stadt zurückkehrten, nachdem sie im vergangenen Herbst gezwungen worden waren, Aachen zu verlassen. Die Amerikaner hatten ihr Papiere ausgestellt, mit deren Hilfe sich »die Frau Oberbürgermeister« frei bewegen konnte. Bis nach Eupen, wenn sie jemand mitnahm. Bis Raeren und Eynatten fuhr sie mit dem Fahrrad, für das sie ebenfalls eine besondere Erlaubnis bei sich tragen musste.
»Ich kann dich ja verstehen, Mama.«
Manfred verstand sie wirklich. Er hatte schließlich alles miterlebt: Wie die Amerikaner dem Vater im vergangenen Herbst durch Vermittlung des Bischofs von Aachen die Erlaubnis erteilt hatten, zusammen mit anderen Aachener Bürgern darüber zu beratschlagen, wie man eine neue Stadtverwaltung aufbauen könnte, eine Behörde also, die dafür Sorge trägt, dass eine Stadt mit Strom und Wasser, intakten Straßen und vielem anderen versorgt ist. Aus ihrer Mitte war er zum Oberbürgermeister gewählt worden und hatte ohne Zögern angefangen, buchstäblich aus dem Nichts etwas zu schaffen.
In den ersten Wochen hatten sie nur Trümmer verwaltet. Vor der Instandsetzung der Wasserversorgung, des elektrischen Stroms, des städtischen Verkehrs hatte man die Stadt überhaupt erst wieder freischaufeln müssen. Die deutschen Landser hatten im Oktober des vergangenen Jahres so lange Widerstand geleistet, bis die Bombardierung der zwangsevakuierten Stadt nach immerhin drei Warnungen nicht mehr abzuwenden gewesen war. Kaum eine Straße war passierbar. Der allererste Verkehr nach acht Tagen Schaufelarbeit in den Straßen waren zwei Pferdefuhrwerke gewesen, mit denen Milch und Gemüse in die Stadt gebracht worden waren. Zehn Tage später war der erste Lastwagen durch Aachen gefahren. Die meisten Nebenstraßen lagen immer noch voller Schutt, viele waren weiterhin vermint. Jeder Schritt dort konnte tödlich sein. In den großen Straßen waren schließlich Schienen für die Schuttloren gelegt worden. Manfred hatte mitgeschaufelt, hatte Verschüttete gesehen und Plünderer, die verfolgt worden waren. Und er hatte seinen Vater mehrfach weinen sehen – den starken Papa, den Herrn Rechtsanwalt Corneli, den Herrn Oberbürgermeister!
»Ich möchte, dass ihr mich nicht länger wie ein Kind behandelt«, forderte er selbstbewusst.
»Es wäre einfach schön«, erwiderte die Mutter, »wenn du mir beim Kleider- und Lebensmittelsammeln helfen würdest. Ja, ja, ich bin ungerecht. Um nicht zu lügen, müsste ich sagen, dass es mir lieber wäre, du würdest die Zeit mit mir verbringen, statt Grete anzustarren. Ich gestehe, ich bin eifersüchtig. Das denkt ihr doch beide.« Ihre Gefühle überspülten sie. »Wenn ich endlich ein zweites Fahrrad hätte, könnte der Junge öfter mit zu den belgischen Höfen raus. Ich will nicht mehr alleine hin, ich fühle mich nicht wohl dabei.«
Der Vater nickte, sein Mund war dünn und breit. »Du glaubst immer noch, nur weil ich der Oberbürgermeister bin, geben mir die Amerikaner ein Fahrrad, wenn ich darum bitte.«
»Wieso denn nicht?«
»Weil Krieg ist?«, sagte er stechend. »Weil es nichts gibt und jeder verpflichtet ist, sein Eigentum anzuzeigen, insbesondere Dinge, die für den Verkehr geeignet sind?«
»Ein einziges Fahrrad!«, rief sie störrisch. »Ich will es ja bezahlen. Aber gut …« Jetzt tat sie resigniert. »Jawohl, ich habe kein Vertrauen zu Grete. Sie ist mir zu selbstbewusst. Irgendetwas stimmt nicht mit ihr, das spüre ich genau. Sie ist zu kess. Außerdem habe ich gesehen, wie sie in deinem Arbeitszimmer in den Papieren herumgeblättert hat.«
»Sie ist nur ein bisschen unzufrieden«, sagte Manfred. »Vorigen Sommer hat sie nach der Mittelschule im Fotoladen ihres Onkels gearbeitet und Filme entwickelt. Das hat ihr großen Spaß gemacht. Und jetzt muss sie als Haushaltshilfe arbeiten.«
»Sie muss ja nicht.« Die Mutter warf den Kopf zurück.
Manfred stand vom Küchentisch auf. »Die Verhandlung ist zu Ende, Papa. Entweder wir halten die Spielregeln ein, die sonst auch vor Gericht gelten, oder ich werde genauso verletzend.«
»Manfred!«, sagte die Mutter empört. »Ich glaube nicht, dass dir das zusteht.«
»Nein, Lisa«, sagte der Vater. »Der Junge hat recht. Grete hat sich nichts zuschulden kommen lassen. Deine Anschuldigungen sind völlig aus der Luft gegriffen. Und die Amerikaner werden mir kein Fahrrad geben, auch nicht gegen Geld.«
»Und deine Papiere, in denen sie schnüffelt?«
»Die liegen offen herum, Elisabeth, und die kann jeder lesen, wenn er will. Du siehst Gespenster.«
Manfred sagte: »Mama, ich habe eine Zukunft, und in dieser Zukunft ist es wichtig, dass ich Englisch spreche. Ich will bei den Amerikanern mehr Englisch lernen.«
»Das Wort heißt wir, Manfred. Wir haben eine Zukunft.«
Aber Manfred ließ sich nicht beirren.
Als er das zerstörte Aachen zum ersten Mal gesehen hatte, war er zu dem Entschluss gekommen, nicht wie die Eltern zu werden. Er wollte nicht so sein. Natürlich musste er solche Gedanken für sich behalten.
Die Eltern sollten einiges nicht wissen. Beispielsweise, dass Grete den Gedanken zuerst ausgesprochen hatte. »Ich will nicht sein wie die Erwachsenen.« Das war gar nicht so lange her, da war sie erst ein paar Wochen zuvor ins Haus gekommen. Manfred hatte sie bestaunt, ihre schönen dunklen Augen, wie sie lächelte. Das war ihm unter die Haut gegangen, bis in den Bauch hinein.
In der Winterkälte trug sie lange Wollkleider, mehrere Filzpullover übereinander, einen zerrissenen Polizeimantel, eine Baskenmütze und Handschuhe, die halbe Finger hatten. Ihre Augen standen eine Nuance zu weit auseinander, ihr wunderbarer Mund war manchmal nass. Er hatte sie gefragt! Er hatte sie gefragt, ob sie ganz erwachsen werden wollte. Er wusste gar nicht mehr, wie er auf die Frage gekommen war oder was sie bezwecken sollte. »Nein«, hatte sie geantwortet, »ich möchte nie erwachsen werden. Ich möchte nicht so sein wie unsere Eltern.« Das war ihm richtig in die Haut gefahren.
»Ich muss in den Keller«, sagte die Mutter. »Ihr tut ja sowieso, was ihr wollt. Was soll ich also hier? Grete kann ja kochen …«
Manfred hörte ihre Schritte leiser werden. Der Vater sah ihn an, verzog den Mund und schmunzelte. Dann sagte er: »Wir lieben sie ja trotzdem, oder?«
Echtes Heldentum
Der Schlosssaal füllte sich. Die hohen Fenster waren verhängt. An der Decke verbreiteten dürftige Glühbirnen ein gespenstisches Licht. Die etwa fünfzig Jungen und wenigen Mädchen saßen auf blanken Holzbänken vor langen Tischen und warteten darauf, dass die Essenholer mit Brot, Muckefuck und Gerstenbrei aus der Küche kamen. Es wurde getuschelt, das Blechgeschirr schepperte. Schweißgeruch lag in der Luft.
Heidrun setzte sich auf ihren Platz. Lene saß ihr schräg gegenüber. Sie vermieden es, sich anzusehen.
Dieser Schüler Erich schielte wieder herüber. Er hatte eine spitze Nase und eng stehende, aber freundliche Augen. Ihm war anzusehen, dass er soeben richtig mit dem Wachsen anfing. Aufgeschossen stand er da, ein bisschen krumm und schlaksig, mit zu dünnen Armen, schmalen Schultern und überlangen, bleichen Mädchenhänden. Sein Blick war kindlich, ängstlich spähend. Heidrun grinste böse, um ihn abzuschrecken. Er wurde rot und setzte sich.
Das Essen kam. Der Lärm im Saal versiegte langsam, als ein Wachsoldat von der Flügeltür her »Ruhe!« brüllte. Hinter ihm tauchte Leutnant Wenzel auf und stellte sich zwischen die Tische. Es wurde still.
»Kameraden, es wird ernst!«, rief er. »Nach dem Appell gibt es den ersten Wettkampf. Im Generalstabskartenlesen. Das hat Spaß zu machen. Einige von euch sehen aus, als hätten sie die ganze Nacht gewichst. Wenn ich so einen erwische, grabe ich ihn höchstpersönlich draußen bis zum Hals ein, verstanden? Den Rest könnt ihr euch denken. Wir sind eine Elitetruppe. Ich verlasse mich darauf, dass jeder sein Äußerstes gibt. Punkt sieben Uhr dreißig geht’s los! Und wehe, da kommt wieder einer, dem noch die Unterhose an den Knien hängt vom Scheißen.« Damit marschierte er durch die Mitte zu der Tür, die zu den Büros und Räumen der Offiziere führte.
Die Blechgeschirre wurden wieder hörbar. Es erinnerte Heidrun an den Lärm der Fabrikhalle, in der ihr Vater gearbeitet hatte. Als Kind hatte sie mittags den Henkelmann hintragen müssen, in eine Decke gewickelt, damit die Suppe warm blieb. Eine Scheibe Graubrot lag dabei. Der Vater zog sein Taschenmesser hervor, schnitt die Rinde ab und schenkte Heidrun das weiche Innere. Auf dem Nachhauseweg genoss sie es in winzig kleinen Stücken.
Sie schaute um sich.
Ihre Kindheit und Jugend erschien ihr mit einem Mal weit zurückliegend. Sie dachte daran, dass ihr Vater sich über ihre Entscheidung, die Führerinnenstelle beim BDM anzunehmen, geärgert hatte. Sie hatten sich sogar gestritten. Nachher hatte es ihr leidgetan. Der Vater war ein stiller, sensibler Mensch; es war überhaupt nicht seine Art, zu streiten, und die Verzweiflung, mit der er sie hatte umstimmen wollen, hatte sie erschreckt. Dabei hatte sie nur ihren Stolz und die Freude mit ihm teilen wollen.
»Denk bloß nicht, ich interessiere mich für dich oder so …«
Heidrun fuhr herum.
Sie hatte nicht gemerkt, dass Erich aufgestanden war und sich herangeschlichen hatte.
»Das denkst du doch, oder?«, fragte er. »Aber da hast du dich geschnitten.« Seine Stimme hüpfte zwischen kindlich und fast erwachsen hin und her.
»Du kommst dir schon ziemlich erwachsen vor, was?«, sagte Heidrun und überlegte, ob sie etwas richtig Bissiges nachlegen sollte. »Hast du mit deinen Freunden gewettet, dass du dich traust, mich anzuquatschen?« Sie schaute zu den anderen Schülern hinüber und grinste. Dann sah sie wieder Erich an. »Ist noch was Wichtiges?«
Er schüttelte den Kopf, zog den Mund auseinander und stiefelte an seinen Platz zurück.
Lene gegenüber hielt sich den Mund vor Lachen. Sie schien wieder versöhnt zu sein. Wenn dieser Erich derjenige war, mit dem sie, Heidrun, in Aachen zurechtkommen musste, würde es keine Schwierigkeiten geben. Der ist weich wie Butter, dachte sie erleichtert.
»Bist du mir noch böse?«, fragte sie.
Lene lächelte zur Antwort. »Heute Abend sag ich dir, wie’s wirklich war. Das erste Mal.«
Standartenführer Klaff stand an der Fensterseite des Schlosssaals und quäkte wie ein Volksempfänger. Was Klaff sagte, kannte Heidrun auswendig. Dieselbe Leier jede Woche. Dass der Krieg noch nicht verloren sei und sich jeder Einzelne fragen müsse, ob er tatenlos zuschauen wolle, wie das Reich zugrunde ging und das Volk vom Ausland erbarmungslos versklavt wurde, oder ob er heldenhaft und tapfer kämpfen wolle. Dann folgte die Beschreibung der Maßnahmen, für die man als Werwolf-Partisan hier im Schloss ausgebildet würde: das Eingraben vor der heranrollenden Front; warten, bis der Feind über das Erdloch hinweggedonnert ist, »… und plötzlich springt ihr von hinten aus der Deckung. Der Feind ist vor Schreck gelähmt. Ihr stürmt mit Panzerfäusten und Granaten vor, kaltblütig, vernichtend und unbarmherzig …« Als wäre es ein Kinderspiel, dachte Heidrun jedes Mal und schaute sich die Schüler an, die um sie her im Saal saßen. Keiner von ihnen war älter als sechzehn, schätzte sie. Sie hatten Kulleraugen und horchten mit offenen Mündern.
Obwohl Heidrun dazugehörte, fühlte sie sich mit ihren neunzehn Jahren fehl am Platz. Jedenfalls was diese Schülerschar betraf, die davon träumte, als Werwölfe das Blatt des Krieges zu wenden. Woche für Woche wartete Heidrun darauf, dass der Standartenführer endlich auf das zu sprechen kam, weshalb sie und ein paar andere junge Frauen hergekommen waren. Der Partisaneneinsatz in der Stadt. In diesem Falle Aachen, das sich seit vier Monaten in amerikanischer Hand befand und seither von gewissenlosen deutschen Kollaborateuren regiert wurde. Eine Schande.
Nachdem die Amerikaner im Oktober 1944 die Stadt nach langem, zähem Landserwiderstand erobert hatten, war ein Aachener Rechtsanwalt vom Feind zum »Oberbürgermeister« ernannt worden. Seinen Namen wusste Heidrun nicht. Jedenfalls war bereits im November an allerhöchster Stelle der Beschluss gefasst worden, ein Exempel zu statuieren und den Verräter hinzurichten. Nur gerecht. Aber nun war März und nichts passierte!
Es gab den Plan, eine Partisanengruppe nach Aachen zu senden. Und Heidruns Aufgabe wäre es – falls sie daran teilnahm — , zusammen mit einem der Schüler auszuspähen, wo der Verräter wohnte und wie man sich in der gefallenen Stadt bewegen musste. Eine junge Frau und ein Junge waren unverdächtig. Wann entschieden wurde, wer dabei sein würde, war noch ungewiss, und das machte sie ruhelos und ungeduldig.
Klaff redete und redete.
Schloss Hülchrath war zum Ausbildungsort für den Werwolf-West geworden. Bereits gegen Ende des vergangenen Jahres hatte man hier die ersten Jugendlichen zusammengezogen, und als Heidrun im Januar dazugestoßen war, hatte sie etwa vierzig Schüler angetroffen, die sich für die Retter des Reichs hielten.
Das Schloss war zur Hälfte eine uralte Ruine, in der sich ein paar Remisen befanden. Das neuere Haupthaus mit spitzem Turm bildete den nutzbaren Gebäudeteil und war ein mehrstöckiger Bau, in dessen Räumen und Stuben der Schimmel schneller wuchs als die Eisblumen auf den undichten Fenstern. Der Kitt bröckelte aus allen Fugen, die Flure waren feucht und schmutzig, das Essen schlecht, der Saal roch muffig und die Toiletten stanken »wie ein jüdisches Bordell«, wie einige der Jungen meinten.
Um das Schloss zog sich ein alter Schutzgraben, der sich im Westen zu einem Weiher verbreiterte, in dessen Wasser sich Trauerweiden und Blutbuchen spiegelten, die das Schloss umsäumten. Daneben lag das Dorf. Hülchrath hieß es, wie das Schloss. Es war winzig klein, dabei sei es im Mittelalter eine Stadt gewesen, sagte man.
Die von SS-Standartenführer Klaff befehligte Wachkompanie war ein Haufen Drückeberger. Heidrun war sicher, dass die meisten dieser Männer den Krieg nur vom Horchen kannten, wenn nachts manchmal das Böllern der Front zu hören war: über fünfzehn oder zwanzig Kilometer hin, irgendwo auf der Linie zwischen Erkelenz im Norden und Jülich im Süden. Der Lärm kroch täglich näher. Der Feind wollte an den Rhein, er zielte auf das Ruhrgebiet, das Herz des Reichs, und Heidrun hatte Angst davor, was folgte, wenn der Krieg verloren wäre. In Aachen, ihrer Heimatstadt, war er bereits verloren. Und deshalb hieß es handeln und nicht reden!
Sie würde nicht so streng denken, hätte sie nicht selbst erfahren, was die Front und was echtes Heldentum waren. Zwei Sommermonate des vergangenen Jahres hatte sie in der Eifel beim Bunkerbau geholfen. Dort hatte sie Männer, Kameraden, Helden kennengelernt, die sie nicht wieder vergessen würde. Der Versorgungsverkehr zur Front, die nicht endende Kette der Lazarettwagen hatten ahnen lassen, wie es dort zuging, welche Verwundungen es gab, welche Tapferkeit und welche Ängste. Wenn sie die Witze der hiesigen Schüler und Wachsoldaten hörte, wurde ihr fast übel, und sie fragte sich, wie es weitergehen sollte mit dem Krieg und mit dem Reich, an das sie weiterhin mit ganzem Herzen glaubte.
Klaff hatte eine Faust gemacht und boxte in die Luft.
Die Ausbildung war rau. Um sechs Uhr früh wurde geweckt, gewaschen, Betten gebaut, Gerstenbrei geschluckt. Dazu gab es Muckefuck mit etwas Milch und Melasse. Es folgte der Frühappell im eisigen Hof, in Finsternis natürlich. Über der Eingangstür brannte eine einzige Funzel. Die Ausbilder, hauptsächlich Leutnant Wenzel und SS-Oberscharführer Schalk verkündeten das Übungspensum. Sie machten sich das Leben leicht, ließen tagsüber stundenlang marschieren, Löcher graben oder Gleichschritt üben – so unnütz wie abgezogene Handgranatenstifte.
Wenzel war ein falscher Fuffziger. Mal gab er sich freundlich, hilfsbereit, nachsichtig. Am nächsten Tag schikanierte er und stellte miese Fallen mit der Begründung, das wahre Leben böte Schlimmeres. Er behauptete von sich, drei Fremdsprachen zu beherrschen, ließ sich aber nie dazu herab, es zu beweisen. In seinem Zimmer bastelte er an einem fast einen Meter großen Modell einer »V1« aus Holz und Pappe, angeblich eine getreue Nachbildung einer der Geheimwaffen, mit denen der Führer London in Kürze endgültig in Schutt und Asche legen würde. Heidrun hatte den Eindruck, dass Wenzel seinen Vorgesetzten, Standartenführer Klaff, sozusagen in der Hand hatte. Sie war Zufallszeuge eines kurzen Streits geworden, bei dem Klaff mit rotem Kopf wütend davongestampft war. Wenzel, der doch bloß Leutnant war, hatte offen hinter ihm hergelacht. Eigentlich undenkbar.
Klaff predigte »flammenden Zorn und lodernde Tapferkeit«. Es gelte »das Lindenblatt des Feindes« zu finden, die schwächste Stelle jeden Gegners. Die Ausbildung verlief ziemlich ungeordnet, und oft hatte Heidrun den Eindruck, dass sich die beiden Ausbilder Wenzel und Schalk bloß einen Spaß aus allem machten. Oberscharführer Schalk hatte beispielsweise seine Freude, die Jungen zu provozieren, insbesondere Erich. Schalk übertrug ihm Aufgaben, beispielsweise fünf oder sechs andere Jungen anzuführen, nur um ihm das Kommando schnell wieder zu entziehen, weil diese oder jene Übung nicht mit der erforderlichen Härte durchgefochten worden sei. »Wir brauchen Männer, keine Daumenlutscher«, pflegte er zu maulen.
Dabei war Schalk selber untersetzt und hatte kaum noch Haare auf dem Schädel. Standartenführer Klaff hatte ihm einmal befohlen, im Büro einen verlorenen Uniformknopf zu suchen. Viele hatten zugeguckt. Während der Adjutant, der bloß Scharführer war, verstohlen grinsend am Schreibtisch saß, kroch Oberscharführer Schalk mit rotem Kopf umher und suchte wie ein Hund.
Heidrun wusste, dass sie Männern gefiel, zumindest auffiel. Sie hatte helle blaue Augen, eine gerade Nase, gerade Zähne. Ihre Körperhaltung strahlte Stolz aus. Wenn sie lief, waren ihre Bewegungen schwingend und weich. Sie hielt die Schultern dabei gerade, den Kopf sehr erhoben. Sie fiel auf. Diese Art zu gehen hatte sie bereits in der Schule gezeigt, ohne es zu wissen. Manche Lehrer hatten sich nach ihr umgedreht, wenn sie vorüberging, und es war ihr unangenehm gewesen. Jetzt, hier im Schloss, störten sie Wenzels Blicke und die einiger Wachsoldaten. Schalk bemühte sich immerhin, seine Glotzerei zu verstecken. Aber dieser Bengel Erich beispielsweise gaffte sich die dummen Äuglein blind. Wenn sie ihn ebenfalls ansah, schreckte er zusammen, als hätte sie ihn auf dem Klo bei etwas erwischt. Heidrun horchte auf.
Klaff hatte die Hände in die Taille gestützt und kam sich vermutlich wie der Führer vor. »Aachen, unsere alte, ehrwürdige Kaiserstadt! Hört zu, Kameraden«, tönte er schneidig, »das Unternehmen Karneval steht kurz bevor und es geht um die gerechte Bestrafung eines erbärmlichen Feiglings. Um zu ermitteln, wer daran teilnehmen wird, haben wir ja bereits mit den Leistungswettkämpfen begonnen. Ihr wisst, wir brauchen einen Jungen und ein Mädel. Strengt euch also an, wenn ihr mit Leutnant Wenzel nach Aachen wollt.« Dann folgten ein paar Floskeln und die Rede war vorbei.
Sobald Klaff den Saal verlassen hatte, kam Unruhe auf. Alle redeten durcheinander. Heidrun schlug das Herz bis in den Hals. Sie überflog die Schülermeute. Von denen dachte keiner nach, worum es hier wirklich ging. Sie selbst war beizeiten mit sich ins Gericht gegangen: Sie würde vielleicht bald einem Kommando angehören, das den Befehl hatte, einen Menschen zu erschießen. Sie war nicht so naiv zu übersehen, dass diese Aufgabe mit außerordentlich großer Verantwortung verbunden war. Dass der Aachener Verräter sich in schwerster Weise schuldig gemacht hatte, war klar. Die Frage lautete: Würde die Aktion bewirken, dass andere Volksgenossen in anderen Städten davon abgehalten wurden, denselben Fehler zu machen und sich auf die Seite des Feindes zu schlagen? Wenn ja, dann würde sie sich weniger Gedanken machen. Sie schob die leisen Zweifel immer wieder fort, und noch gelang es ihr, zu glauben, dass es wichtig war, zu handeln. Aber mit diesen Schülern um sie her? Die meisten waren Träumer, die mit einer Waffe in der Hand zu Fabelwesen wurden, zu kleinen Göttern, wie ihr schien – zu allem, bloß nicht Männern!
Heidrun hätte gerne kräftig ausgespuckt, so wie die Jungen, wenn sie draußen waren. Sie hielt nach Lene Ausschau, die hatte sich zu Schalk gestellt. Heidrun gesellte sich zu Wenzels Schar, in der auch Erich stand und wieder nach ihr glotzte. Mit Lene ließe sich das Abenteuer bestehen – viel besser als mit einem dummen Schüler. Die Amis würden Augen machen, wenn sie es mit zwei jungen Frauen zu tun bekämen, die sie austricksten!
Der Neger
Der Jeep fuhr heute eine neue Route, Manfred staunte. Der Anblick war so eigenartig, dass er sich erschreckte. Auf einem weiten Feld lagen Kirchenglocken, so weit der Blick reichte. Es mussten tausend sein. Sie lagen zweifach, dreifach, vierfach übereinandergestapelt, wie zum Trocknen abgestellte Riesenkaffeetassen. Es gab alle Größen, klein wie Wassereimer, groß wie Badewannen. Roter Staub bedeckte sie. Bei einigen waren große Stücke herausgebrochen; man konnte schmerzhaft ahnen, wie sie aus der Höhe auf die Erde gefallen und zersprungen waren.
»Die wollten sie von hier aus ins Ruhrgebiet transportieren«, erklärte der Vater. »Um Granaten draus zu machen oder Panzerketten. Stammen allesamt aus Frankreich, Holland, Belgien.«
Der Vater wurde jeden Morgen um Punkt sieben Uhr dreißig von einem amerikanischen Jeep zu Hause abgeholt und in die Stadt gebracht. Der Fahrer war bewaffnet, redete kein Wort, selbst sein Gruß war nur ein Murmeln oder Zucken mit dem Mund.
Der eisige Fahrtwind pfiff durch die Ritzen des Stoffdachs. Manfred zog die Schläge seines Mantelkragens enger um den Hals, obwohl er einen Schal trug und eigentlich nicht fror. Sooft es möglich war, begleitete Manfred seinen Vater, um in der amerikanischen Kommandantur einfache Büroarbeiten zu machen und dabei Englisch zu lernen. Offiziell erlaubt war das wohl nicht und die Mutter zweifelte an der Richtigkeit dieser Idee. Aber der Vater hatte Argumente: »Englisch ist die Zukunft, Elisabeth.«
Der Jeep hielt an. Der Vater stieg aus, bedankte sich auf Deutsch beim Fahrer. Manfred tat es auf Englisch. Der Fahrer ignorierte es.
Das alte Regierungsgebäude am Theater zeigte überall die Spuren der schweren Kämpfe im vergangenen Herbst. Die Stadt bestand zur Hälfte aus Ruinen. Wohin man schaute, sah man klaffende Fassaden, halbe Wohnzimmer mit im Wind baumelnden Lampen, Küchen ohne Fußboden, zersplitterte Treppenhäuser, Dächer wie Walfischgerippe. Als hätten wütende Riesenkinder ihre Puppenhäuser zerstört.
Im Treppenhaus blieb der Vater stehen. »Manfred, ich habe mit dir zu reden. Ich wollte das schon lange tun, aber mir fehlte ehrlich gesagt der Mut. Es ist eine heikle Sache.«
Manfred erschreckte sich ein bisschen. »Hab ich was falsch gemacht?«
»Nein, überhaupt nicht, Junge. Ich bin sehr stolz auf dich. Andere in deinem Alter träumen vom Heldentum an der Front, das weißt du ja. Ich bin sehr glücklich, dass du anders bist.« Er ging weiter, weil von oben zwei GIs näher kamen. Als sie vorüber waren, sagte er leise: »Meine Ernennung zum Oberbürgermeister hatte natürlich zur Folge, dass man mich in Kreisen der Nazis als Verräter und Saboteur versteht. Das ist dir nicht neu.«
Manfred spürte, was der Vater sagen wollte. »Du hast Angst?«, fragte er.
Der Vater senkte den Blick. Dann sagte er: »Ich denke jeden Tag daran, dass ich vielleicht längst die Zielscheibe irgendeines Kommandos bin. Manchmal misstraue ich sogar den Fahrern, obwohl es Amerikaner sind. Mutter ahnt nichts. Das Gespräch bleibt bitte unter uns.«
Manfred hätte gerne etwas Gescheites geantwortet. Hier stand sein Vater und erklärte, dass er damit rechnete, getötet zu werden. Was sollte man darauf erwidern? Woher nahm der Vater den Mut, weiterzumachen mit dem Wiederaufbau der zerstörten Stadt?
»Die Amerikaner müssen dich beschützen.«
»Das tun sie natürlich. Ich will dir nicht unnötig Angst machen, Manfred. Es gibt ein paar Dinge, die ich der Mutter nicht zumuten möchte, deshalb brauche ich einen Vertrauten, verstehst du?«
Manfred wurde es heiß vor Aufregung und Ahnung. Er atmete tief ein und aus, als könnte ihm die frostige Luft Linderung verschaffen.
»Ich möchte dir gerne helfen«, sagte er.
Sie folgten dem Flur. Der Vater öffnete eine Tür, begrüßte seine Sekretärin und zog den Mantel aus. Manfred hatte bis zur Kommandantur noch einen kurzen Fußweg vor sich und behielt seine Jacke an.
»Mein Sohn und ich möchten zehn Minuten ungestört miteinander reden, Fräulein Kramer.«
Die junge Frau hatte große dunkle Augen. Sie lächelte hauchzart. Der Vater nahm die Post vom Schreibtisch und blätterte.
»Selbstverständlich, gerne, Herr Corneli«, sagte sie mit etwas rauer, angenehmer Stimme.
Der Vater bot Manfred den Vortritt, schloss die Tür seines Arbeitszimmers. Dann zog er ein Kuvert aus seiner Jackentasche. »Ich habe hier ein paar Namen und Anschriften und Anweisungen für den Fall aller Fälle. Wenn du es liest, wirst du wissen, was du zu tun hast. Ich weiß, dass wenigstens du die Nerven behalten wirst, und ich bin froh, dass ich dir vertrauen kann. Du bist in dieser brenzligen Lage eine große Hilfe, Manfred.« Er reichte ihm den Umschlag.
Der Junge schämte sich, weil seine Hand zitterte.
»Ich lege den Umschlag in meinen Schreibtisch zu Hause. Den Schlüssel findest du im Bücherregal, hinter dem Buch von Max Stirner, du weißt schon.«
Manfred war so beschäftigt, seine Unruhe zu verbergen, dass er nicht mal nicken konnte. Selbstverständlich war er einverstanden mit den Plänen des Vaters. Aber wie ging man mit diesen Gefühlen um? Einen Moment wusste er nicht, in welche Tasche er das Kuvert stecken sollte. Er setzte sich auf einen der einfachen Stühle.
»Ich glaube, du musst rüber, Junge«, sagte der Vater. »Der Sergeant wartet sicher schon.« Er blickte auf seine Armbanduhr.
Manfred straffte sich. »Papa, Grete hat uns ein Fahrrad besorgt. Ich treffe sie heute Mittag unten vor dem Theater, dann hat sie es dabei. Leider fehlen ihr die nötigen Papiere, die Genehmigung, es überall mitzuführen, weißt du?« Er lächelte. »Was denkst du, was Mama für Augen machen wird.«
Erst mal machte der Vater große Augen. »Wo will sie denn ein Fahrrad herbekommen haben?«
»Es gehört ihrem Schwager«, antwortete Manfred. »Sie will uns einen Gefallen tun. Besonders Mama. Sie weiß natürlich, dass Mama misstrauisch ist und sie hasst.«
»Sie hasst sie doch nicht!«
»Grete findet es großartig, was Mama macht, dass sie in Belgien Lebensmittel sammelt. Am liebsten würde sie ihr dabei helfen.«
»Wann trefft ihr euch?«
»Halb eins.«
»Du freust dich auf sie«, stellte der Vater fest. Er nickte, als wollte er es sich selbst bestätigen.
Manfred war genauso stolz auf seinen Vater wie dieser auf ihn und am liebsten hätte er es ihm jetzt gesagt. Was machen wir bloß mit der Angst?, hätte er aber auch gerne gefragt. Eine Art »Theaterfrage«, fand er. Eine von der Sorte wie: Was ist der Sinn des Lebens? Wie finde ich das Glück? Warum bin ich auf der Welt? Was ist Liebe und wo finde ich sie? Manfred stand auf.
Der Vater brachte ihn zur Tür und öffnete. Die Sekretärin übergoss Manfred mit einem langen, schönen Blick, der ihm in die Glieder fuhr.
»Fräulein Kramer«, sagte der Vater, »wenn Sie bitte gleich eine Notiz für das Büro des Majors aufsetzen möchten, wegen einer Erlaubnis, ein Fahrrad mitzuführen, so einen Ausweis, Sie wissen schon …«
»Sehr gerne, Herr Corneli.«
Manfred gab dem Vater die Hand. Das war eigentlich unpassend, aber im Büro des Oberbürgermeisters schien es angemessen. Er ging zur Flurtür, die halb offen stand. Draußen trampelten Soldatenstiefel.
Welches Gewicht die vertraulichen Worte des Vaters hatten, merkte Manfred erst, als er das Gebäude der Militärregierung erreicht hatte und das Zimmer der Nachrichtenoffiziere betrat.
Manfred sprach Englisch und gar nicht mal schlecht. Es war jedenfalls eine gute Grundlage für das weitere Lernen. Die Kenntnisse waren das Ergebnis einer merkwürdigen Freundschaft des vergangenen Sommers und hatten sich in Belgien ergeben. Der Mann, in dessen Haus die Cornelis vorübergehend hatten wohnen können, war so etwas wie ein Großbritannien-Narr. Er war pensioniert, trank Guinness und aß ebenso gerne zinkfarbenen Cheddarkäse wie süßlich schmeckende Pastinakenpasteten, die ihm seine Frau, eine Schottin, zubereitete. Er hatte mit Manfred durchgehend Englisch gesprochen, keineswegs perfekt, aber umso unnachgiebiger. Die Nachbarn hatten sich beklagt, es gehöre sich nicht. Der Mann hatte seine Entgegnungen auf Englisch über den Zaun gerufen. Manfred vermisste ihn manchmal – und seinen Cheddarkäse und die Pasteten.
Sergeant Cleveland drehte sich auf seinem Stuhl herum und zeigte seine strahlend weißen Zähne.
Der Sergeant war ein Neger und rabenschwarz. Manfred hatte manchmal immer noch Probleme, es normal zu finden. Aber er glaubte fest an die amerikanische Demokratie und dass alle Menschen gleich waren – dennoch gruselte er sich immer wieder mal ein bisschen, wenn Cleveland ihn am Morgen ansah.
»Hi, Manfred. Good to see you, pal. I just brewed some coffee.«
Allein diese entwaffnende amerikanische Freundlichkeit war etwas, das Manfred zu Beginn geradezu als verstörend empfunden hatte, während er sich andererseits natürlich freute, von Cleveland so offenherzig angenommen zu werden. Er hatte einen schwarzen Freund gefunden, fand er, und Cleveland einen weißen.
»I am very glad to be here, Sergeant Cleveland.«
Der Neger grinste. »You’re still not used to see people like me, right?«
Manfred verzog den Mund und fühlte sich ertappt.
»I can see it in your eyes.« Cleveland stand auf und nahm einen Becher aus einem offenen Schrank. »Don’t worry, man. You know I’m used to it.« Er lachte freundlich. Ob Manfred eigentlich wisse, dass die Schwarzen in den Staaten für ziemlich alles geradestehen müssten. Wie die Juden in Deutschland.
Cleveland gab sich wenig Mühe, langsam zu sprechen. Aber Manfred verstand das Wesentliche.
Egal was irgendwo passierte, ob ein Mädchen vergewaltigt oder einem Weißen das Auto geklaut wurde, garantiert würde man einen »Nigger« verdächtigen und so lange jagen, bis man ihn hatte, und dann halb tot prügeln. Und der würde dann alles gestehen. »No matter what.«
Er füllte Manfreds Becher. »Don’t look so afraid, brother.« Die Schwarzen in den Staaten seien den Ärger gewohnt und wüssten, wie sie sich ihrer schwarzen Haut zu wehren hätten. Immerhin dürften sie im Land bleiben, das unterschiede sie von den Juden in Deutschland.
»You know Heinrik Himmler?«
Manfred nickte so schwach, dass er sicher war, Cleveland hätte es nicht bemerkt.
»German Himmel means heaven, doesn’t it?«
Manfred nickte ein zweites Mal. Der Ordnung halber sagte er: »And sky. One word for both.« Dabei schaute er zum Fenster, wo das Wolkenlicht hereinfiel und sich bleigrau auf die Dinge legte. Jetzt merkte er, wie abgestorben alles schien.
Cleveland goss für sie beide Kaffee in die Becher. »What the hell has this Himmler to do with heaven, Manfred?«
Er reichte Manfred den Kaffee. Er fände es nicht schön, sagte er, wenn Manfred sich Illusionen mache, was die Staaten betreffe. Schließlich wisse er, wie gerne er Deutschland gegen die USA eintauschen würde. »But it’s tough, I tell you.«
»This is tough, too«, antwortete Manfred und deutete zum Fenster hinaus in die graue Ödnis. Er trank vorsichtig, verzog das Gesicht, weil der Kaffee zu heiß war.
»I have good news for you«, ergänzte Cleveland. »Major McMillan is about to legalize your job.« Er, Manfred, werde sich also zukünftig nicht mehr wie ein Geist umherbewegen müssen, weil es ihn juristisch gar nicht geben dürfte. »You’re one of us now«, fügte er hin. »Welcome, my German friend!« Cleveland prostete ihm zu und Manfred freute sich von Herzen.
Grete hatte den schönsten Mund der Welt. Ihr Mund war Manfreds oberstes Problem geworden. Dieser dunkle Mund war es, der ihn nachts kaum schlafen ließ und am Tag bewirkte, dass er seine Mutter nickend ansah, während sie redete, und er kein Wort verstand. Er würde vor Scham tot niederfallen, wenn die Eltern wüssten, was ihr »Söhnchen« fühlte.
Die Verzauberung bestand darin, dass Manfred, sobald ihm Grete daheim begegnete, eine stechende Sehnsucht empfand, nicht wieder von ihrer Seite zu weichen. Wenn sie schwitzend mit Eimer und Feudel im Treppenaufgang hantierte, drückte er sich im Hausflur herum, schnüffelte wie ein Rüde, stellte die Schuhe der gesamten Familie wie Soldaten auf oder glättete die Mäntel in der Garderobe.
Der Mutter war dieser überraschende Ordnungssinn ihres Sohns nicht entgangen. Jeder wusste, wie die »Krankheit« hieß, und Manfred vermied es in ihrer Gegenwart, sich in Gretes Nähe aufzuhalten. Was ihm schwerfiel. Weil sie einen Duft verströmte, der das Haus ausfüllte. Dieser Duft und ihre Lippen übten eine Gewalt über ihn aus, die er körperlich empfand.
Als er jetzt aus der Kommandantur trat, die Straße überquerte und auf die Theaterruine zuging, sah er Grete schon kommen. Statt das Fahrrad zu betrachten, das sie schob, blickte er auf ihren Mund und dessen süße Dunkelheit. Unpassend in dieser Zeit, wo alles grau und staubig war. Es gehört sich nicht, so einen Mund zu haben, wenn die Welt in Trümmern liegt – so oder ähnlich dachte sicher auch die Mutter. Bestimmt jeder, der Grete traf und ansah.
Das Fahrrad war gut in Schuss. Manfred lächelte sein Jungenlächeln und Grete lächelte zurück. Das machte alles schlimmer. Jetzt sah er gerne ihre etwas schiefen, aber weißen Zähne.
»Und das Ding fährt gut?«, fragte er.
»Wenn ich die Befugnis hätte, damit zu fahren, würde ich es dir zeigen.« Auch ihre Stimme liebte er. »Es ist tadellos. Meine Schwester hat beide Reifen aufgepumpt.«
»Die Frau Oberbürgermeister wird sich freuen«, entgegnete er frech. »Leider bedeutet es auch, dass ich mit ihr nach Belgien in die Dörfer muss. Aber wenigstens liegt sie meinem Vater nicht länger in den Ohren.«
Manfred hätte Grete auch gern gesagt, wie sehr er sie mochte. Aber er traute sich nicht. Sie kam ihm so erwachsen vor, dabei war sie nicht älter als er selbst.
Sie gingen nebeneinander her, ließen die traurigen Reste des Elisenbrunnens links liegen und folgten der Straße. Es war furchtbar: Manfred hatte wieder mal inmitten der Zerstörung und Bedrückung den verwerflichen Wunsch, seine Wange an Gretes Mund zu legen. Ich hol mir einen Kuss ab, nur einen trocknen, kalten, der nicht die Haut verätzt. Von dem ich nicht gleich tot umfalle vor lauter Glück und Schreck. Er fühlte Wut auf jeden alliierten Soldaten, der vorüberkam und hersah.
Er schaute in die klaffenden Häuser. Aus den offenen Zimmern baumelten Stromleitungen und Wasserrohre wie herausgerissene Venen herunter. »Denkst du auch manchmal, dass wir vor einer riesigen Mauer stehen und nicht wissen, wie wir rüberkommen sollen und was dahinter ist?«
»Willst du mich das wirklich fragen, oder was ganz anderes?«
Er sah sie flüchtig an. Ihr Profil, die Atemwolke vor dem Mund, die langen Wimpern, die schöne Nase. Er mochte keine Nasen. Er fand Nasen hässlich, immer, überall, am meisten seine eigene. Bis auf Gretes.
»Deutschland gibt’s nicht mehr. Ich komme mir oft so alt vor, als könnte ich auf mein ganzes Leben zurückblicken. Wie unsere Eltern. Manchmal habe ich morgens keine Lust, aufzustehen. Unbegreiflich, wo mein Vater jeden Tag die Kraft hernimmt.«
»Er ist der Oberbürgermeister«, sagte sie. »Mit ihm geht unser Leben weiter.« Sie blieb mit dem Fahrrad stehen. Manfred machte einen Schritt zu viel, dann drehte er sich zu ihr um.
»Das Leben geht wirklich weiter, Manfred. Ich will einen netten Mann kennenlernen, einen, der überlebt hat und heil zurückgekommen ist. Ich wünsche mir zwei Kinder.«
Ihre Worte polterten wie Steine, er wich ihnen aus.
»Ist was mit dir?«, fragte sie und ging weiter.
Er folgte ihr. »Wenn wenigstens die Schulen nicht kaputt wären und ich das Abitur machen könnte. Ich könnte fix was studieren und hätte einen Beruf …« Mit dem ich dich ernähren könnte! Er kam sich ziemlich albern vor.
»Du wirst bestimmt mal ein prima Ehemann.« »Wirst oder wärst?«
Sie lachte leise.
»Grete, ich habe meinem Vater gesagt, dass wir uns drüben am Dom treffen. Er hat dort zu tun. Wir können das Fahrrad mit dem Auto …«
»Klar«, sagte sie.
Er sah sie an und musste sich vor Anstrengung auf die Zunge beißen. Sogar hier draußen roch er ihren herben Duft, bei Kälte, Staub und Dreck. Eine lange Kette schlammbespritzter Jeeps und ein paar Lastwagen polterten vorbei. Auf den Ladeflächen saßen GIs und drehten die Köpfe. Er hatte große Lust, sie allesamt zu verdreschen, bloß weil sie guckten. Manfred schmunzelte bitter.
»Ist was? Darf ich mitlachen?«, fragte sie.
Er sagte Nein.
»Lüg mich nicht an, du Schuft.«
»Soll ich dich mal richtig anlügen?«
»Mach schon!«
»Ich mag dich sehr, Grete … Sehr, sehr.«
Sie sagte nichts, zog die wunderschönen Brauen hoch, ganz kurz nur. Schaute in die leblose Gegend. Manfred folgte ihrem Blick und sah auf die Fassaden voller Einschüsse in jeder erdenklichen Größe. Als hätte man mit Riesenhämmern gegen die Häuser geschlagen. Es waren zahllose große und kleine Krater, deren Ränder manchmal Strahlen hatten. Ein hässlicher Sternenhimmel. Einer der Soldaten hatte etwas von seinem LKW gerufen und im selben Moment flog etwas her und klappte zu Boden, hüpfte zweimal und blieb liegen. Manfred ging hin und hob die Zigarettenschachtel auf.
»Den würde ich verhauen, wenn ich könnte«, sagte er. »Hier. Ist deine.«
»Ach, Manfred, du bist süß! Bestimmt …«
Zwischen den Ruinen stand eine große Schwengelpumpe, vor der sich eine lange Warteschlange gebildet hatte. Hauptsächlich Frauen, ein paar alte Männer, Kinder. Sie hatten Blecheimer mitgebracht, zwei der Leute hatten Bollerwagen dabei. Ein Mann bediente den quietschenden Schwengel. Die Frauen schleppten die gefüllten Eimer weg, einen in jeder Hand. Man sah, wie schwer sie daran trugen, ihre Schritte waren kurz und staksig, die hochgewickelten Kopftücher nickten energisch zu den Seiten, wenn sie sich entfernten und zwischen den Schutthügeln verschwanden. Ein paar Kinder spielten auf dem Ziegelschutt. Ihre Mütter riefen etwas, das sie nicht zu kümmern schien.
Als Manfred jünger war, hatte er Ruinen toll gefunden, weil man darin spielen konnte. Sie hatten sich versteckt, Landser, Piraten und Indianer, so lange, bis einem von ihnen ein Stein an den Kopf flog und er blutend und heulend nach Hause rannte. Kurz darauf war der »Versehrte« wieder da und eine neue Schlacht begann.
Aus dem Schutt ragte ein Ladenschild hervor: F. Busch. Das Schild gehörte zum Laden einer Frau, die Schreibwaren verkauft hatte. Bleistifte und Papier. Manfred hatte nicht mal die Straßenecke auf Anhieb wiedererkannt. Bei Frau Busch hatte es bunte Bleistifthütchen aus Blech gegeben, die sie selbst mit öliger Farbe bemalt hatte.
Auf einem anderen Schild, das an der Pumpe lehnte, stand handgeschrieben, dass es kein Trinkwasser sei. Aber waschen wird man damit können, dachte er, Kartoffelschalen kochen, Rüben, wenn es welche gab, und vielleicht Pferdefleisch, weil immer wieder tote Pferde an den Straßenrändern lagen. Er merkte, wie er sich von den Bildern ablenken ließ. Er flüchtete vor Gretes Blick, vor ihrem Anblick. Sie schwiegen lange. Er hasste sich wegen seines Geständnisses, das er ihr gemacht hatte. Am liebsten hätte er es aus der Welt genommen wie eine Schachfigur. Aber das Leben ist kein Spiel, das wusste er schon lange.
»Ich bin dir einfach zu jung«, sagte er.
»Du bist mir zu frech.«
»Das soll heißen, ich muss noch frecher werden.«
»Wag es ja nicht!«
»Aber ich kann doch jetzt nicht so tun, als hätte ich nichts gesagt.«
»Dein Pech«, erwiderte sie lachend. »War ja auch schön, zu hören, wie du es sagst. Ich liebe Komplimente.«
Ein Dutzend Männer und Jungen schaufelten in einer Nebenstraße Schutt in Pferdeloren und Lastkraftwagen. Er hatte selber Arbeitspflicht in den umliegenden Dörfern, der Vater hatte ihn keineswegs davon befreit. Er wusste, wie es sich anfühlte. Die Schaufeln flogen hoch und trieben Wolken auf. Der Wind verwehte sie.
»Ich mag dich wirklich, Grete«, sagte er tapfer.
Manchmal, morgens, wenn er nicht mehr wieder einschlafen konnte, wälzten sich in seiner Fantasie Muren aus Harz über ihn hin. In vierzig Millionen Jahren würde er in einem trüben Bernsteinfelsen schlafen. Grete und er als Familie mit Kindern. Ein kleines, sauberes Haus, zwei Etagen und Garten. Das elterliche Ebenbild. Aus der Küche Gretes Stimme, wie sie ihn nach unten rief, weil das Essen fertig war. Die Kinder sitzen am Tisch und heißen Anna-Louise und Erich oder Dorle und Peter. Sie haben winzige Froschhände.
»Du wirst eine Stelle bei einem Fotografen finden«, prophezeite er und hoffte, dass es ihr gefiel. Sie sollte lächeln. »Deine Bilder werden in Illustrierten abgedruckt«, fügte er hinzu. »Und dann holen sie dich nach Amerika, weil du den richtigen künstlerischen Blick hast.«
»Was für einen Blick?«
»Den richtigen eben. Den man als Fotograf unbedingt haben muss. Magst du mich auch?«
»Das weißt du doch.«
»Nicht so.«
»Wie denn?«
»Als Mann.«
»Manfred, bitte.«
»Sag es.«
»Dein Vater kommt.«
»Dann beeil dich eben.«
»Nein.«
»Ich schieße alle anderen tot. Alle.«
»Meinst du, damit wird es gut?«
»Dann hab ich Frieden.«
»Du hast mich doch zu Hause. Ich bin ja da.«
»Du riechst so gut.«
»Da kommt das Auto, glaub ich.«
»Mein Vater kommt noch nicht. Sag mir was Schönes. Bitte!«
»Mach mich nicht verrückt.«
»Du machst mich aber kirre, weißt du das? Stell dir ein kleines
Siedlungshaus vor. Terrasse, Garten …«
»Damit macht man keine Späße, Manfred.«
Eine bestimmte Partie an ihrer Oberlippe, fast im Winkel, übte die größte Anziehung auf ihn aus. Wäre die Stelle groß wie ein Bett oder ein Pferdeleib, würde er sich drauflegen und wohlfühlen.
»Wenn ich winzig klein wäre, würde ich mich an deinen Mund legen und einschlafen.«
»Du bist verrückt.«
»Gefällt dir gar nichts, was ich sage?«
»Es ist zu schön. So etwas gibt es nicht.«
»Du musst es wollen.«
»Und deine Eltern?«
»Wir wollen beide nicht so sein wie sie. Du hast es selbst gesagt. Dass wir nicht so werden wollen wie die Eltern.«
Sie nickte lächelnd. Endlich. Er hatte es geschafft.
»Ich besuche dich«, sagte er.
»Wie bitte? Ich wohne oben bei meiner Mutter.«
»Wenn sie nicht zu Hause ist.«
»Ich habe noch nie jemand so Freches erlebt, Manfred. Hast du keine Angst?«
»Wovor?«
»Dass ich dich verführe?« Sie mussten beide lachen.
»Da kommt dein Vater«, sagte sie und nickte die Straße hinunter.
Er sagte hastig: »Es soll so sein.«
»Was soll so sein?«
»Dass ich zu dir kommen soll«, antwortete er. »Es gibt nämlich eine riesige Weltordnung, hast du das nicht gewusst? Sie hat es vorgesehen.«
»Du hast Fantasie!«
»Selbst wenn wir uns beide dagegenstemmen würden, das würde nichts nützen. Es wird so, wie es werden soll. Das ist die Riesenordnung in der Welt. Das Universum. Ich weiß das einfach.«
Der Jeep kam näher.
»Manfred, Manfred …«
»Grete, Grete …«
»Du bist süß, weißt du das?«, sagte sie leise.
Er lachte hell. »Na klar. Und das Universum und die Riesenordnung wissen es erst recht.«
Die Schere
Heidrun rannte die Treppe nach oben. Als sie ins Zimmer trat, saß Lene auf ihrem Bett und las.
»Ich hab es geahnt, Lene. Mit diesen Schülern geht das nicht. Ich kann mit keinem dieser Kinder einen Einsatz durchstehen.«
»Was ist passiert?«
»Als ich auf die Toilette komme, stehen sie da, ein halbes Dutzend. Auch dieser Erich aus Aachen. Das geht nicht, Lene, wenn die uns wirklich auswählen. Ich kann mit so einem Blödmann nicht zusammenarbeiten.«
»Wieso?«
»Die standen da grinsend und hatte allesamt die Hosen runtergelassen. Das sind wirklich noch Kinder!«
Lene schaute hoch und schien unentschieden, ob sie lachen sollte oder nicht.
»Ich gehe jetzt zu Schalk«, sagte Heidrun. »Diese Doofköppe müssen doch lernen, dass es ernst ist, dass sie hier nicht zum Spielen hergekommen sind. Sonst müssen sie eben nach Hause geschickt werden.«
»Du weißt genau, dass die Offiziere das nicht tun können«, antwortete Lene. Heidrun gab ihr im Stillen recht. Trotzdem fühlte sie sich verletzt, erniedrigt; sie hatte ihren Stolz, und wenigstens könnte einer der Vorgesetzten ihre Partei ergreifen und ihr in dieser Situation Verständnis entgegenbringen. Einen Moment überlegte sie. Nein, sie konnte nicht darüber hinweggehen. Sie konnte nicht Hand in Hand mit so einem Grünschnabel in Aachen umhermarschieren, um herauszufinden, wo der Verräter wohnte. Brüderchen und Schwesterchen spielen!