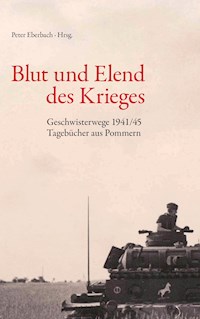
Blut und Elend des Krieges E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
"Mein Bart bleibt bis Moskau!" so umschreibt ein deutscher Panzerleutnant im Oktober 1941 in seinem Tagebuch siegessicher seinen Entschluss, sich das nächste Mal erst wieder nach der Eroberung der russischen Hauptstadt zu rasieren. In der Tat, er hatte es nicht mehr weit. Dreieinhalb Jahre später, im Januar 1945, nimmt eine junge Frau, es ist die Schwester des unrasierten Leutnants, die stabile, langstielige Suppenkelle der Familie aus massivem 800er Silber und versteckt sie griffbereit zwischen zwei Hafersäcken auf einem Pferdegespann. Es ist ihre Notwehrwaffe für die Zeit der Flucht vor der Roten Armee Richtung Westen. "Damit wollte ich einem Russen ins Gesicht schlagen," berichtet sie in ihrem Tagebuch. Blonder Stoppelbart und silberne Suppenkelle, Symbole für blinden, jungenhaften Eroberungsrausch einerseits und die Ohnmacht wehrloser Flüchtlinge gegenüber der feindlichen Militärmacht andererseits. Heinz P., Jahrgang 1919, notiert als 21-jähriger Offizier und Panzerkommandant zwei Feldzüge. Einmal durch Ungarn, Bulgarien und Jugoslawien im ersten Halbjahr 1941. Dann ab Juni 1941 den Russland-Feldzug von Wien aus durch Polen, die Ukraine, Weißrussland, Russland bis kurz vor Moskau. Das war die eine Seite dieses Krieges, der Eroberungskrieg mit zunächst vielen siegreichen Schlachten. Erika P., die Schwester von Heinz, schildert die andere Seite. Sie beginnt ihr Tagebuch am 21. Januar 1945. Der zunächst so "erfolgreiche" Krieg des Jahres 1941 hatte sich inzwischen in ein Desaster für die deutsche Wehrmacht verwandelt. Die russische Armee steht wenige Kilometer vor dem kleinen Städtchen Schönlanke, heute Trzcianka, in Hinterpommern. Es ist ein kalter Wintertag,als die Menschen vom kollabierenden NS-Apparat aufgefordert werden, in selbst organisierten Trecks ihre Stadt zu verlassen. Der Marsch nach Westen in eine unbekannte Zukunft beginnt. Eine Odyssee zwischen den Fronten von zweieinhalb Monaten: zu Fuß, mit dem Rad und auf dem Pferdewagen durch einen bitterkalten Winter. Nach 10 Wochen erst sind sie am Ziel. Dieses Buch ist für Menschen, die hinsehen, hinhören und hinfühlen wollen. Oder einfach neugierig sind. Sie haben die Möglichkeiten, in kleinen persönlichen Ausschnitten zu erleben, wie es wirklich war im letzten großen Krieg (1939-1945), der von deutschem Boden ausging. Der Herausgeber hat die Texte von Schwester und Bruder miteinander verflochten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 177
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
„Freiheit muss erkämpft werden.“
Bundeskanzlerin Angela Merkel
am 9. November 2009, dem 20. Jahrestag des Mauerfalls,
um 20.09 Uhr
vor dem Brandenburger Tor in Berlin
Inhalt
Vorwort
Die Tagebücher: Flucht und Krieg
Übersichtskarte
Der Fluchtweg im Zeitraffer
Anhang
Flugblatt der Roten Armee
Ergänzungen: 35 Jahre danach
Ein Wunsch des Herausgebers
Ihre Meinung gerne per Mail an: [email protected]
Vorwort
„Mein Bart bleibt bis Moskau!“ so umschreibt ein deutscher Panzerleutnant am 5. Oktober 1941 in seinem Tagebuch siegessicher seinen Entschluss, sich das nächste Mal erst wieder nach der Eroberung der russischen Hauptstadt zu rasieren. Er hat das Ziel nur knapp verfehlt.
Dreieinhalb Jahre später nimmt eine junge Frau, es ist die Schwester des unrasierten Leutnants, die stabile, langstielige Suppenkelle der Familie aus massivem 800er Silber und versteckt sie griffbereit zwischen zwei Hafersäcken auf einem Pferdegespann. Es ist ihre Notwehrwaffe für die Zeit der Flucht vor der Roten Armee Richtung Westen. „Damit wollte ich einem Russen ins Gesicht schlagen.“ berichtet sie in ihrem Tagebuch. Blonder Stoppelbart und silberne Suppenkelle, Symbole für blinden, jungenhaften Eroberungsrausch einerseits und die Ohnmacht wehrloser Flüchtlinge gegenüber der feindlichen Militärmacht andererseits.
Dieses Buch ist für Menschen, die hinsehen, hinhören und hinfühlen wollen. Oder einfach neugierig sind. Sie haben die Möglichkeiten, in kleinen persönlichen Ausschnitten zu erleben, wie es wirklich war im letzten großen Krieg, der von deutschem Boden ausging (1939-1945). Ein Geschwisterpaar erzählt. Packend und verstörend zugleich.
Heinz P., Jahrgang 1919, notiert als 21-jähriger Offizier und Panzerkommandant zwei Feldzüge. Einmal durch Ungarn, Bulgarien und Jugoslawien im ersten Halbjahr 1941. Dann, nach einem kurzen Heimaturlaub ab Juni 1941 den Russland-Feldzug von Wien aus durch Polen, die Ukraine, Weißrussland, Russland bis in die Kesselschlacht um Wjasma, heute Vjaz’ma, kurz vor Moskau. Das ist die eine Seite des Krieges, der Eroberungskrieg mit zunächst vielen siegreichen Schlachten.
Erika P., die Schwester von Heinz, schildert die andere Seite – teilweise vertreten durch die sie begleitende Mutter. Sie ist Jahrgang 1916 und beginnt ihr Tagebuch am 21. Januar 1945. Der zunächst so „erfolgreiche“ Krieg des Jahres 1941 hatte sich inzwischen in ein Desaster für die deutsche Wehrmacht verwandelt. Die russische Armee steht wenige Kilometer vor dem kleinen Städtchen Schönlanke in Hinterpommern. Der Ort gehörte damals zum Deutschen Reich, heute zu Polen. Er heißt jetzt Trzcianka, liegt etwa 150 km östlich der Oder, 20 km südwestlich von Schneidemühl, heute Pila.
Es ist ein kalter Tag im Januar 1945, als die Bevölkerung des Städtchens vom kollabierenden NS-Apparat aufgefordert wird, in selbst organisierten Trecks ihre Stadt Schönlanke zu verlassen. Der Marsch nach Westen in eine unbekannte Zukunft beginnt. Eine Odyssee zwischen den Fronten von zweieinhalb Monaten: zu Fuß, mit dem Rad und auf dem Pferdewagen durch einen bitterkalten Winter bis ins Weserbergland, wo Schwester und Schwager auf die Flüchtenden warten. Mit dem Auto würden wir heute für diese Strecke voller Umwege von etwa 1000 km maximal 18 Stunden benötigen.
Der Herausgeber hat beide Tagebücher miteinander verflochten. Die Aufzeichnungen von Erika P. von ihrer Flucht 1945 aus der Heimat in den sicheren Westen dient quasi als Rahmenhandlung für regelmäßige Rückblenden in das Kriegserleben ihres Bruders und Panzeroffiziers im Jahr 1941, blickt also in jene Zeit, als die Dinge geschahen, die jetzt im ersten Halbjahr 1945 den Verlust der Heimat zur Folge haben.
Die Eltern von Heinz und Erika sind damals meine zukünftigen Großeltern. Tochter Waltraut, Erikas ältere Schwester, ist im Winter 1944/45 mit mir schwanger. Vater ist Forstmeister im erzwungenen Ruhestand. Er war politisch stets konservativ gewesen und in dieser Haltung ein konsequenter Gegner der Nazis. Von Anfang an hatte er sich geweigert, an „Führers Geburtstag“, dem 20. April, vor seinem Forstamt die Hakenkreuzflagge zu hissen. Das ging so lange gut, bis er einen Kutscher einstellte, der Mitglied der NSDAP war. Dieser Mann denunzierte ihn. In der Folge wurde mein Großvater, wie man heute sagen würde, gemobbt, bis hin zur Einweisung in die Psychiatrie. Es gibt Hinweise, dass auch Teile der Familie sich aus Scham und Unverständnis von ihm abwandten.
Den beiden Töchtern des aufmüpfigen Vaters wurde nach den Regeln der Sippenhaft das Gymnasium verweigert. Erika und Waltraut gelang es, über ihre sportliche Begabung einen Platz in der Gesellschaft zu finden. Sie wurden Sportlehrerinnen, Waltraut schaffte es 1936 bis in die olympische Reservemannschaft. Die Söhne der Familie, Heinz und Ernst, wurden allerdings nicht daran gehindert, die Offizierslaufbahn wählen.
Am Ende des Krieges wird meine Großmutter schmerzliche Verluste erlitten haben. Der Preis des Krieges. Die Wunden dieses Krieges haben sich bei ihr im wahrsten Sinne des Wortes nie wieder ganz geschlossen. Ihre auf der Flucht vom eisigen Frost geschädigten Beine weigerten sich, zu verheilen und verlangten 30 Jahre lang bis zu ihrem Tod tägliche Pflege und Verbandswechsel.
Im Mittelpunkt der Tagebücher stehen häufig die Probleme des alltäglichen Lebens und Überlebens: Essen, Schlafen, das Vorwärtskommen. Die Gefahr für Leib und Leben ist permanent. Für Gefühle wie Wut, Trauer und Schmerz ist selten Platz. Der Krieg mag keine Tränen. Es muss vor allem irgendwie weiter gehen. Jeden Tag.
Die Leser sollten sich bewusst sein, dass im Zuge des „erfolgreichen“ Vorrückens der deutschen Wehrmacht nach Polen, in die Ukraine, Weißrussland und die Sowjetunion unverzüglich mit der systematischen Vernichtung der Juden begonnen wurde, wie etwa in dem Städtchen Berditschef1. Im Tagebuch von Heinz P., der am 8.Juli 1941 erstmals aus Berditschef zu berichtet, finden sich hierzu jedoch fast keine Aussagen. Dies mag damit zusammenhängen, das mit den umfassenden Erschießungen in Berditschef Sonderkommandos beauftragt waren und die Wehrmacht möglicherweise nicht direkt involviert war. Diese und andere Verbrechen des nationalsozialistischen Regimes können in diesem Buch nur in dem Maße Platz finden, wie sie in den persönlichen Tagebuchdokumentationen der Geschwister auftauchen. Eine solche dokumentarisch bedingte Verengung der Sichtweise darf unter keinen Umständen missverstanden werden als Verdrängung oder Verharmlosung der nationalsozialistischen Verbrechen.
Von den Hindernissen
Im Jahre 2008 ist es ein weiter Weg von einem handschriftlichen Tagebuch aus der Zeit vor 1945 bis zu einem gut lesbaren Text. Die Tagebücher wurden in der „deutschen“, der Sütterlinschrift, die kaum noch jemand entziffern kann, geschrieben.
Zudem gab es für diese Niederschriften keine bequeme Bürosituation oder den heimischen Schreibtisch. Man schrieb, wo man gerade war, im Panzer, auf dem Pferdewagen, in einem fremden Haus in einem fremden Land, unter einem Baum auf der Erde sitzend, im Lazarett, bei Kerzenschein. Jederzeit musste mit einem Alarm gerechnet werden, mit einem feindlichen Angriff. Die Handschriften gerieten also nicht immer optimal leserlich. Die Richtigkeit der Schreibweise vieler Ortsnamen kann nicht garantiert werden.
Besonderer Dank gilt meinem Bruder Dr. Thomas Eberbach, der viel dazu betrug, dass die Tagebücher von Heinz P. in die heute gebräuchliche „lateinische“ Schrift transkribiert werden konnten. Das Tagebuch von Erika P. musste nicht übertragen werden. Sie selber hat es noch zu Lebzeiten in ihre alte Schreibmaschine getippt und der Familie zur Verfügung gestellt.
Es wurde darauf verzichtet, eine größere Anzahl, meist militärischer Abkürzungen in ihrer Bedeutung näher zu erforschen und zu dechiffrieren. Ich denke, das mindert nicht den Stellenwert dieser Dokumente.
Änderungen.
An einigen wenigen Stellen habe ich zum besseren Verständnis Wörter oder kurze Sätze eingefügt, dies aber durch kursiven Druck erkennbar gehalten. Gelegentlich habe ich zur Erleichterung des Lesens die Syntax umgestellt. Einige Namen wurden zum Schutz der Personen anonymisiert. Sonst blieben die Texte unverändert und ungekürzt.
1 Unter www.proza.ru/2010/04/26/720 findet sich ein erschütternder Augenzeugenbericht.
Die Tagebücher
Die Flucht: Etappe 1
Sonntag, 21.Januar 1945
Schönlanke/Trzcianka,2 halb 8 Uhr, kurzes Klingeln, 2 Mal. Statt Ernst, meinem zweiten Soldatenbruder, auf dessen Rückkehr von der Ostfront ich nun schon so lange warte, steht Frau Sachs, unsere Hauswirtin vor der Tür:
„Sie packen noch nicht, wissen Sie noch nichts? Um halb 2 Uhr in der Nacht ist Packbefehl gekommen.“3
Ich setze Waltraut, meine große Schwester, die im Juli ihr erstes Kind erwartet, um halb 10 Uhr ohne Gepäck und ohne Frühstück mit Familie Fahrenholz in den Zug nach Berlin. Gespräche mit Dollo, ihrem Mann, meinem Schwager. Er kann uns nicht holen. Abends zu Gerth, dem Bahnhofsvorsteher, er will Montag früh Gepäck annehmen.
Mutti und ich packen die Nacht durch und sind erst um 13 Uhr auf der Bahn fertig. Abends zu Pforts, Vaters Kollegen, beides Forstmeister, um uns zu verabschieden.
Wir wollten mit der Bahn raus, entschließen uns aber, uns bei Pforts Treck mit Schlitten und Rad anzuschließen, da kaum Züge fahren und niemand Bescheid weiß. Wir packen die 2. Nacht durch, um halb 6 Uhr erscheint Waltraut wieder, um Sachen zu holen. Ich gehe vormittags zu Gebhardts und Egerländers. Frau Gebhardt will uns mit wenig Gepäck mitnehmen.
Waltraut und Vater gehen abends auf die Bahn, Mutti und ich bringen Koffer zu Gebhard. Es geht aber kein Zug, wir schlafen alle wieder zu Hause. Vater und Waltraut gehen um 6 Uhr wieder zur Bahn, sie fahren um halb 4 Uhr ab. Waltraut kann noch den roten und den grauen Sack, sowie die „Honigkiste“ vom Güterbahnhof mitnehmen. Kurz danach verlässt Tilli Lehmann, eine Freundin der Familie, deren Mann gefallen ist, mit einem Lazarettzug die Stadt, leider sah ich sie vorher nicht noch mal.
Mittwoch Abschied von Philippis, Vaters Nachfolger im Forstamt Behle, die mir noch ein Wildschweinsblatt geben, das sofort in die Pfanne wandert. Post von meinem Bruder Ernst, dass er am 26.1.45 wieder an die Ost-Front muss.
26. Januar 1945
Morgens in die Stadt zu Egerländers, alles ist ruhig. Bei Heidchen Jahn bekomme ich 400 Gramm Butter geborgt, hole von Kersten das gutgeschriebene Fleisch und ein Brot von Frau Rieck, unserer Bäckermeisterin. Wir wollen richtig Mittag essen. Die Erbsen stehen im Glas auf dem Tisch, es klingelt. Heinz von Gebhardts, ein evakuierter Junge aus Bochum, bestellt, dass wir in einer halben Stunde mit allem Gepäck bei Gebhardts sein sollen.
Mutti versucht unter Tränen noch 2 Tischtücher als Bettlaken zusammenzunähen, ich ziehe mit Schlitten schon ab und komme bei Gebhardts in einen Familienrat, ob oder ob nicht gefahren werden soll. Als ich zurückgehe, Fliegeralarm.
In anderthalb Stunden soll es nun losgehen. Ich hole Mutti. Mit Sachs’ Handwagen ziehen wir zu Gebhardts, die schon auf uns warten. Unterwegs wird bereits geschossen. Tiefflieger greifen den Bahnhof an, der sofort brennt. 6 Panzer sind in der Stadt, 2 werden abgeschossen.
Die Pferde kommen wieder in den Stall, wir in den Keller. Die 2 Litauer kommen nicht mit, also übernimmt Ilse, Gebhardts Hausmädchen, das Gespann, als wir um 18 Uhr nach dem Angriff die Stadt verlassen. Hansl Egerländer ist bereits vorher mit Frau und seinen 4 Kindern losgefahren. Im Schritt geht’s durch die Stadt, am Forstamt Behle/Biala vorbei, wo scheinbar alles leer ist. Ich bin sehr traurig, weil ich zum letzten Mal das Haus sehe, wo ich groß geworden bin.
Die Straße ist sehr glatt, die Pferde rutschen, hinter uns liegt Schönlanke in rotem Feuerschein. Ich sitze über Ilse, es ist unheimlich kalt, die Füße bekommen Frost.
In Eichfier wird Elses kleiner Junge trockengelegt, dann geht’s wieter bis Werzburg, 4 km vor Schloppe/Czlopa. Ich „schlafe" auf dem Wagen, wache, die andern im Gutshaus. Frühstück, das Dorf wird geräumt. Wir müssen weiter.
27. Januar 1945
16 Grad Kälte, eisiger Wind. Wir treffen einige Soldaten, kommen durch das geräumte Schloppe/Czlopa, müssen sehr oft Pferde „vorlegen", da es sehr bergig ist und kommen doch bloß bis Salm/Zalom, wo wir auf einem leeren Gutshof die Pferde unterstellen und in 2 Stuben übernachten.
Im Gutshaus ist ein Landjahrlager gewesen, das überraschend geflohen ist, denn es war noch alles vom Essen stehen und liegen geblieben, sogar noch warm. Das Vieh wird gefüttert und gemolken. Frau Karuppa, die Kutschersfrau, kocht Kartoffeln, dazu Wildschwein!
28. Januar 1945
14 Grad Kälte. 8 Uhr Abfahrt durch verschneite Waldwege, da die Russen sich bedenklich genähert haben.
Wir laufen auch heute den ganzen Tag und treffen bei Luisenau (bei Niemiensko) Herrn Poll mit seinem Treck von 4o Wagen. Im Forsthaus Luisenau warmes Quartier. Das frisch geschlachtete Schwein liegt im Badezimmer. Wir belegen zwei Stuben, jeder nimmt sich etwas vom Schwein. Nachts kommen noch zwei Soldaten zu uns rein. Else und ich schlafen oder besser wachen auf dem Wagen.
In der Nacht türmt ein Kutscher (Pole) von Egerländers, erscheint aber zur Abfahrt wieder. Am Tage treffen wir Ortsgruppenleiter Gonitzki, Zillmann und Konsorten auf der Flucht zu Fuß, die auch in Salm/Zalom geschlafen hatten. Herr Fröhlich aus Schloppe/Czlopa weist sie zurecht, aber sie gehen wohl weiter. Wir sehen sie nicht mehr.
Die Nacht schrecklich, der Feind ist in Schloppe /Czlopa, bloß 12 km von uns. Kanonendonner und Schießerei ganz nah. Else und ich sind sehr aufgeregt, können nicht schlafen. Außerdem ist es sehr kalt.
29. Januar 1945
12 Grad Kälte. 8 Uhr Abfahrt mit Vorlegen vom Forsthaus. Zu Fuß über Neuwedell/Drawno, Brot gekauft, 10 km weiter bis nach Kölpin/Kielpino, wo wir in einem herrlichen Gutshaus mit viel Militär übernachten. Baron von der Marwitz. Mutti und ich im Salon. Die Leute waren erst mittags gefahren, Verwalter und einige Mädchen sind noch da. In der Küche treffe ich Frau Schwinning, Gutsfrau aus Deutsch Krone /Walcz. Sie kommt kurz zu uns ins Zimmer.
Abends Essen mit Rotkohl, Kaffee, Apfelkuchen mit Puderzucker. Frau Karuppa nimmt eine wunderbare Daunendecke mit: ihr Mann soll nicht mehr so frieren. Nachts kommen noch sehr viele Flüchtlinge.
Blick zurück: Balkankrieg 1
Heinz P., geb. 12.10.1919, tritt freiwillig in die Offiziers-Laufbahn ein und beginnt seinen Dienst am 16.11.1938 beim Panzer-Regiment 15 in Sagan. Beförderung am 1.4.1940 zum Leutnant.
Sagan, 20. Januar 19414
21:30 Uhr. Abmarsch der Kampfstaffel 6. Kompanie vom Dachsberg zum Bahnhof Sagan. Ab 12:15 Uhr Verladung.
Sagan, 21. Januar 1941
3:30 Uhr. Abfahrt nach Süden über Berlin, Oppeln, Ratibur.
Ratibur, 22. Januar 1941
29 Stunden Aufenthalt. 21:00 Uhr Abfahrt Richtung Warburg, Teschen.
Teschen, 23. Januar 1941
3:30 Uhr. Überschreiten der deutsch-slowakischen Grenze. Empfang und Tee mit Rum. Luipoldstis.
11:00 Uhr. Überschreiten der slowakisch-ungarischen Grenze bei Neuhäusel. Galante Grenzstation! Durch die Puszta über Gran zur Donau. An der Donau entlang bis Ujpest kurz vor Budapest nach Helmholtz.
Helmholtz, 24. Januar 1941
Durch die Puszta bis Großwarden.
Großwarden, 25. Januar 1941
Durch gebirgiges Terrain an Buchen entlang auf eingleisiger Bahn bis kurz vor Klausenburg.
Klausenburg, 26.Januar 1941
11:00 Uhr. Wir passieren die ungarisch-rumänische Grenze! Fahren in einem Flusstal entlang. Nachts nehmen wir einen ungarischen Soldaten mit, einen Unteroffizier, der entsetzlich stinkt. Wir fahren stets langsam und auf eingleisiger Bahn bis Razbrienie.
Razbrienie, 27. Januar 1941
Die rumänische Eisenbahn ist nicht ganz so einmalig als die ungarische, außerdem macht Rumänien einen besseren Eindruck. Am Abend passieren wir nochmals die rumänisch-ungarische Grenze bei Neumarkt. Neumarkt macht einen guten deutschen Eindruck. Wir essen sogar, zwar teuer, Schweinefleisch in der Bahnhofswirtschaft. Anschließend machen wir ein kleines „Stoßtrupp-Unternehmen“ durch verschiedene Gaststätten mit Zigeunerkapellen. Allmählich wird es kälter.
Neumarkt, 28. Januar 1941
Am Morgen erwachen wir bei 28° C Kälte in wunderbar bergiger Schneelandschaft der Vorkarpaten. Die Dörfer sind hübsch, wie die deutschen im Sachsenurlaub.
Nachdem wir tagelang über die Puszta durch Ungarn und Rumänien nur stinkige, primitive Hütten ohne Schornstein und die Menschen in Lumpen gesehen haben, ist dies eine Überraschung. Es ist das deutsche Siebenbürgen. Einwohner sprechen leider nur noch ein wenig Deutsch. In Ditro besichtigen wir das Dorf - ich fotografiere - und treffen einen Sachsen, der uns Zwiebeln und Kohlrabi schenkt.
Mit einem Schlitten fahren wir zum Bahnhof, doch unser Transport ist weg. In 3 Stunden holen wir ihn ein. Wir fahren bis Mierzenea-Cäni.
Mierzenea-Cäni, 29. Januar 1941
Nachts war es sehr kalt, minus 28°C. Wieder geht unsere Fahrt durch die schönen Karpaten und durchs deutsche Siebenbürgen. Hier wohnen 800 000 Deutsche. Bis Kronstadt nehmen wir einen Sachsen mit. Kronstadt ist 60 Prozent Deutsch. Vor Kronstadt überquerten wir nochmals die ungarisch-rumänische Grenze. Auf zweigleisiger Bahn geht es durch die verschneiten und Tannen bewaldeten Karpaten.
Mein Benzin-Kocher verursacht im Abteil einen Brand, der das halbe Abteil erfasst. Zum Glück konnten wir den Brand noch löschen.
Allmählich kommen wir in das Ölgebiet von Sinaii/Plöesti. Leider ist es inzwischen dunkel geworden.
Plöesti, 30. Januar 1941
Über Nacht haben wir die Karpaten verlassen und durchfahren bis Fetesti die „Baragan-Steppe“, ein mit Gras bedecktes Ödland. In Fetesti merkt man schon den orientalischen Einschlag bei den Soldaten. Die Donau überqueren wir auf 2 großen Brücken. Um 14:00 Uhr gelangen wir zu unserem Ziel, Medgidia, wo wir ausladen.
Medgidia, 31. Januar 1941
Die Kompanie bezieht Barackenquartiere. Ich wohne mit Leutnant Seitlitz in einem „Stall“ ohne Ofen (kälteste Nacht).
Medgidia, 3. Februar. 1941
Ausflug nach Constanza am Schwarzen Meer. Kleiner Hafen, lausige teure Stadt, Gänsebraten für 60 Lei, Schlagsahne, hübsche Frauen, deutsche U-Boote im Schwarzen Meer. Sonst Enttäuschung.
Medgidia, 3. - 8. Februar 1941
Keine Ereignisse.
Medgidia, 9. Februar 1941
Das Panzer-Regiment 15 steht am Barackenlager angetreten. Unser Kommandeur, Oberst Streich, erhält das „Ritterkreuz zum eisernen Kreuz“ vom Führer und obersten Befehlshaber der Wehrmacht durch unseren Divisionskommandeur General Kruwell verliehen. Er würdigt die Verdienste unseres Kommandeurs in einer Ansprache.
Gleichzeitig ist dies aber auch die Abschiedsfeier für unseren Kommandeur. Unter den Klängen des Präsentiermarsches schreitet er zum letzten Mal die Front seines Regiments ab. Durch seine Abschiedsansprache und die des Majors Dr. Jaraht wird uns allen jetzt erst klar, wie lieb uns unser Kommandeur in der dreieinhalbjährigen Führung des Regiments, von seiner Gründung bis heute, geworden ist. Noch einmal erklingt unser stolzer Regimentsmarsch und das Regiment-Panzerlied. Dann ist die Abschiedsfeier beendet und die Einheiten werden entlassen.
Am Nachmittag unternehmen wir Offiziere des 4./15 einen Ausflug nach Czerna-Woda. Wir besuchen auch die Höhlen- und Zeltbewohner. 3 bis 4 Zimmer und ein Pferdestall sind in die Donauberge eingesprengt. Dort leben Zigeuner in Lumpen ohne Mobiliar. Ein Ofen und die Bank aus Lehm, ein Kind hängt in einer Wiege an der Decke. Die Zeltbewohner sind wie Urmenschen und auch so bekleidet. Das schwarze Zigeunerhaar hängt bis zu den Schultern und die Bärte bis auf den Bauch. Auch haben sie keine Tische etc.
In Czerna-Woda fahren wir in die Nähe der gewaltigen Donaubrücken. Sonst macht die Stadt einen besseren Eindruck als Medgidia.
Am Abend ist die Abschiedsfeier des Oberst für das Offiziers-Korps. Um 12:00 Uhr dann großer Zapfenstreich und Vorbeimarsch einer Ehrenkompanie.
Medgidia, 10. Februar. 1941
Das Panzerregiment hat Spalier von der Wohnung des Oberst bis zum Bahnhof gebildet. Wir stehen am Bahnhof. Oberst Strauch gibt uns noch mal die Hand. Auf dem Bahnhof spielt die Kapelle den Abschiedsmarsch. Sämtliche Feldwebel des Regiments sind angetreten. Um 7:10 Uhr verlässt der Zug mit unserem Regiments-Marsch den Bahnhof. Ein dreifaches „Hurra!“
Medgidia, 11. Febr. 1941
Oberleutnant Heinz Thrudel holt mich vormittags bei herrlichstem Wetter zum Ausflug nach Constanza ab. Dort besuche ich den katholischen Divisions-Pfarrer Gehrmann, der mich zum Mittagessen einlädt. Außerdem trinke ich bei einem ehemals russischen Offizier Café Trütz. Das Schwarze Meer begeistert mich bei schönstem Sonnenwetter. Wir besichtigen den Hafen und einige Konsulate. Außerdem treffe ich Leutnant Fritz Häckel. Wir fahren noch 30 km südlich am Schwarzen Meer entlang - einfach wunderbar - und besuchen das angeblich so schöne „Strandbad“ Minaia 6 km nördlich Constanza, aber Enttäuschung. Mehr scheinen, aber nicht sein!
Beim Rückweg sehen wir einen prachtvollen Sonnenuntergang. Innerhalb 20 Minuten überfällt uns Dunkelheit. Die erste Feldpost nach 10 Tagen trifft ein!
Medgidia, 13. Febr. 1941
Ich ziehe in ein anderes Quartier mit Schlaf- und Wohnzimmer, ganz vornehm gegenüber dem alten. Es ist eine schöne Wohnung mit Mobiliar im orientalischen Stil mit vielen Teppichen. Nachmittags Ausflug nach Constanza, wo ich seit 4 Wochen endlich mal wieder im Hotel Carlton bade!!
Medgidia, 20 Febr. 1941
Völlig überrascht uns die Versetzung unseres Kompaniechefs. Nachfolger wird Hauptmann Priken
Medgidia, 21. Febr. 1941
Unser alter Kompaniechef wird mit einem „dreifachen Hurra“ vom Abteilungskommandeur verabschiedet und Hauptmann Pricken übernimmt die
5
stolze 6. Oberleutnant Körtge wird Kommandant des Stabsquartiers der 11. Regiments-Division. Mich trifft dieser Schlag besonders hart, da Oberleutnant Körtge Zugführer und Kompanieführer mit mir im Westen war.
Medgidia, 27. Febr. 1941
Ich bin wieder in Constanza zur Zahnbehandlung. Beim Russen esse ich Makkaroni mit Parmesankäse. Nachmittags kommt für uns das Stichwort „Frühling“. Also endlich: langsam fertig machen zum Abrücken. Munition wird noch am selben Abend gegurtet, Kraftstoff- und Verpflegungszusatz gefasst.
Medgidia, 1. März 1941
Alles ist marschbereit. Nachmittags unternahmen wir Kompanieoffiziere mit unserem neuen Chef Hauptmann Priken einen letzten Ausflug nach Constanza. Das Wetter ist wieder umgeschlagen. 0°C und die Fahrt wird so sehr kalt. In Constanza essen wir Schlagsahne. Anschließend besichtigen wir den Hafen und rumänische Kriegsschiffe, sowie deren Waffen. Die ersten deutschen Matrosen sind zu sehen. Bulgarien tritt dem Dreierpakt bei.
Medgidia, 2. März 1941
Um 10:00 Uhr verlasse ich mein Quartier. „Georgien Dudu, Adeal Patru!“ Kompanie ist marschbereit.
13:45 Uhr. Abmarsch durch Medgidia/Adamoliri. Die Trojanersäule ist leider während der Dunkelheit nicht mehr zu sehen. Gegen 21:00 Uhr erreichen wir auf bergigem Gelände Ostrow, wo wir auftanken. Dann geht es nachts bei sternenklarer kalter Nacht an der Donau entlang bis kurz vor Silistra.
Silistra, 3. März, 1941
Morgens um 8:00 Uhr überschreiten wir kurz vor Silistra die rumänisch-bulgarische Grenze. Silistra ist für unseren Einmarsch weiß-gelb-rot geflaggt und macht einen günstigeren Eindruck als Rumänien. Die Bevölkerung ist begeistert. Unser Weg geht weiter durch sehr bergiges Gelände über Alfator, Iperiol, Razgrad – ebenfalls sehr schön - bis nach Eski Dzumjaa. Dort machen wir um 22:00 Uhr Halt und übernachten wieder im Panzer.
Eski Dzumaja, 4. März 1941
Um 5:30 Uhr Wecken. Um 6:30 Uhr geht es durch Eski Dzumaja ins Gebirge über den Dervent-Pass im Balkangebirge. Es ist sehr nebelig und kalt, aber die Berge sind wunderbar, halb mit und halb ohne Schnee. Für die Panzer ein schwieriges Experiment, was aber gelingt. Wir erfahren, dass der Mokram-Pass unpassierbar ist und machen einen Umweg.





























