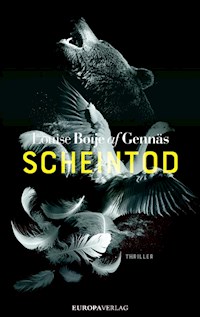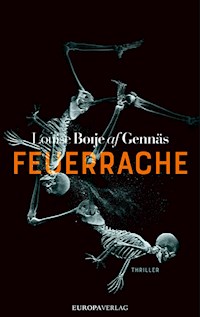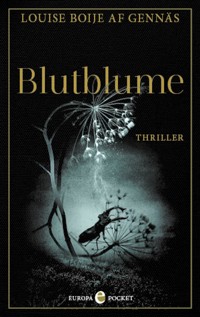
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Europa Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Widerstandstrilogie
- Sprache: Deutsch
Als Saras Vater bei einem rätselhaften Brand zu Tode kommt, zieht sie von der schwedischen Kleinstadt Örebro nach Stockholm. Dort läuft zunächst alles glatt für die 25 Jährige: Aus ihrem Job als Kellnerin wird eine Anstellung bei einer angesehenen PR-Agentur, und von der schäbigen Vorortwohnung geht es in ein luxuriöses Apartment im Nobelstadtteil Östermalm. Sara ist glücklich, dass sich in ihrem Leben endlich alles zum Guten gewendet hat. Doch schon bald muss Sara erkennen, dass nichts so ist, wie es scheint. Beängstigende Dinge geschehen, für die sie keine Erklärung findet. Immer größer wird ihr Misstrauen gegenüber ihrem Umfeld, bis sie schließlich an ihrem eigenen Verstand zu zweifeln beginnt. Bildet sie sich all diese seltsamen Ereignisse nur ein? Oder kann sie tatsächlich niemandem mehr trauen? Packend und erschreckend realistisch erzählt, stellt Louise Boije af Gennäs den Kampf einer jungen Frau gegen anonyme Kräfte ins Zentrum ihrer Widerstandstrilogie. In drei Bänden mischt sich das psychologische Verwirrspiel von "Girl on the train" mit den verschwörungstheoretischen Ansätzen der "Millennium"-Trilogie und macht Louise Boije af Gennäs' Werk zu einer einzigartigen Suspense-Reihe, die man erst dann aus der Hand legen kann, wenn Sara erfahren hat, was wirklich hinter all den seltsamen Ereignissen steckt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 593
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Sammlungen
Ähnliche
Louise Boije af Gennäs
BLUTBLUME
Thriller
Widerstandstrilogie Band 1
Aus dem Schwedischenvon Ulrike Brauns
Die schwedische Originalausgabe ist 2017 unter dem Titel Blodlokan bei Bookmark förlag, Schweden, erschienen.
Dieses Werk ist fiktiv und der Fantasie der Autorin entsprungen. Die wiedergegebenen Artikel sind jedoch echt, genau wie die bislang unaufgeklärten »Affären«, die sie zum Thema haben. Bitte beachten Sie, dass Realität und Fiktion in diesem Buch parallel existieren.
Das eBook einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Der Nutzer verpflichtet sich, die Urheberrechte anzuerkennen und einzuhalten.
1. eBook-Ausgabe 2019
© 2017 by Louise Boije af Gennäs
Published by agreement with Nordin Agency AB, Sweden
© 2019 der deutschsprachigen Ausgabe
Europa Verlag GmbH & Co. KG, München
Umschlaggestaltung: Hauptmann & Kompanie Werbeagentur, Zürich, unter Verwendung eines Designs von Elina Grandin
Lektorat: Antje Steinhäuser
Layout & Satz: Robert Gigler, München
Konvertierung: Bookwire
ePub-ISBN: 978-3-95890-291-6
Alle Rechte vorbehalten.
www.europa-verlag.com
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlags wiedergegeben werden.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von §44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Ansprechpartner für ProduktsicherheitEuropa Verlage GmbHMonika RoleffJohannisplatz 1581667 Mü[email protected]+49 89 18 94 [email protected]
Zur Erinnerungan meinen Vater, Hans Boije af Gennäs(1922–2007)
»Die Fantasie versetzt uns in die Lage, die Wirklichkeitwahrzunehmen, bevor sie eingetreten ist.«
Mary Caroline Richards (1916–1999)
INHALT
PROLOG
1. KAPITEL
2. KAPITEL
3. KAPITEL
4. KAPITEL
5. KAPITEL
6. KAPITEL
7. KAPITEL
8. KAPITEL
9. KAPITEL
10. KAPITEL
11. KAPITEL
12. KAPITEL
DANKSAGUNG
PROLOG
Der Schmerz war unerträglich. Er hatte eine Farbe: Außen rot, innen weiß, und er hatte sich in seinem Kopf festgesetzt. Es war unmöglich zu sagen, ob sein Körper noch mit seinem Gehirn verbunden oder einzelne Gliedmaßen abgetrennt worden waren. Der Geruch von Blut – seinem eigenen – war überwältigend und ekelerregend. Er würgte, aber in seinem Magen gab es nichts mehr, was er hätte erbrechen können.
Er verlor immer wieder das Bewusstsein, die Stimmen um ihn herum verschwanden, kehrten zurück. Sie sprachen eine Sprache, die er verstand, aber die Wörter wollten keinen Sinn ergeben. Trotzdem war ihm klar, was sie wollten: Er sollte kapitulieren und etwas preisgeben. Was er unmöglich tun konnte.
»… Sara.«
Der Name seiner Tochter ließ ihn leicht den Kopf heben, ein Stöhnen entwich seiner Kehle. Sofort folgte der weiß glühende Schmerz: Ein kräftiger Schlag gegen den Schädel. Das Rote breitete sich immer weiter aus und bedeckte nach und nach den weißen Kern.
Die beiden Männer betrachteten ihn: die nagellosen Finger, den Mund, in dem nun kein einziger Zahn mehr war, die zugeschwollenen Augen, die vielen Schnitt- und Brandwunden. Unter dem Tisch, neben zwei Elektroden, lag seine zerbrochene Brille. Der nackte Körper ruhte in unnatürlicher Haltung auf dem Tisch, nicht wiederzuerkennen nach den vielen Stunden der Folter.
Sie wechselten einen kurzen Blick, einer von ihnen nickte kurz.
Das Geräusch von einem Handy, das ein Foto schoss.
Der Geruch von Benzin: streng, beißend. Sein Gehirn wollte den Gedanken nicht verarbeiten, aber sein Körper reagierte trotzdem. Was sich noch in seinen Gedärmen befand, leerte sich auf den Tisch.
Heftiges Fluchen. Das Geräusch von leeren Blechkanistern, die draußen auf dem Hof auf das Pflaster schlugen. Dann Stille.
Bilder lösten sich in seinem Kopf ab.
Ein Ring.
Ein Siegel.
Ein Judaskuss.
»Leiste Widerstand.«
Dann die Familie: Elisabeths Hände; Saras Lächeln; Lina, die auf dem Pferd durch den Nebel eines sonnigen Herbstmorgens galoppiert.
Im nächsten Augenblick ein Blitz und eine Explosion, so heftig, dass sie alle Schmerzen, alles Leid und alle Farben, Gerüche und Gedanken auslöschte.
Etwas entfernt standen die beiden Männer und beobachteten die Flammen, die bis in den blassblauen Frühsommerhimmel schlugen. Rechts von ihnen – über den Baumkronen des Waldes – funkelte die Venus, der Abendstern. Nachdem sie einige Augenblicke lang den heftigen Brand betrachtet hatten, drehten die Männer sich um und gingen zu dem schwarzen Wagen, der unten am Weg geparkt war. Dahinter sprang gerade eine grau gestreifte Katze mit großen Sätzen quer über die Wiese und verschwand unter einer duftenden Traubenkirsche, deren Blüten weiß in der Dunkelheit leuchteten.
Dear Sir/Madam,
ich wende mich an Sie, weil Sie Chefredakteur oder verantwortlicher Herausgeber einer Zeitung oder eines anderen Pressekanals (Funk, Fernsehen oder internetbasiertes Medium) sind, und ich Sie respektiere. Im Anhang finden Sie Dokumente, und ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn Sie einen Blick darauf werfen würden.
Ich habe viel auf mich genommen, um dieses Material zusammenzutragen. Andere Menschen mussten leiden, anfangs ohne mein Wissen, um zu verhindern, dass es Sie erreicht. Deshalb wäre ich Ihnen sehr verbunden, wenn Sie sich die Mühe machten, alles auf seine Echtheit zu prüfen, bevor Sie es ad acta legen.
Dabei werden Sie herausfinden, dass alle Dokumente, die ich diesem Schreiben beigelegt habe, authentisch sind. Ich kann verstehen, dass das anfangs schwer vorstellbar ist, weil das Material so umfangreich, tiefschürfend und entlarvend ist für eine Vielzahl führender Persönlichkeiten. Es berührt nicht nur mein Land, sondern eine Vielzahl weiterer Nationen überall auf der Welt. Mir ist bewusst, dass die Veröffentlichung dieses Materials schwerwiegende Folgen für viele Menschen haben wird, nicht nur in Schweden. Unsere ökonomischen Systeme sind verzweigt und international. Selbst auf Verteidigungs-, Handelsoder Migrationsebene oder im Bereich Arbeitskraft und Umwelt wird kooperiert.
Ich hoffe, dass Sie sich nicht vom Umfang des Materials oder den eventuellen Konsequenzen von einer Publikation abhalten lassen, sondern es der Allgemeinheit zugänglich machen. Alle Mitbürgerinnen und Mitbürger haben das Recht, dies alles zu erfahren. Dies macht den Kern einer Demokratie aus, genauso des journalistischen Auftrags. Die Bevölkerung soll bestimmen. Aber ohne Wissen und Information kann niemand eine bewusste Wahl treffen.
Eine Spur zu mir werden Sie nicht finden. Ich hingegen werde voller Zuversicht darauf warten, dass das Material in den Medien auftaucht.
Vielleicht sollte ich noch anmerken, dass ich das gesamte Material gleichzeitig an Redaktionen auf der ganzen Welt geschickt habe. Manche werden es sicher sofort ablehnen, anderen wird ein Maulkorb verpasst. Trotzdem hoffe ich sehr, dass es jemand wagt, der Erste zu sein, der alles veröffentlicht …
1. KAPITEL
»So«, sagte die kleine, rundliche Dame und öffnete die Tür, »und hier wohnen Sie.«
Ich schaute in ein minimalistisch eingerichtetes Schlafzimmer und spürte sofort, wie sich meine mühsam zusammengeraffte gute Laune verabschiedete. Ein schmales Bett auf vier Beinen, darauf ein orangefarbener, gestreifter Überwurf aus dünner Baumwolle. Er erinnerte mich sofort an unseren Überwurf im Sommerhaus, der aus den frühen Siebzigern stammte. Mein Zimmer in dem Studentenwohnheim in Uppsala vom letzten Jahr wirkte mit einem Mal geradezu luxuriös.
Neben dem Bett stand ein Nachttisch, und meine Vermieterin war bereits dort und ruckelte an der Schublade.
»Sie ist etwas schwergängig«, erklärte sie, »aber sie funktioniert. Das Bad liegt draußen im Flur, und Sie teilen es sich mit zwei anderen Bewohnern. Nutzen Sie bitte keinen Föhn dort drin.«
Die Dame – eigentlich passte Mütterchen besser – hatte sich als Siv vorgestellt. Jetzt verschwand sie schon wieder hinaus in den Flur, und ich folgte ihr nach einem letzten Blick in mein zukünftiges Zimmer. Die Deckenlampe hatte einen runden Papierschirm, und auf dessen Boden, direkt unter der Glühbirne, war ein großer schwarzer Fleck – tote Fliegen? Auf dem Linoleumboden vor dem Bett lag ein Flickenteppich, auf dem jetzt die Katzentransportbox und meine rote Reisetasche standen. Am Fenster fanden sich ein abgenutzter Sessel und daneben eine Kommode mit drei Schubladen. Zudem gab es einen schmalen Schrank mit Drehknauf.
Siv hielt die Badezimmertür auf, und ich ging an ihr vorbei hinein. Es gab eine altmodische hellblaue Wanne mit einem sehr dreckigen Duschvorhang, eine Toilette mit gesprungener Plastikbrille, ein Waschbecken mit einer Armatur aus den Siebzigern (blauer Punkt für kalt, roter Punkt für warm). Blutrotes PVC auf dem Boden.
Sie deutete auf eine nicht geerdete Steckdose.
»Wer weiterleben will, lässt die Finger davon, sage ich immer.«
Sie lächelte über sich selbst, und ich folgte ihr wieder hinaus in den Flur.
»Bleibt noch die Kleinigkeit namens Miete«, sagte sie. »Sechstausendfünfhundert Kronen will ich pro Monat, im Voraus und in bar.«
»Hatten wir uns nicht auf sechstausend geeinigt?«, fragte ich.
Siv kräuselte die Lippen.
»Doch, aber Sie bringen ja eine Katze mit. Da ist mit Schäden und Problemen zu rechnen. Fünfhundert will ich extra, für die Katze.«
Ich seufzte und holte einen Umschlag aus den Untiefen meiner Handtasche, außerdem fischte ich noch einen Schein aus meinem schmalen Portemonnaie. Siv riss den Umschlag auf und zählte gierig die Fünfhunderter. Und genau da, im Schein der Neonröhre, wurde mir bewusst, dass ich mitten in der Stockholmer Wohnungsnot angekommen war. Solange ich zurückdenken konnte, hatte ich mich danach gesehnt: endlich mit dem Studium fertig sein; Uni und Kleinstadt hinter mir lassen; in die Hauptstadt ziehen. Jetzt war ich endlich hier. Der Herbst hatte gerade eingesetzt. Mein neuer Job wartete. Aber nichts passte, alles war falsch; nichts war, wie ich es mir erhofft hatte. Und ein Gefühl von Machtlosigkeit wuchs in mir.
Siv schaute mit bösen kleinen Augen von dem Geldbündel auf.
»Stimmt genau«, sagte sie. »Sie haben ein Fach im Kühlschrank, den ich Ihnen gezeigt habe. Essenszubereitung zwischen 17 und 19 Uhr, da müssen Sie sich mit den anderen beiden Bewohnern absprechen. Danach will ich meine Ruhe.«
»Und das WLAN?«, fragte ich. »Deckt die Miete das ab?«
»Bis 21 Uhr«, antwortete Siv. »Danach will ich es allein nutzen.«
»Okay«, sagte ich. »Nur noch eine Frage: Könnte ich das auch überweisen? Dann muss ich nicht extra welches abheben.«
Siv bedachte mich mit einem messerscharfen Blick.
»Wenn Sie ein Problem mit Bargeld haben, müssen Sie sich eine andere Bleibe suchen.«
»Verstehe«, sagte ich.
Sie ließ mich stehen und ging die Treppe runter. Durch das Fenster am anderen Ende des Flurs konnte ich Teile von Vällingby Centrum sehen. An die großen Kreise aus weißen Pflastersteinen konnte ich mich noch aus meiner Kindheit durch die Besuche bei Oma und Opa erinnern. Das sogenannte ABC-Stadt-Programm. Die Steine gab es noch, das Programm nicht mehr. Genauso wenig Oma und Opa.
Eine Erinnerung an meinen Wehrdienst: drei Stunden Schlaf; unebener Boden unter der dünnen Isomatte; ein irrer Sergeant, der laut die bevorstehende Visitation um fünf Uhr ankündigte. Kein Zuckerschlecken. Warum fühlte sich das hier also unendlich viel anstrengender an?
»Es wird dir guttun, nach Stockholm zu kommen«, hatte meine Mutter gesagt. »Anfangs wirst du dich wohl mit der Untermiete zufriedengeben müssen, aber das wird ja nicht ewig so bleiben. Irgendwann wirst du was Eigenes finden.«
Ich kehrte in mein Zimmer zurück und setzte mich auf das Bett mit dem orangefarbenen Überwurf. Erinnerungen lösten einander ab, begleitet vom üblichen Stechen in der Magengegend aus Sehnsucht nach meinem Vater: jener Abend, als er die Zusage bekommen hatte. Ich muss acht gewesen sein und Lina ungefähr zwei. Ich wusste nicht viel über das, was mein Vater so machte, aber hatte begriffen, dass vielleicht ein neuer Job in Aussicht stand. Und dann war es offensichtlich: Mama und Papa strahlten, Papa brachte frische Krabben zum Abendessen mit, und wir saßen bei brennenden Kerzen in der Küche und feierten. Mama und Papa tranken Weißwein statt Bier, und wir durften mit Limo anstoßen, obwohl nicht Wochenende war. Papa würde für die angesehene Behörde für internationale Entwicklungszusammenarbeit, Sida, arbeiten und nach Stockholm pendeln und viel ins Ausland reisen.
»Wirst du dann jetzt die Welt retten, Liebling?«, hatte Mama gefragt und ihm über die Wange gestreichelt.
Die Welt retten, hatte ich gedacht, das wusste ich noch. Sofort hatte ich James Bond, dem gefährliche Bösewichte dicht auf den Fersen waren, mit gezogener Pistole vor mir gesehen.
»Ich werde es auf jeden Fall versuchen«, hatte Papa lächelnd geantwortet.
»Ist es denn sehr gefährlich?«, hatte ich gefragt, woraufhin Mama und Papa in schallendes Gelächter ausbrachen.
Auch Lina hatte gelacht und mit dem Löffel auf den Tisch geschlagen: »Fährlich! Fährlich!«
»Nein, mein Schatz«, hatte Papa geantwortet, »es ist überhaupt nicht gefährlich. Ich versuche, Gutes zu tun, mehr nicht. Wir leisten Entwicklungshilfe, unterstützen die Menschen, die es in anderen Ländern am schwersten haben.«
Das klang toll, auch wenn ich nicht wusste, was das lange Wort bedeuten sollte, das er da gesagt hatte. Aber ich fragte nicht weiter nach, sondern widmete mich stattdessen den Krabben.
Ein lang gezogenes Miauen holte mich zurück ins Jetzt. Simåns wollte raus, also schloss ich die Tür zum Flur und öffnete die Box.
»Simåns«, sagte ich, »jetzt sind wir angekommen. Hier werden wir wohnen, du und ich.«
Simåns strich durch das Zimmer und beschnupperte die fremden Gegenstände. Dann sprang er aufs Bett und betrachtete mich aus seinen klugen, grünen Augen. Plötzlich gähnte er, und ich konnte direkt in den rosa Schlund mit der rauen Zunge und den nadelspitzen, kreideweißen Zähnen sehen.
Wildtier.
»Du bist ein Wildling, Simåns«, sagte ich und kraulte ihn hinterm Ohr.
Simåns streckte sich und zuckte mit dem Schwanz. Dann kringelte er sich auf dem Überwurf zusammen und schlief ein.
Ich schlief schlecht in dem schmalen Bett, Mondlicht fiel durch die Lücken im Vorhang herein. Wie in den gesamten vergangenen sechs Monaten tauchte ich immer wieder aus dem Schlaf auf. Es war schwer, zwischen Traum und Wirklichkeit zu unterscheiden. Für einen Moment dachte ich, dass meine Tür lautlos geöffnet wurde und das Licht im Flur sich teilte, als stünde dort jemand und würde mich betrachten. Aber als ich mich nach wenigen Augenblicken etwas benebelt aufsetzte, war die Tür geschlossen, und das Zimmer lag im gleichen Halbdunkel wie zuvor.
Am nächsten Morgen klingelte mein Wecker um sieben Uhr. Im selben Moment kam eine SMS von meiner Mutter.
»Wie geht es dir, mein Schatz? Alles in Ordnung?«
»Alles super«, antwortete ich. »Auf den Beinen und unterwegs zur Arbeit.«
Sie schickte mir ein lächelndes Emoji, und ich ging ins Bad, um zu duschen. Die Tür war abgeschlossen, und drinnen rauschte Wasser. Also kehrte ich in mein Zimmer zurück und suchte, um die Wartezeit zu überbrücken, zusammen, was ich für den Tag brauchen würde. Eine Viertelstunde später war das Bad immer noch besetzt, und mir ging langsam die Zeit aus. Weitere fünf Minuten später klopfte ich an die Tür. Sie wurde sofort geöffnet, und ein Mittdreißiger mit langem Oberlippenbart kam zum Vorschein. Er sah verschlafen und wütend aus, die Augen zu schmalen Schlitzen gezogen, und er trug einen blauen Bademantel. Um den Hals hing ein rosa Handtuch mit hellblauen Elefanten, worüber ich unfreiwillig lächeln musste. Mein Lächeln stimmte ihn nicht gerade freundlicher.
»Ich dusche immer um sieben!«, sagte er mit Nachdruck. »Bitte respektieren Sie das!«
»Selbstverständlich«, sagte ich. »Entschuldigung. Mein Name ist Sara, ich bin gerade eingezogen. In das Zimmer am Ende des Flurs.«
Er musterte mich von Kopf bis Fuß und schien wenig beeindruckt von dem, was er sah.
»Jalil«, sagte er abweisend. »Ich komme aus Marokko.«
»Spannend«, sagte ich. »Wie lange sind Sie schon in Schweden?«
Ein weiterer, vernichtender Blick, soweit man das durch die fast zusammengekniffenen Augen beurteilen konnte.
»Lange genug, um zu wissen, dass man sich morgens um sieben Uhr noch nicht unterhalten muss«, sagte er und rauschte dann in seinem Bademantel davon. Ich schaute ihm nach. Er hatte absolut recht.
Der Bus nach Spånga kam pünktlich, aber die S-Bahn nach Sundbyberg hatte Verspätung, zudem wehte auf dem Bahnsteig ein eiskalter Wind. Etwa zehn weitere Passagiere standen außer mir dort und warteten, alle mucksmäuschenstill. Die meisten hörten Musik oder starrten auf ihre Handys. Ich seufzte laut und vertiefte mich dann selbst in die Internetseite des Aftonbladet.
Eine Viertelstunde später tauchte die S-Bahn endlich auf, proppenvoll. Wir konnten uns alle noch hineinzwängen, aber ob ich an meinem ersten Arbeitstag pünktlich sein würde, war mehr als fraglich. Kaum in Sundbyberg, sprang ich aus der Bahn und rannte zwischen den hohen Häusern hindurch, bis ich endlich das Café auf der anderen Seite eines kleinen Platzes entdeckte. Ich war derart außer Atem, als ich hineingeprescht kam, dass ich kaum sprechen konnte.
Zwei Frauen um die fünfzig arbeiteten bereits auf Hochtouren, die eine hatte schwarz gefärbte Haare, die andere war blondiert. Die Blondine war ein bisschen übergewichtig, die Schwarzhaarige schlank wie ein Spargel.
»Soso«, sagte die Schwarzhaarige und warf mir einen Blick zu, während sie den Serviettenhalter an der Theke nachfüllte. »Pünktlichkeit ist das A und O in der Gastronomie.«
»Entschuldigung«, keuchte ich. »Die S-Bahn … kam eine Viertelstunde zu spät.«
»So ist das immer in Stockholm«, sagte die Blondine, lächelte und stützte sich auf den Besen. »Man muss viel Zeit einplanen.«
Sie kamen beide auf mich zu.
»Eva«, sagte die Schwarzhaarige und streckte mir die Hand entgegen.
»Gullbritt«, sagte die Blondine, und ich musste ein breites Grinsen unterdrücken.
Wie sollte sie auch sonst heißen.
»Na, dann!«, sagte Eva, band sich eine Schürze um und warf mir auch eine zu. »Hast du schon mal in einem Café gearbeitet?«
»Nein, leider nicht«, antwortete ich unbeholfen. »Aber das habe ich doch in der Mail geschrieben.«
»Familie?«
»Mutter und eine kleine Schwester. Mein Vater ist letztes Frühjahr in unserem Sommerhaus umgekommen.«
Keine Reaktion, außer dass Eva mich auffordernd ansah. Ich fühlte mich plötzlich unsicher, weshalb ich einfach weitersprach, obwohl mir nicht danach war.
»Die Polizei glaubt, er hatte einen Schlaganfall oder Herzinfarkt«, fuhr ich fort. »Außerdem gab es ein Problem mit dem Gasherd. Es kam zu einem Großbrand. Das ganze Haus fackelte ab, und mein Vater … ja, er kam nicht rechtzeitig heraus. Man konnte nicht mehr feststellen, ob er schon tot war, als das Feuer ausbrach, oder …«
Ich schluckte. Gullbritt schaute mich mitleidig an, während Eva mich aus schmalen Augen betrachtete. Sie schien mir nur so gerade zu glauben.
»Heftig«, sagte sie knapp. »Und es war sicher ein Unfall?«
»Jetzt halt dich mal zurück«, zischte Gullbritt und wandte sich dann an mich. »Du Arme!«
»Was hast du denn dann die ganze Zeit seit dem Schulabschluss gemacht?«, fragte Eva. Ich schluckte noch einmal.
»Direkt nach der Schule erst einmal eine militärische Grundausbildung, danach noch die Offiziersausbildung. Anschließend habe ich in Uppsala studiert. B.A. in Politikwissenschaft und Volkswirtschaft.«
Eva betrachtete mich weiter voller Misstrauen.
»Und was machst du dann hier, nach einer so tollen Ausbildung?«
»Jetzt beruhig dich, Eva, du weißt doch, wie schwer es die Jugend heute hat, eine Anstellung zu finden«, sagte Gullbritt und schob mich vor sich her in die Küche. »Jetzt fängst du erst mal an, Kartoffeln zu schälen.«
Zwanzig Minuten später türmte sich ein Berg frisch geschälter Kartoffeln neben mir auf dem Tisch. Darunter wartete jedoch noch ein weiterer riesiger Sack auf den Einsatz des Sparschälers. Ich schaute aus dem Fenster. Ein Stückchen Himmel ließ sich zwischen zwei hohen Gebäuden erahnen. Er war grau, dunkle Wolken jagten vorbei. Um mich aufzumuntern, schickte ich meiner kleinen Schwester eine Snapchat-Nachricht, ein Bild von mir mit tapferem Lächeln, auf dem ich den Daumen in die Luft recke, im Hintergrund der Kartoffelberg und der dunkelgraue Himmelsfitzel. Work, bitch!, schrieb ich auf das Bild.
Gullbritt war neben mir aufgetaucht.
»Ich hab doch gesagt, du sollst die Spülhandschuhe anziehen«, sagte sie. »Sonst bekommst du sofort Blasen am Daumen.«
Seufzend ließ ich das Telefon in der Schürze verschwinden und tat wie mir geheißen. Im selben Moment rumste es laut hinter mir, ich drehte mich um. Dort stand Eva mit einem breiten Grinsen, sie hatte einen neuen Sack auf den Tisch gewuchtet.
»Möhren!«, sagte sie auffordernd. »Mit denen kannst du gleich weitermachen, wenn du mit den Kartoffeln fertig bist.«
Mein Handy piepste. Lina hatte mit einem Bild von sich und ein paar Klassenkameraden geantwortet, die heftige Grimassen zogen. Zeitalter der Revolution, stand auf dem Foto. Ich musste lächeln. Lina sah endlich wieder zumindest ein bisschen fröhlich aus.
Der Tag wollte nicht enden. Erst ewig Gemüse schälen, dann kochen, kassieren und unfassbare Mengen an dreckigem Geschirr bewältigen. Es gab einen doppelstöckigen Geschirrspüler, der nonstop lief, aber alle großen Gefäße mussten von Hand gereinigt werden. Um achtzehn Uhr durfte ich mich endlich nach Hause schleppen, und da war es draußen schon dunkel. Ich hatte viel zu viele Stunden am Stück gearbeitet, wenn man unsere vertragliche Vereinbarung zugrunde legte, aber es schien nicht der richtige Moment zu sein, das anzusprechen.
Der Bus nach Vällingby hatte Verspätung, und als er endlich auftauchte, hielt er nicht, weil er schon überfüllt war. Erst um zwanzig vor sieben betrat ich das Reich von Siv, die ein Kleid mit Blumenmuster trug und mich mit einem bittersüßen Lächeln im Flur erwartete. Ihre Dauerwelle sah frisch aus. Vielleicht hatte sie meine erste Monatsmiete direkt zu einem Friseur nach Vällingby Centrum getragen.
»Ihnen bleiben noch zwanzig Minuten, sich etwas zu kochen«, sagte Siv. »Danach will ich die Küche für mich haben!«
In der Küche stand Jalil, der marokkanische Schnurrbartträger, in einem hellgrünen Hemd und knallroter Hose. Er hatte drei der vier Herdplatten belegt und bedachte mich mit einem vielsagenden Blick, als ich hereinkam.
»Ich koche abends immer …«, setzte er an, doch ich unterbrach ihn.
»Ja, ja«, sagte ich leicht säuerlich. »Würdest du vielleicht trotzdem ein bisschen Platz machen, damit ich Nudelwasser aufsetzen kann?«
Noch so ein Blick, den ich einfach ignorierte. Ich holte einen Topf aus dem Schrank, füllte ihn mit Wasser, stellte ihn auf den Herd und drehte voll auf. Ich musste mich heute also mit Spaghetti, Butter und Ketchup zufriedengeben.
Mal wieder.
Da lag ein langer Herbst vor mir.
»Hattest du einen schönen Tag?«, presste ich hervor und lehnte mich an den Tisch, während ich darauf wartete, dass das Wasser zu kochen anfing.
Zu meiner großen Verwunderung lächelte Jalil mich breit an, und da erst fiel mir auf, was für schöne Augen er hatte. Er pikte etwas mit der Gabel aus der Pfanne und reichte sie mir.
»Entschuldige, dass ich heute Morgen so grantig war«, sagte er. »Ich bin alles andere als ein Morgenmensch, da komme ich ganz nach meiner Mutter. Die spricht niemand vor Mittag an. Gebratene Paprika mit Chili und Kumin. Nimm dir ein Stück Brot, das ist ganz schön scharf.« Ich lächelte zurück.
»Das klingt perfekt«, sagte ich und nahm die Gabel entgegen. »Scharf ist genau das, was ich brauche.«
Jalil hatte recht: Es war sehr scharf. Ich rupfte etwas von dem Brot ab, das in einer Schale auf der Spüle stand, und wollte es mir gerade in den Mund stecken, als Jalil sich wieder zu mir umdrehte. Blitzschnell schlug er mir gegen die Hand, sodass das Brot auf den Boden fiel.
»Was soll das?«, fragte ich schockiert. »Du hast doch gesagt …«
»Doch nicht das Brot!«, zischte Jalil mit einem Blick zur Tür. »Das ist von der Ollen! Die anderen hier sagen, dass sie da Rattengift reinsteckt und es in den Keller legt. Pass bloß auf, dass deine Katze da niemals hingeht!«
Rattengift? In der Küche? Wo war ich denn hier gelandet?
»Das Baguette auf dem Tisch ist von mir«, sagte Jalil. »Nimm dir was davon.«
»Danke, das ist nicht nötig«, erwiderte ich matt. »Ich bleibe lieber bei der Pasta.«
Nachdem ich gegessen, Simåns gefüttert und eine Runde mit ihm an der Leine gedreht hatte, rief ich meine Mutter an. Sie hob direkt ab.
»Wie geht es dir?«, fragte sie.
»Och, na ja«, sagte ich und spürte plötzlich, wie entmutigt und verzweifelt ich war. »Tja … wo soll ich anfangen? Irgendwie ist es schon komisch. Hatte nicht gedacht, dass ich ausgerechnet hier landen würde, als ich ein A für meine Examensarbeit bekam.«
»Nicht landen«, betonte Mama. »Zwischenlanden! Das ist ein Unterschied.«
»Vielleicht«, erwiderte ich.
»Fang mal von vorn an«, forderte Mama. »Was ist komisch?«
Also erzählte ich von meinem ersten Tag in Stockholm, und Mama lachte und stöhnte abwechselnd. Das Rattengift erwähnte ich nicht; meine Mutter machte sich schon genug Sorgen.
»Warst du denn wenigstens schon in der Innenstadt?«, fragte sie. »Ich weiß doch, wie sehr du dorthin willst. Aber du hältst dich von der Drottninggatan fern, so wie du’s versprochen hast, ja? Und keine Kopfhörer in den Ohren, vergiss das nicht!«
»Mama«, sagte ich geduldig. »Die Drottninggatan ist jetzt vermutlich die sicherste Straße in ganz Stockholm. Meinst du allen Ernstes, dass die zweimal den gleichen Ort nehmen würden?«
»So abwegig ist das gar nicht«, entgegnete sie.
»Dann vergiss du bitte nicht, dass ich beim Militär war«, sagte ich. »Sogar Feldwebel.«
»Wie genau schützt dich das vor einem verrückten Selbstmordattentäter oder einem rasenden Lastwagen?«, fragte sie.
Oder einem kaputten Gasherd in einem ganz gewöhnlichen Sommerhaus, hätte ich erwidern können. Aber ich ließ es bleiben.
Stattdessen musste ich feststellen, dass jemand nebenan den Fernseher eingeschaltet hatte. So laut, dass man jedes einzelne Wort verstehen konnte. Ich seufzte und ging in die entgegengesetzte Ecke meines Zimmers. Aber es machte keinen Unterschied.
»Was ist denn da plötzlich so laut?«, fragte Mama. »Hast du den Fernseher angemacht?«
»Nein«, antwortete ich. »Der Nachbar auf der anderen Seite der Wand.«
Wir schwiegen einen Moment. Der Moderator sprach von der Problematik, dass immer mehr Kinder Allergien entwickelten. Mein Nachbar gähnte laut, und ich hätte schwören können, dass ich sogar hören konnte, wie er sich kratzte.
»Wie sieht es in dir aus?«, fragte Mama.
»Unverändert«, antwortete ich. »Und in dir?«
»Ich finde das immer noch so unwirklich«, sagte sie. »In einer Woche muss ich wieder an die Uni, dann läuft meine Krankschreibung aus. Aber ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll.«
Mama war Bibliothekarin und hatte eine Zeit lang Literaturwissenschaften studiert. Sie arbeitete seit vielen Jahren für die Hauptbibliothek der Universität Örebro, sprang aber manchmal als Vertretung ein, um Vorlesungen in Literatur- oder Filmwissenschaften zu halten. Sie liebte das Lesen, besonders der Klassiker, und hatte der gesamten Familie die Augen für die Literatur geöffnet. Sie hatte mir Charles Dickens und Sofi Oksanen in die Hände gedrückt, und dank ihr hatten wir genauso gern Filme von Alfred Hitchcock oder Woody Allen gesehen wie Fernsehserien wie Homeland oder Modern Family.
»Es ist wichtig, dass du arbeiten gehst«, sagte ich. »Du musst wieder in die Spur kommen.«
Mama seufzte.
»In der Theorie klingt das ja auch toll. Aber heute stand ich im Supermarkt und hatte keine Ahnung, warum ich dort war. Mir war klar, dass ich einkaufen wollte, aber ich konnte den Einkaufszettel nicht finden und mich nicht daran erinnern, was ich brauchte. Und dann wollte ich deinen Vater anrufen … In dem Moment war mir klar, dass ich nach Hause musste. Ich bin mir einfach nicht sicher, ob ich das mit der Arbeit schon wieder hinbekomme.«
Mein Nachbar stellte den Fernseher leiser. Nahm offenbar sein Telefon zur Hand und rief jemanden an. Es klang so, als stünde er mitten in meinem Zimmer, und ich versuchte, das Mikro meines Handys abzudecken.
»Hey, Tompa«, sagte er laut. »Hier ist Sixten …! Ja, Scheiße, oder …?«
Mehrere Sekunden Stille.
Ich dachte nach.
»Ich kann wieder nach Hause kommen und dich unterstützen«, sagte ich. »Was ich hier mache, ist sowieso völlig sinnfrei.«
»Nein«, sagte Mama mit Nachdruck. »Ich will, dass du in Stockholm bleibst und dein Leben anfängst. Nach dem, was im Winter passiert ist, hast du …«
Sie zögerte.
»Ein bisschen neben dir gestanden«, vollendete ich den Satz.
»Nein, aber es ist einfach verdammt viel auf der Arbeit, du weißt ja, wie das ist«, sagte Sixten.
»So könnte man es nennen«, sagte Mama. »Und dann dazu noch das mit Papa. Du musst weg von zu Hause, das spüre ich. Sonst bleibst du in der Trauer hängen.«
Ganz wie du, dachte ich, sprach es aber nicht aus.
»Wie geht es Lina?«, fragte ich. »Ist sie im Stall?«
»Ja«, sagte Mama. »Und gerade für sie ist es wichtig, dass du und ich weitermachen. Sonst droht die nächste Depression.«
Lina, meine geliebte, pferdeverrückte Schwester. Ich sah sie vor mir, wie ich sie immer im Gedächtnis hatte: eine charmante, freche Zwölfjährige mit Lachgrübchen und blondem Pony, der unter der Reitkappe hervorlugte, ein kleiner Mensch, der fast alles tun würde, um andere froh zu machen, egal ob Mensch oder Tier. Lina riss es zwischen extremen Gefühlen hin und her: Freude und Verzweiflung, Hoffnung und Resignation, aber brachte man sie zum Lachen, kam sie sofort wieder in die Balance. Zwischen uns lagen sechs Jahre, mittlerweile war Lina jedoch keine kleine Mittelstufenschülerin mehr – sie war achtzehn Jahre alt und im letzten Jahr am Gymnasium. Im Herbst hatte sie mit den Vorbereitungen für die Schwedischen Meisterschaften im Vielseitigkeitsreiten begonnen, aber nach Papas Tod und allem Drumherum hatte sie aufgehört zu trainieren und war in eine Depression verfallen. Es war uns gerade erst geglückt, sie wieder in den Sattel zu setzen, insofern verstand ich sehr gut, was Mama meinte.
»Aber ich dachte halt, scheiß drauf. Es wird wirklich Zeit, Tompa wiederzusehen und ein Bierchen zusammen zu trinken«, brüllte Sixten nebenan.
Er klang sehr überzeugend.
»Wer schreit denn da so?«, fragte Mama. »Hast du Besuch?«
»Nein, das ist mein Nachbar im Zimmer nebenan«, erklärte ich. »Ist ziemlich hellhörig hier.«
»Klingt nicht gut«, sagte Mama. »Ich mache mir trotz allem ein bisschen Sorgen. Ich habe mit Björn gesprochen, und er war auch betrübt über deine Situation.«
Björn war einer von Papas Kollegen, der über die Jahre zu einem Freund der Familie geworden war. Eigentlich war er ein ziemlicher Playboy, aber nach Papas Tod hatte er sich sehr für uns eingesetzt. Trotzdem fand ich es nicht gerade toll, dass ich Thema zwischen ihr und Björn war.
»Warum sprichst du mit Björn über mich?«, fragte ich. »Er hat doch nichts mit mir zu tun.«
»Björn will nur das Beste für dich und Lina«, sagte Mama. »Er war eine wunderbare Hilfe, das musst du zugeben.«
Nachdem Papa in unserem Sommerhaus verbrannt und die Familie zusammengebrochen war, hatte Björn das Ruder übernommen und sich um alles Schwierige gekümmert: die Identifizierung; den Kontakt mit der Polizei; die Traueranzeige in der Zeitung; die Beerdigung.
»Genau wie Fabian«, fuhr Mama fort. »Ich bin so dankbar dafür, dass die alten Freunde deines Vaters uns unterstützen und noch immer an dich und Lina denken. Meiner Meinung nach sollten wir so viel Hilfe und Unterstützung annehmen, wie wir können!«
Fabian war Papas bester Freund aus Studienzeiten und ihm viel ähnlicher, sowohl was das Aussehen als auch die Persönlichkeit anging. Das machte es leichter, ihm nahezukommen, auch wenn er etwas direkter sein konnte als Björn.
»Björn möchte dich zum Mittagessen einladen«, fuhr Mama fort. »Und über deine Zukunft sprechen.«
»Nein«, sagte ich bestimmt. »Ich habe gerade keine Lust, einen von ihnen zu treffen.«
»Aber Sara …«, tadelte Mama.
»Warum denn nicht jetzt sofort?«, brüllte Sixten. »Verdammte Olle …!«
Er lachte heiser, aber laut durch die Wand. Es klang, als stünde er direkt neben mir.
»Mach dir um mich keine Sorgen«, sagte ich. »Ich komme schon klar, bin schließlich Ex-Militär, schon vergessen? Ich schaff das.«
»Du klingst genau wie dein Vater«, sagte Mama, ich konnte richtig hören, dass sie lächelte.
Eine Sekunde später brach sie in Tränen aus.
»Mama«, sagte ich hilflos.
»Und wie ist es mit Mittwoch?«, dröhnte Sixten. »Oder Donnerstag? Sag ihr, dass es scheißwichtig ist.«
»Alles in Ordnung«, nuschelte Mama. »Das geht vorbei.«
Darauf konnte ich nichts erwidern, wünschte mir einfach nur, sie in den Arm nehmen zu können.
Und dass dieser verdammte Tompa sich auf ein Treffen mit Sixten am Donnerstag einließ, damit ihr nervtötendes Telefonat endlich ein Ende fand.
Spät am Abend, als bei Sixten endlich Ruhe eingekehrt und ich fast eingeschlafen war, piepste mein Handy. Eine SMS von Mama.
»Habe mit Björn und Fabian gesprochen. Fabian wollte wissen, wie es dir geht und was du machst. Ich hab ihm vom Café erzählt, und jetzt glaube ich, dass er vorbeischauen wird. Das ist doch wirklich nett von ihm!«
Ich fluchte leise. Ich wollte keinen Besuch im Café, wollte nicht das geringste bisschen Aufmerksamkeit, bis ich aus der sonderbaren Blase aufgetaucht war, die mich umgab, seit an einem sonnigen Vormittag Ende Mai die Polizei vor der Tür stand. Und bereits lange davor. Aber das konnte ich Mama nicht erzählen. Wenigstens war Fabian ein bisschen besser als Björn.
»Super«, schrieb ich zurück.
»Und Björn möchte sich sehr gern mit dir in der Stadt treffen. Bitte, Sara! Tu’s für mich!«
Ich murrte leise.
In dem Moment kam fast das gleiche Murren von der anderen Seite der Wand. Ich blieb wie versteinert im Bett liegen, bis ich verstand, was es war: Sixten schnarchte.
Ich legte das Handy auf den Boden, zog das Kissen über den Kopf und versuchte zu schlafen.
Es war schwer, Mama etwas abzuschlagen, besonders jetzt; also fuhr ich Samstagvormittag in die Stadt, um Björn zu treffen. Es war die erste Gelegenheit, mich in die Stadt zu begeben, und Mama hatte völlig recht: Was hatte ich diesen Tag herbeigesehnt. Deshalb plante ich großzügig Zeit ein. Björn und ich waren um ein Uhr verabredet, aber schon um halb zwölf verließ ich die U-Bahn-Station Stureplan und schlenderte über den Platz. Der Pilz sah aus wie bei all meinen früheren Stockholmbesuchen, aber das Gefühl war ein anderes: Das war jetzt meine Stadt, ich wohnte hier. Nicht direkt am Stureplan, sondern in Vällingby, achtzehn U-Bahn-Stationen entfernt, aber immerhin.
Ich stellte mich unter den Pilz und beobachtete die Leute um mich herum. Überall coole, gut gekleidete, schöne Menschen, und ich musste an den Comedian Jim Jefferies denken, der mal gefragt haben soll: »Töten die Schweden eigentlich ihre hässlichen Babys?«
Rechts von mir lag der Sturehof mit seiner voll besetzen Terrasse. Ich machte mich auf den Weg dorthin und warf einen Blick auf die Speisekarte. Gedünsteter Saibling für 320 Schwedische Kronen. Gegrillter Mälarzander für 360 Kronen. Steinbutt für 485 Kronen. Das konnte ich mir unter keinen Umständen leisten. Ich stöhnte leise, versuchte, unbeeindruckt zu wirken, und ging weiter.
Ich ließ die Einkaufspassage Sturegallerian rechts liegen. Hundert Meter weiter lag das Trendrestaurant Brillo, von dem ich gelesen hatte. Auch hier war die Terrasse stark frequentiert, aber davon ließ ich mich nicht beeindrucken. Mit dem Rücken zum Restaurant hielt ich das Handy vor mich, achtete darauf, dass das bunte TAVERNA-Schild gut zu erkennen war, lächelte breit und drückte auf den Auslöser. Eine schöne Aufnahme von mir, lächelnd und mit Sonnenbrille vor einem der angesagtesten Lokale Stockholms, tauchte auf dem Display auf. Ich musste sie sofort bei Instagram teilen und schrieb noch darunter: »Eeeeendlich in Stockholm! Jetzt fängt mein neues Leben an!«
Dann setzte ich mich an einen der Tische und versuchte, so auszusehen, als hätte ich nie etwas anderes getan, als Kaffee bei Brillo in der Sonne zu trinken. Der Typ am Nebentisch lehnte sich lächelnd zu mir und sagte: »Neu in der Stadt?«
»Ist es so offensichtlich?«, fragte ich verlegen.
Die Bedienung kam, und ich bestellte einen einfachen Kaffee. Unter meinem Instagrambild wuchs die Zahl der Likes, auch Kommentare kamen dazu: »Ooooh, Glückspilz!«, von Lina, »Coole Sara«, schrieb meine Freundin Sally und »Wünschte, ich wäre auch da« Flisan. Dann wurde es wieder still.
Ich lehnte mich zurück. Der Typ neben mir war weg, stattdessen nahmen ein paar hübsche Mädels den Tisch in Beschlag. Sie steckten von Kopf bis Fuß in exklusiven Markensachen, Modell »Gammel-Samstag«: Trainingshose von Nike, Tigerpulli von Kenzo. Ihre Jacken waren garantiert von Moncler, die Schuhe Vans oder Adidas. Ich zog langsam meine Füße mit den abgetragenen Chucks unter den Stuhl.
Eine Woge von Einsamkeit überkam mich. Wem wollte ich denn eigentlich etwas vormachen? Meine neue Bleibe in Stockholm bestand aus einem gemieteten Zimmer bei einer unheimlichen Alten in Vällingby und mein spannender Job daraus, in Sundbyberg als Kartoffelschälerin zu schuften. Ich ließ mein Leben in den sozialen Medien besser erscheinen, als es in Wirklichkeit war; warum, konnte ich nicht mal sagen. Ich wollte nicht, dass andere mich bemitleideten, sondern sehnte mich nach echter Gemeinschaft, so wie ich sie beim Militär erlebt hatte.
Aber diese Zeit war vorbei. Jetzt saß ich bei Brillo, zwischen den Schönsten Stockholms, die sicher sowohl am Stureplan wohnten als auch arbeiteten. Ich hingegen hatte eine inzwischen kalt gewordene Tasse Kaffee vor mir und wagte nicht mal, die Bedienung zu bitten, mir nachzuschenken.
Um ein Uhr stand ich auf der Treppe vor dem Theater Dramaten und wartete auf Björn. Ich war zu früh und Björn wie immer genau pünktlich. Papa hatte darüber oft gescherzt, als sie Kollegen waren: dass man die Uhr nach Björn stellen konnte und dass das einer der Gründe für sein beispielloses berufliches Vorankommen bei verschiedenen Behörden war. Mein Vater und Björn hatten sich früh durch den Job kennengelernt und seither den Kontakt gehalten, ohne dass der Rest der Familie richtig verstand, warum – wir fanden alle, dass Björn und Papa unterschiedlicher nicht sein konnten. Jetzt erkannte ich Björn bereits aus der Ferne, das halblange, stahlgraue Haar zurückgekämmt, wie es sonst die Grünschnäbel in der Finanzbranche für gewöhnlich trugen. Björn war immer gut gekleidet: Heute trug er eine Jeans und einen Pullover unter einem kamelfarbenen Mantel. Ein Paar Lederhandschuhe rundete das Outfit ab.
»Hallo, Sara«, sagte er und umarmte mich. »Wie schön, dich zu sehen! Dann können wir ja los?«
Björn wollte mich eigentlich zum Essen einladen, aber ich wollte lieber eine Runde in Djurgården spazieren gehen. Mein Plan war, das Ganze sehr kurz zu halten. Wir schlenderten über den Strandvägen und dann rechts über die Brücke. Von dort wollte Björn sich links halten, am Wasser entlang, und ich stimmte sofort zu, weil ich vorhatte, schon bald zu behaupten, zurück zu Simåns zu müssen, und dann bei Djurgårdsbrunn in den Bus zu steigen. Wir kamen am Restaurant Ulla Winbladh vorbei, wo ein Kiesweg die Straße ablöste, auf dem nicht so viele Menschen unterwegs waren. Björn schielte zu mir herüber.
»Wie geht es dir?«, fragte er.
Ich setzte eine unschuldige Miene auf.
»Gut, das hab ich doch schon gesagt«, antwortete ich. »Als du die Frage vorhin gestellt hast und ich sie dir beantwortet habe.«
Björn lächelte.
»Ja, aber jetzt hätte ich gern die echte Antwort.«
Langsam wurde ich wütend. Björn und Fabian glaubten beide, sie wären fantastische Menschenkenner, die genau wussten, wie es uns allen »eigentlich« ging, und uns das nur zu gern erzählen wollten.
Oder lag es daran, dass ich gerade viel zu reizbar war?
Ich lächelte Björn gezwungen an.
»Mir geht es nichts als gut«, sagte ich. »Und selbst?«
Mein Ton war ironischer als beabsichtigt. Björn sagte sicher eine Minute lang nichts, sondern ging einfach weiter. Ich lief neben ihm her, bis ich mich beruhigt hatte.
»Entschuldige«, sagte ich dann. »Ich wollte nicht unhöflich sein.«
»Du weißt, dass ich mich nicht aufdrängen will«, sagte Björn. »Mir lag sehr viel an Lennart, und ich möchte einfach nur sicherstellen, dass es dir und Lina gut geht. Und Elisabeth, selbstverständlich. Wenn ich irgendwas tun kann, um euch zu unterstützen, mache ich das wirklich gern. Was auch immer es ist.«
»Das ist toll«, sagte ich. »Aber mir fällt wirklich nichts ein, bei dem wir Unterstützung bräuchten. Sollte sich das ändern, melde ich mich gern.«
Wir liefen eine ganze Weile schweigend weiter, und ich suchte nach einem guten Gesprächsthema. Als ich gerade den Mund öffnen und Björn fragen wollte, wie es um seine Pläne stand, ins Ausland zu gehen, kam uns jemand entgegen. Eigentlich sah er ziemlich alltäglich aus mit seiner Jeans und Jacke, wäre da nicht dieser auffällige schwarze Hut auf seinem Kopf gewesen, der nicht zu seiner sonstigen Aufmachung passte. Zorro, dachte ich grinsend und wollte gerade eine lustige Bemerkung machen, da kam der Mann zu uns. Björn blieb zunächst wie angewurzelt stehen, dann entfernten sie sich ein paar Schritte und sprachen leise miteinander. Auch ich blieb stehen, zutiefst verwundert. Wer war das, und was wollte er? Kannte er Björn?
Meine Verwunderung steigerte sich, als ich beobachtete, wie sich der Mann zu Björn lehnte und ihm einen Arm um die Schultern legte. Es sollte wohl eigentlich eine freundliche Geste sein, machte aber einen bedrohlichen Eindruck. Der Mann drückte Björn mit gespielter Zärtlichkeit ein paarmal seitlich an sich und schüttelte ihn dabei leicht, dann lächelte er. Björn hingegen sah todernst aus, fast blass.
»War jedenfalls schön, dich zu sehen, Björn«, sagte der Mann laut. »Du musst wirklich gut auf dich aufpassen. Wir bauen auf dich, das weißt du.«
Björn antwortete nicht. Nach wenigen Sekunden ließ der Mann von ihm ab, nickte mir aufmunternd zu und ging dann weiter. Ich schaute ihm verwundert nach. Björn rollte ein paarmal die Schultern, als wäre er soeben eine große Last losgeworden.
»Wer war das?«, fragte ich.
»Niemand«, antwortete Björn. »Vielmehr: jemand, den ich über die Arbeit kenne. Aber niemand Wichtiges.«
Wir setzten uns wieder in Bewegung.
»Du siehst gestresst aus«, sagte ich nach einer Weile. »Willst du das nicht vielleicht doch erklären?«
Björn schwieg, dann blieb er plötzlich stehen. Ich auch. Und so standen wir da und betrachteten einander.
Björn war genauso alt wie mein Vater, etwas über sechzig, aber er wollte offenbar jünger wirken. Ich wusste, dass er ziemlich eitel war, dass er Motorrad fuhr und gerade frisch geschieden war. Ich untersuchte ihn mit unvoreingenommenem Blick: das lange Haar; die leichte Bräune – Bräunungscreme? –, die sich seit dem Sommer hielt; die teure und maßgeschneiderte Kleidung. Mit einem Mal erfüllte mich eine so heftige Verachtung, dass ich mich fast dafür schämte: Die Verachtung eines jungen Menschen für einen älteren, der unbedingt jung erscheinen wollte, und dann wurde ich rot. Seit wann war ich so hart, ohne eine Unze Mitgefühl? Lag es an meiner Wut darüber, dass er sich weigerte, meine Fragen zu beantworten? Ich machte schließlich genau das Gleiche.
Beim nächsten Satz aus seinem Mund löste sich das letzte bisschen Sympathie in Luft auf.
»Weißt du, dass dein Vater in zwielichtige Geschäfte verwickelt war?«, fragte er. »Geschäfte, die man besser keiner näheren Prüfung unterziehen sollte.«
Ich starrte ihn nur an. Dann platzte es aus mir heraus.
»Du«, sagte ich eiskalt, »wenn es auf diesem Planeten jemanden gab, der durch und durch rechtschaffen war, dann war das mein Vater. Nur weil du offenbar irgendwelche Probleme hast, musst du nicht schlecht über ihn reden. Und ich muss jetzt dringend nach Hause zu meiner Katze!«
Björn betrachtete mich voller Skepsis. Allein bei dem Anblick bekam ich Bauchschmerzen, also entfernte ich mich mit schnellen Schritten Richtung Djurgårdsbrunn. Aber er holte mich schnell ein.
»Sara, warte«, sagte er. »Das ist jetzt völlig falsch rübergekommen. Ich weiß doch selbst, was für eine ehrliche Haut dein Vater war. Aber ich glaube, er wurde da in etwas hineingezogen. Gegen seinen Willen.«
»Und woher willst du das wissen?«, fragte ich, ein wenig außer Atem durch das hohe Tempo.
»Ich weiß gar nichts«, antwortete Björn. »Ehrlich gesagt, spekuliere ich nur. Aber das würde ich eben gern mit dir zusammen tun, statt allein vor mich hin zu grübeln.«
Ich blieb auf der Brücke stehen.
»Weißt du was?«, fragte ich Björn und schaute ihm dabei direkt in die Augen. »Ich bin wirklich dankbar für deine Sorge, aber was Papa angeht, bist du auf der falschen Fährte.«
Über Björns Schulter sah ich den 69er Bus.
»Okay«, sagte Björn und hob entschuldigend die Hände. »Du hast sicher recht. Dann scheine ich mich geirrt zu haben und werde dich nicht noch mal behelligen.«
Ohne zu antworten, überquerte ich die Straße und stellte mich an die Haltestelle. Aus den Augenwinkeln sah ich, dass Björn am Ufer entlang zurückging, den Weg, den wir gekommen waren. Er ging mit zögerlichen Schritten, die Hände tief in den Taschen vergraben. Eine Woge schlechten Gewissens überkam mich, als ich ihn Richtung Wald verschwinden sah.
Mitten in der Nacht erwachte ich mit einem Ruck. Mein Herz schlug heftig, ohne dass ich wusste, was mich geweckt hatte. Aber dann ertönte es wieder: ein lang gezogenes Heulen wie von einem Hund. Oder einem Wolf.
Ich setzte mich auf und machte Licht. Das Heulen kam von der anderen Seite der Wand. Offenbar von Sixten.
Ich stand auf, zog den Bademantel an und ging hinaus in den langen Flur. Niemand anders war zu sehen. Aber Sixtens Klagelied drang durch Mark und Bein.
Unter Jalils Tür war Licht zu sehen, also huschte ich hin und klopfte an. Sofort erlosch das Licht im Zimmer. Kein weiteres Geräusch war zu hören. Niemand öffnete.
Ich fluchte. Konnten die alle wirklich so wenig empathisch sein? Was, wenn Sixten da drin lag und starb? Also trat ich vor seine Tür und klopfte dreimal laut an.
Sie flog auf, und im Rahmen erschien Sixten. Ich hatte ihn schon mal gesehen, aber nicht so. Er war ein breiter, untersetzter Mann um die sechzig, trug ein gelb-schwarzes T-Shirt vom Sportclub AIK, das einen breiten Bereich zwischen Shirtsaum und Schlafanzughose unbedeckt ließ. Außerdem schien ihm eine große Anzahl Zähne zu fehlen. Er grinste breit und blinzelte, während er mit der einen Hand die Tür aufhielt und sich mit der anderen am Bauch kratzte.
»Na, hallo«, sagte er freudig. »Wie schön! Möchtest du reinkommen?«
Ich starrte ihn an.
»Was geht denn hier vor?«, fragte ich. »Es ist zwei Uhr nachts, und Sie heulen hier rum wie ein angeschossener Wolf.«
Sixten kicherte.
»Das klingt ja toll!«, sagte er. »Angeschossener Wolf. Das muss ich mir merken!«
»Äh, hallo?«, sagte ich. »Sie wecken das ganze Haus! Was soll das?«
Sixten schaute übertrieben in beide Richtungen.
»Soweit ich sehen kann, ist hier niemand außer dir«, sagte er. »Willst du nicht reinkommen?«
»Warum schreien Sie so?«, fragte ich.
Sixten zuckte mit den Schultern und riss die Augen auf.
»Vietnamveteran?«, fragte er zurück. »Oder aber mir ist einfach ein bisschen langweilig?«
Wir starrten uns ein paar Augenblicke lang an. Sixten kicherte leise. Dann machte ich auf dem Absatz kehrt und ging zurück zu meinem Zimmer, während Sixten seine Tür wieder zumachte.
Meine Tür war verschlossen.
Ich zog kräftig an der Klinke.
Sie ließ sich nicht öffnen, sie war abgeschlossen. Und als ich das Ohr näher brachte, konnte ich drinnen Stimmen hören.
Ohne nachzudenken, stapfte ich durch den Flur bis zum Zimmer meiner Vermieterin und klopfte mit Wucht an. Niemand antwortete, aber die Tür ging von selbst auf.
Siv saß an ihrem Schminktisch vor einem Spiegel, der von warmgelben Glühbirnen eingerahmt war wie in einer altmodischen Theatergarderobe. Sie hatte einen hellrosafarbenen, flauschigen Bademantel an, und als sich unsere Blicke im Spiegel trafen, musste ich unwillkürlich keuchen. Um den Kopf trug sie einen engen Strumpf oder eine Mütze, die dauergewellte Betonfrisur ruhte auf einem Holzstumpf auf einem Beistelltisch.
Siv hatte eine Perücke.
»Oh, Verzeihung!«, rief ich und schloss die Tür mit einem Knall.
Dann blieb ich in der Dunkelheit stehen, unsicher, was ich als Nächstes tun sollte. Schon öffnete sich die Tür wieder, und da stand Siv. Sie sah aus wie immer – mit ihrer dauergewellten Betonfrisur auf dem Kopf.
»Was wollen Sie?«, fragte sie barsch. »Es ist zwei Uhr nachts, und ich will meine Ruhe.«
»Ich habe mich ausgesperrt«, sagte ich. »Sixten hat geheult wie ein Verrückter, haben Sie das nicht gehört? Deshalb bin ich rausgegangen. Jetzt ist jemand in meinem Zimmer und hat von innen abgeschlossen.«
Siv starrte mich an.
»Was reden Sie denn da für einen Unsinn?«, fragte sie.
Dann nahm sie einen kleinen Schlüssel von einem Haken und lief durch den Flur bis zu meinem Zimmer. Dort griff sie nach der Klinke, ohne vorher aufzuschließen, und öffnete die Tür weit.
Sie war nicht verschlossen, das Zimmer leer.
Siv betrachtete mich eine Weile aus verkniffenen Augen.
»Nehmen Sie Drogen?«, fragte sie schließlich. »Dann können Sie sich nämlich sofort eine neue Bleibe suchen.«
»Nein, ich nehme keine Drogen!«, erwiderte ich schockiert. »Ich habe Stimmen gehört, und die Tür war abgeschlossen! Von innen!«
Siv lächelte, ein freudloses, schmales Lächeln.
»Aber sie war ja nicht abgeschlossen«, sagte sie in besorgniserregend weichem Tonfall.
Dann schwebte sie zurück zu ihrem Zimmer und drückte die Tür demonstrativ zu.
Ich selbst betrat mein Zimmer und schloss hinter mir ab, bevor ich genauestens kontrollierte, ob etwas fehlte oder verstellt worden war. Absolut nichts deutete darauf hin, dass jemand hier gewesen war. Ich meinte, schwach Alkohol riechen zu können, aber das konnte genauso gut Einbildung sein.
Überzeugt davon, nicht wieder einschlafen zu können, holte ich meine Kulturtasche hervor und fand schnell die kleine Schachtel mit den Tabletten, die mir mein Hausarzt verschrieben hatte.
»Das ist kein richtiges Schlafmittel«, hatte er gesagt. »Nur etwas, das beim Einschlafen helfen soll. Aber sie machen trotzdem etwas benebelt, nutzen Sie die also nur, wenn Sie wirklich schlafen müssen.«
1–2 Tabletten, stand auf der Packung. Ich zögerte. Dann steckte ich mir zwei Tabletten in den Mund und spülte sie mit einem Glas Wasser hinunter. Sofort legte ich mich wieder ins Bett und schlief ein.
Große, gelbe Flammen züngelten vor dem Fenster. Ich öffnete langsam die Augen und bemerkte den warmgelben Schein an der Decke über mir, dazu das Knistern vor dem Haus.
Es brannte.
Das ganze Haus schien zu brennen, bloß ich hatte aus irgendeinem Grund Grütze im Kopf und konnte meinen Körper nicht dazu bringen, mir zu gehorchen. Die Hitze vor dem Fenster war so stark, dass ich zu schwitzen anfing; es strömte mir nur so aus den Poren. Ich schaffte es, aufzustehen und ans Fenster zu taumeln, wo ich begriff, dass das Haus und mein Zimmer in Flammen standen. Alles um mich herum flackerte gelbrot.
Werde ich jetzt sterben? Werde ich verbrennen wie Papa?
Mein Herz schlug weiter langsam und regelmäßig; es schien unmöglich, mich zu beunruhigen.
Ich sollte in den Flur laufen, den Feueralarm auslösen. Ich sollte die anderen warnen und die Feuerwehr verständigen. Ich sollte die 112 wählen. Aber ich tat nichts davon.
Ich kroch zurück ins Bett und beobachtete das Spiel der Flammen vorm Fenster. Dann schloss ich die Augen und verschwand wieder in der Dunkelheit.
Papa, werde ich dich wiedersehen?
Als ich am nächsten Morgen erwachte, wurde mir bewusst, dass ich einen schrecklichen Albtraum gehabt haben musste. Mein Zimmer sah aus wie immer, die Fensterscheiben waren sauber. Es roch nicht mal nach Rauch.
Vor meinem Fenster hatte es nicht gebrannt.
Das war alles nur ein Traum gewesen.
Aber warum hatte ich darin so sonderbar reagiert?
Am Nachmittag stand ich hinter dem Tresen des Cafés und nahm gerade das Geld für einen Salat entgegen, als das Türglöckchen klingelte und Fabian hereinkam. Ich sah ihn aus den Augenwinkeln und zuckte innerlich zusammen. Er hatte den gleichen Kleidungsstil wie mein Vater – dünne Jacke über schlecht sitzendem Pulli und schlecht sitzender Hose –, und genau wie mein Vater war er groß und schlank. Zu allem Überfluss hatten sie auch noch heimlich dieselbe Zigarettenmarke geraucht, französische Gauloises, die so stark waren, dass sie »bei Verstopfung halfen«. Plötzlich hatte ich Papas Stimme im Ohr und sah seine funkelnden Augen vor mir. Meine Hand zitterte, als ich dem Kunden den Bon reichte.
Da stand Fabian bereits vor der Theke.
»Hallo, Sara«, sagte er ungewohnt sanft. »Deine Mutter meinte, dass ich dich hier finden könnte. Hast du kurz Zeit zum Reden? Sonst komme ich später wieder, ich muss noch was drüben am Platz erledigen.«
Ich warf einen Blick auf die Uhr.
»Ich habe in einer halben Stunde Pause«, sagte ich. »Dann können wir uns zwanzig Minuten zusammensetzen, wenn du magst.«
»Gern«, sagte Fabian.
Ich schaute ihm nach, während er sich entfernte, und natürlich rührte es mich, dass er den Weg vom Außenministerium bis zu mir nach Sundbyberg auf sich genommen hatte, um mir im Café einen Besuch abzustatten. Ihm lag etwas an meiner Familie, und ich glaubte insgeheim, dass er schon immer ein bisschen in meine Mutter verliebt war. Fabian selbst war unverheiratet und kinderlos, außerdem war er Papas bester Freund, seit sie beide so um die zwanzig waren und zusammen studiert hatten. Später hatten sie beide für die Sida gearbeitet und waren viel zusammen gereist. Danach hatten sich ihre Wege getrennt. Fabian fing beim Außenministerium an, und Papa wurde Berater für unterschiedliche Behörden. Beide hatten immer gesagt, sie wären Brüder im Geiste, auch wenn sie sich durchaus heftig streiten konnten. Das war es wohl auch, was mich so extrem nachdenklich gemacht hatte in den letzten sechs Monaten vor dem Tod meines Vaters.
Genau in dem Moment, in dem Gullbritt aus der Küche kam, um mir zu sagen, ich könne in die Pause gehen, tauchte Fabian wieder auf. Ich stellte sie einander vor, und Gullbritt – die mir gleich am ersten Tag eingebläut hatte, dass es den Angestellten verboten war, auch nur so etwas Winziges wie einen Keks zu essen, ohne ihn zu bezahlen – schenkte sofort jedem von uns eine Tasse Kaffee ein, aufs Haus.
»Wie schön, einen von Saras Freunden kennenzulernen«, sagte Gullbritt, während sie uns die Tassen zuschob, und ich hätte schwören können, dass sie dabei eifrig mit den Wimpern schlug. »Oder sind Sie vielleicht verwandt?«
Fabian lachte.
»Wenn Sie damit meinen, dass ich alt genug aussehe, um ihr Vater zu sein, dann haben Sie wohl recht«, sagte er. »Ich war sehr gut mit Saras Vater befreundet.«
»Das hätte ich ja niemals gedacht«, sagte Gullbritt.
Unfassbar, aber wahr: Gullbritt flirtete mit Fabian. Das schien ihn ein bisschen zu beflügeln, als er mit dem Kaffee in der Hand vor mir durch das Café ging.
Wir ließen uns in einer Ecke unter einer Palme nieder.
»Wie geht es dir?«, fragte Fabian. »Wie gefällt dir dein neues Zuhause?«
Ich schüttelte den Kopf.
»Ein Irrenhaus«, sagte ich. »Ich bekomme dort regelrecht Albträume.«
»Albträume?«, fragte Fabian zurück und runzelte die Stirn, aber mit einem Lächeln. »Was ist denn so schlimm?«
»Das würdest du mir eh nicht glauben«, sagte ich.
Fabian lachte. Dann schaute er sich um, während er an seinem Kaffee nippte.
»Hier ist es jedenfalls nett«, sagte er. »Fühlst du dich wohl?«
Ich musste lächeln, ich konnte nicht anders.
»Tja, du hast eine Gullbritt kennengelernt, die bester Laune war«, sagte ich. »Ihre hysterischen Anfälle, wenn die Kasse nicht ganz stimmt, sehen etwas anders aus. Und Eva, ihre Kollegin …«
Ich lachte und schüttelte den Kopf.
»Sie ist das, was Papa und du immer ›eine Klemmrassistin‹ genannt haben. Verkappt, aber ganz schön extrem. Sie fährt morgens nach Rinkeby, um dort billige Lebensmittel zu kaufen, und dann erzählt sie uns von all den ›faulen, dummen, schmutzigen‹ …«
Fabian hob die Hand.
»Danke, schon verstanden«, sagte er. »Aber damit, ihnen ihre billigen Waren abzukaufen, hat sie kein Problem?«
»Nicht das geringste«, antwortete ich.
»Heuchlerin«, sagte Fabian leise.
Dann schaute er mich an.
»Warum bist du hier?«, fragte er. »Mir ist ja klar, dass ein unfassbar anstrengender Herbst und Sommer hinter dir liegen, aber ein Café in Sundbyberg? Mit so fantastischen Qualifikationen wie deinen?«
»Ich bin ja auf Jobsuche«, sagte ich. »Es ist einfach schwer, was zu finden.«
»Ich bitte dich«, sagte Fabian und knuffte mir leicht mit der Faust gegen die Schulter. »Was ist denn aus deinem Traum geworden, den Master an der London School of Economics zu machen? Oder an der INSEAD?«
Schon war meine Laune wieder im Keller. Da konnte ich ja genauso gut die Karten auf den Tisch legen.
»Eigentlich war ich dagegen, dass du mich hier besuchst«, sagte ich. »Weil ich wusste, dass du mit so was kommst. Ich will gerade einfach nur meine Ruhe. Ich habe nichts zu bieten. Papa hat davon geträumt, dass ich in seine Fußstapfen trete, aber mir fehlt sein Talent.«
Fabian betrachtete mich mit ernster Miene.
»Das fehlt dir nicht«, sagte er. »Du bist eine wertvolle Ressource für dieses Land, begreifst du das nicht?«
Ich schüttelte den Kopf.
»Ich kann mir gerade nicht mal merken, wie die Kasse funktioniert«, sagte ich. »Ich, die immer so stark und positiv eingestellt war und eigentlich recht klug. Jetzt bin ich eher …«
Ich schüttelte den Kopf, und Fabian legte seine Hand auf meine.
»Du bist müde«, sagte er. »Du hattest es schließlich schwer in der letzten Zeit.«
Gullbritt stand vor uns.
»Plätzchen?«, fragte sie und legte den Kopf schief. »Kaffee schmeckt ohne doch nie wirklich gut.«
Sie stellte einen Teller mit Keksen vor uns, und Fabian schaute lächelnd zu ihr auf.
»Gullbritt, Sie wissen genau, woran es fehlt«, sagte er und griff nach einem Plätzchen mit Hagelzucker.
»Ich tu mein Bestes«, sagte Gullbritt kokett und verschwand wieder hinter dem Tresen.
Als wir uns verabschiedeten, umarmte Fabian mich noch einmal.
»Ruh dich aus«, sagte er. »Lass ein paar Monate ins Land ziehen. Wenn du dann genug hast von dem hier, melde dich. Dann schauen wir, ob wir was Passendes beim Außenministerium finden.«
»Okay«, sagte ich, wusste aber in mir drin, dass dieser Tag nie kommen würde.
Am Abend hatte die Spülmaschine des Cafés den Geist aufgegeben, also mussten wir alles von Hand spülen, und dann steckte mein Bus wegen eines Unfalls eine Viertelstunde vor der Björnboda-Schule fest. Als ich endlich in Vällingby ankam, war es zwanzig nach sieben und die Küche abgeschlossen.
Auf dem kleinen Tisch im Flur lagen drei an mich adressierte Briefe mit Absagen auf Bewerbungen – »Danke für Ihr Interesse, die Stelle ist bereits besetzt«, »unterqualifiziert« und »überqualifiziert«. Ich knüllte sie zusammen und warf sie in den Papierkorb. Keine Spur von Siv, aber Jalil stand oben am Treppengeländer und lächelte zu mir hinunter, dass sein Bart nur so zitterte. Heute trug er ein strahlend blaues Hemd aus feinem Cordstoff.
»Die Olle ist ins Kino gegangen«, verkündete er. »Dann schließt sie die Küche immer ab.«
Dann konnte ich ihn ja jetzt gut und gern konfrontieren. Ich machte einen Schritt auf die Treppe zu.
»Sag mal: Sixten«, setzte ich an und nickte grob zu seinem Zimmer. »Der Typ, der neben mir wohnt. Warum schreit der denn nachts? Hast du ihn gestern gehört?«
Jalil riss die Augen auf und nickte.
»Und ob ich ihn gehört habe«, antwortete er. »Ich hab das Licht ausgemacht und mir das Kissen auf die Ohren gedrückt.«
»Hat er das schon mal gemacht?«
»Nicht, seit ich hier wohne.«
Ich hielt es für unnötig, die Stimmen in meinem Zimmer zu erwähnen. Und den Albtraum mit dem Feuer.
»Was ist denn mit dem los?«, fragte ich also.
»Vielleicht einfach verrückt?«, schlug Jalil vor und hob die Augenbrauen.
Dann sah er mich freundlich an.
»Hast du Hunger?«, fragte er. »Ich hab noch kalten Couscous mit Joghurtsoße aufm Zimmer.«
»Nein danke«, sagte ich, obwohl ich meinen Magen knurren hören konnte. »Ich lass mir was anderes einfallen. Aber trotzdem danke.«
Jalil wirkte plötzlich abgelenkt, als wäre ihm etwas eingefallen.
»Übrigens«, sagte er. »Da haben heute ein paar Typen nach dir gefragt.«
Wer konnte das gewesen sein? Hatten Fabian und Björn mich hier aufgestöbert?
»Wie sahen sie aus?«, fragte ich.
»Keine Ahnung«, sagte Jalil. »Sie haben mit Siv gesprochen. Klang für mich so, als hätten sie einen Akzent gehabt.«
Also nicht Björn und Fabian. Ich atmete erleichtert auf.
»Danke«, sagte ich. »Dann werde ich mal bei Siv nachhaken, was sie wollten.«
Kurze Zeit später waren Simåns und ich unterwegs zur Imbissbude von Vällingby Centrum, um uns eine Wurst und einen Kakao zu teilen. Ich führte ihn am Katzengeschirr und lief gerade Sivs Auffahrt hinunter, als er plötzlich ins Gebüsch sprang. Die Leine spannte sich, und ich hörte es rascheln.
»Simåns«, sagte ich erschöpft. »Musst du jetzt Mäuse jagen? Ich will was essen! Komm wieder raus!«
Als hätte er mich verstanden, sprang Simåns aus dem Gebüsch, aber er spielte dabei mit etwas. Ein Gegenstand fiel scheppernd vor mir auf die Pflastersteine, und ich hob ihn auf. Simåns schaute sehnsüchtig zu mir auf, weil ich nun sein Spielzeug in den Händen hielt.
Es war eine kleine, runde Dose aus Aluminium, auf die Seite war eine orangefarbene Flamme gemalt. Real Flame Gel Fuel stand in großen schwarzen Buchstaben unter der Flamme. Danger.
Ich steckte die Dose in die Jackentasche, holte mein Handy hervor und googelte den Namen. Gel Fuel konnte man dazu nutzen, innen und außen Feuer zu entfachen. Das Feuer erwärmte das Zimmer; es knisterte sogar. Manchmal gab es einen schwachen Alkoholgeruch von sich.
Mehrere dieser Dosen, nebeneinander aufgereiht direkt unter meinem Fenster?
Aber warum?
Wer könnte etwas so dermaßen Niederträchtiges machen wollen?
War es nicht vielleicht einfach Zufall, dass die Dose dort lag, nachdem ich einen Albtraum gehabt hatte?
Ich schob die Gedanken fort und setzte den Weg zum Imbiss fort, wo ich wirklich ein Würstchen und einen Kakao bestellte. Über uns wölbte sich ein dunkler Himmel, vollkommen sternenleer. Ein beißender Wind blies um das abgedunkelte Eckgeschäft und kündete vom nahenden Winter.
Und genau dort, vor der Imbissbude, während ich die Serviette zusammenfaltete und den letzten Bissen hinunterschluckte, kehrte das alte, allzu bekannte Gefühl extremen Unbehagens zu mir zurück. Die Fassaden machten einen Satz auf mich zu. Ein dunkler Schatten glitt aus einer der Nebengassen und richtete seine leuchtenden, grünen Augen auf mich. Übelkeit und Panik wuchsen in mir und fuhrwerkten mit widerhakenähnlichen Krallen in meinen Eingeweiden herum.
Ich stützte mich mit einer Hand an der Wand des Imbisshäuschens ab.
Verrückt, verrückt, verrückt.
Was hatte die Therapeutin noch gesagt?