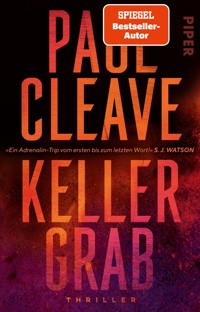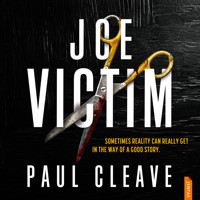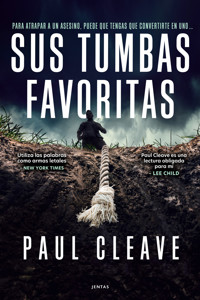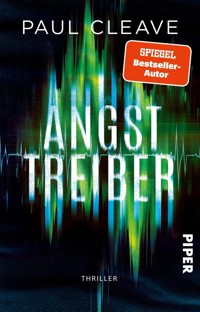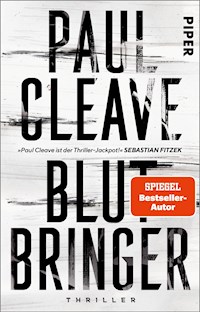
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Als die siebenjährige Alyssa entführt wird, setzt der aufrechte Polizist Noah Harper alles daran, sie zu befreien - und steigert sich dabei in einen hemmungslosen Blutrausch. Noah rettet das Mädchen, aber er übertritt eine Grenze und verliert alles. Seinen Job, seine Frau, seine Freunde. Und auch sich selbst. 12 Jahre später: Noah hat ein neues Leben begonnen. Ein unheilvolles Leben mit Geheimnissen, an die keiner rühren sollte. Wie aus dem Nichts erreicht ihn eine Nachricht, die schreckliche Folgen nach sich zieht. Alyssa ist wieder verschwunden. Um sie zu retten, muss Noah den Tod bringen ... nichts Neues mehr für ihn. Blut soll fließen!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Blutbringer« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.
Für meine Cousine Katrina Cox –
eine der stärksten und positivsten Personen, die ich kenne
© Paul Cleave 2019
Titel der englischen Originalausgabe:
»Whatever it Takes«, Upstart Press, Auckland 2019
© der deutschsprachigen Ausgabe:
Piper Verlag GmbH, München 2021
Lektorat: Lars Zwickies
Covergestaltung: Sandra Taufer, München
Covermotiv: Bilder unter Lizenzierung von Shutterstock.com genutzt
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich der Piper Verlag nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht und dafür keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Cover & Impressum
1 – »Du wirst ihn umbringen«, …
2 – In der Gegend um das …
3 – Ich finde ein paar …
4 – Der Parkplatz ist blau …
5 – Im Erdgeschoss wird …
1
»Du wirst ihn umbringen«, sagt Drew.
Ich lehne meine Stirn gegen die Wand und starre zu Boden. Versuche, meine Atmung zu kontrollieren. Eine tote Kakerlake liegt neben einer Zigarettenkippe, die ich eigentlich in den Mülleimer werfen wollte. Ich reibe mir die Schläfen, um den Schmerz loszuwerden, aber er bleibt. Wie ein Splitter, der tief in meinen Schädel eingedrungen ist und sich entzündet hat. Und die einzige Möglichkeit, ihn loszuwerden, besteht darin, diesen Kerl zu schlagen, der gefesselt auf dem Stuhl sitzt. Und genau das tue ich jetzt. Ich schlage so fest zu, wie ich kann. Dann höre ich, wie etwas knackt, aber ich weiß nicht, ob es mein Finger ist oder sein Jochbein. Ich habe schon so oft zugeschlagen, dass meine Hand höllisch wehtut, aber sein Gesicht schmerzt bestimmt noch viel mehr. Sein linkes Auge ist zugeschwollen und ganz violett, seine Nase gebrochen, seine Unterlippe aufgeplatzt. Überall Blut und zerfetzte Haut. Trotzdem grinst dieser Mistkerl mich immer noch höhnisch an. Auf eine Art, die auch jeden anderen provozieren würde, sein Gesicht zu Brei zu hauen. Leider konnte ich ihm das Grinsen noch nicht austreiben. Ich hab es bloß geschafft, mir die Knöchel aufzuschlagen.
Drew legt mir eine Hand auf die Schulter, und ich schiebe sie weg.
»Lass mich«, sage ich zu ihm.
Er legt die Hand erneut auf meine Schulter und schaut mir in die Augen. Mit Drew bin ich schon seit meiner Kindheit befreundet. Wir sind zusammen aufgewachsen, haben Mädchen über den Schulhof gejagt, sind auf Bäume geklettert und angeln gegangen. Als wir älter wurden, sind wir Polizisten geworden und waren jeweils der Trauzeuge des anderen. Wenn er nicht sofort seine Hand von meiner Schulter nimmt, werde ich sie ihm brechen.
»Das bist du nicht, Noah. So was tun wir nicht.«
Er hat recht. Das bin ich nicht. Trotzdem stehen wir hier. Er nimmt die Hand von meiner Schulter.
»Verdammt noch mal, Noah, ich kann nicht zulassen, dass du ihn totschlägst.«
Drew schaut mich mit einer Mischung aus Verwirrung und Panik an. Am liebsten wäre er gar nicht hier. Mir geht’s genauso.
»Du solltest besser gehen.«
»Aber …«
Ich verpasse dem Kerl auf dem Stuhl noch einen Schlag. Blut und Schweiß sprühen durch die trockene Luft, und das Geräusch des Schlags verhallt im Raum. Ich rieche Holz und Blut und Schweiß. Der Kerl spuckt einen Schwall rötliche Flüssigkeit auf den Boden und schüttelt den Kopf. Setzt wieder dieses Grinsen auf, und mir dreht sich der Magen um.
»Mein Vater wird dich in den Knast bringen«, sagt er. Sein Name ist Conrad. Ich bin mit ihm aufgewachsen, wie ich auch mit Drew aufgewachsen bin. Aber bei Conrad und mir war es anders. Wir waren nie befreundet. Wir hatten überhaupt nichts miteinander zu tun. Mit einem wie Conrad willst du nichts zu tun haben. Er ist ein selbstsüchtiger Drecksack. Total übergriffig und ohne jede Moral. Einer, vor dem die Frauen einander warnen, einer, dem man aus dem Weg geht, indem man die Straßenseite wechselt.
Außerdem ist er der Sohn des Sheriffs.
»Du solltest dir lieber über deine Zukunft Gedanken machen, nicht über meine«, sage ich.
Er spuckt wieder aus. »Ich hab dir doch schon gesagt, ich weiß nicht, wo sie ist.«
Ich laufe im Büro auf und ab. Die Fenster sind geschlossen. Es ist nicht bloß zu warm, es ist brütend heiß. Meine Klamotten sind feucht. Sie kleben an meinem Körper. Der Holzfußboden ist blank vom nervösen Hin und Her all der Vorarbeiter, die in diesem Raum genauso herumgetigert sind wie ich. Die Holzbohlen knarren unter meinen Füßen. Conrad ist hier der aktuelle Vorarbeiter. Die Möbel im Büro sind so alt, dass sie als Prototypen durchgehen könnten. Der erste Schreibtisch, der jemals gebaut wurde, der erste Aktenschrank – meine Güte, sogar der Computer sieht so aus, als hätte man ihn schon bei der Entschlüsselung des Enigma-Codes eingesetzt. An der Wand wurde ein Fernseher festgeschraubt, der mit seinem runden Bildschirm wie ein Goldfischglas wirkt. Die Decke ist mit Fliegendreck übersät, und die Ablagen auf dem Schreibtisch quellen vor Papierkram über. Meine Kopfschmerzen werden immer schlimmer, und mein Magen rebelliert. Mir gefällt überhaupt nicht, in welche Richtung das hier läuft. Ich wünschte, wir könnten alles rückgängig machen.
Geht aber nicht.
Ich muss weitermachen.
Für das Mädchen. Für Alyssa.
Ich baue mich vor ihm auf. »Wo ist sie?«
»Ich will meinen Anwalt sprechen«, sagt er.
Drew stellt sich zwischen uns. Er drückt eine Hand gegen meine Brust, die andere liegt auf dem Griff seiner Pistole, die noch im Halfter steckt. Ich frage mich, ob er sie benutzen will, ob er es über sich bringen würde. Ich hätte ihn nicht in die Sache reinziehen sollen. »Lass uns mal rausgehen und reden«, sagt er.
Ich starre ihn kalt an. Dann lenke ich ein. Wir gehen raus und schauen in die Fabrikhalle hinab. Ich lege meine Hand auf das Eisengeländer. Ein paar Lichter sind eingeschaltet, aber sie bewirken nicht viel. Ihr Licht verliert sich in der riesigen Halle. Ich kann gerade mal zwanzig Meter weit sehen. Dort unten im Zwielicht stapeln sich Baumstämme in langen, geraden Reihen. Draußen, hinter den staubigen Fenstern, herrscht absolute Dunkelheit. Ich lehne mich gegen das Geländer, damit ich Drew ins Gesicht sehen kann, während er die Tür hinter sich schließt. Durch ein Fenster kann ich Conrad im Blick behalten. Er beobachtet uns.
Drew spricht mit leiser Stimme. »Selbst wenn er sie hat, wird er nicht reden.«
Ich löse den obersten Knopf meines Hemds. Es ist mit Blut bespritzt. Die Luft hier ist stickig. Nachts wird das Sägewerk heruntergefahren. Die Klimaanlage ist abgeschaltet.
»Wird er«, sage ich, um Alyssas und auch um meinetwillen. Es gibt keinen Weg zurück. »Er muss.«
Drew schüttelt den Kopf. »Wir können ihn nicht noch weiter verprügeln. Vor allem, weil wir gar nicht wissen, ob er sie wirklich hat.«
»Er hat sie«, sage ich. »Ich weiß, dass er sie hat.«
»Weißt du nicht. Du hast keine Beweise. Du glaubst es nur, willst es glauben. Aber wenn du falschliegst, dann stecken wir in der Scheiße.« Er stöhnt laut auf und schaut zur Decke, als ob da oben eine Antwort oder ein Ausweg zu finden wäre. »Verdammt, Noah«, sagt er. »Selbst wenn wir recht haben, stecken wir in Schwierigkeiten. Selbst wenn er jetzt sofort alles gesteht, wird er ungeschoren davonkommen. Du weißt ganz genau, dass kein Richter der Welt ihn verurteilen wird. Nach dem, was wir hier veranstaltet haben.«
»Damit befassen wir uns später. Zuerst müssen wir Alyssa finden. Wir haben schon so viel erreicht. Das darf nicht umsonst gewesen sein.«
»Ich wünschte, ich könnte sagen, dass du mich dazu überredet hast. Aber das wäre naiv.«
»Ich kann ihn zum Reden bringen.«
Er schüttelt den Kopf. »Wir sind hier fertig. Wir müssen ihn jetzt ordentlich und korrekt festnehmen. Damit wir nicht in der Zelle neben ihm landen.«
»Wenn wir ihn auf die Wache bringen, wird er nie reden. Wie du schon sagtest, niemand wird ihn verurteilen. Wir kämen nicht mal bis zur Anklage. Wenn wir sie finden wollen, müssen wir hier weitermachen, das ist die einzige Möglichkeit.«
»Das dürfen wir nicht«, sagt Drew.
Ich nicke. Dann schüttle ich den Kopf. Ich atme langsam und hörbar aus. Meine Kopfschmerzen gehen nicht weg. Sie pochen unter meiner Schädeldecke. Ich schließe die Augen und massiere meine Schläfen. »Mensch, Drew, ich hab’s vermasselt. Ich hab’s total vermasselt.«
Er legt eine Hand auf meine Schulter. »Vielleicht gibt’s ja eine Möglichkeit, das wieder geradezubiegen. Aber dazu müssen wir den Sheriff rufen. Er wird nicht gerade erfreut sein, aber …«
Ich lasse eine Handschelle um sein Gelenk zuschnappen, die andere um das Geländer.
»Scheiße, Noah, was soll das?«
Ich ziehe meine Waffe und ziele auf ihn. Es ist nicht nötig, dass wir beide unsere Karriere versauen. Wir können das nicht durchziehen. Aber ich kann es. »Ich nehme alles auf meine Kappe. Ich sage ihnen, du wolltest mich aufhalten.«
»Noah …«
»Ich brauche deine Waffe und deine Schlüssel.«
»Tu das nicht, Kumpel.«
»Her damit.«
»Und wenn nicht?«
Ich antworte nicht. Ich werde ihn nicht erschießen, das weiß er. Er seufzt. Es fällt mir schwer, den enttäuschten Gesichtsausdruck meines besten Freundes zu ertragen. Er zieht die Pistole, legt sie auf den Boden und kickt sie zu mir rüber. Dann wirft er mir die Schlüssel zu. Ich schiebe die Waffe über den Rand der Brüstung und höre den Aufprall. Ich lasse die Schlüssel nach unten fallen und verlange sein Handy. Er wirft es mir zu. Ich stecke es in meine Tasche.
»Das wird nicht gut für dich enden«, sagt er.
»Weiß ich.«
Ich gehe zurück ins Büro. Schließe die Tür. Conrad grinst mich an. »Tick, tack«, sagt er.
»Was zum Teufel soll das heißen?«
Er spuckt auf den Boden, wo sein Blut mittlerweile ein Muster bildet, das ein Psychiater vielleicht interessant finden würde. »Das bedeutet, dass mein Vater bald hier auftaucht. Und ihr könnt euch denken, was er dann mit euch macht. Jede Wette, dass er euch ungespitzt in den Boden rammt.«
»Sag mir, wo sie ist.«
»Du klingst wie ’ne kaputte Schallplatte.«
»Wir haben ihr Haarband gefunden.«
»Welches Haarband?«
»Das sie verloren hat, als sie entführt wurde. Deine Fingerabdrücke sind drauf. Es hat mich auf deine Spur gebracht, Conrad.«
Er sagt nichts dazu.
»Ich hab vorhin einen Blick in deinen Wagen geworfen, der draußen auf dem Parkplatz steht. Ihre Schultasche ist im Kofferraum.«
»Du lügst. Und wenn nicht, dann hast du sie da rein gelegt.«
Ich spreize meine Finger. Sie brauchen einen Verband. Müssen gekühlt werden. Und geschient.
»Willst du mich wieder schlagen?«, fragt er. »Du warst immer ein Feigling, Noah. Wieso …«
»Ich weiß, was für ein Kerl du bist, Conrad. Und du weißt, dass ich es weiß.«
Er lacht, und mir läuft es kalt den Rücken runter. »Letzten Endes geht es doch um was ganz anderes. Dieses vermisste Mädchen hat überhaupt nichts damit zu tun«, sagt er. »Wir sind hier, weil du nachtragend bist, sogar jetzt noch, nach all den Jahren. Du bist erbärmlich.«
Ich ziehe meine Waffe und drücke sie gegen seinen Wanst. Sein Grinsen verschwindet. »Hör gut zu, Conrad. Ich weiß, dass du sie entführt hast. Sie ist erst sieben Jahre alt. Ein unschuldiges Kind. Sag mir, wo sie ist, und dann ist das hier vorbei.« Ich drückte die Waffe noch tiefer in seinen Magen. »Wenn du’s mir nicht sagst, ist es auch vorbei. Doch dann läuft es viel schmutziger ab. Mein Partner da draußen wollte mich aufhalten, aber ich hab ihn ans Geländer gefesselt. Er kann dir nicht mehr helfen. Und es kommt auch niemand sonst. Deinen Tick-tack-Scheiß kannst du dir schenken. Weil ich nämlich schießen werde, wenn du mir nicht sagst, wo sie ist. In den Arm zum Beispiel. Oder ins Bein. Vielleicht schieße ich dir auch den Schwanz weg. Willst du für den Rest deines Lebens im Rollstuhl sitzen und aus einem Schlauch pissen?«
»Das wagst du nicht«, sagt er.
Ich nehme ein paar Rechnungen aus der Ablage, knülle sie zusammen und stopfe sie ihm in den Mund. Als ich ihm ins Bein schieße, braucht er eine Sekunde, bis er es begreift. Er wirft sich hin und her und spuckt den Papierknäuel wieder aus. Der nasse blutige Klumpen bleibt am Boden kleben. Drew schreit da draußen, dass ich aufhören soll, hier drinnen kreischt Conrad. Meine Ohren dröhnen von dem Schuss, mein Magen dreht sich um, und in meinem Kopf pocht es immer stärker und stärker. Blut strömt aus Conrads Bein und vermischt sich mit dem Blut auf dem Boden. Ich sehe einen Schmetterling. Ich sehe ein Paar Damenschuhe. Ich sehe das verschwundene Mädchen. Und ich sehe den Tod.
»Wo ist sie?«, brülle ich ihn an.
»Fahr zur Hölle!«
Ich denke an Alyssa, die irgendwo gefesselt und mutterseelenallein Todesängste erleidet. Ich kenne Alyssa. Sie hat schwere Zeiten hinter sich. Zuerst verlor sie ihren Vater, dann ihre Mutter. Sie ist ein tapferes Mädchen, das gegen eine Welt ankämpft, die sich gegen sie verschworen hat. Sie musste so viel ertragen, dass ich sie vor noch mehr Schicksalsschlägen bewahren möchte. Das Klingeln in meinen Ohren lässt nach. Ich höre, wie das Blut auf den Fußboden tropft. Ich höre meinen eigenen Herzschlag.
Ich ramme den Lauf der Waffe in die Wunde. Mir wird schlecht. Ich halte das nicht mehr lange durch. Er muss endlich reden. Ich will, dass es aufhört. Er schreit.
»Ich meine das ernst, Conrad. Ich schwöre bei Gott, ich meine es ernst.«
»Bitte, Noah, bitte, bitte nicht.«
»Wo ist sie?«
»Warte«, sagt er. Er hyperventiliert und weint gleichzeitig. »Nur ganz kurz … Warte kurz.«
Ich warte. Gebe ihm die Chance, wieder zu sich zu kommen. Er wird mich nicht noch mal beleidigen. Er wird es nicht noch mal leugnen.
»Was wäre … Was wäre, wenn ich sie nicht entführt hätte, aber weiß, wer es war?«
Ich fühle mich erleichtert. Damit kann ich umgehen. »Und woher willst du das wissen?«
»Was wäre … Ich meine, o Gott, mein Bein … Das tut sauweh, Mann, echt. Ich brauch einen Krankenwagen.«
»Wo ist sie?«
»Du bist wahnsinnig, weißt du das? Du bist ein Psychopath.«
»Wo ist sie?«
»Was wäre …« Er verdreht die Augen und wird total bleich. Ich schüttle ihn. Er schaut mich an. »Ich fühl mich nicht gut.«
»Sag mir, wo sie ist, dann rufe ich einen Krankenwagen.«
»Einen Krankenwagen«, sagt er und wird langsam ohnmächtig.
Ich schlage ihm ins Gesicht.
»Was?«
»Alyssa.«
»Ja, Alyssa, Alyssa … Ich hab gehört, wie ein paar Typen darüber sprachen. Gestern Abend in der Kneipe. Was wäre, wenn ich dir sage, was ich gehört habe?«
»Wenn es mir hilft, sie zu finden, dann muss ich dir nicht noch eine Kugel verpassen.«
»Das waren Typen vom Such- und Rettungsdienst«, sagt er. »Von außerhalb. Die haben nach einer Frau gesucht, die kürzlich beim Wandern verschwunden ist. Ich hab die vorher noch nie gesehen, ich schwör’s.«
Such- und Rettungsdienst. Die Stadt Acacia Pines ist umgeben von riesigen Wäldern und zahlreichen Seen. Auswärtige verlaufen sich immer wieder in dieser Gegend. Die Einheimischen nennen die Wildnis hier schlicht The Pines. Die Leute vom Rettungsdienst nennen sie das Grüne Loch – schwarze Löcher absorbieren das Licht, das Grüne Loch verschluckt Wanderer und Camper. Wir schicken dann Suchtrupps los, und gelegentlich kommen auch Leute aus anderen Städten zur Unterstützung dazu. Meistens werden die Vermissten gefunden, manchmal aber auch nicht. »Und da hast du nicht daran gedacht, deinen Vater anzurufen? Du hast lieber nichts getan und zugelassen, dass eine vermisste Siebenjährige weiterhin vermisst bleibt?«
Sein Kopf kippt nach vorn. Ich drücke einen Finger in die Schusswunde, und er schreit auf. Ich ziehe den Finger wieder raus und wische ihn an meinem Hemd ab.
»Wieso hast du niemandem etwas davon gesagt?«
Er beißt die Zähne zusammen. »Ich wollte nicht in die Sache reingezogen werden.«
Ich sollte ihn einfach abknallen. Stattdessen sage ich: »Sag mir, was du gehört hast.«
Er würgt einen weiteren Blutklumpen hoch und spuckt ihn in die Pfütze. »Sie sagten, sie wollten sie verkaufen, und dass sie …« Er verzieht das Gesicht vor Schmerz. »Sie sagten, sie sei niedlich und würde alle Kriterien erfüllen. Sie wollten sie in den nächsten Tagen außer Landes bringen.«
»Das erklärt nicht, wie ihre Tasche in deinen Wagen gekommen ist.«
»Wenn du sie nicht reingetan hast, dann weiß ich nicht, wie das sein kann.«
»Und deine Fingerabdrücke auf ihrem Haarband?«
Seine Stimme nimmt einen weinerlichen Tonfall an, als er sagt: »Es gibt tausend Möglichkeiten, wie das passiert sein könnte. Vielleicht hab ich es aufgehoben und gedacht, es sei was anderes. Vielleicht lag es irgendwo herum, und sie hat es gar nicht getragen. Ich weiß es nicht. Vielleicht sind das ja gar nicht meine Fingerabdrücke. Es ist doch dein Job, so was rauszukriegen.«
»Was ist mit der Skibrille, die wir in deinem Handschuhfach gefunden haben?«
Er sagt nichts dazu.
»Willst du mir das nicht erklären?«
»Das ist … nicht so, wie du glaubst«, sagt er.
»Ach ja? Und was glaube ich?«
»Es ist nur eine Skibrille«, sagt er. »Die trage ich, wenn ich zum Jagen gehe, wenn’s kalt ist. Dafür werden diese Dinger doch verkauft. Komm schon, Noah, ich verblute.«
»Wo ist sie, Conrad? Du hast ihnen zugehört … Haben sie gesagt, wo sie sie hingebracht haben?«
»Weiß ich nicht«, sagt er und fängt an zu weinen. »Ich schwör dir, ich weiß es nicht.«
Ich schiebe meinen Finger wieder in die Wunde. Muss den Brechreiz unterdrücken. Er bäumt sich auf und ruckt nach vorn. Seine Adern schwellen an, und sein Gesicht wird so rot, wie ein Gesicht nur werden kann.
»Warte«, sagt er. Ich ziehe meinen Finger zurück und warte. »Sie sprachen von der alten Farm der Kellys«, sagt er. Tränen, Rotz und Blut laufen an ihm herab und sammeln sich in einer ekelhaften Lache auf seinem Hemd.
»Die Farm der Kellys«, sage ich.
»Die Farm der Kellys«, wiederholt er.
Ich stecke meine Waffe ein und verlasse das Büro.
Er schreit hinter mir her: »Du bist erledigt, Noah! Hast du gehört? Du bist fertig!«
»Was zum Teufel hast du mit ihm gemacht?«, fragt Drew.
Ich bekomme kein Wort heraus. Ich gebe Drew sein Handy zurück, steige die Treppe hinunter und schaue nicht zurück.
2
In der Gegend um das Sägewerk herum sind Bäume gefällt, erneut gewachsen und wieder gefällt worden. Verschiedene Bereiche befinden sich in verschiedenen Stadien der Wiederaufforstung, aber die Bäume in der Nähe der Fabrik sind jung und grün und kaum größer als ich. Die Straße, die zum Highway führt, ist eine Meile lang und ziemlich gewunden. Ich fahre so schnell es geht. Die Klimaanlage läuft auf Hochtouren. Das Sägemehl auf meiner Haut juckt. Ich fahre nach Norden Richtung Stadt. Das nächste Gebäude in der Nähe ist Earls Tankstelle. Der Parkplatz und der Highway davor sind so hell erleuchtet wie ein Football-Stadion. Der Inhaber heißt Earl Winters und ruft uns alle paar Monate an, wenn mal wieder jemand eine Ladung Schrot in seine Flutlichter geschossen hat. Und alle paar Monate kriegen wir dann wieder nicht heraus, wer es war. Vielleicht immer dieselbe Person. Vielleicht auch ganz verschiedene Leute, denn das Flutlicht ist ziemlich grell und lästig. Ich rase so schnell an der Tankstelle vorbei, dass es mich nicht gewundert hätte, wenn ich sie in meinem Sog mitgerissen hätte.
Auf dem Highway sind keine anderen Autos zu sehen. Kein Anzeichen von Leben. Dieser Teil des Landes ist so abgelegen, dass die Welt untergehen könnte, und niemand in Acacia Pines würde es merken. Der Highway ist die einzige Straße, die zur Stadt führt. Sie schlägt eine Schneise durch die Wälder, in denen die Geister der vermissten Wanderer herumspuken.
Jede halbe Meile passiere ich eine Abfahrt, die zu einem der kleinen oder größeren Bauernhöfe führt. Ich fahre an rot gestrichenen Scheunen vorbei, die tagsüber aussehen, als würden sie auf einem Meer von Weizen treiben, und nachts wie schwarze Löcher am Horizont. Normalerweise braucht man für die Strecke zehn Minuten, ich brauche nur sechs. Ich nehme die Abfahrt zur Kelly-Farm. Das große Zu verkaufen-Schild, das davor steht, ist während der letzten drei Jahre wegen der glühend heißen Sonne im Sommer und dem Frost im Winter schon ganz verblichen. Aus der asphaltierten Straße wird ein staubiger Kiesweg. Das Heck des Wagens schlingert, während der Split gegen den Unterboden prasselt. Das Haus liegt hinter einer Gruppe von Eichen, die verhindern, dass man es vom Highway aus sehen kann. Ich lenke den Wagen um sie herum und halte vor dem Gebäude, lasse die Scheinwerfer an und steige aus. Staubwolken wabern über den Kiesweg wie Nebelschwaden. Das Land hier draußen ist sehr trocken. Hier wachsen nur Brennnesseln, Stechginster und vereinzelte Grasballen.
Das Haus besteht aus Rotholz, die Verkleidung ist weiß, das Dach ragt spitz in den Himmel. In einem Unterstand stehen ein Auto und ein Traktor, die Reifen sind platt, an den Wänden stapeln sich Heuballen. Ich leuchte mit meiner Stablampe die Veranda ab. Kaputte Holzbohlen. Überall dichte Spinnweben. Etwas trippelt hastig davon. Die Scheinwerfer des Autos und das Mondlicht werden von den Fenstern reflektiert. Die Tür ist verschlossen, aber genauso alt und vernachlässigt wie alles andere. Sie leistet keinen großen Widerstand. Soweit ich weiß, war diese Tür während all der Jahre, in denen die Kellys hier wohnten, nie verschlossen. So ist das in dieser Gegend.
Im Haus hängt ein modriger Geruch in der Luft. Das letzte Mal war ich vor drei Jahren hier, als Jasmine Kelly, die ans andere Ende des Landes gezogen war, bei Drew anrief und ihm mitteilte, sie habe seit einer Woche nichts mehr von ihren Eltern gehört. Ich taste nach dem Lichtschalter, aber es gibt keinen Strom. Ich folge den Fußspuren im Staub. Die Dielenbretter knarren unter meinen Füßen. Ich spüre eine dumpfe Hitze. Schatten huschen über die Wände, während ich mit der Taschenlampe alles absuche. Es gibt eine Menge zu sehen – Sofas, einen Esstisch, Betten, Küchengeräte, einen Couchtisch mit Zeitschriften und einen Fernseher, der höchstens fünf Jahre alt sein kann. An den Wänden und auf den Regalen befinden sich Gemälde und Fotos. Es fühlt sich an, als würde das Haus darauf warten, dass jemand zurückkommt. Ich werfe einen Blick in das Schlafzimmer, in dem Ed und Leah Kelly sich vor drei Jahren mit Schlaftabletten umbrachten, ohne einen Abschiedsbrief zu hinterlassen. Der Hof war hoch verschuldet, und die Tochter erzählte immer, ihr Vater hätte behauptet, das Land sei verflucht, weil hier nur Unkraut wuchert.
Ich steige in den Keller. Keller sind die Orte, wo Männer wie Conrad Haggerty Mädchen wie Alyssa Stone gefangen halten. Ich öffne die Tür. Es riecht wie in einer Kloake. Ich halte die Luft an und beleuchte die Stufen. Sie knarren laut, als ich sie betrete. An den grauen Betonwänden hängen diverse Werkzeuge. Ich sehe eine alte Tiefkühltruhe und hoffe, dass sie leer ist. Auf einem alten Esstisch sind Stühle gestapelt, darunter stehen Kisten voller Gerümpel. Berge von Decken. Ich kann den Atem nicht länger anhalten. Der Geruch ist nicht besser geworden. Ich sehe einen alten Radiator, ein paar Fahrräder und ein altes Fernsehgerät. Auf einem Regal liegt ein Haufen ineinander verhedderter Christbaumkerzen. Hier ist es genauso staubig wie oben. Auf dem Boden sind Fußspuren von jemandem zu sehen, der in den Keller hinein und wieder hinaus ging.
Ich folge ihnen.
Ich muss nicht weit gehen.
Falls es einen Menschen gibt, der Grund hätte, an Flüche zu glauben, dann ist das Alyssa. Ihr Vater hat sein Leben dem Sägewerk geopfert. Er fing mit sechzehn an, schuftete dort achtzehn Jahre lang und verblutete auf dem Fußboden, nachdem ein Bandsägeblatt gerissen war, zehn Meter durch die Luft flog und eine Arterie in seinem Bein zerfetzte. Alyssa war damals sechs Monate alt. Vor drei Monaten ist ihre Mutter bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Ihr Onkel nahm sie danach zu sich. Ich kann nur beten, dass dies hier der letzte Schicksalsschlag für sie sein wird.
In diesem Augenblick versucht Alyssa verzweifelt, sich in einer Ecke hinter ein paar Farbkanistern und alten Brettspielen zu verstecken. Sie schreckt vor dem Licht meiner Taschenlampe zurück, als hätte sie ihr ganzes Leben nur im Dunkeln verbracht. Sie sieht ausgemergelt und verängstigt aus und hat ein blaues Auge, weil jemand sie geschlagen hat. Verklebte schwarze Haarsträhnen fallen in ihr verweintes Gesicht. Als ich sie so sehe, bricht es mir das Herz. Ich möchte sie umarmen und beschützen und sie nie mehr loslassen. Ich möchte die Welt für sie wieder in Ordnung bringen. Um ihr Fußgelenk ist eine Eisenkette geschlungen und mit einem Vorhängeschloss gesichert. Die Kette ist an der Wand befestigt. Ihr Gelenk ist aufgerissen und angeschwollen, und mein Magen rebelliert schon wieder. Wenn ich hier fertig bin, werde ich noch mal ein Wörtchen mit Conrad Haggerty reden.
»Alyssa«, sage ich. »Ich bin Deputy Harper.« Ich richte die Taschenlampe auf mich. Hier, das bin ich. Deputy Noah Harper, im Keller des Hauses eines toten Ehepaars, und dies ist mein letzter Einsatz.
Sie will noch weiter nach hinten rutschen, aber da ist kein Platz mehr. Sie hockt da, starrt mich an und sagt kein Wort. Ich weiß nicht, ob sie mich erkennt. An dem Tag, als ihre Mutter starb, hatten wir notgedrungen miteinander zu tun.
»Es wird alles gut.« Ich stelle die Taschenlampe aufrecht auf den Boden, damit sie zur Decke strahlt. Ich versuche, locker zu klingen. Nett und freundlich. »Alles wird gut«, wiederhole ich, und ich meine es auch so. »Er kommt nicht wieder.«
Sie starrt mich an. Ihre Fingerspitzen sind blutig, weil sie versucht hat, den Bolzen, an dem die Kette hängt, aus der Wand zu lösen.
»Ich suche etwas, womit ich die Kette abkriege, okay? Ich finde hier bestimmt irgendwas, womit ich dich befreien kann.«
Sie sagt nichts.
»Ich hole dich hier raus, Alyssa. Und dann bringe ich dich zurück zu deinem Onkel.«
3
Ich finde ein paar Bolzenschneider, aber sie sind total verrostet und stumpf. Also schaue ich mir das andere Ende der Kette an. Es hängt in einem Bolzen an der Wand neben der Matratze, auf der Alyssa geschlafen hat. Ich finde einen Satz Steckschlüssel. Einer davon passt zu den Schrauben, die den Bolzen festhalten. Meine Finger schmerzen so stark von den Schlägen, die ich Conrad Haggerty verpasst habe, dass ich dem Schlüssel einen Tritt verpassen muss, um ihn zu bewegen. Aber schließlich kann ich ihn drehen. Die drei übrigen Schrauben lassen sich leichter lösen.
Ich habe erwartet, dass sie sofort wegläuft, wenn die Kette ab ist, doch sie bleibt sitzen. »Onkel Frank macht sich schon Sorgen um dich. Alle machen sich Sorgen wegen dir. Wir haben den Mann verhaftet, der das hier getan hat. Er kann dir nicht mehr wehtun.«
Sie zieht die Beine an und schlingt die Arme um ihre Knie.
»Es ist Zeit, nach Hause zu gehen, Alyssa. Aber erst mal musst du eine wichtige Entscheidung treffen. Ich kann dich tragen, oder du kannst selber laufen. Was ist dir lieber?«
Ganz langsam streckt sie eine Hand aus. Sie zittert. Ich ergreife sie, und wir stehen zusammen auf. Einen Moment lang bewegt sie sich nicht, dann führe ich sie zur Treppe. Ich trage die schwere, rostige Kette für sie. Wir steigen nach oben, und der Modergeruch im Erdgeschoss ist geradezu erfrischend im Vergleich zum Keller, wo ein Eimer Alyssa als Toilette diente. Draußen bleiben wir kurz auf der Veranda stehen. Alyssa schaut zum Himmel, und ich lasse meinen Blick über die Felder schweifen. Wir atmen beide tief durch.
Wir gehen zum Auto. Der Staub, den ich aufgewirbelt habe, ist verschwunden. Ein warmer Lufthauch weht über das Brachland, die hohen Gräser neigen sich in unsere Richtung. Kleine Städte haben den Vorteil, dass man viel vom Himmel sehen kann. In diesem Moment ist der Anblick geradezu spektakulär. Unter dem weiten Himmel fühle ich mich sehr klein, und Alyssa wirkt noch kleiner. Indem ich zu einem Monster wurde, habe ich ihr das Leben gerettet. Ich weiß nicht, was uns beiden jetzt bevorsteht. Ob sie sich davon erholen wird, wie damals, als ihre Mutter starb, oder ob sie sich vor der Welt verstecken will. Ob ich in einer Zelle neben der von Conrad Haggerty enden oder von seinem Vater fertiggemacht werde. Große Fragen unter einem weiten Himmel.
Ich setze Alyssa auf den Beifahrersitz, lege die Kette auf den Boden und frage sie, ob das so in Ordnung ist und ob sie Schmerzen hat. Sie starrt mich an und sagt nichts. Ich lege ihr den Sicherheitsgurt an. Keine Sirenen in der Ferne, auch keine Blaulichter. Vielleicht hat Drew keine Meldung gemacht. Vielleicht hatte er keinen Empfang. Vielleicht hat er angerufen, aber Conrad hat ihnen nichts von der Kelly-Farm erzählt. Oder Conrad ist verblutet.
Ich öffnet den Kofferraum und werfe mein blutiges Hemd rein. Jetzt trage ich nur noch meine Uniformhose und das weiße T-Shirt, das halbwegs sauber aussieht. Ich steige ins Auto und betätige den Hebel für die Scheibenwaschanlage. Die Wischer bewegen sich und erzeugen erst Schlieren in der Staubschicht, dann saubere Bögen auf der Windschutzscheibe. Wir fahren in die Stadt. Alyssa schaut aus dem Fenster. Ich schalte die Klimaanlage aus und öffne das Fenster. Ich denke daran, dass ich Alyssas Onkel anrufen muss. Und Sheriff Haggerty. Ich muss meine Frau anrufen. Schließlich telefoniere ich mit Dan Peterson und bitte ihn, mich in fünfzehn Minuten vor dem Krankenhaus zu treffen. Ich bitte ihn, seinen Lieferwagen mitzubringen. Er sagt, geht in Ordnung, aber bevor er fragen kann, warum, bricht das Gespräch ab. Hier draußen, wo der Himmel frei ist von Lichtüberflutung, sind Handy-Verbindungen Glückssache.
Die Bauernhöfe stehen jetzt näher an der Straße, und bald stehen sie noch dichter zusammen. Das Handy funktioniert wieder. Die Weiden werden von Einfamilienhäusern mit kleinen Gartengrundstücken abgelöst, als wir den Stadtrand erreichen. Wir fahren über eine rote Brücke mit riesigen Stahlträgern, die über einen fünfzehn Meter breiten und endlos langen Fluss führt. Wir erreichen die Hauptstraße, fahren an Geschäften, Parkbänken und den bunt beleuchteten Bars vorbei. Eine Viertelmeile geradeaus und dann rechts liegt die Polizeistation im Zentrum von Acacia Pines, einer Provinzstadt mit rund zwanzigtausend Einwohnern. Doch wir biegen nach links ab, fahren am Kino, einer Schule und einem Park vorbei und erreichen das Acacia Hospital.
Das Krankenhaus ist ein dreistöckiges weißes Backsteingebäude mit einem flachen Dach, auf dem zahlreiche Satellitenschüsseln stehen. Quadratische Fenster, kein Licht dahinter. Auf dem Parkplatz davor stehen ungefähr ein Dutzend Fahrzeuge, die meisten gehören den Angestellten. Normalerweise befinden sich drei Krankenwagen vor dem Eingang, aber im Moment fehlt einer davon. Es ist ein Kleinstadt-Hospital mit sechzig Betten. Die Chirurgen und Ärzte können Knochenbrüche schienen und Prothesen anlegen, Herzschrittmacher einsetzen und eine Dialyse durchführen, aber eine Organtransplantation bekommt man hier nicht. Ich weiß das, weil Drew vor einigen Jahren krank wurde und eine neue Niere brauchte. Dafür musste er eine weite Reise antreten.
Ich parke direkt neben dem Lieferwagen von Dan Peterson. Das Heck ist ganz schwarz von den Abgasen. Jemand hat mit dem Finger etwas in den Dreck geschrieben: Ach, wäre deine Frau doch auch so schmutzig. Er lehnt an der Seite, mit den Händen in seinen Taschen, und seine Wampe wölbt sich über den Gürtel. Im Mundwinkel klebt eine Zigarette. Peterson ist Allround-Handwerker und schon fünf Jahre jenseits des Renteneintrittsalters. Das Sägewerk und der Steinbruch und die Farmen mögen ja für den Herzschlag des Städtchens unerlässlich sein, aber wenn Dan irgendwann in den Ruhestand geht, dann müssen wir alle lernen, wie man Vogelhäuschen baut, Dächer deckt oder Gräber auf dem Friedhof aushebt.
Ich öffne die Beifahrertür und helfe Alyssa, sich zur Seite zu drehen, damit sie ihre Füße auf den Boden stellen kann. Dan starrt sie an, er kennt sie aus den Nachrichten.
»Kannst du das Schloss knacken?«, frage ich.
»Dauert keine Minute.«
Tatsächlich braucht er drei.
»Sagst du mir, wer sie entführt hat?«, fragt er.
»Kommt morgen in den Nachrichten.«
»Jedenfalls bin ich froh, dass es ihr gut geht«, sagt er und wirft einen Blick auf meine zerschlagenen, geschwollenen Hände. Er salutiert lässig und fährt davon.
Ich lege die Kette auf den Beifahrersitz und wische mir die Hände an der Hose ab. Dann führe ich Alyssa an der Hand ins Krankenhaus, so, wie ich sie auch aus dem Haus der Kellys geführt habe. Ärzte und Krankenschwestern erwarten uns an der Tür. Ich vermute, dass der fehlende Krankenwagen unterwegs ist, um Conrad zu holen. Alyssa war in den Nachrichten, und alle erkennen sie, aber sie machen keine große Sache daraus, um sie nicht zu ängstigen.
Eine Krankenschwester in den Vierzigern, schlank und mit grauen Strähnen im Haar, kommt uns entgegen. Ich spüre, wie Alyssa mich fester anfasst. Die Krankenschwester nickt mir knapp zu, lächelt Alyssa an und geht in die Hocke. »Wie geht’s dir, Herzchen?«, fragt sie. Alyssa versteckt sich hinter mir. »Ich bin Schwester Rosie, aber du kannst mich Rose nennen, wenn du möchtest. Wollen wir dich erst mal ein bisschen waschen, hm?«
Ich schaue Alyssa an. »Du kannst mit ihr gehen«, sage ich. »Ich bleibe hier und passe auf.«
Sie hebt den Zeigefinger, um mir anzudeuten, dass sie etwas sagen will. Sie lässt mich los, und ich gehe in die Hocke. Sie beugt sich vor und legt die Hände zusammen, um mir ins Ohr zu flüstern: »Ist Onkel Frank böse auf mich?«
»Böse?«
»Weil ich mit dem Mann gegangen bin. In der Schule sagen sie immer, wir dürfen nicht in … fremde Autos … einsteigen. Ich wollte nicht, aber er hat mich gezwungen.«
»Das weiß ich doch, Herzchen.«
»Hat der Mann eine Bank ausgeraubt?«
»Wie kommst du denn darauf?«
»Er hat eine Maske aufgehabt, wie ein Räuber.«
Die Skibrille, die wir in Conrads Wagen gefunden haben. Das bedeutet, er wollte nicht von ihr erkannt werden. Also hatte er geplant, sie irgendwann wieder freizulassen.
»Das war kein Räuber«, sage ich. »Das war einfach nur ein böser Mann.«
»Ja, wirklich böse«, sagt sie. Sie umarmt mich fest. Ich drücke sie.
»Und jetzt gehst du mit Rose. Sie wäscht dich, und dann bringen wir dich zu deinem Onkel. In Ordnung?«
Sie umklammert mich immer noch. »Wird der böse Mann wiederkommen?«
»Nein.«
»Und wenn doch, rettest du mich dann?«
»Natürlich. Ich werde alles dafür tun.«
Sie schaut mich an. »Versprochen?«
»Versprochen.«
Die Krankenschwester führt Alyssa in ein Behandlungszimmer. Eine andere Schwester kommt zu mir. Sie ist Mitte zwanzig, hat kurze blonde Haare und trägt eine modische Brille. Sie heißt Victoria und ist meine Schwägerin.
Sie legt eine Hand auf meinen Arm. »Meine Güte, Noah, wo hast du sie gefunden?«
»Eingesperrt im Keller der alten Kelly-Farm.«
Ihre Brille bewegt sich ein wenig, als sie das Gesicht verzieht. »Wer hat sie entführt?«
»Conrad Haggerty.«
Ein paar Sekunden lang sagt sie gar nichts. Wahrscheinlich malt sie sich aus, was sie jetzt am liebsten mit Conrad tun würde. »Dieser Dreckskerl«, sagt sie, spuckt die Worte geradezu aus. »Bist du sicher?«
»Ganz sicher.«
»Das wird übel ausgehen«, sagt sie.
Ich schüttle den Kopf. »Übel ist noch untertrieben.«
4
Der Parkplatz ist blau und rot erleuchtet, als der Krankenwagen eintrifft, gefolgt von einem Streifenwagen. Eine Reihe von Bäumen grenzt den Parkplatz von der Straße ab, Äste und Blätter schlucken das Licht. Ich schaue durch das Fenster des Sprechzimmers im obersten Stock nach unten, während die Sanitäter Conrad aus dem Krankenwagen ziehen. Anscheinend haben sie ihm ein Schmerzmittel verabreicht, denn er ist wieder besser gelaunt. Drew und Sheriff Haggerty steigen aus dem Streifenwagen. Rein äußerlich unterscheiden sich der alte Haggerty und sein Sohn kaum voneinander, nur durch die Anzahl der Falten, die Haarfarbe und natürlich den Hufeisenbart, den der Sheriff angeblich schon bei seiner Geburt trug.
Ich stehe am Fenster und habe Kühlkissen auf den Händen. Victoria hat mir angeboten, sie zu reinigen und zu röntgen, aber ich sagte ihr, das hätte noch Zeit. An den Wänden hängen Plakate, die den menschlichen Körper zeigen. Zeichnungen von allen Details der Schulter-, Fuß- und Handgelenke. Bilder, die uns daran erinnern, wie zerbrechlich wir sind. In einer Ecke steht ein Modell des menschlichen Skeletts. In den Schrankschubladen liegen Latex-Handschuhe, Verbandszeug und Spritzen. Es riecht nach Desinfektionsmittel. Sheriff Haggerty brüllt jemanden vor dem Haupteingang an, aber ich kann nicht erkennen, wen er da zusammenstaucht. Dann steckt er die Daumen in seinen Gürtel, schaut nach oben und sieht mich am Fenster. Wir starren einander ein paar Sekunden lang an, bevor er seinem Sohn ins Krankenhaus folgt.
Ich warte auf ihn.
Er kommt nicht.
Ich warte noch etwas länger.
Er kommt immer noch nicht.
Nach zehn Minuten möchte ich nur noch, dass es endlich vorbei ist.
Ich zucke zusammen, als die Tür aufgeht. Es ist nicht der Sheriff. Es ist Maggie, meine Frau, und sie ist auf hundertachtzig. Ihre Augen funkeln, ihr Gesicht ist knallrot und angespannt. Sie hat sich die Haare hastig zu einem Pferdeschwanz gebunden. Sie schließt die Tür, und ich trete vom Fenster weg. Sie blickt auf meine Hände.
»Dann stimmt es also«, sagt sie.
Ich gehe zu ihr, aber sie wehrt mich mit ausgestreckter Hand ab. Sie kocht vor Wut. Sie ist nicht als meine Frau hier, sondern als Anwältin. Aber nicht meine.
»Wie schlimm ist es?«, frage ich.
»Setzen wir uns.«
Wir nehmen auf den beiden Stühlen vor dem Schreibtisch Platz und sitzen so dicht beieinander, dass unsere Knie sich fast berühren. Ich achte darauf, dass die Kühlkissen nicht herunterfallen. Die Schwellungen haben nicht nachgelassen.
Sie hebt einen Finger. »Du hast ihn geschlagen.«
»Es ging nicht anders.«
Sie hebt noch einen weiteren Finger. »Und du hast auf ihn geschossen.«
»Er hat sie entführt, Maggie.«
Der dritte Finger geht hoch. »Du hast Drew gefesselt und mit der Waffe bedroht.«
»Er hat sie angekettet wie einen tollwütigen Hund.«
Sie hält noch einen Finger hoch und sagt: »Außerdem hast du ihm Beweismittel untergeschoben und ihn reingelegt.«
Ich muss mich sehr beherrschen, um nicht aufzuspringen. »Soll das ein Witz sein? Behauptet er das etwa?«
»Nein, aber das wird er tun. Du sagst, es gab keine andere Möglichkeit, als so zu handeln, wie du gehandelt hast. Aber das stimmt nicht. Du hättest ihn verhaften können. Dann hätte ich die Möglichkeit gehabt, einen Deal mit ihm zu machen. So hätten wir Alyssa retten und Conrad für lange Zeit in den Knast bringen können.«
»Das ist doch Blödsinn. Sein Vater mag ihn vielleicht nicht besonders, aber er lässt ihm alles durchgehen. Das weißt du besser als jede andere.«
Sie lehnt sich zurück und starrt mich an.
Meine Hände zittern. Ich versuche mich zu beruhigen. »Tut mir leid, das hätte ich nicht sagen sollen.«
»Hast du ihn deshalb so zugerichtet? Wegen dem, was passiert ist, als wir noch Kinder waren?«
»Natürlich nicht«, sage ich. Aber ich muss mir eingestehen, dass ich daran dachte, als ich ihn verprügelt habe. Jedenfalls waren wir damals keine Kinder mehr – wir waren Teenager. Aus ihrem Mund klingt es so, als wäre es eine Kindheitsepisode. »Es ist wie beim Dritten Newtonschen Gesetz – auf jede Aktion gibt es eine gleich starke Reaktion. Vielleicht hättest du Alyssa ja auf diese Weise tatsächlich retten können, aber genauso gut wäre das Gegenteil möglich gewesen.«
»Du hättest mir vertrauen sollen«, sagt sie. »Du hättest Drew und Sheriff Haggerty vertrauen sollen und auch dir selbst. Du hättest dem System vertrauen sollen, aber stattdessen hast du das Gesetz gebrochen und …«
»Ich wollte ihr Leben nicht aufs Spiel setzen. Ich kenne ihn, Maggie. Er hätte niemals …«
Sie hebt die Hände. »Lass mich ausreden, Noah.«
»Conrad hätte sie sterben lassen.«
»Ich sagte, du sollst mich ausreden lassen.«
Ich stehe auf. Ich gehe wieder zum Fenster und schaue auf den Parkplatz. Motten, kaum kleiner als meine Handteller, klatschen gegen die Straßenlaternen. Der Himmel ist nicht mehr so klar wie draußen auf der Kelly-Farm. Die Sterne verblassen hinter dem Lichtschleier der Stadt. »Du hast recht. Es tut mir leid.«
»Wir können ihn nicht anklagen«, sagt sie. Ich drehe mich lieber nicht zu ihr um, weil ich ihren enttäuschten Gesichtsausdruck nicht ertrage. »Ich weiß, dass du glaubst, du hättest richtig gehandelt. Und ich verstehe sogar, wieso du das denkst. Aber das, was du getan hast, macht es unmöglich, ihn zu verurteilen. Du hast seine Rechte verletzt, und deshalb wird er davonkommen. Und das Schlimmste daran ist, und es tut mir wirklich weh, das zu sagen: Dass du das nicht erkannt hast, macht dich zu einem schlechten Polizisten.«
Ich habe das durchaus erkannt. Die Tatsache, dass ich darüber hinwegging, macht es nur noch schlimmer.
»Er kann dich belangen. Du hast ihn gefesselt, geschlagen und angeschossen. Es gibt zahllose Anwälte, die ihn liebend gern vertreten würden. Sie werden von überall her anrufen. Ein, zwei Tage lang werden die Medien dich feiern, aber dann machen sie dich fertig.«
Ich schaue auf meine Hände unter dem Kühlkissen. Die Knöchel sehen aus wie mit Haut überwucherte Kugellager.
»Du hast Scheiße gebaut, Noah, und da kommst du nicht mehr raus.«
»Ich hab getan, was ich tun musste«, sage ich, aber es klingt nicht überzeugend. Vor allem deshalb, weil ich weiß, dass Conrad auf freiem Fuß bleiben wird.
Sie schüttelt den Kopf. »Du hast das getan, was du schon seit zehn Jahren mit Conrad tun wolltest.«
»Das hat überhaupt nichts damit zu tun.«
»Ich wünschte, ich könnte dir das glauben. Ganz egal, was du denkst, wir hätten einen Deal machen können. Wir hätten sie gerettet, und Conrad wäre in den Knast gekommen, und du hättest deinen Job behalten.«
»Sein Vater hätte das ganz bestimmt verhindert.«
Sie steht auf, tritt hinter den Stuhl und stützt sich auf der Lehne ab. »Was redest du denn da, Noah? Sheriff Haggerty ist doch nicht dein Feind. Er hat dich immer gut behandelt. Er hätte garantiert das Richtige getan, aber du hast zugelassen, dass Emotionen dein Urteilsvermögen beeinträchtigen. Du hast dich von einer alten Geschichte beeinflussen lassen.«
Sie hat recht. »Tut mir leid.«
»Ehrlich gesagt, nehme ich dir das nicht ab.«
Meine Kopfschmerzen kehren zurück. »Und was passiert jetzt?«
»Jetzt überlegen wir, wie wir dich vor dem Knast bewahren können.«
Ich massiere mir die Schläfen. Es bringt nichts. »Das hab ich nicht gemeint.«
»Nicht?«
»Nein. Ich meinte uns. Was ist mit uns?«
Sie schiebt sich einige lose Haarsträhnen hinter die Ohren. Ihr Zorn klingt ab, sie sieht jetzt eher traurig aus. »Wäre schön gewesen, wenn du früher darüber nachgedacht hättest«, sagt sie. Sie dreht sich um und geht zur Tür.
»Das heißt?«
»Das heißt, dass du beinahe jemanden umgebracht hättest, Noah. Du hast einen Menschen gefoltert, und ich sehe kein Anzeichen von Bedauern bei dir, keine Reue. Und wenn du es wieder tun könntest, würdest du es machen.«
»Maggie …«
»Was bedeutet, dass du nicht mehr der Mann bist, den ich geheiratet habe. Ich muss jetzt los.«
»Bitte bleib«, sage ich, aber sie ist schon weg.
5
Im Erdgeschoss wird Conrad operiert, und eine Ärztin versichert mir, dass er keine bleibenden Schäden davontragen wird. Sie erklärt mir, die Kugel habe den Knochen getroffen, aber die Arterien verfehlt, und ich tue so, als sei das Absicht gewesen. Victoria röntgt meine Hände. Sie sagt, ich hätte ein paar Frakturen, die sie nur mit einem Verband und einer Schiene behandeln können.
»Eis und Schmerztabletten sind in den nächsten Tagen angesagt«, sagt sie.
»Werden sie wieder heilen?«
»Werden sie. Du kannst es als Kriegsverletzung abbuchen. Ist Maggie sehr sauer?«
»So sauer, wie man nur sein kann.«
»Das wird schon wieder«, sagt sie.
»Glaube ich nicht. Wie geht es Alyssa?«
»Ziemlich mitgenommen, aber es geht ihr gut. Die Kleine ist hart im Nehmen.«
»Wurde sie vergewaltigt?«, frage ich, und mein Magen krampft sich zusammen.
Sie sieht mich mitfühlend an. »Er hat ihr nichts angetan. Falls er es tun wollte, ist er jedenfalls nicht mehr dazu gekommen.«
Nach dieser Antwort fühle ich mich besser in Bezug auf das, was heute Nacht passiert ist. Sie verlässt das Zimmer, um mir ein paar Schmerztabletten zu besorgen. Ich starre die Tür an und frage mich, wer wohl als Nächstes reinkommen wird. Es ist ausgerechnet Pfarrer Frank Davidson. Als er eintritt, sieht er größer aus als bei unserem Gespräch am Nachmittag. Das liegt wohl an der guten Nachricht, dass seine Nichte gefunden wurde. Er hat sich seit Tagen nicht rasiert, und seine dunklen Haare stehen in alle Richtungen ab. Lächelnd kommt er auf mich zu und streckt die Hand aus. Sein Glaube wurde gerade ziemlich auf die Probe gestellt. Andererseits denkt er bestimmt, dass Gott ihm seine Nichte zurückgebracht hat. Ich frage mich nur, wie das zu der Tatsache passt, dass sie ihm überhaupt weggenommen wurde. Als er mir die Hand gibt, zerquetscht er sie fast, und ich unterdrücke einen Schmerzensschrei. Die Schiene hat er überhaupt nicht bemerkt. Vor dem gestrigen Tag hatte ich nur einmal mit ihm zu tun, als der Wagen seiner Schwester von einem Holztransporter überrollt wurde.
»Vielen Dank«, sagt er. »Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank.«
»Gern geschehen.«
»Ich hätte es nicht ertragen«, sagt er. »Nicht noch mal.«
»Ich weiß.«
Er lässt meine Hand los. »Und was ist mit Ihnen, Noah? Geht es Ihnen gut? Ich habe gehört, was Sie getan haben.«
»Sieht so aus, als müssten Sie ein paar Gebete für mich sprechen, Herr Pfarrer.«
»Was Sie getan haben – so etwas wiegt schwer auf dem Gewissen eines braven Mannes. Sie können es jetzt vielleicht noch nicht ermessen, aber es wird Ihnen zu schaffen machen. Ich bin dankbar, dass Sie mir meine kleine Nichte zurückgebracht haben, wirklich. Ich möchte …« Er findet nicht die rechten Worte. Stattdessen zupft er an seinem Priesterkragen und denkt fieberhaft nach. Er schaut mich an, und ich erwidere seinen Blick. Schließlich zuckt er mit den Schultern. »Ich bin immer für Sie da, Noah. Was auch geschieht.«
Er bittet mich, am nächsten Tag zu ihm zu kommen. Ich schaue ihn freundlich an und erkläre ihm, dass ich momentan nicht wirklich frei über meine Zeit verfügen kann. Er klopft mir auf die Schulter, nickt ernst und dankt mir noch mal dafür, dass ich Alyssa gerettet habe. Er verlässt das Zimmer genau in dem Moment, als Victoria zurückkommt. Sie reicht mir einen kleinen Plastikbehälter mit Schmerztabletten.
»Nimm sie nur, wenn du sie wirklich brauchst. Und lass es, wenn du sie nicht brauchst.«
Ein ernst gemeinter Rat, denn wir beide haben oft genug gesehen, was passiert, wenn Menschen sich nicht daran halten. Ich nehme erst mal zwei.
»Und das mit Maggie wird schon wieder«, sagt sie. »Die Sache hat sie ganz schön aufgeregt. Sie braucht halt ein bisschen Zeit.«
»Hoffentlich hast du recht.«
»Sheriff Haggerty bat mich, dir auszurichten, dass er draußen auf dem Parkplatz auf dich wartet.«
»Okay. Danke.«
»Soll ich mitkommen? Es könnte nicht schaden, einen Zeugen zu haben, falls er die Absicht hat, dich zu erschießen.«
»Das geht schon in Ordnung«, sage ich. »Aber du kannst den Chirurgen sagen, sie sollen sich vorsichtshalber bereithalten.«
Ich stecke die Tabletten in die Hosentasche und gehe los. Ärzte und Schwestern drehen sich zu mir um, während ich über den Gang laufe. Ich fühle mich wie ein Verurteilter auf dem Weg von der Zelle zum Galgen. Die Eingangstür schiebt sich auf, und draußen ist es immer noch genauso dunkel und warm wie vorher. Die Lampen, die den Parkplatz erleuchten, summen vor sich hin. Sheriff Haggerty lehnt mit verschränkten Armen an seinem Wagen, sein Hemd spannt sich über seinen breiten Schultern. Ich frage mich, wo Drew ist. Entweder wurde er gefeuert oder nach Hause geschickt. Oder beides.
»Noah«, sagt er und nickt mir zu. Dann schaut er zum Krankenhaus, wo zahlreiche Gesichter hinter den Scheiben zu sehen sind. Mit etwas Glück wird er mich nicht erschießen.
»Sheriff.«
»Du hast auf meinen Sohn geschossen.«
»Stimmt.«
»Das hättest du nicht tun sollen.«
»Dein Sohn hätte Alyssa Stone nicht entführen sollen«, sage ich. »Dein Sohn hätte sie nicht an eine Wand im Keller ketten sollen, damit sie ihm willenlos ausgeliefert ist.«
Er schüttelt den Kopf. »Seiner Aussage nach hat er gehört, wie zwei Typen in der Kneipe darüber sprachen. Und diese Information hat er dir gegeben.«
»Und das glaubst du ihm?«
»Er ist mein Sohn.«
Genau das habe ich erwartet. Alles, was ich tat, fühlte sich richtig an. Und jetzt fühlt es sich sogar doppelt richtig an. Wenn ich Conrad verhaftet hätte, um ihn zu verhören, hätten wir kein Wort aus ihm rausbekommen. Und Alyssa wäre in diesem Keller gestorben.
»Diese zwei Typen in der Kneipe hat es nie gegeben«, sage ich. »Und wenn doch, dann hätte er sich selbst einen Gefallen getan, wenn er dir das ein bisschen früher erzählt hätte.«
Er nimmt die Arme herunter und steckt die Daumen in den Gürtel. »Du weißt genauso gut wie ich, dass Conrad sich keine Gedanken über andere macht. Wenn das Haus seines Nachbarn brennt, während er fernsieht, würde er nicht aufstehen und etwas unternehmen. Ich sage nicht, dass es richtig war, nichts zu unternehmen, als er hörte, was diese Typen mit dem Mädchen gemacht haben. Ich sage nur, dass er eben so veranlagt ist. Was mich allerdings ziemlich aufregt, ist die Tatsache, dass du ganz genau weißt, wie er veranlagt ist.«
»Er hat sie entführt«, sage ich. »Wenn nicht, hätte er es mir gleich beim ersten Mal gesagt, als ich ihn danach fragte.«
»Du meinst, als du damit angefangen hast, ihn zu foltern.«
»Also gut, gehen wir kurz mal davon aus, dass er die Wahrheit gesagt hat. Dann hätte er einfach so dagesessen und all das mit sich machen lassen? Wie blöd kann man denn sein? Er hätte mir doch gleich sagen können, was er angeblich gehört hat. Er hätte nicht warten müssen, bis ich ihm ins Bein schieße.«
»Er ist nicht blöd, aber er ist auch nicht sehr intelligent«, sagt Sheriff Haggerty und glaubt garantiert nicht selbst an das, was er mir da auftischt. Er weiß ganz genau, dass jeder halbwegs normale Mensch die beiden Rettungshelfer erwähnt hätte, als ich mit der Befragung anfing.
»Wir haben ihre Tasche in seinem Lieferwagen gefunden.«
»Er sagt, jemand hätte sie ihm untergeschoben.«
»Und seine Fingerabdrücke sind auf ihrem Haarband«, sage ich.
»Die können auf tausend verschiedenen Wegen dort gelandet sein.«
»Das hat er auch gesagt.«
Er erwidert nichts darauf. Wir starren uns eine Weile an. Dann breche ich das Schweigen. »Komm schon, Sheriff, du weißt ganz genau, dass man Conrad nicht verprügeln muss, um sein Gedächtnis aufzufrischen.«
»Du hättest ihn zum Verhör bringen müssen.«
»Du wärst nicht objektiv gewesen.«
Ich weiß, was jetzt passiert. Und er weiß, dass ich es weiß. Er legt alle Kraft in seinen rechten Haken, und ich weiche nicht aus. Der Schlag bringt meine Zähne zum Klingeln, und mein ganzes Gesicht wird taub. Ich falle zu Boden.
»Steh nicht auf«, sagt er. Ich bleibe liegen. Er baut sich vor mir auf, und das Licht einer Lampe auf dem Parkplatz verpasst ihm einen Heiligenschein. »Ich sage dir jetzt, was Sache ist. Du hast meinen Sohn gequält, und das hättest du nicht tun sollen. Du bist so weit über die rote Linie gegangen, dass es kein Zurück mehr für dich gibt. Ich hab dich immer gemocht. Damals, als ich deinen Vater jeden zweiten Tag in die Ausnüchterungszelle sperren musste, war ich froh, dass ich dir helfen konnte. Weil du ein guter Junge warst und so einen Vater nicht verdient hattest. Ich war stolz auf dich, als du zur Polizei gegangen bist. Scheiße, du bist für mich mehr ein Sohn gewesen als mein eigener. Wir haben einiges hinter uns, und nur deshalb werde ich darauf verzichten, dich einzusperren. Aber du gibst mir deine Marke, deine Knarre und die Wagenschlüssel. Und dann sieh zu, dass du so schnell wie möglich aus Dodge verschwindest und nie mehr zurückkommst. Wenn ich dich noch einmal hier sehe, sperr ich dich ein und lass dich verrecken, das schwör ich dir.«
6
Zwölf Jahre später
Es ist die Art Großstadt-Bar mit Neonleuchten in den Fenstern und riesigen TV-Bildschirmen an den Wänden. Die Theke ist mit hellem Holz vertäfelt, die Wände sind dunkler und haben eine Patina aus Kratz- und Schlagspuren angesetzt. In der Ecke stehen eine Jukebox, die nur Musik aus den Siebzigern spielt, und ein Billardtisch, der neuen Filz benötigt, seit jemand vor ein paar Wochen seinen Drink darauf ausgekippt hat. Wir haben dreißig Biersorten im Angebot, dreißig verschiedene Weine sowie Schnaps aus allen möglichen Ländern der Welt. Freitagabend gibt’s Livemusik, Dienstag ist Ladies Night, und der Sonntagabend ist – wie es scheint – für Raubüberfälle reserviert. Ich arbeite hier seit zwölf Jahren und bin seit zehn Jahren Miteigentümer. In dieser Zeit wurden wir zweimal überfallen, und der Typ, der jetzt vor mir steht, startet gerade den dritten Versuch. Immer wieder sonntags. Sein schlaffes Haar ist schmutzig, sein Gesicht mit Pickeln übersät, er ist sehr dünn und steht gekrümmt da. Die Hand mit der Waffe zittert ziemlich, und wenn die Knarre versehentlich losgeht, könnte die Kugel mich oder irgendwas anderes im Umkreis von einer Meile treffen.
»Wir sind keine Bank«, sage ich und breite die Arme aus, um ihm zu signalisieren, dass ich es gut mit ihm meine. »Nimm die Knarre runter, und geh wieder raus, dann lassen wir das alles auf sich beruhen, okay?«
Er schaut nach links, dann nach rechts. Er kann das, was er sucht, offenbar nicht finden. Oder vielleicht doch. Die Jukebox spielt einen Song von Pink Floyd, die gerade davon singen, angenehm betäubt zu sein. Was so ungefähr meinen derzeitigen Zustand beschreibt.
»Geben Sie mir einfach, was Sie haben.«
»Ich hätte einen guten Rat für dich.«
»Ich will keinen Rat.«
»Kostet nichts. Ein Rat und ein paar Erdnüsse. Das sind die beiden Dinge, die es hier umsonst gibt. Allerdings gibt’s die Erdnüsse nur, wenn man vorher ein Getränk bestellt hat. Wenn wir an jeden Erdnüsse verteilen würden, der sich keinen Drink bestellt, würde es darauf hinauslaufen, dass wir uns irgendwann keine Erdnüsse mehr leisten können.«
Das scheint ihn zu verwirren. Wieder schaut er nach links und nach rechts, aber diesmal bewegen sich nur seine Augen. Die Knarre wackelt ein bisschen.
Ich mache weiter. »Und wenn wir uns keine Erdnüsse mehr leisten können, dann können wir uns auch eine Menge anderer Dinge nicht mehr leisten. Du verschwendest deine Zeit, wenn du hier reinkommst und mit einer Knarre herumwedelst, weil es bei uns nämlich nichts zu holen gibt.«
»Ernsthaft, Mann? Ernsthaft? Willst du sterben?«
Ich zucke mit den Schultern, als würde mich das nicht kratzen. Aber es kratzt mich natürlich schon. Das Herz schlägt mir bis zum Hals, aber Typen wie er sind wie Hunde – wenn du ihnen zeigst, dass du Angst hast, haben sie gewonnen. Er wird sich das Geld in der Kasse greifen, dann mein Portemonnaie, und dann wird er allen Gästen ihr Geld und die Handys abnehmen. Vielleicht nimmt er eine Geisel oder erschießt jemanden. Natürlich sind solche Typen unberechenbar. Wenn man also keine Angst zeigt, kann es trotzdem passieren, dass sie einen abknallen, weil man ihnen nicht genug Respekt entgegengebracht hat. Die Knarre könnte gar nicht geladen sein, oder er ist richtig scharf drauf, heute jemanden umzubringen, oder sie ist geladen, und er glaubt, sie ist es nicht. Es gibt kein Richtig oder Falsch. Es ist einfach so, wie es ist.
Ich öffne die Kasse. Ungefähr ein Dutzend Leute sind in der Bar, manche schauen zu, andere haben noch gar nicht bemerkt, was los ist. Die Sonntagsgäste sind eher zurückhaltend. Deshalb habe ich vor einer Stunde den anderen Barkeeper nach Hause geschickt.
Pink Floyd sind fertig, jetzt kommen die Doors mit einem Song, der auch irgendwie passt. Als ich noch in einer Kleinstadt lebte, musste ich mich mit Kleinstadt-Arschlöchern herumschlagen – jetzt lebe ich in der Großstadt und muss mich mit viel größeren Arschlöchern herumärgern. Ich hebe die Kassenlade heraus und stelle sie auf den Tresen. Es können nicht mehr als vierhundert Kröten drin sein. Lohnt sich nicht, dafür zu sterben. Andererseits lohnt es sich nie, für Geld zu sterben.
»Die Münzen, Mann, die Münzen auch«, sagt er.
»Willst du den Bus nehmen?«
»Willst du dir ’ne Kugel einfangen?«
Ich hol auch den Münzkasten heraus und lasse das Kleingeld auf den Tresen fallen. Ein paar Münzen rollen über die Theke und fallen auf den Boden. Ich bücke mich, um sie aufzuheben, aber er sagt, ich soll damit aufhören, was wirklich schade ist, denn da unten befindet sich eine Knarre. Genau aus diesem Grund habe ich ja die Münzen über den Tresen rollen lassen.
»Pack alles in eine Tüte.«
»Ich hab keine Tüte.«
»Wieso nicht?«
»Hast du eine?«
»Nein.«
»Dann mach mir nicht die Hölle heiß, weil ich keine habe. Du hast dir das hier doch ausgedacht, nicht ich.«
Er greift nach den Scheinen und stopft sie in die Hosentasche. »Gib mir dein Handy.«
»Ich hab kein Handy.«
»Was?«
»Ich hab kein Handy. Hör mal, Kumpel, du hast jetzt, was du haben wolltest. Warum gehst du nicht einfach und lässt es gut sein?«
»Weil … weil du mir dein Handy geben sollst, Mann. Gib … gib’s mir einfach, und erzähl mir nicht, du hättest keins … weil nämlich jeder eins hat.«
»Ich nicht«, sage ich. Und genau in diesem Moment klingelt es natürlich. Ist ja logisch. Wieso auch nicht? »Das ist nicht meins.«
Er umfasst die Knarre jetzt mit beiden Händen, damit sie nicht so wackelt. Er zielt auf meinen Kopf. »Ich kann dich auch abknallen und es mir dann nehmen«, sagt er.
Ich lege das Handy auf den Tresen. Es klingelt immer noch. Auf dem Display steht der Name des Anrufers: Maggie.
»Du hat gelogen«, sagt er.
»Bitte lass mir das Handy. Ich brauch es«, sage ich und schaue dabei auf ihren Namen. Ich hab seit zehn Jahren nicht mehr mit Maggie gesprochen.
Hinter ihm geht die Eingangstür auf. Der Typ wirbelt herum und drückt ab. Die Kugel landet im Türrahmen zwischen einem Mann und einer Frau, die gerade reinkommen. Sie starren uns an, starren die Waffe an. Der Mann lässt sich auf den Boden fallen, die Frau dreht sich um und rennt wieder raus. Ich packe den Schützen am Arm, aber ich bin nicht schnell genug. Er richtet die Waffe auf mein Gesicht.
»Tu’s nicht«, sage ich.
Er drückt ab. Es klickt, aber nichts passiert. Er starrte die Waffe an, dann seine Hand und versucht herauszufinden, wo das Problem liegt. Was auch immer er herausgefunden hat, er teilt es mir nicht mit. Stattdessen schnappt er sich mein Handy und rennt zur Tür. Ich schaue ihm nach und kann mich nicht bewegen. Ich höre immer noch das Klicken der Waffe, höre es nicht nur, sondern spüre es regelrecht. Ungefähr so, wie man den Bohrer beim Zahnarzt spürt, wenn ein anderer Patient gerade behandelt wird. Ich stütze mich an der Theke ab, um nicht umzukippen. Meine Beine zittern. Er hat abgedrückt. Er hat versucht, mich zu töten. In einem Paralleluniversum liegt mein Körper auf dem Boden, und mein Kopf sieht nicht nicht mehr aus wie ein Kopf.
»Alles in Ordnung?« Ein Mann ist zu mir an den Tresen gekommen, aber ich höre ihn kaum, weil es laut in meinen Ohren klingelt. Ich kann nicht antworten. Der Mann, der sich auf den Boden geworfen hat, steht auf und klopft sich den Staub vom Anzug. Er ist völlig bleich. Genau wie ich. Im Paralleluniversum liegt auch er tot auf dem Boden.
»He, Mann, alles in Ordnung?«
Ich schaue den Gast an, der mit mir redet. Ich spüre meine Beine wieder. Ich vergesse das Paralleluniversum und konzentriere mich wieder auf dieses hier. »Mir geht’s gut«, sage ich leise.
»Siehst aber nicht danach aus.«
Ende der Leseprobe