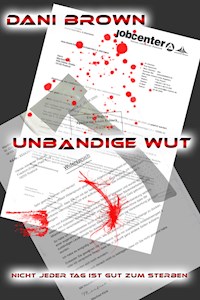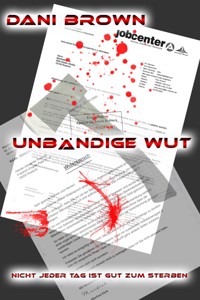7,99 €
Mehr erfahren.
Buch 1: Blutiger Zorn - Niemand stirbt zweimal am Tag
Ein Mord an einem Pressesprecher einer bundesdeutschen Behörde ist der Beginn einer unheimlichen Mordserie, die sich von Berlin aus quer durch den Norden der Republik zieht.
Doch je mehr Menschen sterben, umso mehr kristallisiert sich heraus, dass der Täter äußerst professionell vorgeht und kaum verwertbare Spuren an den Tatorten hinterlässt. So nebenbei spielt er Katz und Maus mit der eingesetzten Soko des Innenministeriums und verhöhnt die versammelte Presse.
Fieberhaft versuchen die Kriminalisten die Puzzleteile, die sie mühsam ermitteln konnten, zu einem ganzen Bild zusammenzusetzen.
Doch der Täter scheint seinen Verfolgern immer einen Schritt voraus zu sein. So steuert letztlich alles auf einen Showdown zu, dessen Ausgang völlig offen ist.
Buch 2: Unbändige Wut - Nicht jeder Tag ist gut zum Sterben
Ein Serienmörder hinterlässt an den Tatorten immer einen unauffälligen Hinweis. Die Bedeutung dieser hinterlegten Zeichen ist den Kriminalisten um Hauptkommissar Peter Geier von Anfang an völlig unklar, da sie keinerlei Sinn ergeben.
Nur eines wird rasch offensichtlich. Der Täter scheint mit seinen Verfolgern Katz und Maus zu spielen, und je mehr Zeit vergeht, umso kürzer werden die Abstände zwischen den einzelnen Straftaten.
Die Vermutung liegt nahe, dass die grauenvolle Mordserie erst dann endet, wenn das Rätsel der hinterlegten Zeichen endlich gelöst ist.
Dabei liegt die Wahrheit so nahe und ist mit den Händen zu greifen. Nur manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
1. Buch
Dani Brown
Blutiger Zorn
Niemand stirbt zweimal am Tag
Der Flug ohne Rückkehr
Als er, wie Ikarus, vom Dach des Gebäudes herunter schwebte, glaubte er für einen winzigen Augenblick, er könnte tatsächlich fliegen, wie ein Vogel. Doch dann packte ihn die Schwerkraft, wie eine eiserne Faust, und er fiel herab, wie ein Stein.
Der Aufschlag auf dem Asphalt war hart, aber nicht tödlich, obwohl er deutlich hörte, wie seine Gliedmaßen und wahrscheinlich auch die Wirbelsäule mit einem lauten Knacks zerbrachen.
Fast zur selben Zeit bemerkte er in der Mundhöhle eine warme Flüssigkeit, die sich dort ansammelte. Als er sich mit einem weithin hörbaren Stöhnen zur Seite drehte, floss diese in einem schmalen Rinnsal aus dem linken Mundwinkel heraus und tropfte auf den, von der Sommerhitze, stark erwärmten Asphalt. Jetzt erst erkannte er, dass es sein eigenes Blut war, was mittlerweile schon eine kleine rote Lache an der Wange gebildet hatte, die stetig größer wurde.
Er war noch immer fassungslos, dass er das Spiel, das so hoffnungsvoll begonnen hatte, bereits vor dem endgültigen Finale verloren hatte. Aber warum und was passierte nun mit ihm?
Die letzte Frage wurde umgehend und gnadenlos beantwortet. Denn in diesem Moment wurde er von einem voll beladenen Tanklastzug, der nicht mehr rechtzeitig bremsen konnten, erfasst.
Als ihn der rechte Reifen mit der tonnenschweren Last überrollte, platzte sein Kopf, wie eine heruntergefallene Melone, auf. Gleichzeitig spritzte die graue Hirnmasse in hohem Bogen heraus und verschmutzte die nahe Bordsteinkante, den Gehweg, sowie die Kleidung und Gesichter einiger Leute, die unweit an einer Fußgängerampel warteten. Aber den entsetzten Aufschrei der versehentlich Getroffenen bekam er schon nicht mehr mit, weil sein geschundener Körper dem Leben bereits kurz davor, die rote Karte gezeigt hatte.
Eine, in Anbetracht der zurückliegenden Ereignisse, völlig richtige Entscheidung.
Review ...
Der Vorfall, über den ich hier, als unabhängiger Beobachter, berichten werde, liegt schon etwas länger zurück. Die Welt hat sich seitdem radikal geändert, denn die Twin Tower, das stolze Zeichen der größten Demokratie, waren 2001 in sich zusammengestürzt und hatten die USA in eine tiefe Krise gestürzt.
Zur gleichen Zeit entstanden am Potsdamer Platz, in der Mitte Berlins, eine kleine Anzahl von Wolkenkratzer. Einige berühmte Architekten durften sich hier austoben und über Geschmack lässt sich ja bekannterweise streiten. Meinen zumindest trifft das hypermoderne Ensemble leider nicht.
Der nachfolgende Kriminalfall hat sich in dieser Zeit tatsächlich zugetragen, wobei ich den Protagonisten auf ausdrücklichen Wunsch allesamt Pseudonyme verpasst habe.
*
Wie so vieles im Leben, begannen die folgenschweren Ereignisse mit einem simplen Zufall und sollten dann völlig außer Kontrolle geraten.
Es war der 4. Monat des Jahres, und das Wetter zeigte sich genauso, wie man es von ihm erwartete: »April, April, der weiß nicht, was er will.«
Gewaltige Wolkengebirge zogen in schneller Folge über die flache Ebene des Norddeutschen Tieflandes und brachten abwechselnd Regen-, Schnee -und Hagelschauer. Nur ganz selten schaute die Sonne schüchtern durch himmelblaue Wolkenlücken hervor. Aber sie hatte noch nicht die Kraft, den Boden und die Luft angenehm zu erwärmen. Schuld daran war auch der nordwestliche Wind, der in stürmischen Böen, die zurzeit kahlen Äste der Laubbäume wild durchschüttelte und die Regenschauer in Wogen über das Land peitschte. Es war also ein Wetter, bei dem man sich nicht sehr lange draußen aufhalten sollte, es sei denn, man war ein Kind.
Genau diese Meinung vertraten auch Jan und Thomas, die gerade aus dem Unterholz auf das freie Feld hinaustraten. Dass sie Brüder waren, erkannte ein Ausstehender sofort. Sie trugen beide die gleiche dunkelblaue Regenjacke und hatten die Kapuzen, zum Schutz vor dem Wetter, tief ins Gesicht gezogen. Jan, der Größere und Ältere von ihnen schob in diesem Moment die Kapuze des Anoraks herunter und ein kurzer blonder Haarschopf kam zum Vorschein. Thomas blickte etwas verwundert zum Bruder hoch. Er schien noch zu zögern, doch schließlich trafen die Sonnenstrahlen auch sein Antlitz und so folgte er rasch dem Beispiel und entledigte sich des Kopfschutzes.
Laut jauchzend und sich gegenseitig jagend, liefen die Geschwister über die weite, vor ihnen liegende, freie Fläche. Das gesamte Areal war vollständig mit Gräsern und bereits seit langem vertrocknetem Unkraut des letzten Jahres bedeckt. Aber dieses Ödland war eigentlich gar keines. Ungefähr in der Mitte wurde es durch eine breite Betonstraße in zwei Hälften geteilt.
Ohne anzuhalten, überquerten die beiden Jungs das graue Band, das sich von einem Horizont bis zum anderen zu erstrecken schien. Einige Minuten später hatten sie endlich das weitläufige Grasland durchquert und gelangten zu einem schmalen Waldstück. Aus diesem führten mehrere, von Unkraut und kleinen Bäumen überwucherte, Betonflächen hinaus. Ohne Zögern quetschten sich die Brüder sofort durch das dichte Unterholz, das sich unter den hohen Kiefer ausgebreitet hatte. Wenig später standen sie genau vor der künstlichen Anlage, die sie vor einigen Tagen zufällig entdeckt hatten.
Direkt vor ihnen erhob sich ein, mit Gras bewachsener, Hügel. Langsam gingen sie um diesen herum, bis endlich ein Gewaltiges, grünschwarz gestrichenes Tor auftauchte, das die südliche Seite abschloss.
Vor Jahren war es höchstwahrscheinlich ständig bewacht und hermetisch abgeschlossen gewesen. Aber nun stand ein Flügel offen und schaukelte im böigen Wind leise knarrend hin und her.
Aus der dunklen Öffnung führte eine der breiten Betonstraßen heraus, die nur wenige hundert Meter weiter, in die ehemalige Start -und Landebahn einmündete. Diese hatten Jan und Thomas bereits auf ihrem Weg hierher überquert.
Auch jedem Uneingeweihten wurde spätestens jetzt klar, dass es sich hier um keinen Abenteuerspielplatz für Kinder handelte. In Wirklichkeit war es ein Flugplatz eines sowjetischen Kampfbombergeschwaders, das hier seit Kriegsende stationiert war, um die Einflusssphäre der UdSSR an der Grenze zur NATO dauerhaft zu sichern und eine eindeutige Drohkulisse aufzubauen. Noch vor wenigen Jahren hatten hier Kampfjets vom Typ MIG 31 mit ohrenbetäubenden Dröhnen abgehoben, um zu Übungseinsätzen zu fliegen. Aber dann kam alles ganz anders, denn die DDR und bald darauf die Sowjetunion gingen, innerhalb kurzer Zeit, sang -und klanglos unter. 1994 musste die ehemalige Sieger- und spätere Besatzungsmacht das endlich wiedervereinigte Deutschland, endgültig wie einen Verlierer verlassen. Doch immerhin wurde der Abschied mit einer milliardenschweren Zahlung durch die Bundesregierung versüßt. Bei ihrem Rückzug ließen die russischen Truppen ihre zahlreichen militärischen Stützpunkte ungesichert und unbewacht zurück. Da die Bundeswehr mit den verwaisten Anlagen nicht viel anfangen konnte, wurden die Areale schließlich ihrem Schicksal überlassen. So holte sich die Natur das retour, was ihr einst schon einmal gehört hatte. Allmählich überwucherten Bäume und Sträucher, die in einen Dornröschenschlaf gefallenen Flugzeughangars und Militärbaracken. Sogar in den Teerfugen der Start- und Landebahnen sprossen zaghaft mehrere Gräser und Grasbüschel.
Aber diese, für Ältere wahrscheinlich spannende Geschichte des Landes und letztlich des Flugplatzes, interessierte die beiden Jungs im Moment überhaupt nicht. Schon vor einiger Zeit hatten sie den Hügel, der sich als getarnter Abstellplatz für Kampfflugzeuge entpuppte, durch das offene Tor betreten. Es war etwas unheimlich im Bunkerinneren und das unaufhörliche tröpfeln von Wasser von der Betondecke, trug dazu bei, dass sie wiederholt ängstlich die Luft anhielten. Doch alle Angst war unbegründet, denn keine einzige Menschenseele war zu sehen und zu hören.
Am hinteren Ende des halbdunklen Hangars befand sich eine stählerne Tür, die einen weiteren Raum hermetisch verschloss. Die Brüder hatten den Zugang bei einem ihrer Streifzüge über den verlassenen Stützpunkt entdeckt, obwohl sich die grau lackierte Stahltür in der Dunkelheit kaum von der Umgebung abhob.
Natürlich erweckte der verriegelte Eingang die Neugier der Kinder und heute hatten Jan und Thomas beschlossen, die Tür, wenn nötig mit Gewalt, aufzusperren. Seit Minuten versuchten sie bereits vergebens, die verschlossene Tür zu öffnen. Für die Jungs stand 100%ig fest, dass sie dahinter einen Schatz finden würden, den die Soldaten beim Verlassen der Anlage glücklicherweise zurückgelassen hatten. Aber so stark sie auch an der Tür rüttelten und zerrten, sie bewegte sich keinen Millimeter und behielt ihr Geheimnis vorerst für sich.
Nach einer Weile gab der Ältere schließlich auf. Der 11-jährige schüttelte energisch mit dem Kopf. »So wird das nichts, Thomas!« Dann blickte er ernst auf den 3 Jahre jüngeren Bruder herab und sagte sehr bestimmt: »Wir brauchen unbedingt ein Stück Eisen, das wir zwischen Türblatt und Rahmen schieben können.«
Der Angesprochene schaute ihn skeptisch an. »Und du meinst, damit brechen wir die Tür auf?«
Jan zuckte mit den Schultern. »Weiß ich nicht« Er kratzte sich nachdenklich an der Stirn, bevor er dem Jüngeren befahl: »Los, du suchst auf der linken Seite und ich schaue rechts nach! Wenn du irgendetwas findest, sagst du mir sofort Bescheid. Hast du mich verstanden?«
Sein Bruder nickte schweigend und begann augenblicklich mit der Erkundung.
Es dauerte nur einige Minuten, bis aus einer dunklen Ecke, die leise Stimme von Thomas zu hören war, die aufgeregt meinte: »Jan, ich habe etwas gefunden.«
So schnell, wie ihn seine kleinen Beine trugen, lief er zum Bruder hinüber. Der Jüngere hielt stolz eine runde Eisenstange in die Luft, die aus einem Gitter, das an der Wand lehnte, herausgebrochen worden war. Er übergab den Fund freudestrahlend dem Älteren.
Jan begutachtete ausgiebig das verrostete Metall. Aber er schien zufrieden zu sein, denn er nickte und meinte anerkennend: »Gut gemacht. Das könnte wirklich funktionieren! Wir werden es gleich einmal ausprobieren.«
Dann liefen die Beiden, einer großen Pfütze in der Mitte des Hangars ausweichend, schnell zur verschlossenen Tür zurück. Dort angekommen, versuchten sie die Stange in einen kleinen Zwischenraum, der sich zwischen Türblatt und Einfassung befand, zu schieben. Als das tatsächlich gelang, zerrten sie die Metallstange gemeinsam hin und her.
Ihr Plan schien zu funktionieren, denn allmählich vergrößerte sich der Türspalt. Trotzdem dauerte es noch einige Zeit, bis das verrostete Schloss endlich mit einem dumpfen Ton nachgab und die Tür laut quietschend aufging. Jan und Thomas stießen, obwohl sie völlig außer Atem waren, einen Freudenschrei aus. Dann betraten sie vorsichtig den dunklen Raum. Feuchter Modergeruch schlug ihnen sofort entgegen und erschrocken liefen sie wieder ins Freie. Dort angekommen, sahen sich die Jungs frustriert an. An ihren Gesichtern konnte man deutlich erkennen, dass der Traum der mutigen Entdecker, einen Schatz zu finden, ausgeträumt war. Es dauerte einige Augenblicke, da nahm Jan seinen ganzen Mut zusammen. Er kramte aus der Tasche des Anoraks eine kleine Taschenlampe hervor.
Thomas blickte den Bruder mit großen Augen an. »Willst du dort etwa noch einmal hinein. Das ist keine gute Idee!« Er schaute ängstlich zur aufgebrochenen Tür.
Der Ältere erwiderte mit ernster und entschlossener Stimme: »Egal! Ich gehe da jetzt rein. Möglicherweise befindet sich ja hinter der Tür doch ein Schatz. Wenn wir ihn nicht finden, dann entdecken ihn andere.« Er atmete tief durch und ging langsam zur geöffneten Tür. Bevor er den Raum betrat, schaltete er seine Lampe an und leuchtete vorsichtig in die dunkle, drohend wirkende Öffnung.
Der Lichtstrahl erfasste einige hohe Metallregale, die hintereinander aufgereiht an den Wänden standen. Jan konnte deutlich erkennen, dass sie einmal weiß lackiert waren. Doch im Laufe der Jahre hatte die Feuchtigkeit ganze Arbeit geleistet. Der größte Teil der Farbe war abgeblättert und eine dicke Rostschicht bedeckte die Metallteile. Neugierig trat der Junge näher an eines der Regale heran, denn er hatte tatsächlich etwas Interessantes entdeckt. Aber es war leider kein Schatz, sondern der Lichtkegel erfasste nur eine große Anzahl von Aktenordnern, fein säuberlich aufgereiht. Wissbegierig nahm er einen der Hefter in die Hand. Der Deckel fühlte sich feucht an und die Schrift, die sich darauf einmal befand, war kaum noch zu entziffern. Trotzdem versuchte er es und buchstabierte mühsam: »I M J ö r g M e …« Mehr war nicht lesbar. Die Feuchtigkeit hatte dem Dokument mächtig zugesetzt.
Merkwürdige Bezeichnung stellte er nachdenklich fest. Doch irgendwie sagte ihm der Begriff etwas. Nur was? Er überlegte angestrengt und endlich fiel der berühmte Groschen.
Überrascht ließ Jan den Aktenordner sinken. Plötzlich war ihm die Bedeutung der entzifferten Buchstaben wieder eingefallen. Vor wenigen Wochen wurde darüber im Unterricht ausführlich gesprochen. Die Geschichtslehrerin hatte der Klasse über ein Land namens DDR berichtet, dass es, seit 1990 nicht mehr gab.
Rasch legte er den Hefter ins Regal zurück. Dann schaltete der Junge die Taschenlampe aus und verließ schnell den unheimlichen Ort. Draußen angekommen, rief er seinem verwunderten Bruder zu: »Leider nichts Besonderes gefunden. Im Raum befinden sich nur jede Menge Aktenordner.«
Thomas war enttäuscht. »Was nur Ordner. Wie langweilig und ich hatte mich so auf den Schatz gefreut!«
Mit ernstem Blick erwiderte Jan: »Trotzdem müssen wir Mutti erzählen, was wir hier gefunden haben.« Leise, mehr zu sich, murmelte er: »Vielleicht sind ja die Dokumente wenigstens wichtig!«
Mit dieser Meinung lag er letzten Endes völlig richtig. Allerdings fragt man sich als Außenstehender rückblickend, ob es nicht besser gewesen wäre, die Kinder hätten die durchnässten und verschimmelten Ordner nicht entdeckt. Nur kurze Zeit nach der Entdeckung begannen dramatische Ereignisse, die bald das ganze Land erschüttern sollten. Aber danach ist man ja immer schlauer.
Blutspuren
Hauptkommissar Peter Geier sah müde aus, als er die Lampe ausschaltete, die mit einer schwarzen Klammer am Schreibtisch befestigt war. Sein Gesicht mit der hohen Stirn und den starken Wangenknochen war blas. Unterhalb der dunkelblauen Augen zeichneten sich, wie so oft in der letzten Zeit, dunkle Ringe ab. Ein deutliches Zeichen, dass der Mann seit Ewigkeiten zu wenig Schlaf bekam. Aber das brachte der stressige Job, den er bereits Jahrzehnten ausübte, leider mit sich. Der Kriminalist wusste das und hatte sich schon lange an dieses Defizit gewöhnt. Der Mund unter der länglichen, geraden Nase war schmal und verbarg sich hinter einem gepflegten Oberlippenbart. Das kurze dunkelbraune Haar, über das er sich jetzt unschlüssig strich, war trotz seiner knapp 51 Jahre noch immer üppig. Trotzdem hatte Geier vor einiger Zeit die ersten grauen Strähnen entdeckt. Doch das beunruhigte ihn nicht, denn er war kein eitler Mann und Angst vor dem Älterwerden hatte er schon gar nicht. Der Kripobeamte war ein äußerst ruhiger Mensch, dem kaum etwas so schnell aus der Bahn warf. Sein Job war eine meist sehr traurige Angelegenheit, aber wenn der breitschultrige Polizist einmal herzhaft lachte, dann sah man eine vollzählige Reihe weißer Zähne im Mund aufblitzen. Das perfekte Gebiss schien einer Werbung für Zahncreme entsprungen zu sein.
Wen auch immer die dunkelblauen Augen, die oberhalb durch buschige Augenbrauen begrenzt wurden, ansahen, den beschlich das mulmige Gefühl, dass sie die verborgene Gedankenwelt, auf der Suche nach der Wahrheit, bis in den letzten Winkel des Gehirns abtasteten. Dieser Eindruck war nicht so ganz abwegig, denn in der Tat waren die analytischen Fähigkeiten Geiers überragend und trugen maßgeblich zur hohen Aufklärungsquote der Abteilung bei. Trotz der vielen Erfolge blieb er zurückhaltend im Hintergrund. Sich selbst bezeichnete er immer bescheiden als Teamspieler. Der Hauptkommissar kleidete sich geschmackvoll und trotzdem dezent unspektakulär. Das hatte er vor allem einer attraktiven Frau, die er glücklicherweise geheiratet hatte, zu verdanken. Sie stand auf dem Standpunkt, dass sich Kommissare schlicht kleiden sollten, damit sie sich in der Öffentlichkeit jederzeit unauffällig bewegen konnten. Letztlich war ihr Mann im Aussehen und im modischen Geschmack eher durchschnittlich und alltäglich. Aber genau das hatte viele Vorteile, fanden die immer noch verliebten Eheleute und lagen damit goldrichtig.
Der »0815« Typ beschloss in diesem Moment, endlich Feierabend zu machen. Also fuhr er den Computer herunter und schaltete ihn kurz drauf endgültig aus.
Ein Blick auf die silberglänzende Armbanduhr, die er am rechten Handgelenk trug, verriet ihm, dass es, wie bereits häufig in der Vergangenheit, wieder einmal viel zu spät geworden war.
Im Stillen bewunderte er seine Frau, die es schon 25 Jahre mit ihm aushielt. Er selbst hätte an ihrer Stelle wohl längst Reißaus genommen.
Als ihre beiden Kinder noch klein waren, da ruhte die gesamte Erziehung fast vollständig auf ihren Schultern und das trotz eigenen stressigen Berufes als Krankenschwester. Aber nie kam ein Wort eines Vorwurfes über ihre Lippen. Er selbst hatte oft ein schlechtes Gewissen ihr gegenüber gehabt. Vor allem dann, wenn er manchmal erst in den Morgenstunden vom Dienst zurückkehrte und sie sich quasi die Klinke in die Hand gaben. Eigentlich habe ich eine solche Frau gar nicht verdient, musste Geier mehr als einmal bewundernd feststellen.
Aber das positive Wesen von Marina nahm ihm immer sehr schnell das eigene schlechte Gewissen.
Sie pflegte dann stets tröstend zu sagen: »Peter, du brauchst mir gegenüber keine Gewissensbisse zu haben. Damals, als wir heirateten, war mir von vornherein klar, dass ich dich mit deinem Beruf und vielen finsteren Gesellen, wie Mördern, Dieben und Vergewaltigern teilen muss. Ich wusste also von Anfang an, auf was ich mich einließ.« Anschließend schwieg sie einen Moment, bevor sie augenzwinkernd mit einem Lächeln meinte: »Unserer Liebe hat diese schwierige Konstellation jedenfalls niemals geschadet. Ich finde, sie ist dadurch eher noch viel stärker geworden und man geniest die wenigen Stunden zu zweit wesentlich intensiver oder wie siehst du das?«
Was sollte er dazu sagen? Er erwiderte gar nichts, sondern war nur schnell aufgestanden und hatte seine Frau wortlos in den Arm genommen.
Manchmal sagt eine Geste eben mehr aus, als tausend gesprochene Worte. Peter Geier war glücklich mit Marina.
Das größte dienstliche Problem hatte der Hauptkommissar gerade vor wenigen Stunden erfolgreich gelöst. Ein bundesweit gesuchter Vergewaltiger konnte endlich festgenommen werden. Ein Sondereinsatzkommando der Polizei, kurz SEK genannt, hatte den Täter in den Morgenstunden in einer halbverfallenen Scheune in der Nähe von Stuttgart aufgespürt und nach kurzzeitigem Kampf überwältigt. Daraufhin war Geier gemeinsam mit einem Kollegen in die Landeshauptstadt von Baden-Württemberg geflogen, um den Verdächtigen zu vernehmen. Aber trotz erdrückender Beweislage dauerte es fast 5 Stunden, eher der Festgenommene bereitwillig Auskunft über seine grausamen Straftaten gab.
Insgesamt hatte er in den letzten Jahren, 10 Frauen aufgelauert und sie an einsamen Orten überfallen und vergewaltigt. Bei jedem der Verbrechen war das Muster seiner Herangehensweise immer gleichgeblieben. Als Handelsvertreter, der ständig unterwegs war, besuchte er regelmäßig Diskotheken im gesamten Bundesgebiet. Nachdem die jeweiligen Veranstaltungen beendet waren, in der Regel in den frühen Morgenstunden, verfolgte er junge Frauen, die sich allein und zu Fuß auf den Weg nach Hause machten. An einer abgelegenen Stelle überfiel er äußerst brutal die total überraschten Opfer und missbrauchte sie. Zwar war bei den Leidtragenden immer wieder die gleiche DNA-Spur festgestellt worden, aber es hatte sehr lange gedauert, dem Vergewaltiger ein Gesicht zu geben. Ein weiteres Manko war, dass seine DNA noch nicht in der Datenbank des Bundeskriminalamtes abgespeichert war. Die Tatorte des Straftäters befanden sich nicht nur an abgelegenen Gegenden, sondern lagen fast immer in der Dunkelheit. Dementsprechend sah dann das Phantombild aus, dass die Geschädigten von ihrem Peiniger erstellen ließen. Es war so allgemein gehalten, dass es auf sehr viele Männer zutreffen konnte.
Aber auch andere Umstände trugen dazu bei, dass der Täter leichtes Spiel mit seinen Opfern hatte.
Trotz ständiger Empfehlungen der Polizei, als Gruppe oder in Fahrgemeinschaft den Heimweg anzutreten, gab es eine Vielzahl von jungen Leuten, die den Hinweis unverständlicherweise ignorierten und sich alleine auf den Weg nach Hause machten. Damit wurde es dem Vergewaltiger natürlich ziemlich einfach gemacht, die brutalen Straftaten zu begehen.
Mit dem umfassenden Geständnis des Täters war für die Kriminalisten der Sonderkommission für bundesweite Verbrechen, kurz SBV genannt, dieser Fall erfreulicherweise abgeschlossen. Das letzte Wort hatten nun die Psychologen, der Staatsanwalt und die Gerichte, um den Vergewaltiger seiner gerechten Strafe zuzuführen.
Peter Geier zog sich schnell den Mantel an, schaltete das Licht des Büros aus und verließ eilig die Dienststelle. Bevor er endgültig nach Hause fuhr, wollte er noch rasch zu einem Blumenladen in der Nähe gehen, um für Marina einen Strauß roter Rosen zu kaufen. Sozusagen als kleines Dankeschön für ihr Verständnis und um sein eigenes schlechtes Gewissen zu beruhigen.
*
Die Mühlen der Behörde mahlten, wie so oft, äußerst langsam. Aber irgendwann in den letzten Wochen wurde doch das zufällig gefunden, was die Verantwortlichen der Stadtverwaltung in all den Jahren bei ihm vergeblich gesucht hatten, einen schmalen Ordner mit einigen handgeschriebenen A4 Seiten.
Nun lagen Kopien dieses Dokumentes vor seinem Vorgesetzten. Helmut Schranz hatte sie demonstrativ in die Mitte des aufgeräumten Schreibtisches gelegt, damit der ungeliebte Mitarbeiter sie sofort sah, als er das Büro betrat. Nach einer kühlen Begrüßung kam der Abteilungsleiter auch sogleich zur Sache. Er zeigte auf die Schriftstücke und meinte nur: »Was das ist, brauche ich Ihnen ja wohl nicht zu sagen!«
Der Angesprochene, ein Mann mittleren Alters, blickte seinen Chef verständnislos an. »Ich sehe mehrere Fotokopien auf Ihrem Schreibtisch. Na und?«
Mit einer energischen Handbewegung schob Schranz die Dokumente zu ihm hinüber. »Es ist Ihre Akte!«
»Aha.« Er sah ihn verwundert an, ehe er die Zettel nahm und sie nacheinander neugierig überflog. Als er damit fertig war, warf er die Blätter mit so einem Schwung auf den Tisch zurück, dass sie auf dem Schoß des Chefs landeten und von dort auf den fleckigen Teppich fielen. Ein Lächeln umspielte seine Lippen, als er dem verhassten Vorgesetzten erwiderte: »Herr Schranz, ich frage mich schon die ganze Zeit ernsthaft. Was habe ich mit diesen Schriftstücken zu tun? Die Kopien sind mit Jörg Hinrichsen unterschrieben. Selbst Sie müssten eigentlich erkennen, dass ich einen Namen trage, der nicht mal entfernt irgendwelche Ähnlichkeiten mit diesem Herrn hat.«
Während der Mitarbeiter sprach, hatte der Abteilungsleiter die heruntergefallenen Blätter wieder aufgesammelt und auf den Schreibtisch zurückgelegt. Es war ihm deutlich anzumerken, dass er über den Verlauf der bisherigen Unterhaltung nicht gerade glücklich war. Er war nahe drauf und dran dem aufsässigen Mitarbeiter etwas Deftiges zu erwidern. Doch er besann sich noch rechtzeitig und schluckte die aufkommende Wut herunter. Schranz war überzeugt, dass ihm die gesuchte Beute, die er endlich im Netz hatte, nicht mehr entkommen würde. Da konnte der Kerl zappeln, wie er wollte, aber seine Stunden in der Abteilung waren erfreulicherweise gezählt. Also holte er schließlich tief Luft und lächelte den anscheinend ahnungslosen Gesprächspartner freundlich an, ehe er spöttisch flüsterte: »Nein, mein Lieber, so einfach kommen Sie hier nicht davon. Gewiss, Sie heißen nicht Jörg Hinrichsen - wenigstens nicht offiziell. Haben Sie denn den Namen auf dem Deckblatt nicht gelesen?«
Der Angesprochene schüttelte wortlos seinen Kopf.
»Nein? Na, dann zeige ich es Ihnen eben noch einmal!«
Der Abteilungsleiter hielt den Zettel hoch und zeigte auf den Schriftzug. Mit schwarzen Druckbuchstaben hatte irgendjemand »IM Jörg Hinrichsen« geschrieben. Allerdings sah die Schrift ziemlich verwaschen aus, als ob das Schriftstück Feuchtigkeit ausgesetzt war.
Sein Gegenüber las den Namen, dann zuckte er mit den Schultern und meinte verständnislos: »Ganz ehrlich, Herr Schranz, ich weiß immer noch nicht, was Sie eigentlich konkret von mir wollen? Sie zitieren mich hier einfach in Ihr Büro, wedeln mit einigen Zetteln vor meiner Nase herum und verlangen allen Ernstes, das ich zugebe in Wirklichkeit Jörg Hinrichsen zu heißen.«
Sein Gegenüber nickte energisch, bevor er laut erwiderte: »Da haben Sie direkt einmal völlig Recht, Herr Kollege, denn genau das möchte ich erreichen!«
Der Angesprochene machte eine ablehnende Handbewegung. »Das können Sie vergessen. Ich gebe ja gerne zu, dass ich Sie persönlich nicht unbedingt mag und Ihre Kompetenz als Abteilungsleiter äußerst in Frage stelle. Aber mir von Ihnen unterstellen zu lassen, in Wirklichkeit ganz anders zu heißen, das dulde ich nicht!« Er sah seinen Vorgesetzten wütend an.
Helmut Schranz hatte dem Delinquenten aufmerksam mit einem überheblichen Lächeln zugehört. Schließlich meinte er leise: »Lieber Kollege, um es noch einmal deutlich zu sagen. Um meine Person geht es derzeit überhaupt nicht, denn ich habe eine saubere Vergangenheit. Das wurde mir sogar vom zuständigen Amt schriftlich bestätigt.«
Der Angesprochene unterbrach ihn umgehend und zischte wütend: »Worauf wollen Sie eigentlich hinaus, Herr Schranz?«
Sein Gegenüber schaute den Gesprächspartner verwundert an. »Nun bin ich aber überrascht. Wissen Sie es nicht oder verdrängen Sie es nur?«
»Keine Ahnung, welches Problem Sie jetzt schon wieder mit mir haben«, erwiderte er kurz angebunden.
Der Leiter ließ sich Zeit mit der Antwort und meinte mehr beiläufig: »Im Vergleich zu einigen anderen Herrschaften habe ich beispielsweise nicht mit der Stasi zusammengearbeitet, wenigstens nicht inoffiziell!« Er blickte den Mitarbeiter scharf an, bevor er fortfuhr: »Nun ja, und Sie waren wohl mittendrin!«
Nach diesen Worten sah er den Abteilungsleiter wütend an. Dann platzte es aus ihm heraus: »Herr Schranz, Ihre Unterstellungen weise ich auf das Entschiedenste zurück.« Erregt schlug er mit der Faust auf den Tisch. »Sie und eine saubere Weste! Dass ich nicht lache. Ich gehe jede Wette ein, dass bei Ihnen die Herrschaften der Staatssicherheit ein -und ausgingen. Als damaliger Sicherheitsinspektor waren Sie doch der Hauptansprechpartner für die Schnüffler vom ›VEB Horch und Guck‹. Ich vermute, dass Sie unzählige Spitzelberichte geschrieben haben!« Er holte tief Luft, strich sich erregt über das Haar, bevor er sich wütend vorbeugte, und flüsterte: »Genosse Schranz, ich möchte nicht wissen, wie viele Leute Sie angeschwärzt haben!«
Doch der Vorgesetzte ließ sich, wie sonst des Öfteren passiert, nicht provozieren und erwiderte gleichgültig: »Nun hören Sie endlich auf, herum zu palavern. Das war damals alles offiziell und jeder im Betrieb wusste, dass das MfS mit mir regelmäßig Gespräche geführt hat. Immerhin arbeitete ich in einem wichtigen Exportbetrieb, der lebensnotwendige Devisen für die DDR erwirtschaftet hat. Aber«, er schaute seinen Mitarbeiter streng an, »um es noch einmal zu betonen. Nicht ich bin das Problem, sondern Sie. Aus den Akten der Behörde geht eindeutig hervor, dass Sie IM ›Jörg Hinrichsen‹ sind und niemand sonst.«
Sein, vor ihm sitzender, Mitarbeiter war außer sich. »Das ist eine dreiste Unterstellung, Herr Schranz. Wie können Sie so etwas ohne Beweise behaupten?« Er hob drohend den Zeigefinger. »Ich warne Sie! Noch weitere Anschuldigungen von dieser Sorte und Sie haben eine Klage wegen Verleumdung am Hals. Ich verspreche Ihnen, dann werden Sie Ihren einträglichen Posten hier endgültig los!«
Aber sein Chef ließ sich nicht einschüchtern. Fast triumphierend hielt er ein Schriftstück hoch, das er bisher nicht gezeigt hatte. »Beweise? Sie wollen Belege Ihrer damaligen Tätigkeit? Nun gut, die Behörde hat die Karteikarte mit dem Klarnamen vom IM ›Jörg Hinrichsen‹ gefunden.« Mit dem Zeigefinger deutete er auf eine bestimmte Stelle des Dokumentes und fuhr zornig fort. »Diese Kopie ist die Bestätigung, dass Sie der IM waren. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Hier unten steht Ihr Name und das hier«, triumphierend klopfte der Abteilungsleiter mit einem Kugelschreiber auf die, vor ihm liegende, Fotokopie, »sind Ihre Berichte für das MfS.«
Dann schwieg er einen Moment, bevor er abschließend feststellte. »Ich persönlich finde, dass Sie der Stasi eine Menge mitzuteilen hatten.«
Sein Gegenüber war auffällig blass geworden. Nur halbherzig unternahm er den Versuch einer Erklärung. »Aber das spielte sich doch alles nur während meiner Armeezeit ab. Ich wurde richtig bedroht, um nicht zu sagen, erpresst, um beim MfS mitzumachen. Die drohten mir mit Militärgefängnis und Verweigerung eines Studienplatzes.«
Mit einer barschen Handbewegung unterbrach Helmut Schranz, die hilflos wirkenden Äußerungen seines Unterstellten. »Ob freiwillig oder gezwungen, das spielt überhaupt keine Rolle. Alle Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes mussten Anfang der 90er Jahre eine Erklärung unterschreiben, nicht wissentlich als IM für das MfS gearbeitet, zu haben. Wer das Dokument unterzeichnete, und trotzdem als IM entlarvt wurde, der erhielt sofort die fristlose Kündigung.«
Er schaute seinen Gegenüber spöttisch lächelnd an, bevor er provozierend fragte: »Haben Sie das etwa schon vergessen, Kollege?«
In diesem Augenblick wurde dem Ertappten bewusst, dass er einen unverzeihlichen Fehler begangen hatte. Schranz hatte letztlich leider vollkommen Recht. Er hatte tatsächlich vor vielen Jahren eine solche Erklärung unterschrieben. Damals ging er davon aus, dass nur das Leitungspersonal der Verwaltung überprüft werden sollte, während die kleinen Mitarbeiter völlig unbehelligt blieben. Das war offensichtlich eine komplette Fehleinschätzung der Situation. Das musste er sich selbst ankreiden, so bitter es auch war. Es war sowieso ein beklemmendes Gefühl, dem verhassten Chef so hilflos ausgeliefert zu sein. Der führte sich schon die gesamte Zeit wie ein Scharfrichter auf und weidete sich genüsslich an den Qualen, des im Spinnennetz gefangenen Opfers. Vom Abteilungsleiter war kein Mitleid oder Vergebung zu erwarten. Obwohl er ahnte, was in den nächsten Minuten passieren würde, fragte er Schranz: »Warum fand überhaupt wieder eine Überprüfung statt?«
Der Angesprochene winkte lässig ab und erklärte: »Kinder haben beim Spielen auf einem ehemaligen Flugplatz der Sowjetarmee einige Aktenordner gefunden. Es war vermutlich geplant, dass die Dokumente von den Russen mit in ihre Heimat genommen werden. Doch das hat offenbar nicht geklappt.«
»Die russische Armee ist also ohne die speziellen Akten abgerückt?«
Sein Chef nickte. »Ja, mehrere hundert Ordner wurden in einem stillgelegten Hangar einfach vergessen. Tja und Pech für Sie, Ihre war darunter!«
Der Mitarbeiter saß eine Weile schweigend da, bevor er leise fragte: »Wie geht es nun weiter?«
Fast ein wenig mitleidig schaute Schranz den, am Boden zerstörten, Mann an. Schließlich meinte er: »Das lässt sich in Ihrem Fall ganz einfach beantworten, lieber Kollege. Der Beschluss, ehemalige inoffizielle Mitarbeiter unter bestimmten Umständen fristlos zu kündigen, besteht immer noch. Die Personalkommission unserer Stadtverwaltung hat sich bereits mit Ihrer Angelegenheit intensiv beschäftigt.«
Ein Fünkchen Hoffnung, dass er den sicheren Job bei der Stadt vielleicht doch behält, schien der geschockte Gesprächspartner trotzdem zu haben, denn leise meinte er zu seinem Chef: »Soweit ich informiert bin, wird bei jedem aufgedeckten Sachverhalt eine Einzelentscheidung getroffen, wie mit dem jeweiligen Mitarbeiter weiter zu verfahren ist. Damit soll verhindert werden, dass es zu einer pauschalen Vorverurteilung kommt!«
Schranz nickte. »Da haben Sie natürlich Recht und deshalb wurde in Ihrem Fall genauso vorgegangen. Leider haben Sie bei Ihrer Einstellung, die Erklärung, wissentlich falsch unterschrieben. Aus diesem Grund hat die eingesetzte Kommission, der auch Mitglieder des Betriebsrates angehören, entschieden, Sie fristlos zu entlassen.«
Einen Moment war es still, bevor der Gefeuerte die Sprache wiederfand. Mit heiserer Stimme fragte er ungläubig: »Ihr werft mich also so einfach raus, ohne mir Gelegenheit zu geben, den gesamten Sachverhalt vor der Personalkommission zu erläutern? «
»Ja, das war in Ihrem Fall nicht mehr erforderlich«, erläuterte sein Gegenüber schnell. »Es war zu offensichtlich, dass Sie damals wissentlich falsche Angaben gemacht haben!«
»Mit Demokratie hat diese Herangehensweise aber rein gar nichts zu tun oder?«
Statt zu antworten, blickte Schranz nervös auf die Uhr. Dann stand er auf und sagte besänftigend zum Kollegen, der wie Häufchen Unglück vor ihm saß: »Kopf hoch, Sie werden garantiert wieder einen Job finden. Zur Not können Sie die Stadt ja auch auf Wiedereinstellung verklagen.«
Sein, von jetzt ab, nur noch ehemaligerMitarbeiter, winkte resigniert ab, bevor er frustriert antwortete. »Der Rechtsweg? Der dauert doch ewig. Da bin ich schon lange Rentner, wenn nach den vielen Gerichtsinstanzen, schließlich das endgültige Urteil gefällt wird.«
Ohne eine Miene zu verziehen, entgegnete Schranz geschäftsmäßig: »Das ist letztlich alleine Ihre persönliche Entscheidung, wie Sie auf den Beschluss reagieren wollen. Ihre Zeit in unserer Abteilung ist zumindest vorerst leider abgelaufen. Bitte räumen Sie bis 17.00 Uhr ihren Arbeitsplatz.« Dann reichte er dem enttäuschten Ex-Kollegen über den Schreibtisch hinweg die Hand. »Ich wünsche Ihnen jedenfalls alles Gute. Die offizielle Kündigung wird in den nächsten Tagen per Einschreiben zugeschickt. Ab dem Tag der Zustellung haben Sie ja 4 Wochen Zeit zu überlegen, ob sie in Widerspruch gehen oder nicht.«
Sein Gesprächspartner zuckte wortlos mit den Achseln und ging, ohne die entgegengestreckte Hand zu beachten.
*
Es gibt Menschen, denen sieht man auf den ersten Blick überhaupt nicht an, was sie beruflich machten und ein Uneingeweihte sollte unbedingt tunlichst vermeiden, vom Äußeren auf den Charakter zu schließen. Zu dieser Spezies musste man auf jeden Fall Joachim Radtke zählen.
Kaum einer vermutete hinter dem schlanken großen Mann mit dem ungepflegten grauen Vollbart, der fast das gesamte Gesicht einnahm, den Pressesprecher einer bekannten Behörde in Deutschland. Das erwähnte Amt versuchte seit vielen Jahren, das Ministerium für Staatssicherheit der ehemaligen DDR in seiner vollständigen Komplexität offen zu legen und die gesamte Tätigkeit für die breite Öffentlichkeit transparent zu machen. Ob das jemals gelingen sollte, stand selbstverständlich in den Sternen. Aber niemals zuvor in der Geschichte der Menschheit wurde ein Geheimdienst eines Landes so krass ins Scheinwerferlicht der Medien gerückt. Doch fraglich blieb von Anbeginn, ob so tatsächlich alle Geheimnisse und Straftaten dieses Ministeriums aufgeklärt werden konnten.
Das ungewöhnliche Äußere Radtkes wurde durch seine langen ergrauten Haare verstärkt, die er auf dem Rücken zu einem Zopf zusammengebunden hatte. In einem seriösen dunklen Anzug sah man den bekennenden Umweltaktivisten höchstens auf wichtigen Empfängen. Ansonsten trug er ausgewaschene Jeans und T-Shirts in dezenten Farben.
Zu DDR-Zeiten war der jetzige Pressesprecher ein angesehener Maler gewesen, der in der damaligen außerparlamentarischen Opposition für die Einhaltung der Menschenrechte, für freie Meinungsäußerung, Reisefreiheit und demokratische Wahlen kämpfte. Seine überaus kritische Haltung gegenüber dem herrschenden System brachte ihm persönlich eine Menge Ärger ein. Radtke wurde wiederholt verhaftet, verhört und auch misshandelt. Während einer Maidemonstration in Ost-Berlin überspannte er, in den Augen der Verantwortlichen, den Bogen endgültig. Auf jener Veranstaltung verteilte er mutig Flugblätter mit der Aufforderung, die bald stattfindenden Wahlen zur DDR-Volkskammer zu boykottieren. Noch am gleichen Tag wurde er festgenommen und wenig später von einem Gericht zu 2 Jahren Haft ohne Bewährung verurteilt. Diese Strafe musste er, bis auf den letzten Tag, in einem Gefängnis in Bautzen absitzen. Schon kurz darauf hörte die DDR endgültig auf zu existieren.
Mitte 1992 erhielt der selbstbewusste und manchmal zu cholerischen Anfällen neigende Endvierziger ein überraschendes Jobangebot, mit dem er niemals gerechnet hatte. Die nach ihrer Leiterin benannte Tietze-Behörde suchte kurzfristig Mitarbeiter, um die sichergestellten Akten des MfS zu verwalten und auszuwerten. Das ihm gebotene Gehalt war ansprechend. Außerdem hatte Radtke schon längst erkannt, dass seine berufliche Situation als Maler im vereinigten Deutschland eher düster als hoffnungsvoll war. Deshalb zögerte er keine Sekunde, sondern nahm die angebotene Beschäftigung dankbar an.
Die ersten Monate der neuen Tätigkeit verbrachte er in einem weitläufigen Keller, dessen Räume mit einer gewaltigen Anzahl von schwarzen und blauen Müllsäcken vollgestopft waren. Alle Säcke enthielten, von Stasi Mitarbeitern in den letzten Tagen ihrer Macht, eilig zerrissene Schriftstücke. Die Aufgabe von Joachim Radtke und weiteren Kollegen bestand nun darin, diese unzähligen großen und kleinen Schnipsel wieder zusammenzufügen. Das war natürlich eine langwierige und ermüdende Sisyphus Arbeit.
Im Vergleich zu einem Teil der Belegschaft, die ihre Tätigkeit in der Behörde eher als normalen Job betrachteten, der äußerst gut bezahlt war und Beschäftigung bis zur Rente verhieß, sah Joachim Radtke in dem Job noch wesentlich mehr. Er war für ihn eine moralische Pflicht, das MfS als die Einrichtung zu entlarven, die sie in seinen Augen tatsächlich war, ein Terrorinstrument des SED-Regimes.
In den ersten Jahren nach der Wende hatte das Amt unheimlich viel zu tun. Jeder Arbeitnehmer des öffentlichen Dienstes musste laut Beschluss des Bundestages auf Tätigkeit für das ehemalige MfS überprüft werden. Etliche enttarnte inoffizielle Mitarbeiter wurden daraufhin von Dienststellen und Institutionen bei denen sie angestellt waren, fristlos entlassen. Dazu kamen noch einige spektakuläre Rücktritte aus politischen Ämtern. Die Daseinsberechtigung der Tietze Behörde hatte sich damit endgültig als richtig erwiesen.
Das Engagement Joachim Radtkes in jener Zeit blieb seinen Vorgesetzten natürlich nicht verborgen und so dauerte es nicht lange, da wurde ihm die Stelle des Pressesprechers angeboten. Dieser Job war wie gemalt für den einstmaligen Künstler. Die große kräftige Gestalt mit dem buschigen Bart machte gehörigen Eindruck und das selbstbewusste Auftreten des Mannes in den Medien prägte sich positiv, wie negativ, tief ein. Unterm Strich gab es nicht wenige Leute, die, regelrecht, Angst vor ihm hatten. Letztlich trug die weiterhin rigorose und harte Haltung gegenüber ehemaligen offiziellen und inoffiziellen Mitarbeitern der Stasi maßgeblich dazu bei, dass Radtke, ein vielbeachtete Person des öffentlichen Lebens geworden war. Es verging kaum ein Monat, wo das Konterfei von ihm nicht auf der Titelseite einer Zeitung oder Illustrierten zu finden war.
Aber wie es manchmal so ist. Der Bekanntheitsgrad des Pressesprechers sollte bald in noch ungeahntere Höhen steigen. Doch so hatte er sich das vermutlich niemals in den schlimmsten Alpträumen vorgestellt.
*
Es war schon Mitternacht durch, als Joachim Radtke das Büro verließ und mit der U-Bahn der Linie 5 Richtung eigene Wohnung fuhr. Seinem Kiez Friedrichshain war er auch nach der schmutzigen Scheidung vor einigen Jahren treu geblieben. Wenige Haltestellen später stieg er bereits wieder aus und stürmte die Treppe der unterirdischen Station hinauf. Oben angekommen, durchquerte er eilig eine winzige Grünfläche und bog in die Gürtelstraße ein.
In der Straße war es um diese Zeit schon sehr ruhig. Nur in einem kleinen Hotel mit dem ungewöhnlichen Namen ‘Tulip Inn‘, das unmittelbar neben einer S-Bahn-Brücke lag, brannte hinter einigen Fenstern noch Licht. Nach wenigen Minuten Fußweg stand er endlich vor seinem Mietshaus, das über 100 Jahren alt war.
Seitdem hatte das Bauwerk vermutlich keinerlei Sanierungsmaßnahmen mehr gesehen, denn der Putz bröckelte in großen Stücken von der Fassade. Vor kurzem war es zu einem Eigentümerwechsel gekommen und der neue Besitzer hatte anscheinend vor, die Wohnverhältnisse seiner Mieter zu verbessern. Deshalb stand seit wenigen Tagen ein Gerüst an der Vorder- und Hinterseite des Gebäudes und einige Arbeiter waren derzeit emsig dabei, die restlichen Putzschichten von allen Außenwänden abzuschlagen. Vor dem eigentlichen Baugerüst hing eine riesige Plane, die sich sanft raschelnd im Wind bewegte. Während der Bauarbeiten sollte sie vorbeikommende Passanten vor Staub und herabfallenden Trümmern schützen. Außerdem eignet sie sich auch vorzüglich als Tarnung. Aber das war eine andere Geschichte.
Joachim Radtke kramte seine Schlüssel hervor und schloss die Haustür auf, die daraufhin leise knarrend nach innen aufging. Muffig feuchter Geruch schlug ihm entgegen und lies ihn leicht frösteln. Aber ohne zu zögern, betrat er den Eingang, schaltete das Flurlicht an und stieg mit eiligen Schritten die ausgetretenen Holzstufen hinauf. Seine kleine Wohnung befand sich im dritten Stock des alten Mietshauses. Als er die erwähnte Etage schließlich erreicht hatte, schloss er rasch die Wohnungstür auf und marschierte in den halbdunklen schmalen Flur hinein. Zu allem Überfluss ging genau in diesem Moment die Lampe im Hausflur aus und Radtke stand völlig unverhofft vollkommen im Dunklen. Leise fluchend klappte er die Tür zu und tastete blind nach dem Lichtschalter. Schließlich hatte er ihn gefunden. Als die Sparlampe an der Decke endlich anging, sah man im schummrigen Licht mehrere kleine Aquarelle an der Wand hängen. Sie zeigten eindrucksvolle Sonnenuntergänge am Meer, sowie einige Berglandschaften. Die Bilder hatte der jetzige Pressesprecher einmal vor vielen Jahren selbst gemalt. Damals lebte er noch in der DDR und war ein weitgehend unbekannter Maler gewesen. Aber seit er bei der Tietze-Behörde arbeitete, fehlte ihm einfach die Zeit, seiner Leidenschaft weiter nachzugehen.
Rasch hängte er den Mantel an die Garderobe, begab sich in die Küche und holte sich ein Bier aus dem Kühlschrank. Mit diesem in der Hand ging er zum Wohnzimmer, das sich schräg gegenüber befand. Er öffnete die angelehnte Tür und durchquerte den stockfinsteren Raum. Aber als er auf den Schalter drückte, um die Stehlampe einzuschalten, passierte erst einmal überhaupt nichts. Die Lampe blieb dunkel. Laut fluchend erhob er sich und tastete sich langsam vorwärts. Endlich hatte er den gesuchten Tisch gefunden und stellte die Flasche mit einem dumpfen Ton ab.
Frustriert murmelte er: »Das verstehe ich nicht. Ist denn die Glühbirne schon wieder kaputt? Ich habe sie doch gestern gerade ausgetauscht!«
Dann sah er sich misstrauisch um und lauschte angestrengt in die Dunkelheit. Irgendetwas hatte sich im Zimmer verändert. Leise wehte die Gardine im kalten Nachtwind. Das irritierte ihn. »Wieso ist eigentlich das Fenster auf? Ich hatte es garantiert heute Morgen geschlossen«, murmelte er und schüttelte missmutig den Kopf. Während er über die kaputte Lampe grübelte und sich fragte, ob er überhaupt noch eine Ersatzlampe im Haushalt hatte, vernahm er plötzlich ein kratzendes Geräusch. Es kam aus Richtung des Fensters und hörte sich so an, als ob jemand blitzschnell hinter ihn trat. Als er völlig überrascht aufblickte, sah er kurz etwas Längliches aufblitzen. Dann griff eine kräftige Hand gewaltsam in Radtkes Haarschopf und zog ihn mit einem Ruck brutal rückwärts. Jetzt war es schon zu spät für jegliche Gegenwehr oder einen Hilferuf.
Eine scharfe Klinge schnitt sich leise schmatzend von links beginnend in seinen Hals. Sie durchschnitt rasend schnell die Kehle und durchtrennte komplett die Halsschlagader. Erst auf der anderen Seite des Halses, nahe der Wirbelsäule, kam das Messerblatt endgültig zum Stehen.
In diesem Moment ließ der Mörder den Kopf des hilflosen Opfers los und verließ geräuschlos und sehr zügig den Raum. Man hörte danach eine Tür klappen und sich immer weiter entfernende Schritte, die schnell die Treppen im Hausflur hinuntergingen und sich schließlich in der Ferne verloren. Dann war es wieder still.
Aber das Herz von Joachim Radtke hatte noch nicht aufgehört zu schlagen und mit jeder Kontraktion pumpte es unaufhörlich Unmengen von Blut durch die durchtrennte Halsschlagader. Während das Opfer, sich um die eigene Achse drehend, langsam auf den Boden sank, wurde die rote Körperflüssigkeit, wie mit einem Rasensprenger, über den gesamten Raum verteilt.
Ein letzter rasselnder Laut war aus der zerstörten Kehle zu hören, dann wurde es endgültig wieder still, totenstill.
*
»Hermann, ich hoffe, du hast unseren Wohnungsschlüssel mitgenommen. Nicht, dass wir erneut den überteuerten Schlüsselnotdienst rufen müssen!«
»Aber ja doch mein Liebling«, erwiderte eine dunkle Stimme, während schwere Schritte die Treppen im Hausflur hinaufgingen. »Ich halte ihn bereits in der Hand. «
»Dann ist ja gut!« Der Tonfall hörte sich so an, als ob der Besitzer dieser resoluten Stimme die Hosen in der Ehe anhatte.
Hermann und Yvonne Müller kamen von ihrem Lieblingsitaliener. Sie verbrachten dort, bis vor kurzem, mit Freunden einen gemütlichen Abend. Erst vor wenigen Momenten hatte sie ein Taxi bis direkt an die Haustür gebracht.
Nun betraten sie bereits ihre Wohnung im 2. Stock des alten Mietshauses.
Während die füllige Frau ihren Mantel an den Garderobenhaken im Flur hängte, sagte sie leise zu ihrem Mann: »Schatz, kannst du mir schnell mein Magazin aus dem Wohnzimmer holen. Ich werde nachher im Bett noch ein bisschen lesen.«
Herrmann murrte zwar ein wenig, doch dann öffnete er die Wohnzimmertür und ging ohne Licht anzumachen, zielsicher zum Couchtisch hinüber. Auf diesem entdeckte er eine aufgeschlagene Illustrierte. Er nahm die Zeitschrift und verließ wieder den Raum.
»Danke, das ist ganz lieb von dir.« Seine Frau drehte sich lächelnd zu ihm um. Als sie ihn anschaute, erstarrten plötzlich ihre Gesichtszüge. Überrascht fragte sie ihn: »Wie siehst du denn aus?«
Herrmann Müller schaute Yvonne verständnislos an und murmelte ungehalten: »Verstehe ich jetzt überhaupt nicht, wie du das meinst?«
»Dein Hemd hat so komische Schmutzflecke. Du musst dich während des Essens mit Tomatensoße bekleckert haben.«
»Das kann gar nicht sein, das wäre mir aufgefallen«, verteidigte er sich.
Die Ehefrau akzeptierte seine Meinung keinesfalls. Stattdessen meinte sie kopfschüttelnd und in einem tadelnden Ton: »Du weißt doch, dass solche Flecke beim Waschen nur sehr schwer wieder herausgehen.«
»Du liegst trotzdem vollkommen falsch, mein Schatz«, widersprach er mit hochrotem Kopf seiner Frau. »Wie du dich vielleicht erinnern kannst, habe ich überhaupt kein Gericht mit Tomatensoße gegessen!«
Er schaute verwundert an sich herunter und wischte mit dem Finger über einen der Flecken. Dabei stellte fest, dass dieser noch feucht war. Das sprach eindeutig gegen die italienische Sauce, denn die wäre bereits eingetrocknet. Irritiert meinte er leise: »Um Gotteswillen, wie sehe ich bloß aus? Komisch. Ich war eben nur im Wohnzimmer und nirgendwo anders!«
Doch dann stieg ein Verdacht in ihm hoch. Er hielt Yvonne zurück, die gerade das erwähnte Zimmer betreten wollte. Ohne Widerspruch duldend, fuhr er erregt seine Gattin an: »Gehe bitte sofort in die Küche.«
»Aber warum das denn?« Sie blickte ihn verwundert an.
Er hatte sich wieder ein bisschen gefangen und beruhigte sie. »Liebling, ich erkläre es dir später. Ich muss erst einmal etwas nachprüfen.«
Die Angesprochene gab widerstrebend nach und verließ ihn kopfschüttelnd. In ihren Augen war ihr Mann nur ein wenig paranoid und merkwürdig. Allerdings war ihr immer noch nicht klar, warum sie nicht in die Wohnstube gehen durfte.
Herrmann Müller wartete, bis sie die Tür endlich hinter sich geschlossen hatte. Daraufhin öffnete er vorsichtig die Tür zum Wohnzimmer und schaltete das Deckenlicht an. Er wurde kurz vom gleißenden Schein geblendet. Aber als dann sein Blick bis hoch zur weißgestrichenen Zimmerdecke ging, erstarrte er förmlich.
Ein großer roter Fleck breitete sich in der Mitte der Decke aus. Einzelne Tropfen fielen auf die Oberkante der Hängelampe herunter. Dort angekommen, sammelten sie sich zu einem kleinen Strom, der stetig die gläserne Kugel hinunterfloss und auf den beigefarbenen Teppich tropfte.
»Ach, du Sch...«, rief er laut und griff entsetzt zum Telefonhörer.
Es war um 3.00 Uhr am Morgen.
*
Aus weiter Ferne drang das nervende Klingeln eines Telefons grausam in die angenehme Traumwelt ein. Er wollte den schrillen Klang, wie einen Gedanken, wegwischen, doch es gelang ihm nicht. Allmählich wurde ihm bewusst, dass das nervige Läuten nicht zu diesem Traum gehörte, sondern ihn abrupt zurück in die Realität brachte. Seine Hand griff suchend über den Nachttisch, bis er endlich das Handy fand und auf Empfang schaltete. »Ja, Geier!«
Sofort erkannte er die Männerstimme, die ihn unsanft geweckt hatte. »Morgen Günther, was liegt denn an?« Während der Kriminalist der Stimme am anderen Ende lauschte, löste er sich vorsichtig aus der Umarmung der noch schlafenden Ehefrau. Dann suchten die nackten Füße die Hausschuhe. Aber vorerst leider vergeblich und so verließ er barfuß das Schlafzimmer in Richtung Küche. Er schüttelte den Kopf und unterbrach erregt den Gesprächspartner. »Nun mal langsam, lieber Freund. Was haben wir denn damit zu tun? Das fällt doch in den Zuständigkeitsbereich der Berliner Kollegen.«
Man hörte, wie sein Gegenüber aufgeregt auf ihn einsprach.
Darauf erwiderte er ziemlich ungehalten: »Der Tote ist also ein Prominenter! Na und Günther? Im Tod sind alle Menschen gleich und in der vorliegenden Angelegenheit gibt es in Deutschland eindeutige Zuständigkeiten. Verantwortlich in diesem Fall ist die Hauptstadt Kripo und kein anderer!« Peter Geiers Stimme klang immer wütender. Das war auch mehr als verständlich. Vor seinen Augen sah er den freien Tag, den er mit Marina schon fest verplant hatte, wie die Titanic im Meer versinken.
Er machte eine unwirsche Handbewegung und hätte fast ein halbvolles Glas vom Küchentisch gerissen. »Günther, wer hat das überhaupt angeordnet, dass wir für den Fall zuständig sind? Dem drehe ich eigenhändig den Hals um. Seit vielen Wochen habe ich endlich wieder einmal einen freien Tag und den darf ich jetzt nicht nehmen! Spuck schon aus, von wem kam die Anweisung, dass wir uns darum kümmern müssen?«
Resignierend hörte Geier zu. Schließlich gab er frustriert auf. »Also gut, Günther. Ja, hole mich in 30 Minuten ab. Falls ich nicht mehr anwesend bin, dann wurde ich von meiner enttäuschten Frau einen Kopf kürzer gemacht. Mach`s gut!«
Er schaltete das Telefon aus und warf es deprimiert auf den Küchentisch.
Plötzlich fragte ihn leise eine Stimme: »Warum soll ich denn wütend auf dich sein, Schatz?«
Geier erschrak und drehte sich um. Jetzt erst sah er Marina, die direkt hinter ihm stand und anscheinend ein Teil des Telefonates mitgehört hatte. Ihre braunen Augen blickten ihn fragend an, während sie sich eine blonde Strähne aus dem verschlafenen, jedoch vom letzten Sommer noch immer leicht gebräunten, Gesicht strich.
Überrascht sah er sie an. »Oh Liebling, du bist schon auf? Das tut mir aber leid. Eigentlich wollte dich auf gar keinen Fall wecken.«
»Peter, du klangst eben ziemlich wütend am Telefon. Das war keineswegs zu überhören.« Sie schaute kurz auf ihre Armbanduhr. »Außerdem ist es erst 6.00 Uhr an einem Samstagmorgen. Als leidgeprüfte Frau eines Hauptkommissars der Kripo weiß ich, dass frühe Anrufe am Wochenende meist nichts Gutes bedeuten.«
Geier hob resignierend die Schultern. »Ach Schatz, du hast es wieder einmal auf den Punkt getroffen. Mein freier Tag wurde gerade eben durch Günther Gölzow gestrichen. Man hat vor wenigen Stunden in einer Wohnung in Friedrichshain die Leiche eines Mannes gefunden.«
Seine Frau schüttelte nun ebenfalls verständnislos den Kopf, denn in den Zuständigkeitsbereichen der einzelnen Abteilungen kannte sie sich, dank des Ehegatten, gut aus. »Was habt ihr überhaupt damit zu tun? Dafür sind doch die Kollegen aus Berlin zuständig oder sehe ich das jetzt falsch?«
Geier nickte. »Ja, das dachte ich eigentlich auch. Aber Günther informierte mich, dass es sich bei dem Toten mit hoher Wahrscheinlichkeit um einen Mitarbeiter der Tietze-Behörde handeln soll.«
»Nun wird mir alles klar, Peter. Einige politische Größen des Landes haben anscheinend kalte Füße bekommen und trauen die Aufklärung dieser delikaten Angelegenheit euren Kollegen aus Berlin nicht zu. Tja und nun sind sie auf Nummer sicher gegangen.«
»So kann man das wohl auch sehen, Marina. Jedenfalls bekam Günther vor kurzem direkt vom Innenministerium einen Anruf. Er wurde angewiesen erstens Herrn Geier aus dem Bett zu klingeln, zweitens dessen freien Tag zu streichen, drittens den Fall zu übernehmen, viertens mich abzuholen und ohne Umwege zum Tatort zu bringen. Aber«, während er noch sprach, umarmte er seine Frau zärtlich und hauchte ihr leise ins Ohr, »immerhin haben wir genau 28 Minuten Zeit, Kaffee zu trinken und Zeitung zu lesen.«
»Was du nicht sagst?«
»Man kann natürlich«, er hob sie mit einem Schwung hoch und trug sie ins Schlafzimmer, »auch andere, viel interessantere, Sachen anstellen.«
*
31 Minuten später bestieg Peter Geier den Dienst BMW, der direkt vor dem Hauseingang stand. Am Steuer saß unübersehbar sein Freund und engster Mitarbeiter Günther Gölzow. Der 52-jährige Stellvertreter war von kleiner Statur, hatte ein feistes Gesicht, in dessen Mitte eine fleischige Nase thronte. Er war seit vielen Jahren, wie er fand, glücklich mit ein- und derselben Frau verheiratet. Das lag sicherlich auch an ihren ausgezeichneten Kochkünsten, was man seiner korpulenten Figur durchaus deutlich ansah. Wahrscheinlich musste er sogar den Bauch einziehen, damit er überhaupt hinter das Lenkrad passte. Manche Kollegen bezeichneten ihn total undiplomatisch als fett und so ganz Unrecht hatten sie keinesfalls.
Doch Gölzow ließ diese Einschätzung vollkommen kalt. Von Diäten hielt er nichts und außerdem war er einer der besten Kriminalisten der Sonderkommission. Jedoch von der korpulenten Gestalt, auf einen gemütlichen Charakter bei ihm zu schließen war völlig falsch, denn der Kommissar ließ sich relativ leicht provozieren und brauste dann sehr schnell mal auf. Gefürchtet waren im Kollegenkreis überdies seine bissigen ironischen Bemerkungen, die eher schon zum Sarkasmus neigten. Aber Gölzow war eine ehrliche Haut und äußerte diese Meinungen auch lautstark in der Öffentlichkeit und das, ohne Rücksicht auf Verluste. Da er dabei gelegentlich über das Ziel hinausschoss, interessierte ihn nicht sonderlich. Der eigenen Karriere allerdings war Letzteres nicht gerade förderlich und so gingen einige Beförderungsrunden spurlos an ihm vorbei.
Seine Wangen hatten einen rötlichen Schimmer angenommen, als Geier die Beifahrertür öffnete, leise, »Guten Morgen«, murmelte und sich neben ihm setzte. Dann strich er sich verlegen über die Halbglatze, die von einem Kranz grauer Haarsträhnen umgeben war, und meinte mit einem vielsagenden Lächeln zum Hauptkommissar: »Na, Peter ausgeschlafen? Hast du deinen freien Tag wenigstens ein bisschen nutzen können?«
Geier grinste seinen Kollegen verschwörerisch an. »Na ja, wie man es nimmt. Eigentlich wollte ich mit Marina heute einen Ausflug ins Grüne machen. Aber immerhin, ein klein wenig kam ich doch noch auf meine Kosten«.
Günther schmunzelte. »Na, dann will ich dich nicht weiter zu deinen morgendlichen Aktivitäten befragen, obwohl ich ahne, mit was du beschäftigt warst. Ich stelle dir lieber mal unseren neuen Fall vor!«
»Okay, ich bin ganz Ohr«, erwiderte Geier mit wachsender Neugier. »Du hast mich ja nicht zum Spaß aus dem Bett geholt!«
Gölzow nickte flüchtig, dann startete er den BMW, blinkte und nachdem er in den Rückspiegel geschaut hatte, fuhr er los. Wenige Augenblicke später begann er zu berichten: »Heute Morgen gegen 3.00 Uhr meldete sich ein aufgeregter Anrufer bei der Polizei. Er berichtete, dass er gerade mit seiner Frau nach Hause gekommen war und beim Betreten des eigenen Wohnzimmers einen großen roten Fleck an Decke entdeckt hat.«
Geier schaute ihn fragend an. »Blut?«
»Ja, das vermuteten die Kollegen in der Zentrale auch sofort. Deshalb schickten sie umgehend einen Streifenwagen zum vermeintlichen Tatort!«
»Wohin genau?«
»In die Gürtelstraße 32 nach Friedrichshain.«
»Und weiter?«
»Sie fanden ein völlig aufgelöstes Ehepaar vor. Das Oberhemd des Mannes hatte einige rote Flecke, die sich bei einer näheren Untersuchung mit Luminol als Blut herausstellten. Die Beamten haben anschließend versucht, den Mieter in der Wohnung darüber zu erreichen. Aber auf das Klingeln und Klopfen wurde leider nicht geöffnet.«
»Haben sie daraufhin die Wohnungstür aufgebrochen?«
»Nein!« Gölzow schüttelte den Kopf. »So drastisch sind die Kollegen nicht vorgegangen. Sie haben den Schlüsselnotdienst kommen lassen und der hat die Tür entriegelt. Na ja und dann haben sie ihn aufgefunden.«
»Wen haben sie gefunden?«
»Joachim Radtke.«
Peter Geier schaute seinen Freund irritiert an.
Der bemerkte den fragenden Blick und fragte überrascht: »Kennst du ihn etwa nicht?«
Der Beifahrer hob bedauernd die Schultern. »Ganz ehrlich, der Name ist mir völlig unbekannt.«
Gölzow begann umständlich zu erzählen: »Wie ich dir ja schon am Telefon erzählte, ist Joachim Radtke bereits einige Zeit der Pressesprecher der Tietze-Behörde und genießt dort den Ruf eines gnadenlosen Hardliners!«
»Und wie äußerte sich das«, fragte Geier neugierig.
Sein Mitarbeiter schaute ihn verwundert von der Seite an und erst nach einem kurzen Zögern erwiderte er: »Beispielsweise möchte er am liebsten, dass die Stasi-Überprüfungen in der öffentlichen Verwaltung noch mindestens 30 Jahre länger durchgeführt werden.«
»Woher weißt du das, Günther?«
Gölzow fuhr langsam an eine rote Ampel heran. Dann bremste er vorsichtig und meinte anschließend zu Geier: »Diese Meinung hat er jedenfalls vehement vor ein paar Tagen in einer Talk-Show vertreten. Mir persönlich schien er sehr verbittert zu sein. Er wurde, ohne Frage, in der DDR von der Stasi quasi fast vernichtet. Somit ist die unversöhnliche Haltung des Mannes gegen ehemalige Geheimdienstmitarbeiter mehr als verständlich.«
Geier musste ehrlich zugeben. »Nein, den kenne ich nicht. Ich muss allerdings zu meiner Entschuldigung anmerken, dass mich die Tietze Behörde noch nie sonderlich interessiert hat. Warum auch?«
Gölzow sah ihn einige Momente nachdenklich an. Endlich fuhr er mit leiser Stimme fort: »Tja, dann wirst du dich wohl jetzt umso intensiver um das umstrittene Amt kümmern dürfen. Jedenfalls haben die Kollegen in der Wohnung eine Leiche gefunden, die förmlich in ihrem eigenen Blut schwamm. Es wurde relativ schnell ermittelt, dass es sich bei den Toten um Joachim Radtke handelt. Daraufhin wurde sofort das Innenministerium informiert. Die Mitarbeiter dort holten wiederum ihren Minister aus dem Bett und in einer eilig einberufenen Krisensitzung wurde entschieden, dass wir den Fall übernehmen sollen. Ja und als Chef vom Dienst bekam ich kurz vor 5.00 Uhr den entscheidenden Anruf und musste dich leider brutal von deiner Marina trennen.«
Geier saß eine Weile schweigend da, dann fragte er nachdenklich: »Wurde bereits mit der Rekonstruktion des Tatherganges begonnen?«
»Selbstverständlich. Die Kollegen der Spurensicherung und der Gerichtsmediziner sind seit Stunden vor Ort«, antwortete sein Mitarbeiter mit ernster Miene.
»Wurde Rene Heinrich informiert?«
Gölzow schmunzelte, als er erwiderte: »Ja, den habe ich bereits vor dir aus dem Bett geholt und quasi als unser Vorauskommando zum Tatort geschickt. Deshalb konntest du auch noch ein klein wenig länger schlafen oder was du sonst so getrieben hast.«
Geier lachte laut auf und mit einem Augenzwinkern meinte er: »Günther, du bist, wie meine Mutter zu mir. Die hat mich ebenfalls immer in Watte gepackt.«
Der nickte seufzend. »Ich weiß! Aber was tut man nicht alles für einen guten Freund.«
Während ihrer Unterhaltung hatten sie mittlerweile Friedrichshain erreicht. Sie bogen von der Frankfurter Allee kommend, rechts in die Gürtelstraße ein. Nach einigen Metern unterquerte die Fahrbahn eine S-Bahn-Brücke. Sie folgten der Straße, fuhren am kleinen Hotel »Tulip Inn« vorbei und hielten wenig später vor einem eingerüsteten Haus. Vor diesem war schon eine Vielzahl von Fahrzeugen, teilweise verkehrswidrig, mitten auf dem Bürgersteig, geparkt. Neben verschiedenen Einsatzfahrzeugen der Polizei entdeckten sie auch die schwarze Limousine des Gerichtsmedizinischen Institutes. Geier und Gölzow stiegen fast gleichzeitig aus, klappten die Autotüren zu und gingen auf einen jungen Polizisten zu, der vor dem Hauseingang Wache schob.
Als der uniformierte Kollege sie bemerkte, versperrte er ihnen mit der Hand den Weg und sagte freundlich: »Entschuldigen Sie bitte, aber Sie dürfen das Haus zurzeit leider nicht betreten.«
Bevor er weitersprechen konnte, hielten sie ihm schon ihre Dienstausweise vor das Gesicht.
Der junge Mann errötete und ging sofort zur Seite. »Alles klar, die Herren Kripobeamten. Sie dürfen natürlich passieren.«
Im Hausflur roch es muffig, es war feuchtkalt und an den Wänden entdeckten sie einige Schimmelpilze. Der Hauptkommissar fröstelte und klappte seinen Mantelkragen hoch. Dann liefen sie langsam die ausgetretenen Holzstufen, die leise unter ihren Tritten knarrten, nach oben. Endlich erreichten sie den 3. Stock des alten Mietshauses. Geiers korpulenter Freund hielt sich am Geländer fest und musste mehrfach tief durchschnaufen, um wieder zu Atem zu kommen. Auf einer Wohnungstür, die schon lange keine neue Farbe mehr gesehen hatte, prangte ein handgeschriebenes Pappschild mit dem Namen J. Radtke. Günther Gölzow drückte auf den grauen Klingelknopf und eine scheppernde Klingel ertönte.
Der schwarze Lockenkopf von Rene Heinrich, mit 28 Jahren einer der jüngsten Mitarbeiter der Abteilung, schaute aus dem Türspalt hervor. Als er seine beiden Kollegen erblickte, begrüßte er sie erleichtert: »Guten Morgen. Schön, dass ihr da seid.«
Geier wies mit der Hand in Richtung der Wohnungstür und fragte leise: »Dürfen wir hereinkommen?«
Heinrich machte die Tür bis zu einem kleinen Spalt wieder zu und sprach ein paar Worte direkt in die Wohnung hinein. Wahrscheinlich holte er sich das Einverständnis von den Technikern, die sich derzeit dort aufhielten. Schließlich öffnete er weit die Tür und meinte zu seinen beiden Kollegen: »Ja, ihr könnt reinkommen. Die Jungs von der Spurensicherung sind gleich fertig.« Dann überreichte er ihnen jeweils einen weißen Einweg-Overall. Das Kleidungsstück war für den einmaligen Gebrauch bestimmt und musste von allen eingesetzten Beamten am Tatort getragen werden. Damit wurde verhindert, dass eventuell vorhandene Finger- und Fußabdrücke bis zur Unkenntlichkeit verwischten, sowie DNA-Spuren vernichtet oder verunreinigt wurden.
»Ich hasse diese Overalls«, knurrte Gölzow mürrisch und zwängte sich mit eingezogenem Bauch laut ächzend hinein.
»Vielleicht solltest du ein wenig abnehmen, Günther«, bemerkte Heinrich schmunzelnd.
Der erwiderte mit einem erschöpften Schnaufen: »Ja, wenn ich stundenlang in diesem Anzug zubringen muss, werde ich mit Sicherheit zig Kilos loswerden. Man schwitzt darin, wie in einer Sauna!«
Mit ernster Miene wandte sich dann Rene an Peter. »Möchtet ihr ihn jetzt sehen?«
Geier zögerte einen winzigen Moment, schließlich gab er wortlos sein Einverständnis.
Leise fragte Hinrich einen Kollegen von der Spurensicherung, kurz Spusi im Polizeijargon genannt, der gerade die Wohnung verlassen wollte: »Seid ihr im Wohnzimmer schon fertig?«
Der Angesprochene bestätigte. »Ja, da sind wir durch. Nur die Gerichtsmedizinerin ist noch anwesend.«
»Alles klar «, erwiderte der junge Kriminalist und fuhr sich mit der linken Hand nachdenklich über die unrasierte Wange. Wahrscheinlich war er am Morgen nicht mehr dazu gekommen, sich zu rasieren. Denn normalerweise achtete er ansonsten sehr penibel auf sein Äußeres.
Nach kurzem Zögern ging Heinrich voran und öffnete vorsichtig die Wohnzimmertür. Als sie eintraten, empfing sie heller Lichtschein. Drei Halogenstrahler leuchteten jeden Winkel des Raumes taghell aus. Direkt vor den Zimmerwänden hatte der Wohnungseigentümer mächtige Holzregale angeordnet, die fast bis zur weißen Stuckdecke reichten. Sie waren bis zum letzten Platz mit Büchern vollgestopft. In der Mitte stand ein großer runder Eichentisch, um den sich 4 gewaltige Sessel aus braunem Leder gruppierten. In der Nähe des Fensters sahen die Polizisten einen Computertisch aus Kiefernholz. Auf diesem befanden sich ein 21 Zoll Monitor, ein Scanner und ein kleiner Drucker. Den eigentlichen Rechner hatte Radtke neben dem linken vorderen Tischbein positioniert. An der rechten Tischkante war eine, mit einer Klammer befestigte, weißlackierte Computerlampe angebracht. Auf beiden Seiten des Displays stapelten sich ungeordnet Akten, Zeitschriften und Briefe auf dem Tisch.
Die graue PVC-Einfassung des Monitors, der Bildschirm, die Deckel von Drucker und Scanner, die beige Gardine, viele Bücher in den Holzregalen und schließlich einige Bereiche der ansonsten schneeweißen Raufasertapete, hatten sich zum Teil erheblich farblich verändert. Man konnte deutlich erkennen, dass die Zimmereinrichtung inklusive der Wände mehr oder weniger mit länglichen Streifen, sowie unzähligen Tropfen geronnenen Blutes übersät war. Dann erblickten die hartgesottenen Kripobeamten endlich das Opfer.
Radtkes toter Körper befand sich in einem Gang zwischen dem Computertisch am Fenster und dem runden Eichentisch in der Mitte des Zimmers. Während die Beine angewinkelt nahe dem Rumpf lagen, war der Kopf unnatürlich um 90 Grad nach oben gedreht. In der grässlich zugerichteten, weit auseinandergerissenen, Wunde der Halspartie konnten die Männer deutlich die durchschnittene Kehle und die komplett durchtrennte Halsschlagader sehen. Fast das gesamte Blut war aus dem Körper des Opfers gepumpt worden und hatte sich neben seinem Oberkörper zu einem großflächigen See ausgebreitet. Der ausgefranste Rand der Blutlache war bereits angetrocknet, während in der Mitte alles noch dickflüssig war.
Grit Bertram, eine große schlanke Frau mit grauem Bubikopf, packte soeben ihre Utensilien zusammen. Sie war eine der besten Gerichtsmediziner des Landes.
»Hallo Doktor«, begrüßte Geier sie.