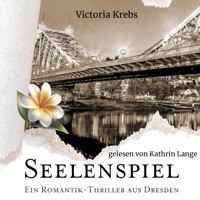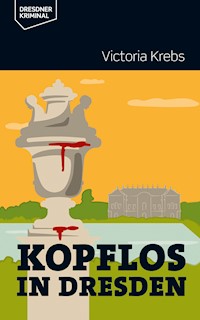10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Saxo-Phon
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ein toter Antiquitätenhändler und ein erschossener Restaurantgast - nichts scheint die Morde zu verbinden, bis auf eine schaurige Gemeinsamkeit: Beiden Opfern fehlt ein Stück Haut im Nacken.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 372
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Victoria Krebs
BLUTIGES ERBE
IN DRESDEN
Ein Maria-Wagenried-Thriller
Victoria Krebs
BLUTIGES ERBE
IN DRESDEN
Die Autorin
Es war Liebe auf den ersten Blick, die Victoria Krebs mit der Barockstadt an der Elbe verband. Die einzigartige Architektur, die malerische Landschaft und die liebenswerte Individualität der Menschen in dieser Region inspirierten sie zu ihrem ersten Thriller, der in Dresden spielt. Protagonisten mit Ecken und Kanten, abscheuliche Verbrechen und nicht zuletzt die Liebe mit ihren Irrungen und Wirrungen beherrschen ihre schriftstellerische Arbeit. Victoria Krebs ist in Oldenburg, Niedersachsen, geboren und lebt heute mit ihrer Familie in Dresden.
Impressum
© DDV EDITIONSächsische Zeitung GmbH
Ostra-Allee 20, 01067 Dresden
www.ddv-edition.de
© Reihengestaltung und Umschlagillustration
www.oe-grafik.de
Autorin: Victoria Krebs
Grafische Gestaltung: Thomas Walther, BBK
Satz: Ö GRAFIK agentur für marketing und design
Druck: CPI Moravia Books
Alle Rechte vorbehalten | Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
ISBN 978-3-943444-82-7 (Print)ISBN 978-3-948916-02-2 (Epub)ISBN 978-3-948916-03-9 (Mobi)
PROLOG
Die elf Männer hatten sich in dem dunklen Gewölbe zu einem Halbkreis versammelt. Flackernder Kerzenschein warf die Schatten ihrer Konturen an das alte Gemäuer, dessen rote Ziegel im Laufe der Zeit gelitten und sich an einigen Stellen schwarz verfärbt hatten. Die Luft, kühl und feucht, atmete den Geruch von nahezu zwei Jahrhunderten und war angereichert mit würzigem Weihrauchduft, den eine kleine Messingschale auf dem Tisch am hinteren Ende des Raumes verströmte.
Hell leuchteten ihre langen, weißen, mit Kordeln geschnürten Kutten. Auf der linken Brust prangte jeweils ein rotes Kreuz. Schweigend und mit unbewegter Miene schauten die Männer auf den Großmeister. Er stand, von zwei mannshohen Kerzenleuchtern flankiert, am offenen Ende des Kreises. Zu seinen Füßen kniete ein zwölfter Mann, den Kopf demütig gesenkt.
Gemäß dem Ritual legte der Großmeister ihm die Hand aufs Haupt und ließ sie dort für einen Moment liegen, bevor er sie wieder zurückzog. Wie auf ein Zeichen hin hob der vor ihm kniende Mann sein Gesicht und richtete seinen Oberkörper auf. Er legte die rechte, geballte Faust auf das leuchtend rote Kreuz und begann, den Schwur zu rezitieren:
»Ich schwöre, meine Rede, meine Kräfte und mein Leben in die Verteidigung des Bekenntnisses des in den Mysterien des Glaubens gegenwärtigen Gottes zu heiligen. Ich gelobe dem Großmeister des Ordens Unterwerfung und Gehorsam. Sollten Unbill und Ungerechtigkeit herrschen, werde ich dem entgegentreten. Mein Kopf und mein Arm sollen der Wahrheit gehören. Niemals werde ich feige die Flucht ergreifen, sondern unsere Feinde bis zum Letzten bekämpfen.«
Ein Luftzug ließ die Flammen der Kerzen flackern, Totenstille hatte sich über die Anwesenden gesenkt.
Aller Augen waren auf den Großmeister gerichtet. Das warme Kerzenlicht milderte die Schatten seiner tiefen Furchen auf Wange und Stirn. Wie ein Glorienschein umgab das schlohweiße Haar sein Haupt und verlieh seiner Erscheinung eine mystische Aura. Er sah die Umstehenden der Reihe nach an. Sein Blick schien jeden von ihnen zu durchbohren, so als wolle er ihre geheimsten Gedanken ergründen, um sich ihres unbedingten Gehorsams und ihrer unverbrüchlichen Treue bis in den Tod zu versichern.
Dann wandte er sich langsam um, griff nach dem einfachen Holzkreuz, das auf dem Tisch hinter ihm lag, und hielt es dem Knienden entgegen.
»Stelle nun deinen Kampfesmut und den unbeug-samen Willen, dem Orden zu dienen, unter Beweis:
Spucke dreimal auf dieses Kreuz! Verleumde Jesus Christus!
Dieser Akt soll dich stärken und vorbereiten auf das, was der Feind dir abverlangt, solltest du ihm im heiligen Kampf unterliegen. Denn er wird dich zwingen, dem Herrn abzuschwören und ihn zu verhöhnen.«
Für einen Moment senkte der Kniende den Blick, er schien zu zögern. Doch dann hob er ihn wieder und sah dem Großmeister fest in die Augen.
Er neigte sich ein Stück nach vorn und spuckte dreimal hintereinander auf das Kreuz.
Der Großmeister legte das heilige Symbol zurück auf den Tisch und reinigte es mit einem weißen Tuch. Dann schritt er zu der dahinter liegenden Wand, die von einem dunklen Vorhang verborgen war. Mit einem Ruck zog er den Stoff beiseite und enthüllte ein Bild mit dem Antlitz Jesu Christi.
Der Kniende erhob sich und stellte sich neben den Großmeister, während sich die übrigen Männer erneut zu einem Halbkreis formierten.
Der Großmeister erhob seine Stimme:
»Erweist dem neuen Primus eure Ehre!«
Einer nach dem anderen kniete vor dem Zwölften nieder, hob den Saum seines Gewandes, führte ihn zum Mund und berührte ihn mit den Lippen.
Als der letzte der Ritter seine Ehrbezeugung kundgetan hatte, holte der Großmeister eine kleine, dunkelblaue Schachtel unter seiner Kutte hervor und öffnete den Deckel. Würdevoll überreichte er dem Primus das Kästchen und legte es in seine ausgestreckten Hände.
»Ich habe dich erkannt und auserwählt. Du bist der Richtige für diese Aufgabe«, sprach er zu ihm. »Zum Zeichen meiner Liebe und Anerkennung übereiche ich dir dieses wertvolle Kleinod.«
Der Primus sah auf das mit weißem Satin überzogene Kissen, in dessen Mitte ein rotes Kreuz eingestickt worden war. Darauf lag ein Siegel aus gehämmertem Silber.
Tränen traten ihm in die Augen, bevor er sie schloss und die Medaille inbrünstig mit seinen Lippen berührte.
Kapitel 1
Prasselnd schlug der Regen gegen die Windschutzscheibe ihres Autos. Die hektisch hin und her tanzenden Scheibenwischer kamen nur schwer gegen die Wassermassen an. Wie kleine Bomben zerplatzten die dicken Tropfen auf der Scheibe und nahmen Maria die Sicht.
Grauenvolles Wetter, dachte sie. Sie blickte mit zusammengekniffenen Augen und leicht nach vorn gebeugtem Oberkörper auf die Königstraße, in die sie gerade eingebogen war. Schon von Weitem sah sie die Einsatzwagen mit ihren blau flackernden Lichtern in der ansonsten grau in grau vor ihr liegenden Straße. Die Konturen der Häuser und Bäume zu beiden Seiten waren verschwommen wie auf einem Aquarellgemälde. Alles, die Gebäude, die vorbeieilenden Passanten, die Blumenkübel vor den Restaurants und Geschäften, schien in den Fluten zu versinken.
In Schrittgeschwindigkeit näherte sie sich den Polizeifahrzeugen. Schon jetzt schauderte ihr bei dem Gedanken daran, das warme, trockene Auto zu verlassen. Wie immer hatte sie ihren Schirm im Präsidium vergessen. Der Wolkenbruch würde sie innerhalb weniger Sekunden bis auf die Haut durchnässen. Fluchend hielt sie direkt neben einem Polizisten und ließ die Scheibe herunter.
»Sie haben nicht zufällig einen Schirm für mich?«, fragte sie und setzte das liebenswürdigste Lächeln auf, zu dem sie an diesem ungemütlichen Maimorgen in der Lage war.
»Einen Schirm?«, fragte der Mann begriffsstutzig.
»Sie könnten natürlich auch einfach den Regen abstellen. Ich wäre aber auch mit einem stinknormalen Schirm zufrieden.«
Der Beamte lächelte, als er begriff, dass Maria einen Scherz gemacht hatte.
»Moment, Frau Wagenried, ich schaue mal nach.«
Sie hatte nicht damit gerechnet, aber er kam wenige Augenblicke zurück, öffnete galant die Fahrertür und hielt beflissen den schützenden Regenschirm über sie.
»Danke sehr. Ich werde Sie befördern. Wie heißen Sie?«
»Wachtmeister Rohrig«, antwortete er mit einem breiten Lächeln und begleitete sie bis zur Eingangstür. Diesmal hatte er den Witz sofort begriffen.
Maria öffnete die Tür neben dem großen Schaufenster und betrat einen mit Antiquitäten, Silber und Ölgemälden vollgestopften Raum. Sie bahnte sich einen Weg durch mehrere Uniformierte, die grüßend Platz machten, als sie die Kommissarin erblickten.
»Wo?«, fragte sie einen Kollegen. Der wies auf eine offen stehende Tür im hinteren Bereich des Geschäfts.
Der Tote saß an einem großen, massiven Schreibtisch. Unzählige Verletzungen entstellten sein Gesicht. Die Augen weit aufgerissen, schien er Maria direkt anzustarren. Ein blutiger Einschnitt klaffte unterhalb des Kehlkopfes, die Vorderseite seines hellblauen Hemdes war blutdurchtränkt. Marias Blick glitt weiter nach unten. Etwas stimmte mit seinen Händen nicht. Sie lagen in einer unnatürlichen Position ausgestreckt nebeneinander, die Innenflächen nach oben gerichtet, so als wolle er einen Segen empfangen. Als sie näher herantrat, sah Maria, dass beide Hände auf der polierten Oberfläche des Schreibtisches festgenagelt waren.
»Bernhard Molberg«, hörte sie eine Stimme sagen. Es war die ihres Assistenten Hellwig Dreiblum, der plötzlich neben ihr stand. »Antiquitätenhändler und Ladeninhaber. Sein Sohn, Alexander Molberg, hat ihn hier vor circa einer halben Stunde gefunden.«
»Todesursache?«, fragte Maria weiter.
»Erdrosselung mit einer Garotte«, ertönte eine Stimme wie aus dem Nichts. Dr. Stein tauchte hinter dem Toten auf. »Ich grüße Sie, Frau Wagenried«, schnaufte er. »Das Tatwerkzeug passt irgendwie zu diesem Ambiente, finden Sie nicht?« Demonstrativ hielt er ein Plastiktütchen hoch.
»Eine Garotte?«, fragte sie ungläubig. »Hatte ich während meiner gesamten Dienstzeit noch nie.« Sie inspizierte den blutigen, an beiden Enden mit kleinen Holzgriffen versehenen Draht. Das dünne und harte Metall war so fest um den Hals des Opfers zusammengezogen worden, dass es die Haut unterhalb des Kehlkopfes und beide Aorten durchtrennt hatte. Maria hoffte für den Mann, dass er bereits vorher erstickt war.
»Kann man schon sagen, ob es ein Raubmord war?«
»Laut seinem Sohn scheint auf den ersten Blick nichts zu fehlen«, sagte Hellwig Dreiblum. »Genaueres kann er aber erst sagen, sobald er die Inventarliste mit dem aktuellen Bestand verglichen hat.«
»Wo ist der Sohn?«
»Auf der Toilette.« Dreiblum zupfte verlegen an seiner Wollmütze. »Musste sich übergeben. Ist allerdings schon fünfzehn Minuten da drinnen. Vielleicht sollte ich mal …«
»Gute Idee, Hellwig. Holen Sie ihn da raus!«
Er setzte sich in Bewegung.
»Beeilen Sie sich!«, rief Maria scharf. Und an die Umstehenden: »Wieso lassen Sie den Mann so lange allein? In einem Mordfall ist jeder verdächtig. Schlamperei!« Verlegenes Füßescharren und Räuspern waren die Reaktionen.
»Können Sie schon etwas zum möglichen Todeszeitpunkt sagen, Dr. Stein?«, wandte sie sich wieder an den Rechtsmediziner.
»Schätze, gestern Abend zwischen zehn und zwölf, aber …«
»Jaja, ich weiß, Genaueres erst nach der Obduktion.«
Dr. Stein zuckte lapidar mit den Schultern. Dann hockte er sich ächzend wieder hin und Maria hörte, wie er seine Instrumente klirrend zurück in den Koffer warf.
»Immer noch Probleme mit dem Rücken, trotz der neuen, ›schweineteuren‹ Matratze?« Das hatte sich Maria nicht verkneifen können. Das letzte Mal hatte sie Dr. Stein getroffen, als er im vergangenen Jahr zu den enthaupteten Frauenleichen gerufen worden war. Schon da hatte er über Rückenprobleme geklagt und den Kauf einer neuen Matratze erwähnt, die ihm allerdings nicht helfe. Unbelehrbar, wie er nun mal war, hatte er bisher alle Ratschläge, sich von einem Orthopäden untersuchen zu lassen, in den Wind geschlagen.
»Ich befürchte, es ist noch schlimmer geworden«, stöhnte er, als er wieder hinter dem Schreibtisch auftauchte.
»Nur so fürs Protokoll: Warum gehen Sie nicht endlich mal zum Arzt?«
»Der Einzige, zu dem ich gehen würde, ist Dr. Rothemund. Mit dem habe ich zusammen studiert, aber diesen Triumph gönne ich ihm nicht auch noch«, schnaubte er verächtlich. »Ich verliere schon regelmäßig beim Schach gegen ihn.«
Hellwig Dreiblum kam mit dem Sohn des Ermordeten zurück, ein blasser, dunkelhaariger Mann, der sich immer wieder nervös durch die Haare fuhr. Beim erneuten Anblick seines ermordeten Vaters schlug er die Hände vor den Mund, so als wolle er einen Schrei unterdrücken. Maria stellte sich ihm vor.
»Schildern Sie doch bitte, wann und wie Sie ihren Vater gefunden haben.« Auffordernd nickte sie ihm zu.
»Kann … kann ich mich setzen?«
»Natürlich«, erwiderte Maria und bemerkte den Schweißfilm auf seiner Oberlippe. Augenscheinlich hatte er auch geweint, denn Augen und Nase waren verquollen und gerötet.
Er wollte sich gerade den Besucherstuhl vor dem Schreibtisch heranziehen, als zwei Männer mit einem Sarg hereinkamen, um den Toten abzutransportieren.
»Muss das jetzt sein?« Verärgert runzelte Maria die Brauen. Sie wandte sich an den Sohn des Opfers: »Warten Sie doch bitte so lange im vorderen Raum, Herr Molberg.«
»Wir brauchen eine Zange«, forderte Maria, als Alexander Molberg das Zimmer verlassen hatte, und wies mit dem Zeigefinger auf die festgenagelten Hände des Opfers. Ein Kollege von der Spurensicherung holte das Werkzeug aus seinem Metallkoffer und versuchte den Nagel aus der rechten Hand herauszuziehen, was ihm aber nicht gelang, weil er die Zange nicht richtig ansetzen konnte. Ein Polizeibeamter kam schließlich auf die Idee, unter dem Schreibtisch nachzuschauen, ob die Nagelspitze das Holz durchstoßen hatte: »Ich brauche einen Hammer, mit dem ich gegen die Spitze schlagen kann. Der Kollege von der Spusi zieht von oben mit der Zange.«
Schließlich gelang es den Männern, die langen Nägel Stück für Stück herauszubefördern. Sie verwahrten sie, wie die Garotte, in einem Beweismittelsicherungstütchen.
Ein unterdrücktes Schluchzen entwich Alexander Molbergs Kehle, als sein Vater im Sarg zu dem vor dem Geschäft wartenden Leichenwagen getragen wurde.
»Wo bringen Sie ihn hin?«, fragte er leise und sah Maria voller Verzweiflung an.
»Es ist üblich, dass eine Leiche nach einem Mord in die Rechtsmedizin gebracht wird«, sagte Maria so ruhig und sachlich wie möglich. »Dort wird eine Obduktion durchgeführt.«
Molberg sackte sichtlich in sich zusammen. »Dann wird er von oben bis unten aufgeschnitten. Alle Organe werden herausgenommen, wie bei einem Tier, das ausgeweidet wird«, flüsterte er tonlos.
»Herr Molberg, die Organe müssen untersucht werden, das ist Vorschrift. Aber natürlich werden sie wieder zurückgelegt.«
Er schluckte krampfhaft.
»Sie wollen doch, so wie wir auch, dass der Mörder Ihres Vaters gefunden wird. Eine Obduktion ist unerlässlich, weil eventuell Spuren des Täters am Körper des Toten nachgewiesen werden können oder sonstige Beweismittel, die vielleicht Rückschlüsse auf den Tathergang zulassen. Das verstehen Sie doch, nicht wahr?«
Jetzt nickte er schwach.
»Ich möchte jetzt noch einmal auf meine Frage von vorhin zurückkommen. Wann und wie haben Sie Ihren Vater gefunden?«
»Also, ich …« Molberg räusperte sich und schluckte hart. »Ich bin gegen halb elf heute Morgen hierhergekommen. Zu meiner Verwunderung hatte mein Vater das Geschäft noch nicht geöffnet. Normalerweise öffnet er um zehn. Da habe ich dann mit meinem Schlüssel die Tür aufgeschlossen und ihn dort«, er blickte kurz zum Stuhl hinter dem Schreibtisch, »kurze Zeit später gefunden. Es war einfach schrecklich, ihn da so … so zugerichtet sitzen zu sehen. Mir war natürlich sofort klar, dass er tot war. Ich habe dann gleich die Polizei gerufen.«
Maria nickte und wandte sich an die Umstehenden.
»Wurde der Schlüssel des Toten gefunden?«, fragte sie.
Ein Kollege der Spurensicherung verneinte und auch die Polizeibeamten schüttelten den Kopf.
»Das bedeutet, dass der Mörder ihn vermutlich mitgenommen hat, denn er hat die Tür von außen wieder verschlossen. Hing der Schlüssel an einem Bund oder Etui?«
»Ja, an einem braunen Lederetui, zusammen mit den anderen Schlüsseln.«
»Welchen Schlüsseln?«, hakte Maria alarmiert nach.
»Die Wohnungsschlüssel … Oh mein Gott!« Alexander Molberg schlug sich die Hände vors Gesicht. »Bedeutet das etwa, dass der Mörder meines Vaters auch in sein Haus eingedrungen ist?« Entsetzt starrte er Maria aus weitaufgerissenen Augen an.
»Das werden wir feststellen. Wir fahren sofort dort hin. Wie ist die Adresse?«
»Goetheallee 59 A, in Blasewitz. Soll ich vielleicht mitkommen?«
»Natürlich«, antwortete Maria bestimmt, »Sie können uns bei der Klärung der Frage behilflich sein, ob etwas fehlt, falls sich tatsächlich jemand Zugang zu der Wohnung verschafft hat. Das würde Ihnen doch bestimmt auffallen, nicht wahr?«
Molberg nickte und schwankte für einen kurzen Moment. Halt suchend griff er die Lehne eines neben ihm stehenden Stuhls.
»Sie fahren mit den Kollegen.« Sie gab den betreffenden Beamten einen Wink und schickte auch die Spurensicherung zu der angegebenen Adresse.
Kapitel 2
Obwohl der starke Regen mittlerweile aufgehört hatte und es nur leicht nieselte, war der Himmel noch immer grau und verhangen. Wie ein schweres Tuch lag er über dem Elbtal. Als Maria über die Albertbrücke fuhr, schaute sie in den Rückspiegel, um sich zu vergewissern, dass ihre Kollegen hinter ihr waren, und seufzte. Eigentlich hatte sie vorgehabt, an diesem Freitag früh Feierabend zu machen, um den Einkaufsbummel zu unternehmen, den sie schon seit Langem vor sich her geschobenen hatte. Sie brauchte unbedingt neue Kleidung fürs Frühjahr und den Sommer. Den größten Teil ihrer Sachen hatte sie bereits aussortiert, in blaue Müllsäcke verpackt und in die Kleiderspende gegeben. Symbolisch hatte sie damit auch ihr altes Leben hinter sich gelassen – und mit diesem die schrecklichen Ereignisse des vergangenen Jahres, Nihats Tod, ihre eigene Schuld. Zumindest hatte sie es versucht.
Allerdings sah es im Moment gar nicht nach Frühjahr aus. Sie schaute von der Brücke aus nach rechts. Dunkel erhoben sich der hohe Turm der Hofkirche und links, ein Stück nach hinten versetzt, die helle Spitze der Frauenkirche. Die langgestreckte Fassade der Kunstakademie auf der Brühlschen Terrasse wirkte in dem trüben Licht seltsam starr und leblos. Sie verließ die Brücke, umfuhr das Karree, das auf das Käthe-Kollwitz-Ufer führte, und passierte wenig später die drei Elbschlösser, die sich auf dem gegenüberliegenden Ufer aneinanderreihten, stumme steinerne Zeugen einer vergangenen Epoche. Am Vogesenweg bog sie rechts ab und stieß wenig später auf die Goetheallee. Nach wenigen Metern tauchte links vor ihr das Standesamt mit seinen Türmchen, Erkern und Loggien auf. Die elektronische Stimme des Navigationssystems teilte ihr mit, dass sie ihr Ziel auf der rechten Seite erreicht hatte.
Sie warf durch die Frontscheibe einen Blick auf das Anwesen. Natürlich, wie konnte es anders sein? Als Alexander Molberg ihr die Adresse genannt hatte, war ihr sofort klar gewesen, dass sein Vater in einer stilvollen Villa residiert hatte. Neorenaissance, vermutete sie, war sich aber nicht sicher, als sie das große, herrschaftliche Haus eingehender betrachtete. Vor einigen Jahren hatte sie an einer Führung durch den Stadtteil Blasewitz teilgenommen. Neben Anekdoten über wohlhabende Persönlichkeiten aus der Vergangenheit waren auch die unterschiedlichen Baustile der Villen erläutert worden.
Aber ob nun Jugendstil oder Neorenaissance, sie mussten dort hinein. Sie warf einen Blick in den Rückspiegel. Die Kollegen rückten ebenfalls an und stellten ihre Fahrzeuge nacheinander hinter ihrem BMW ab.
Alexander Molberg stürmte an ihr vorbei, riss die Pforte zum Grundstück auf, hastete eine kleine Treppe hoch und öffnete die Haustür. Sie und die Kollegen folgten ihm bis in eine kleine Eingangshalle. Ein riesiger Messinglüster hing von der mit dunklem Holz vertäfelten Decke und erhellte den fensterlosen Raum. Molberg öffnete eine schwere Holztür und blieb im selben Moment wie angewurzelt stehen. Maria drängte sich neben ihn, um selbst zu sehen, was ihn so erschreckt hatte. Das Bild, das sich ihr bot, war verstörend. Schränke standen offen, Schubladen waren herausgerissen, Dokumente, Akten und aus Umschlägen herausgerissene Briefe lagen überall verstreut auf dem Boden. Eine Grünpflanze lag vor einer schlanken Blumensäule am Boden. Unter dem Wurzelballen häuften sich schwarze Erde und Scherben des zerbrochenen Topfes, daneben lag, umgekippt auf dem Rücken, ein zierlicher, mit dunkelgrünem Samt bezogener Sessel.
Ein Ruck ging durch Alexander Molberg. Entschlossen durchquerte er das heillose Chaos, sodass einzelne Blätter aufwirbelten. Er ging zur gegenüberliegenden Wand, die mit Kassetten verkleidet war. Marias Augen folgten ihm. Selbst von dort, wo sie stand, konnte sie sehen, dass sich eine der kastenförmigen Vertiefungen von den anderen unterschied. Ein kleines Türchen stand offen. Molberg öffnete es komplett, sodass dahinter ein Safe sichtbar wurde. Auch der war geöffnet. Gähnende, schwarze Leere tat sich vor ihnen auf.
Alexander Molberg wandte sich um, einen hilflosen, ungläubigen Ausdruck auf dem Gesicht.
»Alles weg«, presste er hervor.
»Was war in dem Safe?«, wollte Maria wissen und folgte ihm durch das Durcheinander.
Aber Molberg gab keine Antwort, sondern starrte nur abwechselnd zum Safe und zum Chaos auf dem Fußboden.
»Was war in dem Safe?«, fragte sie erneut.
»Schmuck meiner Mutter aus Familienbesitz, Expertisen und Geld«, gab er schließlich zögernd Auskunft. »Wie viel genau, weiß ich allerdings nicht.«
»Gut, das werden wir später im Protokoll aufnehmen. Hat Ihr Vater die Villa alleine bewohnt?«
»Ja, aber er hat nur die untere Wohnung benutzt. Die obere Wohnung hat er Gästen von außerhalb zur Verfügung gestellt. Ein Zimmer davon hat er genutzt, um Kleinmöbel, Bilder und allen möglichen Krimskrams unterzustellen.«
Maria gab ihren Kollegen ein Zeichen, mit der Arbeit zu beginnen und die übrigen Zimmer zu untersuchen.
»Ich muss Sie bitten, mich aufs Präsidium zu begleiten, wo wir Ihre Aussage zu Protokoll nehmen werden«, wandte sie sich wieder an den Sohn des Ermordeten.
»Ist es möglich, dass ich mich vorher selbst davon überzeugen kann, ob noch weitere Sachen gestohlen wurden?«
»Ja, selbstverständlich«, sagte Maria. »Ich komme mit.«
Zusammen verließen sie das Zimmer und gingen zurück in den Flur, von dem aus sie die übrigen Räume betraten. Aber wie sich herausstellte, hatte der mutmaßliche Mörder von Bernhard Molberg nur diesen einen Raum gezielt durchsucht.
Eine Stunde später saß Alexander Molberg in Marias Büro. Er sah noch immer blass aus und wirkte zutiefst niedergeschlagen. Der Tod seines Vaters hatte ihm augenscheinlich einen schweren Schlag versetzt. Nachdem sie die Formalitäten erledigt und Molberg ihr zugesichert hatte, den Bestand im Geschäft mit der Inventarliste zu vergleichen und eine Aufstellung über den Inhalt des Safes, soweit er davon Kenntnis hatte, anzufertigen, fragte Maria ihn:
»Sie haben angegeben, dass Sie im Geschäft Ihres Vaters mitarbeiten. Worin genau besteht Ihre Tätigkeit denn?«
»Ich akquiriere Kunstgegenstände, im Prinzip im gesamten Bundesgebiet. Das bedeutet, dass ich relativ oft unterwegs bin. Außerdem liefere ich auch Objekte an Käufer aus.«
Maria nickte.
»Ihr Vater war gestern Abend noch lange im Geschäft und hat ganz offensichtlich seinem Mörder die Tür geöffnet. Wissen Sie, ob er eine Verabredung mit jemandem hatte?«
Nachdenklich schüttelte Molberg den Kopf.
»War es üblich, dass Ihr Vater zu so später Stunde noch Kunden empfing?«
»Soviel ich weiß, kam das durchaus vor. Aber Genaues hat er mir nie erzählt. Jeder von uns hatte seinen eigenen Arbeitsbereich.«
»Was könnte es gewesen sein, das der Mörder unbedingt aus dem Safe an sich bringen wollte? Den Familienschmuck oder eine Expertise?«
»Ich weiß es nicht. Bringt man jemanden wegen einer Expertise um?«
»Wenn die Expertise, sagen wir mal, nicht echt ist, vielleicht? Oder einen viel höheren als den tatsächlichen Wert ausweist?«
»Was wollen Sie damit andeuten?« Molberg hatte seine Stimme erhoben. »Mein Vater ist … war ein absolut integrer Geschäftsmann und Kunstkenner mit einem einwandfreien Leumund. Denken Sie, dass sich jemand in diesem Bereich über fünfundzwanzig Jahre lang halten kann, wenn er Kunstgegenstände mit gefälschten Expertisen verkauft? Das ist ja geradezu lächerlich, was Sie da sagen!«
»Ich tue nur meine Arbeit, Herr Molberg«, entgegnete Maria ruhig.
Sein Blick traf sie wie ein eisiger Lufthauch.
»In dem Safe muss sich etwas befunden haben, das für den Mörder von größter Wichtigkeit war und das er unbedingt in seinen Besitz bringen wollte«, fuhr sie ungeachtet seiner Reaktion fort. »Ihr Vater wurde vor seinem Tod misshandelt und so wahrscheinlich zur Herausgabe des Schlüssels und der Nummernkombination für den Safe gezwungen.«
»Ich kann Ihnen nicht mehr sagen als das, was ich bereits genannt habe: Schmuck meiner Mutter, sie ist vor fünf Jahren gestorben, Expertisen und andere Dokumente. Und Bargeld, das er immer parat haben wollte. In dieser Branche ist Barzahlung üblich.«
»Wie viel war es normalerweise?«, hakte Maria nach.
»Unterschiedlich. Aber ich glaube, er hatte immer eine Summe von fünfzehn- bis zwanzigtausend Euro verfügbar.«
»Gut. Wissen Sie, ob Ihr Vater Feinde hatte?«
»Nicht, dass ich wüsste. Neider, ja. Aber Neid ist auch eine Form der Anerkennung für jemanden, der erfolgreich ist.«
»Wer wird das Geschäft übernehmen, jetzt, da Ihr Vater tot ist?«
»Ich nehme an, dass ich der Alleinerbe bin, sollte mein Vater sein Testament nicht geändert haben.« Undurchdringlich sah er sie an. »Und schlagen Sie sich den Gedanken aus dem Kopf, dass ich meinen eigenen Vater ermordet und zuvor gefoltert habe, um an die Kombination für den Safe zu kommen. Ich habe auch kein neu aufgesetztes Testament vernichtet, das mich benachteiligen würde. Wenden Sie sich an den Notar Dr. Hübscher, wenn Sie mir nicht glauben. Meines Wissens hat mein Vater seinen letzten Willen dort hinterlegt.«
Molberg stand auf. »Wenn Sie nichts dagegen haben, würde ich jetzt gerne gehen. Ich möchte ein wenig allein sein.«
»Ja, das war’s fürs Erste«, sagte Maria.
Bevor Molberg das Zimmer verließ, drehte er sich noch einmal um.
»Ich habe meinen Vater geliebt. Der Tod meiner Mutter hat uns noch enger zusammengeschweißt. Ich hoffe sehr, dass Sie das Schwein finden, das ihn auf dem Gewissen hat.« Dann ging er grußlos.
Maria warf den angeknabberten Bleistift, den sie die ganze Zeit in der Hand gehalten hatte, auf den Schreibtisch. Sie hatte den Eindruck gewonnen, dass Alexander Molberg nicht gelogen hatte. Wieder griff sie nach dem Bleistift und fing an, das Ende mit ihren Zähnen zu bearbeiten. Nachdenklich runzelte sie die Stirn, aber noch war es viel zu früh, um irgendwelche Vermutungen anzustellen. Ihr Blick blieb an dem leeren Schreibtisch ihr gegenüber hängen. Bis vor knapp einem Jahr hatte dort ihr Kollege, Hauptkommissar Gerd Wechter, gesessen. Jetzt konnte sie sich unmittelbar nach der Besichtigung eines Tatorts nicht mehr mit ihm austauschen. Das war für Gerd und sie eine Art Ritual gewesen und hatte hervorragend funktioniert. Sie hatten die Gedanken frei und ungehindert fließen lassen und Intuitionen und Gefühle verbalisiert, um sie greifbar zu machen, ihnen Form und Gestalt zu verleihen. Nie wieder würde er sie eindringlich mit seinen grauen Augen mustern, denn sie selbst hatte ihn erschossen, hier, in ihrem gemeinsamen Büro.
Zum tausendsten Mal blitzten die Bilder des Schusswechsels vor ihrem geistigen Auge auf. Sie hatte ihn mit eindeutigen Beweisen für einen von ihm begangenen, brutalen Mord konfrontiert und ihn damit in die Enge getrieben. Er hatte nichts mehr zu verlieren gehabt und seine ungesicherte Dienstwaffe auf sie gerichtet. Maria war es gewesen, die den ersten Schuss abgefeuert und ihn am Oberschenkel verletzt hatte. Er hatte sofort zurückgeschossen. Mit einem Hechtsprung zur Seite war sie der Kugel ausgewichen und hatte ihn noch im Fallen mit einem zweiten, tödlichen Schuss außer Gefecht gesetzt.
Noch immer hatte sie das Geschehene nicht verarbeitet und es hörte einfach nicht auf, sie nachts in ihren Träumen heimzusuchen. Sie quälte sich mit Selbstvorwürfen, denn sie hatte diese Situation heraufbeschworen. Zwar war ihr von Seiten der Staatsanwaltschaft nach der Untersuchung eine Notwehrsituation bestätigt worden, aber Kommissarin Maria Wagenried wusste, dass dies nur die halbe Wahrheit war.
Seitdem saß sie alleine hier in diesem Büro. Wie sie am Rande mitbekommen hatte, wurden mehrere Kandidaten für die Neubesetzung der Stelle gehandelt, aber die Mühlen in Behörden mahlten eben langsam, auch in Personalfragen. Hin und wieder hatte sie sogar mit dem Gedanken gespielt, sich versetzen zu lassen, ihn jedoch stets gleich wieder verworfen. Sie hing an Dresden, hatte schon immer hier gelebt, geliebt und gelitten und dabei Blessuren davongetragen, von denen manche so tief waren, dass sie gedacht hatte, dass sie sich nie mehr davon erholen würde. Hier hatte sie das Leben von seiner erbarmungslosen Seite kennengelernt. Aber auch von seiner schönsten.
Kapitel 3
Seufzend warf Maria den Bleistift zurück auf die Schreibtischunterlage und starrte auf das zerbissene Ding. Es war an der Zeit, sich auch von dieser lästigen Gewohnheit zu verabschieden. Schließlich war es ihr ja auch gelungen, mit dem Rauchen aufzuhören. Ihr Handy klingelte. Mit einem Blick auf das Display erkannte sie, dass es Desmond Petermann war. Das passte ihr im Moment überhaupt nicht. Die Beziehung zu dem Rechtsmediziner wurde ihr zu intensiv. Amouröse Verwicklungen waren das Letzte, was sie im Moment gebrauchen konnte. Und sie hatte Nihat noch nicht vergessen.
»Hallo Dess«, begrüßte sie ihn sachlich, »was gibt’s?«
»Ich habe von euch diesen Bernhard Molberg auf den Tisch bekommen. Ich bin dabei auf ein sehr interessantes Detail gestoßen, das euch möglicherweise am Tatort entgangen ist.«
»Die Garotte ist gar nicht das Mordwerkzeug?«
»Doch«, entgegnete Desmond, »davon ist auszugehen. Aber dem Opfer wurde an der unteren Nackenpartie ein Stück Haut herausgeschnitten.«
»Wie meinst du das? Direkt am Tatort oder eine frühere Operation?«
»Am Tatort. Die Wunde war frisch«, antwortete Desmond. »Hat die Spurensicherung dieses Hautstück gefunden?«
Verblüfft verneinte Maria und runzelte die Stirn, sodass sich die steilen Zornesfalten über ihrer Nasenwurzel noch vertieften.
»Ist der Schnitt tief?«, wollte sie wissen.
»Nein. Der Täter hat nur die Haut herausgeschnitten. Bei der Sektion wird sich herausstellen, ob er noch mehr entfernt hat.«
»Gut, Danke. Wir sehen uns dann am Montag.« Sie wollte das Gespräch so schnell wie möglich beenden, da sie befürchtete, Desmond könnte sie um eine Verabredung am Wochenende bitten. Doch stattdessen sagte er:
»Erinnert mich irgendwie an eine der letzten Frauenleichen, die hier auf meinem Tisch lag. Da hatte dieser Verrückte einen dornigen Rosenstil in der Vagina des Opfers hinterlassen. Diesmal hat der Täter etwas mitgenommen.«
»Ja, hübsche Abwechslung«, konterte Maria lapidar und dachte mit Schrecken an die beiden Frauen, denen der Kopf abgesägt worden war und die der Täter spektakulär für die Öffentlichkeit zur Schau gestellt hatte. Dieser Fall war nicht nur per se der reinste Horrortrip für alle Beteiligten gewesen, sondern hatte sich für Maria auch zu einer persönlichen Katastrophe entwickelt.
»Entschuldige, Maria, ich wollte nicht die alte Wunde aufreißen. Es tut mir wirklich leid. Nimmst du meine Entschuldigung in Form einer Einladung zum Essen an?«
Maria schwieg. Hatte er sie nur daran erinnert, um sich anschließend mit dieser Einladung entschuldigen zu können?
»Wollen wir heute Abend essen gehen? Das Canadian hat nach einer ›Kreativpause‹ eine neue Speisekarte aufgelegt. Klingt ziemlich verlockend, muss ich sagen.«
Sie zögerte. Einerseits war das Essen im Sterne-Restaurant Canadian wirklich vorzüglich, andererseits bedeutete das womöglich, dass der Abend eine Fortsetzung bei ihm oder ihr zu Hause finden würde. Auch wenn sie einige wenige Male mit Desmond geschlafen hatte, war sie absolut noch nicht bereit für eine neue Beziehung. Viel zu tief saßen der Schmerz und die Erschütterung über Nihats grausamen Foltertod.
»Maria?«
Sie gab sich einen Ruck.
»Schön, am Samstag, heute nicht mehr. Und anschließend möchte ich gleich nach Hause, und zwar allein«, machte sie ihm nachdrücklich klar.
»Natürlich, kein Problem. Wir gehen essen und unterhalten uns. Ich hole dich um kurz nach sieben von zu Hause ab. Ist dir das recht?«
Sie willigte ein und beendete das Gespräch.
Eine Menge Schreibkram war noch zu erledigen und sie konnte sich glücklich schätzen, wenn sie das, was sie sich vorgenommen hatte, bis zum Abend schaffte. Sie vertiefte sich in die vor ihr liegende, noch ziemlich dünne Akte »Bernhard Molberg«.
Die Zeit verging wie im Fluge. Ab und zu kam ein Kollege rein, um sie etwas zu fragen. Die Ergebnisse der Spurensicherung würden erst in der kommenden Woche eintrudeln. Als Nächstes musste das Umfeld des Antiquitätenhändlers durchleuchtet und die Frage beantwortet werden, ob sein Sohn Alexander, vermutlicher Alleinerbe, wirklich so unschuldig und trauernd war, wie er es vorgab. Aus beruflicher und eigener leidvoller Erfahrung wusste Maria, dass Eifersucht und Habgier, neben krankhafter Mordlust, die stärksten Motive für das Auslöschen eines Menschenlebens waren. Sie seufzte und griff erneut nach dem Bleistiftstummel. Hin und wieder spuckte sie gedankenverloren einen kleinen Spleiß auf den Boden.
Kapitel 4
Ihre Türglocke schellte. Maria hörte die von knisternden Geräuschen untermalte Stimme von Desmond Petermann in der Gegensprechanlage und betätigte den Türsummer. Dann öffnete sie die Tür einen Spaltbreit und eilte ins Badezimmer zurück, um noch ein paar Spritzer Parfum auf Hals und Haar zu verteilen und ihrem Spiegelbild einen allerletzten prüfenden Blick zuzuwerfen. Gut, nickte sie sich zu, passte alles. Dann hörte sie auch schon seine Schritte im Flur. Mit seiner eindrucksvollen körperlichen Präsenz – hochgewachsen, weit über einen Meter neunzig groß, mit einem Gesicht wie aus Granit gemeißelt – schien er den lächerlich kleinen Raum zu sprengen. Er beugte sich zu ihr hinab und hauchte ihr einen Kuss auf die Wange.
»Hm, du duftest gut«, sagte er lächelnd und hielt sie ein Stück von sich weg. »Neu?«
Sie nickte. »Nimmst du mich so mit?«, fragte Maria, machte sich sachte los und drehte sich einmal um die eigene Achse.
»Solange du nicht wieder eine Sondervorstellung im Canadian gibst, ist das so in Ordnung«, erwiderte er und seine stahlblauen Augen blitzten amüsiert auf.
»Dann schmierst du den Kellner wieder mit einem Mordstrinkgeld«, konterte sie schlagfertig und spielte damit auf einen gemeinsamen Restaurantbesuch an, bei dem sie zu viel getrunken und deshalb bald die Beherrschung verloren hatte. Doch gleichzeitig spürte sie den leichten Stich der Enttäuschung wegen des ausgebliebenen Kompliments. Sie war am späten Freitagnachmittag doch noch in die Stadt gefahren, hatte sich in einer italienischen Restaurantkette mit einer gigantischen Pizza und einem Glas Rotwein gestärkt und sich dann in das übliche Gewühl der Kaufwütigen gestürzt. Trotz ihrer Befürchtungen, lange suchen zu müssen, war sie relativ schnell fündig geworden. Das graue, eng geschnittene Kleid hatte ihr bereits auf dem Bügel außerordentlich gut gefallen. Dazu passend hatte sie sündhaft teure, schwarze Pumps mit hohen Absätzen erstanden, denen sie nicht hatte widerstehen können.
»Du siehst toll aus«, sagte Dess anerkennend.
Doch so richtig konnte Maria sich nicht mehr freuen. Sie nahm an, dass er ihr die Enttäuschung am Gesicht abgelesen und das Kompliment schnell nachgeschoben hatte, um sie bei Laune zu halten.
»Ich habe einen Tisch um halb acht reserviert. Bist du so weit?«
Sie nickte, griff nach ihrer Handtasche, stopfte das Handy und das kleine Schminktäschchen hinein und zog sich einen kurzen Sommermantel über.
Das Edelrestaurant lag auf der anderen Elbseite, im Stadtteil Weißer Hirsch. Sie kamen gut durch, denn der Verkehr war am Samstagabend deutlich schwächer als in der Woche. Fünf Minuten vor der Zeit waren sie da.
Das Canadian war trotz der relativ frühen Stunde voll besetzt. Sie waren offenbar nicht die Einzigen, die die neue Speisekarte gereizt hatte und die ihren Gaumen mit kulinarischen Köstlichkeiten verwöhnen lassen wollten.
Während sie an ihren Tisch gebracht wurden, ließ Maria ihre Blicke schweifen. Das gleiche Publikum wie üblich, gut angezogen, die Damen zurechtgemacht und die Herren frisch rasiert, saß an weiß gedeckten Tischen und unterhielt sich in gedämpfter Lautstärke. Innerlich schmunzelnd dachte sie an ihren ersten gemeinsamen Besuch des Restaurants. Alkoholisiert und unpassend gekleidet hatte sie vor Vergnügen die Hände krachend auf den Tisch geschlagen, als Dess ihr die kuriosen Vornamen seiner Geschwister offenbart hatte. Das auf Hochglanz polierte Besteck war klirrend über den Tisch gehüpft und die langstieligen Gläser hatten bedrohlich geschwankt. An diesem legendären Abend war ihr Lachen wie eine Bombe in diese distinguierte Atmosphäre eingeschlagen. Empört hatte man sie angesehen und unmissverständlich die Köpfe geschüttelt. Doch das wahrscheinlich Allerschlimmste war gewesen, dass sie sich die Missbilligung des Oberkellners zugezogen und es sich vermutlich bis in alle Ewigkeit mit ihm verdorben hatte. Nur dem Umstand, die Begleiterin von Dr. Desmond Petermann zu sein, hatte sie es zu verdanken gehabt, nicht umgehend hinauskomplimentiert worden zu sein. Im Nachhinein schämte Maria sich für ihr Auftreten, aber mein Gott, sie war eben auch nur ein Mensch. Sie hatte sich nicht unter Kontrolle gehabt, der angestaute berufliche und private Druck hatte sich mit einem Mal entladen.
Als sie sich an ihren Tisch gesetzt hatten, nahm Dess ihre Hände und lächelte sie an.
»Ich freue mich auf diesen Abend, Maria. Und ich bin sehr gespannt auf das Essen.«
Bevor Maria etwas erwidern konnte, erschien die Bedienung mit einem kleinen Tablett, auf dem sie zwei Champagnergläser balancierte.
»Guten Abend, Herr Dr. Petermann«, flötete sie und stellte die Gläser auf den Tisch, »schön, Sie wieder hier begrüßen zu dürfen.« Und mit einem kühleren Blick auf Maria: »Guten Abend.«
Sie setzte die Gläser ab. »Ich bringe Ihnen sofort die Speisekarte. Herr Wiegand wird Sie dann beraten«, zwitscherte sie und verschwand wieder.
»Mein spezieller Freund kommt gleich«, grinste Maria, rollte mit den Augen und erhob ihr Glas. »Zum Wohl, Dess, und danke für die Einladung.« Sie tranken jeder einen Schluck. »Mhm, herrlich.« Sie stellte das Glas auf den Tisch zurück. »Mach dir keine Sorgen, ich werde ganz brav sein.«
»Ich mache mir keine Sorgen, Maria. Schöne Frauen dürfen sich fast alles erlauben. Außerdem«, er klopfte auf die Brusttasche seines Jacketts und beugte sich verschwörerisch zu ihr, »habe ich genug Geld dabei, um ihnen das Maul zu stopfen.«
»Droh ihnen doch einfach mit einer Vivisektion, ist bestimmt auch sehr wirkungsvoll.«
Desmond Petermann warf den Kopf in den Nacken und lachte wiehernd wie ein Pferd. Wie immer betrachtete Maria verwundert dieses Schauspiel.
Die Speisekarten wurden gereicht. Sogleich vertiefte sich Dess darin, machte »Ah«, »Oh« und »Mhm«. Maria hatte keine Lust, sich etwas auszusuchen. Sie überließ ihm gern die Entscheidung. Bei ihren bisher zwei gemeinsamen Besuchen im Canadian hatte er mit seiner Auswahl stets richtig gelegen. Stattdessen sah sie sich ein wenig um und beobachtete die Gäste. Am Nebentisch saß ein älterer Herr mit Halbglatze und Vollbart. Unter dem dunkelblauen, geöffneten Jackett wölbte sich der Bauch, der ihm schlaff über die Hose hing. Er hatte seine Bestellung offenbar schon aufgegeben, denn auch er ließ seinen Blick durch den Raum wandern. Für einen kurzen Augenblick schauten sie sich an, dann hob er sein Glas und leerte es in einem Zug. Maria sah, dass er eine Flasche Weißwein geordert hatte, die in einem Kühler neben seinem Tisch stand. Entweder erwarte er noch eine weitere Person oder er war ein solider Trinker, mutmaßte sie. Schräg gegenüber saß ein Pärchen, er dunkelhaarig und im Anzug, sie blond und stark geschminkt. Unablässig klapperte sie mit den viel zu blauen Lidern und lauschte scheinbar aufmerksam seinen Ausführungen. Auch das Rouge auf ihren Wangen leuchtete unnatürlich rot.
Herr Wiegand, der Oberkellner, kam angerauscht und servierte dem einsamen Gast direkt neben ihnen die Vorspeise. Er war also tatsächlich alleine hier, folgerte Maria, als der Mann nach seinem Besteck griff.
Desmond legte die Speisekarte zur Seite, was den Oberkellner dazu veranlasste, an ihren Tisch zu treten, um ihre Bestellung entgegenzunehmen. Würdevoll hob er an, als sein Gesicht zu einer Maske gefror. Mit weit aufgerissenen Augen starrte er in den über Maria und Desmond hängenden Spiegel. Maria wollte gerade seinem Blick folgen, um zu sehen, was ihn so aus der Fassung gebracht hatte, als nacheinander mehrere Schüsse gellten. Sie riss den Kopf herum. Ein maskierter, komplett schwarz gekleideter Mann stand mit erhobener Waffe vor dem Tisch des einzelnen Gastes. Den Bruchteil einer Sekunde später brach ein Tumult los. Einige der Gäste schrien durcheinander oder sprangen von ihren Stühlen auf, sodass diese laut zu Boden polterten, manche versteckten sich schutzsuchend unter ihrem Tisch, andere rannten in Panik dem Ausgang entgegen. Der Maskierte hob die Waffe hoch in die Luft und feuerte einen Warnschuss ab. Erneute Schreie, Deckenputz rieselte von oben herab und die Flüchtenden erstarrten in ihrer Bewegung. Dann drehte sich der Schütze auf dem Absatz um und rannte davon. Maria sprang auf, stieß den Oberkellner zur Seite und folgte dem Mann, der mittlerweile das Lokal verlassen hatte. Sie riss die Eingangstür auf, sah erst nach rechts, dann nach links. Nichts, der Täter war wie vom Erdboden verschluckt. Sie ging ins Restaurant zurück.
»Polizei!«, rief sie laut. »Begeben Sie sich bitte wieder auf Ihre Plätze! Niemand verlässt das Restaurant.« Der völlig verschreckten und hemmungslos weinenden Angestellten hinter der Bar gab sie die Anweisung, die Eingangstür zu verschließen.
Danach eilte sie zurück. Dess hatte sich über den Angeschossenen gebeugt und fühlte den Puls, während Herr Wiegand sich auf ihren Stuhl gesetzt hatte und fassungslos die Szene beobachtete.
Als Maria näher herantrat, bemerkte sie, dass der Gast mit dem Gesicht auf seinem Vorspeisenteller lag. Eine Hummerschere lugte unter seiner Wange hervor. Das Blut des Hingerichteten tropfte langsam auf die weiße Tischdecke. Sie trat neben ihn und hob vorsichtig seinen Kopf ein Stück nach oben. Auf seiner Stirn prangte ein Einschussloch. Ihr Blick glitt tiefer. Weitere Kugeln hatten sein weißes Hemd zerfetzt und blutige Krater hinterlassen. Dess sah auf und schüttelte den Kopf. Dieser Mann war mausetot, genauso wie der Hummer auf seinem Teller. Sie griff in die Innentasche seines Jacketts, in der sie eine Brieftasche vermutete, und wurde tatsächlich fündig.
Maria rief ihre Kollegen, die kurze Zeit später anrückten. Der Polizeifotograf schoss Fotos vom Tatort, der mit einem Band abgesperrt worden war. Alle Gäste wurden in einen kleinen Raum nebenan gescheucht. Dort wurden zwei Tische freigeräumt, an denen Beamte die Personalien der Gäste aufnahmen und sie zum Tathergang befragten. Fast alle Augenzeugen standen noch unter Schock, gaben aber bereitwillig Auskunft. Nur der dunkelhaarige Mann, der in Begleitung der überschminkten Blondine gekommen war, weigerte sich mit Verweis auf seine Privatsphäre lautstark und vehement, Angaben zu seiner Person zu machen. Maria, die den Vorfall mitbekommen hatte, vermutete eine Ehefrau im Hintergrund. Sie versicherte ihm, dass niemand, bei diesem Wort zog sie bedeutungsvoll die Augenbrauen hoch, über seinen Restaurantbesuch informiert werden würde. Sollte er sich nicht kooperativ verhalten, würde sie ihn allerdings bei sich zu Hause vernehmen. Der Mann lief puterrot an, als er den Wink verstand, und gab schließlich Name und Adresse zu Protokoll.
Zwischenzeitlich wurde der Tote abtransportiert und in die Rechtsmedizin gebracht. Die Männer von der Spurensicherung markierten kleine und größere Gegenstände, verteilten Nummernaufsteller und fotografierten alles.
Der kreidebleiche Restaurantchef, der mittlerweile aufgetaucht war, rang sichtlich um Fassung und rieb sich unablässig das Kinn. Zusammen mit Dess und ihm hatte Maria sich ein wenig abseits vom Tatort an einen kleinen Tisch gesetzt.
»Kannten Sie das Opfer, Herr Stegmann?«, fragte sie und sah Oberkellner Wiegand an ihnen vorbeischleichen, der ihr einen undefinierbaren Blick zuwarf. Wahrscheinlich war ihm gerade klar geworden, dass nun sie, die Polizistin, ihm die Autorität streitig gemacht und das Kommando über sein Reich übernommen hatte.
Der Befragte schüttelte den Kopf, was Maria aber nicht weiter erstaunte, denn der Ermordete, er hieß Guido Brunner, war Schweizer, wie sie in seinen Papieren festgestellt hatte.
»Könnten Sie bitte anhand der Kreditkartenzahlungen abklären, ob Herr Brunner schon einmal Gast in Ihrem Haus war?«
»Selbstverständlich, das ist kein Problem. Von welchem Zeitraum sprechen Sie?«
»Ich würde sagen, die letzten drei Jahre.«
»Das wird natürlich ein bisschen dauern. Aber ich gebe Ihnen so schnell wie möglich Bescheid, sollte die Buchhaltung einen entsprechenden Hinweis finden.«
»Vielen Dank, Herr Stegmann, Das wäre es fürs Erste.« Maria erhob sich.
»Ich …, was soll ich denn jetzt mit den Gästen machen? Ich meine, wie lange sind Ihre Leute denn noch da?«
»Das Ganze wird noch ein bisschen dauern. Für heute müssen Sie Ihren Betrieb wohl schließen.«
Zweifelnd sah der Restaurantbesitzer Maria an.
»Ich glaube, das Beste wird sein, wenn ich alle Gäste für später zu einem kostenlosen Essen einlade«, sagte er mehr zu sich selbst als zu ihnen und ging in den Raum nebenan, um diese Botschaft zu verkünden. Wenige Minuten später hörten sie zustimmendes Gemurmel.
Maria und Dess verließen das Canadian.
»Und nun?«, fragte er, als sie wieder in seinem BMW saßen. »Musst du ins Präsidium?«
»Tja, das muss ich wohl. Ich kann mir ein Taxi nehmen.«
»Rede keinen Unsinn. Ich bringe dich selbstverständlich hin. Wie lange wird es dauern?«
»Mindestens zwei Stunden, schätze ich. Wenn die Maschinerie sich erst mal in Gang setzt, kann es sich hinziehen.«
»Ruf mich an, wenn ich dich abholen soll. In der Zwischenzeit bereite ich bei mir was zu essen vor.«
»Ich weiß nicht, ob das wirklich eine so gute Idee ist, Dess. Ich muss doch morgen wieder früh raus. Das Wochenende ist gestrichen.«
»Wir essen zusammen und dann legst du dich gleich ins Bett. Und morgen früh kriegst du ein erstklassiges Frühstück von mir serviert. Na, was sagst du?«
Sie seufzte. »Also gut, einverstanden. Ich bin käuflich, wie du weißt. Für ein gutes Essen tue ich fast alles. Halte aber bitte vorher noch am Albertplatz, ich brauche jetzt auch schon einen Snack. Wer weiß, wie lange es dauert.«
Und tatsächlich vergingen drei Stunden, bis Desmond Petermann Maria abholen konnte. Erschöpft warf sie sich auf den Beifahrersitz und schlief schon während der Fahrt ein. Zwanzig Minuten später erreichten sie in Radebeul die würfelförmige Villa im Bauhausstil, die sich deutlich von der überwiegend historischen Architektur des Viertels abhob. Sie fuhren in die Tiefgarage und betraten über eine Treppe die große, helle Diele, die direkt in ein riesiges Wohnzimmer mit bodentiefen Fenstern führte. Desmond schaltete die Außenbeleuchtung ein. Zu dieser Jahreszeit war der Blick auf den Garten noch nicht ganz so spektakulär wie im Sommer, wenn alle Rosensorten in verschwenderischer Pracht und Farbvielfalt blühten. Maria erinnerte sich noch sehr genau an den Spätsommerabend, an dem sie auf der Terrasse gesessen und mit ihrem ekelhaften Zigarettenqualm die süße, von Rosenduft geschwängerte Luft verpestet hatte. Aber auch dieses Laster gehörte zu ihrem alten Leben, das sie mit so viel Mühe und Not hinter sich zu lassen versuchte. Schnell wischte sie die Gedanken daran beiseite, zog sich die neuen Schuhe aus, die noch ziemlich drückten, und ließ sich aufs Sofa plumpsen. Gerne hätte sie die Beine unter sich hochgezogen, aber das ging wegen des engen Kleides nicht.
»Sag mal, hast du was Bequemes zum Anziehen für mich?«
»Moment, ich mache gerade den Cremant auf«, rief er aus der Küche. Maria hörte das Ploppen des Korkens. Dann kam er aus der Küche und drückte ihr ein Glas in die Hand.
»Ich habe einen Jogginganzug, der wird aber viel zu groß für dich sein. Komm mit, du kannst dich gleich im Bad oben umziehen.«
Sie folgte ihm in sein Schlafzimmer, wo er fluchend auf dem Boden des Kleiderschranks herumzuwühlen begann.
»Ha, wer sagt’s denn«, rief er triumphierend, stand auf und hielt ihr ein dunkelblaues Stoffpaket entgegen. Mit einem misstrauischen Blick griff sie danach und ging ins Bad. »Passt er?«, rief Dess kurz darauf von draußen.
»Perfekt«, gab sie zur Antwort und öffnete die Tür. »Voilà, die neueste Création aus dem Hause Chanel«, sprach Maria mit affektiertem französischen Akzent. »Besticht durch ihre ungewöhnliche Farbe und den großzügigen Schnitt, welcher der Trägerin viel Bewegungsfreiheit lässt.«
Sie lachten beide laut auf.
»Eigentlich müsste ich ein Foto machen«, überlegte Dess, als sie wieder im Wohnzimmer waren und streckte die Hand nach seinem Handy aus, das er auf den Tisch gelegt hatte.