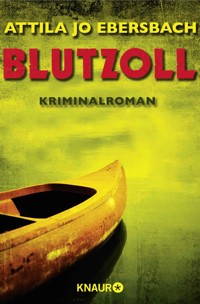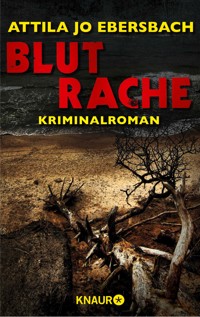
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Romeo und Julia am Edersee. Jule und Patrick sind ein glückliches Liebespaar. Alles könnte perfekt sein, wären ihre Väter nicht bis aufs Blut verfeindet. Nach einem Junggesellenabschied geraten die beiden Väter in Streit. Eine Woche später findet der Ex-Hauptkommissar Arne Guldberg bei einem Segeltörn die Leiche von Lengemann senior im See. Da alle Umstände eindeutig auf einen tragischen Unfall hindeuten, will Franca, Guldbergs Tochter und ebenfalls Kommissarin, den Fall zu den Akten legen. Doch gegen den Widerstand seiner Tochter recherchiert der frühere Ermittler weiter und deckt dabei ein dunkles Geheimnis auf, das die beiden Familien seit Jahrzehnten verbindet... Begeisterte Leserstimmen: »Krimikost vom Feinsten« »Je mehr ich las, um so tiefer wurde ich hineingezogen...« »Dem Autor gelingt es immer wieder die Spannung hoch zu halten.« Nach »Blutzoll« ist »Blutrache« der zweite Fall des Hauptkommissars a.D. Arne Guldberg.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 391
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Attila Jo Ebersbach
Blutrache
Kriminalroman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Romeo und Julia am Edersee.
Jule und Patrick sind ein glückliches Liebespaar. Alles könnte perfekt sein, wären ihre Väter nicht bis aufs Blut verfeindet. Nach einem Junggesellenabschied gerät diese Feindschaft außer Kontrolle. Eine Woche später findet der Ex-Hauptkommissar Arne Guldberg bei einem Segeltörn die Leiche von Lengemann senior im See. Da alle Umstände eindeutig auf einen tragischen Unfall hindeuten, will Franca, Guldbergs Tochter und ebenfalls Kommissarin, den Fall zu den Akten legen. Doch gegen den Widerstand seiner Tochter recherchiert der frühere Ermittler weiter und deckt dabei ein dunkles Geheimnis auf, das die beiden Familien seit Jahrzehnten verbindet …
Nach »Blutzoll« ist »Blutrache« der zweite Fall des Hauptkommissars a. D. Arne Guldberg.
Inhaltsübersicht
Vorwort
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Epilog
Die Handlung dieses Buches beruht auf wahren Begebenheiten, die sich in den vergangenen fünfundsiebzig Jahren im Edertal zugetragen haben und zum Teil in den entsprechenden Ausgaben der örtlichen Presse nachzulesen sind. Mithilfe künstlerischer Freiheit wurden sie zu dem vorliegenden Roman verarbeitet.
Die Namen der Orte wurden nicht geändert; die der handelnden Personen nur dort, wo es zur Wahrung von Persönlichkeitsrechten nötig erschien.
Prolog
Der mit braunem Schlamm bespritzte Lastkraftwagen ratterte über die holprige Dorfstraße. Auf der Ladefläche saßen mit Knüppeln bewaffnete Männer in einfacher Arbeitskleidung entlang der Seitenwände und hielten sich am Gestänge des Aufbaus fest. Ein paar von ihnen umklammerten auch Gewehre. Ihre harten Gesichter ließen erahnen, dass sie zu allem entschlossen waren. Sie starrten in die Nacht, und es sah so aus, als könnten sie es kaum erwarten, ihr zerstörerisches Werk zu beginnen.
Die nach hinten offene Plane flatterte im Fahrtwind.
Längst schon war die Sonne untergegangen, und ein leichenblasser Mond stand am Himmel, als der LKWkw abrupt vor dem breiten Holztor zu einem stattlichen Gutshof am Rand des Dorfes zum Stehen kam. Die Beifahrertür knallte gegen das Blech des Aufbaus, und ein Mann in Breeches und blank polierten schwarzen Reitstiefeln sprang aus dem Fahrerhaus, lief im Stechschritt um den Wagen herum und öffnete mit ein paar raschen Handgriffen die hintere Ladeklappe.
»Los, Männer! Zack, zack! Runter mit euch!«, brüllte er, während er die Klappe fallen ließ. »Aber ’n bisschen dalli jetzt. Und dass mir keiner von euch auf die Idee kommt, Feuer zu legen. Das könnt ihr nachher in Korbach noch zur Genüge. Hier sollt ihr bloß die Fenster einschlagen und ’n bisschen Remmidemmi machen, verstanden?«
Ein kollektives »Jawoll, Herr Hauptscharführer!« erschallte, als das gute Dutzend Männer vom Wagen sprang, mit roher Gewalt die beiden Torflügel aufsprengte und sich über das Anwesen ergoss. Im Handumdrehen zerschlugen sie unter lautem Gejohle und Gelächter sämtliche erreichbaren Fenster der an den Innenhof grenzenden Gebäude.
Der Spuk dauerte keine zwei Minuten, während derer der mit Hauptscharführer angesprochene Mann breitbeinig dastand und die Linke in die Seite gestemmt dem Treiben seiner Untergebenen zusah. Mit einer Reitgerte in der behandschuhten Rechten klopfte er rhythmisch gegen den Schaft seines Stiefels.
Von den Bewohnern des Hofes ließ sich keiner blicken.
Dann, als die Männer, nachdem sie sich ausgetobt hatten, wieder auf den LKWkw geklettert waren und er die Lade geschlossen hatte, bestieg auch der Hauptscharführer zufrieden grinsend das Fahrerhaus, knallte die Tür zu und brüllte seinem Fahrer ein »Los, Mann! Abmarsch!« zu.
Zwei Mann allerdings hatte er zur Bewachung des Guts am Eingang des Haupthauses zurückgelassen. Er wollte ja nicht, dass die Vögel ausgeflogen waren, wenn er nach getaner Arbeit zurückkam.
Das Ziel der Männer, die eigentlich der SS angehörten, aber in dieser Nacht in Zivil auftraten, um wie einfache Bürger auszusehen, waren die Synagoge in Korbach sowie die daneben gelegene Judenschule.
Über das, was in jener Nacht geschah, berichtete die Waldeckische Landeszeitung drei Tage später in ihrer Wochenendausgabe mit folgenden Worten:
»Korbach, 12. Nov. 1938
Die Antwort auf das Pariser Attentat.
Wie überall in Großdeutschland, so löste auch in Korbach die Nachricht von dem furchtbaren Attentat in Paris die größte Empörung und Erbitterung aus. Während man zunächst von Maßnahmen gegen die Juden abgesehen hatte, kam es in den späten Abendstunden des Mittwochs auf die Nachricht vom Tode des Gesandschaftsrats vom Rath zu spontanen Kundgebungen gegen das Judentum. Im Laufe des Abends und der Nacht wurde die Synagoge vollkommen demoliert. Auch die wenigen noch im Besitz von Juden befindlichen Häuser unserer Stadt waren Schauplatz von Demonstrationen. Vor allem wurden fast in allen derartigen Gebäuden die Fensterscheiben eingeschlagen. Um größere Demonstrationen und Zwischenfälle zu unterbinden, wurde noch im Laufe der Nacht eine Anzahl Korbacher Juden in Schutzhaft genommen. Nachdem es gegen 4 Uhr morgens auf den Straßen ruhig geworden war, standen plötzlich gegen 6 Uhr am Donnerstagvormittag Synagoge und Judenschule in hellen Flammen. Während die Schule bis auf die Grundmauern zerstört wurde, brannte die Synagoge aus. Diese Kundgebungen werden endlich dem internationalen Judentum und seinen Helfershelfern gezeigt haben, dass das deutsche Volk nicht gewillt ist, die deutschen Volksgenossen, die draußen auf vorderstem Posten im Ausland stehen, von feiger Judenmeute morden zu lassen. Der mordgierige Judenlümmel Grünspan hat jedenfalls seinen Rassegenossen den denkbar schlechtesten Dienst geleistet.«
Auf dem Rückweg in den späten Morgenstunden las der Hauptscharführer nicht nur die beiden Männer wieder auf, die er als Wache bei dem verwüsteten Gut zurückgelassen hatte, sondern gab den vor Angst zitternden Bewohnern des Haupthauses, einer Familie mit zwei kleinen Kindern, einem vierjährigen Jungen und einem dreijährigen Mädchen, ganze zehn Minuten Zeit, das Notwendigste in einen Koffer zu packen. Er müsse sie in Schutzhaft nehmen, sagte er ihnen. Von seinen Männern ließ er sie auf die Ladefläche des Lastwagens verfrachten und so platzieren, dass ihnen die Flucht unmöglich war.
Keine drei Stunden später lieferte er die vier verängstigten Personen in Wrexen, der Sammelstelle für Juden aus dem Waldecker Raum, ab. Ob sie von dort nach Buchenwald oder Theresienstadt weitertransportiert wurden, war ihm im Grunde egal.
Für ihn zählte nur, dass er seinem Ziel ein entscheidendes Stück nähergekommen war.
Kapitel 1
Die hauchdünne Sichel des zunehmenden Mondes klebte am nächtlich schwarzen Himmel wie das schiefe Grinsen eines Teufels, der wusste, dass noch in dieser Nacht das Unheil seinen Lauf nahm, und der sich diebisch darauf freute. Wolkenfetzen jagten über das Firmament und erzeugten helle und dunkle Schatten im Wechsel. Auf der vom Wind leicht gekräuselten Oberfläche des Edersees spiegelte das fahle Licht der Nacht die Szenerie in verzerrten Bildern wider. Hier und da hingen ein paar verstreute Nebelfetzen wie vergessene Feenschleier über dem Wasser.
Die kühle Nachtluft ließ den Mann, der sich einem Betrunkenen an die Fersen geheftet hatte, leicht frösteln. Der andere, der gerade als einer der Letzten einen Junggesellenabschied im Vereinsheim des Segel-Clubs Scheid verlassen hatte, war sternhagelvoll. Er torkelte in Schlangenlinien auf den Bootshafen am Westufer von Scheid zu und gestikulierte wild mit einer Sektflasche in der Luft herum, die er sich als Wegzehrung mitgenommen hatte. Er sabberte und brabbelte Unverständliches vor sich hin.
Der Verfolger selbst hatte das Klubhaus fünf Minuten vor dem Betrunkenen verlassen, nachdem er mitbekommen hatte, dass der sich auf den Heimweg machen wollte. Er hatte an diesem Abend wie üblich nur wenig getrunken. Sich volllaufen zu lassen, war nicht sein Ding.
Nervös war er von einem Bein aufs andere getreten und hatte ihm im Schutz eines gegenüberliegenden Hauses aufgelauert, bis er den anderen aus dem Vereinsheim wanken sah. Sofort hatte er sich in den Schatten geduckt und gewartet, bis der Betrunkene weit genug weg war, dass er ihm ungesehen nachschleichen konnte.
Er besaß zwar nur eine Jolle und nicht solch ein protziges Schiff wie der andere und konnte sich solch einen teuren Segelklub wie den SCS eigentlich auch gar nicht leisten. Aber er war ihm dennoch beigetreten, weil er darauf spekuliert hatte, so irgendwann einmal eine Gelegenheit zu finden, seinem Widersacher eins auswischen zu können.
Außerdem hatte seine Frau – des gesellschaftlichen Ansehens wegen – darauf bestanden. Man wollte schließlich »dazugehören«.
»Ja!«, dachte er und ballte die Fäuste, während er dem Betrunkenen zuschaute, wie der mit unsicheren Bewegungen einen schaukelnden Kahn bestieg und sich damit abmühte, die Leinen zu lösen und das Boot vom Steg abzustoßen. »Das ist die Gelegenheit, auf die ich so lange gewartet habe. Heute, mein Freund« – er spuckte das Wort vor Abscheu geradezu verächtlich aus –, »bekommst du, was du verdienst!«
Wacklig auf den Beinen, in der linken Hand die Sektflasche und darauf bedacht, nichts von dem kostbaren Inhalt zu verschütten, versuchte der Betrunkene, sich auf die Sitzbank niederzulassen. Doch der Kahn schwankte bedenklich von einer Seite auf die andere, und er musste höllisch aufpassen, nicht über Bord zu fallen. Ganz langsam schob er daher seine Beine auseinander, immer weiter, Zentimeter um Zentimeter, bis er schließlich breitbeinig dastand wie John Wayne vor einem Revolverduell. Oder Ronaldo beim Freistoß. Dann holte er tief Luft, hielt sie eine Sekunde lang an – und ließ sich mit einem beherzten Plumps auf die Sitzbank fallen. Zufrieden ballte er die rechte Faust. Schließlich öffnete er sie wieder und griff nach dem Ruder. Doch sein Griff ging haarscharf daneben. Erneut langte er danach, so, als wolle er mit der Hand einen Vogel fangen. Diesmal hatte er Erfolg.
Vornübergebeugt tat er nun zwei, drei Schläge, und als der Kahn sich zu drehen begann, ließ er das Ruder fahren, nahm einen tiefen Schluck aus der Flasche, wechselte sie in die andere Hand und ergriff mit der nun freien Hand das andere Ruder.
Aufmerksam beobachtete der Mann, wie der Betrunkene auf diese Art und Weise langsam und in Schlangenlinien auf die Mitte des Sees zuruderte, immer wieder die Flasche an den Mund setzte, bis diese schließlich leer war. Denn auf einmal hob er sie hoch, hielt sie wie ein Fernrohr ans Auge und stierte hinein. Ungläubig schüttelte er den Kopf, zuckte bedauernd mit den Schultern und warf sie mit einer unwilligen Geste über seine Schulter. Doch er warf sie nicht weit genug, denn mit einem lauten Knall landete sie im Heck des Bootes. Erschrocken fuhr der Mann zusammen. Dann drehte er sich schwerfällig um und redete mit drohend erhobenem Zeigefinger auf die Flasche ein.
Schließlich setzte er seinen Weg fort.
Als er etwa ein Drittel der Strecke zum jenseitigen Ufer zurückgelegt hatte, bestieg auch der Beobachter einen Kahn und legte sich in die Riemen. Mit ruhigen Bewegungen und darauf bedacht, kein verdächtiges Geräusch zu verursachen, folgte er dem anderen. Und da er mit beiden Armen ruderte und zudem so gut wie nüchtern war, holte er rasch auf.
Als er nur noch etwa zehn Meter vom Kahn des Betrunkenen entfernt war, legte er einen Zahn zu. Kurz bevor der andere die Liebesinsel passierte, holte er ihn ein und rammte mit einer raschen Wende den Kahn des nichts ahnenden Mannes mit voller Wucht in die Seite. Erschrocken ließ der das Ruder fahren, sprang ungeschickt auf und versuchte, torkelnd und hilflos mit den Armen rudernd, irgendwo Halt zu finden.
Darauf hatte der andere nur gewartet. Behände sprang auch er auf, riss ein Ruder aus der Halterung und knallte dem Betrunkenen das Ruderblatt so stark auf das Schulterblatt, dass dieser kopfüber aus dem Kahn stürzte.
Einen Angstschrei ausstoßend, ging er unter. Kam wieder hoch und schlug mit den Armen wild um sich, prustete, schluckte Wasser, als er zu schreien versuchte, und ging gurgelnd erneut unter. Mit wilden Schlägen kam er wieder hoch, doch sein Kopf ragte schon nur noch bis zum Kinn aus dem Wasser, und er schluckte erneut eine Menge davon.
Noch ein letztes Mal tauchte er auf und versuchte sich mit aller Macht über Wasser zu halten. Aber da sich seine Kleidung inzwischen so mit Wasser vollgesogen hatte, dass ihn das Gewicht nach unten zog und er nicht mehr in der Lage war, dagegen anzukämpfen, war es nur eine Frage von wenigen Sekunden, bis er mit einem letzten gurgelnden Laut unterging.
Als sein Kopf verschwunden war, sah man in der heraufziehenden Dämmerung nur noch ein paar Blasen aufsteigen.
Das Schlauchboot, das auf der gegenüberliegenden Seite der Liebesinsel aufs Ufer gezogen dalag und dem Mörder verraten hätte, dass sein Tun nicht unbeobachtet geblieben war, fiel ihm nicht auf.
Und auch die zwei Augenpaare, die das Ganze von erhöhtem Standpunkt aus beobachteten, sah er nicht, als er wendete und, als sei nichts geschehen, mit zügigen Schlägen zurück nach Scheid ruderte.
Die beiden Augenpaare gehörten zwei Teenagern, die die ganze Zeit über wie versteinert in ihrem Schlafsack hinter einem Gebüsch verharrt und aus Angst, dass der Mörder sie entdecken und ebenfalls umbringen würde, auf ihre Fäuste gebissen und kaum zu atmen gewagt hatten.
Wie schon des Öfteren in lauen Nächten hatten sie sich mit dem Schlauchboot des Jungen und ohne Wissen ihrer Eltern davongeschlichen, um die Nacht auf der Liebesinsel zu verbringen, die solcherart Ausflüge ihren Namen verdankte. Sie hatte wie üblich vorgetäuscht, bei einer Freundin in Altwildungen zu schlafen; er legte schon lange keine Rechenschaft mehr ab, wenn er nachts dem heimischen Bett fernblieb.
Doch nun konnte das Mädchen nicht länger an sich halten, und die mühsam zurückgehaltene Anspannung platzte mit einem Mal aus ihr heraus. »Hast du …? Hast du das … hast du das auch geseh’n? Verdammt! Oh verdammt! Verdammt-verdammt-verdammt, was machen wir denn jetzt? Was machen wir jetzt bloß?«, hyperventilierte die Kleine mit Panik in der Stimme, nachdem der Mörder sein Boot wieder im Westhafen von Scheid festgemacht hatte und im Gewirr der Masten untergetaucht war. Geschockt von dem, was sie vor wenigen Minuten hatte mit ansehen müssen, krallte sie ihre Fingernägel in die nackten Schultern ihres Freundes und schrie ihn an: »Los, sag mir, was sollen wir jetzt machen?«
Der Junge zuckte zusammen. »Schrei nicht so!«, fuhr er sie an. »Der kommt sonst zurück, wenn er dich hört. Biste psycho, oder was?«
»Ich will wissen … was wir … jetzt tun sollen«, presste das Mädchen zwischen unkontrolliert hastigen Atemstößen hervor und rüttelte ihn an den Schultern. »Los, Mann, sag’s mir!«
Der Junge hob die Hände zu einer hilflosen Geste. »Weiß … weiß auch nich’. Was schon? Am besten gar nichts. Wir können froh sein, dass er uns nicht entdeckt hat.«
»Hast du … hast du ihn auch erkannt?«
»Klar hab ich ihn erkannt«, antwortete der Junge und verzog seinen Mund zu einer verächtlichen Grimasse. »War ja schön vom Mond beleuchtet, dein Alter. Echt cool, was er da abgezogen hat.«
»Biste bescheuert? Du … du findest das cool, dass mein Vater gerade … deinen Vater ins … ins Wasser gestoßen hat?«, platzte es stoßweise aus ihr heraus, als kämpfe sie plötzlich mit einem Schluckauf.
»Nee!«, zischte er. »Bescheuert bin ich nicht!« Dann löste er die Hände seiner Freundin von seinen Schultern. Sie hatte nicht bemerkt, dass sie ihm blutige Striemen in die Haut gekratzt hatte. »Sondern echt heilfroh, dass der Alte endlich Geschichte ist.«
»Mann, wie krass ist das denn!?«
»Krass? Du weißt ganz genau, wie ich ihn hasse! Dafür, wie er mit meiner Mum umspringt … umgesprungen ist«, korrigierte er sich. »Er hat sie schlimmer behandelt als wie ’nen Putzlappen. Wie den letzten Dreck hat er sie behandelt. Und sich dabei ständig mit irgendwelchen billigen Tussis rumgetrieben. In aller Öffentlichkeit. Mum hat fast jede Nacht geweint«, fügte er mit kratziger Stimme hinzu.
»Aber … aber er ist … war … dein Vater«, gab das Mädchen stotternd zu bedenken.
Der Mund des Jungen wurde zu einem blutleeren Strich. »Schöner Vater«, spuckte er aus und ballte die Fäuste. »Ich wein ihm jedenfalls keine Träne nach. Keine einzige!«, presste er zwischen den Zähnen hervor. »Er hat’s verdient! Hundertprozentig hat er’s verdient! So, wie der Scheißkerl meine Mum behandelt hat. Ich war schon selber drauf und dran …«
Der Kopf des Mädchens zuckte zurück. »Du?« Mit zusammengezogenen Brauen starrte sie ihn an, so, wie man ein exotisches Tier im Zoo betrachtet. »Glaub ich nicht!«, sagte sie und schüttelte zweifelnd den Kopf.
Der Junge biss die Zähne aufeinander, dass sich seine Wangenmuskeln hart abbildeten. »Kannst mir’s glauben: Viel hat nicht gefehlt«, brummte er. »Ich war mir bloß noch nicht klar darüber, wie ich’s machen soll. Wollt natürlich nicht, dass ich auffliege. Doch jetzt hat mir ja dankenswerterweise dein Dad die Arbeit abgenommen.«
»Aber warum … grad er?«
Der Junge lachte bitter. »Vielleicht hat mein Alter ja auch mit deiner Mutter was angefangen. Weißt du’s? Und dein Vater hat’s rausgekriegt und sich jetzt dafür gerächt.«
»Meinste, echt? Aber dass er dann gleich so weit geht und ihn umbringt? Ich weiß nicht … Obwohl … Leiden konnte mein Vater den deinen ja noch nie so richtig. Hat schon immer nur auf ihn geschimpft …«
Erneut lachte er bitter. »Umgekehrt war’s nicht viel anders. Meiner hat deinen immer als Schwächling bezeichnet.«
»Möcht nur zu gern wissen, warum die beiden so verfeindet sind … waren. Hast du ’ne Ahnung?«
Der Junge schüttelte den Kopf. »Nee. Als ich ihn mal fragte, da hat er nur gesagt, dass das alles schon ewig lang zurückliegt und mich jetzt noch ’n Feuchten zu interessieren hat. Später, wenn ich älter wär, würde er mir’s vielleicht mal erzählen.«
»Aus meinem war auch nie was rauszukriegen. Der labert exakt denselben Scheiß.«
Der Junge winkte ab. »Is’ jetzt eh egal. Jetzt brät mein Alter endlich dort, wo er schon lange hingehört: in der Hölle nämlich.«
Mond und Sterne waren schon eine ganze Weile verschwunden, dafür begann sich jetzt der Himmel über dem Peterskopf rosa zu färben. Nicht mehr lange, dann würde ein neuer Tag anbrechen.
Eine Zeit lang schauten beide schweigend aufs Wasser und kauten in Gedanken noch einmal das durch, was sie gerade hatten miterleben müssen. Das Mädchen zitterte noch immer am ganzen Körper. Und das nicht vor Kälte, denn die Nacht war angenehm lau.
Schutz suchend klammerte sie sich an den Jungen. »Das alles macht mir furchtbar Angst«, brach sie schließlich das Schweigen. »Am liebsten würd ich abhauen. Ganz weit weg. Wie soll ich mich denn jetzt bloß meinem Vater gegenüber verhalten?«
»Lass dir am besten überhaupt nichts anmerken«, riet er ihr.
Abrupt fuhr ihr Kopf zu ihm herum, und sie schaute ihn entgeistert an. »Du hast gut reden. Ich werd an nix anderes mehr denken können, wenn ich ihn seh!« Ihre kleinen Brüste schimmerten blass im diffusen Zwielicht.
Dann ließ sie sich zurückfallen und stützte sich auf die Ellbogen. »Nee, ich kann nicht! Ich kann ihm nicht mehr gegenübertreten, ohne dass ich gleich losheule«, sagte sie und kaute auf ihren Daumennägeln. »So viel steht fest: Ich geh nicht mehr nach Haus. Ich weiß genau, ich steh das nicht durch. Nie und nimmer. Und wenn ich mich irgendwann verplappere, dann bringt er mich auch um. Du … du musst mich verstecken.«
Der Junge zuckte zurück. »Verstecken? Wie stellst’n dir das vor? Ich kann dich doch nicht bei uns im Haus verstecken.«
»Aber verstehst du denn nicht: Ich kann nicht mehr nach Haus …«
»Dir bleibt nix anderes übrig!«
Voll Panik starrte das Mädchen ihn an. Dann begann es zu weinen. »Der merkt doch gleich, dass ich … dass ich was weiß. Und dass ich Angst vor ihm hab. Ich kann doch jetzt nicht auf heile Welt machen und so tun, als wär nix gewesen!« Schluchzend barg sie ihren Kopf an der Brust ihres Freundes.
Beruhigend legte er einen Arm um ihre Schulter und drückte sie an sich.
Plötzlich kam das Mädchen wieder hoch. »Ich hab’s!« Sie nickte. »Ich weiß, was ich mach. Meine Granny, die aus Wildungen, hat mir schon vor längerer Zeit mal angeboten, dass ich zu ihr ziehen kann. Dann könnt ich mit dem Fahrrad in die Schule fahren und müsste nicht den Bus nehmen. Und sie könnte auch ein bisschen Hilfe in ihrer Pension brauchen, meinte sie. Es ging ihr nicht mehr alles so schnell von der Hand.« Zufrieden, einen Ausweg gefunden zu haben, strahlte sie ihren Freund an. »Was hältst du davon?«, fragte sie und boxte ihn gegen die Schulter.
Der Junge nickte. »Gute Idee«, fand er. »Aber meinst du, das geht so einfach? Deine Eltern …«
»Mit Mama komm ich schon klar«, fiel sie ihm ins Wort. »Die hat bestimmt nichts dagegen. Ich brauch ihr das bloß richtig zu erklären. Aber ich muss zusehen, dass ich meine Sachen packe, wenn mein Vater nicht im Haus ist.« Sie presste die Lippen zusammen. »Dem möcht ich nicht begegnen!«
Auf einmal schienen ihr aber doch noch Skrupel zu kommen. Sie verzog ihr Gesicht und kaute auf ihrer Unterlippe herum. »Aber … müssten wir nicht eigentlich die Polizei …?«
»Nix Polizei«, fiel ihr der Junge ins Wort. »Wenn wir ihm die Bullen auf’n Hals hetzen, sind wir nie mehr sicher vor ihm. Außerdem weiß man nie, wofür dieses Wissen noch einmal gut sein kann«, fügte er hinzu.
Aus dem Tagebuch des Mörders
1. Eintrag
Vergangene Nacht habe ich einen Menschen getötet …
Das muss ich jetzt erst mal so sacken lassen, denn im Grunde kommt es mir immer noch unwirklich vor, so, als sei ein anderer der Täter und ich nur ein zufälliger Beobachter gewesen. Ich habe etwas getan, von dem ich mir eigentlich auch bis vor … na ja, so anderthalb, zwei Jahren gar nicht vorstellen konnte, es jemals zu tun. Von Haus aus bin ich nämlich ein friedfertiger Mensch. Bin halt so erzogen. Auf gute Erziehung hat meine Familie schon immer großen Wert gelegt. Trotz allem, was wir im Laufe der Jahre erleiden mussten.
Das ging schon bei meinem Großvater los. Den hat’s bös erwischt. Damals. Aber den hab ich nicht mehr kennengelernt. Papa sagte immer, sein Lebensmotto sei gewesen: In traurigen Zeiten blüht der Witz.
Aber jetzt schweife ich ab.
Wie gesagt: Ich war immer so einer, von dem man sagt, er könne keiner Fliege etwas zuleide tun. Konnte ich auch nicht. Und hab ich auch nicht. Und hätt ich auch nie. Wenn da nicht vor circa zwei Jahren etwas passiert wäre, was meine Denkweise und Einstellung in dieser Hinsicht ins Schwanken brachte. Und schließlich irgendwann ins Gegenteil verkehrte. Ehrlich gesagt hab ich dem erst keine Bedeutung beigemessen; aber ab da hab ich’s ganz tief in mir drinnen doch … irgendwie für möglich gehalten, es vielleicht … irgendwann …? Aber nicht so richtig. Oder … vielleicht doch?
Aber mir hat … wie soll ich sagen? … der Mumm gefehlt? Die Gelegenheit? Der zündende Funke im Pulverfass? Oder was?
Ich weiß es nicht.
Doch als ich dann vor einigen Wochen erfuhr, dass er sogar … Verdammt! Die Frau, für die ich mich krumm geschuftet habe, um ihr ein besseres Leben zu bieten, lässt sich ausgerechnet mit diesem Arschloch von einem Flachwichser ein! Ich will es einfach noch immer nicht wahrhaben.
Das war der Zeitpunkt, von dem an der ohnehin schon unterschwellig vorhandene Drang, es dem Kerl heimzuzahlen, wuchs. Irgendwann wurde mir dann klar, dass ich ihm all das vergelten musste, was er einerseits meiner Familie, andererseits mir persönlich angetan hatte.
Ich wusste nur noch nicht, wie.
Noch fehlte die Gelegenheit.
Die kam gestern. Aus heiterem Himmel.
Und ich hab sie genutzt.
Ohne lange nachzudenken, welche Konsequenzen das hätte.
Jetzt, da ich alles noch einmal Revue passieren lasse, flattern meine Nerven gewaltig. Wie … wie die Flügel eines Kolibris, der vor einer Blüte steht und den Nektar aus ihr saugt.
Gestern aber, als ich zum Mörder wurde, da war ich total ruhig. Da zitterten noch nicht mal meine Hände.
Bloß, an den Ablauf des Ganzen hab ich nur noch eine verschwommene Erinnerung. Ich weiß nur noch, dass mich auf einmal irgendein Teufel ritt, als ich die Gelegenheit vor mir sah, auf die ich schon so lange gewartet hatte. Und es durchzuckte mich wie ein Blitzschlag. Wie ein 10.000-Volt-Stromstoß, der mir direkt ins Gehirn fuhr.
Wie von einem Magneten angezogen, bin ich ihm gefolgt.
Und hab ihn dann in den See gestoßen.
Das muss ich jetzt erst mal verdauen.
Doch ich habe niemanden, dem ich so sehr vertraue, dass ich mit ihm darüber reden könnte; niemanden, bei dem ich mir sicher bin, dass er es für sich behält. Keinen, der mich oder meine Tat versteht.
Aber ich muss mich jemandem anvertrauen, sonst platze ich wie ein überdehnter Ballon. Und dann stelle ich mich heute Mittag auf den Marktplatz in Fritzlar oder Korbach oder Frankenberg und schreie es aus mir heraus, sodass es alle hören können.
Dann würden sie mich sofort verhaften.
Und ich könnte das, was ich begonnen habe, nicht zu Ende führen. Aber das geht nicht. Denn jetzt, wo ich es einmal begonnen habe, muss ich konsequent sein und es auch zu Ende bringen.
Wer A sagt, muss auch B sagen.
Kapitel 2
Der Sonntagmorgen dämmerte … und wurde ignoriert. Es war bereits kurz vor elf, als sich Guldberg und die Hüben-thal endlich aus den Federn schälten, strubbelig, verwuschelt und immer noch angenehm erschöpft von der vergangenen Nacht.
Gähnend setzte er schon mal Wasser auf, während sie mit hängenden Schultern lieber erst unter die Dusche schlurfte.
Guldberg schob ein halbes Dutzend Brötchen zum Aufbacken in die Röhre und begann, die Augen noch auf halb acht, den Tisch zu decken. Mit trägen Bewegungen schaffte er Butter, Erdbeermarmelade, Camembert und eine Dose Ananas heran und brühte Kaffee auf. Sie frühstückten am liebsten in der Küche, weil man von dort einen herrlichen Blick hinüber auf den Hafen von Rehbach und das Restaurant Fischerhütte hatte.
Arne Guldberg, der ehemalige Hauptkommissar beim K 11 in Kassel, hatte sich mit Ende fünfzig frühpensionieren lassen und war vor etwas mehr als einem Jahr hierher an den Edersee gezogen, nachdem er bei einer Auseinandersetzung rivalisierender Zuhälterbanden angeschossen worden war und hatte einsehen müssen, dass es auch noch andere Dinge im Leben gab, als böse Buben zu jagen. Mit viel Liebe und unter Mithilfe seines Freundes Bertram Helmer, der vor wenigen Monaten ermordet worden war und dessen Mörder er nach langwierigen Ermittlungen zum Schluss doch noch hatte dingfest machen können, hatte er ein altes Wochenendhaus auf Scheid renoviert; und vor Kurzem war dann auch die Hübenthal, ihres Zeichens Reporterin der Waldeckischen Landeszeitung, bei ihm eingezogen.
Die kam gerade aus dem Bad. Sie trug einen äußerst knappen weißen Slip, der ihren süßen kleinen Po vortrefflich zur Geltung brachte, und ein schwarzes T-Shirt, auf dem in knallgelber Schrift der Satz: Guter Sex ist, wenn selbst die Nachbarn hinterher eine rauchen aufgedruckt war. Mit einem Handtuch rubbelte sie ihre roten Haare trocken und tänzelte barfuß und eine Melodie vor sich hin summend an den Tisch.
»Hätte nicht gedacht, dass du nach solch einer Nacht noch gerade stehen kannst«, frotzelte sie und grinste ihn von unten herauf an. Ihn nicht aus den Augen lassend, griff sie nach einem Brötchen, schnitt es noch im Stehen entzwei und bestrich es mit Butter und Marmelade.
Guldberg schenkte ihnen beiden Kaffee ein, den er mit einem Spritzer Sahne aus dem Spender garnierte. »Nun blas dich mal bloß nicht auf wie ’ne schwangere Elster, nur weil du jünger bist«, konterte er und gab ihr einen Stups auf die Nase. »Bisher hab ich dir doch wirklich keinen Grund geliefert, an meiner Manneskraft zu zweifeln, oder?«
Ihre roten Locken flogen hin und her. »Nee, kann mich nicht beklagen. Da kannte ich Jüngere, die du noch gut in die Tasche steckst. Aber …«
»Aber?«
»Aber das hätt ich jetzt vielleicht« – sie sagte das vielleicht mit Singsang und zog das ei in die Länge – »nicht sagen sollen.«
»Wieso das?«
»Na, weil du dich dann in Zukunft möglicherweise … ähm … weniger anstrengst?«, entgegnete sie und lachte schelmisch.
Mit einem Riesensatz, den er sich selbst nicht zugetraut hätte – am allerwenigsten heute –, war er um den Tisch, packte sie, hob sie hoch und legte sie sich übers Knie. »Du kleiner, süßer Frechdachs«, rief er und gab ihr ein paar spielerische Klapse auf den Po, die sie mit übertrieben verweint klingenden »Auaaa«-Rufen kommentierte.
Lachend ließ er sie wieder los.
Es war wirklich nicht schlecht, auf diese Weise den Sonntagvormittag zu verbringen – mit schäkern, Frühstücken, Kaffee trinken und ab und an einen Blick in die Sonntagszeitung werfen. Zuschauen, wie ein Rechteck aus Sonnenlicht langsam von rechts nach links über die Dielen wanderte. Oder eine vorwitzige Spinne sich am unsichtbaren Faden von der Decke abseilte. Ein bisschen knutschen zwischendurch – und später vielleicht …
Das Klingeln des Telefons unterbrach die Idylle.
Guldberg blieb, wo er war, die Lippen den Nabel der Hübenthal erkundend, eine Hand unter ihrem T-Shirt.
Endlich hörte es auf zu klingeln, und der Anrufbeantworter sprang an.
Mitten in der Ansage wurde der Hörer aufgelegt.
Und dann fing das Klingeln von Neuem an.
Er hob den Kopf und fluchte. »Ist wahrscheinlich …«
Sie zog ihn wieder zu sich herunter. »Lass es klingeln.«
Der Anrufbeantworter machte Piep.
Das Klingeln hörte auf.
Und fing erneut an.
»Verdammt …!«
»Dann geh halt ran«, seufzte sie und schob ihn von sich.
Bevor die Ansage zu Ende war, nahm er ab. »Ja?«
»Na endlich!« Franca.
»Was willst du denn?«, seufzte er ungehalten und fuhr sich mit der Hand durch die halblangen Haare. »So früh am Sonntagmorgen.«
Seine Tochter lachte: »Früh? Es ist gleich Mittag, alter Mann. Ist deine Uhr stehen geblieben, oder was?«
Franca war Kommissarin bei der Kripo in Korbach und hatte ein ambivalentes Verhältnis zu ihm. Einerseits sah er ein, dass sie mit ihren fast dreißig Jahren beruflich nicht mehr an seinem Rockzipfel hängen wollte, andererseits wusste er, dass sie es durchaus schätzte, wenn er ihr bisweilen mit seiner Erfahrung und seinem Instinkt unter die Arme griff.
»Man wird ja wohl noch ein Recht auf ein bisschen Privatleben haben«, brummte Guldberg. »Zumal am Sonntag …«
»Papperlapapp!«, schnitt sie ihm das Wort ab. »Ich hab auch keins. Muss heute Bereitschaft schieben. Und ich denke, das wird dich interessieren: Dein Vereinsboss ist verschollen«, fiel sie dann mit der Tür ins Haus.
Guldberg horchte auf. »Der Lengemann? Vom SCS?«
»Jepp. Behauptet jedenfalls seine Frau. Er sei gestern auf ’nem Junggesellenabschied im Vereinsheim gewesen und danach spurlos verschwunden.«
Heinrich »Henner« Lengemann war Erster Vorsitzender des SCS und besaß ein großes, ertragreiches Gut am Ortsrand von Twiste, einem Dorf zwischen Korbach und Bad Arolsen. Außerdem ein repräsentatives Wochenendhaus oberhalb der Bringhäuser Bucht und eine Bavaria 31 mit allem Drum und Dran im Sportboothafen am Westufer von Scheid. Daneben ein paar Häuser mit Gewerbe und Wohnungen, die er vermietet hatte. Bei ihm galt bei allem, was er tat, die Maxime: Klotzen, nicht kleckern!
Guldberg schaltete den Ton am Hörer ein, damit die Hübenthal mithören konnte. Ein über die offene Handfläche gehauchter Luftkuss dankte es ihm. Rasch schnappte sie sich den immer griffbereit liegenden Block und begann, sich für ihre Zeitung Notizen zu machen. »Lengemann war auf ’nem Junggesellenabschied im Vereinsheim des SCS und ist seit gestern Nacht spurlos verschwunden?«, wiederholte Guldberg dann für sie.
»Seine Frau sagt, sie hätten vereinbart, dass sie ihn so gegen drei Uhr nachts mit dem Auto abholt. Sie habe deshalb extra nichts getrunken und sei auch rechtzeitig losgefahren. Aber bis sie von ihrem Wochenendhaus um den See herum Scheid erreicht habe, seien über anderthalb Stunden vergangen, weil in Höhe der Staumauer wegen eines Unfalls die Straße gesperrt war. Daher habe sie umkehren und den viel weiteren Weg über Affoldern und Waldeck nehmen müssen. Und als sie schließlich das Vereinsheim erreicht habe, sei alles schon dunkel und keiner mehr im Haus gewesen …«
»So’n Pech aber auch …«
»Sie sagt, sie hätte halb Scheid abgefahren auf der Suche nach ihrem Mann«, fuhr Franca unbeirrt fort, »aber nicht die kleinste Spur gefunden. Sie ist dann eilig zurück ins Wochenendhaus gefahren, weil sie hoffte, jemand anderes habe ihn heimgefahren.«
»Betrunken?«
»Na ja, manchmal organisieren sie bei solchen Feten ja einen Fahrdienst.«
»Hm …«
»Anschließend hat sie angeblich den ganzen Morgen überall rumtelefoniert, aber er ist nirgendwo gesehen worden. Sogar in ihrem Haus in Twiste habe sie seinen Vater aus dem Bett geklingelt, aber auch dort sei er nicht gesehen worden. Wie vom Erdboden verschluckt sei er, sagt sie. Sag mal: Warst du nicht zufällig gestern auch …«
»Nein, war ich nicht. Ich kann solche Feten, wo’s nur ums Besaufen geht, auf den Tod nicht ausstehen. Als SCS-Mitglied war ich zwar eingeladen, hab mich aber unter ’nem Vorwand entschuldigt.«
»Schade«, bedauerte Franca. »Hatte gehofft, von dir vielleicht Näheres erfahren zu können.«
»Sorry, Franca, aber damit kann ich dir leider nicht dienen. Weißt du, was ich glaube?«
»Hm …?«
»Der schläft bei irgendeiner seiner Liebschaften seinen Rausch aus und taucht heute Abend oder spätestens morgen früh quietschvergnügt wieder auf und weiß von nichts.«
»Meinst du nicht, dass dein holder Ehegatte bei einer seiner Ischen seinen Rausch ausschläft?«, meinte auch Änne Lengemanns Freundin Dörchen, der diese am Telefon ihr Leid klagte. Dörchen, als beste Freundin von Änne, wusste natürlich Bescheid. Wie übrigens das halbe Edertal. Mindestens. Lengemann machte kein großes Geheimnis daraus, dass er hinter jedem Rock her war, der bei drei nicht schnell genug auf dem Baum war.
Änne Lengemann war sechsundvierzig Jahre alt, drall, und trug ihr blond gefärbtes Haar streng hochgesteckt. »Hm, könnte sein«, antwortete sie mit Zweifel in der Stimme. »Glaub ich aber nicht. Wenn der besoffen ist, kriegt der doch nichts mehr auf die Reihe, wenn du verstehst, was ich meine.« Änne kicherte und wurde leicht rot im Gesicht. Sie war froh, dass ihre Freundin sie jetzt nicht sehen konnte. »Und ich glaube kaum, dass er sich vor einem seiner Bumsmäuschen blamieren will …!«, fügte sie hinzu und schüttelte den Kopf. »Nee, Dörchen, da muss was passiert sein.«
»Meinste echt?«
»Ja, mein ich. Wenn er mich ins Wochenendhaus mitnimmt, geht er normalerweise nicht fremd. Aber er nimmt mich ja immer nur dann mit, wenn irgendwo ’ne Feier ist und er ’ne Fahrerin braucht, ’ne Doofe, um ihn rumzukutschieren. Wie dieses Mal. Und dann ist er auch immer da. Und hat sich von mir ins Wochenendhaus fahren lassen und brav seinen Rausch ausgeschlafen. Aber diesmal …«
»Na ja. Einmal ist immer das erste Mal«, gab Dörchen zu bedenken.
»Ich weiß nicht. Irgendwie hab ich ein verdammt mulmiges Gefühl …«
»Nun mach dir mal keinen Kopp, Änne. Wirst sehen, noch bevor der Tag rum ist, ist dein Alter wieder aufgetaucht. Ist er bis jetzt doch immer.«
»Na ja, bis jetzt …«, unkte Änne.
Aus dem Tagebuch des Mörders
2. Eintrag
Auch jetzt, nachdem eine Nacht verstrichen ist und ich mir den ganzen Ablauf – zum wievielten Mal eigentlich? – durch den Kopf gehen lasse, kommt es mir vor, als ob ich nicht wirklich bewusst gehandelt, sondern mich wie einen Fremden von außerhalb beobachtet hätte, ohne die Möglichkeit, direkten Einfluss auf mein Handeln zu nehmen.
Es fällt mir verdammt schwer, das alles in Worte zu fassen. Nicht nur, weil es so verworren und schwierig zu beschreiben ist, sondern auch, weil ich nie sonderlich gut darin war, mich schriftlich auszudrücken.
Obwohl ich Abitur habe.
Aber was besagt das schon?
Ich hab übrigens nicht gesagt: … jetzt, nachdem ich eine Nacht darüber geschlafen habe …, denn ich habe nicht geschlafen. Ich konnte es nicht. War zu sehr aufgewühlt von meiner Tat.
Der Tat, die mein Leben verändert hat.
Die mich verändert hat.
Noch habe ich keine Vorstellung davon, wie es jetzt weitergeht.
Doch ich weiß, dass ich mit dieser Tat eine Schwelle überschritten, mich auf einen neuen Weg begeben habe. Einen Weg, bei dem ich jetzt noch nicht absehen kann, wo er hinführt. Und ob ich bereit bin, ihn mit allen Konsequenzen zu Ende zu gehen. Doch ich fürchte, dass mir gar nichts anderes übrig bleibt. Ich werde ihn gehen müssen. Denn mir ist auch bewusst, dass mein Leben jetzt nur noch in eine einzige Richtung führt. Wie eine Einbahnstraße.
Auf einem Weg, von dem es kein Zurück mehr gibt.
Auch habe ich keine Ahnung, wie lange das Ganze gedauert hat. Und wie ich nach Hause kam. Oder ob mich wer gesehen hat.
Nein, diese Nacht liegt … irgendwo im Nebel …
Also … dann beschreib ich erst mal, wie es überhaupt dazu kam, dass ich zum Mörder wurde:
Es gibt Menschen, die meinen, sich einfach alles nehmen zu können, wie es ihnen beliebt. Die glauben, nur ihr Wille zähle und jeder müsse sich dem beugen. Und die sich ihre eigenen Gesetze machen.
Ich hasse solche Menschen.
Der, den ich getötet habe, ist ein solcher Mensch.
Gewesen, muss ich ja inzwischen sagen.
Nun ist es bekanntermaßen ein großer Unterschied in der Wahrnehmung, ob anderen Böses widerfährt – oder einem selbst. Ja, auch davor schon hatte ich diesen Mann stets verachtet. Schon immer war mir sein großkotziges Gehabe und die Art und Weise, wie er sich alles nahm, sogar Frauen, die zu anderen Männern gehörten, ein Dorn im Auge.
Doch als es mich dann auf einmal persönlich betraf, tja, da ging’s mir mit einem Schlag so richtig unter die Haut.
Da dachte ich zum ersten Mal daran, es ihm heimzuzahlen.
Nur wie?
Ich hatte keine Ahnung.
Ich weiß auch nicht, wann die Idee in mir keimte, ihn umzubringen.
Aber irgendwann war sie da. Einfach da.
Und wieder stand ich vor der Frage: Wenn ja, wie?
Schließlich ist Morden nicht mein täglicher Job.
Also habe ich lange darüber gegrübelt, wie ich es anstellen könnte. An eine Waffe zu kommen, wäre ein Leichtes für mich gewesen. So einfach, wie … eine Pizza zu bestellen, zum Beispiel. Aber jemanden mit einer Schusswaffe zu töten, war mir zu unpersönlich. Zu distanziert. Zu leidenschaftslos und kühl. Die Schusswaffe ist etwas für einen Killer, der seinen Job schnell und präzise erledigen möchte, um dann wieder rasch zu verschwinden. Sie ist ein Instrument, bei dem es um Effizienz geht, keines, das Genugtuung bereitet.
Aber wenn ich schon zum Mörder werden und meinem bisherigen Leben abschwören sollte, dann konnte der Grund nur einer sein: Genugtuung.
Und dann kam mir der Zufall zuhilfe.
Vorgestern Abend. Beim Junggesellenabschied. Der Anlass ging mich im Grunde genommen gar nichts an. Aber in den Monaten davor hatte sich ein solcher Hass auf diesen Mann in mir aufgestaut, dass schon der kleinste Funke genügen würde, um mein Pulverfass explodieren zu lassen.
Mit hämischen Worten und so laut, dass alle es mithören konnten, auch der Kassenwart unseres Segelvereins, der ein paar Meter entfernt stand, gab er vor einer Gruppe von sechs, sieben Männern damit an, dessen Frau, wie er sich ausdrückte, »flachgelegt« zu haben. Und die habe sich sogar noch geschmeichelt gefühlt, dass er sich mit ihr abgab, und sich das nicht nur gefallen lassen, sondern ihm hinterher noch einen geblasen. Ihr Mann, der arme Kerl, konnte das anscheinend trotz der Distanz hören. Sein Kopf lief hochrot an vor Scham und Wut, und man konnte ihm ansehen, dass er am liebsten um sich geschlagen und den anderen umgebracht hätte. Doch er musste das Maul halten, weil der Verein dringend auf die Finanzspritze dieses Großkotzes angewiesen war, um die in die Jahre gekommene Slipanlage zu sanieren.
Ein falscher Ton, und er würde den Geldhahn zudrehen.
Und da schlug es bei mir ein: Mit einem Mal ging mir auf, dass er vor Kurzem mit Sicherheit genau in diesem Ton und mit denselben schmutzigen, demütigenden Ausdrücken über meine Frau hergezogen war, Intimstes von ihr preisgegeben und mich vor den Vereinskollegen lächerlich gemacht hatte. Wie ein Blitz war diese Erkenntnis durch mich hindurchgefahren und zum zündenden Funken geworden, der einzig und allein gefehlt hatte, um das Pulverfass explodieren zu lassen.
Und dann – ich sagte es bereits zu Beginn – kam mir der Zufall zuhilfe.
Kapitel 3
Karl-August Siebert ließ die vergangenen zwanzig Monate an seinem geistigen Auge vorbeiziehen. Noch bis vor knapp zwei Jahren hätte er keinem widersprochen, der ihn als rechtschaffen, vertrauenswürdig, sittlich gefestigt und unbescholten bezeichnet hätte. Grundehrlich und loyal. Als einen Mann also, korrekt vom Scheitel bis zur Sohle, wie man so sagt.
Siebert, Kundenberater bei der Filiale der Städtischen Sparkasse in Bad Wildungen, war neununddreißig, schlank, mittelgroß und trug das bereits schüttere, zu einer undefinierbaren Sandfarbe verblasste Haar sorgsam von einer Schläfe zur anderen gekämmt, um so die beginnende Glatze dazwischen zu verbergen. Sein Mund war schmal, die Nase ein klein wenig zu kurz, und seine von einer beginnenden Rosazea stets leicht geröteten Wangen in der sonst fahlen Gesichtshaut sahen aus, als habe er die vergangenen zwei Stunden zu nah an einem Hochofen verbracht.
Die etwas schlabbrig an seinem Körper hängenden mausgrauen Anzüge kaufte er – des Portos wegen immer ein halbes Dutzend auf einmal – im Versandhandel. Ebenso seine weißen Nylonhemden und die dezent weiß und grau gestreiften Krawatten.
Bis vor zwanzig Monaten hatte er ein wohlgeordnetes, fehlerloses, aber auch langweiliges Leben ohne Höhen und Tiefen geführt und die Uhr seinen Tagesrhythmus bestimmen lassen: Jeden Morgen war er zur gleichen Zeit aufgestanden, hatte genau dreiundzwanzigeinhalb Minuten für Morgentoilette und Frühstück benötigt und war mit dem Bus zur Arbeit gefahren. Mittags hatte er um die gleiche Zeit am gleichen Stehimbiss eine Wurst mit Pommes verdrückt – an »geraden« Tagen eine Bratwurst, an »ungeraden« eine Currywurst – und war jeden Abend um die gleiche Zeit in sein Reihenhäuschen am Stadtrand zurückgekehrt. Nach dem Abendessen mit seiner Frau, das sie schweigend einnahmen – sie hatten sich schon lange nichts mehr zu sagen –, hatte er sich vor den Fernseher gehockt und sich pünktlich nach den Tagesthemen zu Bett begeben. Und war nach dem allabendlichen Resümee seines Tagesablaufs schließlich mit dem stolzen Gedanken eingeschlafen, seinen zwanzig Dienstjahren in ein und derselben Sparkassenfiliale einen weiteren Tag ohne die geringste Unregelmäßigkeit hinzugefügt zu haben.
Ja, bis vor zwanzig Monaten hätte diese Beschreibung noch zu hundert Prozent auf Siebert zugetroffen.
Bis er eines Vormittags vor dem besagten Zeitpunkt aus heiterem Himmel und mit aller Macht die Tristesse und Freudlosigkeit seines bisherigen Lebens vor Augen geführt bekam.
Und das kam so:
Ein Kunde, den er wegen dessen zwielichtiger Geschäfte zutiefst verachtete, amüsierte sich – selbst braun gebrannt und strotzend vor Selbstbewusstsein – über sein blasses Aussehen und fragte ihn süffisant, warum er denn nicht mal Urlaub bei kaffeebraunen Señoritas mache und sich von ihnen nach Strich und Faden verwöhnen lasse. Ob er ihm vielleicht ein paar Prospekte besorgen solle. Und dann erzählte er ihm lachend und in aller Ausführlichkeit von seiner letzten heißen Eroberung auf der Karibikinsel St. Lucia und zeigte ihm auf seinem Handy Bilder einer nur spärlich bekleideten Schönheit, die sich lasziv im Sand rekelte.
Von der herablassenden Art dieses Kunden zwar angewidert, war Siebert dennoch ins Grübeln geraten und hatte sich gleich am nächsten Tag in der Mittagspause in einem Reisebüro an der Brunnenallee Prospekte von Urlaubszielen jenseits des Atlantiks besorgt.
Die hatte er sofort nach seiner Rückkehr in die Filiale auf dem Mitarbeiterklo heimlich studiert und war sichtlich beeindruckt gewesen von den verlockenden, ein sorgloses Leben an sandigen Stränden und unter Palmen sowie in Gesellschaft heißblütiger Schönheiten vorgaukelnden Bildern.
Vier Wochen lang hatte er mit seinen Grundsätzen gekämpft. War nachts schweißgebadet aufgewacht und tagsüber oft mit seinen Gedanken woanders gewesen, sodass ihn seine Kollegen schon forschend ansahen.
Je mehr er sich jedoch in die Prospekte vertieft hatte, desto heftiger hatte der Drang nach Veränderung von ihm Besitz ergriffen. Bis er nach einer weiteren »Sitzung« auf dem Mitarbeiterklo zu einer Entscheidung gekommen war und beschlossen hatte, es zu wagen und sein Leben zu ändern.
Und da er keine halben Sachen machte, konnte dies nur bedeuten: radikal zu ändern!
Nur noch zum Schein hatte er daraufhin während der vergangenen zwanzig Monate sein vorheriges Leben weitergeführt. Dennoch mit akribischer Genauigkeit. Kein Mensch sollte ja mitbekommen, dass er sich langsam, aber sicher ein Polster zulegte, das ihm bald ein sorgloses Leben garantieren würde.
Niemand aus seinem Umfeld, keiner aus der Sparkasse, nein, absolut kein Aas sollte es auch nur ahnen.
Am allerwenigsten aber seine Frau.
»Da muss irgendwas Ernstes passiert sein«, war sich Änne Lengemann sicher und sah ihre Freundin Dörchen mit zusammengezogenen Augenbrauen an. Heute war schon der zweite Tag, nachdem ihr Mann von der Feier des Junggesellenabschieds aus dem Vereinsheim des SCS verschwunden und seitdem wie vom Erdboden verschluckt war.
Dörchen war gerade dabei, auf der Freiterrasse ihres kleinen Gästehauses oberhalb des Twistesees das Frühstücksgeschirr ihrer Pensionsgäste wegzuräumen. Änne war auf dem Heimweg vom Ferienhaus in Bringhausen zu ihrem Haus in Twiste auf einen Sprung vorbeigekommen und ging ihr dabei zur Hand. Sie hatte Angst, nach Hause zurückzukehren und es dort allein nicht auszuhalten. Die Ungewissheit über das Schicksal ihres Mannes hatte ihre Gefühlswelt völlig durcheinandergewirbelt.
»Glaub ich nicht«, beschwichtigte ihre Freundin sie kopfschüttelnd, während sie Tassen und Teller auf ein Tablett stapelte. »Ich kann ja verstehen, dass dich das alles aufwühlt … Da können manchmal Minuten zu Stunden werden! Aber ich denke, du sorgst dich umsonst. Wirst sehen, Änne, der taucht bald wieder auf und erzählt dir irgendein Märchen von ’ner Amnesie oder so. Derweil lag er selig in den Armen von einer seiner Ischen und hat bei der seinen Rausch ausgeschlafen. ’s wär ja wirklich nicht das erste Mal, dass er ein paar Tage wegbleibt, oder?«
Änne zuckte nur vielsagend die Schultern und rollte mit den Augen.
Zusammen trugen sie ihre vollen Tabletts in die Küche und stellten sie auf der Arbeitsfläche ab.
»Was ich nie verstehen werde«, sagte Dörchen und stemmte die Arme in die Hüften, »dass du diesem Kerl immer noch … wie soll ich sagen? … verfallen bist. Wieso machst du dir Sorgen um ihn, so wie der mit dir umspringt?«
Änne sah auf. »Das verstehst du nicht«, antwortete sie und lächelte verklärt. »Ich liebe den Kerl halt nach wie vor. Egal, was er tut und wie er mich behandelt. Er ist mein Mann!«
Dörchen schüttelte verständnislos den Kopf. Dann ging sie in die Hocke und begann, das Geschirr in die Spülmaschine einzuräumen. »Hat er denn kein Handy dabei?«, fragte sie nach einer Weile und sah zu ihrer Freundin auf. »Das kann man doch orten lassen … Hast du schon die Polizei …?«
Entschieden schüttelte Änne den Kopf. »Das sähe ja aus, als würde ich meinem eigenen Mann hinterherspionieren«, echauffierte sie sich und reichte ihr ein paar Teller an. »Nee, meine Liebe. Diese Blöße geb ich mir nicht. Nachher tratscht die ganze Nachbarschaft darüber. Die Leute reden eh schon genug.«
»War ja nur ’n Vorschlag«, gab sich Dörchen leicht eingeschnappt. Dann kam sie wieder hoch, schloss die Klapptür und drückte auf den Startknopf der Geschirrspülmaschine.
Zusammen schlenderten sie nach draußen.
»Die Polizei meint, erst nach achtundvierzig Stunden könne sie eine Vermisstenanzeige aufnehmen«, stellte Änne klar. »Hab gestern mit der Kripo in Korbach telefoniert. Mit einer Kommissarin Franca Guldberg. Kennst du die?«
Dörchen nickte. »Hm. Ist die Tochter von diesem Ex-Kommissar aus Kassel, der vor ’nem Jahr oder so auf Scheid aufgekreuzt ist. – Scheint ’n komischer Heiliger zu sein«, fügte sie grinsend hinzu. »Stell dir vor: Der hält sich ’nen Waschbären als Haustier.« Verständnislos verdrehte sie die Augen und machte mit der Hand eine Wischbewegung vor ihrem Gesicht.
Änne schmunzelte. »So? Na und. Jedem Tierchen sein Pläsierchen. Find ich ganz sympathisch, so ’ne Marotte.«
Ihre Freundin schüttelte nur den Kopf.
Dann wurde Änne wieder ernst. »Nein, Dörchen: Du kannst sagen, was du willst, ich bleib dabei: Irgendwas muss passiert sein!«
»Und was willst du jetzt tun?«, fragte die Freundin. Mit routinierten Bewegungen begann sie, die Tische abzuwischen.