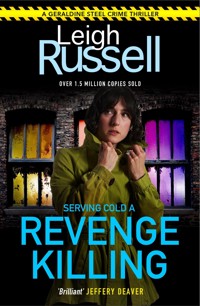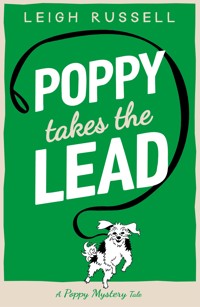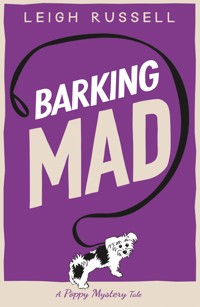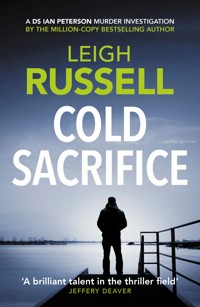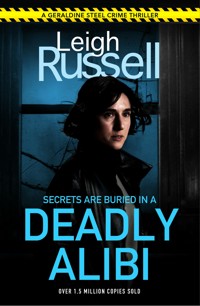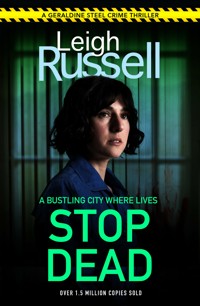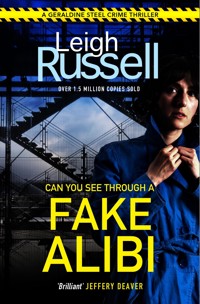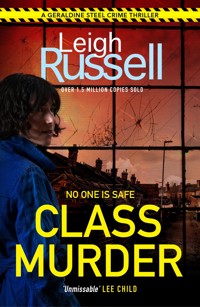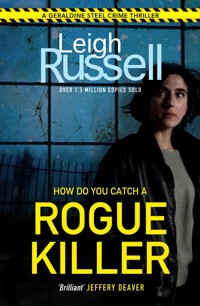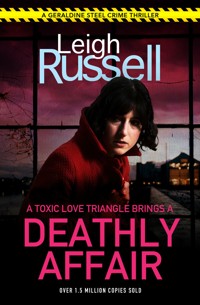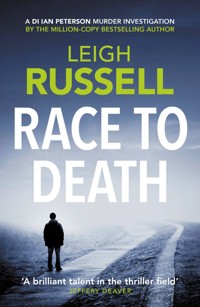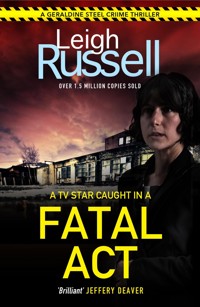9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Krimi
- Serie: DI-Steel-Reihe
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Detective Inspector Geraldine Steel hat in ihrer Dienstzeit schon viele furchtbare Dinge gesehen. Doch als die Leiche der Schulleiterin Abigail Kirby in einem Park gefunden wird, ist selbst die erfahrene Ermittlerin entsetzt. Denn die Frau wurde nicht einfach nur getötet - ihr wurde die Zunge herausgeschnitten, während sie im Sterben lag. Geraldine und ihre Kollegen stehen vor einem Rätsel - und bald vor der nächsten verstümmelten Leiche, einem Mann, dem vor seinem Tod die Augen entfernt wurden. Als wenig später die Tochter des ersten Opfers verschwindet, ahnt Geraldine, dass ihnen die Zeit davonläuft ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 475
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über die Autorin
Titel
Impressum
Widmung
Danksagung
Zitat
Verzeichnis der Abkürzungen
Teil 1
1 – Abigail
2 – Warten
3 – Die Entdeckung
4 – Das Team
5 – Der Schauplatz
6 – Im Chatroom
7 – In der Leichenhalle
8 – Die Familie
9 – Der Schock
10 – Briefing
11 – Befragungen
12 – Abfall
13 – Die Geliebte
14 – Zoe
Teil 2
15 – Vernon
16 – Matthew
17 – Vereinbarungen
18 – Ben
19 – Der Zeuge
20 – Hannah
21 – Die Adoptionsstelle
22 – Charlotte
23 – Tünche
24 – Auf einen Drink
25 – Evie
26 – Der Verfolger
Teil 3
27 – Die Ehe
28 – Vertrauen
29 – Alarm
30 – Ein Essen
31 – Die Party
32 – Vermisst
33 – Die Schule
34 – Die Nachbarn
35 – Carol
36 – Die Entlastung
37 – Gerede
38 – Die Abmachung
39 – Interesse
40 – Der Besuch
41 – Reinemachen
Teil 4
42 – Die Guy-Fawkes-Puppe
43 – Trauer
44 – Die Leiche
45 – Der Laden
46 – Ungeduld
47 – Die Identifizierung
48 – Streit
49 – Geheimnisse
50 – Unzufriedenheit
51 – Flucht
Teil 5
52 – Die Tochter
53 – Panik
54 – Ein Name
55 – Verborgenes
56 – Gerechtigkeit
57 – Die Flucht
58 – Whitstable
59 – Die Schule
60 – Das Café
61 – Die Festnahme
62 – Reue
63 – Der Antrag
64 – Die Reise
65 – Die Wahrheit
66 – Der Keller
67 – Weiterleben
68 – Veränderungen
Über die Autorin
Leigh Russell schloss ihr Literaturstudium an der Universität von Kent ab. Als Gesamtschullehrerin spezialisierte sie sich anschließend auf die Förderung von Schülern mit Lernbehinderungen. Ihre Kriminalromane um DI Geraldine Steel begeistern Leser und Kritiker auf der ganzen Welt. Leigh Russell ist verheiratet und lebt mit ihrem Ehemann und zwei Töchtern in Hertfordshire.
LEIGH RUSSELL
Aus dem Englischen von Sabine Schilasky
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige eBook-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Vollständige Taschenbuchausgabe
Deutsche Erstausgabe
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2011 by Leigh Russell
Titel der englischen Originalausgabe: »Dead End«
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2018 by Bastei Lübbe AG, Köln
Lektorat: Judith Mandt
Textredaktion: Anita Krätzer, Schwarzenbek
Titelillustration: © robertharding/Masterfile
Umschlaggestaltung: Jeannine Schmelzer
eBook-Erstellung: Urban SatzKonzept, Düsseldorf
ISBN 978-3-7325-5009-8
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Danksagung
Ich danke Dr. Leonard Russell für seine medizinische Beratung und all meinen Kontaktpersonen bei der Polizei für ihre Auskünfte. Meiner Lektorin bin ich für ihre Hilfestellungen, David Marshall für seine Unterstützung und Annette Crossland sowie dem gesamten Team von No Exit Press für ihren Einsatz dankbar.
»Wenn man jemanden tötet, verändert man das Universum.«
Dr. Gwen Adshead,leitende forensische Psychotherapeutinam Broadmore Hospital
Verzeichnis der Abkürzungen
DCI – Detective Chief Inspector (leitender Ermittler)
DI – Detective Inspector
DS – Detective Sergeant
SOCO – Scene of Crime Officer (Kriminaltechniker, der die Beweise am Tatort sichert)
PM – post mortem oder Autopsie (die Untersuchung der Leiche zwecks Ermittlung der Todesursache)
GCSE – General Certificate of Secondary Education (Gesamtschulabschluss, vergleichbar der dt. mittleren Reife)
CCTV – Closed Circuit Television (Sicherheitskameras)
Teil 1
»Wenn du traurig bist, dann schau in dein Herz, und du wirst erkennen, dass du um das weinst, was dir Freude bereitete.«
Khalil Gibran
1Abigail
Abigail schmerzte der Kopf. Sie hatte Angst, dass mit ihren Augen etwas nicht stimmte, denn sie konnte nichts sehen. Ein schweres Gewicht drückte auf ihre Brust. Sie kämpfte mit einem Gefühl von Übelkeit und versuchte, ihren Kopf zu drehen, konnte es aber nicht.
»Hallo?«, krächzte sie. Keine Reaktion. Sie war allein in der Dunkelheit.
Es hatte geregnet, als sie aus dem Einkaufszentrum gekommen war. Ihr Sohn Ben hatte sich für die Auswahl in das Unter-Vierzehn-Football-Team an seiner neuen Schule beworben, und Abigail hatte ihm versprochen, da zu sein, wenn er nach Hause kam. Sie erinnerte sich, wie sie durch die Straßen geeilt war, weg von den Läden. Jetzt lag sie in völliger Finsternis, unfähig sich zu bewegen.
»Hallo?«, rief sie wieder. Ihr Hals schmerzte, und da war ein komischer Geruch. Inzwischen war Abigail klar, dass sie in einem Krankenhaus lag und gerade aus einer Narkose aufwachte. Die Krankenschwestern sollten doch wissen, dass man sie nicht allein auf dem Rücken liegen lassen durfte. Immerhin bestand die Gefahr, dass sie an ihrem eigenen Erbrochenen erstickte, wenn ihr übel wurde. Sie schien seit Stunden dazuliegen, immer wieder zu Bewusstsein zu kommen und wieder wegzudriften. »Hallo?«, rief sie abermals. »Ist jemand da? Bitte?«
Das Licht blendete sie.
»Bin ich im Krankenhaus?«, fragte sie. Ihre Stimme klang wie weit weg. »Sind Sie ein Arzt?«
»Hallo, Mrs. Kirby. Mrs. Abigail Kirby.« Der Mann lächelte. »Wie fühlen Sie sich?« Er hielt eine Spritze in die Höhe. Klare Flüssigkeit glänzte oben an der Nadel. Der Mann beugte sich vor, und sein Kopf war von einer Aura aus weißem Licht umrahmt.
Abigail schloss die Augen und tauchte zurück in ihre Träume. Als sie wieder aufwachte, war wieder alles dunkel. »Herr Doktor?«, rief sie. »Hallo? Sind Sie da? Ist jemand da?«
Stille.
2Warten
Matthew Kirby sah genervt zur Uhr. Es waren Trimesterferien, aber Abigail war mal wieder früh aufgebrochen. Sie war besessen von ihrer Arbeit. Seit sie zur Schulleiterin befördert worden war, schien sie kaum noch einen Gedanken an ihre Familie zu verschwenden. Matthew hatte ihr längst vergeben, dass sie ihn vernachlässigte. Er hatte sich ein eigenes Leben eingerichtet, in dem seine Frau nicht vorkam. Bei Lucy und Ben aber war es etwas anderes. Dieser Verrat war unverzeihlich. Ben machte sich gut an seiner neuen Schule. Er hatte sich sofort eingelebt. Mit Lucy aber war es problematisch.
»Es ist das Alter«, sagte Matthews Freundin Charlotte. Ihn überzeugte das nicht. Das ganze Durcheinander des Umzugs nach Südengland, weil die Mutter versetzt wurde, war natürlich nicht ideal für eine Vierzehnjährige, die sowieso schon einige Probleme mit anderen Menschen hatte.
Matthew runzelte die Stirn und sah nach den Würstchen, ehe er vom Treppenende aus rief: »Essen ist fertig!«
Einen Moment später hörte er Ben die Treppe heruntergestürmt kommen. Bens Grinsen verblasste, sobald er sah, wie sein Vater mit einer Bratpfanne voller Würstchen vom Herd zurücktrat. »Wo ist Mum? Ich wollte ihr doch erzählen …« Er verstummte, weil er den Gesichtsausdruck seines Vaters bemerkte. »Sie ist nicht da, oder? Sie hat es versprochen …«
Matthew stellte die Pfanne ab. »Wo ist Lucy?«
Ben zuckte mit den Schultern. »In ihrem Zimmer, wo sonst?« Er warf sich auf einen Stuhl, die langen dünnen Beine halb seitlich überkreuzt. »Ich bin am Verhungern.«
»Wir warten auf Lucy.«
»Wenn ich dich gehört habe, hat sie es auch. Sie wäre schon hier, wenn sie Hunger hätte.«
Matthew trat auf den Flur hinaus. »Lucy! Komm jetzt, das Essen steht auf dem Tisch!« Dann kehrte er in die Küche zurück und füllte Würste und Bohnen auf drei Teller. Hinter ihm sprangen die Toastscheiben aus den Schlitzen.
Mürrisch erschien Lucy in der Tür. »Warten wir nicht auf Mum?«
»Deine Mutter ist nicht hier.«
»Das sehe ich selber.« Lucy machte keine Anstalten, sich zu ihrem Vater und ihrem Bruder an den Tisch zu setzen.
»Komm und setz dich hin«, sagte Matthew. »Mummy arbeitet heute.«
»Immer arbeitet sie«, beschwerte sich Ben. »Heute ist Samstag!« Sein Stuhl schabte laut über den Boden, als er ihn näher an den Tisch rückte. »Ich wollte ihr doch von meinem Fußballtraining erzählen.«
»Das kannst du heute Abend noch.«
»Sie will nicht nach Hause kommen. Wegen ihm.« Lucy sah wütend zu Matthew. »Wegen ihm und seiner Freundin.«
»Komm jetzt und setz dich«, wiederholte Matthew ruhig.
»Ich habe keinen Hunger.«
»Lucy …«, begann er, doch sie rannte schon zurück und die Treppe hinauf.
»Mehr für uns, Dad«, sagte Ben grinsend.
Matthew setzte sich und stocherte in seinem Essen, während Ben sich die Bohnen in den Mund schaufelte. Nach einigen Minuten legte Matthew seine Gabel hin und stand auf. Ben horchte auf die Schritte seines Vaters oben im Flur. Er hörte, wie Matthew an Lucys Tür klopfte. Stille, gefolgt von gedämpften Stimmen. Ben stand auf und nahm sich noch mehr Würste, wobei er die aussuchte, die am wenigsten verkohlt waren. Bis sein Vater zurück nach unten kam, saß Ben wieder am Tisch und wischte den Rest Bohnentunke mit einer Toastbrotecke auf.
»Sie isst nie«, sagte er munter zu seinem Vater. »Kann ich noch mehr haben?« Er sprang auf und kratzte die restlichen Bohnen aus dem Topf.
»Nimm einen Holzlöffel«, befahl Matthew streng. »Du zerkratzt den Topf.«
»Ich bin schon fertig.« Ben drehte sich um. »Was hat sie gemeint, Dad?«
»Womit?«
»Mit dir und deiner Freundin. Wovon hat sie geredet?«
»Nichts. Du kennst doch deine Schwester.« Matthew seufzte. »Was macht sie die ganze Zeit da oben allein in ihrem Zimmer?«
»Sie ist im Internet.« Ben verließ die Küche und lief die Treppe nach oben, wobei er jeweils zwei Stufen auf einmal nahm. Matthew blickte ihm nach. Dünn und schlaksig wie er war, erinnerte ihn Ben an sich als Jungen. Sie hatten die gleiche gerade Nase, die gleichen, zu dem schwarzen Haar ungewöhnlichen blauen Augen. Matthew räumte die Teller ab und stellte sie in die Spüle. Abigail konnte abwaschen, wenn sie nach Hause kam, oder, was wahrscheinlicher war, alles bis morgen früh für die Putzkraft stehen lassen.
Matthew schloss die Küchentür, bevor er Charlotte anrief. »Ich bin’s. Ich komme heute Nachmittag vorbei. Du wolltest doch heute nicht mehr weg, oder?«
»Wann bist du da?«
»Bald.«
»Je eher, desto besser.«
Matthew grinste und legte auf. Er warf einen Blick zu den schmutzigen Tellern im Spülbecken, dann ging er nach oben und klopfte an Bens Tür. Keine Reaktion. Er klopfte lauter.
»Ja?«
Matthew betrachtete das Chaos aus Schulbüchern und Kleidung auf dem Fußboden in Bens Zimmer. »Ich gehe noch mal weg.«
»Okay.« Ben wandte sich wieder seinem Computerspiel zu.
»Ich komme erst spät zurück, aber bleib nicht so lange auf«, ergänzte Matthew. Ben hörte nicht hin.
»Hau ab!«, rief Lucy, als Matthew an ihre Tür klopfte.
»Kann ich reinkommen?«
»Bist du taub? Ich habe gesagt, hau ab!«
Vorsichtig öffnete Matthew die Tür. Lucy saß an ihrem Computer und tippte.
»Lucy …«, begann Matthew.
Lucy verkleinerte ihren Bildschirm und drehte sich erbost zu ihm um. »Raus aus meinem Zimmer! Du hast kein Recht, hier ohne Erlaubnis reinzukommen!«
»Ich wollte dir nur Bescheid sagen, dass ich wegfahre.«
»Schön. Und du brauchst auch nicht wiederzukommen.« Sie kehrte ihm den Rücken zu und wartete, dass er verschwand.
Leise schloss Matthew die Tür. Die Verachtung seiner Tochter war nur eine Pubertätserscheinung, sagte er sich. Er wusste nicht genau, wie Lucy das von Charlotte und ihm herausbekommen hatte. Aber richtig schlimm war es nicht; früher oder später hätten die Kinder es ohnehin herausgefunden. Und Matthew war sich sicher, dass es langfristig kein Problem war, denn wenn sie Charlotte erst kennenlernten, würden die beiden sie zweifellos mögen. Am Ende würde sich alles von allein regeln. Jetzt war er auf dem Weg zu ihr, und das Leben war schön. Pfeifend fuhr er vom Haus weg.
Abigail war in den Süden gezogen und hatte die Kinder mitgenommen, was bedeutete, dass Matthew mitziehen musste. Er hatte Charlotte zu erklären versucht, dass er seine Familie nicht so früh auseinanderreißen wollte. Er fühlte sich verantwortlich für die Kinder, deren Mutter quasi nie da war, auch wenn sie jeden Abend nach Hause kam.
Für Charlotte hatte die einzig denkbare Lösung darin bestanden, ihm in den Süden zu folgen. Sie hatte eine Stelle in Faversham gefunden und war dabei davon ausgegangen, dass Abigail einer Scheidung zustimmen würde, nachdem sie sich in ihre neue Stelle eingefunden hatte. »Ist sie erst mit ihrer neuen Schule beschäftigt, wird sie sich keine Gedanken mehr wegen einer Scheidung machen. Sie wird eher froh sein, mich loszuwerden«, hatte er Charlotte versichert. Allerdings war es nicht so gelaufen, wie Matthew geplant hatte. Als Abigail zur Leiterin der Harchester School in Kent ernannt wurde, hatte Matthew für ein Büro von Bauprüfern in York gearbeitet. Mehrere Firmen vor Ort hatten schon wegen des einbrechenden Baugewerbes schließen müssen, und Matthew hatte den Eindruck gehabt, dass seine Kollegen erleichtert gewesen waren, als er nach beinahe zwanzig Jahren kündigte. Ihre Reaktion gab ihm jedenfalls nicht das Gefühl, besonders geschätzt worden zu sein. Es half auch nicht, dass er sich in Faversham mit einer öden Arbeit zufriedengeben musste, bei der er die meiste Zeit des Tages gelangweilt und deprimiert die Zähne zusammenbiss und sich von einer Frau herumkommandieren ließ, die halb so alt war wie er.
Er war nicht der Einzige, der eine Karriere aufgeben musste. Charlotte hatte seinetwegen ihren Beruf als Krankenschwester an den Nagel gehängt. Matthew hatte vorgeschlagen, dass sie sich für eine Versetzung bewarb, doch sie schien die Krankenpflege gern aufzugeben.
»Mir reicht es mit Blut und Gedärm«, hatte sie zu ihm gesagt. »Und ich kann in einer anderen Stelle mehr verdienen.«
Doch nach all dem weigerte Abigail sich nun stur, in die Scheidung einzuwilligen.
»Ich kann es ohne sie nicht tun«, hatte er Charlotte unglücklich erklärt. »Sie hat gedroht, die Kinder gegen mich aufzubringen, und das würde sie. Du kennst meine Frau nicht.«
Charlotte verlor die Geduld. »Sag ihr, dass du darauf bestehst. Tu es einfach, Matthew. Geh zu einem Anwalt und lass die Papiere aufsetzen. Sie kann dich nicht zwingen, bei ihr zu bleiben.«
Charlotte überlegte, ob sie Matthew erzählen sollte, dass sie einen weiteren Brief von Ted bekommen hatte, den dritten diese Woche. Mit dem Umzug nach Kent hatte sie geglaubt, ihn endgültig los zu sein, aber er gab nach wie vor nicht auf.
»Du kannst nicht wegziehen«, hatte er gesagt, als sie ihm von ihrem Umzug erzählt hatte. »Du gehörst hierher, zu mir.«
»Ted, wir sind einmal kurz zusammen gewesen, als wir noch in der Schule waren. Das ist Jahre her. Zwischen uns läuft nichts. Das tat es nie und wird es nie tun. Komm darüber hinweg.« Als sie seinen gequälten Gesichtsausdruck gesehen hatte, war sie weich geworden. »Wir können immer noch Freunde sein. Wir müssen uns deswegen nicht zerstreiten.«
»Du gehst mit ihm weg, stimmt’s?«
»Er hat nichts damit zu tun«, hatte sie gelogen und war wieder genervt gewesen. »Lass mich in Ruhe, Ted. Mein Leben geht dich nichts an.«
Danach hatten sie sich nicht mehr gesprochen, doch eine Woche später fing es mit den Briefen an. Sie wären Charlotte unheimlich gewesen, hätte sie Ted nicht so gut gekannt. Der arme, dumme Ted war ein Softie und konnte keiner Fliege etwas tun. Sie fasste es bis heute nicht, warum sie jemals zugestimmt hatte, mit ihm zu gehen. Mit seiner Hartnäckigkeit hatte er sie damals rumbekommen, und mit fünfzehn hatte sie sich auch noch blöd geschmeichelt gefühlt.
»Er muss dich wirklich mögen«, hatte eine ihrer Schulfreundinnen gesagt.
»Er ist ein Schwachkopf«, hatte jemand anderes hinzugefügt.
Lange hatte es nicht gehalten, und es war nie eine richtige Beziehung gewesen. Bloß ein paar feuchte Küsse und eine hektische Fummelei auf einer Parkbank. Ted war verzweifelt gewesen, als Charlotte es beendet hatte, und es hatte reichlich Gerede darüber an der Schule gegeben. Aber Charlottes Freundinnen waren sich einig gewesen, dass sie hart bleiben musste.
»Es wird nur schwerer, wenn du es weitermachst.«
»Sag ihm einfach klipp und klar, dass du nicht mit ihm zusammen sein willst.«
»Er kommt drüber weg.«
Aber Ted war nicht darüber weggekommen. »Ich warte auf dich«, hatte er gesagt.
»Da kannst du lange warten.« Sie hatte gelacht, weil er so verbissen war, dann aber eingelenkt und versucht, nett zu sein. »Du findest eine andere.«
»Ich will keine andere.«
Charlotte blickte in den Dielenspiegel, als sie daran vorbeikam. Mit ihren blonden Locken und der Stupsnase sah sie jünger als dreiunddreißig aus, und Matt, der zwölf Jahre älter war und Kinder hatte, verstand nicht, dass sie bald klare Verhältnisse brauchte. Viele ihrer Freundinnen waren längst Mütter.
»Werde doch schwanger. Dann muss er was tun«, hatte eine ihrer Freundinnen vorgeschlagen.
»Vielleicht endest du dann aber als alleinerziehende Mutter«, hatte eine andere eingeworfen.
Charlotte bemühte sich weiter nach Kräften, Matthew dazu zu bewegen, endlich seine Frau zu verlassen. »Du bist unglücklich bei ihr. Ich mache dich glücklich. Und das verdienst du nach allem, was sie dir zugemutet hat.«
Sie war klug genug, das Thema Kinder auszuklammern. Matthew hatte ihr bereits gesagt, dass er keine zweite Familie wollte. Aber Charlotte vertraute darauf, dass alles gut werden würde, wenn sie erst mal verheiratet waren. Nur musste er vorher Abigail verlassen. Sie verdarb alles.
Charlotte öffnete die Tür. Matthew kam in die Wohnung gestürmt, hob Charlotte hoch und wirbelte sie herum. Sie lachte laut auf, und vor lauter Freude, Matthew wiederzusehen, vergaß sie Ted und dessen Jammerbriefe.
»Hat Abigail eingewilligt?« Sie erkannte die Antwort an seinem Gesicht und den sackenden Schultern.
»Keine Sorge«, antwortete Matthew. Sein Lächeln wirkte angestrengt. »Wir sind sie bald für immer los. Versprochen.« Dieses Versprechen hörte Charlotte seit Jahren. Matthew küsste sie und drückte sie an die Wand. »Es ist kalt da draußen«, raunte er. »Wie willst du mich aufwärmen?«
»Ich kann dir eine schöne Tasse Tee machen«, schlug sie lachend vor, als er ihre Hand nahm und sie ins Schlafzimmer führte.
3Die Entdeckung
Der Drachen war eine von Dave Whittakers frühesten Erinnerungen. Sein Vater hatte ihn ihm geschenkt, als Dave ungefähr acht Jahre alt war. Sie mussten in den Ferien gewesen sein, denn Dave erinnerte sich, dass er den Drachen am Strand hatte steigen lassen. Nie hatte er seinen Vater glücklicher erlebt.
Jetzt fühlte er ein wohliges Kribbeln, als er beobachtete, wie sein eigener Sohn die Plastikverpackung eines neuen Drachen aufriss. Das sogenannte Naherholungsgebiet war nicht ideal, weil die große Grünfläche von hohen Bäumen umstanden war. Doch es war die nächstgelegene offene Fläche von ihrem Zuhause aus, und sie konnten es beide nicht erwarten, den Drachen auszuprobieren.
Zac hielt ihn so weit hoch, wie er konnte, während Dave rückwärts lief und die Schnur abwickelte. »Jetzt!«, rief Dave. »Lass los!« Zac schleuderte den roten Rhombus in die Luft und stöhnte, als er sofort zu Boden fiel.
»Was ist los, Dad? Wieso fliegt der nicht?«
Bei dritten Versuch fing eine Windböe den Drachen ein. Zac quiekte entzückt, als der Drachen flatternd in die Luft aufstieg.
»Nicht zu nahe an die Bäume«, warnte Dave ihn, als er ihm die Leine übergab.
»Schon gut, Dad. Ich bin nicht blöd.«
Ein Windstoß packte den Drachen. Er flog auf und sauste wild hin und her, während Zac schreiend hinterherrannte.
»Steh still und lass mehr Schnur los«, rief Dave ihm zu. »Gib ihm mehr Schnur!«
Zac fiel hin, und die Spule rutschte ihm aus den Händen. Der Drachen stieg weiter auf und wurde zu einer immer kleineren roten Raute am grauen Himmel. Sie sahen zu, wie er für einen Moment sehr hoch stieg, ehe er elegant nach unten in Richtung Äste schwebte.
»Dad! Mach was!«
Dave begann, auf den fallenden Drachen zuzulaufen. Er verschwand zwischen den Bäumen. »Dad!«, schrie Zac.
»Warte hier«, rief Dave. »Ich hole ihn.« Fluchend zwängte er sich zwischen den Bäumen durch. Das Unterholz zerkratzte ihm die Beine, und er stolperte auf dem unebenen Boden. Doch hier schien eine Art Trampelpfad zu sein. Jemand war schon vor ihm hier gewesen und hatte zu beiden Seiten überstehende Zweige abgeknickt. Dave gelangte zu einer kleinen Lichtung und blieb abrupt stehen. Am Fuß eines Baumes lag eine Frau flach auf dem Rücken.
Dave zögerte. »Alles in Ordnung mit Ihnen?« Er trat einen Schritt näher und erstarrte. Ihre Augen waren weit offen und blickten blind nach oben. Unterhalb ihrer Nase, wo ihr Mund und ihr Kinn sein sollten, war eine feuchte schwarze Masse zu sehen. Dave starrte ihre leeren Augen an und konnte sich nicht rühren. Eine leichte Brise brachte bisher nicht gefallenes Laub zum Rascheln. Abgesehen davon war alles still.
Dave hielt den Atem an und betrachtete die Tote. In ihrem zerzausten Haar hingen verwesende Blätter, und es sah feucht aus. Ihre Jacke war schwarz gefleckt von getrocknetem Blut. Während er angewidert ihr Gesicht betrachtete, fragte sich Dave, wie lange sie hier schon liegen mochte, dem Wetter ausgesetzt. Zuerst glaubte er, ihr Kinn wäre von einem Wildtier abgebissen worden, doch bei näherem Hinsehen erkannte er, dass ihr Gesicht noch intakt war, aber blutig.
Er wandte den Blick ab und holte sein Handy hervor. »Polizei? Hallo, ich habe einen Körper gefunden. Einen toten Körper.« Das Telefon zitterte in seiner Hand. Seine Zähne klapperten so heftig, dass er kaum sprechen konnte. Er dachte, dass er sich übergeben müsste, schluckte angestrengt und konzentrierte sich.
»Sagen Sie mir Ihren Namen, Sir?« Die ruhige Stimme half Dave zu denken. Er sprach langsam und mit Bedacht. »Ich bin in dem Waldstück beim Naherholungsgebiet. Ich gehe jetzt zurück und warte an der Baumgrenze, damit ich Ihnen zeigen kann, wo sie – es – sie – ist.«
Er hatte das entsetzliche Gefühl, dass er nicht allein war, dass er beobachtet wurde. Panisch rannte er zwischen den Bäumen hindurch zurück und rief nach Zac. Ihm war schwindlig vor Erleichterung, als er seinen Sohn von der freien Fläche her antworten hörte.
Zac kam ihm entgegengelaufen. »Dad! Dad! Hast du ihn gefunden, Dad?«
Dave runzelte die Stirn und blinzelte im Sonnenlicht. Sekundenlang wusste Dave nicht, wovon Zac redete. Dann erinnerte er sich wieder an den Drachen und schüttelte den Kopf.
»Oh mein Gott, Zac«, sagte er. »Mein Gott.«
»Dad …« Zac fing an zu heulen. Dann sah er zu seinem Vater auf, und seine Miene veränderte sich. »Ist schon gut, Dad. Das ist nicht so schlimm. Wir können einen neuen Drachen kaufen. Es macht nichts, Dad.«
Dave legte eine Hand auf Zacs Schulter. »Du musst jetzt sehr vernünftig sein, Zac, und auf mich hören, ja? Ich möchte, dass du zum Wagen gehst und darin wartest. Es … ist etwas passiert, mein Junge. Die Polizei wird bald hier sein. Vielleicht auch ein Krankenwagen …« Er stockte.
»Die Polizei?«, platzte Zac heraus, und seine Augen leuchteten. »Die kommen hierher? Woher weißt du das, Dad?«
»Ich weiß es, weil ich sie gerufen habe. Sie müssen sich – etwas ansehen, das ich im Wald gefunden habe. Jetzt gehen wir zum Wagen, und ich setze dich rein, damit du auf mich wartest. Ich muss der Polizei nur – etwas zeigen, und dann fahren wir nach Hause.«
Zac hüpfte auf und ab. »Was denn? Was ist passiert? Warum kommt die Polizei? Warum, Dad?«
Dave sah seinen Sohn an und traf eine Entscheidung. Er hockte sich hin, um mit Zac auf Augenhöhe zu sein. »Du erinnerst dich doch an Grandad …«, begann er und hielt wieder inne. Er wollte seinem Sohn keine Angst einjagen.
Zac unterbrach ihn. »Ist es ein Toter, Dad? Hast du einen Toten im Wald gefunden?«
Dave nickte ernst. »Die Polizei wird bald hier sein«, sagte er. »Und dann können wir nach Hause und vergessen …«
»Das ist ja so cool!«, rief Zac. »Wer ist es, Dad? Kann ich den sehen, Dad, kann ich? Das ist irre, Dad. Wenn ich das in der Schule erzähle! Hast du ein Foto gemacht? Bitte, sag mir, dass du ein Foto gemacht hast!«
4Das Team
Celia lächelte. »Es tut richtig gut, dich ausnahmsweise mal so entspannt zu sehen. Ich mache mir nämlich oft Sorgen um dich.« Geraldine antwortete nicht. Sie wusste genau, was ihre Schwester meinte. Seit fast einem Jahr tat Celia sich schwer damit, den plötzlichen Tod ihrer Mutter zu verkraften. Anders als Geraldine war Celia ihrer Mutter sehr nahe gewesen. Und jetzt wollte sie, dass Geraldine die Lücke ausfüllte, die der Verlust ihrer Mutter hinterlassen hatte. Doch als Detective Inspector in der Mordermittlung hatte Geraldine nur sehr begrenzt freie Zeit.
»Ich verstehe wirklich nicht, warum du so viel arbeiten musst«, sagte Celia. »Man könnte fast glauben, du willst uns nicht sehen. Manchmal kommt es mir vor, als würde ich dich eigentlich gar nicht kennen. Es ist wirklich nicht leicht, ein enges Verhältnis zu dir zu haben, so viel wie du dich zurückziehst. Chloe wird furchtbar schnell groß, und ich weiß, dass sie dich gern öfter sehen würde. Sie vermisst Mum auch, weißt du? Es dauert nicht mehr lange, dann ist sie ein Teenager, und dann wird es zu spät sein und sie nichts mehr davon wissen wollen.«
Geraldine war geradezu froh, als ihr Diensthandy läutete und die Vorwürfe ihrer Schwester unterbrach. Sie war schon auf den Beinen, ehe das Gespräch endete. »Tut mir leid, Celia. Ich muss weg.«
»Du bist doch eben erst gekommen! Trink wenigstens deinen Tee aus, bevor du gehst!«, entgegnete Celia. »Kannst du nicht noch warten und kurz Chloe Hallo sagen? Sie muss gleich zurück sein, und sie ist garantiert enttäuscht, wenn sie dich verpasst.«
Geraldine lächelte reumütig. »Ich kann wirklich nicht warten. Richte ihr aus, dass es mir leidtut.«
»Der bewegte Alltag eines Detective Inspector bei der Mordermittlung.« Celia lächelte, doch sie klang verbittert. »Es ist immer dasselbe mit dir, nicht? Deine Familie ist egal. Was wir wollen, interessiert nicht. Die Arbeit kommt immer zuerst, nicht wahr, weil wir ohne dich alle Gefahr laufen würden, im trauten Schlummer umgebracht zu werden. Und was soll ich jetzt Chloe erzählen?«
»Ich mache es wieder gut, versprochen.«
»Tja, das solltest du auch besser. Sie wird nämlich sehr enttäuscht sein. Sie hatte damit gerechnet, dich zu sehen. Aber keine Bange, wir sind es ja schon gewohnt.«
Geraldine wurde ein bisschen gereizt. »Ich komme euch wieder besuchen, sobald ich kann«, versprach sie, während sie eilig aufbrach.
Sie bräuchte ungefähr eine halbe Stunde bis zum Revier in Barton Chislet, von wo aus die Ermittlungen koordiniert werden sollten. Bei jeder Ermittlung waren die ersten Stunden entscheidend, ehe irgendwelche Spuren kontaminiert werden konnten. Das galt ganz besonders bei Leichenfunden im Freien. Noch wusste Geraldine nicht, wie lange die Leiche draußen gelegen hatte, bevor die Spurensicherung ein Schutzzelt an der Fundstelle errichtet hatte.
Schnell fuhr sie durch den steten Nieselregen und kam zehn Minuten vor der ersten Lagebesprechung auf dem Revier an. Dort lief sie zunächst zu den Toiletten und bemühte sich, ihr krauses dunkles Haar ein wenig zu glätten. Ihre Augen leuchteten frisch über der leicht gekrümmten Nase, die ihr Aussehen verdarb.
»Leider können wir Ihnen kein eigenes Büro geben. Wir sind nur eine kleine Dienststelle«, entschuldigte sich die Diensthabende.
»Kein Problem.« Tatsächlich zog Geraldine es vor, mitten im Getümmel zu arbeiten anstatt in der Stille eines eigenen Büros.
»Das ist Ihr Arbeitsplatz«, sagte die Polizistin und nickte zu einem Schreibtisch hinten in der Ecke. Geraldine bedankte sich bei ihr und setzte sich an ihren Platz. Als sie sich im Raum umblickte, entdeckte sie zu ihrer Freude Detective Sergeant Ian Peterson. Sie schaltete ihren Computer ein und hatte sich gerade eingeloggt, als er sie unterbrach. Geraldine mochte und vertraute Ian Peterson, der sich eindeutig freute, wieder mit ihr zu arbeiten. Sie hatten schon bei den letzten zwei Ermittlungen zusammengearbeitet und sich gelegentlich zwischen den Fällen auf einen Drink getroffen.
»Morgen, Chefin.«
»Hallo Ian. Wie geht’s?«
Er nickte zufrieden. »Kann nicht klagen. Also, was wissen wir?«
Geraldine blickte auf. »Schwer zu sagen …«
Ehe sie weitersprechen konnte, betrat Detective Chief Inspector Kathryn Gordon den Raum. Alle verstummten und schauten nach vorn zur Falltafel, neben der sie stehen blieb und wartete, bis Ruhe herrschte. Geraldine wechselte einen kurzen Blick mit Ian Peterson. Bei ihrem letzten Fall hatten sie ebenfalls mit Kathryn Gordon gearbeitet. Anfangs hatte Geraldine sie Furcht einflößend gefunden, ihre strikte Arbeitshaltung jedoch nach und nach schätzen gelernt.
Mit Kathryn Gordon als Leiterin würde dies hier keine entspannte Ermittlung werden, und sie kam auch prompt zur Sache. »Ich bin Ihre leitende Ermittlerin, DCI Kathryn Gordon. Die Leiche einer achtundvierzigjährigen Frau, Abigail Kirby, wurde heute Vormittag um zehn Uhr dreißig bei einem Naherholungsgebiet, bekannt als The Meadows, drei Kilometer nördlich vom Stadtzentrum gefunden.« Sie drehte sich zu einem Foto an der Tafel um. Braune Augen lächelten ihnen aus einem Gesicht mit kantigem Kinn entgegen. Es sah aus wie eine Profiaufnahme von einer relativ attraktiven, makellos gestylten Frau, die eben aus einem Friseursalon kam. Unwillkürlich hob Geraldine eine Hand und strich sich über ihr widerspenstiges Haar.
Kathryn Gordons Hand zitterte, als sie auf das Bild zeigte, obwohl sie vollkommen ruhig sprach. Dann blickte sie von der Tafel in ihre Notizen. »Die Tote wurde von einem Anwohner entdeckt, David Whittaker, als er mit seinem kleinen Sohn einen Drachen steigen ließ. Der Drachen war zu den Bäumen abgetrieben, und als Mr. Whittaker ihn suchen ging, fand er stattdessen Abigail Kirby.« Sie zeigte auf eine Karte von der Grünanlage. Zur einen Seite des offenen Bereichs war eine Stelle rot eingekreist. »Der Gerichtsmediziner müsste jeden Moment vor Ort sein, also wissen wir bald mehr. Das Opfer wirkt kräftig, und es gibt keine Anzeichen für einen Kampf. Kannte sie ihren Angreifer, oder wurde sie überrascht? Und was wollte sie dort? Die abgelegene Stelle legt nahe, dass sie sich mit jemandem getroffen hat.«
»Wissen wir, ob sie dort umgebracht wurde? Oder könnte sie auch woanders umgebracht worden sein und die Leiche dann da abgelegt?«, fragte jemand.
»Wie ist sie gestorben?«, wollte ein anderer Officer wissen.
»Bisher wissen wir keine Einzelheiten. Wir müssen hin und es uns ansehen. Wie gesagt, der forensische Gerichtsmediziner müsste demnächst vor Ort sein.«
»Der Wald um die große Grünfläche herum wird wenig genutzt, erst recht in dieser Jahreszeit«, warf ein örtlicher Sergeant ein. »Da werden wir eher keine Zeugen finden.«
»Trotzdem könnte sie jemand gesehen haben«, antwortete Kathryn Gordon. »Kommt ganz darauf an, wann sie dort ankam – und ob sie zu dem Zeitpunkt noch lebte. Je mehr Leute in der Gegend waren, umso größer ist die Chance, dass jemand sie und denjenigen gesehen hat, der bei ihr war. Aber es kann auch sein, dass sie nachts hingebracht wurde. Es könnte sein, dass sie woanders umgebracht und im Schutz der Dunkelheit dort abgelegt wurde. Also«, fuhr sie auf einmal brüsker fort, »genug spekuliert. Sehen wir uns an, was uns die Spurensicherer verraten können, und dann bringen wir alles über Abigail Kirby in Erfahrung, was wir können.«
»Oh mein Gott, das ist Mrs. Kirby!«, rief plötzlich ein junger weiblicher Constable.
»Was wissen Sie über Abigail Kirby?«, fragte Kathryn Gordon.
»Mein Sohn geht auf die Harchester School. Mrs. Kirby ist – war – dort die Schulleiterin.«
»Jetzt nicht mehr«, murmelte jemand.
»Was wissen Sie über sie?«, wiederholte der Detective Chief Inspector.
»Nicht viel, Ma’am. Ich habe sie nie persönlich kennengelernt. Nur einmal war ich dabei, als sie zu allen Eltern gesprochen hat. Mein Sohn ist erst seit September auf der Schule.«
»Gut. War sie beliebt? Was hatte sie für einen Ruf?«
Der Constable zuckte verlegen mit den Schultern. »Das kann ich wirklich nicht sagen, Ma’am. Wie gesagt, mein Sohn ist noch neu an der Schule.«
»Sehen Sie mal, was Sie herausbekommen können. Was wird auf dem Pausenhof oder am Schultor geredet?«
»Ich habe nie irgendwas gehört, Ma’am, außer …«
»Ja?«
»Es hieß, dass sie sehr streng ist. Mein Sohn hatte Angst vor ihr.« Sie lachte unsicher.
»Sie war die Direktorin«, sagte Kathryn Gordon, als sei es für sie selbstverständlich, dass Autoritätspersonen gefürchtet wurden. »Falls Sie die Namen von irgendwelchen Klatschmäulern unter den Eltern und den Lehrern in Erfahrung bringen könnten, wäre das hilfreich. Ich lasse alle von jemand anderem befragen, damit Sie möglichst rausgehalten werden.«
»Danke, Ma’am.«
DCI Gordon wandte sich wieder der Tafel zu und tippte mit einem Finger auf das Bild des Opfers. »Wir müssten noch heute den Autopsiebericht bekommen. Wir kennen den Namen des Opfers, Abigail Kirby, und wir wissen, dass sie Direktorin an der Harchester School war. Bis wir mehr wissen, ziehen wir keine voreiligen Schlüsse. In der Zwischenzeit müssen wir anfangen, Informationen zusammenzutragen. Lassen Sie sich von der Diensthabenden Ihre Dienstpläne geben und fangen Sie an. Legen wir los, damit wir diesen Fall schnell aufgeklärt haben.«
5Der Schauplatz
Geraldine und Ian unterhielten sich angeregt, als sie an einem modernen Einkaufszentrum vorbei und aus der Stadt hinausfuhren.
»Wie geht es Bev?«
»Ganz super.«
Geraldine seufzte. Irgendwie hielten ihre eigenen Beziehungen nie. Sie beneidete den Sergeant, der es besser getroffen zu haben schien. »Wie lange sind Sie beide inzwischen zusammen?«
Peterson zuckte mit den Schultern. »Kommt mir ewig vor.«
Sie parkten am Rand des Naherholungsgebiets, tauchten unter dem Absperrband hindurch und holten sich Schutzanzüge und Überschuhe hinten aus dem Van der Spurensicherung. Dann gingen sie, um nichts zu verfälschen, vorsichtig hintereinander den Trampelpfad entlang in das Waldstück. Immer wieder mussten sie sich unter herabhängenden Zweigen ducken. Am Rande einer kleinen Lichtung war ein Schutzzelt aufgestellt worden. Weiß gewandete Kriminaltechniker waren damit beschäftigt, Fotos zu machen und Fußspuren, aufgeschürfte Stellen in der Erde und alle anderen Auffälligkeiten am Boden und im Unterholz zu erfassen. Der gesamte Bereich um den Fundort der Leiche wurde selbst nach mikroskopisch kleinen Spuren gründlich abgesucht. Leider trugen heutzutage selbst schlampige Mörder Handschuhe.
Ein eleganter brauner Lederschuh lag seitlich am Rand des Schutzzelts. Er passte eher in das Schaufenster eines teuren Schuhgeschäfts. Die hell erleuchtete Szene in dem Zelt mutete wie ein Filmset an. Sogar die Leiche auf dem Boden sah wie eine Requisite aus. Sie lag neben einem Baumstamm, die Beine ausgestreckt und das Kinn bedeckt von getrocknetem Blut. Der von kurzen, hellbraun-grau melierten Locken umrahmte Kopf war nach hinten gestreckt. Ihre braunen Augen blickten leer zu ihnen auf, und nur Zentimeter daneben lag ein Kothaufen von einem Tier. Die Frau trug einen braunen Rock mit winzigen orangen Tupfen und eine passende Jacke, die über und über mit Blut bespritzt war. Doch auch wenn alles feucht, zerknüllt und schmutzig war, erkannte man, dass es sich um ein teures Kostüm handelte.
Geraldine blickte nach unten, und ihr Adrenalinpegel stieg. Es würde Fotos, Berichte und Aussagen geben, aber dies war die einzige Chance, das Opfer am Tatort zu sehen. Sie hockte sich hin und betrachtete den blutigen Kopf der Toten.
»Wahrscheinlich wurde sie woanders umgebracht und hier abgelegt«, sagte einer der Kriminaltechniker. »Ein mieser Platz, um hier zu enden, was?«
»Hatte sie eine Handtasche bei sich?«, fragte Geraldine. Der Kriminaltechniker schüttelte den Kopf. Geraldine richtete sich wieder auf. »Was haben Sie in ihren Taschen gefunden?«
»Ein Schlüsselbund, eine Quittung für einen Kaffee, den sie um zwanzig nach zehn in einem Café im Einkaufszentrum gekauft hat, ein Foto von zwei Kindern und fünfzehn Pence Wechselgeld.« Er reichte ihr die Beweismitteltüte.
»Also haben wir den Ort und die Uhrzeit, wo sie morgens war«, sagte Geraldine. Sie sah sich das Bild von einem Jungen und einem Mädchen an – vermutlich die Kinder des Opfers. Der Junge musste ungefähr zwölf sein, das Mädchen wenige Jahre älter. Sie hatte die haselnussbraunen Augen ihrer Mutter und hellbraunes Haar, während der Junge schwarzhaarig war und blaue Augen hatte.
Geraldine steckte das Foto sorgfältig in die Tüte zurück und schaute sich um.
Der SOCO sah, in welche Richtung sie blickte. »Es gibt sonst nirgends Spuren von einem Kampf.«
»Sie glauben nicht, dass sie hier gestorben ist?«, fragte Geraldine und nickte zur Leiche.
»Hier sind keine Hinweise auf der Erde zu finden. Ich schätze, dass sie schon tot war, als sie hergebracht wurde.«
»Also wissen wir nicht, wo sie ermordet wurde«, sagte Peterson.
»Es ist schwierig«, erwiderte der Spurensicherer. »Es gibt keine Anzeichen für einen Kampf, aber der Fundort wurde kontaminiert. Es sieht aus, als sei sie entweder bewusstlos oder tot über den Boden geschleift worden, wodurch die Fußspuren des Täters verwischt wurden.« Er wies auf die Furchen und die flachen Spuren im Matsch. »Wir haben nicht viel Blut auf dem Boden gefunden, also wurde sie wahrscheinlich getötet, ehe man sie hergebracht hat. Andererseits hat es die Nacht geregnet, folglich könnte das Blut auch weggespült worden sein. Wir überprüfen jeden Zentimeter des Pfades, aber der Mann, der uns die Leiche gemeldet hat, ist hier überall rumgetrampelt. Es sieht aus, als wäre er hin und her gelaufen, während er telefoniert hat. Schade, dass er an der Stelle war, bevor wir eine Chance hatten, sie zu untersuchen. Obwohl wir wohl dankbar sein sollten, dass er sie gefunden hat. Sie war bereits über Nacht hier.« Er zuckte mit den Schultern. »Und hier wimmelt es von Tierkot.«
»Gibt es irgendwelche Abwehrverletzungen?«
Der Kriminaltechniker schüttelte den Kopf. »Keine offensichtlichen, aber der Gerichtsmediziner müsste bald hier sein, dann sieht er sie sich an. Ah, anscheinend ist er das schon.«
Ein großer, schlanker Mann betrat das Zelt und richtete sich auf. Er näherte sich der Leiche mit einer Aura von Autorität und kniete sich neben sie, sodass sie von ihm abgeschirmt war.
Geraldine beobachtete seine geschmeidigen Bewegungen. »Ich glaube, wir kennen uns noch nicht.«
Der Mann wandte den Kopf zu ihr. Leuchtend blaue Augen blickten ihr aus einem schmalen Gesicht entgegen. »Dr. Paul Hilliard.« Sein Gesichtsausdruck wirkte offen und ernst, und er sprach mit einer tiefen, kultivierten Stimme. »Leiten Sie hier die Ermittlung?«
»Ja. Ich bin Detective Inspector Geraldine Steel. Und dies ist Detective Sergeant Ian Peterson.«
Paul Hilliard nickte. »Freut mich, auch wenn die Umstände bedauerlich sind.« Er wandte sich wieder der Leiche zu.
Geraldine trat einen Schritt vor. »Was können Sie uns sagen?«
»Lassen Sie mir eine Minute.« Geraldine betrachtete seinen Rücken. Während er arbeitete, war er vollkommen still. Sein Haar war dunkel, beinahe schwarz, doch im grellen Scheinwerferlicht waren einzelne graue Strähnen zu erkennen. Nach einer kurzen Weile blickte er sich um. »Ich kann natürlich bestätigen, dass sie tot ist. Es hat die Nacht über geregnet, aber der Boden unter ihr ist ziemlich trocken, was nahelegt, dass die Leiche über Nacht hier gelegen hat. Die Witterungsbedingungen machen es unmöglich, einen genauen Todeszeitpunkt zu bestimmen, doch es muss irgendwann gestern Nachmittag gewesen sein.«
»Wie ist sie gestorben?«
Der Pathologe sah wieder zu Geraldine auf. »Da kann ich Ihnen nach der Autopsie Genaueres sagen, doch anscheinend ist die Todesursache«, er machte eine Pause, »Blutverlust.«
»Blutverlust aufgrund der Kopfverletzung?«
Der kniende Arzt sah ihr weiter in die Augen. »Ja«, sagte er schulterzuckend. »In gewisser Weise.«
»Und das erklärt das viele Blut auf ihrer Kleidung?«
»Ja.«
»Vermutlich lässt es sich jetzt noch nicht mit Sicherheit sagen, aber glauben Sie, dass wir es mit einem Mord zu tun haben? Bis wir nicht den endgültigen Autopsiebericht haben, nehme ich an, dass wir nicht sicher sagen können, ob es kein Unfall war.«
»Sie könnte hingefallen sein und sich den Kopf aufgeschlagen haben«, ergänzte Peterson.
Paul Hilliard schüttelte den Kopf. »Ein Unfall kommt nicht infrage. Schon allein deshalb nicht, weil die Leiche bewegt wurde. Sie wurde nicht hier getötet.«
»Sind Sie sicher?«, fragte Peterson.
»Ja. Es wäre sehr viel mehr Blut auf dem Unterholz hier, denn bevor sie starb, wurde ihr die Zunge herausgeschnitten, sodass nur noch ein Stumpf übrig geblieben ist. Das hätte enorm geblutet.«
»Wie bitte?«
»Das Opfer hat keine Zunge, Inspector.«
6Im Chatroom
Lucy knallte ihre Tür zu. Sie wünschte, sie könnte ihr Zimmer abschließen. Es machte sie krank, dass ihre Eltern glaubten, sie hätten das Recht, einfach unangekündigt in ihr Zimmer zu kommen, wann immer ihnen danach war.
»Sei nicht albern, du bist da oben doch alleine«, hatte ihr Vater geantwortet, als sie ihn darauf hingewiesen hatte, dass sie zum Beispiel gerade eine private Unterhaltung führen könnte.
»Warum lädst du nicht mal eines der Mädchen aus deiner neuen Schule hierher ein?«, hatte ihre Mutter vorgeschlagen. Sie hatte damit zu helfen versucht, machte aber alles nur noch schlimmer. Lucy hatte nicht geantwortet. Ihre Eltern verstanden überhaupt nicht, worum es ging. Die verstanden gar nichts. Lucy konnte nicht einfach irgendwelche Mädchen zu sich nach Hause einladen. Und selbst wenn sie es täte, würde niemand kommen. Die anderen Mädchen waren alle seit Jahren miteinander befreundet, und es war von dem Tag an, an dem Lucy das erste Mal den Klassenraum in der Harchester School betrat, klar, dass sie in keiner der Cliquen willkommen war. Sie alle taten nichts anderes, als über Jungs zu reden oder sich über andere Mädchen auszulassen.
Lucy kannte keine von ihnen und wollte sie auch nicht kennenlernen. Sie war froh, dass sie von ihnen ausgeschlossen wurde. Sie hasste ihre neue Schule, und sie wollte sich gar nicht mit diesen blöden Schlampen verstehen. Die Jungs waren noch schlimmer. Während die Mädchen Lucy ignorierten, waren die Jungen offen feindselig. Sie nannten sie »Blindschleiche«, »Knochengestell« und noch weit Verletzenderes, und sie machten sich über ihren nordenglischen Akzent lustig. Lucy mochte keinen von ihnen und würde nicht mal mit ihnen befreundet sein wollen, wenn sie darum bettelten.
Richtig beliebt war Lucy nie gewesen, aber in York hatte sie wenigstens Freunde gehabt. Die waren nicht cool oder schlau gewesen, doch sie waren ihre Freunde. Sie hatte sogar eine beste Freundin gehabt, Nina, die manchmal nach der Schule mit zu ihr nach Hause gekommen war. Und Lucys Eltern hatten eingesehen, dass sie anklopfen sollten, bevor sie in ihr Zimmer kamen, wenn Nina da war.
»Bei allen anderen klopfen die Eltern vorher an«, hatte sie zu ihnen gesagt, und ausnahmsweise hatten sie ihr zugehört.
Lucy war entsetzt gewesen, als sie erfuhr, dass sie wegziehen würden. Ben hingegen, der reichlich Freunde gehabt hatte, schien das überhaupt nicht tragisch zu finden. Er musste ja nichts weiter tun, als in eine bescheuerte Fußballmannschaft zu gehen, und schon würden täglich Jungs kommen, um mit ihm einen Ball durch die Gegend zu kicken. Für Lucy war es sehr viel schwerer, neu anzufangen und sich Mühe zu geben, mit Fremden ins Gespräch zu kommen und so zu tun, als würde sie sich für deren Teenagerleben interessieren. Zuerst hat sie sich schlichtweg geweigert, mit der Familie nach Kent zu ziehen. Aber es hatte nichts genützt. Ihre Mutter hatte die Stelle als Schuldirektorin angenommen, ihr Vater hatte sich auf Arbeitssuche begeben, ihr Haus wurde zum Verkauf angeboten und das Umzugsdatum festgesetzt. Lucys Eltern zerstörten ihr Leben, und es war ihnen egal.
»Wir haben das besprochen«, hatte ihre Mutter gesagt.
»Ich habe nie zugestimmt!«, hatte Lucy zurückgebrüllt. »Aber ich darf ja auch nicht mitentscheiden, oder? Es ist ja nur mein Leben, das zerstört wird, sonst nichts. Du bestimmst, was du willst, und wir müssen alle mitmachen wie beknackte Möbelstücke.«
»Sei nicht albern«, war ihr Vater dazwischengegangen. Das schien das Einzige zu sein, was er überhaupt noch zu Lucy sagte. »Deine Mutter muss an ihre Karriere denken.« Er hatte ziemlich sauer geklungen.
Lucys Mutter hatte daraufhin ihn angesehen. »Fang jetzt nicht damit an, Matthew. Das haben wir oft genug durchgekaut.«
Dann war Lucy gegangen.
Es war ihr ein kleiner Trost, dass Nina in Tränen ausgebrochen war. »Du darfst mich nicht verlassen«, hatte sie geheult. Sie hatten einander versprochen, in Kontakt zu bleiben, was über Facebook leicht war. Doch nach Lucys Umzug veränderte sich alles, und nach einigen Wochen hatte Nina aufgehört, ihre Nachrichten zu beantworten.
»Du musst dich bemühen, neue Freunde zu finden«, sagte ihre Mutter zu ihr. »So etwas braucht Zeit, und es passiert nicht von selbst. Du hast bald raus, wie es geht. Der erste Kontakt ist der schwerste.«
»Ich habe Freunde«, antwortete Lucy. »Lass mich in Ruhe mit deinen blöden Sprüchen!«
Lucy konnte nicht schlafen. Ihre Mutter hätte eigentlich schon zetern müssen, dass sie aufhören sollte, online zu chatten, und »etwas Sinnvolles« machen, aber ihre Mutter war nicht zu Hause, und ihr Vater war nicht so dumm, sich einzumischen. Er hatte sie allein gelassen, und das passte Lucy sehr gut. Sie mochte es am liebsten, wenn er wegfuhr. Sie war vierzehn, alt genug, um mit ihrem zwölfjährigen Bruder allein zu Hause zu bleiben. Sie brauchte keine Eltern, die sich in ihr Leben einmischten. Dauernd sagten sie ihr, was sie machen sollte. Als hätten sie einen Schimmer davon, was gut für sie war. Wenigstens hörte ihre Mutter zu, wenn Lucy etwas sagte. Ihr Vater könnte genauso gut ein völlig Fremder sein, und das wäre Lucy sogar lieber.
Sie loggte sich in den Twilight-Chatroom ein und starrte minutenlang auf den Bildschirm, bevor sie tippte: »Meine Eltern machen mich wahnsinnig.«
Bunny antwortete sofort: »Eltern sind zum Kotzen.« Mehrere andere kamen hinzu, beleidigten ihre Eltern und rissen erbärmliche Witze.
»LOL. Die können gar nicht so schlimm sein wie meine«, tippte Lucy. Es vertrieb ihr zumindest die Zeit.
Der Chat schwenkte auf die Schule. »Jeder hasst die Schule. Warum müssen wir da eigentlich hin?«, fragte Bunny.
»Zeitverschwendung«, stimmte Lucy zu.
»Folter?«
»Mist!«, schrieb jemand anders.
»Scheiße!«
So machten sie eine ganze Zeit lang weiter.
»Bist du im Edward- oder im Jacob-Team?«, fragte Bunny.
»Edward!«, schrieb Lucy und fügte ein rotes Herz an.
Kurz nachdem sie in den Süden gezogen waren, hatte sie Zoe im Chatroom kennengelernt. Sie stellten schnell fest, dass sie viel gemeinsam hatten, und es dauerte nicht lange, bis sie sich auch privat schrieben.
»Was ist mit dir, Zoe?«, fragte Bunny.
Zoe verließ den Chatroom, ohne zu antworten.
Als Lucy sich das nächste Mal einloggte, sah sie, dass Zoe ihr eine private Nachricht geschrieben hatte. »Ich liebe Edward Cullen!«, und daneben drei rote Herzen.
»Zoe, bist du da?«
».«
»Hast du einen Freund?«
»Nein. Hätte ich gern!«
»Wen?«
»Sag ich nicht.«
»Ich verrate nichts.«
»Jemand in meiner Klasse.«
»Weiß er, dass du ihn magst?«
»AUF KEINEN FALL!!!«
»!!!«
»Und du?«
»?«
»Hast du?«
»Nein. Im Moment nicht.« Lucy fügte nicht hinzu, dass sie noch nie einen festen Freund gehabt hatte. Sie chatteten noch ein bisschen weiter über Freunde und frühere Freunde. »Ich habe ihn echt geliebt, aber er hat Schluss gemacht «, log Lucy. Niemand würde je erfahren, dass es nicht stimmte, und sie wollte interessant klingen. Zoe war die einzige richtige Freundin, die sie jetzt noch hatte.
»Wie alt bist du?«, fragte Zoe.
»Du zuerst.«
»Ich habe als Erste gefragt.«
»Du willst es wissen.«
»Vierzehn. Und du?«
»Ich bin fast vierzehn!! Und wie ist es so, Zoe?«
»Ich hasse die Schule!!!«
»Ich auch!!«
Lucy schlug vor, dass sie per Instant Messenger weiterredeten. »Ist privater. Da kannst du mir von deinem Freund erzählen.«
»Er ist nicht mein Freund!«
»Hasse die Schule, LIEBE Edward Cullen!!«, schrieb Lucy.
Zoe schickte ihr ein rotes Herz über den Instant Messenger. »Freundinnen!«
»Freundinnen!«, stimmte Lucy zu.
»Beste Freundinnen!«
»Für immer!«
7In der Leichenhalle
Auf dem Seziertisch sah Abigail Kirby wie eine Wachsfigur aus. Ihr Gesicht war gesäubert worden, sodass ihr kantiges Kinn zu erkennen war. Geraldine näherte sich dem Tisch und zwang sich, in den offenen Mund des Opfers zu sehen. Zwischen den ebenmäßigen Zähnen sah der Zungenstummel verblüffend sauber aus. Abigail Kirby starrte sie stumm vorwurfsvoll an, als wolle sie sich dieses Angaffen verbitten.
Der Pathologe blickte auf, und Geraldine erkannte den dunkelhaarigen Gerichtsmediziner wieder, der die Leiche im Waldstück untersucht hatte. »Hallo, Inspector. Verzeihen Sie bitte, dass ich Ihnen nicht die Hand gebe.«
Geraldine sah zu seinen blutigen Handschuhen. »Guten Morgen, Dr. Hilliard.«
»Bitte nennen Sie mich Paul.« Geraldine lächelte. Der Pathologe wollte noch etwas sagen, als Peterson hereinkam.
»Wollen wir anfangen?«, fragte Geraldine.
Paul Hilliard nickte. »Abigail Kirby hat gut auf sich geachtet. Sie war fit für ihr Alter, gut ernährt, mit hervorragendem Muskeltonus. Wahrscheinlich hat sie im Fitnesscenter trainiert oder zumindest regelmäßig Sport getrieben. Sie hatte vor Kurzem eine Maniküre und eine Pediküre, schätze ich, und ihr Haar ist gut geschnitten. Sie sieht aus wie jemand, der viel in der Öffentlichkeit aufgetreten ist, oder wie eine Narzisstin.«
Geraldine musste unweigerlich lachen. »Sie wissen doch, dass sie Schuldirektorin war!«
Paul Hilliard grinste ihr zu. »Das passt zu dem sehr gepflegten Erscheinungsbild. Jedenfalls hat sie sehr auf sich geachtet.«
Geraldine blickte zu ihren eigenen Fingernägeln, die praktischerweise kurz geschnitten waren, und fragte sich, ob Abigail Kirby recht gehabt hatte, so sehr auf die Würde ihrer Position bedacht zu sein. Aber das spielte jetzt keine Rolle mehr. »Das Opfer hat mehrere Verletzungen. Ihr wurde mit einem stumpfen Gegenstand auf den Hinterkopf geschlagen. Der Mörder setzte eine beträchtliche Kraft ein, also wird es sich wahrscheinlich um einen männlichen Täter handeln. Der Schlag hat zu einer Schädelfraktur und zu einer Hirnblutung geführt.«
»Und die Zunge?«
»Die wurde nach dem Schlag auf den Hinterkopf herausgeschnitten.« Er zeigte auf Blutergüsse an den Oberarmen des Opfers. »Derjenige, der ihr auf den Hinterkopf geschlagen hat, hat sie hinterher gepackt und auf den Rücken gedrückt und dann an Armen und Beinen fixiert.« Er wies auf Fesselmale an Handgelenken und Knöcheln.
»So konnte er leicht an ihr Gesicht«, sagte Peterson.
»Die Zunge wurde nach dem Schlag auf den Schädel entfernt. Der Blutverlust war beträchtlich, also hat sie zu dem Zeitpunkt noch gelebt. Der Stumpf blutet sehr stark. Sie muss bewusstlos gewesen sein, weshalb der Würgereflex nicht einsetzte, und sie lag auf dem Rücken. Das Blut floss ihr in die Kehle, was ihr Ersticken bewirkte.« Paul Hilliard legte sanft eine Hand auf den Kopf des Opfers. »Abigail Kirby ist in ihrem eigenen Blut ertrunken.«
Sekundenlang schwiegen alle.
Der Pathologe sah zu Geraldine auf, ehe er fortfuhr: »Kopfverletzungen sind immer heikel. Da besteht grundsätzlich die Gefahr einer Hirnschädigung. In diesem Fall wäre sie vermutlich schon an den Folgen des Schlags gestorben, wäre sie nicht vorher erstickt.«
»Er muss eine sehr scharfe Klinge benutzt haben, um ihr die Zunge rauszuschneiden«, sagte Geraldine. »Das kann nicht leicht gewesen sein, oder?« Nachdem das Gesicht des Opfers gesäubert war, konnte man den Zungenstumpf deutlich sehen. »Ich könnte mir vorstellen, dass es nicht viele Leute gibt, die das schaffen würden. Nicht, ohne sich sehr viel Zeit zu nehmen. Und ich schätze, unser Täter wollte keine Zeit vergeuden.«
»Das war sorgfältig geplant«, pflichtete Paul ihr bei.
»Von jemandem, der nicht dumm war«, ergänzte Peterson.
»Um Ihretwillen hoffe ich das Gegenteil«, sagte Paul.
»Warum?«
»Weil es im Falle eines hochintelligenten Mörders – oder einer hochintelligenten Mörderin – unwahrscheinlicher wird, dass Fehler begangen wurden, was wiederum bedeutet, dass der oder die Schuldige schwerer zu finden sein wird.« Für einen Moment schwiegen alle. »Was ist mit dem Zeugen, der die Leiche gefunden hat? Hat er irgendwas gesehen?«
»Wir haben ihn noch nicht befragt. Der Constable vor Ort hat seine Aussage aufgenommen, aber der Zeuge stand unter Schock und hatte seinen kleinen Sohn bei sich. Wir werden noch mit ihm reden und uns eine richtige Aussage geben lassen. Haben Sie sonst noch irgendetwas für uns? Irgendwelche Abwehrverletzungen?«
Der Pathologe schüttelte den Kopf. »Sie hatte Handschuhe an, die ich ins Labor geschickt habe, aber ich kann keine Anzeichen für einen Kampf erkennen.«
»Wo wollte sie hin?« Geraldine sprach eher mit sich selbst. »Wollte sie jemanden treffen, den sie kannte? Wurde sie verfolgt? Oder war ihr Angreifer ein Wildfremder?«
»In dem Fall müssten wir nach jemandem suchen, der um des Tötens willen mordet«, ergänzte der Sergeant.
»Ein Psychopath?«, fragte Paul Hilliard. »Jemand Geistesgestörtes?«
»Nun, wer es auch war, gestört war er auf jeden Fall, selbst für einen durchschnittlichen Mörder«, antwortete der Sergeant. »Nicht, dass irgendein Mörder tatsächlich geistig gesund wäre, aber die meisten von ihnen entfernen ihren Opfern nicht die Zunge, während sie sie umbringen.«
Der Pathologe lächelte verhalten.
»Wir müssen uns für alles offenhalten«, sagte Geraldine und erwiderte Paul Hilliards Lächeln.
»Ja, das müssen wir«, stimmte er ihr zu.
»Also, können Sie uns sonst noch etwas sagen?«
»Sie war ungefähr vierzig Jahre alt.«
»Achtundvierzig«, korrigierte Peterson ihn.
»Können Sie uns genauer sagen, wie lange sie schon tot war, als sie gefunden wurde?«, fragte Geraldine und sah wieder zur Leiche.
»Sie wurde heute Morgen um halb elf gefunden. Ich war gegen halb zwölf am Tatort und schätzte den Todeszeitpunkt auf den Samstagnachmittag. Es ist schwierig, genau zu sein, weil sie die Nacht über im Regen gelegen hat. Bei der ersten Untersuchung war meine Schätzung, dass sie ungefähr neunzehn bis zweiundzwanzig Stunden tot sein müsste. Aber bedenken Sie, dass es nur geschätzt ist.«
»Dann ist sie am Samstag zwischen ein und vier Uhr nachmittags gestorben«, folgerte Peterson.
»Höchstwahrscheinlich. Aber es gibt keine absolute Gewissheit. Der Verwesungsprozess kann durch diverse Faktoren beschleunigt oder verzögert werden, erst recht bei einer Leiche, die im Freien liegt.«
»Glauben Sie, dass sie in dem Waldstück ermordet wurde, in dem man sie gefunden hat?«, fragte Geraldine.
»Nein. Es war Erde und Laub in ihrem Haar, was zum Fundort passt, doch da gab es sonst keine Spuren.«
»Tja, wenn das alles ist …«
»Fürs Erste. Sie bekommen meinen vollständigen Bericht heute Nachmittag.«
Der Sergeant konnte gar nicht schnell genug aus dem Raum kommen. Geraldine verstand seine Abneigung gegen Leichen, obwohl sie selbst Autopsien faszinierend fand. Solange sie die Toten nicht als kürzlich noch Lebende betrachtete, waren sie für Geraldine überaus interessant. Sie glaubte, dass Paul Hilliard ähnlich dachte, und fragte sich, was sie sonst noch mit dem schlanken, blauäugigen Arzt gemeinsam haben könnte.
Als Paul seine Handschuhe abstreifte, bemerkte Geraldine, dass er keinen Ehering trug. Sie blickte von Abigail Kirby zu ihm auf und stellte fest, dass er sie beobachtete.
»Ich erinnere mich nicht, Sie hier schon mal gesehen zu haben«, sagte sie.
»Nein, ich bin erst vor Kurzem hergezogen. Wohnen Sie schon länger hier?«, fragte er lächelnd. Es war eine sehr freundliche Reaktion auf ihren zaghaften Versuch, mit ihm ins Gespräch zu kommen.
»Ich habe mir vor einer Weile eine Wohnung in der Nähe gekauft. Gerade, als die Immobilienpreise durch die Decke gingen.«
Paul grinste mitfühlend. »Falls Sie …« Er zögerte. Geraldine wartete. »Ich dachte, wir könnten vielleicht den Fall besprechen. Es ist … eine interessante Geschichte, nicht wahr? Mit der entfernten Zunge, meine ich.« Etwas an seiner Art legte nahe, dass sein Interesse eher Geraldine galt als dem Fall. »Falls Sie Zeit haben, meine ich«, fügte er hinzu.
Geraldine notierte ihre Privatnummer auf der Rückseite ihrer Visitenkarte und gab sie Paul. »Das wäre nett.«
Paul lächelte und steckte die Karte ein.
»Liegt es an mir, oder war dieser Hilliard ein bisschen seltsam?«, fragte Peterson, als er mit Geraldine die Gerichtsmedizin verließ.
»Wie seltsam?«
»Na ja, er hat nicht mal mit der Wimper gezuckt, als er über die Zunge des Opfers sprach. Und er sah beinahe aus, als würde er die Arbeit des Mörders bewundern.«
Geraldine zuckte mit den Schultern. »Er verdient seinen Lebensunterhalt damit, Leichen aufzuschneiden. Was bedeutet schon die eine oder andere Zunge, wenn man den ganzen Tag Körperteile zerschneidet?«
»Ja, kann sein«, pflichtete Peterson ihr bei. »Gott, ich hasse es, in die Pathologie zu gehen und das alles sehen zu müssen. Mir ist schleierhaft, wie jemand solch einen Job machen kann.« Er erschauderte.
»Wie gut, dass nicht jeder so ein Weichei ist wie Sie«, sagte Geraldine lachend.
8Die Familie
Von Abigail war keine Spur zu entdecken, als Matthew am Sonntagmorgen nach Hause kam, und als er an ihre Arbeitszimmertür klopfte, antwortete sie nicht.
»Abi, bist du da?« Er wollte die Tür öffnen, aber sie war abgeschlossen, was bedeutete, dass sie nicht zu Hause arbeitete. Matthew ging nach oben und sah in ihr Schlafzimmer. Das war ebenfalls leer. Er warf auch einen Blick in Bens und Lucys Zimmer; beide schliefen noch. Matthew ging wieder nach unten, stellte den Wasserkocher an und wühlte im Schrank nach seinen bevorzugten Frühstücksflocken. Nach dem Frühstück ging er nach draußen, um den Morgen im Garten zu verbringen. Es war ein sonniger Tag, und Matthew pfiff bei der Arbeit vor sich hin.
Bis zum Tee war Abigail immer noch nicht zu Hause. Ben war bedrückt, Lucy mürrisch, doch daran konnte Matthew nichts ändern. Er war nicht so dumm, seine Frau in der Schule anzurufen. Das war einzig in Notfällen gestattet.
»Wann kommt sie nach Hause, Dad? Ich will ihr doch vom Fußball erzählen«, sagte Ben.
»Halt die Klappe«, fuhr Lucy ihn an. »Keiner will was von deinem blöden Fußball hören.«
Als es klingelte, dachte Matthew, es wäre Abigail. »Wie komisch, dass eure Mum ihren Schlüssel vergisst«, sagte er. Er öffnete und war überrascht, als er einen Mann und eine Frau vor der Tür stehen sah.
»Matthew Kirby?« Die Frau hielt einen Ausweis in die Höhe, und Matthew beugte sich vor, um ihn anzusehen.
»Detective Inspector Steel«, sagte sie. »Dies ist Detective Sergeant Peterson.«
Matthew nickte. »Meine Frau ist nicht hier«, sagte er, während er sich wieder aufrichtete. »Ich weiß, es ist Sonntag, und es sind Trimesterferien, aber sie ist schon den ganzen Tag bei der Arbeit. Sie ist die Schulleiterin.« Er versuchte, nicht verbittert zu klingen. »Ich vermute, Sie wollen sie wegen einem ihrer Schüler sehen? Sie finden Sie in der Harchester School.« Er begann, die Tür wieder zu schließen. »Ich fürchte, ich kann Ihnen gar nichts sagen.«
»Wir möchten mit Ihnen sprechen, Mr. Kirby. Dürfen wir hereinkommen?«
»Ich will gerade Tee machen«, erwiderte er. Die beiden Polizisten rührten sich nicht vom Fleck, und Matthew konnte ihnen schlecht verweigern, ins Haus zu kommen.
Matthew Kirby ging voraus in eine Küche, in der ein ungefähr zwölfjähriger Junge zurückgelehnt auf einem Stuhl saß, die Hände auf dem flachen Bauch und die langen Beine unter dem Tisch ausgestreckt. Er hatte das dunkle lockige Haar und die blauen Augen seines Vaters und trug ein zerknittertes T-Shirt und eine ausgeblichene Jeans.
»Ich habe mich schon bedient«, sagte er grinsend und hielt ein riesiges Stück Schokoladenkuchen hoch. »Hallo«, ergänzte er, als er die beiden Detectives sah.
»Hallo Ben«, antwortete Geraldine. Sie erwiderte sein Lächeln nicht. »Wir würden uns gern mit deinem Vater unterhalten. Wo ist Lucy?«
Ben setzte sich auf, und bei ihrem ernsten Ton verschwand sein Grinsen. »Dad, wer ist das?«