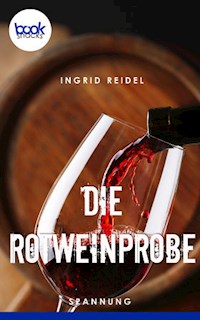5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: vss-verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Lotte freut sich, als sich eines Tages ein attraktiver Mann in ihr altes Jagdhaus im Odenwald verirrt. Ohne ihren Vater zu fragen, der ihr immer alles verbietet, richtet sie dem attraktiven Mann ein Notquartier ein. Fasziniert von ihm beobachtet sie ihn heimlich vor dem Schlafengehen, bis ihr selbst die Augenlider zufallen. Als sie erwacht, ist nichts mehr so, wie es vorher war. Der Mann ist tot. Lotte ist verzweifelt, sie nimmt an, dass ihn ihr Vater getötet hat. Ihr ganz persönlicher Albtraum beginnt. Die 1960 in Weinheim geborene Autorin ist Mediengestalterin und Erzieherin. 2012 begann sie ein Online-Studium: Autorin werden und verlegte sich auf die Sparte Krimikurzgeschichten sowie auf Short-Storys im humoristischen Bereich. Besonders bekannt wurde sie durch ihren skurrilen schwarzen Humor. Die Autorin wurde mehrmals ausgezeichnet. Sie stand auf der Shortlist der Wiener Kriminacht, war im Finale der Art Experience in Baden bei Wien und gewann den Deutschen Kurzkrimi-Preis Tatort Eifel. Ingrid Reidel ist Mitglied bei den Mörderischen Schwestern und den Bloody Maries. Sie ist Mutter einer Tochter und wohnt mit ihrem Partner in einem alten Anwesen in Weinheim.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 293
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Blutrotes Vermächtnis
Ingrid Reidel
Impressum
Copyright: vss-verlag
Jahr: 2023
Lektorat/ Korrektorat: Peter Altvater
Coverbild: Rouven Markovic
Verlagsportal: www.vss-verlag.de
Gedruckt in Deutschland
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie
Das Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung der Verfasserin und des Verlags unzulässig.
Widmung
Dieses Buch widme ich Volker Nau,
verbunden mir meinem großen Dank für die unermüdliche Unterstützung während der Realisierung dieses Werkes
Ich bedanke mich auch bei
Anni
Conny
Dagmar
Eva
Heiderose
Kari
Katie
Kristin
Michelle
Sabine
Stefanie
Volker
für ihre Hilfe, Tipps und ihre Freundschaft
sowie bei
Mara
für den guten Tipp mit dem Verlag
Schneesturm
Ein Schneesturm, das hatte ihm gerade noch gefehlt. Jan schlug aufs Lenkrad. Verdammt! Er schaltete das Fernlicht an. Der Wind tobte, rüttelte den Wagen, als wäre er ein Spielzeug, und die altersschwache Heizung schaffte es nicht, die Scheiben freizuhalten. Es war stockdunkel, und er konnte die Straße kaum noch erkennen, die sich zwischen den Bäumen den Berg hinaufschlängelte. Moment mal, Berg? Seit wann führte die Straße so steil hinauf? Jan runzelte die Stirn. Er konnte sich kaum erinnern, dass die Strecke so stark anstieg. Das letzte Mal, als er hier gefahren war, war es Sommer gewesen, helllichter Tag und strahlender Sonnenschein. Doch jetzt, nach neun Stunden Autofahrt, war er erschöpft und todmüde. Und die Straße kam ihm fremd vor, genauso wie die steilen Hänge und der dichte Wald, der die Straße einengte. »Jetzt mach doch aber mal halblang.«
Er versuchte, seine aufkommende Panik zu unterdrücken. Er konnte es sich nicht leisten, die Nerven zu verlieren. Himmel, er hatte doch schon viel Schlimmeres hinter sich gebracht. Ja, das Schlimmste war die »Umverteilung«, wie er es nannte, gestern Abend. Die Umverteilung von der unehrlichen Gastronomie in die ehrliche. Von seinem Chef Karl Grüber zu seiner neuen Chefin Stephanie Rössle, die mehr für ihn war als nur eine Geschäftspartnerin. Der Plan musste sich schon lange in seinem Kopf zusammengebraut haben. Er hatte beobachtet, wie Karl seine Angestellten schuften ließ, nicht nur sie, sondern auch ihn, während der gute Karl Gott einen guten Mann sein ließ. Hätte sich sein Servicepersonal nicht die Hacken abgerannt, hätten nach Feierabend die Gläser gespült, aufgestuhlt, den Boden geputzt, während Karl sich nur seinen dicken Bauch hielt und mit einem fetten Grinsen in seinem Gesicht zuschaute, dann hätte Karl seine Gaststätte, den »Klabautermann«, sonst wohin hängen können. Und so hatte er, der gute Oberkellner Jan, wie ihn manchmal Karl titulierte, auf dessen Urlaub gewartet, hatte abgewartet, bis der mit seiner Frau Richtung Ballermann aufgebrochen war, und dann die Gelegenheit genutzt, um in die Gaststätte einzubrechen. Einbruch? So konnte man es eigentlich nicht nennen. Karl selbst hatte ihm den Schlüssel gegeben. »Hier«, hatte er gesagt, »ein guter Oberkellner braucht den Schlüssel, falls es mal brennt.« Ja, und es hatte gebrannt. Aber nicht in der Gaststätte, sondern in ihm selbst, in Jan. Also war er gestern Abend zum »Klabautermann« gefahren, hatte sein Auto hinten auf dem Parkplatz abgestellt und sich durch die Hintertür hineingeschlichen. Lautlos hatte er die Küche durchquert, war in den ersten Stock hinaufgestiegen und hatte sich auf die Suche nach dem Schwarzgeld gemacht. Die Wohnung zu betreten, war einfach gewesen. Der Wohnungsschlüssel hing am Schlüsselbund, und der Tresor im Schlafzimmer war ebenfalls keine große Herausforderung. Grüber verwendete für alles Mögliche immer denselben Code: den Geburtstag seiner Frau, also den neunten Oktober neunzehnhundertvierundachtzig – neun, eins, null, eins, neun, acht und vier.
Der Safe war aufgesprungen, und ein Stapel Geldscheine grinste ihm förmlich entgegen. Ohne zu zögern, hatte er sich das Geld geschnappt. Bei der goldenen Rolex, die ebenfalls im Safe lag, hatte er kurz innegehalten, dann aber auch sie eingesteckt. Jetzt war er auf dem Weg zu Stephanie, seiner Traumfrau, irgendwo im idyllischen Odenwald. Schon bei ihrem ersten Treffen hatte sie ihn in ihren Bann gezogen. Ihr langes, schwarzes Haar, ihre makellosen Beine, ihr scharfer Verstand und ihr unternehmerischer Mut – all das war faszinierend. Doch schon bald erzählte sie ihm von ihren Sorgen.
»Hör zu«, gestand sie ihm, »ich führe ein Café, aber es läuft nicht gut. Ich habe es von meinem Mann übernommen, der sein bester Kunde war – wenn du verstehst, was ich meine.«
Oh, er hatte sie sehr wohl verstanden.
»Ich habe ihm das Café abgekauft, das wunderschöne Café, das er von seinen Eltern geerbt hat. Es brach mir das Herz, es vor die Hunde gehen zu sehen.«
Jan hatte ihr geduldig zugehört, sie regelmäßig im Odenwald besucht und ihr bei jeder Gelegenheit unter die Arme gegriffen. Doch der Gedanke an ihre Probleme ließ ihn nicht los. Zu Hause arbeitete er weiter als Oberkellner im »Klabautermann«, aber der Ärger fraß an ihm.
Ärger über seinen Chef Karl Grüber, der nicht besser war als Stephanies ehemaliger Mann. Karl Grüber legte noch eine Schippe obendrauf. Er bediente sich auch noch aus der Trinkgeldkasse und nahm das Geld, das sein Personal durch permanentes Schuften und einer Portion extra Freundlichkeit den Gästen gegenüber erwirtschaftete. Jan konnte seine Wut kaum bändigen.
Es erschien ihm nur gerecht, sich das Geld von Karl zu nehmen, um es »umzuverteilen«, als Ausgleich für die Ungerechtigkeiten, die er und Stephanie erlebt hatten. Mit diesem Plan im Kopf hatte er schließlich gehandelt. Er hatte das Geld und die Uhr in seine Aktentasche gestopft, war nach Hause gefahren, hatte sich eine Weile ausgeruht und dann Gas und Wasser abgestellt.
Aus dem Küchenschrank, wo er in einer alten Keksdose etwas Bargeld versteckt hatte, nahm er Kleingeld für unterwegs heraus. Danach war er bei Nacht und Nebel losgefahren. Extra hatte er ein paar Schleifen gedreht, von Hamburg über Soltau, und an einer Autobahnraststätte gen Süden Rast gemacht, damit, falls ihn jemand verfolgte, der Eindruck entstünde, er sei auf dem Weg nach Italien oder in die Schweiz. Vielleicht würde Grüber nicht sofort zur Polizei gehen, sondern versuchen, ihn selbst zu verfolgen. Und das konnte gefährlich werden. Karl war ein Choleriker, aufbrausend und unberechenbar, jemand, der vor nichts zurückschreckte. Jan erinnerte sich an eine schreckliche Situation, als Karl einer Servicekraft eine Ohrfeige gegeben hatte, weil ihr beim Trocknen ein Glas zerbrochen war. Ein läppisches Glas. Und nun war er hier, mitten im Odenwald, in einem Schneesturm, mitten in der Nacht, und überlegte, was ihm widerfahren war. Und ob Stephanie überhaupt das Geld annehmen würde. Sie würde vielleicht Fragen stellen. Daran hatte er noch gar nicht gedacht. Genauso wenig wie an die Möglichkeit, dass Karl, seinen Bruder Rolf in die Mangel nehmen könnte, um herauszufinden, wo Jan sich aufhielt. Das alles war vielleicht keine gute Idee gewesen, aber jetzt war es geschehen, und er konnte es nicht mehr ändern. Aber eins nach dem anderen. Das Nächste war, sich in diesem verdammten Wald zurechtzufinden. Wozu hatte er überhaupt ein Handy?
Jan stoppte, beugte sich nach vorn und nahm das Gerät aus der Halterung an der Windschutzscheibe. Er schaltete es ein, um die Navigationsapp zu starten. Doch das Handy zeigte nur einen Balken an, der sofort verschwand.
Großer Gott, dachte er. Kein Empfang. Warum war er nur so dumm gewesen und hatte sich den Weg nicht vorher heruntergeladen? Weil er geglaubt hatte, die Gegend hier zu kennen wie seine eigene Westentasche. Er war doch schon ein paarmal hier gewesen. Aber das war wohl ein Irrtum. Denn jetzt, im Dunkeln, bei einem Schneesturm, kannte er die Gegend gar nicht mehr. Und Stephanie hatte ihn vor den Funklöchern gewarnt.
Was sollte er jetzt tun? Ganz klar, offensichtlich hatte er sich verfahren. Und zwar vorhin an der Kreuzung, als er gezögert hatte.
Er musste seinen Verstand einschalten. Dazu musste er erst einmal eine rauchen. Jan stellte den Motor ab, griff in seine Brusttasche, holte eine Schachtel Zigaretten und ein Feuerzeug heraus.
Der erste Zug an der Zigarette wirkte beruhigend, und nun konnte er einigermaßen klare Gedanken fassen.
Das Beste wäre, zu wenden. Also gut, das ergibt Sinn. Er würde zurück zur Kreuzung fahren und sich neu orientieren. Vielleicht würde er an einer Tankstelle vorbeikommen, wo er nach dem Weg fragen könnte.
Jan drehte den Zündschlüssel um und der Motor startete. Er legte den Rückwärtsgang ein, ließ vorsichtig die Kupplung kommen und gab Gas.
Was war das? Die Räder drehten durch. Er versuchte es erneut, doch die Räder rutschten nur noch mehr, und der Motor heulte wie ein wildgewordener Löwe auf.
Verdammtes Pech. Heute schien einfach alles gegen ihn zu laufen. Jan schnallte sich ab, öffnete die Tür, die wie ein altes Scheunentor knarzte, und stieg aus. Sofort wurde er vom eisigen Wind durchgepustet, und die Schneeflocken schnitten ihm wie kleine Messer ins Gesicht. Doch es nützte nichts. Er ging um den Wagen zur Front. Tatsächlich waren die Räder im Schnee festgefahren. Himmel, dachte er und überlegte einen Moment. Die Fußmatte des Beifahrersitzes war ihm irgendwann abhandengekommen, und die des Fahrersitzes hatte sich immer unter das Gaspedal gewickelt, sodass er sie gelegentlich entsorgt hatte.
Er hatte weder eine Decke noch irgendetwas anderes dabei, was er unter die Räder legen konnte.
Himmel, er hätte schreien können. Wenn er weiter so untätig blieb, würde er hier festfrieren. Ha, der alte Witz, und sie fanden nur noch sein Skelett. Das konnte hier ganz schnell zur Realität werden.
Gerade als er sich wieder in den Wagen setzen wollte, fiel sein Blick auf etwas Ungewöhnliches. Ein schwacher Lichtschein schimmerte durch die Bäume, der von weiter oben in der Ferne zu kommen schien. Trotz der Kälte, die sich wie ein eisiger Schleier bis auf die Knochen zog, blieb er stehen. Er zog die Schultern zusammen, um sich etwas vor der beißenden Kälte zu schützen, und versuchte, die Augen zu schärfen. Durch den dichten Schneesturm und die Dunkelheit konnte er nur vage die Umrisse des Lichtes erkennen, doch es war deutlich genug, um seine Hoffnung zu wecken. Mit aller Kraft konzentrierte er sich auf den schwachen Schein, der zwischen den Bäumen hindurchbrach und ihm einen Hauch von Orientierung bot. Vielleicht war dies seine Chance auf Rettung, sein letzter Anhaltspunkt, der ihn aus dieser verzweifelten Situation herausführen konnte.
Kurz hielt Jan inne und dachte darüber nach, was er mit dem Geld im Kofferraum anstellen sollte. Er musste es schweren Herzens zurücklassen, denn es würde ihn nur aufhalten. Das Geld war verborgen im Wagen, der schon bald vollständig unter dem Schnee verschwinden würde. Keiner würde es finden können, da der Schnee wie eine undurchdringliche Decke darüberliegen würde und niemand wusste, was sich im Kofferraum verbarg. In der unermüdlichen Dunkelheit und dem Sturm war das Versteck nahezu perfekt.
Er stapfte weiter durch den Schnee, bemüht, die Kälte und das stechende Pochen in seinem Finger zu ignorieren. Doch plötzlich spürte er, wie sein Fuß hängenblieb, und er stolperte nach vorne. Er fing sich gerade noch rechtzeitig ab, bevor er stürzte, und leuchtete mit der Taschenlampe auf den Boden, um zu sehen, worüber er gestolpert war. Vor ihm lag eine alte, rostige Wildfalle, halb unter dem Schnee verborgen. Ein Schauer lief ihm über den Rücken, als er sich ausmalte, was passiert wäre, wenn er nicht rechtzeitig gestoppt hätte.
Er richtete sich auf, schüttelte den Schnee von seinen Hosenbeinen und hob den Blick wieder. Plötzlich sah er in der Ferne etwas, das wie ein riesiges Geweih aussah. Verwundert und gleichzeitig fasziniert blickte er noch einmal in die Richtung, um sich zu konzentrieren. Im fahlen Lichtschein schälte sich langsam die Silhouette eines Hauses aus der Dunkelheit, an dessen Umrissen das »Geweih« zu kleben schien. Das musste sein Ziel sein. Er hoffte nur, dass die Batterie seines Handys bis dahin hielt.
Entschlossen stapfte er weiter durch den tiefen Schnee, seine Gedanken immer wieder bei dem gruseligen Witz mit dem Skelett, über den er vorhin noch gelacht hatte. Jetzt war er alles andere als lustig. Es war dunkler als die dunkelste Nacht, er war bis auf die Haut durchgefroren, und es gab gefährliche Fallen, vor denen er sich in Acht nehmen musste. Daher blickte er mit Hilfe des Scheins aus dem Handy bei jedem Schritt auf den Boden, um möglichen Fallen auszuweichen.
Er ging weiter. Je näher er dem Haus kam, desto klarer erkannte er, dass es alt und baufällig war. Die Fensterläden hingen schief, und die Fassade war von Rissen durchzogen. Die Atmosphäre war bedrückend, doch er musste Schutz suchen.
Während er sich umsah, flatterte plötzlich etwas auf und verschwand in einem nahe gelegenen Gebüsch. Anschließend hörte er das aufgeregte Gackern – Hühner.
Er war nun ganz nah an der Fassade, fast direkt vor der Haustür. Diese war aus schwerem Holz gefertigt und mit kunstvollen Jagdschnitzereien verziert – sie musste einst sehr schön gewesen sein. Während er hinaufblickte, bemerkte er hinter den Fenstern das Licht. Plötzlich öffnete sich eines der Fenster mit einem lauten Knarren. Eine Hand schob sich hinaus, und bevor er reagieren konnte, flog etwas durch die Luft. Der erste Zug an der Zigarette wirkte beruhigend, und nun konnte er einigermaßen klare Gedanken fassen. Durch den dichten Schnee und die Dunkelheit konnte er nicht genau erkennen, was da vor ihm lag, doch es glänzte feucht und landete fast neben ihm. Jan richtete den Strahl des Handys auf den Gegenstand. Im Schein des kalten Lichtes bestätigte sich sein Verdacht: Es war tatsächlich blutig. Sein Magen zog sich zusammen, als er erkannte, dass es nicht nur Blut war, sondern auch Fell daran haftete. Der unerwartete Anblick ließ ihn zusammenzucken und erschrocken zurückweichen.
Im nächsten Moment wurde das Licht im oberen Fenster gelöscht. Nur ein schmaler Streifen Licht schimmerte noch durch die gerade zugezogenen Gardinen. Er versuchte erneut, laut zu werden, doch die Kälte ließ nur ein leises Geräusch aus seinem Mund kommen.
Für einen kurzen Moment überlegte er, ob er wirklich in dieses unheimliche Haus gehen wollte, doch der Gedanke an die Kälte und die Aussicht auf Rettung ließen ihm keine Wahl. Er wandte sich der Haustür zu, konnte jedoch keine Klingel finden. Also klopfte er so kräftig an die Tür, wie es ihm möglich war.
Ratte
Lotte hob ruckartig den Kopf, als ein unbestimmtes Gefühl sie aus der Lektüre riss. Etwas stimmte nicht. Hatte sie nicht ein Geräusch gehört? Das Aufheulen eines Motors vielleicht, das in der Stille der Nacht ungewöhnlich laut klang. So spät noch? Es war merkwürdig für diese abgelegene Gegend, wo um diese Zeit normalerweise nur die nächtlichen Geräusche der Natur zu hören waren.
Sie legte ihr Buch auf dem kleinen, altmodischen Teewagen neben sich ab und lauschte aufmerksam, ihre Sinne geschärft. Doch im nächsten Moment wurde ihr klar, dass es lediglich der Schneesturm draußen war, der mit unerbittlicher Kraft um das Haus tobte und dabei unheimliche Laute von sich gab. Es war bereits düster geworden, die letzten Lichtstrahlen des Tages waren längst von den dichten Schneewolken verschluckt worden. Ein ganz normaler Schneesturm an einem winterlichen Abend, der in den Höhenlagen des Odenwaldes nichts Ungewöhnliches darstellte und doch immer wieder eine gewisse Bedrohlichkeit ausstrahlte.
Lotte atmete erleichtert auf und lehnte sich tief in ihren gemütlichen Sessel zurück, den sie vor Jahren von ihrer Großmutter geerbt hatte. Sie war so in ihr Buch vertieft gewesen, dass sie den langsamen Wetterwechsel völlig übersehen hatte. Auch die Kälte, die sich inzwischen heimlich ins Wohnzimmer geschlichen hatte, war ihr entgangen. Die Temperatur im Raum war deutlich gesunken, und ein Frösteln zog sich ihren Rücken hinauf. Bevor sie sich jedoch wieder ihrem Buch widmete, stand sie auf, streckte sich kurz und ging zum Jagdofen hinüber. Sie legte einige Scheite Holz nach, die sie vorhin aus dem Holzschuppen hereingeholt hatte, und lauschte dem beruhigenden Knistern des Feuers, das sich sogleich über die neuen Holzscheite hermachte. Es war ein alter Ofen, ein Familienerbstück, wie fast alles in diesem Haus alt war. Der Ofen war verziert mit verschnörkelten Jagdmustern, die kunstvoll in den schwarzen Schamottkorpus eingearbeitet waren. Schon seit ihrer Kindheit stand er hier, ein stummer Zeuge der unzähligen Winter, die sie in diesem Haus verbracht hatte. Fünfunddreißig Jahre lebte sie hier, seit sie ein kleines Mädchen gewesen war, und Paps hatte es stets kategorisch abgelehnt, den Ofen durch einen leistungsfähigeren oder durch eine moderne Heizung zu ersetzen.
Lotte fand das nicht schlecht. Ganz im Gegenteil, sie liebte es, von vertrauten Dingen umgeben zu sein. Es hatte etwas Beruhigendes, ja fast Tröstliches, sich auf die Beständigkeit dieser alten Gegenstände verlassen zu können. Die Welt draußen mochte sich verändern, doch hier drinnen blieb alles, wie es war. Veränderungen, die sie unweigerlich verunsicherten, gab es nur dort draußen, und vor manchen musste man sich ernsthaft in Acht nehmen.
Angenommen, sie ginge hinaus in den Wald, um Holz zu sammeln – eine Aufgabe, die sie als Kind oft mit ihrem Vater geteilt hatte. Die Wildschweine, die in den letzten Jahren die Wälder überbevölkerten, hatten deutlich überhandgenommen und konnten gefährlich werden, wenn sie sich bedroht fühlten. Oder noch schlimmer, sie würde hinunter in die große Stadt fahren, in die chaotische und unübersichtliche Welt von Mannheim oder Heidelberg. In den verwinkelten Straßen und überfüllten Plätzen konnte sie jederzeit von zwielichtigen Gestalten angesprochen werden, Männer mit durchdringenden Blicken, die keine guten Absichten hegten. Da war es hier drinnen im Haus, umgeben von vertrauten Dingen, doch viel angenehmer.
Und mit einer unterhaltsamen Lektüre war es direkt gemütlich. Der Sessel, in dem sie saß, umschloss sie wie eine warme Umarmung, während sie sich wieder setzte, die Beine unter sich zog und ihr Buch aufnahm. Sie betrachtete die Titelseite, die vom vielen Lesen schon ein wenig abgenutzt war: ›Vom Winde verweht‹. Ein alter Klassiker, den sie immer wieder zur Hand nahm, wenn sie in die Vergangenheit und in die Welt von ›Scarlett O’Hara‹ eintauchen wollte. Sie schlug das Buch auf und suchte die Stelle, an der sie durch das Geräusch unterbrochen worden war, als Rhett Scarlett leidenschaftlich küsste. Manchmal konnte sie sich leibhaftig in die Szenen hineinversetzen, ihre eigenen Gefühle vermischten sich mit denen der Protagonisten, und sie wünschte sich insgeheim, Rhett würde nicht Scarlett, sondern sie küssen. Ihr Herz begann schneller zu schlagen, wie immer, wenn sie an solche romantischen Dinge dachte und sich in ihrer Fantasie verlor. Im gleichen Moment durchzuckte es sie. Denn sie wusste nur zu gut, dass auch andere Dinge im Haus diese klopfenden Töne verursachen konnten. Zum Beispiel Stöcke. Genauer gesagt, Paps` Stock. Sie konnte den Ton schon hören, selbst wenn Paps ihn noch gar nicht in der Hand hatte. Sie war so fixiert auf diese Töne, diesen Takt. Tok, tok, tok.
Paps war wohl aus dem Bett aufgestanden. Ganz bestimmt hatte er schreckliche Laune, wie immer, wenn sie nicht sofort neben ihm stand und ihm seine Wäsche reichte.
Rasch versteckte sie das Buch unter dem Stapel alter Zeitungen auf dem Teewagen, stand auf und eilte mit einem mulmigen Gefühl im Magen hinaus in den Flur. Dort stand Paps, seine mächtige Gestalt wirkte in der düsteren Beleuchtung noch bedrohlicher, und er blickte sie finster an. Das prophezeite nichts Gutes, das wusste sie. Und so war es auch. Paps deutete mit dem Stock auf die Ecke hinter dem massiven Garderobenschrank, von wo ein herzzerreißendes Piepsen ertönte. »Sieh nach!«, befahl er mit seiner schnarrenden Stimme, die keinen Widerspruch duldete.
Sie brauchte nicht nachzusehen, denn das klägliche Piepsen verriet ihr bereits, was sie dort finden würde. Trotzdem ging sie langsam hin und schob das schwere Schränkchen zur Seite, ihre Hände zitterten leicht. Eine Ratte hatte sich in der dort aufgestellten Klappfalle gefangen – eine ziemlich große, mit glattem, braunem Fell, das sich unheimlich glänzend in dem spärlichen Licht zeigte. Die Falle hatte die Ratte in der Mitte zerquetscht, aber nicht getötet. Sie zappelte noch, verzweifelt kämpfend um ihr Leben. Eines ihrer Hinterbeine hing über den Rand der Falle hinaus und versuchte, zuckend auf dem Holzboden Halt zu finden. Vergeblich. Ihr Fell war mit Blut durchtränkt, das langsam auf den Boden tropfte und eine kleine, rote Lache bildete.
»Was sagst du dazu?«, knurrte Paps mit einem harten, bitteren Unterton. »Das ist deine Aufgabe. Und warum hast du unten schon das Licht ausgemacht? Wann wirst du endlich mal erwachsen und kommst deiner Verantwortung nach, Kleine?!« Er deutete energisch auf die Ratte, seine Augen funkelten vor Zorn und Enttäuschung.
Lotte schluckte. Ihr wurde übel, ein scharfer, stechender Schmerz kroch von ihrem Magen in ihre Brust hinauf. »Aber, Paps, ich … ich …« Sie blickte hilflos zwischen ihrem Vater und der leidenden Ratte hin und her, hin und her, als würde sie irgendwo ein Zeichen oder eine Hilfe suchen. Sie wusste genau, was er von ihr erwartete, was er immer von ihr erwartete, wenn solche Situationen eintraten.
»Heb sie auf!«, brüllte er sie an, seine Stimme hallte bedrohlich in dem engen Flur wider.
Aber sie konnte nicht. Ihr war nicht nur übel, ihr saß auch ein riesiger Kloß im Hals, der ihr die Luft zum Atmen raubte. Die Ratte schnappte kraftlos nach Luft, ihre kleinen Augen traten vor Schmerz und Panik aus den Höhlen. Der Anblick war unerträglich, und Lotte wandte sich instinktiv ab, unfähig, den letzten Schritt zu tun. Die raue Stimme ihres Vaters drang unerbittlich in ihr Unterbewusstsein, eine tiefe, dunkle Welle, die sie zu verschlingen drohte.
»Dass du nie mitbekommst, wenn die Falle zuschnappt!«, schimpfte Paps weiter, seine Geduld schien sich dem Ende zuzuneigen. »Du weißt, dass sie kommen, wenn es draußen schneit. Aber das kümmert dich nicht. Stattdessen gibst du dich deinem Schmuddelkram hin! Dieser verdammten Schundlektüre!« Böse funkelte er sie an, seine Augen blitzten in der Dämmerung wie die eines Raubtieres.
Mit einem Mal verstummte Paps. Er verstummte einfach, seine Worte erloschen in der Luft, und er stand da, versteinert, wie aus Marmor gehauen. Es war, als hätte jemand die Zeit angehalten, als würde alles um sie herum erstarren.
Lotte starrte ihn an. Starrte ihn und die zappelnde, leidende Ratte an. Ihr Herz klopfte laut in ihrer Brust, der Puls pochte in ihren Ohren. Gerade als sie dachte, er sei für immer in die ewigen Jagdgründe entschwunden, begann er plötzlich wieder zu sprechen, als hätte er nie aufgehört. »Aber nein, meine Tochter gibt sich lieber Schundlektüre hin.«
Lotte erschrak erneut. Konnte Paps jetzt schon durch Wände sehen? Seine Worte schienen direkt auf ihre geheimsten Gedanken abzuzielen, als könne er ihre inneren Welten lesen. »Das ist keine Schundlektüre, Paps. Das ist höhere Literatur, die mit dem Pulitzerpreis ausgezeichnet wurde …« Sie versuchte, ihre Stimme fest klingen zu lassen, doch es gelang ihr kaum.
»Höhere Literatur? Dass ich nicht lache. Du wirst das jetzt tun. Schau die Ratte an.«
Sie schüttelte langsam den Kopf, verzweifelt suchend nach einem Ausweg aus dieser schrecklichen Situation.
»Dann wirst du mit den Konsequenzen leben müssen, Kleine.« Seine Stimme war plötzlich trügerisch sanft, fast zärtlich, und das machte ihr noch mehr Angst. »Dann werde ich dich verlass…«
»Nicht! Sag es nicht!«, schrie sie, und der Kloß löste sich abrupt aus ihrem Hals, als hätte sie etwas Zerbrochenes herausgewürgt. Sie betrachtete die Ratte eingehend, das arme Tier, das immer noch verzweifelt versuchte, sich zu befreien. Der Tod war manchmal eine Erlösung, dachte sie bitter, und es war ein Akt der Nächstenliebe, eine gequälte Kreatur nicht länger leiden zu lassen.
Draußen strich der Sturm um die Ecken des alten Hauses und ließ die Wände ächzen, als ob sie unter der Last der Jahrzehnte nachgeben wollten. Die verstaubten Jagdtrophäen an der ebenso vergilbten Rispentapete, die die Wände bedeckte, und das alte unmoderne Telefon auf dem Garderobenschrank – all diese vertrauten Gegenstände waren ihr plötzlich zuwider, wirkten wie Relikte aus einer längst vergangenen Zeit, die sie in einem Käfig aus Erinnerungen festhielten. Hier kam sie sich mit einem Mal vor, als steckte sie in einer Zwangsjacke, die immer enger wurde.
Widerwillig nahm sie die Rattenfalle auf, ihre Finger spürten das klebrige, feuchte Fell der Ratte. Das Tier, in seiner Todesangst, schnellte mit seinem Kopf herum und versuchte, sie zu beißen, seine winzigen Zähne blitzten auf. Lotte streichelte sanft über das blutige Fell, ihre Hand zitterte dabei. Paps stand hinter ihr, seine Anwesenheit war wie ein drohender Schatten, sein typischer Geruch nach Rasierwasser und Mottenkugeln stieg ihr in die Nase und verursachte eine neue Welle der Übelkeit. Er berührte sie zart an ihrer Schulter, eine Berührung, die mehr einem Befehl glich. »Na los!«, flüsterte er.
Blut tropfte auf die alten Dielen, das würde sie nachher wegputzen müssen, dachte sie mechanisch.
»Los«, forderte Paps sie noch einmal auf, seine Stimme drängend. Sie beugte sich über die Rattenfalle, zog die schwere Feder zurück und holte das zappelnde, vor Angst fast wahnsinnige Tier heraus. Sie drückte das Tier sanft auf die Anrichte, das blutige Fell hinterließ einen Abdruck auf dem Holz.
»Gleich wird es vorbei sein«, flüsterte sie leise, versuchte, das Tier zu trösten, auch wenn sie wusste, dass es sie nicht verstehen konnte.
Ein dünner Blutstrom quoll aus der klaffenden Wunde und dem Maul der Ratte heraus. Lotte war mittlerweile so von Sinnen, dass sie Paps Stimme nur noch wie aus der Ferne hörte, ein schwaches Echo, das kaum zu ihr durchdrang. »Nun, nimm endlich das Messer.«
Mit zitternden Händen zog sie die Schublade der Anrichte auf, nahm das kleine, scharfe Obstmesser heraus, das sie für alltägliche Arbeiten nutzte, und setzte die Klinge am Hals der Ratte an. Sie atmete tief durch, schloss die Augen und vollendete den tödlichen Schnitt. Das Tier erschlaffte augenblicklich in ihrer Hand; der Kampf war vorbei.
Paps nickte zufrieden, als hätte er die Lektion erfolgreich erteilt, und verließ das Badezimmer in Richtung seines Zimmers. Sie starrte ihm hinterher, unfähig, sich zu bewegen, die Lektion war vorbei, doch in ihrem Inneren wütete ein Sturm, der sie nicht zur Ruhe kommen ließ. Sie würde die tote Ratte entsorgen müssen, wie so oft zuvor.
Sie packte die Ratte an den Füßen und eilte zum Badezimmer hinüber. Das Licht über ihr flackerte leicht, als sie die Tür öffnete. Dann machte sie sich an das Fenster, das wie immer klemmte, und musste all ihre Kraft aufwenden, um es endlich aufzustemmen.
Schließlich streckte sie mit einem Seufzen die Hand gerade so weit aus dem Fenster, wie nötig war, um die Ratte fallen zu lassen. Den Kopf zur Seite gedreht, um den Anblick zu vermeiden, spürte sie den eisigen Wind, der in ihre Haut biss. Sie beeilte sich, die unheimliche, blutverschmierte Kreatur loszuwerden. Kaum hatte sie losgelassen, zog sie die Hand zurück und schloss das Fenster hastig. Morgen würde sie ihn wie immer mit den Abfällen der letzten Schlachtung entsorgen, so wie sie es gelernt hatte, emotionslos und effizient.
Sie löschte das Licht, ihre Bewegungen waren mechanisch, wie von einer fremden Kraft gesteuert, ging sie zurück in das spärlich beleuchtete Wohnzimmer, zog die schweren Vorhänge zu und ließ sich wieder in ihren Sessel fallen. Mit zittrigen Händen nahm sie ihr Buch auf, die vertraute Berührung des Einbands bot ihr einen winzigen Hauch von Trost. Sie schlug es auf, suchte die Stelle, an der sie vorhin gewesen war, und widmete sich wieder Rhett und Scarlett, versuchte, sich in ihre Welt zu flüchten, weit weg von dem Albtraum, der sie im Moment umgeben hatte. Sie versank gerade wieder in die Seiten ihres Buches, als es plötzlich unten an die Haustür hämmerte.
Erschrocken fuhr sie hoch, ließ das Buch auf ihren Schoß fallen und lauschte einen Moment angespannt in die Stille. Dann erhob sie sich langsam, legte den Roman vorsichtig beiseite und ging hinaus in den Korridor. Ihre Schritte hallten leise auf dem kalten Steinboden wider, als sie den Flur entlanglief. Am Haken der Garderobe griff sie nach ihrer Strickjacke und zog sie sich eng um die Schultern. Mit einem mulmigen Gefühl in der Magengegend fasste sie schließlich die schwere Haustür und öffnete sie zögernd.
Rhett
»Ja bitte?«
Nachdem Jan die Frau gesehen hatte, war er verblüfft. Aus welchem Grund auch immer hatte er einen Mann erwartet. Er betrachtete sie kurz. Sie trug ein Kleid, das wahrscheinlich einmal in den Sechzigern des vergangenen Jahrhunderts modern gewesen war. Darüber eine alte Jacke, dazu Wollstrumpfhosen und an den Füßen lediglich Slippers. Ihr aschblondes, schulterlanges Haar war zu Zöpfen geflochten. Er schätzte sie auf höchstens Mitte dreißig, doch die Zöpfe, die Kleidung und vor allem ihr unschuldiger Blick verliehen ihr etwas Mädchenhaftes. Eine kleine, unscheinbare Narbe zog sich über ihre Stirn.
»Entschuldigen Sie die Störung«, sagte Jan, während er die Kälte der Luft in seiner Kehle spürte. »Ich bin mit meinem Auto hier gestrandet.« Er deutete auf den verschneiten Weg. »Ich bräuchte etwas, um den Wagen freizubekommen. Haben Sie so etwas?«
Sie blickte ihn skeptisch an, ihre Augen glitten über sein Gesicht und den Schnee, der sich auf seinen Schultern und seiner Mütze gesammelt hatte. »Ich weiß nicht ...«, begann sie zögernd und öffnete die Tür einen weiteren Spalt. »Ich bräuchte einen Teppich oder eine Strohmatte, irgendetwas, das als Unterlage dienen könnte. Bitte«, fuhr Jan drängend fort. »Es ist wirklich wichtig. Ich bin schon seit Stunden unterwegs, und es wird immer kälter. Bitte helfen Sie mir, damit ich weiterfahren kann.«
Die Frau schien einen Moment lang nachzudenken, dann nickte sie langsam. »Kommen Sie in den Flur«, sagte sie, öffnete die Tür ganz und ließ ihn eintreten.
Und er erschrak. Glasige Augen blickten ihn von den Wänden her an. Erst als er erkannte, dass es sich lediglich um Jagdtrophäen handelte, konnte er erleichtert aufatmen. Er war so angespannt gewesen, dass er beinahe in Panik geraten wäre. Unter anderen Umständen hätte er über sich selbst gelacht. »Warten Sie hier«, murmelte sie und verschwand. Er wartete ungeduldig, sein Herz pochte laut in seinen Ohren, in der Hoffnung, dass sie etwas Geeignetes finden würde. Endlich kehrte sie zurück, einen alten Teppich in den Händen. Sie reichte ihn ihm, und er atmete erleichtert auf.
»Vielen Dank«, sagte er. »Das ist wirklich nett von Ihnen.«
Die Frau lächelte. »Wo kommen Sie denn her?«
»Vom Weg unten«, antwortete er. »Ich glaube wirklich, ich habe mich verfahren.«
»Na dann, passen Sie auf sich auf da draußen. Den Teppich können Sie einfach dort liegen lassen. Er ist alt, ich hole ihn bei Gelegenheit, wenn der Schnee weg ist. Aber fahren Sie vorsichtig, wenn Sie zurückfahren. Der Weg ist allein schon im Sommer eine Herausforderung. Es war mutig, im Schnee ganz hochzufahren.«
Jan nickte, bedankte sich mehrmals und kämpfte sich gegen den Schnee zurück zu seinem Auto. Der Wagen war mittlerweile mit einer dicken Schneeschicht bedeckt. Er legte den Teppich unter die Reifen und stieg in den Wagen. Zu seiner Erleichterung sprang der Motor problemlos an. Doch damit war sein Glück bereits ausgeschöpft, denn die Räder drehten immer noch durch.
»Meine Güte«, dachte er, »ich könnte wahnsinnig werden.« Er trommelte so stark auf das Lenkrad, dass er versehentlich die Hupe betätigte. Das Geräusch hallte in die stille Nacht hinein.
Er griff erneut zum Handy, stellte jedoch fest, dass es immer noch keinen Empfang hatte. Wäre ja auch zu schön gewesen. Die Frau oben im Haus hatte hoffentlich ein Festnetztelefon, das er benutzen konnte. Er stieg aus, knallte die Autotür zu und stapfte fluchend zum zweiten Mal durch Schnee und Kälte zum Haus.
Das Licht im Flur brannte noch. Er klopfte. Wieder sah er den schlanken Schatten im Flur auf sich zukommen. Ihm war heiß, und sein Herz pochte heftig.
Erst jetzt bemerkte er, dass er den Teppich unten vergessen hatte, den er eigentlich hätte mit hochbringen wollen. Das zusätzliche Gewicht des Teppichs hatte ihn in seinem Eifer wohl etwas abgelenkt. Seine Gedanken wirbelten durcheinander, während er sich überlegte, wie unprofessionell das alles wirkte.
Zum Glück öffnete sie wieder die Tür. Ihr freundliches, aber leicht fragendes Lächeln machte ihn noch nervöser. »Tut mir leid, Sie nochmals zu stören«, hauchte er mit belegter Stimme, während seine Hand nervös an der Kante seines Hemdes zupfte. »Aber es klappt nicht. Darf ich Ihr Telefon benutzen? Hier ist ja kein Empfang, und ich habe wirklich das Gefühl, dass ich mir sonst nicht weiterhelfen kann.«
Er konnte den peinlichen Ausdruck in ihrem Gesicht nicht ganz deuten, aber ihr Mitgefühl war offensichtlich. Ihre Augen schienen ihn durchdringen zu wollen. Vielleicht war es seine Unsicherheit oder sein verwirrtes Verhalten, das sie irritierte.
»Kommen Sie rein«, sagte sie schließlich, öffnete die Tür weiter. »Klopfen Sie sich bitte die Füße ab.«
Sie ließ ihn eintreten, und er tat, wie sie ihm geheißen hatte, klopfte seine Füße am Schmutzfänger ab. Wieder starrten ihn die ausgestopften Tiere an.
Er holte tief Luft. »Kann ich die Pannenhilfe anrufen?«, fragte er, während er sich im Flur nach einem Telefon umsah. Aus unerklärlichen Gründen hatte er hier eines vermutet.
»Möchten Sie vielleicht als Erstes einen Tee?«, bot sie ihm an. Ihre Stimme war jetzt hoch.
»Das wäre wunderbar, danke«, sagte er erleichtert. Die Vorstellung von einem heißen Getränk half ihm, seine nervösen Gedanken etwas zu ordnen. »Geben Sie mir bitte Ihr Jackett«, fügte sie hinzu und streckte die Hand nach ihm aus. »Ich hänge es auf, damit es nicht im Weg ist.« Er zog das Jackett aus und reichte es ihr. Dabei hatte sie offensichtlich seinen Finger bemerkt. Das Blut war zu einem dunkelroten Pfropfen geronnen. »Was haben Sie denn da?«, fragte sie. »Kommen Sie bitte.« Sie hängte das Jackett an der Garderobe auf und führte ihn in die Küche.
Die Küche passte zu der Fassade und dem Flur. Offene Rohre zogen sich durch den Raum, in der Ecke stand ein milchverglaster Küchenschrank, der seine besten Tage längst hinter sich hatte, und ein alter Kühlschrank brummte leise vor sich hin. Im hinteren Bereich gab es eine Sitzgelegenheit: eine Eckbank mit abgewetztem Gobelinbezug, einen Resopaltisch und einen Stuhl mit schäbigem Polster. Dahinter befand sich ein alter, verstaubter Kachelofen, dessen Fliesen gesprungen waren und der offensichtlich schon lange nicht mehr in Betrieb war. Der einzige Lichtblick war der alte, mit Holz befeuerte Herd, der angenehme Wärme spendete. Erst jetzt wurde ihm bewusst, wie sehr sein Körper schmerzte.
Die Frau deutete auf die Eckbank.
»Setzen Sie sich«, sagte sie.
Er nahm ihr Angebot an und ließ sich auf der Bank nieder.
»Warten Sie einen Moment, ich hole Verbandszeug«, sagte sie und fügte hinzu: »Mein Vater ist Schlachter, da hat man so etwas immer im Haus.«
Er zuckte leicht zusammen und beobachtete, wie sie zum Küchenschrank ging, ihn öffnete und eine abgenutzte Schachtel mit Verbandsmaterial herausholte.
Als sie zurückkam, meinte sie: »Zeigen Sie mal.«
Er streckte ihr seine Hand entgegen und als sich dabei ihre Finger berührten, bemerkte er, wie sie rot wurde.
»Übrigens, mein Name ist Lotte«, sagte sie leise, ohne ihn anzusehen.
Jan zögerte einen Moment, bevor er schließlich antwortete: »Franz.«
Armes Ding, dachte er. Ihre Schüchternheit war unübersehbar. »Hier kommen sicher nicht viele Leute her.«
Sie sah ihn weiterhin nicht an, konzentrierte sich nur darauf, ihm einen notdürftigen Verband anzulegen. »So, erledigt«, meinte sie schließlich und verstaute das Verbandszeug wieder im Schrank. »Jetzt kümmere ich mich um den Tee.«
Sie ging zum Herd, um den Wasserkessel aufzusetzen.
»Danke«, sagte er. »Kann ich telefonieren?«
Lotte nickte. »Wissen Sie die Nummer der Pannenhilfe auswendig?«
Jan schüttelte den Kopf. »Vielleicht habe ich die Nummer auf meinem Handy gespeichert.« Er zog es aus der Tasche und starrte auf den schwarzen Bildschirm. »Ach nein, verflixt«, raunte er, »die Batterie ist leer. Ich hatte es vorhin die ganze Zeit an.«
Sie seufzte fast unmerklich, öffnete die Tischschublade und holte ein altes, zerfleddertes Telefonbuch und einen Zettel heraus. Sie blätterte im Buch. Er wurde langsam ungeduldig und wollte ihr schon helfen, aber dann notierte sie eine Nummer.
»Ich gehe jetzt nach oben«, gab sie kund. »Unser Telefon steht dort. Paps hat sich zwar gerade hingelegt, aber ich werde ihn hoffentlich nicht stören.«