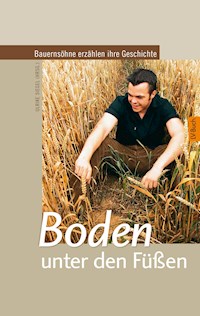
Boden unter den Füßen E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: LV Buch
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Boden unter den Füßen so lautet eine der über 20 Erinnerungen an eine Kindheit auf dem Bauernhof, die in diesem Buch gesammelt wurden. Herausgeberin Ulrike Siegel, weitreichend bekannt durch ihre Sammlung der Kindheitserinnerungen von Bauerntöchtern, geht in diesem ihrem nächsten Buch neue Wege. Denn hier erzählen erstmals Männer, wie sie ihre Kindheit und Jugend zwischen den 50er und 80er Jahren auf dem Land erlebt haben. Diese neue, männliche Sichtweise auf das Landleben ergänzt absolut notwendig die bisherigen Aufzeichnungen der weiblichen Ansicht in Ulrike Siegels zeitgeschichtlicher Arbeit. Wie war es für Jungen und junge Männer in der Landwirtschaft aufzuwachsen? Welche Ängste, Sehnsüchte und Perspektiven gab es für sie? Was hat sie in dieser Zeit besonders geprägt? Diese und andere Fragen werden in den spannenden, heiteren und ehrlichen Beiträgen beantwortet.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 278
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bauernsöhne erzählen ihre Geschichte
Boden unter den Füßen
ULRIKE SIEGEL (HRSG.)
Inhalt
Vorwort
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Impressum
Wie der Vater, so der Sohn?
Hier sind sie endlich – die Geschichten der Bauernsöhne. Schon seit dem Erscheinen der Bauerntöchter-Geschichten wurde immer wieder der Wunsch geäußert, doch bitte schön auch die Brüder dieser Bauerntöchter-Generation zu Wort kommen zu lassen. Wie haben diese das Aufwachsen auf dem Bauernhof damals erlebt? Was hat sie geprägt, wie blicken sie denn heute auf diese Zeit zurück?
16 Bauernsöhne gehen unter dem Arbeitstitel „Der Apfel fällt meist weit vom Stamm“ diesen Fragen nach. Es geht also um das Verhältnis Vater – Sohn, „Apfel“ – „Stamm“, um die Verwurzelung in der bäuerlichen Herkunft oder die Entfernung davon. Wie weit kann ein Apfel von seinem Stamm fallen?
Potenzielle Hoferben und passionierte Schlepperfahrer, aber auch weichende Erben und Weltenbummler beschreiben ihre Lebenswege, die alle auf einem Hof begannen und die sie in ganz unterschiedliche Richtungen führten. Alle haben sie in den 50er bis 70er Jahren auf Bauernhöfen in den unterschiedlichsten Regionen Deutschlands ihre Kindheit und Jugend erlebt, in der Zeit des beginnenden Strukturwandels, der zunehmenden Technisierung und Spezialisierung, in einem immer randständiger werdenden bäuerlichen Umfeld. Einige sind der Landwirtschaft treu geblieben, haben den elterlichen Hof übernommen oder sind nach Umwegen wieder dahin zurückgekehrt, andere haben ihr auch für immer den Rücken gekehrt.
Die autobiografischen Geschichten erzählen vom Aufwachsen mit Erfahrungen und Entbehrungen, zwischen Privileg und Verantwortung, von Weichenstellungen im Leben zwischen Bewahrung von Traditionen und der Entfaltung eigener Lebenspläne. Sie vermitteln mit Alltagsgeschichten ein Bild von Landwirtschaft, jenseits jeglicher Idealisierung und Verteufelung. Und sie reflektieren rückblickend den Wert bäuerlicher Sozialisation für ihr heutiges Leben. Sie machen damit einen spannenden Teil der Agrargeschichte erlebbar.
Mein ganz herzlicher Dank gilt allen Autoren, die sich auf dieses Wagnis eingelassen haben, für ihre Zeit und ihre Offenheit, mit der sie mit ihren sehr persönlichen Geschichten einen Einblick in ihr Leben gegeben haben. Möge es ihnen gelingen, die Bauern und den Wert ihres Tuns wieder mehr ins Blickfeld zu rücken. Nicht zuletzt wird von ihnen die Zukunft der ländlichen Räume und der Landwirtschaft abhängen.
Oktober 2009
Ulrike Siegel
Hans Georg Frank
Der Zettel auf dem Küchentisch
Hans Georg Frank, geb. 1954 in Gschwend im Welzheimer Wald (Baden-Württemberg), wächst mit zwei Brüdern auf. Nach dem Abitur arbeitet er als Redaktionsvolontär bei der Rundschau in Gaildorf, als Redakteur bei der Heidenheimer Zeitung und bei der Heilbronner Stimme. Seit 1985 als Korrespondent der Südwest Presse (Ulm) in Heilbronn. Verheiratet mit einer Fernsehjournalistin, zwei Kinder.
Auf den Zettel war Verlass. Wenn ich von der Schule, dem Gymnasium in Welzheim, nach Hause kam, fand ich während der Erntezeit die Nachricht meiner Mutter auf dem Küchentisch, sauber abgelegt vorne links, also unübersehbar. Die handschriftliche Notiz teilte mir stets zweierlei mit. Erstens: Sind auf der Wiese/dem Acker xy. Zweitens: Dein Essen steht im Backofen. Die Bedeutung dieser Botschaft hatte ich bald verinnerlicht: Wir warten auf dich, du musst vorher etwas essen – Ernährung ist auf dem Bauernhof schließlich eine Selbstverständlichkeit, Hausaufgaben dagegen konnten später erledigt werden.
Als braver Bub gehorchte ich natürlich, meistens wenigstens, und flitzte mit dem Fahrrad dorthin, wo die liebe Familie bereits schaffte. Nur wenn die Lehrer gar zu viel aufgegeben hatten, musste die Mithilfe reduziert werden. An Handlangerdienste war ich schließlich von klein auf gewöhnt. Zupacken, das gehörte zum Alltag auf dem Bauernhof. Ganz egal, was es zu erledigen galt, ob Kartoffeln roden, Rüben hacken, Grünfutter schneiden, Getreide ernten, auch für ein Kind gibt es immer etwas zu tun. Kaum, dass ich mich einigermaßen sturzfrei vorwärtsbewegen konnte, schon hatte ich irgendein Gerät in der Hand. Was eher spielerisch begann, entwickelte sich mit den Jahren zu scheinbar fest einkalkulierter Unterstützung. Rechen und Harke, Besen und Gabel gehören zu einem Bauernbuben, habe ich gelernt. In meinem kleinen Dorf im Schwäbischen Wald gab es keine Familie, in der dies nicht genauso gehandhabt worden wäre.
Volkswirtschaftlich mögen die kindlichen Handreichungen von höchst untergeordneter Bedeutung sein. Für die technische Fortbildung des Buben waren sie allerdings sehr wichtig. Wenn der Vater ein bestimmtes Werkzeug benötigte, durfte ja auf keinen Fall das falsche herbeigeschleppt werden, es musste sowieso alles dalli dalli erledigt werden. Also lernte der tüchtige Sohn die Unterschiede zwischen diversen Hämmern und Schraubenschlüsseln. Selbst bei Schaufeln und Gabeln musste sorgfältig nach dem jeweiligen Zweck getrennt werden. Sogar ganz spezielle Utensilien wie der Sapi bei der Waldarbeit sind einem lernfähigen Agrar-Assistenten bestens vertraut.
Ganz nebenbei wurde man Zeuge des technischen Fortschritts. Als kleiner Knirps guckte ich noch staunend zu, wie das Heu mit langen Gabeln auf einen Wagen mit eisenbeschlagenen Holzrädern gehievt wurde, auf dem der Großvater als Lademeister fungierte. Eine große Erleichterung war schon der „Heuschwanz“, der am Schlepper befestigt wurde, um den Nachschub für das Winterfutter hinterrücks aufzunehmen. Bald schon diente diese Konstruktion als Gerüst für ein zeltartiges Lager, denn der revolutionäre Ladewagen machte sie überflüssig. Auch für einen Bauernbuben, der für Technik nur mittelmäßige Begeisterung mobilisieren kann, gibt es kaum ein großartigeres Ereignis als den Erwerb eines neuen Schleppers, den man zudem noch weit entfernt – in diesem Fall in Heilbronn – abholen kann. Es war ein Güldner S 30 (oder S 35?), mit dem wir am 24. Mai 1965 unterwegs waren und aus einem sehr ungewöhnlichen Grund eine Pause in der Nähe von Aspach einlegen mussten. Die englische Königin Elisabeth II. kreuzte unseren Weg, als sie von Schwäbisch Hall nach Marbach am Neckar fuhr. Natürlich stellten wir uns an den Straßenrand und starrten den Konvoi mit geziemender Neugier an. Eine leibhaftige Königin läuft einem ja schließlich nicht alle Tage über den Weg.
Als Bauernsohn bist du ein Teil des Systems. Je älter du wirst, desto unverzichtbarer ist deine Mitarbeit. Diese eherne Regel stellt man nicht einfach in Frage. Es gab ja schließlich auch schöne Aufgaben. Den Schlepper über die abgemähte Wiese zu lenken, während der Wagen mit Heu beladen wird, das ist für einen Sieben-, Achtjährigen schon eine tolle Sache, jedenfalls viel toller, als hinter dem Pflug über den Kartoffelacker zu stolpern und die letzten Knollen aufzuklauben. Wenn mit dem schweren Schleifrechen noch der letzte Grashalm von der Wiese gekratzt werden musste, gehörte diese Tätigkeit nun mal zum schwäbischen Agrar-Glaubensbekenntnis „Bloß nix verkomme lasse“.
Das Bewachen der Kühe auf einer Weide, wohin sie über einen Gemeindeverbindungsweg getrieben wurden, konnte ich dank meiner blühenden Fantasie zum Wildwest-Abenteuer eines unerschrockenen Cowboys verklären. Fester Bestandteil des Rituals war die Kontrolle des elektrischen Zauns mit Hilfe eines Grashalms. Mit fortschreitender Technisierung des Hofes trieb ich die Kühe nicht mehr, wie es der Schäfer mit seiner Herde macht, jetzt wurden die Tiere an den Traktor gekettet, der im Schneckentempo den abgelegenen Weidegründen entgegentuckerte. Mir fiel oft am späten Nachmittag das Abholen der Kühe auf diese motorisierte Art zu. Das habe ich auch gerne erledigt, war ja nicht weiter schwierig und eigentlich mit keiner beschwerlichen Handarbeit verbunden. Nur mittwochs hat mir das nicht so recht gepasst. Mittwochs kam damals im einzig empfangbaren Radioprogramm des Süddeutschen Rundfunks eine Sendung, die ein junger Mensch um nichts in der Welt verpassen durfte. „Mittwochsparty“ hieß dieses Muss. Da wurden die aktuellsten Hits gespielt, die sonst nicht so oft über den Äther gingen. Glücklicherweise konnte ich ein von meinem ältesten Bruder beschafftes Kofferradio der Marke „Grundig“ benutzen, damit mir bestimmt nichts entging. Inwiefern sich diese musikalische Berieselung auf die Milchleistung der von mir eskortierten Kühe auswirkte, ist nie untersucht worden.
Schon mit zwei Jahren wurde Hans Georgs Begeisterung für Fahrzeuge aller Art deutlich
Für das Füttern der Kühe und Bullen wurde ich immer mehr eingespannt. Samstags, wenn die Grasrationen für zwei Tage beschafft werden mussten, kam ich zum Zusammenrechen und Aufladen mit, nachdem nun alle vierzehn Tage ein verlängertes Wochenende ohne Unterricht in Mode gekommen war. Abends wurde ich abgestellt zum Auffüllen der Tröge, was sich allerdings einigermaßen gut mit dem Fußballspielen auf dem Hof verbinden ließ. Wenn freilich das Kicken gerade mal arg spannend war, konnte es schon geschehen, dass ich mit dem Nachschub für die Milchlieferanten etwas in Verzug gekommen bin. Wenn es jahreszeitlich passte, habe ich die Viecher manchmal mit einer Extraportion Futterrüben für das Warten entschädigt.
Auch die Entsorgung der Verdauungsprodukte fand sich in meinem Aufgabenkatalog. Mit dem Mist hatte ich keinerlei Berührungsängste. Der Einsatz mit der Gabel ging mir sogar einigermaßen flott von der Hand: Aufladen und ruck, zuck mittels Kran abkippen. Das großflächige Ausbringen der Jauche machte mir wegen des Intensivaromas weniger Freude. Als ich jedoch alt genug war, mit dem Gespann auch über die Landstraße zu zuckeln, fand ich mehr Gefallen an der Beseitigung des Flüssigdüngers. Mit dem Fendt Dieselross (16 PS) ging es nämlich zunächst eine kleine Steigung hoch, sehr gemächlich. Weil die Strecke unübersichtlich war, mussten sich Autofahrer notgedrungen gedulden und hinten anstellen. Für manche eiligen Zeitgenossen war dieses Zeitlupentempo eine Zumutung, sie konnten gar nicht schnell genug jenen Punkt erreichen, an dem sie um die Kurve sehen und hoffentlich überholen konnten. Dazu jedoch rückten sie meist dem Fass mit der stinkenden Brühe sehr nahe. Ein Fehler: Wenn ich nämlich einen Gang hochschaltete, ließ ich die Kupplung ein bisschen abrupt los – physikalischen Gesetzen gehorchend, schwappte die Gülle aus dem lose befestigten Deckel auf die Motorhaube des Dränglers. Meine klammheimliche Freude konnte ich nur mühsam verbergen.
Wegen des Schlepperfahrens werden Bauernbuben von Kumpels aus Arbeiterfamilien oder aus der Stadt oft beneidet. Dabei ist die Zugmaschine ein gefährlicher Apparat. Dies musste ich am eigenen Leib erfahren, ohne schon selbst am großen Lenkrad zu sitzen. Ich dürfte wohl um die sechs Jahre alt gewesen sein, auf jeden Fall noch kein Schüler, als ich mit der Familie auf die Wiese fuhr, um Grünfutter zu holen. Der Schlepper, ein Eicher, stand an einer ziemlich abschüssigen Halde. Einziger Passagier: ich auf dem Sitz über dem linken Rad. Plötzlich setzte sich der Bulldog in Bewegung, rollte zunächst ganz langsam den Abhang hinunter. Meine Mutter wollte die Handbremse ziehen, stürzte aber. Mein Vater versuchte gleichfalls, den grauen Eicher zu stoppen – vergebens, er zog sich mehrere Knochenbrüche zu. Während meine Eltern mit schweren Verletzungen auf der Wiese liegen blieben, überschlug sich der Schlepper und kam auf allen vier Rädern in einem Bach zum Stehen. Dem verdutzten Knirps ist dabei nicht ein Härchen gekrümmt worden: Ich hatte mich, wohl instinktiv, am Sitz festgeklammert. Lebensretter war das Dach, das den gewaltigen Einwirkungen standgehalten hatte. Überrollbügel gab es damals noch nicht.
Als Reporter auf dem Schlepper 1978
Später, im Gymnasium, war die Abstammung aus einer Bauernfamilie eine eher zwiespältige Erfahrung. Vielen Lehrern dieser kleinstädtischen Bildungsanstalt schienen Kinder von Höfen der weit verstreuten Weiler nicht ins soziale Raster zu passen. Diese sogenannten Pädagogen widmeten sich mit auffallender Fürsorge lieber den Nöten der Sprösslinge angesehener Mitglieder der besseren Gesellschaft. Hatte der begriffsstutzige Abkömmling eines Arztes oder Architekten eine Verständnisblockade, nahmen sich diese Zwei-Klassen-Studienräte ihrer besonders an. Der Bauernbub durfte derlei Hingabe nicht erwarten. Wenn für ihn der Unterrichtsstoff zu schwierig war, musste er sich eben eine andere Schule suchen. Glücklicherweise war ich mit ausreichend Intelligenz ausgestattet, um solche Benachteiligung in erträglichen Grenzen zu halten. Mitschüler Thomas, ein Bauernbub, bekam dagegen oftmals die volle Breitseite dieses seltsamen Auswahlverfahrens ab, bis hin zu körperlichen Übergriffen.
Die Mitschüler hatten mit meiner Abstammung glücklicherweise keine Probleme. Ganz im Gegenteil: Musste etwa für den Biologieunterricht ein Anschauungsobjekt besorgt werden, das im Lehrmittelfundus nicht in ausreichender Menge zur Verfügung stand, pflückte ich eben einige Büschel Salbei und schleppte selbige in die Schule. Mitunter führten solche Beschaffungsmaßnahmen auch zu Irritationen. Einmal verlangte Oberstudienrat Dr. Heiligmann nach frischen Birnenblüten. Eine leichte Aufgabe, dachte ich und stopfte das Material in eine große Plastiktüte. Als ich die Beute großzügig verteilte, musste ich zu meinem Entsetzen feststellen, dass ich ein Behältnis erwischt hatte, in dem vorher wohl Heringe eingepackt worden waren. Peinlich! Doch ich war extrem erleichtert, als der kluge Botanik-Experte die Schüler über das typische Fischaroma der Blüten aufklärte.
Meine Klassenkameraden lernten auch den Freiraum eines Bauernhofes zu schätzen. Die Fertigstellung eines großzügig bemessenen Maschinenschuppens mit Trockenboden für das Getreide verknüpfte ich mit einer Party, wie es sie bis dahin noch nicht gegeben hatte. Weil ja reichlich Platz vorhanden war, wo später der Weizen gelagert werden sollte, konnten alle Gäste übernachten. Das Fest geriet zu einem vollen Erfolg, wenngleich die Nachbarn möglicherweise nicht zum Schlaf in der sonst gewohnten Ungestörtheit gefunden haben dürften. Solche geselligen Zusammenkünfte verlegte ich auch gerne in abseits gelegene Waldhütten, die ich dank guter Beziehung zum Forstpersonal nutzen durfte. Fuchs und Hase haben dann sicherlich keine ruhige Nacht gehabt, dafür war die Musik vom Kassettenrecorder leider viel zu laut.
Das Dorfleben bot Freiräume, die sich meine Kinder heute nicht einmal annähernd vorstellen können. Wir hatten Platz, viel Platz, konnten auf vielen Wiesen kicken, stromerten durch Wälder, stauten Bäche auf und bauten „Lägerle“, rasten querfeldein mit unseren Fahrrädern, bretterten auf selbst gebauten Fahrzeugen des Typs „Abenteuerlich“ die steilsten Gassen hinunter, kletterten auf schwindelerregend hohe Bäume. Wenn wir stundenlang unterwegs waren, musste sich keine Mutter Sorgen machen und sich bei Hinz und Kunz nach unserem Verbleib erkundigen. Wir kamen ja nach Hause, meistens allerdings ziemlich verdreckt und mit leicht ramponierter Kleidung – aber hungrig und glücklich.
Immer nah an der Landwirtschaft: Interview mit einem Schäfer auf den Heilbronner Neckarwiesen 1980
Schade nur, dass in den Ferien die familiären Verpflichtungen zum Nachteil gerieten, was mit fortschreitender Pubertät als Einengung der persönlichen Entfaltung empfunden werden musste. Entschwanden die lieben Freunde mit ihren Eltern an entlegene Strände von Mittelmeeranrainerstaaten, so durfte ich, der Bauernbub, meinen Sonnenbrand auf der heimischen Wiese kultivieren. Urlaub, das war ein Fremdwort, fast ein Tabu, weil so etwas einfach nicht mit dem landwirtschaftlichen Dasein zu vereinbaren war. Für ein paar Wochen mit einem Interrail-Ticket durch Europa ziehen? In einem Zug von Saloniki nach Stockholm? Völlig undenkbar! Für Abenteuer vor der Haustür sorgte allenfalls mein Freund Fittich, der mir zeigte, wie man ganz einfach mit der Hand eine Forelle aus dem Huberlesbach holt. Die Fische waren jedoch so klein, dass sie rasch wieder ihre Freiheit im klaren Wasser zurückbekamen.
Ich musste schon 18 Jahre alt werden, ehe ich tatsächlich eine Reise unternehmen durfte/konnte, die diese Bezeichnung auch verdiente. Ein kleines Dorf namens Arcenant in Burgund war das Ziel. Doch dort ging es nicht um Laisser-faire mit Baguette und Coq au vin, wenigstens nicht in erster Linie. Kurz vor dem Abitur wollte ich mit meinen Freunden die nicht ganz befriedigenden Französischkenntnisse radikal verbessern. Das ehrenwerte Vorhaben konnte nicht ganz in die Tat umgesetzt werden, weil die Dorfjugend auffallend größeres Interesse an unseren schwäbischen Schimpfwörtern zeigte, als uns neue Vokabeln beizubringen. In dem Kaff gab es kaum mehr einen Burschen, dem nicht „Halbdackel“ und „Schafseckel“ flüssig über die Lippen gegangen wäre. Selbst einige Mädchen, die sich tagsüber bei der Himbeerernte die Finger einschmutzten, fanden Gefallen an den Exoten aus Allemagne.
Den sommerlichen Arbeitseinsätzen waren freilich auch positive Aspekte abzugewinnen. Hier lernte ich, wie wichtig Solidarität ist. Nicht nur innerhalb der Familie, die gemeinsam eine Aufgabe erledigt. Gerne denke ich auch daran zurück, wie Nachbarn manchmal mit anpackten, wenn ein plötzlicher Regenschauer, von dem der Wetterbericht nichts gewusst hatte, das Heu kurz vor dem Einbringen einzunässen drohte. Dann wurde mit vereinten Kräften und erhöhtem Tempo geschafft, um der meteorologischen Unbill, ruck, zuck, ein Schnippchen zu schlagen. Und anschließend wurde gemeinsam gevespert. Alle zusammen am Küchentisch vor vollen Tellern, das war ein mehr als sättigendes Erlebnis.
Jeden Tag aufs Neue wurde deutlich, dass nur durch Leistung etwas erreicht werden kann – „Wer nix tut, hat nix“. Dieser Grundsatz fiel mir ein, als ich als Teenager das Angebot bekam, ganz scheußliche Bilder mit Schutzengeln und Kitschblumen zu verkaufen und dafür mein Taschengeld nennenswert aufzustocken. Ich muss ziemlich erfolgreich gewesen sein, denn der Händler hatte nicht mit einem solchen Absatz gerechnet. Wenn es eine Geldquelle anzuzapfen gab, war ich schnell zur Stelle. Das Zählen der Tiere in den Ställen für den Viehversicherungsverein brachte ebenso ein paar Pfennig ein wie das „Fleischumsagen“, wenn nach einer Notschlachtung die Mitglieder der Solidargemeinschaft ihre Rationen abholen mussten.
Keineswegs möchte ich den Eindruck erwecken, dass der Fortbestand unseres Familienbetriebs von meiner Arbeitskraft abhängig gewesen wäre. Ich war lediglich ein ganz kleines Rädchen in dem großen Getriebe. Eigentlich nur ein Ersatzrädchen. Denn zum legitimen Nachfolger war ja mein ältester Bruder auserkoren, auch wenn dieser sich auf einer weiterführenden Schule sicherlich bestens behauptet hätte. Ich hatte nicht sonderlich konkrete Überlegungen über meine berufliche Zukunft angestellt. Gewiss, es gab im Endspurt zur Reifeprüfung vage Planspiele: Pfarrer, Rechtsanwalt, Lehrer? Oder doch lieber Küchenchef? Dabei hatte mein Vater längst erkannt, wo es karrieremäßig langgehen könnte. Schon mit 16 Jahren hatte ich mir eine einträglich-abwechslungsreiche Freizeitbeschäftigung zugelegt – ich war freier Mitarbeiter für vier Tageszeitungen meiner von Gemeindegrenzen zerteilten Heimat. Ich ließ mich zu Hauptversammlungen von Vereinen aller Art chauffieren oder berichtete ausführlich über einen plötzlichen Wintereinbruch im Mai, auch die neue Stromleitung quer durch den Landstrich hielt ich als Chronist für die Nachwelt fest. Als eines Tages der Lokalchef der „Rundschau“ in Gaildorf bei uns zu Hause eines meiner Manuskripte abholte, fragte ihn mein Vater bei einem Gläschen selbstgebrannten Obstwassers wie zufällig, ob er mich nicht als „Lehrling“ einstellen würde. Ohne Zögern und Zaudern stimmte der Redakteur zu. Die schriftliche Bewerbung konnte entfallen, ich hatte ja schon genügend Spalten mit meinen journalistischen Ergüssen gefüllt. Auf das Vorstellungsgespräch in der Konzernzentrale wurde wenigstens der Form halber nicht verzichtet, so kam das Landei wenigstens mal in die Landeshauptstadt.
Der nahtlose Übergang von der Schule ins Berufsleben – bis zum Antritt meiner Stelle als Volontär verdiente ich mir ein paar Wochen lang ein ordentliches Salär als Briefträger – entsprach genau meinen Vorstellungen. Vom Büffeln und Pauken hatte ich genug, auch Rumhängen in irgendwelchen Universitäten wollte ich nicht. Mich drängte es nach sichtbarer Leistung, die zudem ordentlich entlohnt wurde. Und Journalismus ist ja mit der Landwirtschaft durchaus verwandt: Es gibt geregelte Abläufe, dazwischen freilich tauchen immer wieder Überraschungen, unvorhersehbare Ereignisse auf.
Als Bauernbub habe ich ganz unbewusst auch das Rüstzeug für einen rasenden Reporter erworben. Einsatzbereit bei jeder Tages- und Nachtzeit, rasche Auffassungsgabe, auch in kniffligen Situationen die Nerven behalten. Das „Bauern-Gen“ ist eine sehr segensreiche Ausstattung. „Wir Bauern“ sind belastbarer, wir schauen nicht auf die Uhr oder den Kalender, wenn es eine Arbeit zu erledigen gilt, wir verzweifeln nicht vorauseilend, sondern vertrauen auf unseren Problemlösungsverstand.
Wie der Landwirt nachts aus den Federn hüpft, wenn eine Kuh nicht komplikationslos kalben will, so macht sich der Reporter auf den Weg, wenn zu unbotmäßiger Zeit ein Zug entgleist oder ein durchgeknallter Typ bis zum frühen Morgengrauen in einer Bank traumatisierte Geiseln bedroht. Die Arbeitseinstellung scheint sich bei meinen Kollegen in der Zentralredaktion herumgesprochen zu haben. Muss mal wieder ein Termin wahrgenommen, ein Sachverhalt recherchiert werden, für den sich sonst niemand auf die Schnelle findet, wissen sie schon, wo sie anrufen müssen. Gerade für Journalisten ist eine bäuerliche Grundbildung sehr hilfreich. Auf einem Hof lernt man vieles, weil man vieles kennen und können muss. Landwirte sind Botaniker, Zoologen, Veterinäre, Meteorologen, Mechaniker, Manager, Techniker, Tüftler sowieso. Eine solche Universalqualifikation nützt auch Reportern, die heute über den Amoklauf, morgen über Altstadtsanierung und übermorgen über Armeeabzug, Arbeitslosigkeit und Abenteuerurlaub berichten wollen.
Bei meiner Arbeit kann ich meine Herkunft sowieso nicht verleugnen. Immer wieder fallen mir bäuerliche Themen ein und auf, die interessanten Lesestoff abgeben und danach von lieben Kollegen konkurrierender Organe aufgegriffen werden. Als ich eines Tages über die immer hemmungslosere Klauerei auf den Feldern und den dadurch verursachten „Schaden in Millionenhöhe“ ausführlich berichtet hatte, nahmen sich auch andere Medien dieser beklagenswerten Zeiterscheinung an. Eine Reportage über die Entwicklung des Landwirts zum Festwirt war auch dem Fernsehen einen längeren Beitrag wert.
Zu meinen Wurzeln kehre ich gerne zurück. Wie früher als kleiner Bub helfe ich auch heute noch ganz selbstverständlich, wenn ich gebraucht werde. Kartoffelernte, Waldarbeit, Stroh pressen, Heuballen aufladen – für mich ist das eine wohltuende Abwechslung von meiner beruflichen Eingleisigkeit. Geruchsbelastungen sind nicht zu befürchten, weil im Stall schon lange keine Viecher mehr stehen. Im Gegenzug kann ich mich auf ausreichenden Nachschub an Nahrungsmitteln aus familiärer Produktion verlassen, wodurch nicht nur meine Lebenshaltungskosten beträchtlich gesenkt, sondern die Qualitätsnormen in Vorratskammer und Gefrierschrank wesentlich erhöht werden. Fest eingeplant sind die Schnitzel und Würste von einem Schwein, das meine Mutter jedes Jahr extra mit ausgesuchten Leckerbissen mästet und das ganz zufällig zur Weihnachtszeit die Schlachtreife erreicht hat.
Der Blick zurück, jetzt nach mehr als 50 Jahren, erfüllt mich nicht mit wehmütigem Bedauern über Zwänge und Enge. Manchmal ertappe ich mich sogar bei dem Gedanken, dass meinen Kindern die vielfältigen Möglichkeiten der Erfahrungssammelei, die ich haben durfte, gänzlich fehlen, auch wenn sie in der Weltgeschichte herumreisen können und ihnen kaum ein Wunsch nicht erfüllt wird.
Ich jedenfalls bin zufrieden.
Matthias Stührwoldt
Fallobst
Matthias Stührwoldt, geb. 1968 in Neumünster (Schleswig-Holstein), wächst mit einem älteren Bruder in Stolpe (Kreis Plön) auf einem Gemischtbetrieb auf. Nach dem Abitur landwirtschaftliche Lehre, Zivildienst, Ausbildung zum Erzieher, Besuch der Landwirtschaftsschule und der Höheren Landbauschule. Seit 1998 Bauer auf dem Heimathof. Seit Mitte der neunziger Jahre Autor von ländlichen Texten aller Art, vor allem für die Unabhängige Bauernstimme. Erste Buchveröffentlichung (Verliebt Trecker fahren) 2003. Zahlreiche Leseauftritte, vor allem in Norddeutschland. Schließlich muss er morgens wieder melken. Seit 1991 verheiratet mit Birte, fünf Kinder.
Der Apfel und der Stamm. Das Erste, was mir in den Sinn kam, als ich über diese beiden Begriffe nachdachte, war: Fallobst. Wir alle sind Fallobst; jeder und jede von uns ist Fallobst.
Fallobst ist nicht glatt und schier. Fallobst hat Stellen, Dellen und Ditscher. Ich hab Stellen, Dellen und Ditscher. Es gab eine Zeit, in der ich sehr darunter gelitten habe, und ich wollte, sollte ich selber Vater werden, dafür sorgen, dass meine Kinder keine Stellen, Dellen und Ditscher kriegen.
Inzwischen bin ich schon seit 16 Jahren Vater; meine Liebste und ich haben fünf Kinder, drei Mädchen und zwei Jungs. Sie alle sind grundverschieden, aber sie alle haben Stellen, Dellen und Ditscher, denn sie sind Fallobst. Und die Stellen, Dellen und Ditscher gehören dazu. Sie lassen sich nicht vermeiden. In Wahrheit machen sie uns erst zu dem, was wir sind: Individuen, unverwechselbare Individuen.
Wir sollten unsere Stellen, Dellen und Ditscher annehmen, mehr noch: Wir sollten ihnen dankbar sein. Ohne sie wären wir ein Granny Smith, Handelsklasse A. Glatt und schier und fad und stinklangweilig.
Ich bin Bauer, und ich bin es gerne und leidenschaftlich. Aber ich bin kein besonders guter Landwirt. Da sind andere besser, viel besser. Dennoch komme ich zurecht. Seit elf Jahren schon bewirtschafte ich den Hof, den ich von meinen Eltern übernehmen durfte, und obwohl der Betrieb in dieser Zeit nicht nennenswert gewachsen ist, sind wir weit davon entfernt pleitezugehen.
Meine Vorfahren väterlicherseits sind noch nicht seit besonders langer Zeit Bauern. Sie waren Landarbeiter auf einem großen Gut hier in Schleswig-Holstein. Im Jahre 1911 kauften meine Urgroßeltern einen kleinen Hof hier im Dorf; sie waren die „Kätner vom Kielerkamp“. Mein Opa war 1903 geboren worden und er konnte sich noch daran erinnern, wie der Gutsherr meine Urgroßeltern geschlagen hatte. Wenn er mir, seinem Enkel, Jahrzehnte später davon erzählte, füllten sich seine Augen sofort mit Tränen. Bauer zu sein, freier Bauer sein zu können, das bedeutete ihm viel. Die Freiheit meinte vor allem: Freiheit von Knechtschaft. Das hat meinen Vater, das hat auch mich geprägt.
Meine Großeltern hatten zwei Söhne. Mein Vater Johannes wurde 1934 geboren, sein Bruder 1937. Mein Vater übernahm in den frühen sechziger Jahren den Hof. 1962 heiratete er seine Dorothea, eine Bauerntochter vom anderen Ende unseres Landkreises. 1963 wurde mein großer Bruder Udo geboren, 1968 ich.
Im Jahre 1965 hatten meine Eltern die Möglichkeit, sich zu vergrößern. In gut drei Kilometer Entfernung vom Kielerkamp stand ein 32 Hektar großer Hof zur Übernahme auf Leibrente an. Thea und Hannes wagten den Schritt. Sie verschuldeten sich, um die Anzahlung leisten zu können, zogen auf den Hof Wittmaaßen und wirtschafteten fortan von dort aus, während der Kielerkamp zum Sitz der Altenteiler wurde. Meine Großeltern lebten dort; heute leben dort meine Eltern. Drei Kilometer entfernt. Die perfekte Distanz zwischen den Generationen: Man ist dicht beieinander, aber man geht sich nicht zu sehr auf die Nerven.
Ich glaube, meine Kindheit war eine ziemlich normale Bauernhofkindheit in den siebziger Jahren. Es war eine überwiegend glückliche, aber niemals unbeschwerte Zeit für mich. Und ich glaube, dass es nirgends, in keiner Familie, so etwas wie eine unbeschwerte Kindheit gibt. Jedes Kind muss da durch, muss sein Leben leben, muss sich entwickeln, muss wachsen an Problemen, und das ist niemals leicht.
Für meine Eltern gab es nur eine Priorität: Der Hof musste laufen. Das war bei vielen Bauern so; bei uns war es, wahrscheinlich aufgrund des großen Wachstumsschrittes und der damit verbundenen finanziellen Belastung, noch eine Spur härter, vor allem für meine Eltern. Nach ihrer Hochzeitsreise – eine Woche Zürich, wo meine Mutter in jungen Jahren als Hauswirtschafterin tätig gewesen war – hatten sie nie auch nur einen Tag frei, bis sie zweiundzwanzig Jahre später, also 1984, mit einem Landtechnikhandelsunternehmen für drei Tage ins Allgäu fuhren: zum Fendt-Werk in Marktoberdorf. Mit einem Bus voller anderer Bäuerinnen und Bauern, die wahrscheinlich auch alle zum ersten Mal seit ihrer Hochzeit von zu Hause weg kamen.
Matthias mit Collie Semm 1979
Meine Eltern hatten wenig Zeit für uns Kinder. Wir liefen einfach so mit. Es gab keine Extrawürste für uns. Wenn ich heute sehe, wie viele junge Eltern ihr ganzes Leben und ihren ganzen Alltag um ihre Gören herum organisieren, dann muss ich oft schmunzeln. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass meine Eltern irgendwann einmal eine Unternehmung nur unseretwegen gemacht hätten. Wenn wir tagsüber mal wegfuhren, dann meist zu Geburtstagen irgendwelcher Großonkels. Wenn wir Glück hatten, gab es dort andere Kinder zum Spielen. Wenn nicht, gab es nur muffig feuchte Begrüßungsküsse der senilen Großtanten und als Highlight ein Eis auf dem Rückweg, an der Tanke. Ausflüge in den Zoo, in einen Freizeitpark oder auch nur ins Kino: So etwas kam bei uns nicht vor. An Urlaub war schon gar nicht zu denken. Es war die Zeit, in der es nicht unüblich war, dass die Klassenkameraden schon mal mit ihren Eltern in den Ferien wegfuhren. Mein Vater sagte immer: „Irgendwann fahren wir auch einmal in Urlaub.“ Das sagte er so lange, bis sowohl mein Bruder als auch ich aus dem Alter heraus waren, in welchem man gerne mit seinen Eltern in den Urlaub fährt. Im Nachhinein empfinde ich das als sehr schade, denn niemals erlebte ich meine Eltern abseits ihres kräftezehrenden und von wirtschaftlichen Sorgen geprägten Alltags. Nie waren meine Eltern unbeschwert, nie hatten sie Feierabend, nie Muße für irgendwelche Freizeitaktivitäten als Familie. Das wollte ich in meiner eigenen Familie anders machen. Eine Woche Familienurlaub pro Jahr muss einfach drin sein, und die große Bereitschaft meiner Eltern, in der Zeit unserer urlaubsbedingten Abwesenheit auf dem Hof tätig zu sein, interpretiere ich jetzt als ihr spätes Eingeständnis, damals vielleicht doch nicht immer die richtigen Prioritäten gesetzt zu haben. Nach etlichen Familienurlauben ist unsere Älteste inzwischen so alt, dass sie keinen Bock mehr auf Reisen mit uns hat. Es sind Jahre und Jahrzehnte, aber sie huschen einfach so vorbei.
Dass unsere Eltern so wenig freie Zeit aufbringen konnten, hatte für uns Kinder Vor- und Nachteile. Zwar gab es für uns keine Kinderbespaßungserlebnispädagogik, aber wenigstens waren unsere Eltern immer da. Uns wurde keine Show vorgespielt; wir waren mitten im Leben, und wenn unsere Eltern arbeiteten, hatten wir Freiraum, den wir bald zu nutzen wussten. Wir bewegten uns früh alleine durchs Dorf, und meine Eltern vertrauten darauf, dass alles gut ging. Und es ging alles gut.
Einmal, so kann ich mich erinnern, gab es Ärger, weil meine Eltern sich Sorgen machten. Es waren Sommerferien; ich glaube, ich hatte gerade Schwimmen gelernt. Nachdem ich meiner Mutter versprochen hatte, die Nichtschwimmergrenze nicht zu überqueren, durfte ich alleine zum See und sollte zu einer bestimmten Zeit wieder zu Hause sein. Am See traf ich meinen großen Bruder, der am späten Nachmittag im Nachbarort noch ein Fußballspiel hatte. Ich machte mir überhaupt keine Gedanken, ich bin ja bei Udo, alles in Ordnung, so empfand ich und begleitete ihn, um beim Fußballspiel zuzugucken. So kam ich irgendwann mit erheblicher Verspätung mit dem Rad auf den Hof gefahren. Dass mein Vater so unglaublich böse war, kam für mich völlig überraschend. Er trug gerade die vollen Milchkannen über den Hof. Als er mich sah, ließ er sie einfach fallen. Ich erinnere mich noch, dass ich sah, wie die Milch überschwappte, unglaublich, Vater verschüttet die Milch, da bekam ich eine der sehr seltenen Ohrfeigen, die heftigste meines Lebens. Mein Vater schrie: „Kannst du dir vorstellen, was für Sorgen wir uns gemacht haben?“ Nö. Konnte ich nicht. War doch alles okay. Ich heulte, halb vor Schmerz, halb, weil ich beleidigt war.
Frisch verliebt 1990
Dass meine Eltern keine Zeit hatten, fand ich meistens gar nicht so schlimm. Das war ja auch nicht ungewöhnlich. In meiner Grundschulklasse kam noch etwa ein Drittel der Kinder von einem Bauernhof, und überall war es ähnlich. Blöder fand ich, dass wir so arm waren. Das war zwar nicht wirklich so, aber das war ein vorherrschendes Gefühl meiner Kindheit: Wir waren arm, wir konnten uns nichts leisten. Das fing schon beim Auto an. Alle anderen Bauern fuhren einen Mercedes 200 D – meine Eltern fuhren Käfer, alte, gebrauchte Käfer, die mein Onkel in seiner Werkstatt immer wieder zurechtbriet. Dabei hatten sich meine Eltern durch die harte, niemals enden wollende Arbeit längst einen gewissen Wohlstand geschaffen. Aber sie hatten sich so an ihr spartanisches, überaus bescheidenes Leben gewöhnt, und es gab keinen triftigen Grund, das zu ändern. Jede Ausgabe wurde gründlich überlegt, so gründlich, dass ich daraus nur schließen konnte, dass wir arm waren und uns nichts leisten konnten. Noch heute, als wirklich wohlhabende Altenteiler, kaufen meine Eltern nur die billigsten Lebensmittel beim schäbigsten Discounter. Gleichzeitig beschweren sie sich gern über die schlechten Erzeugerpreise in der Landwirtschaft. Dass da ein Zusammenhang bestehen könnte, wollen sie nicht akzeptieren. „Was nützt es denn schon, wenn einer woanders einkauft?“, fragen sie dann. Und horten das Geld, bis es so viel wird, dass sie einen Teil davon in den Betrieb stecken. Wofür ich dann wieder dankbar bin. So einfach ist das, und so kompliziert.
Natürlich mussten mein Bruder und ich – wie alle Bauerngören – auf dem Hof helfen. Wir wurden dabei aber niemals überfordert; immer ging die Schule vor; wir waren niemals dermaßen eingespannt, dass die Arbeit ohne uns nicht zu bewältigen war. Zumindest bei einem der Bauernsöhne aus dem Bekanntenkreis war das ganz anders. Der musste schon sehr jung heftig ran. Er übernahm den Hof, aber ich bin sicher: Er hat ihn gehasst, bis er ihn später irgendwie lustvoll an die Wand gefahren hat, weil es keinen anderen Weg gab, ihn los zu werden.
Die Mithilfe im Betrieb habe ich nur selten als Belastung empfunden. Bis ich elf Jahre alt war, hatte ich keine festen Aufgaben auf dem Hof, sondern musste nur gelegentlich, zum Beispiel beim Steinesammeln, mit anpacken. Zum Glück hatten wir keine Rüben. Vom Rübenhacken erzählten die anderen Bauernkinder immer wahre Horrorgeschichten, stundenlang in der Sonne stehen, endlose Rübenreihen von sich und nicht vorankommen, während die Sonne einem auf den Pelz brennt und das Hirnwasser langsam verdunstet.
Als mein Bruder dann seine Banklehre begann, übernahm ich seine täglichen Aufgaben im Stall. Das waren täglich etwa anderthalb Stunden Arbeit. Kühe, Jungtiere und Mastbullen füttern, Stroh und Heu vom Heuboden werfen, im Sommer die Kühe von der Weide zum Melken in den Stall treiben. Das tat ich meist sogar gerne; das strukturierte meinen Tag, und wenn ich die Arbeit gut machte, bekam ich etwas ab von Mutters Eiergeld, welches immer in einer Kaffeetasse im Küchenschrank gehortet wurde. Nur im Sommer, wenn meine Freunde am Badestrand des Stolper Sees rumhingen, verfluchte ich meinen täglichen Dienst, weil ich nun mal nicht gleichzeitig planschen und Kühe füttern konnte. Und die Arbeit ging vor, das hatte ich schon sehr früh gelernt. Also tat ich einsam meine Arbeit und dachte an die Mädels im Bikini, am See, beim Baden, ohne mich.
Matthias mit Mutter und Bruder Udo 1968
Wenn dann allerdings die Erntezeit kam, war es immer voll und toll auf dem Hof. Als ich so vierzehn, fünfzehn Jahre alt war, schleppte ich immer einige Kumpels mit, die dann beim Stroh- oder Heuabladen halfen. Sie verdienten sich so ein paar Mark extra, und wir hatten viel Spaß bei der Arbeit, noch mehr allerdings in den Pausen dazwischen. Trotz aller Sparsamkeit waren meine Eltern immer sehr gastfreundlich. Aller Besuch wurde gut versorgt; es gab immer von Mutter selbst gebackene Kuchen und Kekse, und schon früh war es okay, wenn wir mal ein Bier tranken oder uns Besucherzigaretten aus dem Küchenschrank stibitzten. So wurde unsere Küche eine Zeitlang beliebter Treffpunkt für meine Clique.
Weihnachten 1976





























