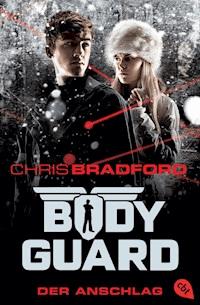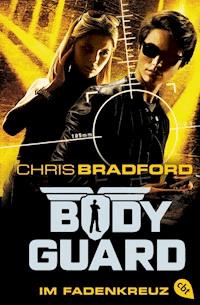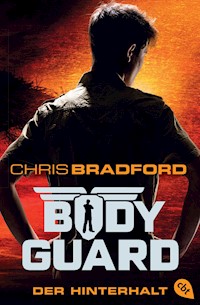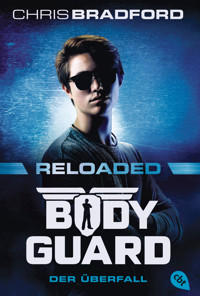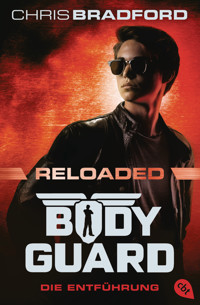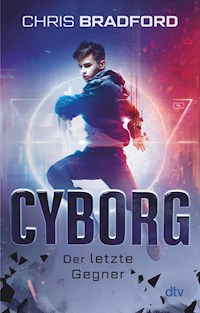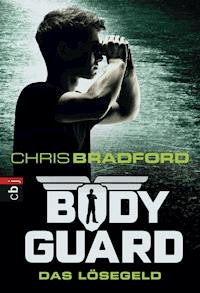
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: cbj
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Die Bodyguard-Reihe
- Sprache: Deutsch
Geld oder Leben - der zweite Auftrag des knallharten Schutzengels Connor Reeves!
Kidnapper haben auf hoher See die Jacht eines schwerreichen australischen Medienmoguls geentert und dessen Töchter in ihre Gewalt gebracht. Nun wollen sie ein Lösegeld in Millionenhöhe erpressen. Sie ahnen jedoch nicht, dass der so harmlos wirkende 14-Jährige, der sich ebenfalls an Bord befindet, in Wahrheit ein ausgebildeter Elitekämpfer ist. Plötzlich haben sie ein Problem. Denn Connor Reeves hat nicht die Absicht, klein beizugeben. Der zweite Auftrag in seiner Laufbahn als Bodyguard erweist sich als Duell auf Leben und Tod ...
Erfolgsgarant Chris Bradford liefert mit "Bodyguard" kugelsichere Action kombiniert mit explosiven Showdowns.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 481
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Inhalt
PROLOG
KAPITEL 1
KAPITEL 2
KAPITEL 3
KAPITEL 4
KAPITEL 5
KAPITEL 6
KAPITEL 7
KAPITEL 8
KAPITEL 9
KAPITEL 10
KAPITEL 11
KAPITEL 12
KAPITEL 13
KAPITEL 14
KAPITEL 15
KAPITEL 16
KAPITEL 17
KAPITEL 18
KAPITEL 19
KAPITEL 20
KAPITEL 21
KAPITEL 22
KAPITEL 23
KAPITEL 24
KAPITEL 25
KAPITEL 26
KAPITEL 27
KAPITEL 28
KAPITEL 29
KAPITEL 30
KAPITEL 31
KAPITEL 32
KAPITEL 33
KAPITEL 34
KAPITEL 35
KAPITEL 36
KAPITEL 37
KAPITEL 38
KAPITEL 39
KAPITEL 40
KAPITEL 41
KAPITEL 42
KAPITEL 43
KAPITEL 44
KAPITEL 45
KAPITEL 46
KAPITEL 47
KAPITEL 48
KAPITEL 49
KAPITEL 50
KAPITEL 51
KAPITEL 52
KAPITEL 53
KAPITEL 54
KAPITEL 55
KAPITEL 56
KAPITEL 57
KAPITEL 58
KAPITEL 59
KAPITEL 60
KAPITEL 61
KAPITEL 62
KAPITEL 63
KAPITEL 64
KAPITEL 65
KAPITEL 66
KAPITEL 67
KAPITEL 68
KAPITEL 69
KAPITEL 70
KAPITEL 71
KAPITEL 72
KAPITEL 73
KAPITEL 74
KAPITEL 75
KAPITEL 76
KAPITEL 77
KAPITEL 78
KAPITEL 79
KAPITEL 80
KAPITEL 81
KAPITEL 82
KAPITEL 83
KAPITEL 84
KAPITEL 85
KAPITEL 86
KAPITEL 87
KAPITEL 88
KAPITEL 89
KAPITEL 90
KAPITEL 91
KAPITEL 92
KAPITEL 93
KAPITEL 94
KAPITEL 95
KAPITEL 96
KAPITEL 97
KAPITEL 98
KAPITEL 99
KAPITEL 100
KAPITEL 101
KAPITEL 102
KAPITEL 103
KAPITEL 104
KAPITEL 105
KAPITEL 106
KAPITEL 107
KAPITEL 108
KAPITEL 109
KAPITEL 110
KAPITEL 111
KAPITEL 112
KAPITEL 113
Gleich weiterlesen? Für Sie ausgewählt:
Newsletter-Anmeldung
Orientierungspunkte
Impressum
Widmung
Prolog
Hauptteil
DER AUTOR
© Danny Fitzpatrick
CHRIS BRADFORD recherchiert stets genau, bevor er mit dem Schreiben beginnt: Für seine neue Serie »Bodyguard« belegte er einen Kurs als Personenschützer und ließ sich als Leibwächter ausbilden. Bevor er sich ganz dem Bücherschreiben widmete, war Chris Bradford professioneller Musiker und trat sogar vor der englischen Königin auf. Seine Bücher wurden in über zwanzig Sprachen übersetzt und vielfach ausgezeichnet. Chris Bradford lebt mit seiner Frau, seinen beiden Söhnen und zwei Katzen in England.
Mehr Informationen zur Bodyguard-Serie unter:
www.cbj-verlag.de/bodyguard
CHRIS BRADFORD
DAS LÖSEGELD
Aus dem Englischen von
Karlheinz Dürr
Für meine Patin Ann und meinen Paten Andrew.
Danke, dass ihr mein Leben lang auf mich Acht gebt.
PROLOG
Brutal stieß er ihr den Lauf der Pistole gegen den Kopf. Kalter Stahl, hart und unerbittlich.
»Knie nieder!«, befahl er. Eine Stimme, so trocken und grausam wie der Wüstenwind.
Sie hatte keine andere Wahl. Blind ließ sie sich in die Knie sinken. Das schmutzige Tuch, mit dem er ihr die Augen verbunden hatte, ließ an den fadenscheinigen Stellen ein wenig Licht durch. Es stank nach schalem Schweiß. Sie stöhnte auf vor Schmerz, als sich ein spitzer Stein in ihr linkes Knie bohrte. Flüchtig schoss ihr der Gedanke durch den Kopf, dass sich die Wunde entzünden könnte, doch dann hörte sie ein Geräusch, das unendlich viel schlimmer war als eine Schürfwunde: das unheilvolle Klicken, als die Patrone in die Kammer geschoben wurde.
Sie erstarrte.
Ihr Entführer beugte sich zu ihr herab – sie konnte ihn nicht sehen, aber sie spürte seinen Atem, der warm und irgendwie vertraut über ihr Ohr strich. Er stank, ein bitteres Gemisch von Kaffee und Nikotin.
»Leb wohl, mein kleiner Spatz.«
Das war’s dann wohl, dachte sie und wunderte sich über ihre Gelassenheit. Doch nach all den Wochen der Ungewissheit, der fieberhaften Angst, der unzähligen schlaflosen Nächte hatte sie jede Hoffnung aufgegeben. Sie hatte die Angst hinter sich gelassen; nichts war geblieben als stumpfe Benommenheit. In wenigen Augenblicken würde sie tot sein. Der Gedanke weckte tief in ihrem Innern ein seltsames Gefühl – Erleichterung, dass ihre Qualen bald ein Ende haben würden.
Doch während sie auf die erlösende Kugel wartete, hörte sie irgendwo in ihrem Kopf plötzlich eine Stimme – zuerst schwach und leise, dann immer lauter. Die Stimme der Wut.
Warum haben sie mich im Stich gelassen? Warum wurde das Lösegeld nicht gezahlt? Was ist schiefgelaufen?
Sie hatte so viele gute Vorsätze gefasst, die sie einlösen wollte, wenn sie aus dieser Sache lebend herauskam, hatte so viele Hoffnungen gehabt, die sich immer wieder zerschlagen hatten – doch jetzt wurde ihr klar, dass sie sterben würde. Eine Kugel in den Kopf. Eine Leiche im Wüstensand.
Würde mich überhaupt jemand finden?, dachte sie. Und würden sie überhaupt noch feststellen können, wer ich war, wenn ich erst mal ein paar Tage in der glühend heißen Sonne gelegen habe? Oder ist es ihnen längst völlig gleichgültig, was aus mir wird?
»Bringen wir’s hinter uns«, murmelte sie. In diesem Augenblick sehnte sie sich sogar danach, dass ihr Henker endlich auf den Abzug drückte und ihrer langen Leidenszeit ein Ende setzte.
Stille.
Nichts klickte. Kein Knall. Nicht einmal eine Antwort. Nur das Surren der Fliegen in der drückenden Hitze.
Wieso braucht er so lange?, fragte sie sich. Oder gehört das nur wieder zu seinen Psychospielchen?
Ein Schweißtropfen rann unter der Augenbinde hervor und über ihre Wange.
»Traust dich wohl nicht, wie?«, krächzte sie mit zittriger Stimme. Erst Resignation, dann Ungeduld, und jetzt Frustration.
Niemand antwortete.
Endlich hob sie die zitternde Hand, traute sich, den stinkenden Stofffetzen von den Augen zu reißen. Sie blinzelte den Sand aus den Augen … und entdeckte, dass sie allein war, verlassen …
Sie befand sich in einem einfachen, düsteren Raum. Lehmwände. Das Gebäude schien nur aus diesem einen Raum zu bestehen. Eine notdürftig zusammengenagelte Holztür, durch deren Ritzen und Spalten ein paar Sonnenstrahlen wie scharfe Speere durch die Dunkelheit schnitten.
Soll ich zu fliehen versuchen?, fragte sie sich. Aber sie hatte keine Ahnung, was hinter der Tür auf sie wartete. Ihr Entführer? Das schwarze Mündungsloch einer Waffe? Oder, was ihr am wahrscheinlichsten vorkam, meilenweit nichts als glühend heißer Wüstensand?
Plötzlich flog die Tür krachend auf. Die gleißende afrikanische Sonne blendete sie, doch dann füllte eine dunkle Gestalt die Türöffnung. Ein Mann … bewaffnet, der Finger lag auf dem Abzug eines großen Maschinengewehrs. Jetzt erkannte sie, dass er eine Art Uniform trug, eine kakifarbene Hose.
Er machte einen Schritt in den Raum, schwenkte die Waffe herum, blickte sich rasch nach Gefahren um. Erst als er sicher war, dass sich niemand sonst im Raum befand, richtete er den Blick auf das Mädchen, das mitten im Raum auf dem Boden lag.
»Emily Sterling?«, knurrte er.
Ihre Kehle war zu ausgetrocknet, außerdem traute sie ihrer Stimme nicht. Sie nickte nur schwach.
Der Soldat drückte auf sein Mikro. »Yankee four an X-Ray. Geisel gesichert. Lebt. Wiederhole: Geisel LEBT.«
Emily sackte in sich zusammen. Er hob sie wie eine Stoffpuppe vom Boden auf und trug sie zur Tür hinaus.
Erst als sie in die grelle Sonne und den weiten Himmel blinzelte, wurde Emily allmählich bewusst, dass sie gerettet war. Gerettet. Ein Schluchzen brach aus ihr hervor und ließ sich nicht mehr stoppen.
»Es ist vorbei«, sagte der Soldat, nun plötzlich mit überraschend sanfter Stimme. »Jetzt bist du in Sicherheit.«
Sicherheit?, dachte Emily, während Tränen über ihre Wangen strömten und das Hemd des Soldaten durchnässten. Nein. Die wird es für mich nie mehr geben.
KAPITEL 1
»Kopf runter!«, brüllte Connor.
Einen Sekundenbruchteil später knallten die Schüsse und prallten wirkungslos gegen die Backsteinmauer.
Connors Klient war offenbar so geschockt, dass er nur noch an Flucht denken konnte. Immer wieder wollte er aufspringen und aus der Deckung sprinten. Aber das war die schlechteste aller Reaktionsmöglichkeiten, die sich boten. Ein unbekümmerter Spaziergang auf der Straße hatte sich in den ultimativen Bodyguard-Albtraum verwandelt – und jetzt hatte es einen gut geplanten Überfall aus dem Hinterhalt gegeben.
Connor war klar, dass seine nächste Aktion entscheidend sein würde. Automatisch schoss ihm die wichtigste Grundregel des Bodyguard-Jobs durch den Kopf: A-C-E – Assess, Counter, Escape.
Assess – Die Gefahr einschätzen: Überfall durch zwei bewaffnete Angreifer. Einer in einer Nebengasse, der andere hinter einem Baum. Absicht: Elimination, nicht Gefangennahme der Zielperson.
Counter – Der Gefahr begegnen: Kontermaßnahmen mussten Connors erste Priorität sein – Deckung zu finden und seinen Klienten in Sicherheit zu bringen. Aber die niedrige Backsteinmauer, hinter der er und sein Klient momentan kauerten, würde ihnen nicht mehr lang Deckung bieten. Die Heckenschützen mussten nur die Position wechseln, und schon würden er und sein Klient wieder völlig ungeschützte Zielscheiben abgeben.
Escape – Aus der Gefahrenzone fliehen: Leichter gesagt als getan! Wohin?
Connor tippte das Mikro an. »Alpha one an Control. Fordere Notevakuierung an.«
In Connors Ohrstöpsel knisterte es, dann war Charleys Stimme zu hören. Als Operationsleiterin des Teams reagierte sie sofort. »Alpha one, hier Control. Unterstützung ist unterwegs. Drei Minuten.«
Drei Minuten?, stöhnte Connor innerlich. Bis dahin würden sie längst Entenfutter sein. Und ohne eigene Waffen waren sie den Angreifern vollkommen schutzlos ausgesetzt.
Connor brauchte dringend eine Exit-Strategie. Und zwar schnell.
Er deckte den Klienten mit seinem Körper, spähte über die Mauer und checkte die Lage. Weiter rechts sah er ein paar dicht beieinanderstehende Büsche. Visuelle Deckung, wenn man fliehen wollte, aber keine physische Deckung gegen den Beschuss. Auch ein weiter unten an der Straße geparktes Auto gab ihm keine Hoffnung. Er hatte keine Ahnung, wie er ein Fahrzeug ohne Zündschlüssel in Gang kriegen sollte.
Connor warf einen Blick über die Schulter auf das Gebäude hinter ihnen – einen kleinen Lagerschuppen mit angebauten Büroräumen. Der Hintereingang war zwar nur zehn Meter entfernt, aber um dorthin zu gelangen müssten sie über völlig ungeschütztes Terrain spurten. Mit einem schnellen Blick vergewisserte sich Connor, dass der Feind noch nicht weiter vorgerückt war. Doch in diesem Moment huschte einer der Schützen von einem Baum zum nächsten, von dem aus er eine bessere Schussposition hatte. Connor blieb keine andere Wahl mehr.
»Los!«, zischte er, packte seinen Klienten am Arm und zerrte ihn hinter sich her zu dem Lagerschuppen hinüber.
Connor hielt den Jungen eng bei sich, um ihn so gut wie möglich zu schützen. Der Feind eröffnete wieder das Feuer. Kugeln flogen Connor und seinem Klienten buchstäblich um die Ohren, eine so dicht, dass er den Luftstrom an seinem Ohr fühlen konnte. Sie stürmten über den Asphaltstreifen, der sie vom Lagerhaus trennte. Und sie schafften es, ob durch schieres Glück oder durch ihre Schnelligkeit, hätte Connor nicht sagen können.
Connor riss die Tür auf … wollte die Tür aufreißen.
»Nein!«, schrie er und rüttelte wie verrückt an der verschlossenen Tür.
Zwecklos. Er gab auf und drehte sich um. Jetzt waren sie den Angreifern schutzlos ausgeliefert; vor dem Lagerschuppen bildeten sie lebende Zielscheiben. Connor riss den Klienten mit sich zu einem großen Müllcontainer auf Rädern, der ihnen wenigstens für kurze Zeit Deckung bieten konnte.
»Ich will noch nicht sterben!«, schrie der Junge und versuchte weiterzurennen.
Connor riss ihn zurück, stieß ihn hinter dem Container zu Boden und fauchte: »Bleib in Deckung!« Dann fügte er wütend hinzu: »Amir, verdammt, du machst es mir nicht gerade leichter!«
»Sorry«, antwortete sein Freund und grinste ihn unter der Sicherheitsbrille breit an. »Aber ich soll doch einen Klienten spielen, der in Panik gerät!«
»Okay, aber kann es nicht ein bisschen weniger Panik sein?«, zischte Connor ihn an. Im selben Augenblick ratterten ein paar Kugeln gegen den Container.
Amir zuckte zusammen und schützte den Kopf mit beiden Armen. »Bisschen schwierig unter diesen Umständen, meinst du nicht auch?«
Richie, der bei dieser Feldübung die Rolle des ersten Attentäters spielte, kam kurz hinter dem Baum hervor und feuerte einen wahren Hagel von Paintball-Kugeln auf Connor und Amir ab. Auch Ling, die zweite Angreiferin, feuerte; sie stand jetzt am Ende der niedrigen Backsteinmauer. Wenn auch nur ein Schuss traf, würde Connor diese Übung verlieren.
Connor hatte seinen ersten Feldeinsatz als Buddyguard der Tochter des amerikanischen Präsidenten mit großem Erfolg durchgeführt. Das Team war sehr beeindruckt gewesen, aber auch ein wenig neidisch auf seinen neuen Status als Star der Buddyguard-Organisation. Das einzige andere Mitglied, das jemals das goldene Buddyguard-Abzeichen verliehen bekommen hatte, war Charley, die es wahrhaftig verdient hatte. Gegen sie war Connor nur ein blutiger Anfänger, der zufällig ein bisschen Glück gehabt hatte.
Das war der Grund, warum es sich ein paar andere Teammitglieder vorgenommen hatten, ihm ein wenig die Flügel zu stutzen. Oder, wie Ling es ausgedrückt hatte, dafür zu sorgen, dass »Connor nicht total abhebt«. Connor selbst hatte kein Problem damit, ihre im Grunde freundschaftlichen Sticheleien zu ertragen, zumal er sich insgeheim selbst immer wieder die Frage stellte, ob sein Erfolg bei seiner ersten Mission nicht tatsächlich schieres Anfängerglück gewesen war. Es stimmte zwar, dass sein Vater bei der britischen Sondereinheit SAS gewesen war und als einer der besten Bodyguards gegolten hatte, aber das hieß noch lange nicht, dass Connor aus demselben Holz geschnitzt war. Er brauchte ständig neue Erfolge, um sein Selbstvertrauen zu stärken und seine Selbstzweifel zurückzudrängen.
Connor schaltete sein Mikro ein. »Alpha one an Control. Wo bleibt der Wagen?«
»Alpha one – dreißig Sekunden. Position halten.«
Während weitere Paintball-Kugeln gegen den Container klatschten und Farbe über ihre Trainers sprühten, murmelte Connor: »Bleibt mir denn was anderes übrig?«
Richie wechselte zu einem anderen Baum und nahm Amir ins Visier. Connor schob seinen »Klienten« weiter hinter den Container. Immer mehr Paintballs prallten gegen das Metallgehäuse und platzten. Endlich bog ein schwarzer Range Rover mit quietschenden Reifen in die Gasse ein, bremste abrupt und schwang dabei in Querposition, sodass er Connor und Amir zusätzlichen Schutz vor Richies Schüssen bot. Die Paintballs platzten harmlos gegen die Karosserie.
Ling hingegen konnte ihnen immer noch gefährlich werden. Um das Auto zu erreichen, mussten Connor und Amir ihre Deckung aufgeben und ein paar Schritte ungeschützt zum Auto rennen. Unmöglich, dass Ling die Gelegenheit ungenützt vorübergehen lassen würde. Aus fünfzehn Meter Entfernung würde sie mindestens einen von ihnen erwischen. Connor war klar, dass er in dieser Lage nicht ungeschoren davonkommen würde. Ob sie losrannten oder in der Deckung blieben, einer von ihnen würde sich auf jeden Fall einen Paintball einfangen.
Doch dann kam ihm eine Idee. Mit zwei blitzschnellen Tritten kickte er die Standbremsen an den Rädern des Containers nieder, packte Amir am Arm und schob gleichzeitig den Container mit der Schulter auf das Auto zu.
»Verdammt, was machst du denn?«, rief Amir, als sich der Container in Bewegung setzte und Richtung Auto rollte. Connor zwängte seinen »Klienten« zwischen sich und den Container, sodass er ihn mit dem eigenen Körper schützte, während er den Container mit beiden Händen schob.
»Ich wollte schon immer Müllmann werden«, keuchte er.
Ling feuerte, was das Zeug hielt, aber ihre Paintballs klatschten harmlos gegen den Container. Der Stahlkoloss kam in Fahrt, rollte immer schneller; Connor und Amir mussten rennen, um Schritt zu halten und dahinter in Deckung zu bleiben. Doch der schwerfällige Müllbehälter ließ sich nicht mehr steuern – er prallte gegen die Backsteinmauer und blieb dort stehen. Jetzt blieb ihnen nichts anderes mehr übrig – sie mussten aus der Deckung und die letzten Meter zum Range Rover ungedeckt zurücklegen.
Paintballs platzten auf der Windschutzscheibe und gegen die Karosserie, während Connor die hintere Tür aufriss und Amir grob hineinstieß. Er sprang hinter ihm in das Fahrzeug; beide landeten aufeinander im Fußraum.
»LOS! LOS! LOS!«, brüllte Connor die Fahrerin an.
Diese trat das Pedal bis zum Anschlag durch. Der mächtige Motor röhrte und beschleunigte rasant. Schon nach Sekunden hatten sie die Todeszone hinter sich.
KAPITEL 2
Connor gestattete sich ein zufriedenes Grinsen: Gegen jede Wahrscheinlichkeit hatte er es geschafft: Er hatte seinen Klienten gerettet. Doch dann wandte sich Amir zu ihm um und Connors selbstzufriedenes Lächeln fror auf der Stelle ein. Auf Amirs Schutzbrille prangte, mitten auf dem rechten Auge, ein Farbfleck: ein Paintball-Volltreffer.
»Verdammt – wieso bist du getroffen?«, rief Connor und hieb frustriert auf die Armlehne. »Ich hab dich doch nach allen Richtungen gedeckt!«
Amir nahm vorsichtig die Schutzbrille ab und rieb sich den Nasenrücken. Er stammte aus Neu-Delhi, ein schlanker Junge mit kantigem Gesicht, hellen Augen und schwarzem, glattem Haar. »Gedeckt hast du mich? Schön wär’s. Das tat nämlich verdammt weh.«
Die Fahrerin stoppte den Range Rover und drehte sich zu den beiden Jungen um. Jody war eine ihrer Ausbilderinnen im Buddyguard-Trainingscenter in Wales. Sie hatte früher bei der für besondere Schutzaufgaben zuständigen Abteilung SO14 der Metropolitan Police gearbeitet, der Einheit, die für den Personenschutz des Königshauses zuständig war. Jetzt allerdings trug sie einen schwarz-roten Trainingsanzug und hatte ihr dunkelbraunes Haar zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden. In dieser Aufmachung sah sie wie eine Fitnesstrainerin aus. Niemand hätte in ihr einen Bodyguard vermutet. Aber genau darum ging es. Kaum jemand kam auf die Idee, dass auch Frauen als Personenschützerinnen arbeiteten, und das verschaffte diesen manchmal einen Vorteil.
»Die Übung ist zu Ende, Connor – dein Klient ist definitiv tot«, sagte sie und zog amüsiert eine gepflegte Augenbraue in die Höhe, als sie Amirs farbverspritztes Gesicht sah. Doch dann wurde ihre Miene wieder streng. »Wenn das ein Teilmantelgeschoss gewesen wäre, hätte Amir jetzt keinen Kopf mehr.«
»Würde niemandem auffallen«, bemerkte Charley, die auf dem Beifahrersitz saß, in ihrem weichen kalifornischen Akzent. »Er benutzt ihn sowieso nie.« Sie zwinkerte ihm schelmisch zu.
Connor lachte, aber Amir funkelte sie in gespielter Wut an. »He! Spiel doch du nächstes Mal den Klienten!«
Charleys Lächeln verschwand; sie schaute durch das Seitenfenster hinaus und seufzte leise. »Nichts lieber als das … »
Jody fuhr zügig in eine Kurve und Connor konnte nun Charleys Gesicht sehen, das sich im Seitenfenster spiegelte. Ihre sonst so funkelnden himmelblauen Augen wirkten matt und ihr unbesiegbares Selbstvertrauen schien momentan brüchig geworden zu sein.
»Nichts hindert dich daran, nächstes Mal als Schützin mitzumachen«, schlug er vor.
Er beobachtete ihre Reaktion im Spiegelbild. Charley schob eine Strähne ihres blonden Haars hinter das Ohr und ihr Lächeln kehrte zurück.
»Das wäre unfair«, lachte sie und blickte ihn im Spiegel herausfordernd an. »Denn dann würdet ihr beide nicht mal zehn Sekunden lang am Leben bleiben.«
Connor lachte. Eigentlich hatte er daran keinen Zweifel. Trotz aller Schwierigkeiten, denen Charley durch ihre Behinderung tagtäglich gegenüberstand, hatte sie viele Talente: Sie war ehemalige Quicksilver-Juniorenmeisterin im Surfen, eine geschickte Kampfsportlerin und sprach fließend Mandarin. Connor hatte nicht den geringsten Zweifel, dass sie auch eine hervorragende Schützin war.
Jody parkte vor dem stillgelegten Lagerschuppen und befahl Connor und Amir auszusteigen. Auch die anderen Mitglieder des Alpha-Teams hatten sich zu einer kurzen Auswertung der Übung versammelt. Marc, ein schlanker Franzose mit gebleichten blonden Haaren, hatte das Training gefilmt, damit es später im Unterricht detailliert analysiert werden konnte. Er klopfte Connor mitfühlend auf die Schulter. »Pas de bol! Und dabei hattest du den Esel fast im Stall!«
Connor hielt Charley die Tür auf. »Stimmt. Aber eben nur fast.«
»Fast ist nicht gut genug für einen Bodyguard«, warf Ling ein und hievte ihren Paintball-Markierer in das Auto, ein Gerät, das vor ihrem schlanken, zierlichen Körper geradezu überdimensional aussah. Ihr ovales Gesicht wurde von kurz geschnittenem rabenschwarzen Haar eingerahmt; auf einem ihrer elfenhaften Nasenflügel glitzerte ein silbernes Piercing.
»Stimmt«, sagte Richie in seinem schweren irischen Akzent. »Das wäre ja genau so, als würdest du einem Zug fast aus dem Weg springen. Bist dann aber trotzdem Ketchup.« Zur Betonung feuerte er zwei Paintballs auf eine alte Mülltonne.
»Feuer einstellen!«, schimpfte Jody, während sie Charleys Rollstuhl aus dem Kofferraum des Range Rovers nahm. »Nicht alle tragen Schutzbrillen!«
»Sorry, Miss!«, rief ihr Richie zu und grinste entschuldigend, wobei seine Zahnspange wie die Zahndiamanten eines Rappers in der Sonne funkelte. »Wir feiern nur unseren Sieg.«
Charley hievte sich geschickt in ihren Rollstuhl und rollte zum Team hinüber. Connor bemerkte, dass immer noch ein Teammitglied fehlte.
»VOLLTREFFER!«, brüllte Jason, der plötzlich von der Feuerleiter am gegenüberliegenden Gebäude herabsprang. Er stolzierte herbei, den Markierer trug er lässig wie Rambo auf der Schulter. Für sein Alter war Jason ungewöhnlich muskulös; er hatte ein kantiges Kinn und lockiges, dunkles Haar. Connor war insgeheim überzeugt, dass sich sein australischer Teamkamerad tatsächlich für Rambo hielt.
»Vielleicht wechsele ich die Seiten und werde Terrorist«, verkündete Jason lachend und klatschte sich mit Richie und Ling ab.
»Töte mich«, säuselte Ling und ließ die Wimpern ihrer Halbmondaugen verführerisch flattern, wobei sie ihn allerdings gleichzeitig gegen den Arm boxte, »oder versuch es doch wenigstens …«
»Du warst auf dem Dach?«, rief Connor aufgebracht. »Aber bei dieser Übung gibt es doch immer nur zwei Schützen, dachte ich?«
»Dachtest du das?« Jason zuckte spöttisch die Schultern. »Oh, tut mir ja sooo leid, Kumpel.«
»Aber das ist unfair!«, beschwerte sich Connor und wandte sich an Jody, um eine Erklärung zu verlangen. »Alle anderen hatten nur zwei Schützen!«
»Als Bodyguard musst du eben mit allem rechnen«, gab sie kühl zurück. »Gefahren können aus allen Richtungen kommen, und niemand legt fest, wie viele Gegner du hast. Deshalb brauchst du auch Augen im Hinterkopf.«
Sie wandte sich an das Team. »Im Stress einer Kampfsituation kommt es zu einer erhöhten Ausschüttung von Adrenalin und Stresshormonen. Dadurch verbessert sich eure Kampfkraft und Reaktionsfähigkeit, es gibt aber auch Nachteile. Einer davon ist der sogenannte Tunnelblick. Ihr verliert das periphere Sehen, weil ihr euch nur noch auf die unmittelbar drohende Gefahr konzentriert. Und wie Connor gerade selbst erfahren musste, kann das fatale Konsequenzen haben.«
Connor seufzte verärgert. Nicht ein einziges Mal hatte er während der Übung nach oben geblickt. Das war die vierte Übung hintereinander, die er vermasselt hatte – eine wirklich katastrophale Leistung. Allmählich kamen ihm ernsthafte Zweifel, ob er wirklich zum Bodyguard geeignet war.
»Schau nicht so belämmert«, sagte Marc. »Der Einfall mit dem Müllcontainer war doch Spitze! Ich hab alles auf Video. Es war zum Totlachen!«
»Und ziemlich effektiv«, gab Ling widerwillig zu. »Ich hab meine ganze Munition verpulvert und dich doch nicht erwischt.«
»Vor echten Kugeln hätte der Container die beiden nicht retten können«, warf Jason schnell ein.
»Aber solange er in Deckung bleibt, ist er schwerer zu treffen«, widersprach Charley. »Es war jedenfalls eine gute Ablenkung.«
Jody nickte. »Das stimmt. Connors Taktik hätte auf jeden Fall die Überlebenschancen verbessert. Aber er hat seinen Klienten nicht retten können, und deshalb …«, sie wies mit einer grandiosen Geste auf den farbverschmierten Range Rover, »… darf er jetzt das Auto waschen.«
KAPITEL 3
»Mr Gibb! Mr Gibb! Stimmen die Anschuldigungen?«
»Kein Kommentar«, murmelte der australische Minister für Ressourcen und Energie, als er sich durch die Reportermeute kämpfte, die sein Ministerium in Canberra belagerte. Eine Kamera wurde ihm direkt vor das erschöpfte Gesicht gehalten; das Blitzlicht ließ ihn fast erblinden. Wütend stieß er die Kamera beiseite.
»Wann treten Sie zurück?«, brüllte ein anderer Reporter.
»Wie viel haben Sie selbst für den Deal erhalten?«
»Kein Kommentar!«, fauchte Harry Gibb noch einmal.
Endlich hatte er die Glastür erreicht. Erleichtert trat er in die klimatisierte Empfangshalle. Die Security drängte die Medienmeute zurück. Harry eilte über die polierten Marmorfliesen zum Lift. Noch immer wütend stieß er seinen dicken Finger auf den Knopf. Einen Augenblick später ertönte ein gedämpftes »Ping!«, das die Ankunft der Kabine signalisierte. Die Lifttüren glitten auseinander.
»Harry!«, rief jemand von hinten.
Die Stimme war ihm bestens bekannt, aber so scharf hatte sie noch nie geklungen. Harry tat so, als hätte er den Senator nicht gehört. Schnell trat er in den Lift und rammte den Daumen auf die Türschließtaste. Der Senator beschleunigte seinen Schritt, kam aber eine Sekunde zu spät. Die Metalltüren schlossen sich direkt vor seiner Nase.
Während der Lift nach oben schwebte, nutzte Harry die momentane Ruhe, um seine vom Wind aufgebauschten, schütter werdenden Haare zu glätten und seine Krawatte zu richten. Er war völlig außer Atem, außerdem spürte er, dass sich unter seinen Achseln Schweißflecken zu bilden begannen. Harry hatte einen stattlichen Bierbauch; kein Anzug passte ihm wirklich.
Die Türen des Aufzugs glitten auf und Harry Gibbs setzte sich wieder in Bewegung. Trotz seiner unförmigen Gestalt marschierte er mit so viel Würde und Autorität, wie er unter den gegebenen Umständen aufbringen konnte, durch das Großraumbüro. Es war wie ein Spießrutenlauf; er wusste, dass inzwischen alle Welt die Nachrichten gehört hatte: Harry Gibb, der australische Minister für Ressourcen und Energie, war zum Abschuss freigegeben. Aber er weigerte sich, sich das anmerken zu lassen.
Im Vorzimmer seines Büros stand die Sekretärin auf, um ihn zu begrüßen. Mit einem leicht dümmlichen Lächeln wollte sie ihm die heutige Korrespondenz übergeben, aber er winkte sie mit einer gereizten Geste weg.
»Später«, murmelte er, wobei ihm vollkommen bewusst war, dass draußen im Großraumbüro ungewöhnliche, geradezu atemlose Stille herrschte.
Nachdrücklich schloss er die Tür, stellte seinen Aktenkoffer ab und ließ sich in den schweren Ledersessel mit der hohen Lehne fallen. Er rieb sich die übermüdeten Augen und stieß einen langen, schweren Seufzer aus. Einen Augenblick lang erlaubte er sich, zu glauben, dass es ihm gelungen sei, den politischen Sturm zu umschiffen, der ihn zu verschlingen drohte. Aber als er die Augen wieder öffnete, wurde er schon wieder brutal mit der Realität konfrontiert: Vor ihm auf dem Schreibtisch lag die neueste Ausgabe der Australian Daily. Ein riesiges Foto zeigte ihn in Nahaufnahme mit einer Miene, die schuldbewusster gar nicht aussehen konnte. Über dem Foto schrie ihm eine Schlagzeile entgegen: BERGBAUMINISTER SCHAUFELT GOLD IN EIGENE TASCHE!
Harry starrte bewegungslos auf die Beleidigung. Eine Ader an seiner Schläfe begann heftig zu pulsieren.
Das Telefon klingelte. Es klang wie ein Befehl, sich sofort zu melden, doch er ignorierte es.
Während er noch die anklagende Schlagzeile anstarrte, spürte er, wie sich etwas in seiner Brust verkrampfte. Er wühlte hastig in der Sakkotasche nach seinen Herzpillen. Gleichzeitig riss er eine der Schubladen auf und nahm einen schmalen versilberten Flachmann heraus. Ein Etikett warnte: »Nur für Notfälle«. Harry schüttete ein paar Pillen in seine Hand und spülte sie mit mehreren kräftigen Schlucken Whiskey hinunter. Der Alkohol brannte in seiner Kehle; er musste husten. Sein Arzt hatte ihn gewarnt, jede Art von Fusel zu vermeiden. Aber heute war ihm das egal.
Harry lehnte sich zurück und wartete darauf, dass die Brustschmerzen verflogen. Tatsächlich flaute der Anfall nach ein paar Minuten wieder ab und der dumpfe Restschmerz wurde von neu aufflammender Wut verdrängt.
»Dieser gottverdammte Schmierfink!«, zischte er, ließ die Faust auf den Mahagonitisch krachen und fegte die Zeitung auf den Boden.
Wütende Gedanken wirbelten ihm durch den Kopf. Nur weil diesem Sterling die Australian Daily gehörte – wie überhaupt fast jede nationale Zeitung – hatte er noch lange nicht das Recht, sich in seine, Harrys, Angelegenheiten einzumischen! Es war ja auch nicht so, dass der Medienmagnat selbst eine blendend weiße Weste gehabt hätte! Wie oft war dieser schlüpfrige Aal schon einer Anklage wegen Steuerhinterziehung, illegalen Firmenübernahmen und anderen Geschäftsskandalen nur mit knappster Not entkommen! Sterling war mindestens so korrupt wie Harry selbst, wenn nicht sogar noch korrupter!
Harry gönnte sich einen weiteren Schluck aus der Pulle. Ganz klar: Er war das Opfer einer Medienkampagne, die der Medienmogul inszenierte, weil seine Zeitungen ständig noch skandalösere Schlagzeilen produzieren mussten. Er war zum Ziel einer übertriebenen Zeitungsschmiererei geworden, mit der Sterling nur einen Zweck verfolgte: die Auflage in die Höhe zu treiben. Aber Harry Gibb hätte den Weg nach ganz oben auf den Ministersessel nicht geschafft, wenn er nicht gewusst hätte, wie man die eigenen Interessen schützte und sich den Rücken freihielt. Und ganz bestimmt hatte er nicht vor, sich einfach zu ergeben und kampflos unterzugehen.
Er war ein Überlebenskünstler. Und er würde alles tun, um sich selbst zu retten. Alles.
KAPITEL 4
Gleißend hell stand die Julisonne am Himmel. Die riesige Menschenmenge jubelte. Amerikanische Flaggen wehten überall und die Menge schwenkte amerikanische Fähnchen. Connor stand am Rand des Podiums und musterte aufmerksam die freudig erregte Menge, während der Präsident der Vereinigten Staaten seine Rede hielt: »Ich habe um ein Wunder gebetet, und es wurde gewährt …«
Das Westende des National Mall war ein einziges Meer von strahlenden Gesichtern – Männer, Frauen, Kinder, alle hatten sich versammelt, um die Befreiung der Präsidententochter zu feiern.
Aber Connor feierte nicht und jubelte nicht. Er hielt nach einem Gesicht Ausschau. Dem Gesicht eines Killers.
Es war wie die berühmte Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Natürlich würde der Attentäter vollständig mit der Menge verschmelzen, eine unauffällige Person unter Tausenden anderer unauffälliger Personen. Und das machte jeden zum Verdächtigen … Doch dann fokussierte sich Connors Blick plötzlich auf etwas Schwarzes, das zwischen einem Jungen und seiner kleinen Schwester hervorragte: der Lauf einer Pistole. Der Präsident winkte seine Tochter Alicia zu sich ans Rednerpult. Die Mündung der Waffe folgte ihr, als sie zum Podium hinüberging. Die Geschwister wedelten eifrig mit ihren Fähnchen; sie bemerkten nicht die tödliche Waffe, die zwischen ihnen hervorragte. Connor schrie den Secret-Service-Agenten an der Absperrung vor dem Podium eine Warnung zu. Aber der Jubel der Menge übertönte alles andere.
Verzweifelt stürzte Connor zum Podium, aber die Schwerkraft schien sich an ihn zu klammern, schien ihn niederzudrücken. Je mehr er sich anstrengte, desto langsamer kam er vorwärts. Wieder brüllte er warnend. Alicia wandte den Kopf und blickte verwundert zu ihm herüber.
Ein Knall, so laut wie ein Donnerschlag, brach durch den Jubel. Connor glaubte die Kugel zu sehen, die aus der Mündung flog. Er warf sich in die Schusslinie. Aber die tödliche Kugel flitzte an ihm vorbei, verfehlte ihn um Haaresbreite. Nutzlos fiel er zu Boden. Und Alicia blickte geschockt auf ihr reines weißes Kleid hinunter, auf dem sich ein blutroter Fleck immer weiter ausbreitete.
»NEIN!«, schrie Connor und musste ohnmächtig mitansehen, wie sie auf dem Podium zusammenbrach …
»Connor! Connor! Alles in Ordnung?«
Eine Hand rüttelte ihn an der Schulter. Connor blinzelte, einen Moment lang desorientiert. Der Raum lag im Dunkeln, nur ein erleuchtetes Rechteck war auf dem Boden vor der offen stehenden Tür zu sehen
»Du hast geschrien«, sagte Charley, die neben seinem Bett in ihrem Rollstuhl saß, das Gesicht halb im Schatten. Sie nahm die Hand von seiner Schulter. »Ich hoffe, es macht dir nichts aus, dass ich nach dir geschaut habe.«
Connor setzte sich auf und rieb sich die Augen. »Nein … überhaupt nicht … War nur ein Traum.«
»Kam mir eher wie ein Albtraum vor.«
Connor zögerte; er fürchtete, dass Charley es ihm als Schwäche auslegen würde, wenn er ihr seine inneren Zweifel gestand. Seine Zweifel, jemals ein guter Bodyguard zu werden. Doch dann besann er sich: Im ganzen Team war Charley bestimmt die Einzige, die das verstehen würde.
»Ich erlebe immer wieder den Mordanschlag auf Alicia.«
»Das passiert, wenn man eine Nahtoderfahrung hinter sich hat.« Für einen kurzen Augenblick wirkte Charley verängstigt, aber sie hatte sich so schnell wieder im Griff, dass Connor glaubte, er habe sich nur getäuscht.
»Aber in meinem Traum komme ich immer zu spät«, erklärte er.
»Es war sehr knapp. Du wurdest angeschossen. Solche Ängste sind deshalb völlig normal. Wichtig ist nur: Du hast sie gerettet!«
»Ich weiß, aber was ist, wenn das nur Anfängerglück war? Ich meine, seit einer Woche habe ich kein einziges Buddyguard-Training erfolgreich hinter mich gebracht!«
»Die Trainings sind dazu da, Fehler zu machen. Nur so kann man lernen«, sagte sie. »Außerdem werden die Trainingseinheiten bewusst hart geplant, damit wir im Ernstfall auch wirklich höchste Leistung bringen können.«
Connor seufzte bedrückt. In ein paar Tagen würde er zu seiner nächsten Mission aufbrechen müssen, die ihm schon jetzt Sorgen bereitete. Wieder lag ihm die Verantwortung für den Schutz einer anderen Person wie eine Last auf den Schultern. »Aber was ist, wenn ich nächstes Mal nicht rechtzeitig reagiere?«
Charley schaute ihn streng an. »So darfst du nicht denken, niemals. Du hast die Präsidententochter beschützt, als es wirklich darauf ankam. Damit hast du eindeutig bewiesen, dass du dem Job gewachsen bist.«
»Aber das ist doch genau der Punkt! Alle glauben, dass ich ein ganz heißer Bodyguard bin. Aber das bin ich nicht! Eine Sekunde später, und …« Schon beim Gedanken an das, was dann hätte passieren können, versagte ihm die Stimme.
Auf dem Nachttisch entdeckte Charley einen kleinen Schlüsselanhänger aus Plastik, den Connor aufrecht an den Wecker dorthin gestellt hatte. »Hör mal, du weißt doch, dass du es im Blut hast, oder nicht?«, sagte sie leise.
Connor folgte ihrem Blick und betrachtete das schon ein wenig verblasste Foto unter der zerkratzten Plexiglaskapsel. Sein Vater, Justin Reeves, schaute ihn daraus an. Braun gebrannt, hart und mit durchdringenden blaugrünen Augen, die Connor von ihm geerbt hatte – jeder Zoll ein Soldat, ein Mann, auf den man sich selbst in den gefährlichsten Situationen verlassen konnte. Ein Mann, der bei einem Einsatz als Bodyguard ums Leben gekommen war.
Connor spürte eine Last auf den Schultern, die noch schwerer wog als nur die Verantwortung für einen Klienten. »Ich bin eben nicht mein Vater«, gestand er leise. »Und so sehr Colonel Black es auch glauben will, ich kann niemals seinem Namen gerecht werden. Dad war bei den Spezialtruppen, ich bin ein Spezial-Nichts.«
Charley blickte ihm durchdringend in die Augen. »Das ist negatives Denken. Natürlich wirst du versagen, wenn du mit dieser Haltung in eine Mission gehst! Hör mir zu: Du kannst dich nicht mit einer Erinnerung messen!«
Connor zuckte vor ihrer plötzlichen Heftigkeit zurück. »Ich weiß. Du hast natürlich recht. Aber es ist …«
Eine Tür quietschte irgendwo weiter hinten im Flur. Nach zehn Uhr abends durften sie sich eigentlich nicht mehr in fremden Zimmern aufhalten. Charley rollte zur Tür, aber auf der Schwelle blickte sie sich noch einmal um.
»Lass nicht zu, dass du in Selbstzweifeln versinkst, Connor. Immer wenn ich an meinen eigenen Fähigkeiten zweifle, denke ich an ein altes Sprichwort: ›Ob du dir etwas zutraust oder nicht – recht hast du wahrscheinlich immer.‹«
Sie zog die Tür hinter sich zu. Connor lag im Dunkeln und dachte über das nach, was Charley gesagt hatte. Vor allem über die Macht, die dem Glauben an die eigenen Fähigkeiten innewohnte. Und als er die Augen schloss, stellte er sich seinen Vater vor, der ihn anspornte weiterzumachen, genau so, wie er es immer getan hatte, als er noch lebte.
KAPITEL 5
»Operation Gemini beginnt in zwei Wochen«, verkündete Colonel Black. »Ich hoffe, ihr habt eure Hausaufgaben gemacht.«
Der Colonel stand, die Hände hinter dem Rücken, im Besprechungsraum vor dem Alpha-Team. Mit seinen breiten Schultern, dem kantigen Kinn und dem silbergrauen Kurzhaarschnitt sah er genau so aus, wie man sich einen Offizier vorstellte. Der hell leuchtende, große Monitor an der Wand unterstrich seine eindrucksvolle Erscheinung. Black, ein ehemaliger SAS-Offizier, war Gründer und Kommandant der Buddyguard-Organisation. Er beschäftigte sich persönlich mit jedem Einsatz und nahm an jeder operativen Besprechung teil. Auf dem Monitor hinter ihm rotierte die 3D-Darstellung des Buddyguard-Logos – ein silberner Schild mit Flügeln.
Connor wischte über das Display seines neuen Tablet-PCs und legte eine neue Datei an, in der er seine Notizen abspeichern wollte. Während der nächsten Stunden würde das Team unter einer Flut von Informationen begraben werden, die die verschiedenen Aspekte des Einsatzes betrafen: Profil des Klienten, Beschreibung der Örtlichkeiten, Gefahrenpotenzial, Sicherheitsvorkehrungen, Verfahrensregeln, Arbeitsaufträge, logistische Unterstützung … und das waren noch lange nicht alle Aspekte. Jedes einzelne Element konnte sich entscheidend auf den Erfolg der Mission auswirken und jedes Teammitglied musste sich zumindest das grundlegende Wissen über den Auftrag aneignen, für den Fall, dass ein Rollentausch erforderlich würde oder der vorgesehene Buddyguard in letzter Minute ersetzt werden musste.
Colonel Black trat zur Seite und Charley rollte nach vorn. Als operative Teamleiterin und als erfahrenste Buddyguard leitete sie immer die Einsatzbesprechungen.
»Bei dieser Mission gibt es zwei Klienten, die unseren Schutz benötigen«, erklärte sie und klickte auf die Fernbedienung des Beamers. Fotografien von zwei Mädchen erschienen; sie sahen buchstäblich identisch aus. »Das sind die Zwillingstöchter von Mr Maddox Sterling, einem australischen Medienmogul und Milliardär.«
»Sehen aus wie die Olsen-Zwillinge«, witzelte Richie mit ziemlich interessiertem Grinsen, womit er die vom Fernsehen berühmten Schwestern Ashley und Mary Kate meinte.
»Hast wohl sämtliche Episoden ihrer Serie auf DVD, was?«, neckte ihn Ling.
»Nein – ich hab nämlich Geschmack, im Gegensatz zu dir. Du schaust dir doch nur immer diesen Vampirscheiß an. Total gaga.«
Ling betrachtete ihn mit zusammengekniffenen Augen wie ein totes Insekt. »Wann schicken dich deine Eltern endlich in den Kindergarten zurück?«
Connor blendete die Hänseleien seiner Teamkameraden aus und konzentrierte sich auf die beiden Fotografien. Die Zwillinge hatten beide weizenblonde Haare, meergrüne Augen und hohe, elegant geschwungene Wangenknochen. Sie konnten ohne Weiteres als Popstars durchgehen – und waren kaum voneinander zu unterscheiden. Würde wohl schwer werden, sie auseinanderzuhalten.
Charley richtete den roten Laserpointer auf das rechte Foto. »Chloe ist um zwölf Minuten älter. Die Zwillinge sind fünfzehn, und Chloe gilt als die offenere; sie ist extrovertiert, gesellig und intelligent, aber man sagt, dass sie sich auch manchmal wie eine Prinzessin aufführt.« Charley zuckte die Schultern, als sei das von der Tochter eines Milliardärs auch nicht anders zu erwarten. »Emily ist stiller und schüchterner. Sie liest gern und unternimmt lange Spaziergänge in der Natur, während Chloe lieber Netzball spielt und am Strand oder auf Partys abhängt. Emily war nicht immer so still. Dass sie sich seit einiger Zeit viel reservierter verhält als ihre Schwester, ist eine Folge dessen, dass sie letztes Jahr entführt worden ist …«
»Tja, hätten sie uns ein Jahr früher engagiert …«, witzelte Amir und schaute sich um, erntete aber nicht einmal ein müdes Grinsen.
Ein strenger Blick der stahlgrauen Augen des Colonels verdarb ihm den Spaß. »Das mag tragisch sein, aber es ist nur zu oft der Fall. Im Nachhinein ist man immer klüger.«
Charley klickte auf eine Zusammenstellung von Zeitungsausschnitten. Die Schlagzeilen vollzogen die Entführung praktisch im Zeitraffer nach:
STERLINGS TOCHTER VERMISST … WER HAT EMILY GESEHEN? … MILLIONEN DOLLAR LÖSEGELD GEFORDERT … LÖSEGELDVERHANDLUNGEN GESCHEITERT? … LEBT EMILY NOCH? … STERLINGTOCHTER FREI!
»Emily wurde während des Familienurlaubs an der Côte d’Azur entführt«, erläuterte Charley. »Die korsische Mafia wurde der Tat verdächtigt, aber das konnte nicht bewiesen werden. Emily wurde mehrere Monate lang in der algerischen Wüste gefangen gehalten und erst nach langwierigen Verhandlungen über die Höhe des Lösegelds freigelassen.«
Ling hob die Hand. »Wenn der Vater so reich ist, warum hat es dann so lange gedauert?«
Colonel Black antwortete: »Lösegeldverhandlungen erfolgen selten direkt und geradlinig. Jede Seite versucht zu bluffen, die andere Seite blufft dagegen, Angebote werden gemacht und abgelehnt. Manchmal werden auch unmögliche Forderungen gestellt. Das Wichtigste ist aber, dass die Geisel freikam, und zwar unverletzt.«
»Und wie geht es Emily heute?«, fragte Connor.
»Überraschend gut«, sagte Charley und rief einen ärztlichen Untersuchungsbericht auf. »Physisch ist sie gesund und fit; es zeigen sich keinerlei dauerhafte Nachwirkungen. In ihrem psychologischen Befund wird auf gelegentliche Stimmungsschwankungen hingewiesen: Sie zeigt Rückzugssymptome und hat Angst vor dunklen und engen Räumen. Emily erhält Medikamente gegen ihre Angstanfälle, die Nebenwirkungen sind allerdings Benommenheit, Verwirrung und eingeschränkte Reaktionsfähigkeit. Aber das ist auch schon alles, was ihre Leidenszeit angeht. Das Alpha-Team soll nun verhindern, dass einer der Sterling-Schwestern so etwas noch einmal geschieht.«
Charley rief eine Karte auf, die das Gebiet des Indischen Ozeans zeigte. »Wir sollen für die beiden Mädchen einen unauffälligen Schutz bereitstellen, während sie ihren Urlaub in den Seychellen und den Malediven verbringen.« Sie deutete auf die beiden Gruppen von winzigen tropischen Inseln inmitten der riesigen blauen Fläche des Ozeans zwischen Afrika und Indien. »Die Operation dauert einen Monat. Der Einsatzort ist Mr Sterlings Privatjacht.«
Eine schlanke, elegante Fünfzig-Meter-Jacht mit mehreren Decks erschien auf dem Monitor.
»Wow!«, stieß Amir hervor und riss die kaffeebraunen Augen weit auf. »Das ist ja nun wirklich ein echt cooles Schiffchen.«
»Ein Schiffchen? Das ist ein schwimmender Palast«, verbesserte ihn Marc, der angestrengt auf das Oberdeck spähte. »Und dort auf dem Oberdeck … das sieht tatsächlich aus wie ein Whirlpool!«
Jason warf Connor einen neidischen Blick zu. »Du hast da wirklich eine Faulenzermission an Land gezogen, Mann«, sagte er. »Bestimmt als Belohnung dafür, dass du die Präsidententochter aus dem Schlamassel geholt hast.«
»Meinst du wirklich?«, antwortete Connor, der sich nur zu gut an die Probleme erinnerte, die er gehabt hatte, auch nur eine einzige Fünfzehnjährige zu schützen. »Ich glaube eher, Zwillinge sind doppelter Ärger.«
KAPITEL 6
»Es sind weibliche Klienten – du weißt, wie du dich zu verhalten hast, nicht wahr, Connor?«, sagte Charley mit einem bedeutungsvollen Seitenblick in seine Richtung.
Die anderen verstanden die Bemerkung nicht, weil sie den Hintergrund nicht kannten, aber Connor wusste genau, was Charley meinte: den Kuss, bei dem sie ihn und Alicia überrascht hatte. Als Alicias Buddyguard hätte er diese Linie nicht überschreiten dürfen – obwohl er streng genommen bei diesem kleinen, intimen Ereignis von seinen Pflichten als Buddyguard bereits entbunden gewesen war. Aber Charley hatte offenbar nicht vor, ihn diesen Zwischenfall vergessen zu lassen.
»Und weil es zwei Klienten sind«, fuhr Charley fort, ohne auf die verwunderten Blicke der anderen zu achten, »hat Colonel Black beschlossen, bei dieser Mission zwei Bodyguards einzusetzen.«
Im Raum wurde es absolut still, während das Team diese Information verdaute. Niemand hatte damit gerechnet, dass es notwendig würde, einen zweiten Buddyguard einzusetzen. Obwohl es bei zwei Klienten natürlich nur logisch erschien, wenn man effektiv für ihre Sicherheit sorgen wollte.
Alle Blicke richteten sich auf den Colonel. Jason setzte sich erwartungsvoll aufrecht. Marc, der genauso gierig auf den Auftrag war, lehnte sich im Gegensatz zu Jason lässig zurück, als interessierte ihn die Sache nicht besonders. Ling nagte voller Spannung an der Unterlippe, während sich Amir mit seinem Stuhl so weit nach vorn lehnte, dass er jeden Augenblick umzukippen drohte. Nur Richie kaute gelangweilt auf den Fingernägeln herum; ihm war klar, dass er nicht in Betracht kam, weil er gerade erst von einer Mission zurückgekehrt war. So sehr Connor auch die anderen Teammitglieder schätzte, er hoffte doch, dass der Colonel Amir einsetzen würde. Er wusste, dass sich sein Freund verzweifelt nach dem ersten Auftrag sehnte, damit auch er endlich das geflügelte Ehrenabzeichen verliehen bekam.
Colonel Black ließ sie nicht lange im Unklaren. »Ling, du bist Buddyguard Nummer zwei.«
»Ja!«, rief Ling und stieß triumphierend die Faust in die Höhe.
Jason und Ling tauschten einen freundschaftlichen Fauststoß. »Gratuliere. Hol schon mal den scharfen Bikini raus.«
»Dachte, ich könnte mir deinen ausleihen«, witzelte Ling und zwinkerte ihm zu.
Mittlerweile hatte Amir still ausgeatmet und war in seinen Stuhl zurückgesunken wie ein Ballon, aus dem die Luft abgelassen wurde.
Connor lächelte seinem Freund aufmunternd zu. »Keine Angst, es gibt immer ein nächstes Mal«, flüsterte er ihm zu.
Amir nickte ohne rechte Überzeugung.
Aber inzwischen war auch der zweite Teil dessen, was der Colonel gesagt hatte, bei Ling angekommen. Ihre freudige Miene ging in Stirnrunzeln über. »Sir … Nummer zwei?«
Der Colonel hob eine Augenbraue. »Hast du ein Problem damit?«
»Ähm … natürlich nicht«, antwortete Ling und lächelte Connor entschuldigend zu. »Aber das ist jetzt schon meine dritte Mission, und ich dachte …«
»Ihr habt genau die gleiche Verantwortung für den Schutz der beiden Klientinnen«, fiel ihr der Colonel ins Wort. »Aber bei einer Mission muss es immer eine eindeutige Befehlshierarchie geben. Amir, bitte informiere das Team über die Gefahrenlage … Amir?«
Amir blickte leicht verwirrt auf. Offenbar hatte er die Enttäuschung noch nicht verkraftet. Er ging zum Rednerpult und verband sein Tablet mit dem Beamer, wobei er sich ein bisschen mehr Zeit als nötig nahm, vermutlich um seine Enttäuschung zu verbergen. Schließlich räusperte er sich und las, fast ohne aufzublicken, von seinen Notizen ab.
»Ich fange mit dem Vater der Klientinnen an: Maddox Sterling. Fünfzig Jahre alt, Gründer und Vorstandsvorsitzender der Fourth Estate Corporation, des größten Medienkonzerns in Australien.«
Ein silberhaariger Mann in perfekt geschnittenem Maßanzug erschien auf dem Monitor.
»Das Unternehmen umfasst Zeitungen und Magazine, ist aber auch im Internet aktiv, ferner gehören Sterling ein Pay-TV-Sender und mehrere TV-Produktionsgesellschaften. Im Grunde beherrscht Fourth Estate die gesamte nationale Medienlandschaft Australiens.«
Amir klickte durch eine Reihe von Bildern, die verschiedene Zeitungen, Magazine, Filmposter und Fernsehkanäle zeigten.
»Wegen seiner dominanten Stellung in der Medienwelt hat Sterling viele mächtige Verbündete, sowohl in der Politik als auch in der Wirtschaft. Aber er hat sich auch viele Feinde gemacht – wegen seiner aggressiven Geschäftsmethoden, aber auch wegen der Berichterstattung in seinen Medien. Seine Journalisten betreiben nämlich einen knallharten Enthüllungsjournalismus, der in Australien regelmäßig für große Skandale sorgt und sehr umstritten ist. Hier ist ein Beispiel.« Amir rief das Foto einer schlanken dunkelhaarigen Frau auf. »Das ist die frühere Oppositionsführerin Kelly Brocker. Nachdem in Sterlings Zeitungen ziemlich peinliche Berichte über ihr Privatleben erschienen waren, musste sie zurücktreten.«
»Noch ein Beispiel.« Amir rief ein weiteres Foto auf. Es zeigte einen sonnengebräunten Mann mit rotbraunem Haar. »Das ist Joseph Ward, der frühere Hauptgeschäftsführer von Ward Enterprises. Er wurde wegen Betrugs zu zehn Jahren Haft verurteilt. Der Finanzskandal wurde von Insider aufgedeckt, einem Politmagazin, das von Sterlings TV-Sender ausgestrahlt wird. Das Ergebnis war, dass Mr Ward bankrott ging. Mr Ward war einer von Sterlings schärfsten Konkurrenten. Als Ward infolge des Skandals seine Medienfirmen verkaufen musste, wurden sie alle von Sterlings Fourth Estate erworben.« Amir hob die Augenbrauen. »Was für ein schöner Zufall! Als Mr Ward verhaftet wurde, schwor er, sich an Sterling bitter zu rächen. Aber derzeit sitzt Mr Ward noch im Gefängnis.«
Amir räusperte sich. »Der jüngste Vorfall betrifft einen hochrangigen Politiker namens Harry Gibb, seines Zeichens australischer Minister für Ressourcen und Energie. Sterlings Zeitungen warfen ihm vor, er habe sich bei der Vergabe von Schürfrechten in den Bergbaugebieten bestechen lassen.«
Die Titelseite der Australian Daily erschien; die Schlagzeile schrie: GIERIGER GIBBS MUSS GEHEN! Daneben war ein wenig schmeichelhaftes Foto eines dickbäuchigen Anzugträgers mit schütterem Haar und rötlich-feistem Gesicht zu sehen, der gerade in einen doppelten Cheeseburger biss.
»Von diesen Leuten können wir zwar niemanden als direkte Bedrohung für unsere Klientinnen ansehen«, erklärte Amir, »aber im Grundsatz gilt, dass jeder Feind des Vaters potenziell auch ein Feind der Töchter sein könnte. Deshalb habe ich Hintergrundinfos über diese Leute in eurem Missionsordner abgespeichert.«
»Und was ist mit der Mutter?«, fragte Ling. »Gibt es nichts über sie zu berichten?«
»Sie ist schon früh bei einem Autounfall ums Leben gekommen«, antwortete Amir. »Die Zwillinge waren damals grade mal acht Jahre alt.«
Connor verspürte einen Stich, als er das hörte. Er war im selben Alter gewesen, als er seinen Vater verloren hatte, und das brachte ihm die Mädchen irgendwie näher.
»Aber vor Kurzem hat sich ihr Vater wieder verlobt«, fuhr Amir fort. Ein neues Foto erschien. Es zeigte Sterlings Verlobte, eine glamouröse, sehr viel jüngere Frau in eng anliegendem rotem Kleid. »Amanda Ryder ist neunundzwanzig; sie arbeitet als Model für Bademode und ist eines der bekanntesten Society-Girls der Schickeria von Sydney. Als zukünftiges Familienmitglied wird sie ebenfalls auf der Jacht sein.«
»Das dürfte nun wirklich eine höchst unterhaltsame Mission werden«, flachste Marc und grinste Connor listig an. »Zumindest hast du immer was zum Anglotzen in der Nähe.«
Connor unterdrückte ein Kichern.
»Vielleicht können wir uns darauf verständigen, die Gossenwitze endlich mal bleiben zu lassen?«, sagte Colonel Black in scharfem Ton.
Das wischte sofort das Grinsen von den Gesichtern der Jungen.
Amir setzte schnell seine Präsentation fort. »Was die Bedrohungsszenarien angeht, hat Miss Ryder vermutlich mehr Bewunderer als Feinde. Es dürfte wohl Mr Sterlings immenser Reichtum sein, der ihn und seine Familie ganz generell zu einem lohnenden Ziel für Kidnapper macht. Schließlich wird sein Vermögen auf eineinhalb Milliarden Dollar geschätzt. Emilys Entführung hat ja bewiesen, dass die Töchter für eine kriminelle Organisation oder irgendeine Verbrecherbande eine große Versuchung darstellen. Die korsische Mafia wird zwar im Indischen Ozean nicht auf eurem Radar auftauchen, aber dort, wo ihr herumkreuzen werdet, ist das Risiko einer Entführung durch Terroristen definitiv sehr hoch, zum Beispiel durch Gruppierungen wie die Sieben Säbel von Somalia, oder sogar durch internationale Verbrechersyndikate wie die russische Bratva oder die chinesischen Triaden.«
»Gibt es andere potenzielle Bedrohungen?«, fragte Connor, ohne auf die eisigen Blicke zu achten, mit denen der Colonel ihn und Marc immer noch betrachtete.
Amir nickte. »Wie überall in Touristenorten sind auch auf den Seychellen und den Malediven Straßenüberfälle und Diebstähle weit verbreitet, vor allem in der Nähe der Häfen. Meistens handelt es sich um ungeplante, spontane Aktionen; ihr müsst also ständig damit rechnen. Außerdem sind die Sterling-Zwillinge in der australischen Öffentlichkeit sehr bekannt; Paparazzi sind ständig hinter ihnen her, und seit Emilys Entführung sogar noch mehr als vorher. Aber Mr Sterlings Wunsch, sein Privatleben nicht zu stören, wurde überraschenderweise im Großen und Ganzen befolgt. Bisher jedenfalls.«
Amir legte eine Pause ein. Er schaute seine Kollegen einen – Augenblick lang ernst an. »Aber im Indischen Ozean gibt es eine noch viel größere Gefahr«, sagte er dann und legte eine kleine Pause ein, um die Spannung zu steigern. »Piraten.«
KAPITEL 7
»Du meinst so wie in Piraten der Karibik?«, fragte Jason grinsend.
»Nein, er meint echte Piraten«, antwortete Colonel Black. »Somalische Piraten, um genau zu sein. Und das Grinsen würde dir schon vergehen, wenn du es mit ihnen zu tun bekämest. Mit der üblichen romantischen Vorstellung von Piraten haben sie nicht viel zu tun. Johnny Depp mit Augenbinde, Säbel und einem Papagei auf der Schulter kannst du vergessen. Die modernen Piraten benutzen Boote mit sehr starken Motoren und sind bis an die Zähne bewaffnet, mit Kalaschnikows und sogar mit Granatwerfern.«
Amir bestätigte das mit einem Nicken und rief ein Video auf. Es war ziemlich verwackelt aufgenommen, offenbar war es von einem Schiff aus gefilmt worden. Es zeigte ein schmales weiß-blaues Motorboot, das mit hoher Geschwindigkeit durch die Wellen schnitt und direkt auf das Schiff, von dem aus das Video aufgenommen worden war, zufuhr. An Bord kauerten sieben junge Afrikaner mit Automatikwaffen. Durch das wütende Heulen des Außenbordmotors hörte man das harte Knattern von Schüssen. Ein Pirat am Bug des Bootes feuerte auf ein unsichtbares Ziel. Connor und dem Team stockte unwillkürlich der Atem, als vom Boot aus eine Granate abgefeuert wurde, die genau auf die Kamera zuflog. Das Bild wirbelte wild herum, als der Kameramann in panischer Angst in Deckung ging. Einen Sekundenbruchteil später kam die Granate wohl durch Zufall noch einmal ins Bild, als sie die Brücke knapp verfehlte und weiter auf die Kamera zuraste.
Das Video endete abrupt.
Niemand sprach. Die Vorstellung von den bösen, aber doch irgendwie liebenswerten Schurken auf ihren Schiffen mit Totenkopfflagge, Bandana und Holzbein, das sie aus den Hollywoodfilmen kannten, wurde von der harten Realität zerschmettert.
»Glücklicherweise war in diesem Fall ein Kriegsschiff in der Nähe und kam dem angegriffenen Frachter zu Hilfe«, fuhr der Colonel fort. Alle atmeten erleichtert auf. »Aber nur allzu oft ist das eben nicht der Fall. Dann gelingt es den Piraten, ein Schiff zu entern, die Besatzung gefangen zu nehmen und Lösegeldforderungen für die Freilassung ihrer Geiseln zu erpressen.«
Amir rief nun eine Grafik auf. Sie zeigte eine Reihe von senkrechten Balken in unterschiedlichen Farben, unter denen die letzten zehn Jahreszahlen standen. Die Balken wurden von Jahr zu Jahr höher und sahen damit fast wie eine steil ansteigende Treppe aus. Nur die Balken für die letzten beiden Jahre waren wieder deutlich kleiner. »Wie ihr hier sehen könnt, stieg die Zahl der Überfälle in den letzten zehn Jahren von ungefähr fünfunddreißig auf fast dreihundert pro Jahr an. Das war der Höhepunkt; seither ist die Zahl der Überfälle in dieser Meeresregion rückläufig. Im selben Zeitraum sind auch die Lösegeldforderungen ständig gestiegen. Vor zehn Jahren lagen sie bei etwa dreihunderttausend Dollar. Jetzt werden bis zu zwanzig Millionen Dollar gefordert, manchmal sogar noch mehr.«
Richie pfiff leise durch die Zähne. »Wir haben offenbar den falschen Beruf.«
»Das Problem ist«, fuhr Amir fort, »dass die Piraten ziemlich erfolgreich sind. Das Piratengeschäft begann zu wuchern. Die Banden fingen an, die Überfälle besser und effektiver zu organisieren. Am Anfang lief alles unprofessionell und chaotisch ab; heutzutage ist es ein durchorganisiertes Geschäft. Dieses Jahr zum Beispiel hat es zweiundvierzig Entführungsversuche gegeben; sechs Schiffe wurden mit ihrer Besatzung tatsächlich als Geiseln genommen. Das ist ein Rückgang im Vergleich zum letzten Jahr, aber immer noch sehr besorgniserregend.«
»Warum lassen wir die Schiffe überhaupt noch dort durchfahren, wenn es so schlimm ist?«, fragte Ling.
»Gute Frage«, antwortete der Colonel. »Die Gefahr ist zwar vorhanden, aber insgesamt ist das Risiko nicht sehr hoch. Amir wird das gleich erklären.«
Amir rief wieder Charleys Karte des Indischen Ozeans auf. »Inzwischen finden Angriffe auch in einer Entfernung von bis zu tausend Seemeilen vor der somalischen Küste statt. Aber die Mehrzahl konzentriert sich auf den sogenannten ›International empfohlenen Transitkorridor‹ durch den Golf von Aden.« Er wies mit dem Laserpointer auf eine breite Schifffahrtsstraße, die zwischen Somalia im Süden und dem Jemen im Norden verlief. Dann deutete er auf einen weiter im Südwesten liegenden Abschnitt des Ozeans. »Für Mr Sterlings Jacht ist eine Route in diesem Gebiet geplant – sie kommt also nicht mal in die Nähe der Gefahrenzone.«
»Aber wurde nicht vor ein paar Jahren ein älteres britisches Ehepaar in der Nähe der Seychellen als Geiseln genommen?«, fragte Connor, der sich vage an den Zwischenfall erinnerte, über den die Zeitungen intensiv berichtet hatten.
»Du meinst die Chandlers«, nickte Colonel Black. »Sie hatten einfach Pech: falscher Zeitpunkt, falscher Ort. Seit damals konnte die Sicherheit in dem Gebiet stark verbessert werden. Zum Beispiel durch die NATO, deren Operation Ocean Shield zum Ziel hat, die Piraterie zu bekämpfen. Ferner haben die Seychellen selbst ein Regionales Piraterie-Bekämpfungszentrum eingerichtet. Diese Maßnahmen haben zu einem beträchtlichen Rückgang der Piratenaktivitäten geführt. Außerdem kommt es ausgesprochen selten vor, dass Piraten eine Privatjacht angreifen. Für die Somalier ist das ganz große Geld nur mit den großen Frachtern zu machen, weil diese in der Regel gegen Lösegeldforderungen versichert sind.«
Amir nickte. »Das stimmt. Von den zwanzigtausend Schiffen, die jedes Jahr durch den Transitkorridor fahren, werden nur dreihundert tatsächlich angegriffen – und weniger als ein Viertel davon werden geentert. Und unter diesen Schiffen befanden sich nur eine Handvoll Privatjachten. Ich habe den Risikofaktor ausgerechnet.« Er blätterte in seinen Notizen. »Eure Chance, geentert zu werden, ist eins zu zehntausend.«
»Würdest du darauf wetten?«, fragte Ling herausfordernd.
Amir zuckte die Schultern. »Warum nicht?«
KAPITEL 8
»Glauben Sie wirklich, dass wir Ihnen noch vertrauen können?«
Harry Gibb saß allein in einer Tischnische in einer der dunkelsten Ecken des Restaurants. Die Stimme klang irgendwie körperlos, auf jeden Fall aber düster und drohend. Der Politiker wagte es nicht, einen Blick in die Nachbarnische zu werfen, aus der die Stimme kam. Er fürchtete sich vor den Folgen.
»Der Feind meines Feindes ist mein Freund«, verkündete Harry im Brustton der Überzeugung. Auch wenn es ihm selbst reichlich salbungsvoll vorkam.
»Na schön. Aber wären Sie auch tatsächlich bereit, alles Notwendige zu tun?«
»Ja, ja! Ich will Sterling vernichten. Genauso, wie er mich zu vernichten versucht!«, stieß Harry durch zusammengebissene Zähne hervor und ballte die Fäuste.
»Dann müssen wir ihn dort treffen, wo es ihm am meisten wehtut: seine Familie.«
Harry lief ein eiskalter Schauder über den Rücken. Sekundenlang blickte er auf seine Fäuste hinunter und dachte an seine Karriere, die kurz vor dem Zusammenbruch stand. »M… meinen Sie?«, fragte er mit leicht bebender Stimme. Das war ein Aspekt, über den er noch gar nicht nachgedacht hatte. »Aber Sie erwarten doch nicht, dass ich das mache, oder? So etwas würde ich nicht fertigbringen.«
»Ach, Harry. Sie sind ja nun wirklich kein Engel. Als Politiker haben Sie auf dem Weg nach oben doch schon eine hübsche Menge unschuldiger Leute niedergetrampelt.«
»Ja, schon möglich … aber das war etwas anderes.«
Ein hohles Lachen war zu hören. »Nein, Harry, das war es nicht. Politik ist genau so rücksichtslos wie Rache. Der Unterschied ist nur der Zeitpunkt. In der Politik fügt man dem Gegner Schaden zu, bevor er einem gefährlich werden kann. Dagegen findet ein Racheakt erst danach statt, also wenn einem der Gegner schon etwas angetan hat. So betrachtet, scheint mir die Rache doch sehr viel ehrenhafter zu sein.«
»Ich bin nicht sicher, ob ich damit hundertprozentig einverstanden bin«, sagte Harry, der das Gefühl hatte, dass ihm die Situation ziemlich schnell aus den Händen glitt. Er wollte eigentlich nur Sterlings Glaubwürdigkeit beschädigen und ihn so weit bringen, dass er seine Schnüffelhunde, die Journalisten, zurückpfiff. Sie sollten ihn gefälligst in Ruhe lassen.
»Zu spät, Harry. Sie stecken bis zum Hals drin. Und ich darf Ihnen versichern: Mr Sterling hat nicht die geringsten Skrupel, Sie zu vernichten, Harry. Aber keine Angst, Harry – die, äh, schmutzigeren Arbeiten erledigen meine Leute. Die Frage ist nur: Haben Sie überhaupt die Mittel, um die Sache durchzuziehen?«
»Ja … schon«, sagte Harry zögernd und zog einen dicken braunen Umschlag aus der Tasche, in dem fünfhundert knisternde Hundertdollarnoten steckten.
Ein Kellner tauchte wie aus dem Nichts auf – oder vielmehr ein Mann, der mit einem Tablett an Harrys Tisch trat. Mit seinen großen, tätowierten Gorillahänden wäre der Riese als Kellner in einem Restaurant dieser Klasse ziemlich fehl am Platz gewesen. Vermutlich war er eher an robustere Arbeiten gewöhnt als an das Servieren von Kaviarhäppchen und Champagnerflöten. Harry legte den Umschlag auf das Tablett und der »Kellner« entfernte sich ohne ein Wort.
»Wann wird die … die Kampagne beginnen?«, erkundigte sich Harry.
Aus der Nachbarnische kam keine Antwort.
»Ich habe gefragt, wann die Kampagne anfängt?«, wiederholte Harry etwas lauter.