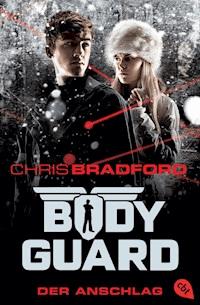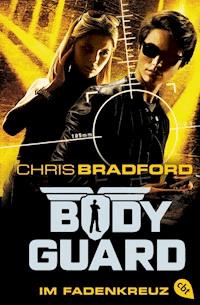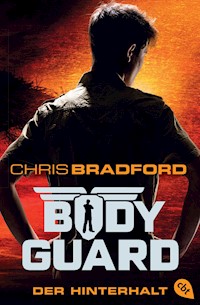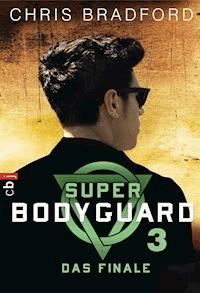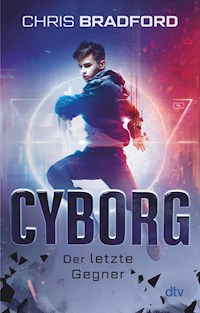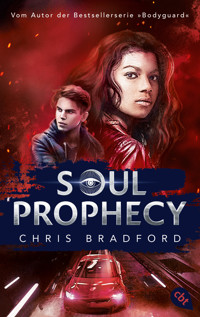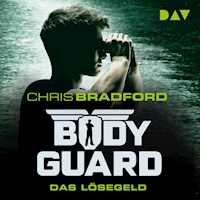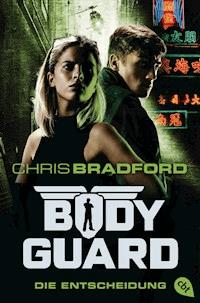
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: cbt
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Die Bodyguard-Reihe
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Auf sich gestellt. Auf der Jagd. Auf der Flucht.
Als Connor nach einem Anschlag auf das Hauptquartier der Bodyguards nach China beordert wird, zögert er keine Minute. Dort angekommen muss Connor aber feststellen, dass in Wahrheit ER das Ziel der Angriffe ist. Der junge Agent entkommt nur um Haaresbreite und befindet sich nun, verlassen in einem fremden Land, auf der Flucht vor einem Feind, den er nicht kennt. Ohne seine Verbündeten muss Connor sich dort nahezu allein durchschlagen. Dabei ist es diesmal er selbst, der dringend Schutz bräuchte ...
Erfolgsgarant Chris Bradford liefert mit "Bodyguard" kugelsichere Action kombiniert mit explosiven Showdowns.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 474
Ähnliche
DER AUTOR
© Danny Fitzpatrick
DER AUTOR
CHRIS BRADFORD recherchiert stets genau, bevor er mit dem Schreiben beginnt: Für seine neue Serie »Bodyguard« belegte er einen Kurs als Personenschützer und ließ sich als Leibwächter ausbilden. Bevor er sich ganz dem Bücherschreiben widmete, war Chris Bradford professioneller Musiker und trat sogar vor der englischen Königin auf. Seine Bücher wurden in über zwanzig Sprachen übersetzt und vielfach ausgezeichnet.
Mehr Informationen zur Bodyguard-Serie unter:
www.cbj-verlag.de/bodyguard
Mehr zu cbj auf Instagram @hey_reader
CHRIS BRADFORD
DIE ENTSCHEIDUNG
Aus dem Englischen von
Karlheinz Dürr
Für all meine Bodyguard-Fans:
Passt auf euch auf!
KAPITEL 1
Connor Reeves packte den Stock fest mit beiden Händen und schmetterte ihn in den Bauch des Ringers mit der silbernen Maske, so fest er nur konnte. Der Ringer wurde herumgerissen, durch den Hieb ins Schwanken gebracht.
»Dale! Dale! Dale!«, schrie die Menge auf Spanisch und spornte ihn mit ihrem rhythmischen Hau drauf!-Gebrüll an, noch einmal und noch härter zuzuschlagen.
Als der Ringer wieder zu ihm herumschwang, holte Connor zum zweiten Schlag aus. Dieses Mal versetzte er ihm einen derart vernichtenden Treffer, dass ihm der Bauch aufplatzte, seine Eingeweide herausquollen und auf den gefliesten Boden prasselten. Die Menge jubelte, Connor wurde fast niedergetrampelt, als alle heranstürmten. Connor riss sich die Augenbinde herab. Verblüfft beobachtete er, welche überschäumende Begeisterung eine Geburtstags-Piñata auslösen konnte. Allerdings hatte er auch nur Obst und Süßigkeiten erwartet, mit denen die aus Pappmaschee geformten mexikanischen Piñatas normalerweise gefüllt waren – und nicht Dollarbündel, Silbermünzen, Goldkettchen, glitzernde Halsketten und funkelnde Ringe! Aber schließlich war der Vater des Geburtstagskinds ein schwerreicher Banker und äußerst großzügiger Gastgeber der Party.
»Du hast einen sehr guten Schlag drauf, Connor«, sagte Carlos Silva, der Vater des Mädchens, dessen 14. Geburtstag mit der Party gefeiert wurde. Er sprach Englisch mit weichem lateinamerikanischen Akzent.
Connor zuckte die Schultern, aber um die für sein Alter erstaunliche Kraft zu erklären, sagte er: »Ich spiele sehr oft Cricket, Señor Silva.«
»Na, du hast dem guten El Santo jedenfalls einen ordentlichen Hieb versetzt!«
Carlos lachte und wies mit einem Nicken auf die Piñatafigur, die die Gestalt des berühmten mexikanischen Ringers mit der Silbermaske hatte. Im wahren Leben war der Ringer ein gewisser Rodolfo Guzmán Huerta gewesen, den man aber nur unter dem Namen El Santo – der Heilige – kannte. Jetzt baumelte die Pappmascheefigur wie ein leerer Sack einsam und verlassen von der Decke. »Nach unserer Tradition symbolisiert die Piñata den Teufel. Du hast ihn so mächtig verprügelt, dass er alle schönen und guten Sachen wieder hergeben musste, die er gestohlen hatte. Was kann dir denn der Teufel gestohlen haben, dass du so wütend auf ihn einhaust?«
Connor antwortete nur mit einem halbherzigen, bitteren Lächeln. Mit der scherzhaften Frage hatte Señor Silva ziemlich genau Connors empfindlichste Stelle getroffen – auch wenn er das niemals erfahren würde. Connor wünschte, er könnte mit den Schlägen seinen Vater wieder zurückholen, den er verloren hatte, als er gerade mal acht Jahre alt gewesen war – seinen Vater, der in einen feigen Hinterhalt geraten und ums Leben gekommen war, als er den amerikanischen Botschafter im vom Krieg zerrissenen Irak beschützen wollte. Und jetzt schien es der Teufel darauf abgesehen zu haben, Connor auch noch die Mutter zu nehmen. Sie kämpfte seit Jahren gegen eine immer weiter fortschreitende Multiple Sklerose. Nur seine Großmutter schien dem Teufel die Stirn zu bieten und immer weiter kämpfen zu wollen, trotz ihres Alters und der schmerzhaften Hüftarthrose.
Connor gab dem Gastgeber den Schlagstock zurück, der Piñatabuster genannt wurde.
Doch Carlos schüttelte den Kopf. »Behalte ihn. Als Erinnerung daran, dass du eine der größten Legenden des mexikanischen Sports besiegt hast.«
»Danke.« Connor schob den in allen Regenbogenfarben gestreiften Stock in die Gesäßtasche seiner Jeans.
Der Banker klopfte ihm fest auf die Schulter. »Und jetzt genieße die Party, mein Freund.«
Carlos gesellte sich wieder zu seiner Frau, die auf der Veranda das Schauspiel des Sonnenuntergangs genoss.
»Hi, Connor!« Ein junger Mexikaner schlenderte herbei und legte Connor freundschaftlich den Arm um die Schultern. Eduardo war der Sohn eines hochrangigen mexikanischen Politikers und der Klient, den Connor beschützen musste – ein schlanker Junge mit glattem, schwarzem Haar und bronzefarbener Haut. Eduardo hatte zwar bereits zwei muskelbepackte Leibwächter, die ihn auf Schritt und Tritt begleiteten, aber Connor sollte sein »unsichtbarer Schutzschild« sein – ein gleichaltriger Freund, in dem niemand einen Bodyguard vermuten würde. Obwohl Connor für Eduardo arbeitete, waren sie von Anfang an gut miteinander ausgekommen, und im Laufe der letzten Wochen hatte sich eine Freundschaft zwischen ihnen entwickelt.
»Hey, hast du denn gar nichts von der Piñata abbekommen?«, fragte Eduardo, der ein Bündel Banknoten in der einen und eine Menge Süßigkeiten in der anderen Hand hielt.
Connor schüttelte den Kopf. »Nein – war viel zu sehr damit beschäftigt, den Teufel zu verprügeln.«
Eduardo wickelte einen Lutscher aus der knallgelben Folie und steckte ihn in den Mund. »Na, du hast eine Menge verpasst!«
»Nein, hat er nicht!« Maria war unbemerkt herangekommen. Sie trug ein glitzerndes weißes Kleid, das lange, honigfarbene Haar hatte sie zu einem dicken Zopf geflochten und mit kleinen roten Rosen geschmückt. So wunderbar, wie sie aussah, konnte es keinen Zweifel geben, wer das Geburtstagskind war. »Connor, extra für dich habe ich das hier genommen …« Und mit schüchternem Lächeln legte sie eine kleine goldene Kette um sein Handgelenk.
»Äh … danke!«, sagte Connor verlegen. Er war nicht sicher, wie er auf das Geschenk reagieren sollte. »Das ist … wirklich nett.«
»Nett?«, echote Eduardo grinsend und schob den Lutscher von einem Mundwinkel zum anderen. »Nett? Das Ding ist aus massivem Gold, zweiundzwanzig Karat!«
Also ganz sicher kein normales Partygeschenk, dachte Connor ein wenig erschrocken. Aber im Grunde war ihm klar, dass ihn das nicht wundern sollte. Das hier war sein fünfter Einsatz, diesen unbekümmerten, nachlässigen Umgang mit Reichtum hatte er mittlerweile oft genug beobachten können. Es war praktisch unvermeidlich, wenn man die Söhne und Töchter der Reichen und Mächtigen beschützte. Trotzdem bereitete es ihm Unbehagen, ein Geschenk zu bekommen, das womöglich ein paar Tausend Dollar wert war. Er öffnete den Verschluss des Kettchens. »Tut mir leid, aber ich kann das nicht annehmen. Das ist zu viel.«
»Natürlich kannst du!«, widersprach Maria. »Das ist meine Party! Heute bestimme ich, wer Geschenke bekommt!« Sie fixierte ihn mit ihren bezaubernden braunen Augen. »Oder willst du etwa das Geburtstagskind beleidigen? Na?«
Connor trat verlegen von einem Fuß auf den anderen. »Äh … natürlich nicht …«
Plötzlich setzte dröhnender Latinobeat ein. Das Lautsprechersystem ließ die gesamte Terrasse erbeben. Discolichter blitzten und wirbelten über den Köpfen der Menge.
»Komm schon, tanzen wir!«, rief Maria, packte Connors Arm und zerrte ihn zur Tanzfläche auf der Terrasse.
Connor warf Eduardo einen hilflosen Blick zu. Natürlich war ihm vollkommen klar, dass er an der Seite seines Klienten bleiben musste. Aber Eduardo lachte nur, als Marias Freundinnen Connor kichernd umzingelten und verhinderten, dass er sich davonstehlen konnte. Alle Mädchen wollten mit ihm tanzen und natürlich fühlte sich Connor ob dieser Aufmerksamkeit geschmeichelt. Besorgt blickte er noch einmal zu Eduardo hinüber, doch dann beruhigte er sich mit dem Gedanken, dass noch mehrere andere Sicherheitsleute Haus und Park bewachten. Außerdem war das gesamte Anwesen von hohen drahtbewehrten Mauern und Videokameras umgeben und die Wachmänner patrouillierten regelmäßig im Park. Sein Klient war so sicher, wie er nur sein konnte, auch wenn ihn Connor nicht ständig im Blick hatte.
Immer mit einem Auge auf Eduardo, tanzte Connor mit Maria und ihren Freundinnen bis spät in den Abend hinein. Bei jedem Song schob sich das Geburtstagskind ein wenig näher an Connor heran, was Connor in eine peinliche Zwangslage brachte. Als der Discjockey schließlich noch langsamere Lieder aufzulegen begann, raffte Maria ihren Mut zusammen, schob den Arm um Connors Nacken und …
Der zärtliche Augenblick wurde glücklicherweise durch Connors Handy unterbrochen. Er zog es aus der Tasche und warf einen Blick auf das Display. Charley.
Connor entschuldigte sich und ging auf die Veranda hinaus. Maria blickte ihm mit gerunzelter Stirn und verletztem Ego nach. Connor nahm den Videoanruf entgegen. Charleys warmes, breites Lächeln erschien auf dem Display. Ihr Kopf lag auf einem Kissen, ein paar Strähnen ihres weizenblonden Haars hatten sich von den Verbänden nicht bändigen lassen.
»Hi, Connor.« Ihre Stimme klang sanft, aber erschöpft. Sie hörte den rhythmischen Sound der Discomusik und sah die blitzenden Stroboskoplichter im Hintergrund. »Ich hoffe, ich störe dich nicht bei irgendwas …?«
»Natürlich nicht«, antwortete Connor. Er war überglücklich, seine Freundin zu sehen. Seit einer Woche hatten sie keine Gelegenheit mehr gehabt, miteinander zu sprechen – Connor war durch seinen Einsatz in Mexiko voll beansprucht gewesen, und Charley hatte weitere Behandlungsschritte ihrer Rückgratoperationen hinter sich bringen müssen. Charley hielt sich in China auf, um sich einer speziellen, bisher einmaligen Operationsmethode mit anschließender intensiver Physiotherapie zu unterziehen. Die Rückgratverletzungen hatte sie sich bei einem Einsatz als Buddyguard zugezogen, der ein furchtbares Ende genommen hatte. Von der Hüfte abwärts war sie gelähmt und seit zwei Jahren an den Rollstuhl gefesselt. Das hatte sie allerdings nicht daran gehindert, weiter mitzuarbeiten, und zwar mit vollem Einsatz: Sie war Operationsleiterin des Alpha-Teams und eine der erfahrensten Buddyguards in der gesamten Organisation.
»Wie ist die Operation verlaufen?«, fragte Connor.
»Ich fühle mich immer noch ein bisschen groggy und habe manchmal seltsame Träume, aber der Arzt meint, die Implantation sei erfolgreich verlaufen. Jetzt habe ich mich so weit erholt, dass ich mit der Physiotherapie beginnen kann. Ich habe noch einen langen Weg vor mir, aber der Arzt ist zuversichtlich.«
»Das ist ja großartig …!«
»Connor! Komm endlich zurück! Ich will weitertanzen!«, rief Maria, die plötzlich hinter Connor auftauchte.
Charley runzelte die Stirn. »Klingt so, als würdest du dich bestens amüsieren.«
Connor grinste verlegen. »Geburtstagsparty«, erklärte er. »Maria hat meinen Klienten eingeladen, sie sind Klassenkameraden.«
»Na, ich glaube, die Klassenkameradin wird ungeduldig und möchte jetzt mit dir tanzen«, sagte Charley mit gepresster Stimme.
»Charley … du weißt doch: Du bist die Einzige«, versicherte ihr Connor. Und es war die Wahrheit – noch nie hatte er ein Mädchen wie Charley kennengelernt. Sie war sein Ein und Alles. »Ich würde dich niemals betrügen. Schon deshalb, weil du mich dann in den Arsch treten würdest!«
Charley lachte auf – sie wussten beide, dass es stimmte. Mit Charley musste man rechnen, das hatte sie im Kampftraining immer wieder bewiesen. So mancher der anderen Buddyguard-Rekruten hatte auf schmerzhafte Weise lernen müssen, ihre Fähigkeiten nicht zu unterschätzen, nur weil sie im Rollstuhl saß.
»Und nach der Therapie«, fuhr Connor fort, »wird es bestimmt nicht mehr lange dauern, bis ich mit dir tanzen kann …«
Eine ohrenbetäubende Explosion zerriss die Nachtluft. Connor zuckte heftig zusammen.
KAPITEL 2
Der Nachthimmel wurde jäh von einem gleißend grellen Blitz erhellt. Connor fuhr herum, suchte mit den Blicken nach Eduardo. Schreiend kamen Maria und ihre Freundinnen auf die Terrasse gerannt.
»Probleme?«, fragte Charley, plötzlich angespannt und besorgt.
»Nein, nur ein Feuerwerk!«, lachte Connor erleichtert auf. Er hatte inzwischen seinen Schützling entdeckt, der an der Balustrade lehnte. »Das große Finale der Party. Ich muss meinen Klienten nach Hause bringen.«
Charley ließ sich wieder auf das Kissen sinken und lächelte erleichtert. »Ja, okay, pass auf dich auf. Du fehlst mir.«
»Du mir auch«, sagte Connor, strich ihr auf dem Display kurz übers Gesicht und beendete das Gespräch.
Das Feuerwerk flammte am Himmel mit einem prächtigen Schauspiel funkelnder roter, blauer und goldener Blitze, auseinandersprühender Sterne und bunt glitzernder Wirbel. Die Gäste ließen das übliche Ooooh und Aaaah hören, als immer neue Raketen in die Nacht stiegen, Böller knallten, bengalisches Feuer aufleuchtete und sich Sterne und Sonnen in allen Farben des Regenbogens über den Nachthimmel ergossen. Zum Abschluss rollte ein ohrenbetäubender Böllerschlag über die Party, und eine wahre Galaxie von Sternen regnete herab: Die Party war zu Ende. Die Gäste nahmen ihre Taschen und Jacken und machten sich auf den Weg zu den wartenden Limousinen.
Auch Connor zog seine Jacke an und schaltete wieder in den Buddyguard-Modus. Er wich keinen Meter von Eduardos Seite.
Solange sie sich auf dem Villengelände aufhielten, befanden sie sich in einer relativ sicheren Zone, die Straßen von Mexico City jedoch waren ein potenzielles Schlachtfeld, schließlich galt die Stadt als Kidnapping-Hauptstadt der Welt. Drogenkartelle und andere Verbrecherbanden entführten oftmals Familienangehörige der Reichen und Mächtigen, um immer höhere Lösegelder zu erpressen. Diese großen Risiken machten Connors Einsatz besonders gefährlich. Und doch war Connor in den drei zurückliegenden Wochen nichts Gefährlicheres widerfahren als ein Sonnenbrand und ein paar Moskitostiche.
»Die Party hat dir wohl ziemlich gut gefallen, stimmt’s?«, fragte Eduardo und grinste breit, als die beiden Jungen auf der von Flutlicht beleuchteten Zufahrt zum Parktor gingen, begleitet von den beiden stiernackigen, schwer bewaffneten Bodyguards.
»Absolut«, antwortete Connor und zeigte Eduardo das goldene Kettchen an seinem Handgelenk. »Du hast sehr großzügige Freunde.«
Eduardo winkte Maria zum Abschied, dann stieß er Connor mit dem Ellbogen an. »Ja, und Maria fährt definitiv auf dich ab.«
Connor blickte zurück. Maria winkte ihm hinterher, ihre dunklen Augen funkelten. Als er ein wenig zaghaft die Hand hob und den Gruß erwiderte, warf sie ihm eine Kusshand zu.
»Spätestens morgen wird sie deine Handynummer haben wollen«, prophezeite Eduardo grinsend.
Connors Gedanken kehrten zu Charley zurück. »Bin bereits vergeben.«
Eduardo warf ihm einen verblüfften Blick zu. »Aber bestimmt sieht sie nicht so super aus wie Maria, oder?«
Connor lächelte nur.
Eduardo lachte. »Na, wenn das der Fall ist, will ich unbedingt Buddyguard werden. Ihr Typen kriegt doch immer die heißesten Mädels ab!«
Sie gingen durch das Haupttor auf die Straße hinaus. Maria hatte so viele Freundinnen und Freunde eingeladen, die teilweise in Begleitung ihrer Eltern gekommen waren, dass die Straße auf beiden Seiten vollkommen zugeparkt war. Der SUV, in dem Eduardo und Connor hergefahren worden waren, parkte deshalb ein gutes Stück entfernt auf der anderen Seite. Unter Sicherheitsaspekten war das keinesfalls ideal, es bedeutete, dass Eduardo unnötig lange einer potenziellen Gefahr ausgesetzt war. Connor erhöhte instinktiv seine Alarmbereitschaft und ließ den Blick aufmerksam umherschweifen. SUVs mit dunkel getönten Scheiben reihten sich auf beiden Straßenseiten dicht an dicht. Es herrschte nur leichter Verkehr, der keine unmittelbare Bedrohung darstellte. Außer den Partygästen, die von ihren Leibwächtern begleitet unter ständigem Lachen und Plappern zu ihren Fahrzeugen schlenderten, waren kaum Passanten zu sehen, und auch von diesen kam Connor niemand verdächtig vor. Trotzdem konnte und wollte er sich nicht entspannen, bevor sein Klient nicht wieder sicher und wohlbehalten in der Villa der Familie angekommen war.
Flankiert von den beiden schwergewichtigen Sicherheitsmännern warteten Eduardo und Connor am Straßenrand auf den SUV. Ein weiß-blauer TV-Übertragungswagen näherte sich. Connor sah, dass der Fahrer eine Atemschutzmaske trug. Bei dem Smog in der Stadt verständlich, dachte Connor. Obwohl … im Fahrzeug gibt es doch bestimmt eine Klimaanlage mit Filter …
»Nach der ganzen Tanzerei bin ich am Verhungern«, bemerkte Eduardo. »Wir könnten unterwegs noch kurz anhalten und ein paar Tacos …«
Es quietsche durchdringend, der Ü-Wagen hatte mitten auf der Straße scharf abgebremst, die Hintertüren flogen auf. Fünf maskierte Männer sprangen heraus und richteten Sturmgewehre auf die Partygäste und Passanten auf dem Gehweg.
Eduardos Sicherheitsmänner zogen ihre Waffen, wurden aber schon vom ersten Kugelhagel niedergemäht. Connor, dessen sechster Sinn schon durch den maskierten Fahrer alarmiert worden war, hatte Eduardo bereits zu Boden gestoßen und kauerte über ihm, während weitere Geschosse ihm um die Ohren pfiffen. Die Sicherheitskräfte der übrigen Partygäste erwiderten das Feuer. Sie erschossen einen der Angreifer und verwundeten einen zweiten. Aber ihre Priorität war nun einmal, die eigenen Klienten zu schützen, nicht Eduardo.
Die Bodyguards hatten nur eins im Sinn: ihre Schützlinge so schnell wie möglich zu ihren jeweiligen Fahrzeugen zu schaffen und aus der Gefahrenzone zu fliehen. Nachdem Eduardos Sicherheitsmänner niedergemäht worden waren, blieben Connor und Eduardo allein zurück, Connor war jetzt der einzige Schutz, den sein Klient hatte.
Connor warf einen Blick über die Schulter und fluchte. Die schweren Parktore hatten sich schon bei den ersten Schüssen automatisch geschlossen. Damit war ihnen die nächste und beste Fluchtroute versperrt. Sie hatten nur noch eine Überlebenschance: ihr kugelsicherer SUV.
»Kopf unten lassen!«, befahl Connor, als er Eduardo hinter ein geparktes Auto stieß. Er selbst reckte sich gerade so weit, dass er durch die hinteren Seitenfenster spähen konnte. Die maskierten Angreifer kamen heran. Der dreiste und äußerst brutale Angriff schockierte ihn. Die Maskierten waren ein extrem hohes Risiko eingegangen, ein derart gut geschütztes Anwesen offen anzugreifen, zu einem Zeitpunkt, als sich dort zahlreiche bewaffnete Bodyguards aufhielten. Das konnte nur bedeuten, dass es eine Alles-oder-nichts-Mission war: Sie hatten es eindeutig auf eine ganz bestimmte Zielperson abgesehen … und angesichts der Tatsache, dass die beiden Sicherheitsmänner schon in den ersten paar Sekunden erschossen worden waren, musste Connor annehmen, dass diese Zielperson niemand anders sein konnte als Eduardo.
Auf der Straße hatte sich ein wildes Feuergefecht entwickelt, zahlreiche Tote, Sterbende oder Verwundete lagen auf dem Gehweg. Connor hörte das Kreischen der Reifen, als ein weiterer SUV aus seiner Parklücke hervorschoss, um seine Insassen in Sicherheit zu bringen, dann quer über die Straße schlingerte und gegen einen Laternenmast krachte. Die Straße wurde zum Schlachtfeld, Connor musste unter allen Umständen versuchen, seinen Klienten zu evakuieren. Er spähte über die Motorhaube des Fahrzeugs, hinter dem er und Eduardo in Deckung lagen, und entdeckte Eduardos Chauffeur, der sich hinter das Armaturenbrett duckte. Der Fahrer konnte sie nicht sehen, aber wenigstens hatte er nicht zu fliehen versucht … noch nicht.
Während Connor noch die Chance abzuschätzen versuchte, den SUV lebend zu erreichen, schrie Eduardo plötzlich: »Cuidado, Connor!«
Connor fuhr herum, ein maskierter Mann hatte sich hinter ihnen herangeschlichen, eine Glock 17 direkt auf sie gerichtet. Connor riss den Piñatabuster aus der Jeanstasche und ließ den Stock blitzschnell auf die ausgestreckte Pistolenhand krachen. Ein hässliches Knacken war zu hören, als das Handgelenk brach. Der Mann stöhnte auf vor Schmerzen und ließ die Waffe fallen. Connor rammte ihm den Stab unters Kinn, sodass sein Kopf brutal zurückgestoßen wurde. Ein letzter Schlag auf die Kniescheibe und der Angreifer stürzte, kaum noch bei Bewusstsein, zu Boden.
Eduardo starrte Connor mit runden Augen an, voller Bewunderung für die Kampfkünste seines Freundes.
»Los, komm!«, rief Connor, packte Eduardo am Oberarm und zog ihn auf die Füße. »Zum SUV!«
Schüsse peitschten um sie herum, als sie zu ihrem Fahrzeug sprinteten. Connor tat alles, um Eduardo mit dem eigenen Körper vor Kugeln zu schützen. Er spürte einen heftigen Schlag an der Schulter, offenbar ein Streifschuss, aber die kugelsichere Jacke absorbierte den größten Teil der Energie. Ihr Fahrer, der sie inzwischen im Rückspiegel entdeckt hatte, entsperrte die Türen. Kugeln prallten von der gepanzerten Karosserie ab. Eduardo schrie auf und stolperte, aber Connor hielt ihn aufrecht. Er riss die große Hecktür des SUV auf, stieß Eduardo hinein, sprang auf ihn und schlug die Klappe hinter sich zu. Zahlreiche Geschosse hämmerten wie Hagel gegen das Panzerglas der Heckscheibe und die Karosserie.
»VAMOS!«, brüllte Connor auf Spanisch.
Der Fahrer trat das Gaspedal durch und der SUV schoss davon. Aber schon tauchte wie aus dem Nichts ein weiterer Van auf und blockierte den Fluchtweg. Der Fahrer fluchte, zog die Handbremse, vollführte eine 180-Grad-Wende und raste direkt auf die beiden verbliebenen Angreifer zu. Die Männer gingen sofort in Deckung, der starke SUV rammte den Ü-Wagen mit solcher Wucht, dass er mit einem knochenmarkerschütternden Krachen zur Seite geschleudert wurde. Damit hatte der Fahrer ihnen den Fluchtweg aus der Todeszone freigekämpft, er trat das Gaspedal voll durch, schlängelte sich zwischen den übrigen Fahrzeugen hindurch und raste davon. Die Heckscheibe klirrte unter der Wucht der High-Velocity-Geschosse, die auf sie einprasselten. Doch dann raste der SUV praktisch auf zwei Rädern um die nächste Kurve und ließ die Todeszone hinter sich.
Als sie außer Gefahr waren, schob sich Connor von Eduardo. »Alles in Ordnung bei dir?«, fragte er.
Doch Eduardo gab keine Antwort. Sein Gesicht war blass, sein Atem ging schnell, keuchend, heiser. Connor hielt es zuerst für die Auswirkungen des Schocks – bis er den Blutfleck auf dem Hemd des Jungen bemerkte, der sich immer weiter ausbreitete.
»Nein! Bitte nicht … nein!«, keuchte Connor. Er beugte sich tief über die Lehnen der Vordersitze und zog das Erste-Hilfe-Pack aus dem Stauraum unter dem Fahrersitz hervor. Mit einer sterilen Binde drückte er auf die Brustwunde, um den Blutverlust zu stoppen, und schrie dem Fahrer zu: »Al hospital! Rápido!«
KAPITEL 3
Connor stand am Bordstein in der Abholzone vor dem Terminal 5 des Londoner Flughafens Heathrow, den Koffer neben sich, und wartete seit über einer halben Stunde darauf, von einem der Trainer der Buddyguard-Organisation mit dem Auto abgeholt zu werden. Er hoffte immer noch, dass die Verzögerung einfach nur einem Verkehrsstau zuzuschreiben war, aber je länger er zusehen musste, wie die ankommenden Passagiere von ihren Familien oder Freunden abgeholt wurden und unzählige Taxis ankamen und abfuhren, desto größer wurden seine Zweifel, dass nur der Verkehr die Ursache für die Verspätung war.
Er hatte bereits mehrfach versucht, das Buddyguard-Hauptquartier anzurufen, aber es hatte sich niemand gemeldet. Vermutlich hatten sie alle Hände voll zu tun, die Folgen der Katastrophe, die er in Mexiko angerichtet hatte, aus der Welt zu schaffen. Das wäre wirklich nicht erstaunlich. Bei dieser Mission hatte er versagt.
Sein Klient war tot.
Obwohl der Fahrer das Letzte aus dem SUV herausgeholt hatte, waren sie zu spät im Krankenhaus angekommen. Und obwohl auch Connor während der wilden Fahrt sein Bestes getan hatte, um die Blutung zu stoppen, war Eduardo schließlich seinen schweren inneren Blutungen erlegen. Dem Autopsiebericht zufolge war Eduardo von einer Kugel in der oberen Brusthälfte getroffen worden, die den linken Lungenflügel durchschlagen und seine Lungenarterie zerfetzt hatte.
Nach dem Überfall hatte Connor einen kurzen Bericht an das Alpha-Team gemailt. Allerdings war er so geschockt gewesen, dass er sich nur auf die wichtigsten Fakten beschränkt hatte. Eduardos Vater, außer sich vor Trauer und Wut, hatte Connor sofort gefeuert. Connor hatte sich nicht gegen die Vorwürfe gewehrt. Selbst wie benommen, zutiefst geschockt und erschüttert, war er in die Villa des Politikers zurückgekehrt, hatte sich mit einer langen Dusche Eduardos Blut vom Körper gespült, Koffer und Rucksack gepackt und ein Ticket für den erstbesten Flug zurück ins Vereinigte Königreich gekauft.
Dass das Hauptquartier niemanden geschickt hatte, um ihn vom Flughafen abzuholen, konnte nur bedeuten, dass er in Ungnade gefallen war.
Nach einer weiteren halben Stunde beschloss Connor, ein Taxi zum Bahnhof Paddington zu nehmen. Schon im Flugzeug hatte er mit dem Gedanken gespielt, nach der Ankunft direkt nach Ostlondon zu fahren, wo er mit seiner Mutter und Großmutter wohnte. Aber wie sollte er den beiden Frauen die unerwartete Ankunft erklären? Sie hätten ihn mit Fragen gelöchert, auf die er keine Antwort geben konnte oder durfte. Seine Mutter ahnte noch immer nicht, dass er als junger, verdeckter Bodyguard arbeitete, der die Söhne und Töchter der Reichen, Berühmten und Mächtigen beschützte. Sie glaubte, er habe ein Sportstipendium bekommen, das ihm den Besuch eines Privatinternats in Wales ermögliche – und dass er sich die vielen Blutergüsse, Kratzer und Wunden, mit denen er nach jedem Schulhalbjahr nach Hause kam, bei den hart ausgetragenen Wettkämpfen, auf endlosen Touren mit dem Mountainbike oder bei Kampfsportturnieren zugezogen habe.
Nur Connors Großmutter kannte die ganze Wahrheit. Trotz ihres hohen Alters und ihrer Gebrechlichkeit funktionierte ihr Verstand noch so klar wie immer, den Täuschungsversuch mit dem angeblichen »Stipendium« hatte sie sofort durchschaut. Connor hatte ihr alles über die sogenannte »Internatsschule in Wales« erzählt, die in Wahrheit eine Buddyguard-Organisation war und von dem strengen Colonel Black geleitet wurde. Und obwohl sie das ganze Arrangement missbilligte, hatte sie widerstrebend eingewilligt, dass Connor den Job übernahm. Denn die Organisation zahlte für die medizinische Betreuung von Connors schwer kranker Mutter, einschließlich einer im Haus wohnenden Vollzeitpflegekraft. Ohne das Arrangement hätte seine Mutter wahrscheinlich in ein Pflegeheim und seine Großmutter in ein Altersheim ziehen müssen – und Connor selbst wäre in die Obhut einer Pflegefamilie gekommen. Das wären die Alternativen gewesen, die weder den beiden Frauen noch Connor gefallen hätten. Und da sein Vater nicht mehr lebte, fühlte sich Connor dafür verantwortlich, die kleine Familie beisammenzuhalten.
Deshalb konnte er jetzt nicht nach Hause – noch nicht.
Connor stieg in den Schnellzug zum Bahnhof Cardiff Central. Er fand einen Platz in einem halb leeren Abteil und verstaute sein Gepäck auf der Gepäckablage über den Sitzen. Im Bahnhof hatte er sich zwar ein Sandwich gekauft, musste aber jetzt feststellen, dass ihm der Appetit vergangen war. Er ließ sich auf das fadenscheinige Sitzpolster fallen und starrte mit leerem Blick hinaus. Die Vorortsbezirke Londons flogen wie eine schier unendliche Abfolge von verwischten grauen Häuserreihen und Industriegebieten vorbei, bis sie durch grüne Felder und sanfte Hügel abgelöst wurden.
Als der Zug in einen Tunnel raste, wurde Connors Welt in Dunkelheit gestürzt – und plötzlich sah er Pistolen, aus denen rote Blitze schossen … hörte ferne Schmerzensschreie … und Eduardos Gesicht, blass, leblos, schwebte vor seinen Augen.
Die geisterhafte Vision, die er im Fenster sah, jagte ihm einen Schauder über den Rücken. Eine Sekunde später raste ein Gegenzug vorbei und riss ihn brutal in die Realität zurück. Schon schoss sein Zug wieder aus dem Tunnel ins grelle Tageslicht hinaus. Connor presste beide Hände vor die Augen und atmete tief ein und aus. Das war eine milde Panikattacke gewesen, ihm war klar, dass er erschöpft und ausgebrannt war. Fünf Missionen, eine dicht nach der anderen, ohne Pause … und dieser fünfte Auftrag in Mexiko war einer zu viel gewesen. Er hatte dabei einen Fehler gemacht, eine fatale Fehlentscheidung getroffen, die seinen Klienten das Leben gekostet hatte.
Die Atemschutzmaske des Fahrers im Van war mir doch sofort verdächtig vorgekommen – warum habe ich die beiden anderen Sicherheitsmänner nicht auf ihn aufmerksam gemacht? Hätte ich nicht besser versuchen sollen, wieder in den Park zurückzukommen, statt mitten durch den Kugelhagel zum SUV zu laufen? Was wäre geschehen, wenn ich die Pistole aufgehoben und zurückgeschossen hätte? Oder wenn ich einfach in Deckung hinter dem Auto geblieben und auf Verstärkung gewartet hätte? Wäre dann Eduardo vielleicht noch am Leben? Hätte ihn dann vielleicht keine Kugel getroffen? Was wäre passiert, wenn ich …?
Tränen schossen Connor in die Augen und die Landschaft draußen verschwamm zu einem einzigen grün-grauen Nichts. So viele »Wenn« und »Vielleicht«. Jedes Mal, wenn er an Eduardo dachte, wurde er von einer Gefühlswelle überwältigt, ein Gemenge aus Wut, Trauer und Schuld – Wut auf die brutalen, schießwütigen Angreifer, Trauer über den tragischen Tod des Jungen, der nicht nur ein Klient, sondern auch sein Freund gewesen war. Und Schuldgefühle, weil er seine Pflicht nicht getan und seinen Klienten nicht beschützt hatte.
Er wischte sich die Tränen mit dem Ärmel aus den Augen. Tief im Innern war ihm klar, dass es Zeit war aufzuhören – Buddyguardsein und die Zeit als »unsichtbarer Schutzschild« endgültig hinter sich zu lassen. Irgendwie musste er eine andere Möglichkeit finden, für die Pflege seiner Mutter zu sorgen …
Aber sein Vater, ein hoch angesehener, mehrfach für seine Tapferkeit ausgezeichneter SAS-Soldat, hatte niemals aufgegeben. Hatte er jemals bei einer Mission versagt? Und wenn es so war, wie war er mit den erdrückenden Schuldgefühlen umgegangen? Connor konnte sich nicht vorstellen, dass sein Vater bei irgendetwas versagt hätte. Selbst bei seinem letzten Einsatz im Irak, als er bereits angeschossen und schwer verwundet gewesen war, hatte er es noch geschafft, seinen Klienten in Sicherheit zu bringen. Bei jener schicksalhaften Mission, bei der er niemand Geringeren als den amerikanischen Botschafter Antonio Mendez hatte beschützen müssen, denselben Mann, der später Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika wurde.
Was hätte Eduardo wohl mal eines Tages werden können, wenn er den Angriff überlebt hätte? Das würde niemand jemals erfahren …
Wieder musste Connor Tränen der Scham und Trauer wegblinzeln. Wie er sich in diesem Moment nach Charley sehnte, danach in ihren Armen alles zu vergessen, Mexiko, Eduardo, die Kugel, die seinem Klienten in die Brust gedrungen war. Und tatsächlich genügte schon der Gedanke an seine Freundin, um sein eigenes Schicksal wieder nüchterner, aus der richtigen Perspektive betrachten zu können. Denn anders als Charley war er bei diesem Einsatz nicht verwundet und von der Hüfte abwärts gelähmt worden. Nein – er hatte überlebt und war, von einem schmerzhaften Bluterguss an der Schulter abgesehen, unverletzt geblieben. Er hatte Glück gehabt.
Was würde Charley jetzt von ihm halten? Was dachten die anderen im Alpha-Team über ihn? Ling, Jason, Richie, Marc, Amir … sie alle waren aufeinander angewiesen, vertrauten einander das eigene Leben an. Doch bei Connor hatten sie jetzt allen Grund, niemals mehr auf seine Fähigkeiten als Bodyguard zu vertrauen.
Connor lehnte den Kopf gegen das kühle Abteilfenster und spürte, wie der Rhythmus der Räder auf den Gleisen durch seinen Körper vibrierte. Endlich gab er nach, ließ sich von seiner Erschöpfung und dem Jetlag überwältigen und schloss die Augen …
Ein durchdringendes Quietschen weckte ihn. Der Zug fuhr gerade in die Cardiff Central Station ein.
Connor nahm seinen Koffer und den Rucksack und stieg aus. An der Stelle, wo viele der anderen Mitreisenden abgeholt wurden, wartete niemand auf ihn, kein Range Rover mit Jody oder Steve am Steuer, kein vom Colonel geschicktes Taxi. Connor hatte dem Alpha-Team eine SMS geschickt und sie über seine Ankunftszeit informiert, und trotzdem war keiner gekommen, um ihn abzuholen. Colonel Black musste wirklich sehr wütend sein. Connor mochte sich innerlich entschieden haben, aus der Buddyguard-Organisation auszusteigen, doch offenbar war ihm die Organisation ohnehin zuvorgekommen und hatte ihn bereits gefeuert!
Connor seufzte, hob an einem Bankautomaten Geld ab, ging zum Taxistand und nannte einem der Fahrer sein Ziel. Der Chauffeur warf ihm einen ungläubigen Blick zu. Er war ein älterer Mann mit grauem Drei-Tage-Bart, schweren Tränensäcken unter den Augen und einem Bierbauch, der sich förmlich an das Lenkrad schmiegte. »Das liegt in den Brecon Beacons, Junge, mitten im Nirgendwo!«
»Ich weiß.« Connor packte sein Gepäck in den Kofferraum und setzte sich auf den Rücksitz, den Rucksack stellte er neben sich.
Der Fahrer pfiff leise durch die Zähne. »Das wird dich eine ordentliche Stange Geld kosten. Bist du sicher, dass du nicht lieber den Bus nehmen willst?«
Connor schüttelte den Kopf. »Die Schule liegt meilenweit von der nächsten Bushaltestelle entfernt.«
»Na gut, Junge.« Der Fahrer zuckte die Schultern und schaltete den Motor an.
Eine Stunde später fuhren sie auf einer schmalen, von schier endlosen Steinmauern oder hohen Hecken gesäumten Landstraße durch grüne Felder und über sanfte Hügel, auf denen Schafe grasten, die aus der Ferne wie unzählige weiße Punkte aussahen.
»Bist du sicher, dass wir hier auf dem richtigen Weg sind?«, fragte der Fahrer, als sich die Straße noch mehr verengte und durch ein verstecktes Tal führte. »Sieht nicht so aus, als würde da noch was kommen.«
Connor nickte. »Wir sind bald da. Es ist ein privates Internat.«
»Offenbar sehr privat.«
Als sie sich der Kuppe eines Hügels näherten, tauchte plötzlich ein Viehtransporter auf der Gegenspur auf. Er fuhr sehr schnell, der Truckfahrer hupte wütend. Fluchend riss der Taxifahrer das Lenkrad nach links, geriet mit zwei Rädern auf den grasbewachsenen Fahrbahnrand und streifte an der Hecke entlang. Er schaffte es nur knapp, eine Kollision mit dem mächtigen Truck zu vermeiden.
»Verdammte Mistbauern!«, schimpfte er, während der Truck rücksichtslos vorbeidonnerte. »Die glauben, die Straße gehört nur ihnen!«
Connors Herzschlag hatte ausgesetzt, er konnte nur wortlos nicken. Ein Lieferwagen raste hinter dem Truck her.
»Der Verkehr ist hier ja schlimmer als in der Stadt!«, schnaubte der Fahrer, fuhr jetzt aber viel langsamer und vorsichtiger weiter. Ein paar Minuten später kam ein großes schmiedeeisernes Tor in Sicht. Eine lange Umgebungsmauer erstreckte sich links von der Straße in beide Richtungen.
»Sie können mich am Tor absetzen«, sagte Connor.
Der Fahrer runzelte die Stirn und schaute sich um. Es war kein Gebäude zu sehen. Eine lange Zufahrtsstraße führte vom Tor zwischen offenen Feldern hindurch und verschwand hinter einem Hügel. »Soll ich dich nicht bis zur Haustür fahren?«
»Nein, danke.« Connor reichte ihm ein paar knisternde Banknoten. Bis zur Schule war es noch ein ordentlicher Fußweg, aber er wollte vermeiden, dass der Fahrer die Schule zu sehen bekam. »Der Rest ist für Sie.«
Er wartete am Tor, bis das Taxi gewendet hatte und davongefahren war. Über dem Tor glänzte ein großes, geflügeltes Schild wie ein Raubvogel in der Mittagssonne. Es sah aus wie ein altertümliches Wappen, war aber in Wirklichkeit das Logo der Buddyguard-Organisation. Connor erinnerte sich an den Tag, als er das Wappenschild zum ersten Mal zu sehen bekommen hatte. Eine junge Frau hatte ihn damals vom Bahnhof abgeholt – Jody, seine Trainerin für Personenschutz, wie er später erfuhr. Er war neugierig und aufgeregt gewesen, aber auch nervös und unsicher, was ihn hier erwarten würde. Inzwischen wusste er es und wünschte sich, er hätte niemals den Fuß auf das Gelände gesetzt.
Schon vom Taxi aus hatte er bemerkt, dass beide Torflügel weit offen standen. Das war ungewöhnlich, anscheinend wurde er erwartet. Aber wie werden sie mich empfangen?
Connors Schuldbewusstsein wog fast schwerer als sein Koffer, mit dem er sich auf den Weg machte. Eine gut getarnte Videokamera überwachte das Tor und den Anfang der Zufahrtsstraße. Er war sicher, dass sie seine Ankunft aufgezeichnet hatte, außerdem passierte er eine der vielen verborgenen Alarmanlagen, die rings um das gesamte Gelände angebracht waren. Als Connor über die Hügelkuppe kam, sah er einen vertrauten Anblick vor sich: das alte, schlossähnliche Gebäude des Buddyguard-Hauptquartiers. Ja, ein vertrauter Anblick – mit Ausnahme der seltsamen, unheilvollen Rauchsäule, die sich aus dem Dach kräuselte. Und der Leiche, die mitten auf dem kiesbestreuten Vorplatz lag.
KAPITEL 4
Connor ließ den Koffer fallen und rannte auf das rauchende Gebäude zu. Was zum Teufel war passiert? Wer war jener Mann, der dort auf dem Vorplatz lag? Aus der Ferne war es nicht zu erkennen. Vielleicht ein Klient? Oder einer der Ausbilder? Ein neuer Rekrut … oder ein Eindringling?
Er blieb abrupt stehen, als der erste Schock von einem klareren Reflex verdrängt wurde, einer Mischung aus Instinkt und Professionalität. Sich ohne Überlegung in eine unbekannte, potenziell gefährliche oder sogar feindliche Situation zu stürzen, war ungefähr, als würde man ohne Fallschirm aus einem Flugzeug springen. So lief er Gefahr, selbst zum Opfer zu werden, bevor er auch nur die Chance hatte, jemandem zu helfen. Nein, zuerst einmal musste er nach dem ACE-Prinzip vorgehen: Assess, Counter, Escape.
Die Bedrohung einschätzen.
Der Gefahr begegnen.
Nur der letzte Punkt war hier anders – statt aus der Gefahrenzone zu fliehen, musste er in sie eindringen.
Connor nahm sich einen Moment Zeit, um das Terrain sorgfältig zu mustern, nach Bedrohungen im Parkgelände, auf den umliegenden Feldern und Wiesen und in der Nähe des Hauses. In diesem Stadium hatte er noch keine Ahnung und erst recht keine Vermutung, worin die aktuelle Gefahr bestand. Jener Mann, der auf dem Vorplatz lag, konnte ebenso gut die Treppe hinuntergestürzt sein, als er aus dem brennenden Gebäude fliehen wollte. Oder vielleicht hatte er eine Rauchvergiftung erlitten und das Bewusstsein verloren. Oder einen Herzinfarkt erlitten. Der Rauch war ein Zeichen dafür, dass es in einem Flügel des großen Schulgebäudes brannte. Aber Connor konnte auch ein Worst-Case-Szenario nicht ausschließen: dass das Feuer durch einen Angriff oder eine Bombe verursacht worden war.
Sein Blick glitt über den kleinen Weiher, den Fußballplatz, das Sommerhaus und den alten Brunnen im Garten. Er konnte niemanden entdecken, auch keine verdächtige Bewegung in den Büschen oder hinter den Bäumen. Das war an sich schon sehr ungewöhnlich – sofern sich nicht alle am Evakuierungspunkt beim Tennisplatz auf der abgewandten Seite des Gebäudes versammelt hatten. Der kleine, aber dichte Wald im Norden des Parkgeländes und niedrige Steinmauern würden potenziellen feindlichen Elementen genügend Deckung bieten. Aber so aufmerksam Connor sich auch umblickte, er sah keinerlei Bedrohungen.
Dass keine fremden Personen zu sehen waren, verwunderte ihn nicht. Denn von neuen Klienten abgesehen, die sich vor Ort vergewissern wollten, dass Geheimhaltung und Vertraulichkeit gewährleistet wurden, und den wenigen Personen, die Bescheid wussten, war die Buddyguard-Zentrale noch immer ein gut gehütetes Geheimnis. Fremde Personen waren hier so gut wie nie zu sehen. Und schon der bloße Gedanke, das Hauptquartier könnte überfallen worden sein, war absurd und höchst unrealistisch.
Trotzdem: Nach allem, was er in Mexiko erlebt hatte, wollte Connor kein Risiko mehr eingehen. Er duckte sich und schlich an der Trockensteinmauer entlang, um kein so offenkundiges Ziel zu bieten und auch die friedlich grasenden Schafe auf den Feldern nicht aufzuscheuchen. Natürlich war ihm klar, dass er damit einen großen Umweg in Kauf nehmen musste, aber bei dieser Art von Mission zahlte es sich manchmal aus, geradezu paranoid vorsichtig zu sein.
Am Rand des Fußballfelds angekommen, sprintete er hinüber und näherte sich dem Hauptgebäude aus östlicher Richtung. Die Sonne stand hinter ihm, er hatte damit einen klaren Sichtvorteil, während mögliche Angreifer ins Gegenlicht blicken mussten. Er spähte um die Ecke des Hauses. Der Mann lag immer noch unbeweglich auf dem Vorplatz.
Jetzt erst, aus größerer Nähe, konnte er erkennen, wer dort lag. Wie eine kalte Riesenfaust packte die Angst seine Brust und ein Kloß stieg ihm in die Kehle. Der kahl geschorene Kopf war unverkennbar: Steve Nash, sein Kampftrainer. Ein ehemaliger Soldat der britischen Spezialeinheit SAS, mit einem Körperbau, der sogar Filmstars wie »The Rock« Johnson vor Neid erblassen lassen würde. Steve war das härteste Mitglied des Buddyguard-Trainerstabs. Wenn es jemand geschafft hatte, ihn zu besiegen, dann …
Connor verdrängte den Gedanken, dann lachte er plötzlich leise in sich hinein. Wie blöd konnte man doch sein! Natürlich war das eine Trainingsübung, ganz einfach, genau wie Dutzende anderer Prüfungen, an denen er während seiner Ausbildung im Personenschutz teilgenommen hatte. Nur diesmal vielleicht noch eine Spur realistischer. Auf möglichst echt wirkende Übungen hatte Colonel Black regelmäßig bestanden, um sicherzustellen, dass seine Rekruten so gut wie möglich auf den realen Einsatz vorbereitet waren. Steve mimte einfach nur das Opfer eines Überfalls.
»Steve!«, rief Connor und trat aus der Deckung.
Keine Reaktion.
»Steve! Ich bin’s, Connor! Ist das wieder eine deiner Trainingsübungen?«
Immer noch keine Reaktion. Wieder verspürte Connor die Unruhe in sich aufsteigen. Wenn der Ausbilder den Toten nur spielte, machte er seine Sache verdammt gut. Connor blickte sich noch einmal um, dann rannte er über den Platz. Kaum hatte er den muskulösen Oberarm berührt, wurde ihm klar, dass hier etwas nicht stimmte. Steves Haut fühlte sich kühl an, fast kalt. Connor tastete mit zwei Fingern nach der Halsschlagader: kein Puls. Mühsam wälzte er Steve auf den Rücken – und stöhnte entsetzt auf. Blut hatte sich auf dem Kies unter dem Mann ausgebreitet und in der breiten Brust des Trainers entdeckte er mehrere kleine, aber klar sichtbare Einschusslöcher.
Connor starrte eine Minute lang unbeweglich auf seinen toten Lehrer. Schock und Trauer kämpften miteinander, doch dann schoss ihm der Gedanke durch den Kopf, dass er sich hier in größter Gefahr befand. Sein Blick zuckte auf der Suche nach dem Schützen ringsum. Er bemerkte, dass der Kies auf dem Vorplatz tief aufgewühlt war, ein Zeichen, dass mehrere schwere Fahrzeuge angekommen und vermutlich mit hoher Geschwindigkeit und durchdrehenden Rädern wieder davongerast waren.
Aber das hieß noch lange nicht, dass keine feindlichen Elemente mehr im Haus lauerten.
Für Steve konnte er nichts mehr tun. Connor sprang auf, rannte zum Eingang und ging daneben in Deckung. Kein Wunder, dass niemand auf seine Anrufe und die SMS reagiert und keiner ihn am Bahnhof abgeholt hatte.
Das Buddyguard-Hauptquartier war angegriffen worden.
Es mochte sogar sein, dass sich die überlebenden Lehrkräfte und die Rekruten im Gebäude verschanzt hatten oder sich noch immer gegen die Angreifer zu wehren versuchten. Connor zog rasch seine XT-Taktische Taschenlampe aus dem Rucksack und ließ mit einer raschen Handbewegung den Schlagstock ausfahren. Der war wirkungsvoller als ein Piñatabuster und eine echte Selbstverteidigungswaffe. Ein Schlag genügte, um jeden Angreifer auszuschalten. Connor zog den Rucksack nach vorn, sodass er die Brust schützte, und zog die Gurte enger. Der Rucksack war innen mit einem kugelsicheren Schutzschild ausgestattet, aber Connor hoffte, dass er diesen Schutz nicht brauchen würde – und auch nicht das Erste-Hilfe-Pack, das in einer Seitentasche steckte.
Er atmete tief ein und aus, um seine Nerven zu beruhigen, und schlich die Treppe hinauf. Vorsichtig schob er sich durch die große Tür in die Eingangshalle. Auf den ersten Blick wirkte alles völlig normal. Ungewöhnlich war jedoch die Todesstille, die im Gebäude herrschte. Dann fielen Connor weitere Unregelmäßigkeiten auf: Das Ölgemälde über dem großen Kamin hing schief. Die mit dunklen Holzpaneelen verkleideten Wände waren von Einschusslöchern übersät. Blut war überall auf dem polierten Parkettboden verschmiert und weitere Blutflecken waren auf der großen Treppe zu sehen. Steve hatte offenbar einen heldenhaften Abwehrkampf geliefert.
Connor schlich näher an die breite, geschwungene Treppe heran, die zu den oberen Stockwerken führte, und lauschte. Nicht das leiseste Geräusch war zu hören.
Connor entschied, zuerst das Erdgeschoss zu sichern. Leise bewegte er sich durch den Hauptkorridor zum Besprechungsraum des Alpha-Teams. Unterwegs kam er an mehreren Unterrichtsräumen vorbei, die Türen standen offen, in den Zimmern herrschte Chaos – umgekippte Tische und Stühle, fehlende Computer. Im Speisesaal stand das Mittagessen noch auf den Tischen. Als er durch den Saal schlich, stieg ihm zuerst ein Gasgeruch in die Nase, der noch in der Luft hing, dann entdeckte er mehrere explodierte Blendgranaten – klares Anzeichen dafür, dass es sich hier nicht um einen einfachen Einbruch handelte.
Die Stille war nervenzerfetzend. Wie mit eisigen Fingern kroch die Furcht über Connors Rücken. Wo sind bloß alle?
Connor hustete und seine Augen begannen zu tränen. Obwohl der Rauch durch die oberen Fenster abziehen konnte, hing das Gas hier im Speisesaal noch wie ein leichter Dunst in der Luft. Connor zog sich in den Korridor zurück. Längst befand er sich in höchster Alarmbereitschaft, zwang sich aber zur Ruhe, als er dem Besprechungsraum näher kam. Im Flur war eines der Fenster geborsten, Glassplitter lagen überall auf dem Boden verstreut. Connor schlich um die verstreuten Scherben herum, bemüht, auf keine zu treten. Im Einsatzbesprechungsraum herrschte ein ähnliches Chaos wie in den übrigen Räumen: Möbel waren verschoben und umgestoßen worden, sämtliche Computer fehlten. Spuren an der Tür deuteten darauf hin, dass man versucht hatte, sie von innen zu verbarrikadieren. Sie mochte eine Weile standgehalten haben, aber rußgeschwärzte Stellen ließen vermuten, dass sie schließlich aufgesprengt worden war. Jetzt hing sie nur noch an einem Scharnier.
So, wie alles aussah, hatte hier ein brutaler und völlig unerwarteter Angriff stattgefunden. Aber warum wurde kein Alarm ausgelöst? Wie hatten die Angreifer sämtliche Sicherheitsanlagen am Tor und im Park überwinden können?
Connor ging zum Präsentationstisch und nahm das Telefon in die Hand. Keine Verbindung. Er zog sich zurück, schlich weiter zu Colonel Blacks Büro, wieder kam er an mehreren anderen halb zerstörten Räumen und geborstenen Fenstern vorbei. Das Schloss der schweren Eichentür des Büros war aufgesprengt und die Tür eingeschlagen worden. Im Büro war der große LED-Bildschirm an der Wand, das technisch höchst entwickelte Gerät auf dem Markt, zertrümmert worden. Aber zu Connors Überraschung schienen die Eindringlinge den Computer auf dem Schreibtisch des Colonels nicht entdeckt zu haben. Sie hatten sämtliche Papiere und persönlichen Gegenstände von der Platte des schweren Mahagonischreibtisches gefegt und die Schubladen durchsucht, aber offenbar den Auslösemechanismus für den in der Tischplatte versenkten Slim-Line-Monitor nicht entdeckt. Vielleicht konnte er den Computer starten und sich Zugriff auf die Sicherheitsanlagen verschaffen, um herauszufinden, was geschehen war. Und möglicherweise dabei auch herausfinden, wo alle steckten … ob tot oder lebendig.
Connor legte den Schlagstock weg und setzte sich auf den Schreibtischsessel, der mit rotem Leder gepolstert war und eine hohe Rückenlehne hatte. Er drückte den Daumen auf den Fingerprint-Scanner, der an der Innenseite einer Armstütze angebracht war. Ein kleines, digitales Display leuchtete auf: ZUGRIFF VERWEIGERT. Er wusste, wie sinnlos das war, versuchte es aber trotzdem noch einmal. Wieder erschien das rote Warnfenster. Im selben Moment hörte er ein leises Knirschen vom Flur: Jemand war auf eine Glasscherbe getreten. Connor packte die XT-Taschenlampe und hielt den Schlagstock bereit, als er zur offen stehenden Tür huschte.
Noch einmal knirschte Glas. Der Eindringling stand direkt hinter der Tür! Connor sprang mit einem Satz hinaus, um ihm zuvorzukommen … und entdeckte, dass der Flur menschenleer war. Zu spät wurde ihm klar, dass dieses Knirschen nur ein Ablenkungsmanöver gewesen war: Hinter sich hörte er eine Bewegung, dann stieß ihn etwas heftig in den Rücken. Ein greller Schmerz schoss durch seinen Körper, seine Muskeln zuckten unkontrolliert. Connor fühlte sich, als würde ein Dutzend Baseballschläger gleichzeitig auf ihn einprügeln. Krämpfe überwältigten ihn, er brach zusammen.
KAPITEL 5
Connor öffnete blinzelnd die Augen. Die Bewusstlosigkeit konnte nicht mehr als ein paar Sekunden gedauert haben. Sein Nervensystem meldete ein warmes, kribbelndes Gefühl, das gerade verebbte – so als hätte er eine 5-Volt-Batterie mit der Zunge berührt, nur hundertmal stärker. Sämtliche Muskeln schienen sich entzündet zu haben, er fühlte sich völlig ausgelaugt und so erschöpft, als hätte er gerade einen Dreifachmarathon hinter sich. Doch dann stieg unvermittelt Wut in ihm auf, genährt durch seinen Überlebensinstinkt. Abrupt setzte er sich aufrecht und starrte in die dunklen Augen des Angreifers.
»Tut mir echt leid!«, sagte Amir und hob entschuldigend beide Hände. In der Rechten hielt er einen Taser X2 Defender, eine Elektroschock-Pistole. Connor stöhnte, als er das Gerät erkannte. Zwei Drähte baumelten daran herab, die mit den Projektilen verbunden waren, welche noch immer in Connors Rücken steckten.
»Du hast mich getasert!«, rief Connor und starrte seinen Freund wütend an.
Amir grinste ein bisschen dümmlich. »Hab dich für einen der Typen gehalten.«
»Wieso hast du mich nicht erkannt?«
Amir zuckte die Schultern. »Du solltest doch immer noch in Mexiko sein, oder nicht?«
Connor zwang sich, ruhig durchzuatmen. Der von dem Elektroschock ausgelöste Adrenalinschub versiegte allmählich. Er seufzte tief auf. Bei all dem Chaos, das hier offenbar herrschte, den fehlenden Computern und der gestörten Telefonleitung hatte Amir seine SMS wahrscheinlich gar nicht bekommen. Jetzt war er einfach nur froh, dass sein bester Freund noch lebte und offenbar nicht verwundet worden war. Connor kam mühsam auf die Füße und umarmte Amir.
»Ja, klar, du hast mir auch gefehlt«, sagte der und zog die beiden Projektile aus Connors Rücken.
Connors Beine fühlten sich an wie Gummi. Amir stützte ihn und führte ihn zum Schreibtischsessel zurück.
Connor ließ sich erleichtert auf den weichen Stuhl sinken. »Was ist hier passiert? Sieht aus wie ein Kriegsschauplatz!«
Amir blickte nervös zur Tür, zog einen Stuhl heran und setzte sich. Jetzt erst bemerkte Connor, wie abgekämpft und verzweifelt sein Freund aussah: das dichte schwarze Haar verklebt und schmutzig, die Augen waren blutunterlaufen, stark gereizt und tränten, die Jeans zerrissen und offenbar völlig durchnässt und das T-Shirt stark verschmutzt. Amir schüttelte müde den Kopf. »Ich habe keine Ahnung. Wir waren gerade mit den Folgen der Operation in Mexiko beschäftigt, und …«
»Ja, das hab ich vergeigt, stimmt’s?«, unterbrach ihn Connor, wobei er verlegen hin und her rutschte und auf die Schreibtischplatte starrte.
Amir schüttelte den Kopf. »Es ging nicht nur um deine Mission. Auch ein paar andere Aufträge gingen gleichzeitig in die Binsen.«
»Was?«, rief Connor und richtete sich auf.
»So eine Situation hatten wir noch nie. Eine Bombendrohung in Thailand, eine Schießerei in Amerika, eine Autoentführung in Südafrika. Offenbar sind alle unsere Operationen gleichzeitig gestört worden.«
Connor starrte Amir mit weit aufgerissenen Augen an. Er konnte nicht glauben, was er da hörte. »Du meinst … auch alle anderen Teams, Bravo, Charlie und Delta, wurden angegriffen?«
Amir nickte ernst. »Elsa liegt im Krankenhaus, ihr Zustand ist kritisch. Sean wird vermisst. Wir haben noch auf ein Lebenszeichen von David gewartet, aber während wir uns mit den ganzen Katastrophen beschäftigten, wurden wir … wurde das Hauptquartier plötzlich angegriffen.«
»Wann genau war das?«
Amir schluckte, offenbar war er den Tränen nahe. »Heute Mittag, beim Essen. Ohne jede Vorwarnung.« Seine Stimme brach. »Es … es passierte alles so schnell … Wir wurden kalt erwischt. Irre, wenn man sich das überlegt. Wir sind doch Bodyguards! Wir sind ausgebildet, um mit genau solchen Situationen fertigzuwerden!«
Connor nickte und legte seinem Freund die Hand auf die Schulter. Amir zitterte am ganzen Körper. »Ich weiß, ich weiß … aber keiner von uns hat damit gerechnet, dass wir je selbst angegriffen würden. Erzähl mir genau, was hier passiert ist.«
Amir stützte den Kopf in die Hände. »Sie tauchten plötzlich auf, wie aus dem Nichts. Sie waren sogar schon ins Gebäude eingedrungen, bevor wir auch nur reagieren konnten! Ich nahm mir gerade Gemüse, als es plötzlich im Speisesaal unglaublich laut knallte – Blendgranaten. Da merkten wir überhaupt erst, dass wir angegriffen wurden! Aber die Ausbilder reagierten sehr schnell, versuchten, uns zu evakuieren.« Amir blickte auf. »Aber irgendwie … schienen die Angreifer alle Aktionen schon im Voraus zu ahnen, die wir für solche Fälle trainiert hatten. Sämtliche Ausgänge waren schon gesichert und der Schutzraum abgesperrt. Ein paar Teams schafften es, sich zu verbarrikadieren. Ich und Ling und die anderen flohen in den Alpha-Einsatzraum. Aber sie sprengten einfach die Tür auf!« Amir schnaubte fassungslos. »Wir wurden überrannt! Steve und Jody stellten sich ihnen entgegen, sodass wir anderen es hinaus in den Park schafften … Aber dann … hörten wir Schüsse und Schreie.«
»Ja. Ich habe Steve gesehen. Draußen«, murmelte Connor.
Amir schaute ihn hoffnungsvoll an, aber Connor schüttelte nur den Kopf. Amir schaute zum Fenster hinaus, seine Augen schwammen in Tränen. »Dann hat sich Steve für uns geopfert. Aber wofür? Sie haben dann doch alle gefangen genommen. An der Parkmauer standen Bewaffnete. Wir hatten nicht die geringste Chance.«
Connor schaute Amir fragend an. »Aber was ist mit dir? Wie hast du es geschafft zu entkommen?«
Amir lachte freudlos. »Glück im Unglück. Ich versuchte zu fliehen, war aber halb blind vom Tränengas. Stürzte in den alten Brunnen. Hab mir dabei fast ein Bein gebrochen! Und hab dann eine Ewigkeit gebraucht, um wieder herauszuklettern. Aber der Brunnen hat mir das Leben gerettet. Keiner der Angreifer kam auf die Idee, hineinzuschauen.«
»Und wo sind nun alle?«
»Ich glaube, ich bin der Einzige, der davongekommen ist. Und du natürlich.«
Connor war, als hätte er einen wuchtigen Schlag in die Nieren bekommen. »Willst du damit sagen, die anderen sind alle … tot?«, stieß er voller Entsetzen hervor. »Ling? Jason? Marc? Richie …?«
»Nein! Sie wurden zusammengetrieben und in einen Truck verladen. Sah aus wie ein Viehtransporter. Unsere Computer haben sie auch mitgenommen. Ließen sich verdammt viel Zeit, um die ganze elektronische Ausrüstung einzupacken. Kam mir ziemlich seltsam vor.«
»Ein Viehtransporter?«, hakte Connor nach. »Mein Taxi wäre um ein Haar in einen gekracht! Und dann kam auch noch ein Lieferwagen.«
»Ja – in dem Van transportierten sie die Computer und ihren Sturmtrupp«, nickte Amir verbittert.
Connor stand auf und schüttelte die Beine, die sich immer noch wie taub anfühlten. »Okay – dann wissen wir wenigstens, dass unsere Freunde noch leben.«
»Kann sein, aber wie lange noch? Wir haben keine Ahnung, wohin man sie gebracht hat. Verdammt, wir wissen nicht mal, warum man sie entführt hat!«
»Hast du irgendeine Idee, wer uns angegriffen hat?«
Amir schüttelte den Kopf. »Alle trugen Sturmhauben. Hab kein einziges Gesicht zu sehen bekommen.«
Connor runzelte die Stirn. »Kannst du dich in Colonel Blacks Computer hacken? Vielleicht finden wir dort einen Hinweis.«
»Ich glaube schon.« Amir setzte sich auf Blacks Sessel und drückte den Daumen auf den Fingerabdruckscanner. Auf dem kleinen Display leuchtete wieder die Schrift auf: ZUGRIFF VERWEIGERT. »War zu erwarten«, sagte Amir. »Aber als Systemadministrator habe ich einen eigenen Zugriffscode … 43XGT7«, murmelte er vor sich hin, als er den Code eingab. Ein grünes Signal erschien, dann leuchtete auf dem Schreibtisch ein Laser-Keyboard auf, in der Schreibtischplatte öffnete sich ein schmaler Spalt, durch den der dünne Glasmonitor emporglitt.
»Eins verstehe ich nicht«, sagte Connor, während er im Zimmer hin und her ging. »Warum gab es keinerlei Alarm, keine Warnung? Was ist mit den Sicherheitsanlagen an der Außenmauer? Den Überwachungskameras? Den vielen Sensoren im Rasen? Die Schule ist praktisch eine Festung! Die Angreifer hätten eigentlich nicht mal in die Nähe des Hauptquartiers gelangen sollen, ohne den Alarm auszulösen!«
»Das habe ich mich auch schon gefragt«, antwortete Amir nickend, während seine Finger über die Lasertastatur flogen. Er loggte sich in das Überwachungssystem ein und starrte eine Weile stirnrunzelnd auf den Monitor. »Nichts wurde ausgelöst. Weder die Alarmanlagen am Perimeter noch die Trittsensoren im Rasen. Nicht einmal die Sensoren an den Fenstern. Alles war deaktiviert. Auch die Überwachungskameras. Und die Videoaufzeichnungen der letzten vierundzwanzig Stunden wurden vollständig gelöscht!« Er gab erneut Befehle ein und rief weitere Dateien auf, die Connor nichts sagten. »Auch unser gesamtes Kommunikationssystem wurde ausgeschaltet. Sämtliche Nachrichten, Eingang und Ausgang, sind blockiert!«
Connor starrte Amir sprachlos an. »Wie … Aber wie kann das sein? Hast du mir nicht mal erzählt, es sei ein geschlossenes System?«
»Ist es auch«, antwortete Amir, ohne die rasch über den Bildschirm laufenden Codezeilen aus den Augen zu lassen. »Wer unsere Firewalls überwinden und sich aus der Ferne in unser System hacken kann, ist kein Hobbyhacker. Das müssen Top-Profis gewesen sein …«
»Oder jemand hier drin hat die Sicherheitssysteme deaktiviert«, warf Connor ein.
Amir blieb buchstäblich der Mund offen stehen. »Meinst du das im Ernst?«
»Wäre doch eine Möglichkeit, oder nicht? Wir müssen auch damit rechnen.«
»Aber wer?«
»Im Moment können wir nur spekulieren. Aber um das Hauptquartier überhaupt ausfindig zu machen und dann auch noch unser gesamtes Sicherheitssystem auszuschalten, braucht man jemanden mit Insiderwissen.«
Amir lehnte sich zurück. »Nicht unbedingt. Das könnte auch jeder bewerkstelligen, der über beachtliche Ressourcen verfügt, zum Beispiel ein staatlicher Geheimdienst. Auf jeden Fall muss es eine extrem mächtige Organisation sein, die in der Lage ist, an verschiedenen Orten der ganzen Welt gleichzeitig zuzuschlagen.«
Connor dachte an seine bisherigen Missionen zurück, die er vor Mexiko durchgeführt hatte. »Die russische Mafia vielleicht? Oder sogar die russische Regierung? Oder beide zusammen?«
»Es waren eindeutig Ausländer«, sagte Amir, »aber definitiv keine Russen. Als ich im Brunnen hockte, hab ich ein paar der Männer miteinander reden gehört. Mir kam es wie Japanisch oder Chinesisch vor. Natürlich verstand ich nichts, aber sie nannten auch einen Namen, den ich kannte – und den widerholten sie sogar ein paarmal …« Amir zögerte und verzog das Gesicht, als hätte er Zahnweh.
Connor blieb stehen und drehte sich zu seinem Freund um. »Einen Namen? Welchen denn?«
»Deinen.«
KAPITEL 6
Connor fühlte sich, als hätte er einen Tiefschlag unter die Gürtellinie einstecken müssen. »Willst du damit sagen, dass ich das Ziel war? Ich?«
»Sieht so aus«, antwortete Amir. »Ich meine, deine Operation in Mexiko wurde als erste torpediert. Aber so, wie sie das Hauptquartier ausgeräumt haben, vermute ich, dass sie auch noch hinter etwas anderem her waren.«
Connor dachte an Mexiko zurück. Was war geschehen? Der Angriff nach der Geburtstagsparty war gut geplant und mit brutaler Effizienz durchgeführt worden. Der Van seiner Angreifer war in genau der richtigen Sekunde vorbeigefahren. Connor erinnerte sich deutlich daran, dass der Fahrer ihn und nicht Eduardo angeblickt hatte. Und einer der Angreifer hatte seine Glock 17 auf sein Gesicht gerichtet. Jetzt erst dämmerte es Connor, dass die Attentäter nicht den geringsten Versuch unternommen hatten, Eduardo zu entführen – sondern ihn, Connor, zu töten! Connors Knie gaben nach. Entsetzt ließ er sich auf einen Stuhl fallen. War er wirklich der Grund für die Angriffe in Mexiko und hier auf das Hauptquartier? Der Gedanke jagte ihm einen eiskalten Schauder über den Rücken. Wie benommen starrte er Amir an. »Aber warum …? Was … was wollen sie von mir? Was suchen sie?«
Amir zuckte die Schultern. »Ich habe nicht die geringste Ahnung. Wie gesagt, ich hab kein Wort verstanden. Aber ich hoffe, dass Colonel Black etwas darüber weiß.«
Connor fuhr hoch. »Was? Er wurde nicht gefangen genommen?«
»Nein. Er war gar nicht hier.«
Eine Woge der Erleichterung überkam Connor. Der Colonel war nicht nur der Gründer und Leiter der Organisation, für Connor war er auch so etwas wie ein Ersatzvater. »Wo ist er denn?«
»Na ja, weiß ich nicht genau«, gab Amir zu. »Er hat letzte Woche einen Anruf von Bugsy bekommen. Danach ist er sofort abgereist.«
»Also ist auch Bugsy in Sicherheit?«
Amir nickte. »Er ist auf einer Art Sondermission – ich glaube, er wollte eine weitere Operation vorbereiten. Alles ist so geheim, dass ich denke, es muss etwas furchtbar Wichtiges sein. Nicht einmal mir durfte Bugsy sagen, wohin er geht, obwohl ich in der Logistik doch sein Stellvertreter bin!«
Connor verspürte ein wenig Hoffnung, als er sich klarmachte, dass sowohl der Colonel als auch der Trainer für Überwachungstechniken dem Angriff entkommen waren. »Hast du schon versucht, sie zu kontaktieren?«