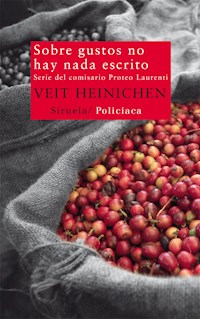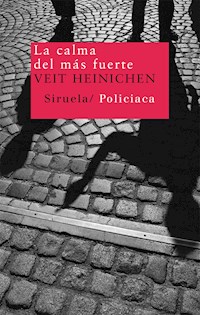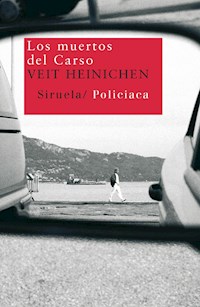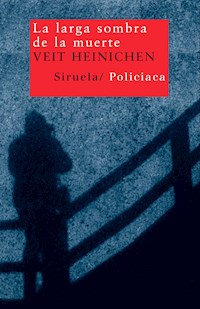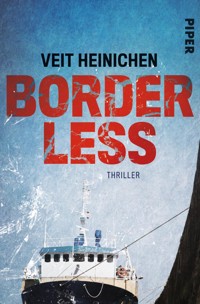
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Brillant recherchiert und hochspannend erzählt Veit Heinichen von den Verstrickungen des internationalen Verbrechens mit der Politik. Commissario Xenia Zannier will sich an den Mördern ihres Bruders rächen. Ihr Hass gilt der skrupellosen Senatorin Romana Castelli de Poltieri, deren korruptes Netzwerk sich von Grado bis nach Rom, München, Berlin, Salzburg und Rijeka erstreckt. Bald setzt ein Frachter syrische Flüchtlinge vor dem Adria-Bad ab, und ein befreundeter Investigativ-Journalist wird brutal ermordet. Die Spur führt Xenia vom BND zu Waffenschiebereien über Kroatien in den Nahen Osten. Bei der Senatorin laufen alle Fäden zusammen, und Xenia ahnt, dass diese alles tun wird, um ihre Macht zu erhalten. Ein Roman von brennender Aktualität.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher: www.piper.de/literatur
Wenn Ihnen dieser Thriller gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Borderless« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.
Die Protagonisten dieses Romans entspringen der Fantasie des Autors. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind unbeabsichtigt, rein zufällig und entbehren jeglichen realen Zusammenhangs.
© Piper Verlag GmbH, München 2019Covergestaltung: zero-media.net, MünchenCovermotiv: David Lichtneker / arcangel images
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich der Piper Verlag nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht.
Inhalt
Cover & Impressum
Zitat
1
Grado Pineta, Via delle Pleiadi.
Grado, Diga Nazario Sauro.
Grado, Isola della Schiusa. Kommissariat.
Grado, Isola della Schiusa. Kommissariat.
Berlin, Platz der Republik. Bundeskanzleramt.
März 1990. Zagreb, Stadion Maksimir.
Salzburg, Rudolfsplatz 2. Justizgebäude.
Porto Nogaro, Hafengelände.
Grado, Isola della Schiusa. Kommissariat.
Berlin, Hotel am Gendarmenmarkt.
Berlin, Prenzlauer Berg. Gaudystraße.
Grado Pineta, Via delle Pleiadi.
22. April 1996, 5 Uhr 55. Triest.
2
Grado, Isola della Schiusa. Kommissariat.
Berlin – Grado.
München. Weißes Bräuhaus im Tal.
12. Juni 1994. Triest. Grenzübergang Prebenico/Prebeneg.
Grado, Isola della Schiusa. Kommissariat.
Rom, Piazza del Viminale. Innenministerium.
Pullach bei München. BND.
Grado, Isola della Schiusa. Kommissariat.
Obere Adria. Internationale Gewässer.
Novigrad, Istrien.
3
Grado, Viale Kennedy.
Rijeka, Wenzelova ulica.
Grado, Isola della Schiusa. Kommissariat.
Grado Lagune. Isola di Sant’Andrea.
Grado, Isola della Schiusa. Kommissariat. Redipuglia. Monte Calvario.
4
Rijeka, Zentrum.
Rijeka, Hafen.
Gorizia. Schießstand der Polizia di Stato.
Triest, Piazza San Giovanni. Büro im Piano nobile.
Grado, Isola della Schiusa. Kommissariat.
Gorizia, Piazza Cavour. Questura.
Grado, Isola della Schiusa. Kommissariat.
Grado Pineta, Via delle Pleiadi.
5
Rijeka, Hafen.
Nova Gorica. Universität.
Rijeka, Korzo. Bed & Breakfast.
Rijeka, Hotel.
Rijeka – Zagreb.
Golf von Triest.
Trieste Airport.
Grado, Isola della Schiusa. Kommissariat.
Rijeka, Frachthafen.
6
Salzburg Leopoldskron, Zwieselweg.
Adria-Schiffsroute nach Süden.
Grado, Isola della Schiusa. Kommissariat.
Triest, Piazza San Giovanni. Büro im Piano nobile.
Vieste, Gargano. Spiaggia Sfinalicchio.
Grado, Riva Slataper. Hotel Savoy.
Vieste – Bari.
Grado, Isola della Schiusa. Kommissariat.
Bari – Triest.
Grado, Via Caprin. Pizzeria.
Grado Pineta, Via delle Pleiadi.
Bari – Triest.
7
Grado, Isola della Schiusa. B &B Nontiscordardimé.
Grado, Riva Slataper. Hotel Savoy.
Triest, Piazza San Giovanni. Büro im Piano nobile.
Grado, Piazza Biagio Marin. Arztpraxis.
Grado, Isola della Schiusa. Kommissariat.
Lagune von Grado und Marano.
Grado, Fischereikanal.
Lagune von Grado und Marano.
Grado, Fischereikanal.
Grado Lagune. Isola di Sant’Andrea.
Grado Pineta, Via delle Pleiadi.
Grado, Riva Slataper. Hotel Savoy.
Grado, Fischereikanal.
8
Grado, Isola della Schiusa. Kommissariat.
Grado, Isola della Schiusa. B & B Nontiscordardimé.
Grado, Isola della Schiusa. Kommissariat.
Triest, Piazza San Giovanni. Büro im Piano nobile.
Grado, Isola della Schiusa. B & B Nontiscordardimé.
Monfalcone, Via Galvani. Ospedale San Polo.
Triest, Via Cadorna.
9
Berlin, Platz der Republik. Bundeskanzleramt.
Triest, Piazza dell’Unità d’Italia. Präfektur, großer Sitzungssaal.
Triest, Piazza San Giovanni. Büro im Piano nobile.
Grado Pineta, Via delle Pleiadi.
Eine Woche später
Berlin, Chausseestraße. Bundesnachrichtendienst.
Grado Pineta, Via delle Pleiadi.
Zitat
Lasst, die ihr eintretet, alle Hoffnung fahren!
Dante, Die Göttliche Komödie, Inferno III, 9
1
Grado Pineta, Via delle Pleiadi.
Such dir einen neuen Job, Flittchen. Ich mach dich fertig. Groß wie die Headline einer Boulevardzeitung prangt der Satz in fetten Lettern an der weißen Wand über einer Serie von Fotos der Senatorin und ihres Bruders Carletto. Zeugnisse, die einen langen Zeitraum umspannen. Romana Castelli de Poltieri von ihren politischen Anfängen als blutjunge Agitatorin gegen die Liberalisierung des Abtreibungsverbots in den Siebzigerjahren, später als Stadträtin von Triest und schließlich die Wahl in den Senat in Rom, in dem sie in der fünften Legislaturperiode sitzt.
Ein plakatgroßer Bogen Papier voller Linien, Zahlen und Zeichen zeigt das komplizierte Beziehungsgeflecht der Dame, samt Anlässen und Daten, die weiter ergänzt werden können. Schon die Wände des Büros im römischen Vorort Ostia, ihrer ersten eigenen Dienststelle, hatte Kommissarin Xenia Zannier bei komplexen Fällen so mit Fakten tapeziert, dass ihr kein Detail entgehen konnte. Zufälle, üble Überraschungen lassen sich vermeiden, wenn man sich nur genug in die Sache vertieft. Die Methodik der Kommissarin zeigte auch dank ihrer Durchsetzungsfähigkeit rasch Erfolg. Kurz nach der nächsten Beförderung schlug sie allerdings eine attraktive Stelle bei der DIA aus, den direkt dem Innenministerium angegliederten Antimafia-Spezialisten, und ließ sich zur Überraschung aller in den Nordosten zurückversetzen. Ausgerechnet in den verschlafenen Adria-Badeort Grado. Heimweh, meinten viele, die sich ihre Entscheidung nicht anders erklären konnten. Sie hatten die junge Frau bisher für eine eiskalte Karrierepolizistin gehalten: verbissen, vielsprachig, intelligent und unberechenbar.
Als müsste sie sich an das Motiv ihrer Versetzung erinnern, starrt Xenia auf die Wand in ihrem Zimmer im Erdgeschoss des kleinen Fertigbauhäuschens aus den Sechzigerjahren. Kein Laut dringt mehr von draußen herein, die Nachbarn sind längst schlafen gegangen. Um das kalte Licht der nackten Glühbirne kreisen Mücken. Auf ihrem Schreibtisch, einer Holzplatte auf zwei Böcken, sind Berge von Akten ausgebreitet, systematische Aufzeichnungen, die die Kommissarin über Jahre zusammengetragen hat. Ein Mosaik mehr oder weniger bedeutungsvoller Fakten, ein Gewebe von Indizien, gleichwohl noch keine eindeutigen Beweise. Nach denen wird sie so lange suchen, bis sie die Senatorin und ihren Bruder endlich zur Strecke bringen kann.
»Du bist doch nicht anders, Xenia, nur weil du blond bist. Du hast halt die Haare deines Papas …« Floriano saß neben seiner kleinen Schwester zwischen den Rebreihen auf dem Monte Calvario im hohen Gras, wo sie Schinken und Käse aßen.
»Was meinst du damit, Flori?« Sie zog ihn neckisch an einer Locke. »Papa hat doch schwarze Haare wie du, du Esel«, lachte die Achtjährige, die ihren großen Bruder immer gerne zur Arbeit im Weinberg begleitete.
Zu spät, um sich auf die Zunge zu beißen. Floriano blickte auf die Tiefebene zwischen dem Meer und dem hügeligen Weinland hinunter. Arglos hatte er das Familiengeheimnis ausgeplaudert, trotz der Ermahnung seiner Eltern, doch eines Tages hätte die Kleine es ohnehin entdeckt.
»Ach, Xixi.« Floriano legte seinen Arm um die strohblonde Xenia und drückte sie zärtlich an sich. »Das Leben zeichnet Wege, die wir nicht immer gleich verstehen können. Dass du blonde Haare hast und ich schwarze, spielt doch überhaupt keine Rolle, solange wir uns mögen. Und ich werde dich immer mögen, Teufelchen. Du mich doch auch, oder?«
»Ja, schon, aber irgendwie auch nicht. Ich bin nicht wie ihr. Oder hast du etwa Angst, wenn alle Fenster geschlossen sind oder wenn die ganze Klasse dich umzingelt und sie sich daran freut, dass du das nicht aushältst? Dann sperren sie mich in den Schrank oder in die Besenkammer und lachen wie die Idioten.«
»Was tun die? Das hast du mir nie erzählt.«
Floriano war immer in Sorge, dass ihr etwas passieren könnte, und stellte sich schützend vor sie. Selbst wenn sie zu Hause etwas angestellt hatte, nahm er das oft auf seine Kappe, ließ die Strafpredigten gleichmütig über sich ergehen und zwinkerte ihr verschwörerisch zu.
»Na ja, bis ich dann so tobe, dass entweder der Schrank kaputtgeht oder ein Lehrer kommt, der mich befreit. Aber die Schuldige bin immer ich, Flori.«
»Ich werde dafür sorgen, dass sie das nicht mehr tun. In Zukunft sagst du es mir gleich, Xixi. Versprochen?« Floriano atmete auf, offensichtlich hatte sie das eigentliche Thema schon vergessen.
»Ich gebe es denen schon selber, Flori.« Xenia sprang auf und zeigte ihre kleinen Muskeln. »Bring mir ein paar Tricks bei, die du immer im Training machst.«
»Das sind keine Tricks, das sind Techniken. Das heißt Wing Tsun Kung Fu. Wenn du willst, dann nehme ich dich morgen mit, und du schaust uns zu.«
»Flori, ist es ein Zufall, dass mein Geburtsort Gemona und nicht Gorizia ist, wie bei dir und Mama und Papa?«
Xenia setzte sich wieder neben ihn und umklammerte den kräftigen Arm ihres großen Bruders, während er ihren blonden Schopf streichelte und zaghaft nach den richtigen Worten suchte. Es gab jetzt keinen Ausweg mehr.
»Zufälle gibt es nicht, Xixi. Wir sagen das nur, wenn wir uns die Dinge nicht erklären können oder wollen.«
Die frische Nachtluft, die durch die sperrangelweit geöffneten Fenster ihres hell erleuchteten Arbeitszimmers strömt, riecht nach Frühling. Xenia sitzt vornübergebeugt auf einem dreibeinigen Holzschemel, Tränen laufen ihr unaufhaltsam über die Wangen, doch sie schluchzt nicht. Ihr Blick ist starr auf ein mit schwarzem Rand eingefasstes Porträt in einem silbernen Bilderahmen gerichtet. Das Gesicht eines fröhlichen jungen Mannes. Floriano Benes 31. 1. 1966 – 9. 6. 1990 steht darunter. Xenia hat es von der Wand genommen und ist in Erinnerungen versunken. Arne war irgendwann hereingekommen, ihr Freund, nachdem er zuvor lange in der Tür gestanden hatte, ohne dass sie ihn bemerkte. Er umarmte sie und versuchte, ihr zuzureden, nach vorne zu sehen.
»Ein Teil der Zukunft liegt in der Vergangenheit«, hatte sie tonlos gesagt, »das verstehst du nicht. Geh schlafen.«
Sie schüttelte ihn steif ab, und ihm blieb nichts übrig, als ihr einen Kuss auf die Stirn zu drücken und sie zu mahnen, nicht die ganze Nacht in Hader zu versinken.
Xenia ist allein. Auch wenn sie seit fast einem Jahr mit ihm zusammenlebt. Sie erinnert sich nicht an den genauen Tag, an dem er in ihr Leben trat. Absurd genug, eine italienische Polizistin und ein arbeitsloser Jungarchäologe aus Dortmund, dessen Eltern ein Bestattungsinstitut führen. Vielleicht wird sie sich noch an ihn gewöhnen, an seine Ansprüche einer trauten Zweisamkeit. Ohne dass es ihr zu eng wird. Ohne ein weiteres Mal davonzulaufen. Ein netter Kerl, der in sie verliebt ist.
Erst seit jenem Nachmittag im Weinberg weiß Xenia, dass Safiria Lepore in Wahrheit die Schwester ihrer leiblichen Mutter ist und sie zusammen mit ihrem Mann Danilo zwei Tage nach ihrer Geburt adoptiert hatte.
Ihr Babyfoto war durch die europäische Presse gegangen: Hoffnung im Leid, Das Wunder von Gemona oder Das Leben aus der Nacht des Todes lauteten die pathetischen Headlines. Jordan S. Becker, ein österreichischer Journalist, lässt es sich nicht nehmen, an jedem Jahrestag über ihren Werdegang zu berichten. Mit der Zeit wurde er zu einem fernen Freund, mit dem sie sporadisch telefoniert, wenn er nicht unverhofft auf der Schwelle steht. Selbst in Ostia besuchte sie der groß gewachsene Mann mit dem grauen halblangen Haar eines Tages in ihrem Kommissariat. In diesem Jahr ist sein Besuch längst überfällig.
Schon ihre leibliche Mutter war auf den Namen Xenia getauft gewesen. Sie hatte in Gemona die städtische Bibliothek geleitet und war im siebten Monat, als sie beim großen Erdbeben im Friaul eine einstürzende Mauer ihres Wohnhauses unter sich begrub. Stunden später hatte eine erste Rettungsmannschaft ihre verzweifelten Rufe aus den Trümmern vernommen, die Siebenundzwanzigjährige befreit und zu einem eilig errichteten Militärlazarett gebracht. Um 4 Uhr 37 des 7. Mai 1976 hauchte die junge Frau nach dem Notkaiserschnitt ihr Leben aus. In der Nacht des Todes erblickte Xenia Ylenia Zannier zwei Monate zu früh das Licht der Welt. Fast tausend Menschen hatten ihr Leben verloren und über fünfundvierzigtausend das Dach über dem Kopf. Die Medien hatten sich auf das Neugeborene gestürzt wie auf ein Wunder. Gab es doch Hoffnung im Tod?
Xenia wurde als Vollwaise geboren, auch ihren Vater Gaetano Zannier hatte sie nie kennengelernt. Helfer bargen die Leiche des Gemeindepolizisten erst drei Tage später aus den Trümmern. Und ihr Onkel Danilo Benes wurde dank der unerschütterbaren Entscheidung Safirias, das Baby umgehend zu adoptieren und ihm den Namen der Mutter zu geben, zu dem Mann, den Xenia schließlich Papà nannte. Ihre Tante wurde zur Mamma. Tatsächlich war Floriano also ihr Cousin, für sie aber ihr großer Bruder. Er war schon zehn Jahre alt gewesen und hatte die Kleine von Anfang an in sein Herz geschlossen.
Such dir einen neuen Job, Flittchen. Kommissarin Xenia Zannier sitzt mit durchgedrücktem Rückgrat auf dem Holzhocker, fährt sich mit beiden Händen durch das streichholzkurze blonde Haar, ballt die Fäuste, dass sich die Knochen weiß auf dem Handrücken abdrücken und ihre Nägel in die Hand schneiden, bis sie den Schmerz spürt. Sie schnellt blitzartig auf, drei Schritte, ihre Faust trifft das Bild der Senatorin.
Xenia war vierzehn Jahre alt, als sie die Frau zum ersten Mal sah. Im Gerichtssaal während des Prozesses gegen Floriano. Drei Tage bevor er sich angeblich in seiner Zelle erhängte, um sich seinem Urteil zu entziehen. Jahre später hatte Xenia sich die Akten besorgt und selbst mit den Zeugen geredet, um sich ihr eigenes Bild zu machen.
1990 hatte Floriano bei der Finanzpolizei in Triest im Dienst gestanden und an einem freien Abend mit zwei Freunden nach dem Kino auf einen Drink in der Bar Bellavia an der Viale XX Settembre gelandet. Die ehrwürdige Platanenallee im Herzen der Stadt, an der das Geburtshaus von Italo Svevo liegt, strotzte damals vor Hakenkreuzschmierereien und antislawischen Hetzplakaten. Der alte faschistische Hass gegen alle, die anders sind, er hatte schon 1920 in der Stadt die ersten Toten gefordert. Ausgelassen unterhielt sich Floriano mit seinen Freunden auf Slowenisch, worauf die Kerle am Tresen sie anpöbelten und den Weg zum Ausgang versperrten. Floriano rief, jemand möge die Polizei verständigen, und stellte sich schützend vor seine Freunde. Die ersten beiden Angreifer brachte er rasch zu Boden und bahnte sich einen Weg nach draußen. Vor der Tür waren sie zu dritt mit Baseballschlägern und einem zerschlagenen Bierkrug auf ihn losgegangen, worauf er sein Repertoire abspulte. Während er sich nur eine Schramme geholt hatte, zogen seine Gegner einen am Boden liegenden Kameraden in die Bar hinein und blockierten die Tür. Floriano und seine beiden Begleiter warteten, bis nach über einer halben Stunde endlich die Polizei vorfuhr. Er wies sich als Beamter der Guardia di Finanza aus und schilderte sachlich den Vorfall, bis die Sirene eines Krankenwagens ihn unterbrach. Einer der Feiglinge wurde auf einer Bahre abtransportiert, während seine Kameraden üble Drohungen ausstießen. Erst als weitere Streifenwagen vorgefahren waren, hatten sich die Polizisten getraut, in die Bar einzudringen, um die Personalien aufzunehmen. Floriano, Albert und Sebastian erstatteten Anzeige wegen Körperverletzung, Beleidigung und rassistischer Übergriffe und waren davon überzeugt, dass die Sache damit erledigt war. Bis Floriano eines Tages zum Kommandanten seiner Einheit gerufen wurde, wo zwei Polizisten in Zivilkleidung ihm einen Haftbefehl aushändigten: Mordversuch mit gefährlicher Körperverletzung. Die Anzeige stammte vom Schlimmsten der Hetzer in der Bellavia: Carletto Castelli de Poltieri. Als Florianos Vorgesetzter ihn aufforderte, Waffe und Uniform abzulegen, ihn vorübergehend vom Dienst suspendierte und ihm riet, in Anbetracht der Schwere der Vorwürfe einen Anwalt zu nehmen, erinnerte er ihn auch daran, dass die Schwester des Klägers über die besten Beziehungen verfügte. Widerstandslos ließ Floriano sich abführen, fest davon überzeugt, dass sich die Sache rasch aufklären ließ. Dann aber standen den drei Aussagen der Freunde plötzlich neun andere gegenüber, die dem Wortlaut nach klar abgesprochen waren. Floriano habe den Streit mit wüsten Beschimpfungen vom Zaun gebrochen und sei tätlich geworden. Die Bar Bellavia sei bekannt dafür, dass sie von ordnungsliebenden, pflichtbewussten Söhnen solider italienischer Familien frequentiert würde. Über die Provokationen militanter Slowenen wisse man schließlich ausreichend Bescheid. Die Anwürfe waren ungeheuerlich. Lügen, die zu enthüllen ein Blick in die Zeitungsarchive genügte. Neofaschistische Übergriffe standen damals auf der Tagesordnung, selbst vor Brandsätzen gegen Schulen, Kindergärten und Studentenwohnheime hatten die Extremisten nicht zurückgeschreckt. Florianos Hinweis auf seine Herkunft, die Mutter Italienerin, sein Vater mit slowenischen Vorfahren, fand vor Gericht kein Gehör. Die gegnerischen Anwälte zerpflückten seine Aussage und die seiner Freunde bis in die Einzelheiten. Die Verletzungen ihres Mandanten ließen Tötungsvorsatz erkennen. Das Urteil war hart: Vier Jahre erschwerte Haft, ein lebenslanges Verbot jeglicher Kampfsportbetätigung und der Ausschluss aus dem Staatsdienst samt einer hohen Schmerzensgeldzahlung in Höhe von sechzig Millionen Lire. Noch im Gerichtssaal rief Floriano, dass er in Berufung gehen würde. Als loyaler Diener eines demokratischen Rechtsstaats dürfe er keine Manipulation von Beweismitteln und Zeugenaussagen zulassen. Am dritten Tag im Gefängnis hatte er seinem Leben angeblich selbst ein Ende gesetzt. Ohne ein einziges Wort zu hinterlassen.
Grado, Diga Nazario Sauro.
Die zarte Sichel des neuen Mondes steht tief am wolkenlosen Himmel über der nachtschwarzen Adria. Nur das matte Licht der Laternen auf der Diga Nazario Sauro, dem Deich mit der Uferpromenade, der die Altstadt des Badeorts vor Überflutungen schützt und bei gutem Wetter die Feriengäste zum Flanieren einlädt, lässt zaghaft den Verlauf der ins Meer reichenden Mole erkennen und die sich anschließenden Sandstrände. Stürme und für die Jahreszeit untypisch starke Niederschläge bestimmten den Saisonaufakt. Nach einem sommerlich heißen April hatte der Mai deutlich zu kalt begonnen, und die Hoteliers der Isola del Sole klagen über nicht kompensierbare Umsatzeinbußen, obwohl das große Geschäft noch bevorsteht.
Weit und breit ist keine Seele zu sehen, die sich fragen könnte, weshalb zwei dunkel gekleidete, stämmige Männer um halb 4 Uhr morgens rauchend aufs Meer stieren. Weit draußen schiebt sich ein Frachtschiff gegen Westen. Das gemächliche Stampfen seiner Maschinen dringt dumpf herüber und wird schließlich vom Lärm zweier höherdrehenden Motoren überlagert, der sich kontinuierlich nähert. Keine Fischkutter, keine Patrouillenboote.
»Das ist die erste Gruppe.« Der Ältere bläst eine dicke Rauchfahne in die Nachtluft. »Die übernehme ich, du die nächsten. Du kannst schneller rennen.«
»Wer soll uns um diese Zeit schon entdecken?«
»Nur wenn’s pissen würde, könntest du dir da sicher sein. Also sei vorsichtig.« Er zieht noch einmal an der Kippe zwischen seinen Lippen und spuckt sie aus. Seine Hände stecken tief in den Taschen der speckigen Jacke.
Von der Mole ist das Kratzen einer Bordwand zu vernehmen, kurz darauf eine Gruppe von etwa vierzig Personen zu erkennen, die den Strand heraufeilen. Der Ältere stellt sich in den Schein der Laterne und winkt mit beiden Armen, dann geht er zum Eingang des Strandbads, um sie in Empfang zu nehmen. Ihre Fußspuren sind die ersten im geometrischen Muster, das die Rechen im Sand hinterlassen haben.
Suchend tastet Xenias Hand nach dem Mobiltelefon auf der zum Nachttischchen umfunktionierten Obstkiste. Endlich reißt sie das anhaltende Klingeln und Vibrieren des Geräts restlos aus dem Schlaf. Kaum eineinhalb Stunden hat sie geschlafen. Die Kommissarin meldet sich knapp, legt nach ein paar Sekunden auf. Arne sitzt aufrecht im Bett und knipst das Licht an.
»Was ist passiert?«, fragt er blinzelnd und mit belegter Stimme.
»Schlaf weiter.«
Sie ist bereits auf den Beinen, schlüpft in Jeans und Sweatshirt, steckt ihre Dienstwaffe in den Hosenbund. Ohne Helm fährt sie durch das dunkle Viertel und biegt Richtung Zentrum ab. Die Luft ist kühl.
Auch der Busbahnhof ist Opfer der Patria Nostra geworden, einer fremdenfeindlichen Gruppierung, die seit Tagen die Region mit Plakaten voller Hassparolen gegen die Europäische Union und Deutschland zukleistern. Plump in der Aufmachung und in einem Kauderwelsch, das seinesgleichen sucht. Der Kleister ist noch feucht.
NIX FRIEDE.
100 anni senza pace.
RAUS dall’Italia!
BASTA. SCHLUSS.
No all’egemonia crucca!
NO ALL’EUROPA INVASORE.
PATRIA NOSTRA.
Xenia schüttelt besorgt den Kopf. Bei den unzähligen Feierlichkeiten zum siebzigsten Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs wurden regelmäßig die Errungenschaften des Vereinten Europas betont, während immer mehr Separatistenbewegungen Hass auf alles Fremde versprühen.
Seit zwei Wochen bemühen sich Arbeiter der Stadtverwaltung, die Plakate zu entfernen, bevor die Touristen morgens ihre Hotels verlassen. Vergebliche Anstrengungen, die von den Fanatikern schnell wieder zunichtegemacht werden. Undenkbar bei der knappen Personallage, ihnen durch verstärkte nächtliche Patrouillen das Handwerk zu legen.
Die Scheinwerfer der Streifenwagen der Polizia di Stato, Guardia di Finanza und der Carabinieri sind auf der Piazza Carpaccio auf eine Gruppe ausgezehrter Menschen gerichtet, die stumm auf dem kalten Asphalt kauernd der Dinge harren. Flüchtlinge aus dem Nahen Osten ihrem Äußeren nach. Eine Handvoll Beamte wacht darüber, dass sich keiner von ihnen aus dem Staub macht. Inspektor Rino Refolo, der ranghöchste Kollege unter ihnen, kommt Xenia entgegen und umreißt in knappen Worten die Situation. Er spricht leise, immer wieder schweift sein sorgenvoller Blick zu der Gruppe hinüber.
»Ein Fahrer, der die Tagespresse verteilt, hat die Gruppe gesehen und uns verständigt, Commissario. Einundachtzig Männer oder Jugendliche, acht Frauen. Beim Anrücken der Streifenwagen liefen einige über die Brücke auf die Isola della Schiusa genau in Richtung Kommissariat, wo wir sie aufgreifen konnten. Bis auf zwei. Die sind uns entwischt. Ganz sicher Ortskundige. Dunkle Seemannsjacken, schwarze Mützen, helle Haut. Keine Illegalen, eher Lotsen.«
»Und wie sind diese Leute hierhergekommen? Ausgerechnet hierher?« Widerborstig steht ihr das Haar vom Kopf ab. Die rote Strieme von der Naht des Kopfkissens auf ihrer Wange gleicht einer langsam verheilenden Narbe.
Refolo zuckt die Achseln und schaut hilflos zu der ihn deutlich überragenden, zehn Jahre jüngeren Vorgesetzten auf.
»Grado ist nur über zwei Brücken erreichbar«, sagt sie. »Niemand flieht in eine Sackgasse. Diese Leute sind übers Meer gekommen. Vor Kurzem erst ausgesetzt von einem größeren Schiff, sofern sich kein maroder Fischkutter vor den Stränden findet. Aber die schaffen die achthundert Seemeilen in die obere Adria nicht.« Xenia wählt die Nummer des Rettungsdienstes.
Noch vor ihrer Identität muss der Gesundheitszustand dieser Menschen überprüft werden. Gleich darauf verlangt sie bei der Guardia Costiera in Monfalcone nach dem diensthabenden Offizier. Die Küstenwache soll den Schiffsverkehr der letzten Stunden kontrollieren, Satelliten- und Funkmeldungen analysieren und die Verdächtigen festsetzen, bevor sie internationale Gewässer erreichen. Falls es dazu nicht längst zu spät ist.
Die Kommissarin winkt einen Kollegen heran. »Berto, besorg Mineralwasser.«
Der übergewichtige Berto Donadoni verdreht die Augen. Er ist an Trägheit kaum zu überbieten und will protestieren.
»Ich weiß selbst, dass die Läden erst in ein paar Stunden öffnen«, schneidet Xenia ihm das Wort ab. »Hol den Trottel vom Supermarkt aus dem Bett, er ist uns einen Gefallen schuldig. Los, beweg dich endlich.«
»Soll er auch Champagner für die Willkommensparty mitbringen?«
»Stilles Wasser, ohne Kohlensäure. Halbliterflaschen, kein Glas. Kapiert?«
Noch hält sie sich von der Gruppe fern. Das Telefon des Questore klingelt lange und vergebens. Xenia weiß, Polizeipräsident Falsariga wird ihr bittere Vorwürfe machen, falls sie ihn übergeht. Zwei Versuche, nichts. Sie hat keine andere Wahl, als sich direkt an Präfekt Affaiati in Gorizia zu wenden. Es braucht seine Anordnung, um eine Turnhalle als Sammelstelle freizugeben. Nachdem Affaiati sich wach geräuspert hat, stellt er in Aussicht, sich in Kürze mit weiteren Instruktionen zu melden.
Xenia nähert sich, einige der Menschen blicken ängstlich zu ihr auf. Die meisten von ihnen sind sehr jung, die wenigen Frauen sitzen eng im Kreis beieinander. Aus der Sitzordnung ist nicht zu erraten, ob einer der Flüchtlinge einen höheren Rang einnimmt. Sie sind erschöpft von der langen Überfahrt, schmutzig und verwahrlost, doch auf den ersten Blick geht es keinem von ihnen körperlich so schlecht, dass es eine Noteinlieferung verlangt.
»Good Morning. Welcome to Italy.« Xenia Zannier fühlt sich beschissen. Sie weiß ganz genau, dass in Europa kein Flüchtling mehr willkommen ist. Sie räuspert sich. »I am a police officer of the republic of Italy. Does anybody speak English?« Sie besinnt sich ihrer Amtssprache. »C’è qualcuno che parla italiano? Sono un commissario della Polizia di Stato della Repubblica Italiana.«
Ihr Blick schweift über die Köpfe. Die Leute schauen sie stumm an. Sie weiß aus ihrer Dienstzeit im Süden, dass jetzt niemand antworten wird. Diese Menschen sind nicht frei. Wenn sie durch eine Schleuserorganisation nach Europa gelotst wurden, haben sie viel Geld dafür bezahlt. Und weit mehr zu verlieren: Sicherheit, Hoffnung – so knapp vor dem Ziel hatten sie geglaubt, das Schlimmste überstanden zu haben.
Auch die Kollegen folgen neugierig ihren Worten. Keiner von ihnen hatte bisher mit der Aufnahme von Flüchtlingen zu tun. Sie kennen die Problematik nur aus den klischeegespickten Fernsehberichten oder der Presse. Und vom Geschwätz an den Tresen der Bars. Die Verkäufer, überwiegend Senegalesen, die in der Fußgängerzone oder am Strand ihren Tand verkaufen, kennen sie längst mit Namen. Wie die Tamilen und Bengalen mit ihren Textilläden verfügen sie über gültige Dokumente.
Xenia entscheidet sich für Englisch. »We know that you have been brought here by a vessel and that you immigrated illegally to our country and the European Union. Two of our busses will arrive in a few minutes. It is warmer inside. We will bring you to a safe place where you will get to drink and to eat. There will also be medical assistance. Please follow our instructions.«
Einer der Männer am Boden übersetzt flüsternd, sie prägt sich sein Gesicht ein. Endlich kommt der Lieferwagen des Supermarkts. Ein hagerer übermüdeter Mann ihres Alters im Trainingsanzug steigt aus. Neulich hatten sie ihm seine Tageseinnahmen vollständig wiederbesorgt, weil er nach Feierabend seine Geldtasche auf dem Autodach vergessen hatte. Bedankt hatte er sich mit keinem Wort. Er öffnet die Hecktüren und stellt wortlos einige Gebinde Plastikflaschen auf den Gehweg. Er wirft ein paar verstohlene Blicke herüber und macht sich, so schnell er kann, wieder davon. Angst vor Eindringlingen und Krankheiten? Schlechtes Gewissen und Mitgefühl schließt Xenia bei diesem Mann aus. Als der Tag über die Nacht siegt, verteilen drei Kollegen die Flaschen. Auch sie vermeiden jeden körperlichen Kontakt, als hätten sie es mit Aussätzigen zu tun.
Die Nummer der Präfektur leuchtet auf dem Display ihres Mobiltelefons. Sie entfernt sich ein paar Schritte, bevor sie das Gespräch annimmt. Dem betont freundlichen Tonfall von Präfekt Antonio Affaiati nach rechnet Xenia damit, den Fall bereits los zu sein, weil er die Flüchtlinge sofort in die nächste größere Stadt verlegen lassen will, wo mehr und vor allem geschultes Personal zur Verfügung steht. Weder Status noch Ausstattung der Dienststelle in Grado machen Hoffnung, dass ausgerechnet sie sich an die Fersen einer mafiosen Schleuserbande heften darf, die offensichtlich ortskundig ist.
»Die Illegalen bleiben vorerst in Ihrer Obhut, Commissario. Die Ordnungskräfte in Monfalcone sind anders gebunden. In Grado haben Sie es dagegen geradezu gemütlich. Außerdem ist das für Ihre Leute eine gute Übung. Die Auffanglager sind alle überfüllt. Ihr Chef ist ganz meiner Meinung«, ergänzt Affaiati.
Auf seinen Anruf hatte Questore Falsariga also geantwortet. Ärger steht ins Haus.
»Falsariga schickt Ihnen Verstärkung aus Gorizia, Leute mit Erfahrung bei der Identitätsermittlung von Illegalen. Bezüglich der Versorgung hat seine Eminenz der Erzbischof rasche Hilfe durch die Caritas zugesagt, und der Bürgermeister sagt, dass im Stadttheater wegen fehlendem Budget keine Vorstellungen stattfinden. Waschräume gibt es auch dort. Sorgen Sie aber bitte dafür, dass diese Leute keinen unnötigen Schmutz machen. Die Illegalen werden so rasch abgeschoben, wie sie angekommen sind. Wir sind hier nicht der Mülleimer Afrikas. Spätestens in drei Tagen ist der Spuk vorbei, und Sie können sich um den besonnenen Verlauf des Pfingsttourismus kümmern.«
Das war klar genug: In Grado sollten sie die Basisarbeit leisten, und danach würde wieder die übliche Langeweile einkehren. Die letzten Instruktionen des Präfekten werden vom Motorengeräusch einfahrender Omnibusse übertönt. Die blau-weiß lackierten Polizeibusse blockieren die Zufahrt, während aus einem Mannschaftswagen Kollegen in Kampfanzügen aussteigen und eine Mauer bilden.
»Eine Frage noch, Dottor Affaiati: Sind die Beamten zur Identitätsermittlung immer mit Helm, Schlagstöcken und Schutzschildern ausgestattet?«
»Was reden Sie da, Commissario?«
»Hier ist soeben eine Spezialeinheit ausgestiegen. Die Situation wird eskalieren, so, wie die sich aufbauen.« Xenia stellt sich der Truppe entschieden in den Weg und gebietet ihr mit der Hand Einhalt.
»Davon weiß ich nichts. Das Kommando haben Sie, Zannier.«
»Was geht hier vor?«, herrscht sie den Einsatzleiter an, ein etwa fünfzigjähriger Borstenkopf. »Geht das nicht behutsamer?«
»Ein Befehl des Questore, Kollegin. Er sagt, Sie seien mit solchen Situationen überfordert. Wir verfrachten sie ins Theater und sorgen dafür, dass keiner abhaut.«
Breitbeinig und mit verschränkten Armen steht er vor seinen Männern und grinst überheblich. Xenia baut sich eine Armlänge entfernt vor ihm auf.
»Weshalb wohl sitzen die Flüchtlinge hier? Bisher waren sie ruhig. Lösen Sie diese Formation auf. Ihre Leute können dann die Bewachung des Theaters übernehmen. Von außen.«
»Sagen Sie das dem Questore, Zannier. Gehen Sie mir endlich aus dem Weg.«
»Sie können es darauf ankommen lassen, in Grado kommandiere ich. Zeigen Sie mir Ihren Dienstausweis.« Der Mann bleibt stur stehen, ein nervöses Zucken umspielt seinen linken Mundwinkel. Xenia winkt Refolo und zwei weitere Beamte herbei, die sich in respektvollem Abstand gehalten haben. »Nehmt ihn fest.«
»Sie spinnen, Zannier. Das wird Folgen haben.«
»Worauf Sie sich verlassen können.«
Der Borstenkopf gibt seinen Männern das Zeichen, sich zurückzuziehen. Sie zögern zuerst, doch dann kommen sie dem Befehl nach.
»Sobald die Flüchtlinge im Theater sind, riegeln Sie mit Ihren Leuten die Straße ab, Kollege, und warten auf weitere Befehle. Refolo, lassen Sie diese Menschen einsteigen und bringen Sie sie in die Via Marchesini.«
Xenia rührt sich nicht von der Stelle. Wie ein Wachtturm steht sie zwischen der Spezialeinheit und den Flüchtlingen, die sich langsam erheben und zu den Bussen gehen.
In der Straße vor dem Auditorium Biagio Marin gibt es kein Durchkommen. Die blauen Autobusse blockieren den Verkehr. Vor dem Theater weisen zwei Beamte die Journalisten der regionalen Medien zurück, während die Kollegen aus dem Mannschaftswagen einen Korridor bilden, durch den die Flüchtlinge ins Innere des Gebäudes gehen.
Xenia hängt den Helm an den Rückspiegel des Scooters, mit einer abwehrenden Handbewegung drängt sie sich an den Reportern vorbei. »Wenden Sie sich bitte direkt an den Questore in Gorizia. Er wird noch am Vormittag eine Pressekonferenz einberufen. Am besten fahren Sie gleich rüber, dann verpassen Sie nichts.«
Nur wenige fallen darauf rein. Ein Kameramann des regionalen Fernsehsenders filmt die Helfer der Caritas, die Kleidung und Lebensmittel ins Gebäude schleppen. Xenia übergibt an Inspektor Refolo und fährt ins Kommissariat. Der Anruf von Questore Falsariga wird nicht lange auf sich warten lassen, er wird sie gewiss wegen Eigenmächtigkeit und Kompetenzüberschreitung rügen.
Nur Donadoni sitzt im vordersten Büro und stiert auf den Eingang. Immerhin riecht es nach Kaffee, Xenia sieht sich vergeblich nach einer Tasse um, nimmt wortlos die des Beamten und spült sie flüchtig aus.
»Kaffee machen kannst du also auch nicht.« Sie stellt die Tasse angewidert auf den Schreibtisch. »Dir bringt vermutlich deine Frau den Espresso ans Bett.«
»Und weckt mich mit zärtlichen Küssen. Nein danke, ich bin glücklich geschieden.«
»Hat jemand angerufen?«
Berto Donadoni beugt sich gemächlich über ein Blatt auf dem Schreibtisch. »Die sind übrigens vor der Diga gelandet. Ein orangerotes Boot, den Lackspuren an der Mole zufolge. Und Fußspuren im Sand. Ich hab selbst nachgesehen. Ach ja, vorhin hat einer angerufen.«
»Wer?«
Der Dicke hebt wortlos die Schultern.
»Sein Name?«
»Ein Italiener war es auf jeden Fall nicht«, fügt er sogleich mit erhobenen Händen hinzu, ganz die Unschuld vom Lande.
»Die Telefonnummer?«
Er schreibt ein paar Zahlen auf einen Zettel und legt ihn vor die Kommissarin. »Meine Schicht ist jetzt eigentlich zu Ende.«
»Dann machst du heute eben Überstunden. Du bleibst, bis die Kollegen zurück sind und jemand übernehmen kann.«
Xenia Zannier schüttet den Kaffee zum Fenster hinaus. Refolo hatte die beiden Männer vage beschrieben, die in der Dunkelheit entwischt waren. Ein Altersunterschied wie zwischen Vater und Sohn, abgewetzte schwarze Jacken, die darauf schließen lassen, dass sie diese ständig tragen. Ein Hinweis, dem zu folgen ist. Die Kommissarin wettet darauf, dass man diese Typen in der Stadt kennt und bald auch ihr Stammlokal ausfindig macht. Genau dort muss man sie festnehmen, damit ihre Kumpels gewarnt sind. Die Typen auszuquetschen wird allerdings dauern. Die Fischer in Grado sind zähe Schweiger.
Sie wirft einen Blick auf den Zettel, den Donadoni ihr gegeben hat. Eine österreichische Vorwahl. Sie kennt die Nummer.
Grado, Isola della Schiusa. Kommissariat.
»Ist was passiert?«, ruft Valerio Alfieri dem Beamten zu.
Auf seiner Insel hatte er nur noch darauf gewartet, dass das kleine Frachtschiff im Morgengrauen wie geplant in den Schifffahrtskanal einfuhr, der durch die Lagune führt. Erst danach machte er die Leinen des flachen Boots los, um drüben in der Stadt mit dem Motorrad zur Post zu fahren und das Schließfach zu leeren. Er sah die Busse der Polizia di Stato, die nach Grado hereinfuhren. Die sonst verschlafene Dienststelle ist ungewöhnlich geschäftig, als er im Hof des Kommissariats den Zündschlüssel seiner Harley-Davidson auf Stopp stellt.
»Wir haben Hunderte Illegale am Busbahnhof aufgegriffen.« Berto Donadoni lehnt wie ein Waschweib im Fensterrahmen und schnipst seine Zigarette in den Hof.
»Ihr doch nicht?« Lachend nimmt Alfieri den Helm ab, worauf sein mit dicken grauen Strähnen versetztes Haar bis auf die Schultern fällt. »Ihr seid viel zu wenige für so einen Coup. Erzähl das jemand anderem.«
»Jeder weiß, dass Sie diese Leute lieber mögen als uns, obwohl sie uns die Arbeitsplätze wegnehmen und unsere Frauen.«
»Red keinen Unsinn. Wenn sich die Politik unmenschlich verhält, sind wir gefragt. Jeder Einzelne von uns. Denk dran, wenn es dir mal schlecht geht.«
Der träge Donadoni steckt sich noch eine Zigarette an. »Sie können sich das ja leisten. Aber unsereins verliert mit jedem, der hier ankommt. Denen wird das Geld nur so hinterhergeworfen. Und Sie, Signor Alfieri, geben denen sogar Arbeit, anstatt jemanden von uns anzustellen.«
»Das hab ich lange genug versucht. Euch geht es allen zu gut, um den Rücken krummzumachen und Land zu bestellen. Gemüse kennt ihr nur aus dem Supermarkt.«
Valerio Alfieri gilt als Idealist. Seit Jahren investiert er in Immobilien in der Altstadt, die er originalgetreu renoviert und günstig an junge Leute vermietet, um etwas gegen die Abwanderung zu unternehmen und den Ausverkauf an Deutsche und Österreicher zu verhindern. Andere halten ihn für einen miesen Spekulanten, der an der Frankfurter Börse ein Vermögen verdient hat und es sich erlauben konnte, sich früh aus dem Berufsleben zurückzuziehen.
Das Erdgeschoss des niedrigen Gebäudes auf der Isola della Schiusa hat er an die Staatspolizei vermietet, als man in Grado wieder ein Kommissariat eröffnete. Er hatte sich lediglich ausbedungen, das Motorrad und seinen Wagen auf dem Gelände parken zu dürfen. Die neue Kommissarin, in seinen Augen eine hochgewachsene Blonde mit Adrenalinüberschuss, hatte Sicherheitsbedenken vorgebracht, musste am Ende aber nachgeben. Seine Verbindungen zur Präfektur und manchen Politikern hatten schwerer gewogen. Für Alfieri ist es die bequemste Lösung: Nebenan befindet sich der Anleger, an dem seine hochseetüchtige Motorjacht liegt und wo auch das flache Boot vertäut ist, mit dem er täglich durch die Lagune zu seiner privaten Insel Sant’Andrea fährt.
Er winkt Donadoni, streicht sich durch den Vollbart und klemmt die Post unter den Arm. Dann schließt er das Tor und geht zur Treppe in den ersten Stock. Er schaltet sein Telefon ein und wählt eine türkische Nummer. Nebenher legt er die Lieferscheine für das Gemüse aus, die seine Sekretärin später bearbeiten wird.
»Alles okay. Die Ware ist angekommen. Nur hat sie sofort einen Großkunden gefunden.« Er hält sich kryptisch kurz.
Seine Kommunikation führt er fast nur hier, auf seiner Insel duldet er weder Computer noch Mobiltelefon. Auf Sant’Andrea ist er nur persönlich erreichbar und im Büro nur in den frühen Morgenstunden mancher Wochentage. Wenn er telefonisch sehr wichtige Dinge zu regeln hat, nimmt er die große Jacht und fährt in internationale Gewässer hinaus, von wo er die Gespräche über Satellit führt.
Seit acht Jahren ist die Isola di Sant’Andrea sein ausschließlicher Wohnsitz. Seit seinem Rückzug aus dem Börsengeschäft kümmert sich seine Frau Feride Akgün in Frankfurt um den in Deutschland belassenen Teil seines Vermögens, während er sich dem Gemüseanbau und der Fischzucht widmet und die Abgeschiedenheit genießt. Sant’Andrea bildet die natürliche Barriere zur offenen Adria und schützt die beiden Lagunen von Marano und von Grado vor Sturmfluten. Nur die Fahrrinne für die kleineren Frachtschiffe zum Terminal von Porto Nogaro führt daran vorbei, und manchmal nähern sich die kleinen Mietboote allzu neugieriger Touristen, die der Meinung sind, dort eine Trattoria zu finden. Große Schilder am Anleger schrecken sie schließlich ab.
Neben der Tatsache, dass es das Schiff, ein schrottreifer Seelenverkäufer, bis zum nördlichsten Punkt der Adria geschafft hat und seine Strategie damit bereits fast aufgegangen war, macht etwas anderes Valerio Alfieri an diesem Morgen zu einem noch zufriedeneren Menschen: Seine zähen Verhandlungen mit Romana Castelli de Poltieri haben endlich das gewünschte Resultat gebracht. Die Senatorin stimmt der Veräußerung seiner Aktienmehrheit an der ChimiCo SpA im nahe gelegenen Torviscosa an die deutsche MainChemie AG zu. Bisher hatte sich die Politikerin mit dem Hinweis gesperrt, die ChimiCo sei ein strategisch wichtiges Unternehmen. Bei einem Verkauf stünden über hundert Arbeitsplätze auf dem Spiel. Und schon zu viele internationale Großkonzerne seien im krisengeschüttelten Italien auf Einkaufstour, um sich die besten Betriebe unter den Nagel zu reißen. Von der Landesregierung zugesagte Investitionszuschüsse und Steuergeschenke sowie politische Zusagen aus Deutschland mussten für ihr Einlenken ausschlaggebend gewesen sein. Umsonst gab es von der Senatorin nichts. Und die Tageszeitungen hatten in den letzten Tagen verlautbart, dass Romana Castelli de Poltieri auf deutschen Rückhalt baue bei der Wahl des nächsten Generalsekretärs der OSZE, der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa.
Nur einmal in seinem Geschäftsleben, als er die ChimiCo SpA erwarb, hatte der gebürtige Mailänder Valerio Alfieri sich von Emotionen leiten lassen. Nach der Weltwirtschaftskrise hatte sein Großvater im Auftrag des Duce den Ort Torviscosa geplant. Das faschistische Italien sollte durch neue Industriezentren unabhängiger werden. Schon ein Jahr nach der Grundsteinlegung hatte Mussolini inmitten der trockengelegten Sümpfe schließlich die Viskoseproduktion eingeweiht. In den Fünfzigern wurde der Ort zu einem Chemiezentrum privatisiert, doch seit der Öffnung der Weltmärkte ist die ChimiCo der einzige relevante Arbeitgeber dort und weist herbe Verluste aus. Nur die Bereiche Fluorwasserstoff und Ammoniumhydrogendifluorid laufen noch. Der Markt von Dual-Use-Produkten ist krisenresistent. Trotz aller internationalen Exportkontrollen genießen Güter, die sowohl zivil als auch militärisch weiterverarbeitet werden können, eine mindestens konstante Nachfrage. Die ChimiCo ist der ideale Übernahmekandidat für ein kapitalstarkes Großunternehmen wie die MainChemie mit Zugang zum Weltmarkt. Alfieri wird es seiner Frau Feride als Erster berichten. Seit Langem hatte sie ihn dazu gedrängt, das defizitäre Unternehmen abzustoßen. Sie wird erleichtert sein.
Während Valerio Alfieri die Leinen löst, den Bug des Boots in die Lagune dreht und den Kragen seiner schweren Lederjacke hochschlägt, sind seine Gedanken schon wieder bei den Gemüsebeeten und den Anweisungen für die afrikanischen Arbeiter, denen er freie Kost und Logis sowie ein Salär bietet, bis ihre Asylanträge bearbeitet sind. Kaum einer bleibt allerdings länger als ein paar Wochen.
Kühltransporter einer Biosupermarktkette warten jeden Morgen an der Mole auf die kommissionierte Tagesernte, und ein Restaurant am Fischereikanal, das nur mit lokalen Produkten kocht, ist der zweitwichtigste Kunde. Die nicht abgesetzte Ware geht kostenlos an ein Altersheim und zwei Kindergärten. Doch obwohl Stadtverwaltung und Handelskammer seine Großzügigkeit Jahr für Jahr als beispielhaft erwähnen, fühlt Alfieri sich immer wieder unüberwindbar benachteiligt: Reicht er eine Baugenehmigung für die Erweiterung seines Wohnhauses ein oder für eine neue Lagerhalle, lässt man ihn mit Hinweis auf die Bürokratie freundlich abblitzen. Feride behauptet, es sei der Neid. Wenn er wenigstens eine Frau aus Grado geheiratet hätte anstatt einer Deutschtürkin, würde er selbst noch das hässlichste Projekt genehmigt bekommen.
Die Niederschläge und die überdurchschnittlich kühlen Temperaturen der ersten Maiwochen haben das Land auf der kaum drei Meter über den Meeresspiegel ragenden Insel mit ihrem artesischen Brunnen in einen Sumpf verwandelt. Doch die Wettervorhersagen machen Hoffnung auf rasche Besserung. Sobald die Sonne die Wolken durchbricht, werden die Pflanzen schneller sprießen, als das Auge es erfassen kann. Noch ist die Farbe des Meers metallisch grau, aber die Bora treibt bereits die ersten Böen über das Wasser und reißt die schwere Wolkenschicht auf, die erste Stücke des blauen Himmels freigibt.
Grado, Isola della Schiusa. Kommissariat.
Die Telefonnummer auf dem Zettel. Xenia wundert sich, dass Jordan S. Becker sich schon so früh gemeldet hatte. Hat er etwa über einen der Kanäle, auf die er bei seinen heiklen Recherchen zurückgreift, bereits von der Landung der Flüchtlinge in Grado gehört? Für Xenia ist Becker einer der letzten unbestechlichen Rechercheure. Wenn er sich einmal in ein Thema verbissen hat, scheut er keinen Aufwand. Vor allem verfügt er über einen Vorteil, um den Staatsanwälte und Polizisten ihn nur beneiden können: Er kann ohne bürokratische Hürden auf sein internationales Netzwerk von Informanten und Kollegen zurückgreifen und muss dabei keine nationalen Gesetze beachten. Und er vermag Menschen dazu zu bringen, mit ihm zu reden, selbst wenn sie auf der Anklagebank sitzen oder dort landen könnten. Allerdings hat er sich mit seiner Berichterstattung oft genug Ärger eingehandelt. Nur ein Thema hat er in den vergangenen Jahrzehnten konsequent beibehalten: Xenia. Abgesehen von der Rekapitulation der Erdbebennacht von 1976 und den Umständen ihrer Geburt, gibt er darin einen Abriss ihres rasanten Aufstiegs innerhalb des Polizeiapparats sowie einiger größerer Fälle, die im Süden des Landes unter ihrer Führung aufgeklärt wurden. Und plötzlich die Versetzung in den Nordosten.
Strafe oder Strategie? War Hauptkommissarin Xenia Zannier zu unbequem? Soll sie jetzt in einem gemächlichen Adria-Seebad ausgetrocknet werden? Auszuschließen ist das nicht. Genauso wenig wie eine Strategie, die nicht bekannt werden soll.
Becker nimmt nach dem dritten Klingeln ab. »Gut, dich zu hören, Xenia. Ich habe allerdings nicht viel Zeit. Ich habe gleich einen Termin beim Leiter der Sonderkommission Middle European Credit Bank.«
Vor Jahren hatte Becker sich wie ein Pitbull in die Machenschaften eines österreichischen Finanzinstituts verbissen. Die MEC war bereits Anfang der Neunziger tief in kriminelle Geschäfte während des Umbruchs auf dem Balkan verstrickt und wurde schließlich von der BavariaFinance Group in München übernommen. Seines Erachtens ein vergeblicher Vertuschungsversuch mafioser Machenschaften, von Betrug, Geldwäsche und Bereicherung – das bis dahin größte Wirtschaftsverbrechen im Europa der Nachkriegszeit. Die Politik in der Alpenrepublik versuche mit aller Kraft, Ermittlungen im Ansatz zu ersticken. Immer wieder fiele ihm als Journalisten der Teil der Aufklärung zu, der eigentlich von der Exekutive geleistet werden müsste.
»Bist du noch dran?«
Xenia hebt die Brauen. »Gibt’s etwa Neuigkeiten?«
»Mir wurde Material zugespielt, das belegt, dass die BavariaFinance bereits vor der Übernahme das gesamte Ausmaß des Desasters kannte. Die Deutschen klagen jetzt auf Schadensersatz, dabei kannten sie den Umfang der Spekulationsgeschäfte genau. Sogar der Rückkauf durch einige Altaktionäre war vereinbart, bei dem allerdings nur noch ein Bruchteil des Preises anfallen und der Rest dem Steuerzahler aufgehalst werden sollte. Milde gerechnet zwanzig Milliarden. Mir fehlt nur noch das juristische Bindeglied, um die Sache wasserdicht zu machen. Dann kann ich damit an die Öffentlichkeit. Ich versuche, einen Deal mit dem Staatsanwalt auszuhandeln. Eine Hand wäscht die andere. Deine Freundin, die Senatorin, könnte das um Kopf und Kragen bringen.«
»Gratuliere. Wie ich dich kenne, kriegst du das auch noch hin.«
»Deswegen habe ich dich angerufen. Wir müssen uns sehen. Ich fühle mich nicht mehr sicher. Vor fünf Wochen wurde ich am helllichten Tag zusammengeschlagen. Inmitten einer Horde japanischer Touristen. Oder Chinesen. Und vor drei Wochen wurde mein Büro durchsucht, der Computer zerstört und Akten gestohlen. Das entscheidende Material haben sie aber nicht gefunden. Wenn es dumm läuft, geht es das nächste Mal schief.«
»Warum? Du hast doch beste Kontakte. Du musst das mit einem Ermittler besprechen, dem du vertraust und der mit dir an einem Strang zieht.«
»Den gibt’s in ganz Österreich nicht, Xenia. Vergiss es. Außerdem müsste ich Dinge erklären, die ich selbst erst in jahrelanger Arbeit begriffen habe. Meine einzige Sicherheit ist, eine Kopie der Recherchen an einem sicheren Ort zu deponieren.«
»Verstehe. Aber das sind keine Dinge, die man am Telefon bespricht.« Xenia zieht noch einmal an ihrer Zigarette und drückt sie aus. Immer wieder hatte sie ihn ermahnt, sich bei ihren Gesprächen bedeckt zu halten und verschlüsselt einen Treffpunkt zu vereinbaren, an dem sie unter vier Augen miteinander reden konnten. Von Salzburg nach Grado ist es nicht so weit, dass man sich nicht auf halbem Weg in den Bergen verabreden könnte.
»Übrigens läuft da noch etwas anderes«, fährt Becker fort. »Einige der Drahtzieher kennst du. Auch die Senatorin hat mit der Übernahme einer Chemiefabrik in Torviscosa zu tun.«
»Das steht sogar in der Zeitung.«
»Aber dass der deutsche Auslandsgeheimdienst die Regie führt, wohl kaum. Außerdem saß diese Frau lange im Aufsichtsrat der MEC. Vielleicht hilft dir das. Ich muss jetzt los, sonst platzt mein Termin mit dem Staatsanwalt.«
»Ich komme nach Salzburg, Jordan. Dann bereden wir alles.«
»Ich melde mich später.«
Noch während sie auflegt, steht Donadoni in der Tür. Sein dicker Bauch ragt aus der offenen Uniformjacke hervor, das Hemd spannt an den Knöpfen, den Gürtel seiner Hose hat er gelockert, der Reißverschluss steht halb offen. Die Kommissarin wirft ihm einen wütenden Blick zu.
»Die Nervensäge von der Küstenwache hat schon zweimal angerufen, während Sie am plaudern waren.« Er schnieft.
»Gib mir seine Nummer.«
»Ich habe sie nicht aufgeschrieben. Ich dachte, die haben Sie.« Der Uniformierte wendet sich zum Gehen.
»Du siehst aus wie ein abgehalfteter Penner, Berto. Wie heißt der Mann?«
»Ich frage nie nach, Commissario. Das ist unhöflich.«
»Verschwinde und richte deine Uniform.« Xenia wählt die Nummer der Küstenwache und wird durchgestellt.
Die Angaben des Offiziers sind präzise wie ein Navigationsbefehl: Im Morgengrauen machte im nahen Hafen von Porto Nogaro um viertel nach fünf die EARLY SUN fest. Ein kleines Frachtschiff, 1977 in einer japanischen Werft gebaut. Registriert im Russian Maritime Register, fährt es unter panamaischer Flagge. Der Eigner sitzt in Tripoli im Libanon. Die Ladung besteht aus Flachstahl, den es im südtürkischen Hafen İskenderun nahe der syrischen Grenze geladen hat. Dort hat es wohl auch die Flüchtlinge an Bord genommen. Der türkische Kapitän wurde festgenommen, das Schiff ist beschlagnahmt. Auch die Besatzung ist in Gewahrsam, man wartet auf einen amtlichen Übersetzer. Beamte der Küstenwache und Kriminaltechniker krempeln den Kahn um. Es war ein Leichtes gewesen, ihn zu finden. Dem Radar der Behörden, der Satellitenüberwachung und den Funkmeldungen entkommt niemand. In Porto Nogaro, einem in Meeresnähe gelegenen Flusshafen, legen nur wenige und kleine Schiffe an. Die Kratzspuren am Bug der Rettungsboote entsprechen dem Farbton der Lackspuren an der Mole der Spiaggia principale.
Berlin, Platz der Republik. Bundeskanzleramt.
Trotz der Sonne wurde die Maschine beim Anflug so heftig durchgeschüttelt, dass zwei Manager in seiner Sitzreihe sich mit blassen Gesichtern an die Sitzlehnen krallten, bis sich die Knöchel ihrer Hände weiß unter der Haut abbildeten. Bernd Körber ist Turbulenzen gewohnt, seit er Teil des Auslandsgeheimdienstes wurde.
Er gähnt, ohne die Hand vor den Mund zu halten, sein Blick schweift aus dem Fenster der Limousine. Er gibt Anweisung, am Spandauer Schifffahrtskanal entlangzufahren. Als versuche er zwanghaft, seinen Widerwillen gegen die Hauptstadt aufzufrischen, besteht Körber bei jeder Dienstreise nach Berlin auf der alten Strecke und betrachtet aus dem Fond der Limousine die Tristesse bedeutungsloser Kleinbetriebe, Blechlawinen in den Höfen osteuropäischer Gebrauchtwagenhändler, Lagerhallen von Kleinspediteuren und Low-Cost-Autovermieter. Die Sonne steht hier zu dieser Jahreszeit am frühen Morgen zwar höher als im Süden, doch die wenigen Blätter an den Bäumen vermögen die Trostlosigkeit der Randbezirke Berlins nicht zu verhüllen. Der späte Frühlingseinbruch ist für Körber schon Grund genug, sich dem Umzug der Behörde zu verweigern. Und der Gedanke, irgendwann über den neuen Großflughafen reisen zu müssen, widert ihn an – sollte er jemals fertiggestellt werden.
In Pullach kennt man sich, trifft sich nach Feierabend unter Kollegen zum Bier. Im alteingesessenen Behördendomizil wird den Dienstältesten Respekt gezollt. Schon die Patina der einst von den Nazis erbauten Siedlung strahlt aus, dass Neuerungen nur zäh durchzusetzen sind. In der Hauptstadt hingegen errichtete man die neue Zentrale ausgerechnet in der Chausseestraße, unweit des Brecht-Hauses und der früheren Wohnung des kommunistischen Liedermachers Wolf Biermann. Ein von uneinsehbaren Mauern umgebener Komplex mit vierzehntausend Fenstern. Hier laufen für Körbers Geschmack zu viele junge Schnösel herum, die keinen Arsch auslassen, um in ihn reinzukriechen. Und die ständig auf seine Narbe oberhalb der linken Augenbraue starren.
Heute muss er sie wieder ertragen. Zuerst Kanzleramtsminister von Menzig und dann Weißenfels, seinen designierten Nachfolger. Ein beißwütiger Bundeswehrhengst im Majorsrang, den der Minister wegen seines Parteibuchs durchgesetzt hat. Zu den wenigen Prinzipien, zu denen Körber sich hingegen bekennt, zählen Standfestigkeit, Sachkenntnis und immer einen Schritt weiter zu sein als der Gegner. Ideologien und Parteibücher perlen an ihm ab wie an einem Ölmantel. Bernd Körber brachte es in seiner vierzigjährigen Laufbahn weit und firmiert seit zwei Jahrzehnten als Direktor der Expertengruppe Südosteuropa der Abteilung EA des Bundesnachrichtendienstes, Einsatzgebiete/Auslandsbeziehungen. Schwerpunkt Balkan. Mit Österreich, aber ohne Bayern, wie er früher scherzte. Und er ist meist selbst vor Ort, um die Dinge zu regeln. Er hält nichts davon, im Büro zu sitzen und zu delegieren.
Wieder gähnt der klein gewachsene Mann mit den geröteten Wangen und den geplatzten Äderchen auf der Nase. Er putzt die großen Brillengläser und wirft einen flüchtigen Blick auf die Armbanduhr, als sich der Wagen dem Platz der Republik nähert. Kurz nach acht, er kommt verspätet, doch einen früheren Flug von München gibt es nicht.
»Ich hoffe, Sie haben einen Mantel dabei, Herr Direktor«, sagt der Chauffeur, während er die Tür aufhält und auf eine dunkle Wolke im Osten zeigt. »Es ist ein abrupter Wetterumschwung angekündigt.«
»Wie jedes Mal, wenn ich in die Hauptstadt komme. Und in München sitzen schon alle im Biergarten.«
Drei Lesebrillen liegen auf dem Konferenztisch des Bundesministers im Kanzleramt. Eine auf einem Stapel Unterlagen, eine weitere sitzt auf seiner Nase.
»Jeder plant für sich allein. Doch ab und zu jemandem einen Gefallen zu tun heißt auch, selbst einen erwarten zu dürfen, wenn es nötig ist.« Dr. Hartlieb von Menzig tippt auf ein Blatt Papier. »Der Nahe Osten ist seit der Irak-Affäre offiziell natürlich nicht mehr unser direktes Operationsgebiet, Herr Direktor. Nur die Fregatte SACHSEN und das Flottendienstboot OKER bleiben vor der syrischen Küste im Einsatz. Ansonsten stützen wir uns auf die Auswertungen unserer Verbündeten.«
Die Stimme des Ministers ist klar wie Morgenluft, er nimmt die Brille ab und wirft sie auf den Tisch. Der Ausdruck seiner graugrünen Augen ist wie immer heiter und täuscht über den Gemütszustand Menzigs hinweg.
»Die Türkei und Israel genügen uns als Basis. Aber unsere Verbindungen auf dem Balkan sind ein Ass im Ärmel, um das uns unsere Alliierten noch immer beneiden.« Hartlieb von Menzig lehnt lässig in seinem Stuhl. Nichts in seinem Gesicht verrät, was er von seinem Gegenüber hält.
»Sie können es nicht wissen, Herr Minister, aber heute ist der fünfzehnte Todestag meiner Frau. Nach Berlin zu kommen fiel mir nicht leicht, reden wir also bitte nicht um den heißen Brei herum. Sie haben mich nicht ohne Grund einbestellt.«
»Nachträglich mein Beileid, Herr Körber. Sie haben sie sicher sehr geliebt.« Von Menzig blinzelt kurz und schnappt sich eine seiner Brillen, bevor er zur Sache kommt. »Die demokratische syrische Opposition braucht schleunigst mehr Unterstützung vom Westen, bevor die fundamentalistischen Terroristen die Situation endgültig zu ihren Gunsten wenden können. Und dass es denen nicht an Nachschub fehlt, wissen Sie. Wir haben in Kroatien noch immer riesige Waffenbestände, die während der Bosnienoffensive nicht gebraucht wurden.« Der Blick des Ministers bleibt auf Körbers Narbe stehen. Das Souvenir vom Hindukusch an seiner Stirn hatte er sich 1982 durch einen Streifschuss an der pakistanisch-afghanischen Grenze gefangen. In einer streng geheimen Aktion musste er von den Mudschaheddin erbeutetes russisches Kriegsgerät übernehmen, damit es in Deutschland analysiert werden konnte, um Einblick in die Waffentechnik der Sowjets zu bekommen.
»Und das soll wie immer der alte Körber erledigen«, kommentiert Körber trocken. Er hatte einst die Lieferung von Dual-Use-Produkten in den Irak, nach Syrien und Libyen organisiert, und auch für Raketenlieferungen in den Sudan hatte man seine Erfahrung gebraucht. »Wissen Sie eigentlich, Herr Minister, wann Deutschland seinen ersten Giftgasexport getätigt hat? 1916 an die Österreicher zur Isonzofront, weil die den Italienern sonst nicht mehr standgehalten hätten.« Seit dem Tod seiner Frau hat Bernd Körber nichts mehr zu verlieren. Seine rot geränderten Augen starren den Vertrauten der Kanzlerin ausdruckslos an.
»Wie immer polemisch, Körber. Wer Sie nicht kennt, würde sofort die Loyalitätsfrage stellen. Alle Welt weiß doch, dass die Italiener uns zuerst verraten haben und dann nur dank des Beistands ihrer Alliierten zu Siegern wurden.« Wieder der strahlende Blick Menzigs, der schon viele getäuscht hat. Er greift nach dem dünnen Stapel Papier auf dem Tisch.
»Wissen ist hilfreich. Aber man muss es interpretieren können. Zwei Probleme stellen sich bei dieser Waffenlieferung.« Körbers Hände verharren reglos auf der Tischplatte. Die Ärmel seines Jacketts werfen grobe Falten an den dünnen Armen. Das aufgedruckte Muster seiner gelben Krawatte passt nicht zu seinem blassblauen Hemd: Tennisschläger. Maja hatte ihm damals so eine geschenkt, seither kauft er sie immer wieder nach. »Seit unsere kroatischen Freunde Mitglied der Europäischen Union und auch der NATO wurden, ist der Preis unverhältnismäßig gestiegen. Der Spielraum ist enger geworden. Meldepflichten gegenüber Brüssel, Kontrollen, Transparenz. Und die politische Opposition versucht sich jetzt kleinlich für die Vergangenheit zu rächen, Herr Minister. Dazu die Staatsanwälte und der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag. Selbst in Kroatien sind die Möglichkeiten nicht mehr die gleichen wie damals, als Sie noch nicht in der Politik waren.«
Der Minister übergeht den Seitenhieb. »Lieber Körber, auf den Schlüsselpositionen sitzen meist noch die richtigen Leute. Und Sie kennen sie besser als jeder andere. Es führt kein Weg daran vorbei. Der Flüchtlingsdruck auf Europa nimmt gefährliche Dimensionen an. Die in Syrien verfolgten Christen könnten wir gerade noch aufnehmen, aber all die anderen sorgen für Angst in der Bevölkerung. Das Boot ist voll. Und Sie müssen mit diesem Einsatz das Leck stopfen.«
»Natürlich kenne ich Wege, die Sache durchzuziehen, aber …«
»Nutzen Sie Ihre Kontakte, denken Sie an Ihre Abschiedsprämie.« Die Lesebrille schaukelt an einem Bügel zwischen den Fingern des Ministers. »Die Analyse der Amerikaner belegt, dass Syrien noch nicht überwiegend von fundamentalistischem Terror durchsetzt ist. Wir müssen kooperieren, um Schaden von der Bundesrepublik fernzuhalten und um dem Flüchtlingsdruck Herr zu werden. Alle wollen zu uns.«
»Es ist eine Frage des Preises.«
»Die Amerikaner und die Briten haben sich mit dem Plazet der Franzosen zu dieser Lieferung entschieden. Die Bundesrepublik stellt lediglich ihre Kontakte zur Verfügung. Durch Sie, Körber.« Von Menzig wedelt mit den Blättern, er zieht die Brille aus der Brusttasche. »Überbestände aus dem Bosnienkrieg. Sie stehen in kroatischen Armeedepots bereit. Granatwerfer Milkor MGL/RGB-6, Panzerabwehrkanonen vom Typ M60 und anderes. Das ist Ihre Liste. Sie regeln die Verschiffung. Die Chefin hat die Sache abgenickt.«
Menzig wirft die Papiere auf den Tisch, richtet sich auf und steckt demonstrativ den Montblanc in die Innentasche seines Jacketts, als wolle Körber ihn stibitzen.
»Die Zeit drängt.« Er erhebt sich und überragt den Mann aus Pullach um mehr als einen Kopf. »Sie informieren niemand anderen als mich. Auch nicht beim BND. Offiziell reisen Sie in meinem Auftrag, um ein paar symbolische Orte wegen eines möglichen Staatsbesuchs der Kanzlerin zu sondieren: Zagreb, Rijeka, die ehemaligen kroatischen KZs Loborgrad und Jasenovac sowie die Kroatiendeutschen zwischen Vukovar und Osijek.« Wieder starrt von Menzig auf seine Narbe.
»Durchaus glaubwürdig, das gebe ich zu.«
Sobald in der Behörde die Sprache auf die ehemaligen Konzentrationslager kommt, wird niemand weiter nachfragen. Schadenfreude oder Mitleid wird er aus den Gesichtern der Kollegen lesen können, dass ausgerechnet er eine solche Mission übernehmen muss, die ein Anfänger erledigen könnte. Der Beginn des Abstiegs.
»Und um Ihnen den Rücken freizuhalten, kümmert sich so lange Major Weißenfels um die Amtsgeschäfte. Vor allem um die Koordination mit den Italienern wegen der Friedensfeier der Regierungschefs zum Hundertjährigen des Giftgaskriegs an der Isonzofront. Sie rückt immer näher, übergeben Sie ihm die Liste Ihrer Kontakte und bringen Sie ihn auf den aktuellen Stand.«
Ein Tiefschlag. Das ist seit Jahrzehnten Körbers ureigene Domäne. Seine Entmachtung hat also bereits begonnen. Er schluckt trocken und hebt fragend die Brauen. Der Umgang mit den Kollegen in Rom verlangt Fingerspitzengefühl, das er seinem Nachfolger nicht zutraut.
»Die Friedensfeier ist ein Appell für die Stabilität in Europa und die gemeinsame Ächtung von Chemiewaffen ein Zeichen für die Zukunft. Und Sie, Körber, müssen zu allem ja auch die Übernahme von diesem Chemiebetrieb in Torviscosa durchziehen. Die Senatorin, die das Geschäft auf italienischer Seite garantieren soll, ist uns doch hoffentlich noch gewogen.«
»Es ist nur eine Frage von Tagen, bis die Verträge unterzeichnet werden können. Senatorin Castelli de Poltieri will lediglich die Garantie dafür, dass sie im Rahmen der Friedensfeier mit der Kanzlerin zusammentrifft. Könnten Sie das ins Protokoll setzen? Davon hängt alles ab.«
»Diese Produktionsstätte ist wichtig für uns«, unterbricht von Menzig harsch. »Wegen der Waffenexportkontrollen verlagern unsere Konzerne die Produktion ins Ausland. SIG Sauer will in den USA produzieren, und Heckler & Koch muss über ausländische Niederlassungen liefern. Wenn die MainChemie die ChimiCo übernimmt, können wir unser Know-how in der Produktion von Dual-Use-Produkten profitabel in Italien einbringen, ohne dass die Medien Wind davon bekommen. Außerdem sichert es Arbeitsplätze.«
Körber fragt sich, ob Menzig abschweift, um ihn abzulenken. »Die Senatorin wird uns nicht in den Rücken fallen, Herr Minister, solange Sie ihre Unterredung mit der Kanzlerin garantieren. Ohne sie kann der Mehrheitseigner die Firma nicht verkaufen. Diese Frau mischt auch bei der Planung der Friedensfeier in Redipuglia mit. Ich kenne sie seit über zwanzig Jahren, wir müssen uns an die Absprachen halten. Sonst wird sie stur wie ein Esel. Es ist besser, alles in einer Hand zu wissen.«
»Es ist unmöglich, dass Sie das alles gleichzeitig schaffen, Herr Direktor. Es bleibt dabei, die Sache mit der Zeremonie liegt bei Major Weißenfels. Das Zusammentreffen der Senatorin mit der Chefin wird er in Absprache mit mir arrangieren. Sie haben mein Wort. Habe ich mich klar genug ausgedrückt?«
»Immer vorausgesetzt, dass nichts Unvorhergesehenes dazwischenkommt, Herr Minister.« Wieder einmal muss Körber die Drecksarbeit übernehmen, deren Ergebnisse beim nächsten internen Jahresbericht seinem Nachfolger gutgeschrieben werden, der dafür keinen Finger zu regen braucht. »Sind Sie sicher, dass bei Ihnen alle dichthalten, Herr von Menzig?«
Der Minister fährt hoch und wirft seine Brille auf den Tisch, doch Körber fährt unbeirrt fort.
»Wir überwachen seit Monaten einen dieser Schmierfinken, der sich durch nichts abschrecken lässt. Ein Jordan S. Becker, Journalist in Salzburg. Er weiß bereits über die Sache mit der ChimiCo Bescheid. Das ist an sich nichts Schlimmes. Allerdings kennt er sich bei der Übernahme der MEC Bank fast besser aus als alle, die damals beteiligt waren. Seine Artikel haben bisher viel Staub aufgewirbelt.«
»Dann regeln Sie das. Das kann doch nicht schwierig sein. Es bleibt dabei, Sie verantworten die reibungslose Übernahme der ChimiCo durch MainChemie. Und Weißenfels die Zeremonie. Basta.« Nach dem Machtwort lockert sich von Menzig wieder. »Wie lange brauchen Sie?«
»Geben Sie mir einen Monat.«
»Nicht einmal zwei Wochen, Körber. Denken Sie an den Flüchtlingsdruck.«
Ein unergründbares Lächeln umspielt Körbers Mundwinkel, als der um fast zwanzig Jahre jüngere Menzig ihm zum Abschied viel Erfolg wünscht. Die Zeit bestimmt immer noch er, da können die da oben machen, was sie wollen. Und auch von Weißenfels wird er sich nicht ins Handwerk pfuschen lassen.
Kurz vor 9 Uhr verlässt Bernd Körber zielstrebig dieses Symbol der wiedervereinigten Republik. Vergeblich hält er Ausschau nach seinem Wagen und greift verärgert zum Telefon. Sein Chauffeur antwortet erst nach langem Klingeln, während Körber bereits auf den kahlen Platz der Republik hinaustritt. Schwere schwarze Wolken schieben sich über den Himmel, als würde Körber seinem Gemüt freien Lauf lassen. Der Sonnenschein über Berlin dauerte nur kurz. Er weist seinen Fahrer an, vor dem Reichstag auf ihn zu warten. Wie ein einsamer müder Wanderer überquert der kleine Mann die Wiese. Die gelbe Krawatte flattert über seine Schulter.
»Chausseestraße, BND«, knurrt er schließlich und lässt sich auf die Polster des schwarzen Mercedes fallen.
Das Gespräch mit dem Minister hat ihm zugesetzt. Wie immer, wenn ihn die Aussichtslosigkeit seines Lebens nach dem Ausscheiden aus dem Dienst überwältigt, sehnt er sich zurück in die Zeiten seiner großen Triumphe. Afghanistan. Jugoslawien. Kroatien.
März 1990. Zagreb, Stadion Maksimir.
Seit einer Woche hängt eine schwere Wolkenschicht über der Stadt. Nieselregen bei unwirtlichen Temperaturen schränkt das städtische Leben noch stärker ein als der Unwille der Kroaten, angesichts der aufgeheizten Stimmung in der Volksrepublik ihre Arbeitsplätze bei den jugoslawischen Kollektivbetrieben aufzusuchen.
Punkt 8 Uhr verlassen fünf Fahrzeuge das Flughafengelände und biegen in enger Kolonne auf die Hauptverkehrsader Richtung Zentrum ein. Ein silbergrauer Mercedes 300 an der Spitze, dahinter drei weiße Kleintransporter, gefolgt von einem gepanzerten 500 E mit Diplomatenkennzeichen und getönten Scheiben. Rasch durchqueren die Fahrzeuge die breiten Straßen der Unterstadt, doch auf der Maksimirska cesta kommt Nervosität unter den Männern im vordersten Auto auf. Ein Kastenwagen ist in die alte Straßenbahn verkeilt, die Ladung liegt über beide Fahrbahnen verstreut, die Fahrer beschimpfen sich wüst. Hektische Rangiermanöver über den Bürgersteig, dann brausen die Fahrzeuge in Richtung Maksimir-Park, wo sie in der Durchfahrt neben der Haupttribüne des Fußballstadions von Dinamo Zagreb verschwinden, um direkt vor dem Eingang zu den Mannschaftsräumen zu stoppen. Zehn durchtrainierte, bis an die Zähne bewaffnete Männer mit schusssicheren Westen über den Kampfanzügen der GSG 9 entsteigen vor Körber den Fahrzeugen, observieren das Spielfeld mit dem wintermüden Rasen und die leeren Sitzreihen der Tribüne, dann bauen sie sich vor den Lieferwagen auf.