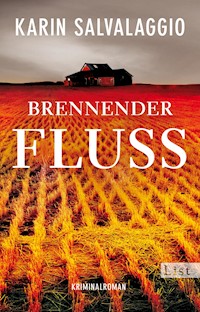
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein Ebooks in Ullstein Buchverlage
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Flathead Valley, Montana: Das nur spärlich besiedelte Tal wird von einer Hitzewelle heimgesucht. Ein Brandstifter bringt die Bewohner in große Gefahr, die Feuerwehr kämpft vergeblich gegen die Flammen an. Dann wird ein toter Soldat gefunden. Die Polizei bittet Detective Macy Greeley um Hilfe. Sie muss gegen das Schweigen der eingeschworenen Gemeinschaft ankommen, die Probleme lieber unter sich löst. Jeder weiß etwas, doch niemand spricht darüber. Zu allem Überfluss taucht auch noch Ray Davidson auf – zugleich Macys Chef und der Vater ihres kleinen Sohnes. Dann wird eine weitere Leiche gefunden. Bald ist nicht nur Macys Karriere, sondern auch ihr Leben in großer Gefahr ... Der spektakuläre neue Fall für Ermittlerin Macy Greeley.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Das Buch
Detective Macy Greeley wohnt mit ihrem kleinen Sohn wieder bei ihrer Mutter. Nur so kann sie als Alleinerziehende ihren Beruf bewältigen. Ray Davidson, der Vater ihres Sohns und zu allem Überfluss Macys Chef, lässt sich nie blicken. Obwohl Macy weiß, dass Ray bei seiner Frau bleiben wird, kann sie sich nicht von ihm lösen, so unglücklich sie auch ist.
Daher ist es ihr ganz recht, dass sie ins Flathead Valley gerufen wird. Eine Hitzewelle hat das Tal im spärlich besiedelten Montana erfasst, und ein Brandstifter terrorisiert die Farmer. Als ein ehemaliger Soldat tot aufgefunden wird, soll Macy der örtlichen Polizei weiterhelfen. Die Bewohner des Tals, sonst Fremden gegenüber misstrauisch und verschlossen, freunden sich langsam mit Macy an. Doch plötzlich taucht Ray auf und bedrängt sie. Macy muss feststellen, dass er tiefer in die Ereignisse verstrickt ist, als sie es sich je hätte vorstellen können …
Die Autorin
KARIN SALVALAGGIO wurde in den USA geboren und ist in Alaska, Florida, Kalifornien und im Iran aufgewachsen. Seit zwanzig Jahren lebt und schreibt sie in London. Sie hat zwei Kinder und einen Schnauzer namens Seamus. Brennender Fluss ist der zweite Band der erfolgreichen Krimiserie um Ermittlerin Macy Greeley.
Weitere Informationen finden Sie auf www.karinsalvalaggio.com
Karin Salvalaggio
Brennender Fluss
Kriminalroman
Aus dem Englischen von Sophie Zeitz
Marion von Schröder
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein-buchverlage.de
Wir wählen unsere Bücher sorgfältig aus, lektorieren sie gründlich mit Autoren und Übersetzern und produzieren sie in bester Qualität.
Hinweis zu Urheberrechten
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten.Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Widergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem Buch befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Die amerikanische Originalausgabe erschien 2015unter dem Titel Burnt Riverbei Minotaur Books, New York
ISBN: 978-3-8437-1161-6
© 2015 by Karin Salvalaggio© der deutschsprachigen AusgabeUllstein Buchverlage GmbH, Berlin 2015Umschlaggestaltung: Cornelia Niere, MünchenUmschlagabbildung: © Acker: Corbis / Farm: Shutterstock
E-Book: Pinkuin Satz und Datentechnik, Berlin
Alle Rechte vorbehalten
Zwischen dem Wunsch und der Sache wartet die Welt.
Cormac McCarthy, All die schönen Pferde
Die Frau fiel am Fuß einer hohen Kiefer auf die Knie und betete zum dritten Mal an diesem Tag. Der Rauch war so dicht, dass sie kaum Luft bekam. Sie blinzelte, suchte nach einem Durchkommen, aber da war nichts, was irgendwie nach einem Weg aussah. Der Wald brannte lichterloh, spiralförmige Flammen loderten empor, und das Laubdach explodierte. Das Kreischen der berstenden Bäume schmerzte in ihren Ohren. Sie hielt sich den Ärmel vors Gesicht, rappelte sich auf und lief auf die einzige Lücke zu, die sie erkennen konnte. Glühende Asche versengte ihr Haar und ihre Kleider. Ihre Augen brannten, ihre Haut schlug Blasen. Gestrüpp zerkratzte ihre nackten Beine. Sie folgte einem schmalen Pfad, der auf einer Klippe endete. Tief unten lag das felsige Flussbett; im Osten blitzte blauer Himmel auf. Sie hielt sich an den nackten Baumwurzeln fest und kletterte über die Kante. Ihre linke Schulter pochte, und ihre Hände waren nass von Schweiß und Blut. Auf halber Höhe rutschte sie ab. Sie stürzte und prallte gegen spitze Felsvorsprünge. Als sie wieder erwachte, lag sie im seichten Wasser, die Augen geschlossen, aber sie atmete noch. Langsam nahm die Welt wieder Formen an. Sie hörte, wie das Wasser über die Felsen plätscherte. Dann schlug sie die Augen auf. Das Stück blauer Himmel war verschwunden. Der schwarze Rauch wurde immer dichter. Das Feuer verzehrte alles, was ihm in den Weg kam. Flammen schlugen über den schmalen Canyon. Am Ufer loderten die Pappeln auf, und die Waldblumen welkten und zerfielen zu Staub. Ihre Arme und Beine lagen reglos unter der Wasseroberfläche. Ihre Hilfeschreie wurden vom Feuer verschluckt.
Kapitel 1
Die Sonne kletterte über die Hügel und umriss die östlichen Hänge des breiten Tals. Granitblöcke, so groß wie Häuser, leuchteten gespenstisch weiß auf, und über den Kiefernwäldern stieg Dampf auf. Im Schatten schimmerte der Flathead River wie ein silbriges Band, schmal, wo er breit sein sollte, ein Rinnsal, wo sonst ein Strom war. Es war Ende Juli, und die Hitzewelle nahm einfach kein Ende. Ein ätzender Dunst verschleierte den weiten Himmel, und weiter oben im Tal stiegen die Rauchschwaden über dem jüngsten Waldbrand fast einhundert Meter hoch in die Luft.
Dylan Reed ritt auf seiner Fuchsstute in leichtem Trab den Uferweg hinauf. Bei jedem Ruckeln verzog er das Gesicht. Er hielt die Zügel mit einer Hand, mit der anderen massierte er sich den Oberschenkel. Vor sechs Monaten war er in Afghanistan bei einer Razzia verwundet worden. Er wusste, dass er Glück gehabt hatte. Um Haaresbreite wäre er in einer Kiste zurückgekommen. Er schob seinen Hut zurück und richtete den Blick auf die Böschung. Bis zu den Klippen am Nordufer des Darby Lake war es noch ein halbstündiger Ritt. Über sich hörte er das monotone Brummen einer zweistrahligen Maschine. Der See diente den Löschflugzeugen als Tankstelle. Sie zogen Schleifen über dem Tal, dann glitten sie über das Wasser, um ihre Tanks zu befüllen. Schon den ganzen Sommer waren sie ununterbrochen in der Luft. Dylan trieb seine Stute zu mehr Tempo an.
Die Route 93 lag noch in der stillen Kühle des Morgens, doch über ihm surrten die Hochspannungskabel. Er ritt auf die wuchtige Stahlbrücke zu, die den Flathead River überspannte. Die Hufe schlugen auf den Asphalt und schreckten die Stare auf, die in den Brückenbögen nisteten. Der Vogelschwarm erhob sich mit einem Rauschen, dann tauchte er zwischen den Metallstreben ab. Sie flogen tief über dem steinigen Flussufer, bevor sie weiter oben in einem Pappelhain verschwanden.
Ein rostiges, verbogenes Tor versperrte den Weg zu einem ehemaligen Aussichtspunkt. Seine Freunde John und Tyler wollten sich um sechs Uhr hier mit ihm treffen, doch von beiden gab es weit und breit keine Spur. Dylan führte sein Pferd in den Wald, um nach etwa zwanzig Metern auf den Weg zurückzukehren, dann folgte er den engen Serpentinen hinauf. Der Boden hatte tiefe Risse, und die trockenen goldenen Grasstellen erinnerten an Bartstoppeln. Weiter oben öffnete sich der Blick ins Tal. Noch lagen die flachen Hügel im Osten völlig im Schatten, doch Lichtsäulen zerschnitten den Nebel über dem Fluss. Durch die Bäume erkannte er das regelmäßige Straßennetz von Wilmington Creek. Ein Streifenwagen raste mit Blaulicht über die Route 93. Er verschwand am südlichen Ende in Wilmington Creek.
Nach der letzten Serpentine ritt Dylan auf die offene Kuppe des Steilhangs hinaus und näherte sich der Kante, bis das stille dunkle Wasser des Darby Lake vor ihm lag. Der Weg endete in einem unbefestigten Wendekreis, der einst als Parkplatz des Aussichtspunkts gedient hatte. In den Bäumen flatterten zerfetzte Plastiktüten, zwischen den Zwergkiefern und Felsbrocken sahen die Bierdosen und Whiskeyflaschen wie Wildblumen aus. Vor Jahren war das Geländer abgestürzt, als ein Erdbrocken von der Größe eines Omnibusses in den See gerutscht war. Seitdem standen überall Warnschilder herum. Das ganze Gebiet wurde als unsicher eingestuft. Knapp zehn Meter vor dem Klippenrand stieg Dylan ab, um sein Bein auszuruhen. Es war vom Knie bis zur Hüfte taub, doch der Schmerz würde bald wiederkommen. Er kramte seinen Feldstecher aus der Satteltasche. Tiefe Risse taten sich im felsigen Grund zwischen ihm und dem Klippenrand auf. Er tastete sich vorsichtig über die nackte Erde vor. An manchen Stellen konnte er durch die Spalten den See sehen. Er beugte sich über den Abhang, und Geröll prasselte mehr als zwanzig Meter in die Tiefe, wo blanke Felsen wie riesige Würfel am Nordufer lagen. Er streifte sich den Riemen des Feldstechers über den Kopf und betete, dass die Klippe hielt. Der Wasserstand war noch niedriger als beim letzten Mal. Er konnte die Umrisse auf dem Seegrund erkennen. Vor einer Gruppe von Felsen hob sich ein dunkles Rechteck ab. Es war nur eine Frage der Zeit, bis die Piloten der Löschflugzeuge Ethan Greens Pick-up entdeckten. Dylan legte seine Wange an die warme Erde und lauschte dem leisen Knistern der überhängenden Klippe. Ein Wolf heulte, und er richtete den Feldstecher auf das Ostufer des Sees. Es dauerte eine Weile, bis er das Rudel entdeckte. Ein paar Kilometer weiter kamen die Wölfe aus dem Kiefernwald und verteilten sich am Ufer. Insgesamt waren es sechs ausgewachsene Tiere und drei Welpen. Dylan beobachtete sie, bis sie wieder unter den Bäumen verschwanden.
Dann kehrte er auf sicheres Terrain zurück und setzte sich an einen Felsen gelehnt in die aufgehende Sonne. Er war erst gegen eins ins Bett gegangen und saß seit fünf Uhr auf dem Pferd. Ihm war flau im Magen, und sein Kopf tat weh. Aus Gewohnheit klopfte er sein Hemd nach Zigaretten ab, bis ihm wieder einfiel, dass er aufgehört hatte. Er schloss die Augen und wünschte, er hätte es auch geschafft, mit dem Trinken aufzuhören. Er spürte die Sonne auf seinen Lidern. Er lauschte den Geräuschen von fern und nah. Das Land erwachte im heller werdenden Licht. Es dauerte nicht lang, dann lief ein Schauer durch seinen Körper, und sein Kopf fiel nach vorne. Er atmete regelmäßig. Sein Brustkorb hob und senkte sich. Seine Beine zuckten, und die Stiefelabsätze kratzten im Sand, während er im Schlaf vor sich hin murmelte. Ein weiteres Flugzeug flog vorbei, und seine Lider flatterten kurz, dann schlossen sie sich wieder. Schließlich wurde sein Atem langsamer, die Beine kippten nach außen, eins angewinkelt, das andere steif.
Eine vertraute Stimme drang in seine Träume. »Wach auf, fauler Sack.«
Instinktiv griff Dylan nach dem Gewehr, das auf seinem Schoß hätte liegen müssen, und erschrak, als er es nicht fand. Er hob seine Hände hoch, aber im blendenden Licht konnte er nichts sehen. Ein Schatten trat zwischen ihn und die aufgehende Sonne, und blinzelnd erkannte er das Gesicht, das ihm seit der Kindheit vertraut war.
Tylers Mund verzog sich zu einem Grinsen. »Raus aus den Federn, du Penner.«
Dylan trat mit dem gesunden Bein nach ihm. »Tyler, das war echt scheiße, Mann.«
Tyler stand mit den Händen in den Hosentaschen da und beobachtete seinen Freund. Er war kleiner, aber doppelt so breit. Seine massigen Arme waren mit Tätowierungen und Brandnarben übersät. Sein kahler Schädel hatte so viele Granatsplitter abbekommen, dass er aussah wie ein gesprenkeltes Ei. Er hockte sich vor Dylan und zog an seiner Zigarette.
»Bei dir sollte ich mir meine Witze wohl lieber sparen.«
Dylan konnte das Zittern in seiner Stimme kaum verbergen. »Ja.« Er sah sich um. »Wo ist John?«
Noch ein Zug, gefolgt von einem festen Blick. »Ich hatte gehofft, er wäre bei dir.«
»Wahrscheinlich schläft er noch.« Dylan zog das Kinn an und verschränkte die Arme. Ihm war nicht kalt, aber er konnte das Zittern nicht abstellen. »Hast du gesehen, was ich mit dem Wasserstand gemeint habe?«
»Ja, wir haben ein Problem. Wie lange, schätzt du, haben wir noch?«
»Weniger als eine Woche, bevor man es aus der Luft sehen kann.« Er stand umständlich auf und zeigte zum Himmel. Ein Löschflugzeug kam genau auf sie zu. Es zog eine Schleife über dem Steilhang, bevor es zur Wasseroberfläche abtauchte. »Einer der Piloten könnte es melden.«
»Das glaube ich nicht. Ich schätze, es ist nicht der erste Truck, der im See gelandet ist. Er könnte seit Jahren da unten liegen.«
»Wir sollten kein Risiko eingehen.«
»Es soll bald regnen.«
»Das sagen sie seit Wochen.«
Tyler warf einen Stein in Richtung See. »Ich wusste, dass uns dieser Scheiß noch mal einholt.«
»Es war eine Reihe von falschen Entscheidungen.«
»Ich erinnere mich nicht, irgendwas entschieden zu haben.« Tyler zupfte sich einen Tabakkrümel von den Lippen, dann stellte er sich an den Klippenrand. Seine Stiefelspitzen ragten über den Abgrund hinaus. Kurz sah es aus, als wollte er springen. »John hat recht. Wir müssen den Rest der Klippe sprengen.« Er hüpfte ein paarmal auf und ab, als testete er, wie viel Gewicht der Vorsprung aushielt. »Ein paar gut platzierte Ladungen in den Spalten, und unser Problem ist für immer begraben.«
»Die Detonation hört man kilometerweit.«
»Na und? Die graben bestimmt nicht den ganzen See um.« Tyler schwieg einen Moment und sah dann zu Dylan. »Und dann ist da noch Jessie.«
»Was ist mit ihr?«
»Du musst mit ihr reden. Rausfinden, was sie sagt, falls uns das alles um die Ohren fliegt.«
»Jessie war blau in der Nacht. Sie hat keine Ahnung.«
Tyler kam auf Dylan zu, bis ihre Nasen fast zusammenstießen. »Das hab ich ihr nie abgekauft. Ich glaube, sie hat Spielchen gespielt. Sie wusste, wie ihr Vater reagiert hätte, wenn er rausgefunden hätte, dass sie mit Ethan rumhing.« Er zog lange an seiner Zigarette. »Wir müssen dafür sorgen, dass sie den Mund hält, auch wenn sie unter Druck gesetzt wird.«
»John sagt, sie redet nicht.«
»John hat keine Ahnung. Er will nicht, dass sie sich aufregt.«
»Jessie hat recht, wenn sie die Sache hinter sich lassen will.«
Tyler packte Dylan am Kragen. »Hör zu, es ist mir scheißegal, was sie angeblich durchgemacht hat«, knurrte er und griff noch fester zu, als Dylan versuchte, sich loszumachen. »Entweder du kümmerst dich um sie oder ich mach es.«
Dylan riss sich los. »Wenn du Jessie anrührst …«
»Hab ich etwa einen Nerv getroffen?«
»Ach, leck mich.«
Tyler hielt schützend die Hand vor das Feuerzeug und zündete sich die nächste Zigarette an. »Ich hab mich immer gefragt, ob du ihren Zustand damals in der Nacht nicht ausgenutzt hast. Sie hat bei dir übernachtet, in deinem Bett geschlafen.« Er blies eine dünne Rauchfahne in Dylans Richtung. »John ist nicht hier. Mir kannst du’s sagen, Bruder.«
Dylan humpelte zu seinem Pferd und zog eine Wasserflasche aus der Satteltasche. »Du bist echt krank, weißt du das?«
Tyler ging an den Klippenrand zurück. »Reg dich ab, Kleiner. War nur ein Witz. Ob es John passt oder nicht, wir müssen Jessie klarmachen, was los ist. Wenn der Truck entdeckt wird, hat sie am meisten zu verlieren.«
»Ich weiß.«
»Sie ist kein Kind mehr.«
»Schon kapiert.«
»Also redest du mit ihr.«
Dylan drückte die Stirn gegen den Sattel. »Ja.«
»Gut. Übrigens habe ich meinen Kumpel Wayne angerufen.«
»Den Typ von der Skipatrouille?«
»Ja, er schuldet mir einen großen Gefallen. Er gibt mir, was wir brauchen, um die Klippe hochzujagen. Hortet seit Jahren Sprengstoff.«
»Wie schafft er das?«
»Er ist bei der Lawinenpatrouille. Anscheinend schreiben sie nicht auf, wie viel Dynamit sie brauchen, wenn sie die Pisten instand setzen.«
»Es muss diese Woche passieren.«
»Schon klar.«
»Kannst du dich auf ihn verlassen?«
»Entspann dich. Ich hab ihn am Sack. Er sagt kein Wort.«
Dylan band sein Pferd los und hievte sich wieder in den Sattel. »Ich will nach Hause. Kommst du mit?«
»Ja«, sagte Tyler, den Blick starr auf die dichten Rauchschwaden gerichtet, die im Süden den Himmel verfinsterten. »Ich komm gleich nach.«
Kapitel 2
Sheriff Aiden Marsh stand mit dem Hut in der Hand auf dem Bürgersteig vor dem Wilmington Creek Diner. Mit einem Meter achtzig und keinem Gramm Fett zu viel wirkte er nüchtern und effizient. Er war mit einem älteren Herrn ins Gespräch vertieft und bemerkte Detective Macy Greeley nicht, die mit ihrem Einsatzwagen auf den freien Parkplatz hinter ihm rollte. Sie blieb bei geöffnetem Fenster hinter dem Lenkrad sitzen und nippte an ihrem Kaffee. Die Männer sprachen leise, doch als Macy den Motor abstellte, verstand sie jedes Wort.
»Jeremy, es tut mir schrecklich leid.«
Der Mann, den Macy für Jeremy Dalton hielt, lehnte am Türrahmen und strich sich mit der fleischigen Hand über seinen ordentlich gestutzten Bart. Er hatte die Baseballkappe tief ins Gesicht gezogen, so dass seine Augen im Schatten lagen. Das lange graue Haar fiel ihm über die Schultern.
»Bei allem Respekt, Aiden, ich brauche dein Beileid nicht. Ich brauche Antworten.«
»Ich verspreche dir, dass ich Antworten finde.«
Der ältere Mann schluckte und rang sichtlich um Fassung. »Ich kann nicht glauben, dass mein Junge tot ist.«
»Bald sollte Detective Macy Greeley hier sein. Sobald sie sich umgesehen hat, bringe ich sie zu dir.«
»Kommt mir komisch vor, dass sie eine Frau raufschicken.«
»Greeley ist eine der Besten.«
»Kennst du sie?«
Aiden wählte seine Worte mit Bedacht. »Ich habe sie kennengelernt, auch wenn wir noch nie zusammengearbeitet haben. Sie war drüben in Collier, als sie vor ein paar Jahren den ganzen Ärger hatten.«
»Ich hoffe, ich bin dir nicht auf den Schlips getreten, als ich den Gouverneur angerufen habe. Ich dachte, er schickt ein paar Männer mehr rauf. Ich wusste nicht, dass er dir eine Polizistin aus Helena vor die Nase setzt.«
Aiden drückte Jeremys Schulter. »Schon gut, Jeremy. Ich bin für jede Hilfe dankbar. Ich will das hier schnell aufklären.«
Jeremys Kinn bewegte sich kaum. »Beeil dich. Ich muss nach Hause. Ich will nicht, dass Annie und die Mädchen es von jemand anderem erfahren.«
Die Tür des Diners fiel zu, und Aiden ging ein paar Schritte über den Bohlenweg. Dann blieb er stehen und starrte über die Straße. Macy war ihm vor fünf Jahren in Las Vegas bei einem Polizeikongress begegnet, und seitdem hatten sich ihre Wege nicht mehr gekreuzt. In seiner siebenjährigen Amtszeit als Sheriff von Wilmington Creek hatte es so gut wie keine Verbrechen gegeben. Macys Kollegen in Helena staunten darüber, aber sie ließ sich nicht so schnell beeindrucken. Sie war zu sehr Zynikerin, um an solche Idyllen zu glauben. Im Gegensatz zu den meisten Gesetzeshütern in Montana hatte Aiden relativ langes Haar, aber seine Uniform war tadellos und frisch gebügelt. Er trug eine Sonnenbrille, und hinter den verspiegelten Gläsern konnte sie seine Augen nicht sehen. Doch sie erinnerte sich daran, dass sie hellblau und hübsch waren.
Macy trank noch einen Schluck Kaffee und sank tiefer in den Sitz. Seit sie aus dem Haus gegangen war, kämpfte sie gegen Kopfschmerzen. Sie gab dem dritten Glas Rotwein die Schuld, das sie gestern statt eines Abendessens getrunken hatte. Die letzten paar Stunden hatte sie sich mit einem Bagel über Wasser gehalten, aber wenn sie diesen Tag durchhalten wollte, brauchte sie etwas Handfesteres. Der Chief der State Police hatte sie in der Nacht angerufen. Erst hatte sie gedacht, Ray Davidson wollte aus persönlichen Gründen mit ihr sprechen; es war drei Wochen her, dass sie sich das letzte Mal privat gesehen hatten. Aber sie hätte es besser wissen müssen. Eine halbe Stunde später verließ sie das Haus, das sie mit ihrer Mutter Ellen und ihrem anderthalbjährigen Sohn Luke bewohnte. Sie stellte einen kleinen Koffer in den Kofferraum und rief sich noch einmal Rays Worte in Erinnerung.
Macy, der Gouverneur hat persönlich angerufen. Der Druck ist groß, dass die Sache richtig gemacht wird. Du musst sofort nach Wilmington Creek.
Alles Weitere hatte sie über die Freisprechanlage erfahren, als sie auf der Route 93 nach Norden fuhr. John Dalton war kurz vor Weihnachten ehrenhaft aus der Armee entlassen worden und in sein Elternhaus zurückgekehrt. Er war sechsundzwanzig Jahre alt und ein hochdekorierter Kriegsveteran, der drei Einsätze an einigen der gefährlichsten Orte der Welt hinter sich hatte. Laut Zeugenaussagen hatte er in der Nacht um Viertel nach eins an einer Bar namens The Whitefish gehalten, um Zigaretten zu kaufen. Eine halbe Stunde später lag er tot in der Gasse. Er hatte eine Schusswunde am Hinterkopf und zwei im oberen Rückenbereich. Die Gerichtsmedizinerin war eher zurückhaltend, daher war Macy überrascht, als sie zu diesem frühen Zeitpunkt äußerte, das Ganze sehe nach einer Hinrichtung aus.
Macy folgte Sheriff Aiden Marshs Blick. Eine Gruppe von Polizisten bewachte die Gasse zwischen dem Whitefish und der örtlichen Bausparkasse. Irgendwo hinter dem niedrigen Sichtschutz lag John Dalton mit dem Gesicht im Kies.
Es klopfte ans Fenster, und Macy stellte ihren Kaffee ab. Aiden stand an der Fahrertür. Er hatte die Sonnenbrille abgenommen und starrte auf den Asphalt. Erst als er den Kopf hob, sah sie, dass er mit den Tränen kämpfte. Sie nahm ihre Tasche und stieg aus. Ihr langes rotes Haar war zu einem Pferdeschwanz gebunden, und statt Make-up trug sie eine immer dichter werdende Schicht Sommersprossen. Es war kühler, als sie erwartet hatte, auch wenn ein Teil der Schaufenster nach Osten schon im Licht der aufgehenden Sonne glühte. Bis zum Vormittag würden die Temperaturen auf knapp 30 Grad klettern. Bis Mittag hätten sie 40 erreicht.
Sie schüttelten sich die Hände, ohne zu lächeln. »Schön, Sie wiederzusehen, Detective Greeley. Ich wünschte, die Umstände wären erfreulicher.«
»Ja, ich weiß. Ich schätze, Sie kannten das Opfer und seine Familie.«
Aiden nickte in Richtung des Diners und sprach in kurzen Sätzen. »Ich kenne die Daltons seit Jahren. Johns Vater Jeremy wartet da drin. Ihm die Nachricht zu überbringen … Das war das Schwerste, was ich je getan habe.«
Seite an Seite überquerten sie die Main Street. Wilmington Creek war ein hübsches Städtchen. Niedrige Häuser säumten in regelmäßigen Abständen die Straße. Die Bürgersteige wurden von alten Bäumen beschattet. In großen, gepflegten Vorgärten leuchteten bunte Blumenbeete vor weißen Gartenzäunen. Drei Häuserblocks weiter westlich folgte die Route 93 dem mäandernden Bett des Flathead River. Auf der Fahrt von Helena hatte Macy Heufelder passiert, deren Halme sich zart im Wind bogen und kilometerweit bis zum Fuß der Berge erstreckten. Dort endete die Aussicht. Die Whitefish Range war in Rauchschwaden gehüllt. In den letzten zwei Monaten hatte es in der Gegend drei Waldbrände gegeben. Der jüngste wütete südwestlich der Stadt.
Macy zog sich ein Paar Füßlinge über und schob die Sonnenbrille auf den Kopf. Die Beamten, die den Tatort bewachten, wichen zur Seite, als sie und Aiden näher kamen. Keiner von ihnen blickte auf.
»Erzählen Sie mir von der Familie.«
»Jeremy Dalton, der Vater des Opfers, ist der Besitzer einer der größten Ranches hier im Tal. Auch John hat auf der Ranch gearbeitet, seit er aus Afghanistan zurück ist.«
»Was ist mit der Mutter? Ich habe gehört, sie ist krank.«
»Annie leidet seit ein paar Jahren unter Demenz.«
»Geschwister?«
»Eine Zwillingsschwester namens Jessie, auch wenn man es ihnen nicht ansieht. Sie sind vollkommen unterschiedlich.« Aiden hob das Absperrband hoch, und Macy bückte sich darunter durch, während sie ein Paar Latexhandschuhe überzog. »Die Familie ist ziemlich einflussreich hier oben.«
»Habe ich mir gedacht, nach den Anrufen, die ich mitten in der Nacht bekommen habe.«
»Jeremy und der Gouverneur kennen sich schon ewig. Jagen, Fischen, solches Zeug.«
»Wann ist die Spurensicherung hier?«
»Sind unterwegs. Die Gerichtsmedizinerin und der Fotograf sind seit ungefähr einer Stunde fertig.« Er reichte Macy eine Beweismitteltüte mit einem Portemonnaie. »Wir haben seinen Geldbeutel in der hinteren Hosentasche gefunden. Das Geld ist da. Es war kein Raubmord.«
»Was ist mit dem Handy?«
»Lag neben ihm auf dem Boden. Es hat ein bisschen gelitten. Ich habe es runter nach Helena geschickt.«
Macy ging auf den Eingang der Bar zu. »Wenn es Ihnen recht ist, würde ich gern hier anfangen.«
Aiden zeigte auf die zwei Überwachungskameras an der Dachrinne. »Sie sind auf den Eingang gerichtet. Gasse und Parkplatz werden nicht überwacht.«
Macy spähte durch die Glastür. Eine einzelne Lampe brannte über dem Tresen. Sie entdeckte keine Fenster. Nach kurzer Überlegung entschied sie, nicht hineinzugehen.
»Ich schätze mal, auf den Videos war nichts zu sehen.«
»Bisher nicht. Die Bank nebenan und ein paar Läden weiter unten haben auch Kameras. Wir sehen sie uns alle an.«
Sie wandte sich zur Gasse und versuchte, ihre Nerven zu beruhigen. Sie kam nicht drum herum. »Also los.«
Der bleiche Kies blendete im Morgenlicht, das zwischen die Gebäude fiel. Macy setzte ihre Sonnenbrille wieder auf. Der Personaleingang der Bar stand offen. Aus dem Innern drangen gedämpfte Stimmen, die Macy von der Radiosendung erkannte, die sie auf der Fahrt gehört hatte. Die Gasse führte zu einer Anliegerstraße, über die die Geschäfte an der Ostseite der Main Street versorgt wurden. Auf der anderen Seite stand ein niedriger weißer Bungalow mit grünem Rasen und einer Terrasse, die rundum mit Fliegengitter verschlossen war. Hinter dem Fliegengitter war die Silhouette eines Mannes zu erkennen. Er saß kerzengerade da und schien sie direkt anzusehen.
Macy zeigte auf den Bungalow. »Ich möchte auch mit dem Mann auf der Terrasse sprechen. Vielleicht hat er etwas gesehen.«
Aiden schirmte seine Augen gegen die Sonne ab. »Das muss Mr Walker sein. Ich schicke einen Beamten zu ihm, aber freuen Sie sich nicht zu früh, er ist fast blind.«
Macy zog an der Plastikplane. An John Daltons Hinterkopf war deutlich die dunkle Einschusswunde zu erkennen. Unter seinem Gesicht sickerte eine Blutlache in den lockeren Kies, und sie war froh, dass sie die Austrittswunde nicht sehen konnte. Auch ohne das Briefing hätte sie erraten, dass der junge Mann beim Militär gewesen war. Sein Haar war kurz geschoren, und die Details seiner Kleidung ließen auf jahrelange Disziplin schließen. Das blutgetränkte T-Shirt spannte über den breiten Schultern; am rechten Schulterblatt waren in einem Abstand von wenigen Zentimetern zwei Einschusswunden zu sehen. Keine Tätowierungen oder sonstige Kennzeichen. Keine Hautabschürfungen an den Händen oder Fesselspuren an den Handgelenken. Die Bluejeans waren verwaschen, doch die Stiefel sahen nagelneu aus. Macy zog das Portemonnaie aus der Tüte. Es enthielt einen Führerschein und einen Militärausweis, dazu ein paar Fotos, ein paar Kreditkarten und mehr als einhundert Dollar in bar. In einem Fach steckte die Visitenkarte einer Psychotherapeutin in Collier.
Macy hob eine Taschenlampe auf, die auf dem Boden neben der Leiche lag, und las, was darauf stand: Auf einen Streifen Klebeband war mit schwarzem Marker Whitefish geschrieben.
»Kannten die Leute aus der Bar das Opfer?«
»Ja, aber zur Tatzeit war nur ein Gast da, und der ist immer noch betrunken. Nach Aussage des Managers hat John die meiste Zeit mit seiner On-Off-Freundin Lana Clark gesprochen.«
Sie hielt die Taschenlampe hoch. »Sie haben die Schüsse gehört und kamen heraus, um nachzusehen?«
»Sie haben etwas gehört, das wie Schüsse klang, aber die Musik lief, und sie dachten sich nicht viel dabei. Sie haben es für eine Fehlzündung gehalten oder für irgendeinen Rowdy, der Quatsch macht. Der Manager hat die Leiche erst entdeckt, als er draußen eine Zigarette rauchen wollte.«
Auf den Betonstufen des Personaleingangs glitzerten winzige Glasscherben zwischen den Zigarettenstummeln. Die Lampe über der Tür war kaputt. »Irgendeine Ahnung, wann das passiert ist?«
»Nach Aussage des Managers muss es gestern Abend gewesen sein.«
»Ein toter Winkel, eine kaputte Glühbirne, kein Hinweis auf einen Raub. Sieht nicht nach einem Zufall aus.«
»Das habe ich auch gedacht.«
»Drei Einsätze in Afghanistan, und dann wird er in seinem Heimatort erschossen.«
Macy überflog ihre Aufzeichnungen. »Die Frau in der Bar, Lana Clark? Ist sie die ›On-Off-Freundin‹?«
»So erzählt man sich.«
»Wo ist sie jetzt?«
»Ein Streifenwagen hat sie nach Hause gebracht, weil sie ein paar Sachen brauchte. Sie ist ziemlich durch den Wind.«
»Wann ist sie wieder da?«
»Dauert sicher noch eine Stunde. Sie wohnt ganz schön weit draußen.«
»Können wir uns John Daltons Wagen ansehen? Hat man die Autoschlüssel gefunden?«
»Die brauchen Sie nicht. Der Wagen war offen.«
An den Kotflügeln von John Daltons Pick-up klebten zwanzig Zentimeter getrockneter Matsch, und der Wagen sah aus, als hätte er sich mindestens einmal überschlagen. Über die Windschutzscheibe lief ein Netz feiner Risse, und Grasspuren waren zu sehen. Auf der Tür stand: Dalton Ranch – Qualitäts-Viehzucht seit 1863. Hinter dem Fahrersitz war ein Gewehrhalter, in den eine Schrotflinte eingeschlossen war. Am Boden lagen leere Lebensmittelpackungen und Colaflaschen. Alles war voller Sand und Hundehaare. Es roch wie in einem Stall.
»Sieht aus, als hätte er hier gewohnt.«
»Bei der Größe der Ranch hat er wahrscheinlich die meiste Zeit hier verbracht.«
»Was läuft mit Lana Clark?«
»Seit seiner Rückkehr gab es Verwirrung um Johns Beziehungsstatus. Insbesondere waren da zwei Frauen. Die eine war Lana, die andere Tanya Rose.«
»Sie kennen die Daltons gut.«
»Wilmington Creek ist eine Kleinstadt, die Leute reden gern. Anscheinend war Lana der Grund, warum Tanya mit John Schluss gemacht hat. Es heißt, seitdem versucht er sie zurückzubekommen.«
»Mit ihr muss ich auch sprechen.«
»Ich sage ihr Bescheid.«
»Wissen wir, mit wem John Dalton früher am Abend zusammen war?«
»Mit ein paar Freunden. Wir bestellen sie zur Befragung ein.«
»Könnte es sein, dass er etwas gesehen hat, das er nicht sehen sollte? Wird der Parkplatz hier manchmal von Drogendealern benutzt?«
»Wir sind hier auf dem Land. Ein paar Kilometer weiter nach Norden oder Süden, und kein Mensch merkt, wenn man eine Bombe zündet. Es gibt bessere Stellen, um Drogen zu verkaufen, als einen Parkplatz mitten im Ort.«
»Hatten Sie einen Eindruck davon, wie er mit der Heimkehr zurechtkam? Drei Kampfeinsätze können ziemlich belastend sein.« Macy öffnete das Handschuhfach und fand eine halbautomatische Pistole. Sie war geladen. Sie hielt die Waffe hoch. »Vielleicht war er auf Ärger aus.«
»Nach Aussage seines Vaters hat er viel gearbeitet. Er hat die Arbeit auf der Ranch sehr ernst genommen.«
»Er war mit zwei Frauen zusammen. Für Ärger hatte er also trotzdem Zeit.«
Aiden zuckte die Schultern. »Wir sollten mit Jeremy reden. Er will so schnell wie möglich nach Hause zu seiner Familie, bevor sie aufwachen und von jemand anderem erfahren, was passiert ist.«
Macy schob die Pistole in eine Beweismitteltüte und schlug die Wagentür hinter sich zu. »Wenn die Spurensicherung einen Blick darauf geworfen hat, soll der Truck zur weiteren Untersuchung nach Helena.«
Macy vermutete, dass Jeremy Dalton die schwieligen Hände auf dem Tisch gefaltet hatte, damit keiner sah, wie stark sie zitterten. Sein gebräuntes Gesicht war von feinen Linien durchzogen. Draußen auf der Straße war Bewegung, als die Spurensicherung in die Gasse einbog. Jeremy hob den Blick, doch er hielt die Hände weiter verschränkt. Schweigend starrte er hinaus, und mit den Sekunden, die verstrichen, wurden die Furchen in seinem Gesicht tiefer.
Macy zog ein dünnes Notizbuch aus der Tasche. »Mr Dalton, ich bin Detective Macy Greeley. Ray Davidson, der Polizeichef, hat mich persönlich mit diesem Fall beauftragt. Normalerweise arbeite ich in Helena, aber ich habe auch schon hier oben im Flathead Valley ermittelt.«
Jeremy räusperte sich. »Ich habe gerade mit Sheriff Warren Mayfield telefoniert. Er hat nur Gutes über Sie zu sagen. Hat ihm gefallen, wie Sie an die Sache in Collier rangegangen sind.«
»Da habe ich ihm wohl zu danken.« Macy schob ihre Visitenkarte über den Tisch. »Ich verspreche Ihnen, dass ich alles tue, um den Mörder Ihres Sohnes zur Rechenschaft zu ziehen.«
Jeremy strich sich über den Bart. Er trug keinen Ehering, und seine Augen waren blass und rotgerändert. »Als John in Afghanistan war, habe ich vor Sorge nachts oft nicht geschlafen. Seit er endlich wieder daheim ist, schlafe ich wie ein Baby.«
Macy wartete.
»Er musste nicht gehen, aber er hat sich freiwillig gemeldet. Er hat es für seine Pflicht gehalten.«
»Wie ich gehört habe, war er ein guter Soldat. Sie müssen sehr stolz auf ihn gewesen sein. Waren Sie auch bei der Armee?«
»Ich war zu jung für Vietnam und zu alt für den nächsten Krieg.« Seine Stimme zitterte. »Hab wohl Glück gehabt.«
Ein paar Tische weiter saß ein älterer Herr. Er trug staubige Jeans, ein langärmeliges Hemd und Arbeitsstiefel. Sein weißes Haar war kurz geschoren, und er beobachtete Macy mit dunklen Augen, seit sie den Diner betreten hatte. Außer Jeremy war er der einzige Gast, der nicht zur Polizei gehörte.
Macy erwiderte den Blick des älteren Mannes. »Sind Sie allein hier, Mr Dalton?«
Jeremy nahm die Mütze ab und drehte sie in den Händen. »Ich habe meinen Vorarbeiter Wade geweckt, als der Anruf kam. Er ist gefahren.«
»Stört es Sie, wenn er bei unserem Gespräch dabei ist?«
»Wade Larkin gehört zur Familie.«
Macy notierte sich Wades Namen. »Wann haben Sie John zum letzten Mal gesehen?«
»Gestern beim Abendessen. Wir haben gegen sechs gegessen. Er hat gesagt, er wollte sich mit Freunden treffen.«
»Jemand Bestimmtes?«
»Ich schätze, es waren die üblichen.« Er warf Aiden einen Blick zu, bevor er die Namen aufzählte. »Dylan Reed, Tyler Locke, Chase Lane. Wer sonst noch dabei war, weiß ich nicht.«
»Ist John unter der Woche öfters abends länger weggegangen?«
»Normalerweise nicht. Aber heute war sein freier Tag.«
»Fällt Ihnen jemand ein, der Interesse hätte, Ihrem Sohn zu schaden?«
»Falls er irgendwelchen Ärger hatte, hat er nie was davon gesagt.«
Macy dachte an das, was sie über die Daltons wusste. »Was ist mit der Ranch? Gab es je irgendwelche Streits, die hässlich geworden sind?«
»Wir sind schon lange im Geschäft. Natürlich hatten wir auch unzufriedene Angestellte. Wir wurden mehr als einmal verklagt, aber in den letzten Jahren ist nichts gewesen.«
»Probleme mit der örtlichen Bürgerwehr? In anderen Teilen des Landes hat es Konflikte gegeben. Sie hatten ein paar der großen Landbesitzer im Visier.«
Jeremy sah auf seine Hände. »Das sind nur ein paar radikale Spinner, die Unruhe stiften. Wenn Sie mich fragen, tun sie sich mit ihren jüngsten Forderungen keinen Gefallen.«
»Wie meinen Sie das?«
»Sie haben was dagegen, dass Nutzflächen in Privatbesitz sind. Aber damit kommen sie hier bei niemandem gut an. Ich überlasse meine Ranch doch keinem Haufen Irrer, die Soldat spielen wollen.«
»Wurden Sie bedroht?«
»Nur ein paar nächtliche Anrufe.«
»Sind Sie zur Polizei gegangen?«
»Ich kann diese Trottel nicht ernst nehmen.« Er schwieg kurz. »Es gibt da eine Frau, die über die Milizen hier im Tal recherchiert. Ich glaube, sie heißt Patricia Dune. Wenn Sie mehr darüber wissen wollen, sollten Sie die fragen. Meiner Meinung nach weiß sie ein bisschen zu gut Bescheid.«
Macy sah Aiden an. »Haben Sie von dieser Frau gehört?«
»Sie hat vor ein paar Monaten ein Interview mit mir geführt. Sie recherchiert für eine Doktorarbeit. Sie scheint korrekt vorzugehen, aber es gab Gerede.«
»Was für Gerede?«
»Die Leute finden, sie wirbelt unnötig Staub auf. Sie haben Angst …«
Jeremy unterbrach ihn. »Vor einem Monat kam sie raus, um mich zu interviewen. Hat ziemlich viele Fragen über Ethan Green gestellt. Ich musste sie bitten zu gehen.«
Macy runzelte die Stirn. Der Name Ethan Green war ihr wohlbekannt. Er hatte eine der ersten Bürgerwehren in Montana gegründet. »Ich dachte, Ethan Green wäre untergetaucht, seit er per Haftbefehl gesucht wird.«
Aiden antwortete. »Ethan Green wird im Zusammenhang mit einer Vergewaltigung letztes Jahr in Collier gesucht. Seitdem hat ihn keiner mehr gesehen.«
Macy machte sich Notizen, bevor sie Jeremy die nächste Frage stellte.
»Warum, glauben Sie, interessiert sich Patricia Dune so für Ethan Green?«
»Keine Ahnung. Das müssen Sie sie fragen.«
»Wissen Sie, ob Green auch an die Kollektivierung von Nutzflächen glaubte?«
»Irgendwann hat er daran geglaubt. Was er jetzt glaubt, weiß ich nicht. Er hat seine Meinung immer wieder geändert.«
»Könnte er der nächtliche Anrufer gewesen sein?«
»Er war es nicht.«
»Sie scheinen sich sicher zu sein.«
»Ich kenne Ethan mein Leben lang.«
»Hat John vielleicht Kontakt zu ihm gehabt?«
»Meine Kinder halten sich von ihm fern. Sie hatten nichts mit ihm zu schaffen.«
»Diese Spannung zwischen Ihnen und Green. Gab es da Gewaltpotential?«
»Unser Streit ist älter als meine Kinder. Ich glaube nicht, dass einer von uns heute noch einen Gedanken daran verschwendet.«
»Ich weiß, dass es sehr schwer für Ihre Familie ist, aber wir müssen mit allen sprechen, auch mit den Leuten, mit denen Ihr Sohn zusammengearbeitet hat. Vielleicht hat er sich jemandem anvertraut.«
Jeremy rang um Fassung. »Ich muss los. Ich habe keine Ahnung, wie ich es ihnen sagen soll …«
Er drückte sich die Handballen an die Augen und weinte. Macy war die Einzige, die den Blick nicht abwandte. Dieser Mann hatte seinen einzigen Sohn verloren. Sie wehrte sich dagegen, sich in ihn hineinzuversetzen. Ihr Sohn Luke war so weit weg. Plötzlich hatte sie das Bedürfnis, aus dem Restaurant zu laufen und nach Hause zu fahren. Wie konnte sie Luke beschützen, wenn sie nie da war? Macy reichte Jeremy ein Taschentuch und winkte Wade Larkin heran.
»Mr Dalton, ein paar Beamte begleiten Sie nach Hause. Wir haben eine Opferbetreuerin aus Helena hier. Sie heißt Sue Barnet und kümmert sich um Sie. Ich habe Ihnen meine Visitenkarte gegeben. Sie können mich jederzeit anrufen. Vielleicht fällt Ihnen noch was ein. Selbst wenn es Ihnen nicht wichtig vorkommt, bitte sagen Sie es mir trotzdem.«
Macy hängte sich ihre Tasche über die Schulter. »Ich komme heute Nachmittag raus zu Ihnen und Ihrer Familie. Ich muss mit jedem sprechen, der John nahestand.«
Er steckte ihre Karte in die Hemdtasche, bevor er den Stuhl vom Tisch schob. Seine Beine knickten ein, als er aufstand, doch Wade war da, um ihn zu stützen. In der Stille, die folgte, klingelte plötzlich sein Telefon.
Kapitel 3
Jessie Dalton rieb sich den Schlaf aus den Augen, dann drehte sie sich um und sah auf die Uhr. Es war kurz nach sechs, und im Zimmer war es noch dunkel. Sie sank in die Kissen zurück und starrte an die niedrige Decke. Fast die ganze Nacht hatte sie wach gelegen und sich im Kopf Listen gemacht, und jetzt war sie zu müde, um irgendwas zu erledigen. Sie legte ihre Hand auf die Brust. Ihr Herz schlug noch. Manchmal hatte sie das Gefühl, das Klopfen ihres Herzens wäre das Einzige, was ihr bewies, am Leben zu sein. Plötzlich knarrte eine Diele, und sie setzte sich auf.
»Wer ist da?«
Ihre Mutter Annie trat in den Lichtstreifen, der durch den Spalt zwischen den Vorhängen fiel. Sie trug einen geblümten Morgenmantel, und ihr langes graues, perfekt gescheiteltes Haar wippte geschmeidig. Sie fasste sich an den Hals.
»Habe ich dich geweckt?«
Jessie beobachtete ihre Mutter und versuchte, ihre Stimmung einzuschätzen. Nicht, dass es eine Rolle spielte. Annies Temperament war unberechenbar. Wie eine verirrte Kugel konnte es jederzeit die Richtung wechseln.
Annie setzte sich auf den Bettrand und malte mit dem Zeigefinger Muster auf die dünne Steppdecke. Ihre Worte folgten dem Takt ihres Fingers. »Dein. Bruder. John. Ist. Tot.«
Jessie wartete auf die verwirrten Erklärungen, die den haarsträubenden Behauptungen ihrer Mutter gewöhnlich folgten, doch diesmal kamen keine. Also reagierte sie wie immer: Sie sprach beruhigend auf sie ein und lächelte, auch wenn ihr zum Heulen war.
»John ist aus Afghanistan zurück. Du musst keine Angst mehr haben.«
Annie hielt ihr Telefon hoch. Ihre Fingernägel waren eingerissen, und ihre Knöchel waren geschwollen. Sie hielt sich das Display vor die Nase und runzelte die Stirn.
»Ich verstehe das nicht. Wenn er tot ist, wie kann er mir eine Nachricht schicken?«
Jessie dachte an Annie vor zehn Jahren und mit fünfzehn Kilo mehr auf den Rippen. Die Frau, die vor ihr saß, log. Jessie war zu müde, um sich auf das Spiel einzulassen, und veränderte ihren Ton. Das Lächeln war fort.
»Das muss ein Witz sein.«
»John war der einzige ernsthafte Mensch in der Familie. Er hätte über so was keine Witze gemacht.«
»Sprich nicht in der Vergangenheit von ihm.«
Annie sah sich im Kommodenspiegel an. Sie strich sich durchs Haar und runzelte die Stirn. »Unzählige Male habe ich mir vorgestellt, dass er gefallen ist. Immer wenn es klingelte, war ich überzeugt, es wäre jemand von der Armee, der kam, um uns zu sagen, dass er tot ist. Es wurde so schlimm, dass ich die Klingel aus der Wand gerissen habe.«
»Niemand macht dir Vorwürfe. Wir hatten alle Angst.« Jessie streckte die Hand aus. »Zeig mir mal die Nachricht.«
Doch Annie drückte das Telefon an ihre Brust. »Woher weiß ich, dass du nicht auch meine anderen Nachrichten liest? Sie sind privat. Ich will nicht, dass du sie siehst.«
»Ich verspreche dir, ich lese nur die von John.«
»John ist tot. Er konnte sie nicht schicken.«
»Gibst du mir bitte das Telefon?«
»Du hast mich schon so oft belogen.«
»Ich habe dich nie belogen.«
»Jetzt weiß ich, dass du lügst.«
»Mom, ich versuche zu helfen. Du sollst nicht traurig sein. Ich bin mir sicher, John ist drüben in seiner Wohnung und schläft.«
»Es hat niemand in seinem Bett geschlafen. Er ist gestern nicht nach Hause gekommen.«
John wohnte in einem Wohnmobil draußen bei den Ställen. Jessie sah wieder auf die Uhr. Es war erst halb sieben. Eigentlich galt die Regel, dass ihre Mutter das Haupthaus nicht verlassen durfte. Sie hatten Angst, dass sie sonst einfach loslief und sich in den tiefen Canyons hinter der Ranch verirrte oder, schlimmer noch, zum Flathead River aufbrach. Zweimal war sie schon entwischt. Beide Male hatten sie sie oben an den Bridger Falls gefunden, den Blick in die Tiefe gerichtet.
»Er hat wahrscheinlich bei Tyler übernachtet. Hast du mit Dad gesprochen?«
»Jeremy ist auch nicht da.« Ihre langen Finger zitterten, bevor sie sich ans Kinn fasste. »Wahrscheinlich ist er bei dieser Frau. Ich habe dir gesagt, dass es irgendwann passiert. Irgendwann hat Jeremy die Nase voll von mir. Ich habe gehört, wie er mit dem Arzt geflüstert hat. Er will mich einweisen lassen.«
»Ich verspreche dir, dass ich deine anderen Nachrichten nicht lese. Ich will nur die von John sehen.«
»Vielleicht würde er noch leben, wenn ich das Klingeln gehört hätte, aber ich schlafe so fest. Es sind diese Pillen. Ein Wunder, dass ich überhaupt noch träumen kann.«
»Mom, gib mir das Telefon.«
»Du gibst es mir gleich zurück?«
»Natürlich.«
Annie hielt Jessie das Telefon hin. »Er ist tot. Du kannst nichts daran ändern.«
»Hör auf damit. Du machst mir Angst.«
Annie ließ das Telefon in Jessies Schoß fallen und sah zum Fenster. »Zu Recht.«
Das Telefon war warm vom Griff ihrer Mutter. Jessie las die Nachricht.
Tut mir leid, Annie. John hat mir keine Wahl gelassen. Er musste sterben.
Sie wiederholte die Worte ein paarmal leise, bevor sie sie laut flüsterte. In der Stille des Zimmers klangen sie wie ein Gebet. Annie schlug nach einem Moskito. Jeder in Wilmington Creek wusste, dass Annie krank war. Seit bei ihr als Teenager eine bipolare Störung diagnostiziert worden war, lebte sie mit wechselnden Medikamentencocktails. Doch es war das frühe Einsetzen der Demenz, die alle überrascht hatte. Nachdem die Diagnose feststand, konnte man nichts mehr tun. In einem verzweifelten Versuch, an der Realität festzuhalten, hatte Annie begonnen, jeden Gedanken aufzuschreiben. Jessie erinnerte sich an das Gesicht ihres Vaters, als er hinten im Schrank unter der Treppe die Stapel der Hefte gefunden hatte. Sie hatten sie sich zusammen angesehen, während Annie mit den Fäusten gegen die abgeschlossene Arbeitszimmertür gehämmert hatte. Das Einzige, was ihre Mutter je aus der Stadt verlangte, waren Stifte und Papier. Drei Jahre später waren ihre Finger schwarz und ihre Augen kaputt.
Jessie versuchte, ihren Bruder anzurufen, aber er antwortete nicht.
»Das ist nur ein geschmackloser Streich«, wiederholte sie.
Annie kaute an ihren Nägeln. »Ich muss überlegen, was ich bei der Beerdigung anziehe. Alle meine Kleider sind mir viel zu groß. Ich will schön sein.«
»Es gibt keine Beerdigung. John lebt.«
Annie packte ihre Tochter am Kinn und zwang sie, ihr in die Augen zu sehen. »Warum glaubst du mir nicht dieses eine Mal? Das ist kein Wettbewerb. Jeremy und du müsst nicht immer recht haben.«
Jessie riss sich los. »John ist nicht tot.«
»Wenn du mir nicht glaubst, ruf Jeremy an. Er weiß ja anscheinend immer, was los ist.«
Gedankenverloren tippte Jessie auf die Tasten. Mit dem Tageslicht sickerten Zweifel durch die Vorhänge. Jessie tat ihr Bestes, um sie nicht hereinzulassen. John lebte. Er war aus dem Krieg zurückgekehrt. Er war endlich in Sicherheit.
Annie ging vor dem Fenster auf und ab, das sie von hinten beleuchtete. »Mach schon. Ruf Jeremy an. Wovor hast du Angst?«
Jeremy war nach dem ersten Klingeln am Apparat. »Hallo, Liebes«, sagte er leise, als müsste er sich beherrschen.
Jessie wurde ganz anders zumute. Die Stimme ihres Vaters klang falsch. Er sprach leise. Jeremy sprach niemals leise. Jeremy war wie ein Stier. Er betrat einen Raum nicht, er stürmte ihn. Er redete nicht, er brüllte. Sie schloss die Augen. Sie wusste jetzt schon, dass ihre Mutter recht hatte. Jeremy nannte sie nie Liebes.
»Wo bist du?«, fragte sie.
»In der Stadt. Es ist etwas passiert.«
»Es ist John, oder? Es ist ihm etwas zugestoßen.«
»Ich bin gleich zu Hause. Ich erzähle dir alles, wenn ich da bin.«
»Ist er wirklich tot?«
Jeremys Stimme brach. »Es tut mir so leid, dass du es von jemand anderem erfahren musstest. Ich wollte es dir sagen …«
Jessie schrie auf. »Wann?«
»Mitten in der Nacht.«
»Jemand hat Mom eine Nachricht von Johns Telefon geschickt.«
»O Gott. Wie geht es Annie?«
Jessies Stimme wurde leiser. »Sie ist hier bei mir.«
»Was tut sie?«
»Sie geht auf und ab. Sie ist völlig fertig.«
»Ich komme sofort nach Hause.«
»Warum passiert das alles?«
»Ich weiß es nicht, Jessie. Ich weiß es wirklich nicht.«
Annie Dalton packte die Vorhänge und lachte. »Ich habe dir gesagt, dass ich recht hatte.«
Jessie las die Nachricht noch einmal. Sie konnte nicht atmen, geschweige denn sprechen. Sie hatte keine Worte. Ihre Mutter warf die Arme in die Luft und riss die Vorhänge auf. Als stünde sie auf einer Bühne, streckte sie die Arme der Sonne entgegen.
»Es ist ein guter Tag zum Sterben. Findest du nicht?«
»Hör auf.«
»Komm, schau dir die wunderbare Aussicht an. Wer kann an einem Tag wie heute traurig sein?«
Jessie sprang aus dem Bett. Sie stieß Annie gegen den Schrank, gab ihr eine Ohrfeige und hielt ihren Kopf fest.
»Ich habe gesagt, hör auf.«
Ein Lächeln spielte über Annies Lippen. »Und ich habe dir gesagt, dein Bruder ist tot.«
Jessie schrie. »Hör endlich auf! Ich kann nicht mehr. Wir können alle nicht mehr.«
Annie sank zu Boden und griff sich mit tintenschwarzen Fingern an den Kopf. Jessie zitterte am ganzen Körper. Sie kroch zurück ins Bett und rollte sich unter die Decke. Auf dem Handrücken hatte sie ein primitives Rosen-Tattoo. Wenn sie nervös war, kratzte sie daran herum. Sie hatte keine Erinnerung an die Nacht in Reno, als sie sich die Tätowierung hatte stechen lassen. Im selben Nebel war auch ihre Tochter gezeugt worden. Inzwischen war Tara sechs. Jessie hatte vor einem Jahr das letzte Glas Alkohol getrunken, vor vier Jahren hatte sie mit Meth aufgehört. Langsam lichtete sich der Nebel.
Irgendwo im Haus quietschte eine Tür. Tara war wach. John hatte versprochen, mit ihr reiten zu gehen. Er hatte etwas von einem Pony gesagt, das ein Freund verkaufte und das er sich ansehen wollte. Jessie sah auf die Uhr. Es war noch früh. Sie hatten Zeit. Dann fiel ihr ein, dass John Tara nirgendwohin mitnehmen würde. Sie bohrte die Fingernägel in das Rosen-Tattoo und spürte, wie die Haut nachgab.
Annie sprach langsam. »John war mein einziger Sohn. Ich habe ihn mehr geliebt als jeden anderen Menschen auf der Welt.«
»Es tut mir leid. Ich hätte dich nicht schlagen dürfen.«
»Du warst nicht die Erste. Du wirst nicht die Letzte sein.«
»Du bist krank. Du kannst nichts dafür.«
»Als ich nicht schwanger wurde, hat Jeremy mir die Schuld gegeben, dabei stimmte bei ihm etwas nicht.« Sie senkte die Stimme. »Du und dein Bruder seid der Beweis. Ihr habt mich gerettet.«
»Ich habe noch niemanden gerettet.«
Annie stand auf und klopfte sich den Morgenmantel ab. Unten ging der Fernseher an. Tara sah immer bei voller Lautstärke fern. Wie Jessie und ihr Bruder John, als sie klein waren. So mussten sie die Streite ihrer Eltern nicht mit anhören.
»Ich hätte die Wahrheit am liebsten von den Dächern geschrien, aber ich hatte gelernt, den Mund zu halten. Ihr wart das Einzige, was Jeremy mir nicht wegnehmen konnte.«
Jessie stand auf und sammelte die Kleider ein, die sie am Abend auf den Boden geworfen hatte. »Tara ist wach. Ich muss mich anziehen.«
»Du lässt sie zu viel fernsehen. Wenn du nicht aufpasst, wird nichts aus ihr.«
Vielleicht würde Jessie Tara den ganzen Tag vor dem Fernseher sitzen lassen. Sie würde nicht mitbekommen, wie die Zeit verging. Sie würde nicht an nicht gehaltene Versprechen denken. Sie würde noch oft genug in ihrem Leben traurig sein. Sie wollte sie heute davor bewahren.
»Lass Tara in Ruhe. Es schadet ihr nicht.«
Annie starrte aus dem Fenster. Ihre Augen waren klar. Zum ersten Mal seit Ewigkeiten schien sie geistig voll da zu sein. »Wir bekommen Gesellschaft. Ich gehe besser runter und mache Kaffee. Es wird ein schwieriger Tag für uns alle.«
Ihre Mutter schlug die Tür hinter sich zu. Jessie stellte sich ans Fenster und beobachtete die vier Fahrzeuge, die die lange Auffahrt heraufkrochen. Von weitem sahen sie aus, als wären sie miteinander verbunden wie Eisenbahnwaggons. Blaulicht blinkte. Die Kolonne zog eine Staubwolke hinter sich her. Jessie hatte das Gefühl, gleich aufzuwachen, aber noch in einem Alptraum festzustecken. John konnte nicht tot sein. Er war ihr Zwillingsbruder, ihr bester Freund, ihr Beschützer. Er war einen Kopf größer als sie, und wenn er wollte, konnte er sie über seine Schulter werfen und kilometerweit laufen. Er hatte riesige Hände. Er konnte ihren Kopf damit umfassen wie einen Basketball.
Vor dem Haus blieb die Kolonne stehen, und das Blaulicht erlosch. Sie beobachtete, wie ihr Vater über den Kies lief und sich dabei die Hose hochzog. Sekunden später erfüllte seine Stimme das Haus. Er rief Jessies Namen, und die Resignation in seiner Stimme jagte ihr einen Schauer über den Rücken. Sie stand im Zimmer und scheute sich davor hinauszugehen. Jeremy konnte ihre Anwesenheit im Haus kaum ertragen. John hatte sich immer schützend vor sie gestellt und ihren Vater gemahnt, mehr Geduld zu haben, versöhnlicher zu sein. Sie wich von der Tür zurück. Sie trug immer noch das T-Shirt, in dem sie geschlafen hatte. Das dunkle, ungewaschene Haar fiel ihr ins Gesicht. So konnte sie nicht nach unten gehen. Ihr Vater rief wieder nach ihr, und sie griff zu den Shorts, die über der Stuhllehne hingen. Doch bevor sie sie anziehen konnte, hörte sie ihre Mutter schreien. Jessie stürzte aus dem Zimmer und stieß mit der Hüfte gegen den Türrahmen. Auf dem Weg nach unten sah sie ihre Eltern durchs Treppengeländer. Annie hatte Jeremy die Hände um die Kehle gelegt. Wade hielt Jeremys Arm fest, mit dem er versuchte, blind auf Annie einzuschlagen, und dabei die Bronzefigur eines Pferds vom Regal riss.
»Du bist schuld, Jeremy. Du bist schuld, dass mein Sohn tot ist.«
Ein uniformierter Beamter packte Annie, doch sie holte mit dem Ellbogen aus und traf ihn mit voller Wucht im Gesicht. Ein zweiter Beamter hielt sie mit beiden Armen fest, so dass sie sich kaum noch bewegen konnte. Sie trat nach Jeremy, der sich auf sie stürzen wollte, und stieß mit dem nackten Fuß gegen sein Brustbein. Jetzt war er nicht mehr aufzuhalten. Er war ein wilder Stier. Zwei Beamte warfen sich auf ihn, während Wade ihn und Annie anflehte, sich zu beruhigen.
Jessie nahm zwei Stufen auf einmal. Das Wohnzimmer war leer und der Fernseher ausgeschaltet. Sie riss die Schranktüren auf. Ihre Stimme nahm wieder den beruhigenden Tonfall an.
»Alles ist gut, Tara. Du kannst rauskommen.«
Aiden Marsh tauchte in der Haustür auf. »Jemand ist bei Tara draußen. Ich glaube, sie hat nichts mitbekommen, falls das ein Trost ist.«
Jessie biss sich auf die Lippe. Sie konnte die Hände nicht still halten. Stöhnend hielt sie sich an der Sofalehne fest. Sie war am Ende ihrer Kräfte.
Aiden legte ihr die Hand auf die Schulter. »Nimm dir Zeit und beruhige dich.«
Sie hielt sich die Ohren zu. Das Gebrüll ging weiter. Durch die geschlossene Küchentür war zu hören, wie sich ihr Vater und ihre Mutter Beleidigungen an den Kopf warfen. Wade gab sich alle Mühe, Jeremy zur Vernunft zu bringen, aber ohne Erfolg.
Jessie schüttelte den Kopf. »Ich habe keine Zeit.«
»Tara ist jetzt das Wichtigste, und ihr geht es gut. Nimm dir Zeit.«
Jessie schwitzte. Sie strich sich das Haar aus dem Gesicht. Es klebte an ihren feuchten Händen wie Spinnweben. »Es tut mir leid. Annie ist vollkommen durchgedreht.«
»Dafür kann niemand etwas.«
Ein Streifenpolizist kam herein. Jessie erkannte das Gesicht, aber sie hatte seinen Namen vergessen. Seine rechte Wange war geschwollen, wo ihn Annies spitzer Ellbogen getroffen hatte.
»Etwas stimmt nicht mit Jeremy. Er ist einfach umgefallen.«
Jessies Knie wurden weich. Sie hatte das Gefühl, sie schaffte es nicht zur Tür. In der Küche gab ihre Mutter Anweisungen, wie man Kaffee kochte. Anscheinend hatte sie die Gebrauchsanleitung auswendig gelernt. Im Flur sah sie ihren Vater am Boden liegen. Sie war überrascht, dass sie nichts gehört hatte. Es hätte einen gewaltigen Schlag geben müssen.
Wade Larkin kniete neben Jeremy und sprach mit leiser Stimme auf ihn ein. Jessie setzte sich daneben und legte ihrem Vater die Hand auf die Brust. Sein Herz schlug wie ein Presslufthammer. Er hatte die Augen weit aufgerissen. Jessie starrte ihn an. Sie hatte ihn noch nie so verletzlich gesehen. Sie hätte ihm ein Kissen aufs Gesicht drücken können und er hätte sich nicht wehren können. Der Gedanke war seltsam tröstlich. Wades Stimme drang an ihre Ohren. Er roch nach Kaffee und Vieh. Tröstlich auf eine andere Art.
»Jessie ist hier. Alles wird gut.«
Sie legte ihrem Vater die Hand auf die Stirn. Unter dem Schweißfilm war die Haut kalt. Er fühlte sich nicht menschlich an.
»Jeremy, ab jetzt kümmern wir uns um dich.«
Aiden stand über ihnen. »Ein Rettungshubschrauber der Bergwacht war schon in der Luft. Er ist in fünf Minuten hier.«
Die Küchentür ging auf. Annie schrie nicht mehr. Man hatte ihr Handschellen angelegt. Auf dem Weg zur Haustür stolperte sie über den Saum ihres Morgenmantels. Jessie sah sie nicht an. Jeremy drückte ihre Hand. Wie John hatte er große Hände. Sie konnte sich nicht erinnern, wann er sie das letzte Mal berührt hatte. Sie blinzelte, und dann war ihre Mutter fort.
Jeremys Stimme klang gepresst. »Ich brauche keinen Scheißhubschrauber. Hauptsache, diese Frau verschwindet aus meinem Haus.«
Jessie zog die Hand zurück, und Jeremys Finger fielen auf den Boden. »Beruhige dich.«
Wades Knie knackten, als er das Gewicht verlagerte. »Würde nicht schaden, wenn dich ein Arzt ansieht.«
Möchten Sie gerne weiterlesen? Dann laden Sie jetzt das E-Book.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben:





























