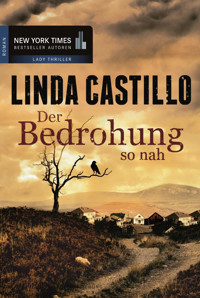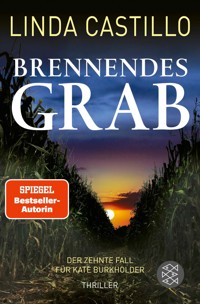
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Kate Burkholder ermittelt
- Sprache: Deutsch
Eine brennende Scheune wird zur tödlichen Falle: Wer hasste den 18-jährigen Daniel Gingerich so sehr, dass er ihn bei lebendigem Leib verbrannte? Der Sohn der amischen Familie Gingerich wurde bei lebendigem Leib verbrannt. Er starb eingeschlossen in einer brennenden Scheune. Daniel galt als tüchtig, freundlich und zuverlässig. Doch die Ermittlungen bringen auch eine dunkle Seite von ihm ans Licht. Eine Seite, von der die amische Gemeinde nichts wissen will, nur hinter vorgehaltener Hand wird getuschelt. Als Kate Burkholder den Dingen auf den Grund geht, finden sich plötzlich mehr Verdächtige, als ihr lieb ist. Jemand muss Daniel Gingerich grenzenlos gehasst haben. So sehr, dass er ihn in die Scheune lockte und sie anschließend anzünde
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 438
Veröffentlichungsjahr: 2019
Sammlungen
Ähnliche
Linda Castillo
Brennendes Grab
Roman
Über dieses Buch
Eine brennende Scheune wird zur tödlichen Falle: Wer hasste den 18-jährigen Daniel Gingerich so sehr, dass er ihn bei lebendigem Leib verbrannte?
Die Nachricht von der brennenden Scheune auf der Gingerich-Farm geht spät am Abend ein. Kate Burkholder macht sich sofort auf den Weg, die Feuerwehr ist alarmiert. Was zunächst nach Brandstiftung aussieht, entpuppt sich aber nach dem Fund einer männlichen Leiche als brutaler Mordfall.
Der 18-jährige Sohn der Familie Gingerich wurde bei lebendigem Leib verbrannt. Er starb eingeschlossen in einer brennenden Scheune. Daniel galt als tüchtig, freundlich und zuverlässig. Doch die Ermittlungen bringen auch eine dunkle Seite von ihm ans Licht. Eine Seite, von der die amische Gemeinde nichts wissen will, nur hinter vorgehaltener Hand wird getuschelt. Als Kate Burkholder den Dingen auf den Grund geht, finden sich plötzlich mehr Verdächtige, als ihr lieb ist. Jemand muss Daniel Gingerich grenzenlos gehasst haben. So sehr, dass er ihn in die Scheune lockte und sie anschließend anzündete.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Linda Castillo wurde in Dayton/Ohio geboren und arbeitete lange Jahre als Finanzmanagerin, bevor sie mit dem Schreiben anfing. Ihre Thriller, die in einer Amisch-Gemeinde in Ohio spielen, sind internationale Bestseller, die immer auch auf der SPIEGEL-ONLINE-Bestenliste zu finden sind. Die Autorin lebt mit ihrem Mann auf einer Ranch in Texas.
Inhalt
[Widmung]
[Motto]
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
Dank
Dieses Buch widme ich meiner verstorbenen Freundin Margaret Burris. Ihre Freundschaft, ihre Klugheit, ihre Stärke und ihr Humor haben mein Leben bereichert – und nicht zu vergessen der Spaß und selbst die Probleme und Sorgen, die wir in One Galleria Tower und auch sonst hatten. Alle, die sie kannten, werden sie sehr vermissen.
»Es ist ein Geist des Guten in dem Übel,
Zög’ ihn der Mensch nur achtsam da heraus.«
Shakespeare, Henry V.
Prolog
Sie hatte kein bisschen geschlafen. Sie schlief nachts schon lange nicht mehr durch. Zu viel Dunkelheit war um sie herum, aber keine, die sie mit Ruhe erfüllte. Als ihre Mamm bei Tagesanbruch in ihr Zimmer spähte und sie drängte, die Tiere zu füttern und sich für den Gottesdienst fertigzumachen, war sie hellwach. Und bereit.
Stets die gehorsame Tochter, streifte sie ihr Kleid über, band sich die Haare zum Knoten und setzte die Kapp auf. Dann zog sie die Wollstrumpfhose an, schlüpfte in die Sneakers und ging nach unten. Aber nicht in die Küche, wo ihre Mamm Wurst briet und mit dem Frühstücksgeschirr klapperte, sondern ins Wohnzimmer und von dort durch die Seitentür hinaus in die Kälte. Der Morgen war feucht und grau, Nieselregen fiel aus dem bleischweren Himmel. Im Stall gab sie den Pferden Heu und frisches Wasser, füllte Körner in den Futterspender der Hühner und sammelte sechs braune Eier ein.
Sie hatte ihre Eltern noch nie belogen. Kein einziges Mal in ihren siebzehn Lebensjahren. Aber als ihre Mamm sie aufforderte, sich für den Gottesdienst fertigzumachen, hatte sie behauptet, sich die halbe Nacht übergeben zu haben und sich nicht wohl zu fühlen. Natürlich missfiel ihrer Mamm, dass sie einen so wichtigen Tag versäumen würde, aber was konnte sie schon sagen?
Nachdem alle morgendlichen Pflichten erledigt waren, ging sie zurück in ihr Zimmer und legte sich aufs Bett. Sie starrte an die Decke und lauschte den Geräuschen im Erdgeschoss – den Stimmen ihrer jüngeren Geschwister, dem Kratzen des Bestecks auf Tellern, der Ruhe während des Dankgebets nach dem Essen. Kurz darauf, als ihr Datt hinausging, um dem Buggy-Pferd das Zaumzeug anzulegen, schlug die Tür zu, gefolgt vom Getrappel der Kleinen, die hinterherliefen, um ihm zu helfen.
Wie sehr alle ihr fehlen würden!
Um sechs Uhr dreißig schlug die Hintertür zu. Ein paar Minuten später klapperten die Hufe des alten Trabers auf dem Weg. Sie stand auf und trat ans Fenster, schob die Gardine beiseite und sah dem Buggy hinterher, der in Richtung Straße verschwand.
Zeit zu gehen.
Es war ein kalter Morgen, weit unter null Grad, aber sie zog keinen Mantel an. Sie öffnete ihre Zimmertür, trat in den Flur und ging die Treppe hinunter, wo die vertrauten Gerüche von Toast und Kaffee und dem Petroleum des Küchenherds in der Luft hingen. Sie dachte an ihre kleinen Brüder und Schwestern, und die Traurigkeit, die sie überkam, zwang sie fast in die Knie. Sie hatte gewusst, dass es schwer werden würde, aber auch, dass es keinen anderen Weg gab. Sie hatte Gott um Weisung gebeten, und im Gegensatz zu ihr log ER nie.
Unten an der Treppe ging sie nach links, weiter durch die Küche, wo sie den noch warmen Tee und trockenen Toast, die ihre Mamm auf dem Tisch hatte stehen lassen, zu ignorieren versuchte. Und doch entlockte ihr der Anblick ein Lächeln. Trockener Toast und Tee waren das Heilmittel ihrer Mamm für alle Krankheiten dieser Welt. Wenn das Leben doch nur so einfach wäre!
Es tut mir leid.
Die Worte hallten in ihrem Kopf wider, als sie zum Vorraum ging, die Hintertür aufstieß und hinaus in den frühmorgendlichen Nieselregen trat. Sie spürte weder Kälte noch Nässe, als sie den gepflasterten Fußweg entlang zur Scheune lief, die Schiebetür aufdrückte und den düsteren Innenraum betrat. Der Duft von Datts Pfeife stieg ihr in die Nase, vermischt mit den erdigen Gerüchen von Pferden, Alfalfa und feuchtem Boden. Rechts an der Wand stand der Heuwagen, eine Mistgabel lehnte daran. Geradeaus reckte der alte Ackergaul wiehernd den Kopf über die Stalltür. Normalerweise wäre sie zu ihm hingegangen und hätte seine Stirn gestreichelt, doch heute Morgen war dazu keine Zeit.
Links war die Treppe zum Heuboden. Ohne ihr Vorhaben noch einmal zu überdenken, stieg sie zügig hinauf. Hier oben gab es nur zwei schmutzige Fenster, durch die kaum Licht drang. Doch selbst im Halbdunkel kannte sie hier jeden Zentimeter. Der Heuboden war stets ihre Zuflucht gewesen, wenn es ihr ganz schlechtging. Aber heute Morgen suchte sie etwas, das hier verborgen war.
Zielstrebig ging sie zu dem kleinen Heuhaufen unter dem Fenster. Sie kniete nieder, schob ihn beiseite und legte das aufgerollte Seil frei, das sie gestern dort versteckt hatte. Datt hatte es letzten Sommer gekauft, um eine Schaukel für die Jungen zu bauen. Ein paar Meter waren übrig geblieben, die er im Schuppen für das nächste Projekt aufbewahrte.
Sie wickelte das Seil ab, wobei sie sich bemühte, nicht an ihre Familie zu denken – und daran, was sie ihnen allen antat. Sie würden zutiefst verletzt sein und es nicht verstehen. Aber es gab keinen anderen Weg. Gott hatte zu ihr gesprochen, und sie hatte auf ihn gehört. Nur so konnte sie ihr Geheimnis bewahren.
Das Seil war etwa drei Meter lang und knapp eineinhalb Zentimeter dick. Vielleicht war es aus Baumwolle, vielleicht auch nicht. Und es war sowieso egal. Sie nahm das Seil mit zu der Öffnung im Boden, wo die Deckenbalken frei lagen und sie hinunter bis zum Heuwagen, der Mistgabel und dem Pferd blicken konnte.
Sie legte sich auf den Bauch, wickelte das Seil um den nächstgelegenen Balken und band einen dreifachen Knoten. Sie zerrte ein paarmal daran und befand ihn für fest genug. Dann setzte sie sich auf und betrachtete das andere Ende, nicht ganz sicher, wie sie es machen sollte. Schließlich formte sie mit zittrigen Händen eine Schlinge, band sie ebenfalls mit drei Knoten fest und zurrte daran. Auch das würde halten.
Sie atmete tief durch, um sich zu beruhigen, zog die Schlinge über den Kopf, vorsichtig, damit die Kapp nicht verrutschte. Das Seil kratzte rau und hart auf ihrer Haut. Und dann liefen ihr Tränen übers Gesicht, doch sie sah darin einen Ausdruck der Freude, der Erleichterung. Ihre Mamm hatte immer gesagt, der Tod sei Teil des göttlichen Plans. An diesem Morgen glaubte sie das aus vollem Herzen. Sie wusste, dass Gott sie mit offenen Armen empfangen würde. Er würde ihr beistehen. Ihre Familie musste einfach auf Seine Weisheit vertrauen. Eines Tages würden sie alle wieder vereint sein.
Dennoch empfand sie einen Schauder, als sie aufstand, ihr war ganz mulmig, und ihre Beine zitterten. Sie dachte nicht daran, was gleich geschehen würde, doch sie betete, dass es schnell ging. Und dann war sie frei.
»Ich vergebe dir«, flüsterte sie.
Sie schloss die Augen, machte einen Schritt nach vorn und fiel ins Leere.
1. Kapitel
Sechs Monate später.
Er zog seine englische Kleidung an – Jeans, ein weißes T-Shirt und Cowboystiefel, für die er im Western-Store in Berlin, Ohio, einen Haufen Geld hingeblättert hatte.
Voller Vorfreude trat er aus seinem Schlafzimmer in den dunklen Flur. Er mochte die Heimlichtuerei nicht, die so sehr Teil seines Lebens geworden war, dass er sich dieser Tage kaum noch wiedererkannte. Aber er konnte nicht aufhören damit. Und so hatte er sich schließlich damit abgefunden.
Die Schlafzimmertür seiner Eltern war nur angelehnt; dahinter hörte er seinen Datt schnarchen. Die Tür des Zimmers seiner kleineren Schwestern stand halb offen. Als er vorbeischlich, glaubte er, ihren süßlichen Duft zu riechen. Die Tür seiner älteren Schwester war hingegen seit etwa einem Jahr nachts geschlossen. Pubertät, vermutete er. Auch Mädchen hatten ihre Geheimnisse.
Als er die Treppe hinunterging, machte er sich kaum Sorgen, erwischt zu werden. Er war ja gerade in der Rumspringa. In den letzten Monaten hatte er so ziemlich alles getan, wonach ihm der Sinn stand. Seine Eltern stellten sich blind und taub. Er hatte sein erstes Auto gekauft, seinen ersten Whisky getrunken und zum ersten Mal erlebt, wie sich ein Kater anfühlte. Er hatte seine erste Marlboro geraucht, war nachts lange unterwegs und kam nach Hause, wann es ihm passte. All das gehörte bei den Amischen zum Erwachsenwerden – und vielleicht war es sogar der beste Teil. Natürlich gefiel das Mamm und Datt nicht, aber sie hielten den Mund. Gegenüber den Schwestern erfanden sie Ausreden. Euer Bruder arbeitet viel, erzählten sie ihnen. Aber sie beteten für seine Seele.
Im ganzen Haus war es still und dunkel, nur durchs Wohnzimmerfenster fiel Licht herein, zwei graue Rechtecke inmitten endloser Schwärze. Der Geruch von Lampenöl und der Sandwiches mit gebratener Mortadella, die es zum Abendessen gegeben hatte, vermischte sich mit der kühlen Brise, die durch die Fliegengitter der Fenster drang. Als er in die Küche kam, nahm er den Zettel aus der Tasche. Er blieb vor dem Tisch stehen, zog eine winzige Taschenlampe aus der Gesäßtasche, leuchtete damit auf das Stück Papier und las es zum x-ten Mal.
Komm heute Nacht in die Scheune. Du wirst es nicht bereuen. ☺
Sie hatte die Worte mit einem lila Stift geschrieben und auf die is Herzchen gemalt. Beim Anblick des Smileys musste er grinsen. Er konnte es kaum fassen, dass sie endlich nachgeben würde. Nachdem er sie wochenlang bedrängt hatte, nach vielen schlaflosen Nächten voller Verlangen, das ihn oft und mit ungekannter Dringlichkeit überkam, würde sie endlich ihm gehören.
Er durfte keine Zeit verschwenden.
Als er durch die Hintertür nach draußen ging, fiel ihm ein, dass er dummerweise vergessen hatte, sich die Zähne zu putzen. Es war eine schwüle, windige Nacht. Am Himmel leuchteten Tausende Sterne, und im Osten prangte eine gelbe Mondsichel über den Baumkronen. Die wuchtigen Umrisse der Scheune in sechzig Meter Entfernung konnte er gerade noch so erkennen. Als er die Auffahrt überquerte und die Rampe hochging, knirschte der Schotter unter seinen Füßen. Die große Schiebetür stand dreißig Zentimeter weit offen. Sein Datt machte sie immer zu, damit die Füchse und Coyoten nicht über die Hühner herfielen. Sie ist hier, dachte er und wurde von so großer Erregung erfasst, dass seine Beine zitterten und sein Schritt stockte.
Als er durch die Tür trat, stieg ihm der Geruch von Pferden und von frisch geschnittenem Heu in die Nase. In der Scheune war es stockfinster, doch er kannte hier jeden Meter. Er konnte die Hand zwar nicht vor Augen sehen, wusste jedoch genau, wo die Laterne vom Deckenbalken hing, und fuchtelte mit dem Arm durch die Luft. Aber aus unerfindlichen Gründen war sie nicht da.
»Mist«, murmelte er, holte die Taschenlampe aus der Gesäßtasche und knipste sie an. Die Schatten wichen in die Ecken zurück und offenbarten ein Universum silbriger Stäubchen, die im Lichtstrahl tanzten.
»Hallo?«, rief er. »Bist du da?«
Er lauschte, bekam aber keine Antwort.
Verdutzt ging er an dem Wagen mit Heu vorbei, das sein Datt und er letzten Monat gemäht und gerade eingebracht hatten. Daneben stand der alte Gülleverteiler mit dem kaputten Rad, das er schon vor einer Woche versprochen hatte zu reparieren. Er wunderte sich, warum die zwei Buggy-Pferde in den Boxen ihn nicht begrüßten. Ganz egal, wie spät es war, für einen Snack waren sie eigentlich immer zu haben, und normalerweise meldeten sie sich lautstark. Er überquerte den Lehmboden, kam zu dem Holzpodest, auf dem sie die Leinensäcke mit Hafer, Mais und Hühnerfutter lagerten, blieb stehen und ließ den Lichtstrahl von rechts nach links wandern. Als er unter der Tür zur Sattelkammer einen schmalen Lichtstreifen entdeckte, musste er grinsen.
»Komm raus, komm, wo immer du steckst!« Mit auf den Boden gerichtetem Lichtstrahl ging er an dem Podest entlang.
Zuerst fand er es ein wenig merkwürdig, dass sie sich für die Sattelkammer entschieden hatte. Aber dann wurde ihm klar, dass die Kammer zwar klein war, der Holzboden aber täglich gekehrt wurde und es darin angenehm nach Leder und Sattelseife roch. Außerdem bewahrten sie dort die Pferdedecken auf, die Halfter und das Zaumzeug. Aber was noch wichtiger war: Die Tür hatte ein Schloss. Sein Datt hatte es angebracht, nachdem vor einigen Monaten ein Halfter, ein Sattel und zwei Ledergeschirre gestohlen worden waren. Er wusste, dass das auf das Konto des Englischen unten an der Straße ging, der die Sachen wahrscheinlich für schnelles Geld bei einer Pferdeauktion in Millersburg verscherbelte. Der Kerl war ein Dieb und obendrein ein Säufer.
Ohne sie überhaupt gesehen zu haben, reagierte sein Körper bereits, je näher er der Sattelkammer kam. Sein Datt hatte es lusht genannt und ihn vor ihrer Macht gewarnt. Aber was wusste ein alter Mann denn noch von Lust? Erinnerte er sich überhaupt noch, wie es mit achtzehn war? Wenn Gott die Lust in die Herzen der Menschen gepflanzt hatte, wie konnte das dann etwas Schlechtes sein?
Als er die Sattelkammer erreichte, drehte er am Knauf und öffnete die Tür. Goldenes Licht erhellte den kleinen Raum. Der Geruch von frisch geöltem Leder, von Petroleum und der Duft ihres Parfüms hingen in der Luft. Zwei Pferdedecken waren auf dem Boden ausgebreitet. Ein Teller mit einer flackernden Kerze stand auf der alten Zweihundertlitertonne. Sogar eine Flasche Wein hatte sie mitgebracht und zwei Plastikgläser mit Stielen! Bei dem Anblick verwandelte sich sein Lächeln in ein herzhaftes Lachen.
»Hier fehlt nur noch das Mädchen«, sagte er beim Betreten der Kammer, denn sie musste in Hörweite sein. »Ich frage mich, wo sie ist?«
Da er sie in der Nähe wähnte, knipste er die Taschenlampe aus und ging zu den Decken. Die Weinflasche war schon offen. Er legte die Taschenlampe auf die Tonne und ließ sich im Schneidersitz nieder, die Hände auf den Knien.
»Wenn sie nicht bald auftaucht, muss ich den Wein ganz allein trinken«, sagte er jetzt lauter. Sicher würde sie jeden Moment hereingerauscht kommen, kichernd und zu allem bereit. Sein Penis war schon erigiert, das erregte Pulsieren konnte er genauso wenig kontrollieren wie seinen Atem. Er stellte sich vor, wie sie ihren warmen Körper an seinen drückte, ihre festen Brüste, und konnte kaum glauben, dass er sie heute Nacht endlich besitzen würde.
Er griff nach der Flasche und schenkte sich ein, hatte im Geiste bereits das süße Aroma des Rotweins im Mund. Und während er sich noch vorstellte, was sie alles miteinander machen würden, knarrte die Tür. Sein Herz klopfte erwartungsvoll, doch dann knallte die Tür so heftig zu, dass die Halfter an der Wand wackelten.
Erschrocken setzte er die Flasche ab und stand auf.
Als er hörte, wie das Schloss einschnappte, sprang er zur Tür. »Was soll das, Süße?« Er drehte am Knauf, doch vergeblich.
»He!«, rief er. »Süße, dafür musst du büßen!«
Dann hörte er Geräusche in der Scheune. Etwas Schweres wurde über den Boden geschleift, knallte gegen die Tür. Verwirrt ruckelte er am Knauf, stieß ein Lachen aus. »Was hast du vor?« Es sollte scherzhaft klingen, aber es klang gereizt. Auf solche Spielchen hatte er keine Lust. Jedenfalls nicht heute Nacht.
»Hör auf damit, Süße!«, stieß er aus. »Es reicht mit den Späßchen! Komm her und leiste mir Gesellschaft!«
Plötzlich war es still. Neugierig drückte er das Ohr an die Tür und lauschte. Nichts.
»Wenn ich die Tür aufbrechen muss, wird dir das leidtun.« Er gab sich Mühe, locker und spielerisch zu klingen, doch seine Geduld war bald am Ende. »Hörst du mich?«
Er wartete einen Moment. Glaubte Schritte zu hören. Holz kratzte über Holz. Was hatte sie vor?
»Also gut, Süße. Mach, was du willst.« Er ruckelte noch einmal am Knauf, unterdrückte die aufsteigende Wut. »Dann trinke ich den Wein eben ohne dich.«
Keine Antwort.
Er trat einen Schritt zurück und warf sich mit der Schulter gegen die Tür, um zu sehen, wie stabil sie war. Die Tür bebte, hielt aber stand. Kopfschüttelnd ruckelte er wieder am Knauf. »Komm, Süße, lass mich raus. Was immer ich dir getan habe, ich mach’s wieder gut.«
Als erneut keine Antwort kam, wurde er wütend. Er warf sich wieder mit der Schulter gegen die Tür, die auch diesmal nur heftig bebte. Er wollte gerade ein drittes Mal Anlauf nehmen, als er Rauch wahrnahm. Nicht von Kerzen oder Laternen und auch nicht von einer Zigarette. Etwas brannte.
Und dann sah er entsetzt, dass Qualm unter der Tür durchdrang. Es brannte tatsächlich, Holz und Heu, vielleicht auch Petroleum. Was zum Teufel ging hier vor?
Jetzt reichte es ihm wirklich. Er schlug mit der flachen Hand an die Tür. »Mach auf!«, schrie er wütend. »Du fackelst noch die verdammte Scheune ab. Mach schon. Das ist nicht mehr witzig!«
Er ging ein paar Schritte zurück, nahm Anlauf und warf sich mit voller Wucht gegen die Tür. Das Holz knarrte, aber mehr auch nicht. Als er die Hand daranlegte, war es ganz warm. Sollte das vielleicht ein Scherz sein? Was dachte sie sich nur dabei?
»Was du da gerade veranstaltest, ist gefährlich!«, schrie er. »Hör auf mit dem Scheiß, und mach sofort die verdammte Tür auf!«
Er lauschte, hörte aber nur ein Knistern, das wie Feuer klang. Das ist kein Spiel, dachte er, und alle Alarmglocken fingen an zu läuten. Angst kroch ihm den Nacken hinauf. Er machte einen Schritt zurück, hob das Bein und trat mit voller Wucht rechts neben den Türknauf. Wieder krachte es, diesmal lauter. Ein zweiter Tritt folgte, ein Stück Türpfosten splitterte, und er konnte den Schließmechanismus sehen. Er fing an zu husten, schwarz und dick drang Rauch jetzt unter der Tür hindurch und machte ihm das Atmen schwer.
»Es reicht!«, schrie er. »Bist du verrückt? Mach die Tür auf!«
Wieder nahm er Anlauf und rammte die Schulter gegen die Tür. Schmerz durchzuckte sein Schlüsselbein, aber das ignorierte er. Der Spalt war größer geworden, er drückte die Handballen mit aller Kraft gegen die Tür, doch etwas blockierte sie von draußen, zu schwer, um es wegzuschieben. Durch den Spalt drangen Rauch und Hitze und Flammen in die Kammer, versengten ihm Gesicht und Hände und brannten in den Augen. Er taumelte zurück, entsetzt über das Ausmaß des Feuers. Er konnte es nicht fassen, dass sie so fahrlässig handelte – dass das alles hier überhaupt passierte.
»Hey! Lauf los, und hol Hilfe!« Er blickte wild um sich, packte die Weinflasche und schleuderte die Flüssigkeit in die Flammen. Aber zum Löschen reichte das nicht, das Feuer schluckte sie gierig und wollte mehr.
Die Hitze war jetzt so stark, dass er weiter zurückwich. Immer mehr Rauch drang durch den Türspalt, heiße schwarze Schwaden drängten ihn weiter zurück. Gelbe Flammen züngelten am Holz, immer größer und näher und näher. Er winkelte den Arm an, hielt ihn vors Gesicht und rannte zur Tür, warf sich mit dem ganzen Körper dagegen. Die Hitze versengte ihm die Schulter, eine Hälfte des Gesichts, das Ohr, doch er fühlte keinen Schmerz. Das Schloss hatte jetzt nachgegeben, der Spalt war ein paar Zentimeter größer geworden. Doch seine Hoffnung schwand sofort wieder, denn hohe Flammen drangen durch die Öffnung, gierten nach Nahrung, verschlangen das trockene Holz, fraßen sich in die Bodenbretter.
»Hilf mir!«, schrie er. »Verdammt nochmal! Hilfe!«
Rauch und Flammen drangen immer tiefer in die Kammer, die Hitze fraß allen Sauerstoff, setzte seine Lungen in Brand. Er hörte sich keuchen und japsen, jeder Atemzug glühte wie heiße Kohle in seinem Hals. Um Luft ringend, sah er sich nach irgendetwas um, mit dem er sich ins Freie kämpfen konnte.
Sein Blick fiel auf den selbstgebauten Sattelhalter, zwei Bretter, die wie ein umgedrehtes V zusammengefügt und mit langen Nägeln an der Wand befestigt waren. Er warf den Sattel zu Boden, hob das Bein und trat mit ganzer Kraft von oben auf die Bretter. Kreischend kamen die rostigen Nägel ein Stück aus der Wand, der Sattelhalter hing nach unten, er trat erneut darauf, und die Bretter fielen zu Boden. Wieder schöpfte er Hoffnung. Er packte eins der Bretter und lief zur Tür, schwang es wie einen Baseballschläger mit voller Wucht dagegen. Einmal, zweimal.
Beim dritten Mal krachte das Holz durch die Tür. Doch auch die neue Hoffnung wurde sofort von dem Feuer, das wie ein wildes Tier durch das Loch schoss, zerstört. Flammen loderten hinauf bis zur Decke.
Jetzt hatte ihn die Panik voll im Griff. Der Brand war außer Kontrolle. Auf dem Speicher lagerten dreißig Ballen Heu, die wie Zunder brennen würden. Wenn sie Flammen fingen, käme er hier nicht lebend raus.
Keuchend und fluchend stolperte er zurück. Die Hitze war unerträglich, der Rauch nahm ihm die Luft. Er riss sich das T-Shirt vom Leib, sank auf die Knie und drückte es auf Nase und Mund. Dann rollte er sich auf den Rücken, winkelte die Beine an und trat mit den Stiefeln gegen die Tür, einmal, zweimal.
Die Tür schwang krachend auf. Holzsplitter, Asche und Funken regneten auf ihn herab, brannten sich in seine nackte Brust, in Arme und Gesicht. Eine Lawine heißer Luft rollte über ihn hinweg, beißender Rauch füllte seine Nase, brannte in seinen Augen. Glühende Asche fraß sich durch seine Jeans und verbrannte seine Haut. Verzweifelt schlug er die kleinen Funken weg, aber es waren zu viele, und die Hitze war zu groß, die Luft wurde immer knapper. Lieber Gott …
Ein Feuerball barst in den Raum, eine wilde, brüllende Bestie, die sich auf ihn senkte und ihre glühenden Zähne in ihn grub. Rauch drohte ihn zu ersticken. Erst da wurde ihm das ganze Ausmaß seiner Lage bewusst. Er schrie, wälzte sich auf dem Boden, schlug mit den Armen, um dem Schmerz zu entfliehen, doch es gab kein Entkommen.
Seine Lungen standen in Flammen, Lippen und Zunge verbrannten. Die Luft war zu heiß zum Atmen, seine Augen, längst blind von Hitze und Rauch, verglühten in ihren Höhlen, um ihn herum der Gestank von brennendem Fleisch. Ich sterbe, dachte er, noch immer ungläubig, dass ihm das passieren konnte.
»Datt! Datt!« Aber seine Worte waren kaum mehr als erstickte Schreie. Er rollte sich über den Boden, schlug nach den Flammen, die seinen Körper verschlangen, stieß gegen die Wand. Endstation.
Er versuchte zu schreien, doch der Speichel in seinem Mund kochte, die Zunge brannte.
Laut brüllend fegte ein letzter Feuerball über ihn hinweg, glühend rot und gefräßig, verschlang ihn mit Haut und Haaren, bis nur noch eine unkenntliche Masse von ihm übrig war.
2. Kapitel
Wenn man als Polizeichefin einer Kleinstadt um vier Uhr morgens angerufen wird, verheißt das nie etwas Gutes. Ich drehe mich auf die Seite und taste nach meinem Handy, sehe mich schon mit einer schlimmen Nachricht konfrontiert, einem tödlichen Verkehrsunfall oder, Gott bewahre, dass einem meiner Officer oder gar meiner Familie etwas passiert ist.
»Burkholder«, sage ich mit rauer Stimme.
»Tut mir leid, Sie zu wecken, Chief«, meldet sich Mona Kurtz, die nachts im Revier die Telefonzentrale besetzt. »Ich hab gerade einen Anruf bekommen, dass draußen auf der Gingerich-Farm die Scheune brennt, und dachte, Sie wollen das sicher wissen.«
Die Familie Gingerich ist mir bekannt. Miriam und Gideon sind Amische und leben auf einer kleinen Farm einige Meilen außerhalb von Painters Mill. Näher kenne ich sie nicht. Es ist eine nette Familie, die ein ruhiges Leben führt. Soweit ich weiß, wohnen vier ihrer Kinder immer noch zu Hause.
Ich stütze mich auf den Ellbogen und hieve mich in Sitzposition. »Jemand verletzt?«
»Ist noch unklar. Ich hab mit einem der Männer von der freiwilligen Feuerwehr gesprochen, und der meinte, die Familie könnte noch nicht sagen, wo ihr Sohn Danny steckt.«
Sofort beschleicht mich ein ungutes Gefühl. Ich schlage die Bettdecke zurück und stelle die Füße auf den Boden. »Hat schon jemand etwas zur Brandursache gesagt?«
»Keiner weiß was.«
»Ich mache mich auf den Weg.«
Ich drücke auf »beenden«, rolle mich aus dem Bett und gehe zum Wandschrank, wo meine Uniform hängt.
»Was ist los, Chief?«
Im Licht des beleuchteten Wandschranks sehe ich John Tomasetti, meinen Lebensgefährten, der sich gerade aufsetzt und mit zusammengekniffenen Augen auf den Wecker blickt. Seine Haare sind zerzaust, und selbst in dem düsteren Licht kann ich die Bartstoppeln an seinem Kinn und die Sorge in seinen Augen erkennen.
»Auf der Gingerich-Farm brennt es«, sage ich und ziehe die Bluse über. »Ist schon alles in die Wege geleitet. Schlaf weiter.«
»Ist jemand verletzt?«
Das ist immer die erste Frage eines Polizisten. Besitz kann ersetzt werden, ein Leben nicht. Ich nehme meine Hose, gehe zum Bett und schlüpfe hinein. »Ein Sohn im Teenageralter wird noch vermisst.«
»Mist.« Er schiebt die Decke beiseite. »Soll ich mitkommen?«
»Nicht nötig, schlaf noch eine Runde.«
»Ich muss erst um neun im Büro sein.«
Tomasetti ist Agent im Ohio Bureau of Criminal Identification and Investigation, kurz BCI, und arbeitet in Richfield, eine halbe Stunde nördlich von hier. Da Painters Mill in seinen Zuständigkeitsbereich fällt, wäre es nicht ungewöhnlich, wenn er zu einem Scheunenbrand fährt. Zumal es einen Vermissten gibt. Allerdings müssen wir vorsichtig sein, denn wir haben unser Zusammenleben bewusst nicht an die große Glocke gehängt. Lange kann es aber nicht mehr dauern, bis es rauskommt, und heute Morgen müssen wir das Risiko eingehen. Ein Junge wird vermisst, und Tomasetti hat viel mehr Möglichkeiten, eine Suche zu organisieren, als unser kleines Polizeirevier.
Ich hole meinen Ausrüstungsgürtel mit der .38er aus der Kommode, schnalle ihn um, während ich das Fußende des Bettes umrunde, und stelle mich vor ihn. »Hat dir schon mal jemand gesagt, dass du ein Masochist bist?«
»Hat dir schon mal jemand gesagt, wie gut du mit der .38er aussiehst?«
»Nur du.«
Er steht auf und gibt mir einen Kuss, wobei sein Mund etwas zu lange auf meinen Lippen verweilt, was mir durchaus gefällt.
»Kennst du die Familie?«, fragt er.
»Kaum, wir sind uns ein paarmal begegnet. Sie sind Amische, gut angesehen.«
Er geht um mich herum zum Wandschrank und zieht ein Hemd vom Kleiderbügel. »Hoffen wir mal, dass der junge Mann auftaucht, bevor wir da sind.«
Die Flammen des Feuers schlagen so hoch, dass ich bereits aus einer halben Meile Entfernung den orangefarbenen Schein über den Baumkronen sehen kann. Ich muss das Gebäude gar nicht erst vor Augen haben, um zu wissen, dass der Schaden enorm sein wird. Als ich in die Straße zu den Gingerichs einbiege, brennt die eine Hälfte ihrer wuchtigen Scheune lichterloh.
Ich stelle meinen Dienstwagen auf einem grasbewachsenen Seitenstreifen ab, ein Tanklöschfahrzeug der Holmes-County-Feuerwehr rattert gerade vorbei. Ich bin kaum ausgestiegen, da trifft Tomasetti schon mit seinem Tahoe ein und parkt hinter mir. Hundert Meter von uns entfernt schießen zwölf Meter hohe Flammen in die Luft, greifen mit tausend feurigen Fingern in den Nachthimmel.
Asche und Glut wirbeln überall umher wie Schnee. Der Gestank von Rauch, verbranntem Holz und unzähligen anderen Materialien vermischt sich mit den Gerüchen von Diesel und Abgasen. Vier Feuerwehrautos aus zwei Bezirken stehen mit ratternden Motoren auf dem Schotter zwischen Haus und Scheune. In einigem Abstand von der Scheune spritzen Feuerwehrmänner mit Schläuchen Löschwasser in die Flammen.
Auf halbem Weg zum Haus holt Tomasetti mich ein. Als wir den seitlichen Hof überqueren, stürzt mit lautem Getöse ein Teil des Scheunendaches ein. Funken wirbeln durch den Nachthimmel.
»Hoffentlich hatten sie Zeit, die Tiere rauszuholen«, sage ich, als wir die Veranda hochsteigen.
Die Tür geht auf, noch bevor ich klopfen kann. Eine amische Frau kommt heraus, Ruß und Panik im Gesicht. Ihre Kapp ist verrutscht, die Jacke hängt lose über den Schultern. Sie sieht mich an, zittert am ganzen Körper. »Wir können Danny nicht finden«, bricht es aus ihr heraus.
»Sonst sind alle da?«, frage ich.
»Ja, aber Danny müsste auch hier sein, in seinem Zimmer. Ich kann ihn nirgends finden.« Sie dreht sich um und geht zurück ins Haus, lässt die Tür offen.
Tomasetti und ich folgen ihr. Im Wohnzimmer riecht es nach Kerzenwachs und dem Rauch, der durchs offene Fenster hineinweht. Auf dem selbstgezimmerten Beistelltisch brennt eine Laterne. Die amische Frau führt uns in die Küche, wo ebenfalls eine Laterne kreisrundes Licht auf einen großen Tisch wirft, an dem sechs Stühle stehen. Durch das Fenster über der Spüle flackert das Licht vom Scheunenfeuer herein.
Wortlos geht die Frau zu der weit offenen Hintertür, tritt hinaus auf die Veranda und starrt auf die brennende Scheune. Ein Stück entfernt stehen unzählige Rettungswagen mit Blaulicht, Feuerwehrleute in Schutzanzügen laufen zwischen Haus und Scheune hin und her.
»Danny ist Ihr Sohn?«, frage ich.
»Ja.«
»Wie alt ist er?«
»Gerade achtzehn geworden.« Sie dreht sich zu mir um, die Arme fest um den Körper geschlungen, das Gesicht von Sorge gezeichnet.
Ich spüre Tomasettis Blick im Rücken, als ich auf sie zutrete. »Wann haben Sie ihn zuletzt gesehen?«, frage ich.
Sie blinzelt, als wolle sie ihrem überlasteten Gehirn einen Stoß geben, damit es anfängt zu arbeiten. »Letzte Nacht. Er ist früh ins Bett gegangen, weil er die Nacht vorher lange aus war. Heute Morgen muss er zur Arbeit.«
»Im Haus haben Sie überall gesucht?«
»Da zuallererst. In jede Ecke haben wir geguckt.« Sie schenkt mir nur ihre halbe Aufmerksamkeit, starrt weiter zur Scheune, als könnte sie kraft ihres Blickes ihren Sohn herbeizaubern.
»Kann es sein, dass er früh aufgestanden und gegangen ist, ohne Bescheid zu sagen?«, frage ich. »Vielleicht wollte er Überstunden machen. Oder er hat sich mit einem Freund zum Frühstück verabredet.«
Sie schüttelt den Kopf »Danny hat ein Auto. Ein altes, mit dem fährt er, seit er in der Rumspringa ist. Gideon erlaubt ihm nicht, auf dem Grundstück zu parken, deshalb stellt er es immer ans Ende vom Weg. Es steht noch da.«
Vage erinnere ich mich, unten an der Wegmündung einen alten Chevy unter einem Walnussbaum gesehen zu haben. Ich hatte mir nichts dabei gedacht und nur das Feuer im Auge gehabt. Aber das verheißt nichts Gutes für ihren Sohn.
»Ist es möglich, dass er von jemandem abgeholt wurde«, frage ich. »Einem Kollegen oder von der Freundin?«
»Warum sollte ihn jemand mitten in der Nacht abholen?« Sie sieht mich an. »Er hat ja selber ein Auto und muss erst um acht bei der Arbeit sein. Danny schläft gern lang, besonders seit er so viel unterwegs ist.«
Mit gequälter Miene blickt sie wieder zur brennenden Scheune. »Vielleicht haben sie ihn ja inzwischen gefunden. Vielleicht ist er ja da draußen und hilft den Feuerwehrmännern beim Löschen.«
Tomasetti berührt sie am Arm. »Ich sehe mal nach.«
Hoffnung scheint in ihren Augen auf, unbändige, wilde Hoffnung. »Mein Mann ist auch da. Er macht sich furchtbare Sorgen, aber die Feuerwehrmänner lassen ihn nicht so nah an die Scheune ran.«
»Haben Sie ein bisschen Geduld.« Tomasetti nickt mir kurz zu und geht. Wir treten von der Veranda zurück in die Küche.
Mein Funkgerät knistert mit Dutzenden Meldungen, die durchgegeben werden, und ich reduziere die Lautstärke. »Mrs Gingerich, ich würde gern noch einmal das Haus checken, während wir auf Nachricht warten. Nur um sicherzugehen, dass auch überall nachgesehen wurde.«
»Mamm?«
Ein Mädchen im Teenageralter kommt zur Küchentür herein. Ihr Gesicht ist rot und verheult. Sie hat über das Nachthemd eine Arbeitsjacke gezogen und an den Füßen matschige Socken.
»Habt ihr Danny gefunden?«, fragt sie.
»Noch nicht.« Die Frau ringt ihre Hände, geht einen Schritt auf das Mädchen zu und wieder zurück zur offenen Hintertür. »Ich bin sicher, er ist hier irgendwo.«
»Danny ist dein Bruder?«, frage ich das Mädchen.
»Ja.«
»Wann hast du ihn zuletzt gesehen?«
»Kurz bevor er in sein Zimmer gegangen ist. Wir haben auf der Veranda Eis gegessen, und dann ist er hoch ins Bett.«
»Wie spät war das?«
»Ungefähr zehn Uhr.«
»Du hast in seinem Zimmer nachgesehen? Im Bad?«
Die amische Frau antwortet anstelle des Mädchens. »Natürlich, das hab ich doch schon gesagt. Da ist er nicht.«
Ich sehe weiterhin das Mädchen an. »Können wir beide noch einmal das Haus checken? Badezimmer, Wandschränke. Nur um ganz sicherzugehen. Kannst du mir dabei helfen?«
Wir brauchen nicht lange, um festzustellen, dass Danny nicht da ist. Die beiden kleinen Mädchen schlafen noch friedlich in ihrem gemeinsamen Zimmer.
Oben im Flur halte ich das Mädchen am Arm fest. »Wie heißt du?«, frage ich.
»Fannie.«
»Ich heiße Kate.« Ich reiche ihr die Hand, die sie kraftlos schüttelt. »Hat Danny ein Handy?«, frage ich.
»Handys erlaubt die Ordnung nicht«, sagt das Mädchen und bezieht sich dabei auf die ungeschriebenen Regeln ihrer Kirchengemeinde.
Ich hake trotzdem nach. »Aber er ist doch in der Rumspringa, nicht wahr? Vielleicht hat er sich ja eines besorgt und wollte nicht, dass eure Eltern das wissen.«
Fannie schüttelt den Kopf. »So was macht er nicht.«
Ich nicke, weiß es aber besser. Es ist sehr wahrscheinlich, dass ein achtzehnjähriger amischer Junge in der Rumspringa ein Handy hat.
Rumspringa ist ein deitshes Wort und bezeichnet eine Zeit, in der amische Jugendliche die Welt erkunden dürfen, ohne sich an die amischen Regeln zu halten. Diese Tatsache gibt mir Hoffnung, dass er sich mitten in der Nacht einfach weggeschlichen und niemandem davon erzählt hat. Denn das geht nach der Rumspringa alles nicht mehr. Man wird dann getauft und tritt der Kirche bei.
Zuletzt gehe ich in Dannys Zimmer. Fanny kommt hinter mir her. Wie in den meisten amischen Schlafzimmern, steht auch in diesem kein Schrank. Die Kleidung hängt gewöhnlich an Holzhaken, die Schuhe stehen entlang der Wand. Mir fällt sofort auf, dass ein Haken leer ist. Und unter dem Bett sind Arbeitsstiefel.
Ich zeige auf die Stiefel. »Ist das sein einziges Paar Schuhe?«
Sie legt den Kopf schief, sieht die Schuhe an und verzieht das Gesicht. »Seine Cowboystiefel sind weg.« Sie fängt an zu weinen.
»Cowboystiefel?«
Sie zieht ein zerfleddertes Papiertaschentuch aus der Tasche und wischt sich damit über die Augen. »Die hat er sich vom ersten selbstverdienten Geld gekauft. Er hat einen Job in der Stadt und ist total vernarrt in die Stiefel.« Ein Laut entfährt ihrem Mund, halb Schluchzen, halb Lachen. »Er meint, die Mädchen würden voll darauf abfahren. Ich finde sie furchtbar hässlich, aber er zieht sie überallhin an.«
Ich berühre sanft ihren Arm. »Fannie, vielleicht hat er sich heimlich rausgeschlichen, um einen Freund oder sogar eine Freundin zu treffen. Gib die Hoffnung nicht auf. Wir haben gerade erst angefangen, ihn zu suchen.«
Das Gesicht des Mädchens hellt sich auf, doch Hoffnung entdecke ich nicht darin. »Luanes Mamm und Datt würden nie erlauben, dass sie das Haus nach Einbruch der Dunkelheit verlässt, schon gar nicht mit einem Jungen. Auch nicht mit einem guten Jungen wie Danny.«
»Luane ist seine Freundin?«
»Ja.« Wieder fängt sie an zu weinen, doch sie fasst sich schnell. »Ihre Eltern sind Swartzentruber. Also sehr strikt. Sie lieben Danny wie einen Sohn, aber so etwas würden sie trotzdem nicht zulassen.«
»Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg«, murmele ich und zeige zur Treppe. »Lass uns noch mal mit deiner Mamm reden.«
Kurz darauf sitzen Miriam, Fannie und ich am Küchentisch und versuchen, das Stimmengewirr, die Motoren und Sirenen vor dem Haus zu ignorieren. Miriam hat Kaffee gekocht, doch keinem ist nach Kaffeetrinken zumute.
»Fannie hat mir erzählt, Danny hätte eine Freundin«, sage ich.
Die amische Frau nickt. »Luane Raber. Ein nettes Mädchen, erst sechzehn. Sie passen gut zusammen. Sie werden wohl einmal heiraten …«
»Haben die Rabers ein Telefon?«, frage ich. »Vielleicht ist er zu ihr hingefahren.«
»Sie sind Swartzentruber und brauchen kein Telefon.«
Ich drücke auf mein Ansteckmikro. »T.J.? Wo sind Sie gerade?«
T.J. Banks ist der jüngste Officer in meinem kleinen Revier und noch ein Greenhorn. Da er die wenigsten Dienstjahre hat, kriegt er meistens die Nachtschicht aufs Auge gedrückt.
»Ich stelle an der Straße zur Gingerich-Farm Lichtkegel auf, Chief.«
»Ich möchte, dass Sie zur Farm von Mose und Sue Raber in der Dogleg Road fahren. Sagen Sie ihnen, dass es auf der Farm der Gingerichs brennt und wir Daniel suchen. Finden Sie heraus, ob er dort ist. Sehen Sie in Scheunen und Nebengebäuden nach. Und stellen Sie sicher, dass ihre Tochter Luane zu Hause ist. Sie müssen selbst mit ihr sprechen, falls er sich ohne Wissen ihrer Eltern heimlich mit ihr trifft.«
»Wird gemacht.«
Ich wende mich wieder Miriam zu. »Daniel ist in der Rumspringa, nicht wahr?«
»Ja. Er ist in dem Alter.«
»Mrs Gingerich, fällt Ihnen irgendein Ort ein, wohin er gegangen sein könnte? Wo wir ihn finden können?« Ich sehe von Miriam zu ihrer Tochter. »Gibt es Freunde, die er vielleicht besucht?«
Fannie schüttelt den Kopf. »Dann hätte er den Wagen genommen.«
»Es sei denn, jemand hat ihn abgeholt«, gebe ich zu bedenken.
Miriam Gingerich schließt die Augen, schüttelt den Kopf. »Seine Freunde haben alle kein Auto, Chief Burkholder. Danny arbeitet viel, er spart Geld. Er hat sich den Wagen vor ein paar Monaten gekauft und fährt damit, wann immer er kann.«
An der Hintertür klopft es. Noch bevor Miriam sich erhebt, geht die Tür auf, und Tomasetti betritt die Küche. Er wirft mir einen kurzen Blick zu, und ich weiß schon, was er sagen wird.
Miriam steht auf. »Haben Sie ihn gefunden?«
Tomasetti verneint. »Wir suchen ihn noch, Ma’am.«
Ich stehe auf, entschuldige mich und gehe mit Tomasetti nach draußen. Wir stehen auf der kleinen Veranda, beobachten die Rettungsfahrzeuge und die Feuerwehrmänner. Die Scheune brennt noch immer, aber nicht mehr so schlimm wie zuvor. Rauch und Dampf steigen in den Nachthimmel, und Dachsparren liegen frei, doch der Großteil des Dachs ist dem Feuer zum Opfer gefallen.
»Sind die Tiere in Sicherheit?«, frage ich.
»Darüber wollte ich mit dir reden.«
Ich sehe ihn verwundert an.
»Vor ein paar Minuten habe ich mit Gideon Gingerich gesprochen. Er hat mir erzählt, dass er und Danny abends gegen acht Uhr die beiden Buggy-Pferde und vier Kälber in die Scheune gebracht haben, wo sie über Nacht bleiben.«
Ich ahne, was als Nächstes kommt, und meine Sorge wächst.
»Die zwei Pferde und die Kälber waren hinter der Scheune auf der Weide«, sagt er.
»Jemand hat sie rausgebracht«, sage ich leise.
»Sieht so aus.«
»Ein Feuerwehrmann? Vielleicht einer der Ersten, die vor Ort waren?«
»Gingerich meinte, dass die Scheune bereits in Flammen stand, als die Feuerwehr anrückte. Die Tiere sind schon vorher rausgebracht worden.«
»Interessant.«
»Laut Feuerwehrchef ein bisschen zu interessant.«
Ich warte.
»Kate, jemand hat die Tiere ins Freie gebracht. Aber es war weder Gideon Gingerich noch einer der Feuerwehrleute.«
»Vielleicht war es Daniel«, sage ich. »Vielleicht ist er aufgewacht, hat Rauch gerochen, nachgesehen und das Feuer entdeckt.«
»Oder er war sauer wegen irgendwas oder wütend auf seine Eltern und hat die Scheune abgefackelt. Aber die Tiere zu töten hat er nicht fertiggebracht.«
»Wenn er geflohen wäre, dann bestimmt mit seinem Auto.«
»Glaube ich auch.« Tomasetti sieht mich ernst an. »Wir müssen ihn finden, Kate.«
»Aus vielerlei Gründen.«
»Der Feuerwehrchef hat einen Brandermittler angefordert. Der wird sich das hier genau ansehen.«
»Geht er von Brandstiftung aus?«, frage ich.
»Er ist zumindest misstrauisch genug, um einen Brandermittler hinzuzuziehen.« Er sieht mich von der Seite an. »Aber vielleicht ist der Feuerwehrchef auch nur sehr genau. Höchstwahrscheinlich hat bloß einer vergessen, die Laterne auszumachen, und der Glaszylinder ist zu heiß geworden, oder eine streunende Katze hat sie umgeworfen, und schon war’s passiert.«
»Oder Danny Gingerich hat das Feuer gelegt und dann Panik gekriegt.«
»Es gibt viele Möglichkeiten. Immerhin war in der Scheune eine Menge Heu. Gingerich hatte dreißig Ballen auf dem Speicher gelagert, die wie Zunder gebrannt haben.« Er zuckt mit den Schultern. »Aber die Tatsache, dass der Junge verschwunden ist und die Tiere freigelassen wurden, rechtfertigt in seinen Augen eine genaue Untersuchung.«
Ich nicke zustimmend, doch die diversen Möglichkeiten machen mir Sorgen. »Der Wagen des Jungen steht unten an der Straße.«
»Ich hab ihn gesehen, als ich in die Zufahrt gebogen bin.« Er runzelt die Stirn. »Warum hat er ihn da geparkt?«
»Seine Eltern sind nicht gerade begeistert über das Auto und erlauben ihm nicht, es auf dem Grundstück abzustellen. Das kenne ich auch von anderen Familien.«
»Gab es böses Blut zwischen Daniel und seinen Eltern?«
»Bisher hatte ich nicht den Eindruck, aber ich bohre noch ein bisschen tiefer, vielleicht finde ich ja was.«
An der Hüfte vibriert mein Telefon, ich blicke aufs Display und sehe T.J.s Namen. »Was haben Sie rausgefunden?«, frage ich.
»Ich bin noch draußen auf der Raber-Farm, Chief«, sagt er. »Hab mit den Eltern und Luane, der Tochter, gesprochen. Daniel Gingerich war seit ein paar Tagen nicht mehr hier.«
»Danke, dass Sie das gecheckt haben.«
»Keine Ursache.«
»Können Sie mir noch einen Gefallen tun, bevor Sie Feierabend machen?«
»Schießen Sie los.«
»Fahren Sie die weitere Umgebung von Gingerichs Farm ab. Sprechen Sie mit den Nachbarn, vielleicht hat ja einer Daniel gesehen.«
»Wird gemacht.«
Ich lege auf und sehe Tomasetti an. »Wenn Daniel Gingerich sich verdrückt hat, dann nicht nur ohne sein Auto, sondern auch ohne seine Freundin.«
»Klingt nicht gerade typisch für einen Achtzehnjährigen.« Tomasetti zieht sein Handy aus der Jackentasche, blickt aufs Display und steckt es wieder zurück. »Ich muss los. Halt mich auf dem Laufenden, okay?«
»Danke, dass du mitgekommen bist.«
»Immer wieder gern.« Er sieht nach rechts und nach links, aber es sind zu viele Leute hier, um einen Kuss zu riskieren. Stattdessen schenkt er mir ein Grinsen. »Man sieht sich.«
3. Kapitel
Es ist bereits Mittag, als ich ins Revier komme. Vorher habe ich noch mit Fred Achin, dem Feuerwehrchef von Millersburg, gesprochen, den ich schon von anderen Einsätzen her kenne. Er ist ein Familienmensch, ein guter Chef und erfahrener Feuerwehrmann. Die Scheune war zwar noch zu heiß, als dass sie schon hineingehen konnten, aber ich erfuhr, dass sie fast zwanzigtausend Liter Wasser zum Löschen gebraucht hatten. Fred ging davon aus, dass sie sich am Nachmittag daranmachen konnten, den Schutt unter die Lupe zu nehmen.
Sowie es hell geworden war, hatte ich das Grundstück und die nahe Umgebung zu Fuß erkundet, aber nichts Nennenswertes entdeckt – weder Hinweise auf einen Wagen noch verdächtige Fußspuren. Normalerweise lassen Polizisten es erst einmal langsam angehen, wenn ein Achtzehnjähriger vermisst wird. Aber in Anbetracht des suspekten Feuers und der relativ langen Zeit ohne ein Lebenszeichen von Daniel Gingerich suchen wir bereits offiziell nach ihm. Ich hatte mich auch noch einmal mit seinen Eltern zusammengesetzt. Wenn Amischen ein Unglück widerfährt, reagieren sie zunächst meist stoisch. Trotzdem sind die Eheleute natürlich äußerst beunruhigt, dass ihr Sohn verschwunden ist. Sie haben mir eine Liste mit den Namen von Dannys Freunden gegeben und der Orte, wo er hingegangen sein könnte. Ich habe ihnen versprochen, jeden Stein umzudrehen. Ob er etwas mit dem Brand zu tun hatte oder nicht, ihn zu finden hat oberste Priorität.
Der starke Rauchgeruch meiner Uniform steigt mir in die Nase, als ich mich am Schreibtisch niederlasse und den Computer hochfahre. Ich habe kaum meinen ersten Schluck Kaffee getrunken, da klingelt das Telefon. Es ist Fred Achin.
Sofort überkommt mich eine böse Vorahnung. Ich weiß, dass er Neuigkeiten für mich hat – und dass es keine guten sind.
»Wir haben eine Leiche in der Scheune gefunden«, sagt er.
»O verdammt.« Ich springe auf. »Irrtum ausgeschlossen?«
»Absolut.«
Sofort wird mir klar, was das alles nach sich ziehen wird. »Ist sie schon identifiziert?«
»Nein.«
»Hat schon jemand mit den Gingerichs gesprochen?«
»Nein. Der Brandermittler hat die Überreste erst vor wenigen Minuten entdeckt. Aber ich wusste, dass Sie sofort benachrichtigt werden wollen.«
»Dann ist der Brandermittler schon vor Ort?«
»Seit einer Stunde.« Er hält inne. »Offiziell ist es zwar nicht, aber er geht von Brandstiftung aus. Er hat Spuren eines Brandbeschleunigers gefunden. Benzin.«
»Was für Spuren?«
»Man kann es riechen.«
Dass das Feuer wahrscheinlich gelegt wurde, macht das Ganze noch schlimmer. »Haben Sie Doc Coblentz angerufen?«, frage ich. Doc Coblentz ist der für Holmes County zuständige Leichenbeschauer.
»Er steht als Nächster auf meiner Anrufliste.«
»Fred, können Sie damit noch einen Moment warten?« Ich nehme meine Autoschlüssel. »Ich bin in zehn Minuten auf der Farm. Wir wissen zwar noch nicht, wer der Tote ist, aber die Familie muss trotzdem von dem Leichenfund erfahren.« Es fällt mir schwer, die richtigen Worte zu finden. »Ich sollte ihnen die Situation erklären, bevor sie den Wagen des Leichenbeschauers sehen.«
»Sie haben recht, Chief. Um diese Aufgabe beneide ich Sie wirklich nicht.« Er stößt einen Seufzer aus. »Ich warte dann noch, aber beeilen Sie sich.«
Ich mache das Blaulicht an, fahre an der Main Street bei Rot über die Ampel und erreiche die Gingerich-Farm in Rekordzeit. Da ich auf dem letzten Stück Schotterweg mein Tempo nicht drossele, schlagen von unten Steine an meinen Wagen, und eine dicke Staubwolke folgt mir. Etwa zehn Meter vor der ausgebrannten Scheune steht ein einzelnes Löschfahrzeug der freiwilligen Feuerwehr von Painters Mill, für den Fall, dass noch Glut in den Trümmern schwelt und sich entzündet. Den schwarzen SUV ein Stück weiter weg sehe ich zum ersten Mal. Dann sind da noch ein roter Suburban und ein rot-weißer Van mit dem Logo der Brandermittlungsbehörde von Ohio. Fred Achin und zwei mir unbekannte Männer stehen neben Freds Wagen und unterhalten sich. Beim Haus ist ein schöner brauner Traber vor einen Buggy gespannt und am Pfosten angebunden. Der Wagen des Leichenbeschauers ist nirgends zu sehen. Fred hat Wort gehalten.
Ich stelle meinen Explorer hinter dem Buggy ab und habe das Haus noch nicht erreicht, als die Tür aufgeht. Gideon Gingerich tritt auf die Veranda, den flehentlichen Blick auf mich gerichtet.
»Haben Sie Nachrichten von meinem Sohn?«
Seine Frau Miriam erscheint neben ihm und starrt mich an, als wolle sie mir mit Blicken Informationen entreißen. »Haben Sie ihn gefunden?«
Ich steige die Stufen zur Veranda hinauf, sehe von einem zum anderen. »Können wir ins Haus gehen und uns kurz hinsetzen?« Ich zeige zur Tür. »Bitte.«
Wortlos stößt Gideon die Tür auf und bedeutet mir mit der Hand einzutreten.
Kein Polizist weiß, wie jemand reagieren wird, wenn er eine schreckliche Nachricht erhält. Deshalb bleibt mir an diesem Punkt nichts anderes übrig, als die Fakten darzulegen und die Ungewissheit zu betonen, ob es sich bei der Leiche tatsächlich um ihren Sohn handelt.
Das Paar mittleren Alters, das am Küchentisch der Gingerichs sitzt – wahrscheinlich Nachbarn –, begrüße ich mit einem Kopfnicken. Sie machen ein ernstes Gesicht, tragen ihre besten Kleider und sind hier, um die Familie zu unterstützen. Das ist für Amische ganz selbstverständlich.
Ich wende mich an Miriam und Gideon Gingerich. »Kann ich kurz mit Ihnen allein sprechen?«
»Das sind mein Bruder und meine Schwägerin.« Gideon weist mit dem Kopf zu ihnen. »Was immer Sie für Nachrichten bringen, Chief Burkholder, sie können es hören.«
Ich nicke dem Paar noch einmal zu und sehe wieder die Gingerichs an. »Zuerst möchte ich Ihnen mitteilen, dass wir noch keine definitiven Neuigkeiten zum Verbleib Ihres Sohnes haben.« Ich halte kurz inne. »Aber Sie sollten wissen, dass in der Scheune eine Leiche entdeckt wurde.«
Miriam Gingerich stößt einen Laut aus, wie ein kleines Tier, das langsam zu Tode gequält wird. Sie hebt die Hand, als wolle sie nicht, dass ich weiterspreche, krümmt sich leicht und tritt vom Tisch weg. »Nein. Nein.«
»Wir wissen nicht, ob es Daniel ist«, beharre ich. »Die Identität des Leichnams wurde noch nicht festgestellt, aber der Coroner ist auf dem Weg hierher. Wenn die Leiche geborgen ist, beginnt der Identifizierungsprozess.«
Gideons Lippen zittern, er öffnet den Mund, als wolle er etwas sagen, aber kein Ton kommt heraus.
»Ein Brandermittler von der Feuerpolizei ist eingetroffen, um den Brandherd und die Ursache des Feuers herauszufinden.«
»Die … tote Person in der Scheune …« Der amische Mann flüstert die Worte mit rauer Stimme. »Glauben Sie, es ist Daniel?«
»Das kann im Moment nicht ausgeschlossen werden«, antworte ich aufrichtig. »Ich würde Ihnen gern bessere Nachrichten bringen, aber wir wissen es einfach noch nicht.«
»Wer sollte es denn sonst sein?«, bricht es aus Miriam hervor. »Unser lieber Danny. Ich kann es nicht glauben.«
Miriams Schwägerin steht auf, geht zu ihr hin und legt ihr die Hände auf den Arm. »Du moosht ohheicha netda Deivel.« Hör nicht auf den Teufel. »Solange es nicht sicher ist, darfst du nur das Beste glauben.«
In dem Moment taucht Fannie Gingerich im Flur auf. Sie bleibt vor der Küchentür stehen, die Hände auf den Schultern ihrer beiden etwa vier oder fünf Jahre alten, jüngeren Schwestern. Die Blicke von drei Augenpaaren huschen von mir zu ihren Eltern und zurück zu mir.
»Was ist passiert?«, fragt Fannie.
Als niemand antwortet, fängt sie an zu weinen. Die kleinen Mädchen blicken zu ihr hoch, sehen ihr Gesicht und beginnen ebenfalls zu weinen.
»Seid still.« Miriam schließt die beiden Kleinen in die Arme, die zu ihr gelaufen kommen und das Gesicht an ihren Busen drücken. »Ihr müsst jetzt still sein, hört ihr? Es liegt alles in Gottes Hand, und wir müssen Ihm vertrauen, dass Er uns helfen wird.«
Ich wende mich an Gideon. »Kann ich kurz draußen mit Ihnen sprechen?«
Er nickt und folgt mir auf die Veranda. Ich gebe ihm einen Moment, sich zu sammeln, während wir zu den schwarzen Überresten der Scheune blicken, in der gerade zwei Männer in Schutzkleidung verschwinden. Doc Coblentz scheint auch schon eingetroffen zu sein, jedenfalls steht sein Escalade nur ein paar Meter vom Absperrband entfernt.
»Mr Gingerich«, beginne ich. »Der Brandermittler meinte, dass das Feuer womöglich mit einem Brandbeschleuniger entfacht wurde. Er glaubt, es ist Benzin.«
Der amische Mann sieht mich mit schmerzverzerrtem Gesicht an. »Wollen Sie damit sagen, jemand hat das Feuer gelegt? Dass unsere Scheune absichtlich niedergebrannt wurde?« Er senkt den Kopf und wischt sich mit der Hand über die Augen, als könnte er das alles nur schwer verkraften.« »Mein Gott. Danny …«
»Bewahren Sie Benzin in der Scheune auf?«, frage ich mit sanfter Stimme. »Oder irgendwo auf Ihrem Grundstück?«
Er schüttelt den Kopf. »Die Ordnung verbietet die Benutzung von Benzin. Wir benutzen nur Diesel für den Generator.«
»Gibt es jemanden, von dem Sie sich vorstellen könnten, dass er das getan hat? Mit oder ohne Absicht?«
Er schüttelt entschieden den Kopf. »Nein.«
»Haben Sie mit irgendjemandem eine Meinungsverschiedenheit gehabt? Probleme mit Nachbarn oder Bekannten? Fremden? Familienmitgliedern?«
»Nein.«
»War jemand wütend auf Sie oder jemanden in Ihrer Familie?«
Erneutes Kopfschütteln. »Wir kommen mit allen gut aus.«
»Was ist mit Geschäftspartnern? Englischen oder amischen? Irgendjemand?«
»Nein. Nein.«
Die nächste Frage stelle ich mit Bedacht, denn er wird sie nicht gern hören. »Mr Gingerich, gab es Probleme oder Meinungsverschiedenheiten zwischen Ihnen und Daniel?«
»Danny?« Er sieht mich an, als hätte ich gerade Benzin ausgeschüttet und es selbst angezündet. »Nein, nie«, sagt er mit zittriger Stimme. »Er ist ein guter Junge.«
»Hat Danny –«
»Nein!«, schneidet er mir das Wort ab, die Stimme sowohl tränenerstickt als auch warnend. »Keine Fragen mehr.«
»Mr Gingerich, bitte –«
»Genug!« Er dreht sich um und stößt die Tür auf. »Wenn Sie uns helfen wollen, Chief Burkholder, dann finden Sie endlich meinen Sohn.«
Er wirft einen letzten Blick über die Schulter, geht ins Haus und lässt die Tür hinter sich zufallen.
Zehn Minuten später stehe ich hinter dem gelben Absperrband, das um die Scheune gezogen ist, und sehe den beiden Ermittlern bei ihrer Arbeit zu. Die meisten Außenmauern sind noch intakt, aber mehrere Dachsparren sind gebrochen und haben einen Teil des Dachs zum Einsturz gebracht.
»Nur gut, dass die Feuerwehr so schnell hier war, sonst wäre nur noch Asche von dem Gebäude übrig.«
Mit diesen Worten kommt Doc Coblentz auf mich zu, eine Arzttasche in der Hand. Er ist ein rundlicher Mann mit einem unglücklichen Händchen für Kleidung und einer bekannten Schwäche für Fastfood. Als einer von sechs Ärzten in Painters Mill ist er zudem seit fast zwölf Jahren der zuständige Leichenbeschauer.
»Hi, Doc.« Ich gehe ihm entgegen, und wir geben uns zur Begrüßung die Hand. »Danke, dass Sie so schnell gekommen sind.«
Er wirft einen vielsagenden Blick zur Scheune. »Da soll eine noch nicht identifizierte Leiche drin sein.«