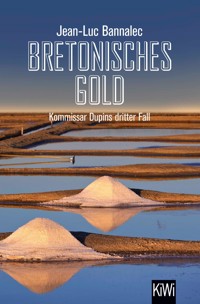
10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kommissar Dupin ermittelt
- Sprache: Deutsch
Bretonische Salzgärten, mysteriöse Vorkommnisse und ein Kommissar auf heißer Spur - Dupin ermittelt in einem neuen spannenden Fall voller Überraschungen! Die spektakulären Salzgärten auf der Guérande-Halbinsel. Der Veilchenduft des Fleur de Sel in der Erntezeit, von dem die alten Salzbauern erzählen, er erzeuge bisweilen Hirngespinste. Das glaubt auch Kommissar Dupin, als er in den Salinen aus heiterem Himmel angegriffen wird. Eigentlich war Kommissar Dupin froh, dem leidigen Papierkram zu entkommen und einen Ausflug ins »Weiße Land« zwischen tosendem Atlantik und idyllischen Flüssen zu unternehmen. Doch als er sich dort für Lilou Breval, eine befreundete Journalistin, nach mysteriösen Fässern umsieht, gerät er unversehens unter Beschuss. Der Täter ist nicht auszumachen, und wenig später verschwindet Breval spurlos. Seiner Sekretärin Nolwenn und dem Ehrgeiz des Präfekten ist es zu verdanken, dass Dupin in diesem Fall ermitteln darf. Aber nicht allein, denn die zuständige Kommissarin des Départements heißt Rose – und macht ihrem Namen alle Ehre … Was geht in den Salzgärten vor sich? Dupin und Rose suchen fieberhaft nach Anhaltspunkten und stoßen zwischen dem malerischen Golfe du Morbihan und den atemberaubenden Salinen auf falsche Alibis, gewaltige Interessenkonflikte, persönliche Fehden – und immer wieder auf urbretonische Geschichten. In seinen fesselnden Krimis um Kommissar Dupin aus der Bretagne bietet Jean-Luc Bannalec die ideale Urlaubslektüre: Mit feinem Witz und einem Gespür für die Region bringt er seine Leser in die bemerkenswerte Bretagne, wo man die frische Atlantikbrise förmlich inhaliert. Die Krimi-Bestseller aus der Bretagne sind in folgender Reihenfolge erschienen: - Bretonische Verhältnisse - Bretonische Brandung - Bretonisches Gold - Bretonischer Stolz - Bretonische Flut - Bretonisches Leuchten - Bretonische Geheimnisse - Bretonisches Vermächtnis - Bretonische Spezialitäten - Bretonische Idylle - Bretonische Nächte - Bretonischer Ruhm - Bretonische Sehnsucht - Bretonische Versuchungen Die Bücher erzählen eigenständige Fälle und können unabhängig voneinander gelesen werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 480
Veröffentlichungsjahr: 2014
Sammlungen
Ähnliche
Jean-Luc Bannalec
Bretonisches Gold
Kommissar Dupins dritter Fall
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Jean-Luc Bannalec
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Jean-Luc Bannalec
Jean-Luc Bannalec ist ein Pseudonym; der Autor ist in Deutschland und im südlichen Finistère zu Hause. Die ersten sieben Bände der Krimireihe mit Kommissar Dupin, »Bretonische Verhältnisse«, »Bretonische Brandung«, »Bretonisches Gold«, »Bretonischer Stolz«, »Bretonische Flut«, »Bretonisches Leuchten« und »Bretonische Geheimnisse«, wurden für das Fernsehen verfilmt und in zahlreiche Sprachen übersetzt. 2016 wurde Jean-Luc Bannalec von der Region Bretagne mit dem Titel »Mécène de Bretagne« ausgezeichnet. Seit 2018 ist er Ehrenmitglied der Académie littéraire de Bretagne.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
»Das hat Charme. Es ist eine Hommage an eine raue Landschaft und das Savoir-vivre ihrer Menschen, an alte Zünfte und ihre Werkzeuge.« Der Freitag
»Diese Figur wird so anschaulich gezeichnet wie die herrliche Landschaft, in der sie agiert, und der Plot ist komplex und raffiniert gebaut.« Sächsische Zeitung
»[Bannalec] ist auch diesmal ein locker-leichter Ferienkrimi mit hohem Spannungspotenzial gelungen.« Kölner Stadt-Anzeiger
»Wie bei den vorangegangenen Fällen arrangiert der Autor liebevoll kulinarische Abenteuer, bretonische Volkskunde und Geschichte.« Tiroler Tageszeitung
»Dass der Leser […] eine ganze Menge über die Bretagne und die Bretonen lernt, ist einer der schönen Nebeneffekte dieses spannenden […] Krimis.« Südwest Presse
»Macht Spaß, ist spannend: eine Reihe, die mit jedem Buch besser wird.« Grazia
»Nach dem Lesen möchte man sofort an den französischen Nordatlantik reisen. Und dort genau das essen, was auch Dupin isst.« Neue Luzerner Zeitung
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
© 2014, 2015, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Covergestaltung: Rudolf Linn, Köln
Covermotiv: © Thierry RYO – Fotolia.com
Kartografien: Birgit Schroeter, Köln
ISBN978-3-462-30776-4
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses Zusatzmaterial ist auch auf unserer Homepage zu finden:
https://www.kiwi-verlag.de/magazin/extras/die-karten-zu-bretonisches-gold
Inhaltsverzeichnis
Motto
Widmung
Der erste Tag
Der zweite Tag
Der dritte Tag
Es war abgekühlt, nicht ...
Mit dem Betreten der ...
Dank
Leseprobe »Bretonische Versuchungen«
Bis man weiß, woran man miteinander ist, muss man sieben Säcke Salz zusammen verbrauchen.
Bretonisches Sprichwort
à L.
Der erste Tag
Das eigentümliche Veilchenaroma, welches das Fleur de Sel in den Tagen nach der Ernte verströmte, vermischte sich mit dem Geruch von schwerer Tonerde sowie dem Salz und Jod in der Luft, die man hier, mitten im Weißen Land – dem Gwenn Rann, der weitflächigen Salinenlandschaft der Guérande –, mit jedem Atemzug noch stärker roch und schmeckte als anderswo an der Küste. Der besondere Duft erfüllte jetzt, am Ende des Sommers, die gesamten Salzgärten. Die alten Paludiers, die Salzbauern, erzählten, dass er einen zuweilen um den Verstand bringe, Trugbilder und Hirngespinste erzeuge.
Es war eine atemberaubende, bizarre Landschaft. Eine Landschaft aus den vier Elementen, die die Alchemie des Salzes ausmachten: dem Meer, der Sonne, der Erde und dem Wind. Eine große Meeresbucht einst, dann eine Lagune, ein Watt, Schwemmland, das sich geschickte Menschenhand zunutze gemacht hatte, gelegen auf einer Halbinsel, die der tosende Atlantik zwischen Loire und Vilaine geschaffen hatte. Das stolze mittelalterliche Städtchen Guérande – das der Gegend seinen Namen gegeben hatte – markierte die nördliche Ausdehnung der Salzgärten. Im Süden verloren sie sich in das verbliebene Stück der Lagune, auf deren gegenüberliegender Seite Le Croisic mit seinem bezaubernden Hafen lag. Von dort aus konnte man es sehen, ein eindrucksvolles Schauspiel: Im mächtigen Rhythmus der Gezeiten versorgte der Atlantik die Lagune mit Wasser und führte es den feinen Kapillaren der Salzgärten zu. Insbesondere an den Tagen der »grande marée«, der Springflut, den Tagen nach dem Vollmond.
Ganz und gar flach war das Weiße Land, ohne die kleinste Erhebung. Seit über zwölf Jahrhunderten gegliedert in zahllose große, kleinere und sehr kleine mathematisch genau angelegte rechteckige Salinenbecken, die wiederum in willkürlich scheinenden, fließenden Formen aus Erde und Wasser eingefasst waren. Ein unendlich verzweigtes, ausgeklügeltes System von Kanälen, Speicherbecken, Vorwärmbecken, Verdunstungsbecken, Erntebecken. Ein System, das nur einen Zweck hatte: das durch Schleusen eingefangene Meer, so langsam es ging, auf eine Reise zu schicken, auf der Sonne und Wind es dann beinahe restlos verdunsten ließen, bis sich die ersten Kristalle ausbildeten. Das Salz war die reine Essenz des Meeres. »Kind der Sonne und des Windes« nannte man es. Poetische Namen hatte man den Becken gegeben: Vasières, Cobiers, Fares, Adernes, Œillets. Eines der Œillets, der Erntebecken, wurde unverändert seit Karl dem Großen bestellt. Die Erntebecken waren die Heiligtümer der Paludiers, von ihnen, ihrem »Charakter«, hing alles ab: von ihren Böden, den verschiedenen Tonarten und ihren unterschiedlichen mineralischen Zusammensetzungen. Faul, generös, vergnügt, fiebrig, empfindlich, hart, widerspenstig – die Paludiers sprachen von ihnen wie von Menschen. In ihnen wurde unter freiem Himmel das Salz gezogen und gepflückt. Das weiße Gold.
Abenteuerlich schmale, unbefestigte Wege schlängelten sich entlang der Becken und bildeten unentwirrbare Labyrinthe, zumeist nur zu Fuß zugänglich. War das Salzland auch flach, so vermochte man dennoch nie weit zu sehen, bewachsene Erdwälle in verschiedenen Höhen liefen entlang der Becken und Wege. Struppige Büsche, Sträucher, hohe windschiefe Gräser, von der Sonne strohig-gebleicht. Hier und da ein knorriger Baum. Wild verteilt standen die cabanes, die Schuppen der Salzbauern, aus Stein, Holz, Blech.
Und nun, im September, war allenthalben das grell blendende Weiß des sich im Laufe des Sommers zu ansehnlichen Bergen auftürmenden Salzes zu sehen. Kunstvoll gehäuft, oben spitz zulaufend, wie Vulkane, zuweilen zwei, drei Meter hoch.
Kommissar Georges Dupin vom Commissariat de Police Concarneau musste schmunzeln. Es war eine unwirkliche Landschaft. Eine fantastische Szenerie. Verstärkt wurde die Stimmung durch den Exzess aus Farben am Himmel und im Wasser – eine extravagante Schau der verschiedensten Töne von Violett, Rosa, Orange und Rot –, den die untergehende Sonne auslöste. Mit der langsam hereinbrechenden Spätsommernacht hatte zudem nach einem neuerlich brütend heißen Tag eine erlösend frische Brise eingesetzt.
Kommissar Dupin schloss den Wagen ab, einen offiziellen, blau-weiß-roten Polizeiwagen. Der beeindruckend alte und problematisch winzige Peugeot 106 diente dem Kommissariat als allgemeiner Ersatzwagen. Dupins eigener, innig geliebter, gleichermaßen höchst betagter Citroën XM stand seit zehn Tagen in der Werkstatt. Die Hydropneumatik, wieder einmal.
Dupin hatte am Straßenrand geparkt, halb in den Gräsern. Von hier aus würde er zu Fuß gehen.
Es war ein schmales, immerhin noch asphaltiertes Sträßchen, das sich chaotisch durch die Salinen schlängelte. Es war nicht leicht zu finden gewesen, es ging von der Route des Marais ab, einer der drei kurvigen Straßen zwischen Le Croisic und Guérande-Stadt, die überhaupt durch das Salzland führten.
Dupin blickte sich um. Es war niemand zu sehen. Auf der ganzen Route des Marais war er keinem Wagen begegnet. In den Salinen schien der Tag zu Ende gegangen zu sein.
Er besaß lediglich eine handgezeichnete Skizze des Ortes, zu dem er wollte. Sie zeigte einen Schuppen nahe einer der Salinen, eher Richtung offener Lagune. Vielleicht dreihundert Meter entfernt. Er würde die fragliche Saline suchen, den dazugehörigen Schuppen, und Ausschau halten nach »irgendetwas Verdächtigem« – es war zugegebenermaßen alles abstrus.
Er würde sich einmal umschauen und dann schnurstracks auf den Weg nach Le Croisic machen. So stellte Dupin es sich vor: dass er nach einer kurzen, vermutlich ergebnislosen Inspektion des Ortes eine Viertelstunde später im Le Grand Large eine bretonische Seezunge essen würde, in gesalzener Butter goldbraun gebraten. Und bei einem Glas kalten Quincy auf das Wasser blicken, die hellsandige türkisfarbene Lagune, und langsam im Westen das letzte Licht schwinden sehen. Er war schon einmal in Le Croisic gewesen, letztes Jahr, mit seinem Freund Henri, und hatte beste Erinnerungen an das Städtchen (auch an die Seezunge).
Kommissar Dupin war – ungeachtet der Tatsache, dass es äußerst vage, zweifelhafte, eigentlich lächerliche Gründe waren, die ihn hierhergeführt hatten – ausgesprochen guter Laune am heutigen Abend. Er hatte nämlich das übermächtige Bedürfnis gehabt, endlich wieder ins Freie zu kommen. Fünf Wochen hatte er – mehr oder weniger Tag für Tag – in seinem muffig-stickigen Büro zugebracht. Fünf Wochen! Beschäftigt mit stupider Schreibtischarbeit, formalem Kram, den gewöhnlichen Schikanen der Bürokratie – mit Arbeiten, aus denen das Leben eines echten Kommissars, anders als in Büchern und in Filmen, dann doch immer wieder bestand: neue Dienstwagen für seine beiden Inspektoren, damit einhergehend neue »Vorschriften für die Nutzung der zur Ausübung des polizeilichen Dienstes überlassenen Fahrzeuge«, achtundzwanzig Seiten lang, 9-Punkt-Schrift und praktisch kein Zeilenabstand, »extrem wichtig«, mit einer »Anzahl entscheidender Neuerungen«, wie es vonseiten der Präfektur hieß; eine Gehaltserhöhung für Nolwenn (immerhin!), seine universell-patente Sekretärin, für deren Durchsetzung er zwei Jahre und neun Monate gekämpft hatte; die penible Ablage zweier alter und durchweg unwesentlicher Fälle. Das war sein Rekord gewesen, seit er aus Paris ans Ende der Welt »versetzt« worden war. Fünf Wochen Büroarbeit, in diesen magischen September-Spätsommertagen, deren zauberhaftes Licht das der anderen Monate sogar noch einmal überbot. Wochen eines stabilen, spektakulären Azorenhochs, bilderbuchartig, nicht ein Tropfen Regen war gefallen – »La Bretagne fait la cure du soleil«, die Bretagne macht eine Sonnenkur, hatten die Zeitungen geschrieben. Fünf Wochen, in denen sich Dupins Übellaunigkeit beinahe von Tag zu Tag gesteigert hatte. Es war unerträglich geworden, für alle.
Lilou Brevals Bitte, sich die Saline anzusehen – auch wenn er natürlich überhaupt gar nichts mit diesem Gebiet hier zu schaffen hatte –, war nur ein allzu willkommener Vorwand gewesen, einen veritablen Ausflug zu unternehmen. Jede Ausrede war Dupin am Ende recht gewesen. Und, viel wichtiger: Er war Lilou Breval schon lange etwas schuldig. Der Journalistin des Ouest-France, die sich von Polizeibeamten eigentlich prinzipiell fernhielt – nicht zuletzt weil sie bei ihren Recherchen mit zumeist unorthodoxen Methoden nicht selten in Konflikte mit polizeilichen und gesetzlichen Vorschriften geriet –, die aber irgendwie Vertrauen zu ihm gefasst hatte. Dupin achtete und mochte sie.
Lilou Breval hatte ihn das eine oder andere Mal mit »gewissen Informationen« versorgt. Im Fall des ermordeten Hoteliers in Pont Aven vor zwei Jahren, der am Ende ganz Frankreich beschäftigt hatte, hatte sie Dupin zuletzt »geholfen«. Lilou Breval war weniger in das journalistische Tagesgeschäft eingebunden, sondern auf die großen Recherchen und Geschichten spezialisiert, sehr bretonische Geschichten zumeist. Investigativ. Vor zwei Jahren hatte sie einen nicht geringen Anteil an der Aufdeckung eines gigantischen Zigarettenschmuggels gehabt: 1,3 Millionen Zigaretten waren in einem riesigen Betonpfeiler versteckt worden, der angeblich für eine Bohrinsel vor der Küste gebaut worden war.
Lilou Breval hatte Dupin gestern Abend angerufen und – das hatte sie noch nie getan – ihn um etwas gebeten: sich einmal »eine bestimmte Saline und einen Schuppen dort« anzusehen. Nach »verdächtigen Fässern« zu schauen, »blaue Plastikfässer«. Sie könne noch nicht sagen, worum es gehe, aber sei sich »einigermaßen sicher«, dass »etwas richtig faul« sei. Dass sie nach seiner Inspektion so bald wie möglich im Kommissariat vorbeikommen werde, um ihm alles darzulegen, was sie bis dahin wisse. Dupin hatte nicht im Geringsten verstanden, was das alles sollte, hatte jedoch nach einigem erfolglosen Nachfragen irgendwann »gut, ja« gemurmelt, und Lilou Breval hatte ihm heute früh eine Skizze des Weges und Ortes gefaxt. Natürlich wusste er, dass er gegen alle Vorschriften verstieß, und hatte sich eben auf der Hinfahrt sogar ein klein wenig unwohl dabei gefühlt, was für gewöhnlich gar nicht Dupins Art war. Er hätte schon rein formal nicht hierherkommen dürfen beziehungsweise: Er hätte die örtliche Polizei bitten müssen, der Sache nachzugehen. Nicht zuletzt, weil das Département Loire-Atlantique, in dem die Salinen lagen, administrativ gesehen nicht mal mehr Bretagne war – geschweige denn »sein Terrain« –, seit es den Bretonen im Zuge der von ihnen verhassten »Reform der Verwaltungsstrukturen« in den Sechzigern »mit legalisierter Gewalt« entrissen worden war. Kulturell, im Alltag und auch im Bewusstsein der Franzosen und ohnehin der ganzen Welt war das Département selbstverständlich bis heute durch und durch bretonisch.
Doch der kurze Moment des Zweifels war schnell verflogen.
Dupin schuldete Lilou Breval etwas, und das nahm er sehr ernst. Ein guter Polizist war darauf angewiesen, dass ihm jemand ab und an einen Gefallen tat.
Kommissar Dupin stand neben dem Dienstwagen, den er mit seiner insgesamt stattlichen Physis und den breiten Schultern auffällig überragte. Er warf zur Sicherheit noch einmal einen Blick auf die Skizze. Dann lief er über die Straße und folgte dem grasigen Weg. Schon nach wenigen Metern begannen links und rechts die ersten Salinenbecken, in die der Weg an den Rändern ohne Übergang scharf abfiel. Einen Meter, einen Meter fünfzig tief, schätzte Dupin. Die Becken hatten die unterschiedlichsten Farben – hellbeige, hell-gräulich, gräulich-bläulich, andere erdig-bräunlich, rötlich, alle durchzogen von schmalen Tonstegen und Dämmen. An den Rändern stolzierten Vögel, die vollkommen geräuschlos auf der Suche nach Nahrung zu sein schienen, Dupin hatte keine Ahnung, wie sie hießen, sein ornithologisches Wissen war mangelhaft.
Es war wirklich eine verrückte Landschaft. Das Weiße Land, so schien es, gehörte nur tagsüber den Menschen, abends und nachts wieder ganz der Natur. Es war still, kein Geräusch zu hören, im Hintergrund nur eine Art seltsames Zirpen, von dem Dupin nicht hätte sagen können, ob es Vögel waren oder Grillen. Fast ein wenig gespenstisch. Nur selten schrie eine zänkische Möwe, eine Botschafterin des nahen Meeres.
Es war vielleicht doch eine blödsinnige Idee gewesen, hierherzukommen. Selbst wenn er etwas Auffälliges sähe – was nicht der Fall sein würde –, er würde ohnehin sofort die Kollegen vor Ort informieren müssen. Dupin blieb stehen. Vielleicht sollte er direkt nach Le Croisic fahren. Und den abstrusen Auftrag vergessen. Aber – er hatte es Lilou Breval versprochen.
Dupins Hadern wurde vom Schrillen seines Handys unterbrochen, es wirkte in dieser meditativen Stille noch lauter als sonst. Widerwillig fingerte er das kleine Gerät hervor. Seine Gesichtszüge hellten sich auf, als er Nolwenns Nummer sah.
»Ja?«
»Bonj--- aire. --- da?«, eine kleine Pause, dann: »---uft--- Und haben --- Strecke ---as Kän---ru---?«
In der Leitung knackte es fürchterlich.
»Ich verstehe Sie nicht, Nolwenn. Ich bin schon in den Salinen, ich …«
»Sie--- zwischen den bei--- Ich--- lich --- Kängur--- wissen.«
Dupin hätte schwören können, bereits zum zweiten Mal das Wort »Känguru« gehört zu haben. Aber womöglich vertat er sich. Er sprach jetzt deutlich lauter.
»Ich – verstehe – wirklich – kein – Wort. Ich – rufe – Sie später – an.«
»--- nur --- gen --- ter«, die Verbindung schien vollständig zusammenzubrechen.
»Hallo?«
Keine Reaktion.
Dupin hatte keinen Schimmer, was Nolwenn mit einem australischen Beuteltier wollte. Es klang grotesk. Aber er zerbrach sich nicht weiter den Kopf darüber. Nolwenn war hier, am Ende der Welt, ohne Zweifel die wichtigste Person für ihn. Und auch wenn er das Gefühl hatte, mittlerweile selbst schon ein Stück »bretonisiert« zu sein, so war er ohne sie verloren. Tatsächlich hieß Nolwenns Programm »Bretonisierung«, nach dem Motto: »Die Bretagne: Du liebst sie – oder du verlässt sie!«.
Er schätzte Nolwenns praktisches und soziales Genie sowie ihr schier unendliches regionales und lokales Wissen. Und ihre Leidenschaft für Skurrilitäten und »gute Geschichten«. Um eine solche würde es sich bei dem Känguru handeln.
Dupin hatte sich gerade wieder auf seine kleine Mission konzentriert, als das Telefon erneut klingelte. Er nahm automatisch ab.
»Verstehen Sie mich jetzt, Nolwenn?«
Eine Weile hörte er nichts, nur wieder heftiges Knacken.
Dann jäh ein paar einigermaßen gut zu verstehende Worte:
»Ich freue mich --- Morgen, Georges. Sehr.«
Claire. Es war Claire. Sofort wurde die Verbindung wieder schlecht.
»--- aurant --- icher --- bend.«
»Ich – ich komme morgen Abend. Ja, natürlich!«
Es entstand eine Pause. Der ohne Vorwarnung ein ohrenbetäubendes Rauschen folgte. Morgen war Claires Geburtstag. Er hatte einen Tisch im La Palette reserviert, ihrem Lieblingsrestaurant, im Sechsten. Ein großes Bœuf Bourguignon mit deftigem Speck und jungen Champignons, in bestem Rotwein über viele Stunden geschmort, das Fleisch konnte man mit dem Löffel essen, so zart war es. Es sollte eine Überraschung sein, auch wenn er annahm, dass Claire es längst erraten hatte, wie immer hatte er zu viele Andeutungen gemacht. Er wollte den Zug um dreizehn Uhr fünfzehn nehmen, dann wäre er um sechs in Paris.
»Schien --- wischen --- zu kommen? Ist – - – mer – - – unsicher?«
»Nein. Nein. Gar nicht. Nichts ist unsicher! Ich bin um sechs da. Ich hab schon die Fahrkarte.«
»Ich --- dich schlecht ---.«
»Ich dich auch. Ich wollte nur sagen, dass ich mich sehr freue. Auf morgen Abend, meine ich.«
»--- nur --- Essen ---.«
»Ich hab alles arrangiert, mach dir keine Gedanken.«
Dupin sprach wieder zu laut.
»--- Fisch --- später.«
Das war sinnlos.
»Ich – rufe – dich – später – an – Claire.«
»--- vielleicht --- später --- Arbeit --- besser---.«
»Gut.«
Er legte auf.
Nach ihrem Treffen letztes Jahr in den späten Pariser Augusttagen, das sehr schön gewesen war, hatten sie begonnen, täglich zu telefonieren und sich regelmäßig zu sehen. Meist spontan, sie waren einfach in den TGV gestiegen. Ja, sie waren wieder zusammen. Auch wenn sie es nicht ausgesprochen hatten. Und es noch keinesfalls offiziell war, obgleich Dupin den verheerenden Fehler gemacht hatte, es in einem unbedachten Moment vage seiner Mutter gegenüber zu erwähnen, die sofort überhaupt nicht vage entzückt gewesen war, nun vielleicht doch noch zur lang ersehnten Schwiegertochter zu kommen.
Claire war gerade in den USA gewesen, eine Fortbildung an der kardiologischen Chirurgie der berühmten Mayo-Klinik. Sie hatten sich also die letzten sieben Wochen nicht gesehen, auch wenn sie häufig telefoniert hatten. Ohne Zweifel war das ein weiterer Grund für Dupins Verdrießlichkeit der letzten Zeit gewesen. Claire war erst seit zwei Tagen wieder zurück. Und dies war nun wiederum wesentlich mitverantwortlich für Dupins gute Laune heute. Er war dennoch ein wenig nervös. Allgemein. Er wollte die Sache mit Claire nicht wieder vermasseln, nicht wie beim ersten Mal. Er hatte auch das Zugticket schon vor drei Wochen gekauft, damit ganz sicher nichts dazwischenkommen konnte.
Er würde Claire gleich aus Le Croisic zurückrufen. Und noch einmal in Ruhe mit ihr über morgen sprechen. Direkt nach der Seezunge.
Er würde sich jetzt hier beeilen.
Kommissar Dupin war sich ziemlich sicher, jemanden gesehen zu haben. Nah an dem hölzernen Schuppen. Ganz kurz nur, für den Bruchteil einer Sekunde. Einen Schatten eher, der sofort wieder verschwunden war.
Der Kommissar hatte seine Schritte verlangsamt. Er fixierte die Umgebung. Es waren vielleicht noch zwanzig Meter bis zum Schuppen. Der Weg führte daran vorbei und schien sich kopfüber in ein Salinenbecken zu stürzen.
Dupin blieb stehen. Er fuhr sich am Hinterkopf heftig durch die Haare.
Sein Gefühl sagte ihm, dass etwas nicht stimmte. Die Situation gefiel ihm ganz und gar nicht.
Er schaute sich ein weiteres Mal aufmerksam um. Objektiv war nichts zu sehen, das irgendwie verdächtig schien. Und wenn es nur eine Katze gewesen war? Oder ein anderes Tier? Vielleicht hatte er es sich wirklich nur eingebildet. Zu der Stimmung hier würde es allemal passen. Vielleicht begann auch der betörende Duft, der hier, tief in den Salzgärten, noch intensiver war, seine halluzinierende Wirkung zu entfalten.
Plötzlich, vollkommen aus dem Nichts, war ein Zischen zu hören, ein eigentümliches Geräusch, metallisch, hohe Frequenz. Gefolgt von einem kleinen dumpfen Schlag, nicht weit entfernt. Eine Schar Vögel stob mit lautem Gekreische auf.
Dupin erkannte das Geräusch sofort. Mit einer Schnelligkeit und einer Präzision, die man seiner eher massiveren Physis auf den ersten Blick nicht zugetraut hätte, warf er sich nach links zu Boden, wo der schmale Grasstreifen steil zu einem Speicherbecken hin abfiel. Geschickt rollte er sich ab und drehte sich dabei so, dass er mit den Beinen und Füßen in das Becken rutschte und dort Halt fand. Das Wasser war ungefähr einen halben Meter tief. Dupin hatte seine Waffe gezogen – eine Sig Sauer 9 mm – und instinktiv auf den Schuppen gerichtet. Es war alles andere als ein perfekter Schutz, aber besser als nichts. Die Kugel war nicht allzu weit rechts von ihm eingeschlagen, woher sie genau kam, ob vom großen Schuppen oder von einem der kleineren Verschläge in der Nähe, konnte er nicht sagen. Gesehen hatte er nichts. Gar nichts. Dupins Gedanken rasten. In einer Situation wie dieser gab es kein reguläres Denken, vielmehr mischten sich Hunderte Dinge gleichzeitig: Helle, scharfe Wahrnehmungen, Reflexe, Instinkte und Gedankenfetzen vermengten sich fiebrig und ergaben, was man vage »Intuition« nannte.
Dupin musste herausfinden, wo sich der Angreifer befand. Und hoffen, dass es nur einer war.
Drei Verschläge waren es, die er sehen konnte, nahe beieinander. Der ihm nächste war um die zehn Meter entfernt.
Allzu nah konnte der Schütze nicht gewesen sein, er hätte sein Ziel nicht verfehlt.
Wieder das hohe Geräusch – und wieder ein dumpfer Einschlag. Nicht weit vor ihm. Und noch einmal. Wieder Vögel, die aufschreckten und kreischend in den Himmel stiegen. Dupin rutschte noch etwas tiefer in das Becken, kniete jetzt im Wasser, das ihm bis zum Bauch ging. Ein viertes Mal.
Dieses Mal konnten es nur Zentimeter gewesen sein, um die die Kugel ihn verfehlt hatte. Er hatte etwas an seiner linken Schulter gespürt. Vom Gefühl her kamen die Schüsse jetzt alle aus einer Richtung. Dann wurde es abrupt still. Vielleicht suchte der Angreifer eine bessere Position.
Dupin war klar, dass es keine Lösung war, sich in dem Becken zu verschanzen. Er musste handeln. Er dachte fieberhaft nach. Ein einziges Mal könnte er das Moment der Überraschung auf seiner Seite haben. Hoffentlich. Ein einziges Mal.
Mit einer pfeilschnellen Bewegung sprang er aus dem Becken hoch, zielte in die Richtung, in der er den Schützen vermutete, und feuerte dabei in so schneller Folge, wie es die Waffe zuließ. Auf diese Weise stürmte er auf den nächsten Verschlag zu. Als er ihn erreicht hatte, hatte er das Magazin vollständig geleert. Fünfzehn Schuss.
Dupin atmete ein paarmal tief durch. Es war totenstill. Der Kommissar war eigenartig ruhig, das wurde er immer, wenn es brenzlig wurde. Dennoch stand kalter Schweiß auf seiner Stirn. Er hatte kein zweites Magazin bei sich. Im Handschuhfach des Wagens, ja, aber nicht hier. Er hatte sein Handy, aber das half ihm im Augenblick nicht, auch wenn er natürlich schnell versuchen sollte, Meldung zu machen.
Der Verschlag, hinter dem er nun kauerte, war aus stärkerem Wellblech, es war schwer zu sagen, wie stark. Auch hatte Dupin keine Ahnung, wo sich die Tür befand. Ob sie offen war. Aber vermutlich war es seine einzige Chance. Er befand sich an einer der beiden längeren Seiten. Am logischsten wäre es, die Tür läge dem Weg zugewandt, also links von ihm. Er wusste, er konnte nicht lange nachdenken. Und hätte auch bei diesem Manöver nur genau einen Versuch.
Mit schnellen, behutsamen Schritten bewegte er sich dicht an das Blech gedrückt, bis zur Ecke. Er hielt einen Augenblick inne. Im nächsten Moment sprang er in einer jähen Bewegung um die Ecke, sah tatsächlich eine Tür, riss sie auf, warf sich hinein – und schlug sie hinter sich zu.
Das Ganze hatte zwei, drei Sekunden gedauert. Entweder hatte der Angreifer Dupin nicht gesehen oder er war wirklich überrascht gewesen, Tatsache war: Er hatte nicht geschossen.
Im Verschlag war es stockdunkel. Nur durch Ritzen an der Tür fiel etwas vom letzten dämmerigen Licht.
Dupin hielt den Türgriff fest umklammert. Es war, wie er gedacht hatte: Von innen ließ sich die Tür nicht verschließen. Dupin griff nach seinem Handy, das war jetzt das Wichtigste. Nolwenns Nummer war die vorletzte der Wahlwiederholung. Das kleine Display erleuchte erstaunlich viel von dem Raum. Dupin sah sich rasch um, die vordere Hälfte war leer, in der hinteren standen ein halbes Dutzend großer Säcke und irgendwelche Stangen. Dann starrte er wieder auf das Display. Er hatte keinen Empfang.
Das durfte nicht wahr sein. Nichts. Nicht ein Balken. »Verbindung nicht möglich«. Der Satz war klar und deutlich auf dem Display zu lesen. Er kannte das: Am »Ende der Welt« war man häufig wirklich von der Welt abgeschnitten, stabilen Empfang hatte man bisweilen nur in größeren Ortschaften. Sein Funkgerät lag – neben dem zweiten Magazin – sicher im Wagen, Dupin führte es, gegen jede Dienstvorschrift, fast nie mit sich. Vielleicht hätte er auf irgendeiner Frequenz einen Kollegen der Region ausmachen können. Auf der Notfrequenz bestimmt, aber das war jetzt egal: Er hatte es nicht bei sich. Und dass zufällig um diese Uhrzeit an diesem einsamen Ort irgendjemand vorbeikäme, war extrem unwahrscheinlich.
»So ein Scheiß.«
Der Satz war ihm viel zu laut herausgerutscht. Im nächsten Augenblick gab es einen ohrenbetäubenden metallischen Krach, Dupin hätte um ein Haar das Telefon fallen lassen. Ein Schuss. Und noch einer. Ein dritter. Immer derselbe infernalische Lärm. Dupin hatte den Atem angehalten. Er hatte keine Ahnung, ob das Blech die Kugeln abhalten würde. Vor allem, wenn der Schütze klug war und wiederholt auf dieselbe Stelle schoss. Im Moment konnte er keinen Einschuss feststellen. Wieder krachte eine Kugel in das Wellblech, dieses Mal mit noch größerem Lärm, der Angreifer schien sich dem Schuppen zu nähern. Und zwei weitere Male in rascher Folge. Dupin kniete sich hin und stützte den Ellbogen auf das Knie, den Handballen unter die Türklinke gestemmt. Aber auch so wäre es schwer zu verhindern, dass jemand die Tür öffnete. Er hatte den ungleich schlechteren Hebel. Er musste immer noch hoffen, dass der Angreifer es aus Angst vor einem Schusswechsel nicht wagen würde. Mit einem Mal gab es einen gewaltigen, dumpfen Schlag gegen die Tür. Es war kein Schuss, eher als wäre etwas Massives gegen die Tür geknallt, dann eine Art lautes Schaben. Der Türgriff ruckelte kurz. Jemand war direkt an der Außenseite der Tür, ein paar Zentimeter von ihm entfernt. Dupin meinte, eine Stimme zu hören, ein paar wenige Worte, leise, aber er war sich nicht sicher. Dann war es wieder still.
Auch in den folgenden Minuten passierte nichts. Es war beklemmend. Er wusste nicht, was sein Angreifer als Nächstes tun würde, und hatte keine Chance, es herauszufinden. Er konnte nichts tun. Nur hoffen, dass dieser keinen Versuch unternehmen würde, den Schuppen zu stürmen. Was er auf alle Fälle ahnen würde: dass Dupins Handy hier keinen stabilen Empfang hatte und er niemanden zu Hilfe holen konnte.
Aber höchstwahrscheinlich würde sein Gegner sich umsehen und den Polizeiwagen entdecken. Oder es gab sowieso noch einen Posten irgendwo an der Straße, der den Polizeiwagen direkt gemeldet hatte. Das hing auch davon ab, wie groß die Sache war, um die es hier ging.
Mit einem Mal hörte Dupin den Motor eines Wagens, nicht nahe am Schuppen, aber auch nicht weit entfernt. Er hatte auf dem Weg hierher nirgendwo einen Wagen gesehen. Der Motor lief eine Weile, ohne dass etwas passierte. Dann erst fuhr der Wagen an. Dupin konnte es gedämpft, aber deutlich hören. Was geschah? Machte sich sein Angreifer aus dem Staub? Irgendetwas hatte er noch erledigt. Nach ein paar Metern bremste der Wagen jäh ab. Dupin wartete auf das Geräusch sich öffnender Türen. Aber nichts passierte.
Plötzlich klingelte sein Handy. Mit einer reflexhaften Bewegung griff er nach dem Gerät.
»Hallo?«, stieß er hastig mit gedämpfter Stimme hervor.
Er hörte nichts außer Knacken und Rauschen.
»Das ist ein Notfall. – Ich befinde mich in den Salinen der Guérande. – In einem Schuppen. – Ich werde beschossen. – Mein Wagen steht auf einer Nebenstraße der Route des Marais. Von dort aus bin ich den Kiesweg nach Westen entlanggegangen. --- Hallo?«
Dupin hoffte, dass der Anrufer irgendetwas von diesen Worten hören würde und alarmiert wäre. Aber es war sehr unwahrscheinlich.
»Hallo? Das ist ein Notfall«, nun schrie er fast, gegen seinen Willen, »ich werde beschossen, ich …«
»--- nur anrufen, um --- Tisch --- acht Uhr.«
Dupin konnte die verzerrte Stimme nicht erkennen. Aber das Wort »Tisch« und »acht Uhr« war merkwürdig deutlich zu hören gewesen. Das durfte nicht wahr sein. Das musste das La Palette sein, wegen seiner Reservierung für morgen Abend. Stéphane vielleicht, der Oberkellner, der wusste, dass es immer besser war, Dupin an die genaue Reservierung zu erinnern.
»Ein polizeilicher Notfall – bitte rufen Sie das Commissariat Concarneau an. – Hallo, Stéphane?«
Offenbar hatte der Anrufer kein Wort verstanden. Aber Dupin musste den Empfang nutzen, wie schlecht auch immer er war. Solange es ihn überhaupt gab. Es war tatsächlich ein einzelner kleiner Empfangsbalken zu sehen. Hastig drückte er die rote Taste und dann umgehend auf Wahlwiederholung, auf Nolwenns Handynummer. Es klingelte. Dupin konnte es deutlich hören. Einmal. Dann brach die Verbindung ab. Er versuchte es wieder. Vergeblich. Er starrte fassungslos auf das Display: Der einsame kleine Balken war verschwunden.
Im nächsten Augenblick war zu hören, wie der Wagen, dessen Motor die ganze Zeit gelaufen war, anfuhr und sich mit Tempo entfernte.
Dupin legte das Handy zurück auf den Boden. Er musste das Display im Auge behalten. Aber nichts tat sich.
Der Wagen war nicht mehr zu hören. Er hatte die Saline verlassen. War es nur ein Angreifer gewesen oder zwei oder sogar mehr? Wenn es mehr als einer gewesen war, war dann einer zurückgeblieben? Der nur darauf wartete, dass Dupin den Schuppen verlassen würde? Stellten sie ihm eine Falle?
Es wäre zu riskant, jetzt zu versuchen, den Verschlag zu verlassen. Er würde weiterhin warten müssen. Weiter in diesem stickigen Schuppen ausharren müssen, ohne irgendetwas tun zu können. Noch war die Situation nicht ausgestanden.
Es war kurz nach zehn. Nichts, nichts war passiert in dieser unendlich langen halben Stunde. Dupin hatte schlimmer und schlimmer schwitzend in dieser unmöglichen Körperhaltung verharrt, alle zwei, drei Minuten den linken und rechten Arm wechselnd, um die Türklinke zu blockieren. Bald hatte alles wehgetan, dann hatte er in der Hand, im Arm und im Bein allmählich gar kein Gefühl mehr gehabt, irgendwann hatte er seinen ganzen Körper nicht mehr gespürt. Nur ab und zu an der linken Schulter einen punktuellen, stechenden Schmerz. Er schätzte die Temperatur im Inneren des Verschlages auf über dreißig Grad, der Sauerstoff schien restlos verbraucht.
Er musste aus dem Schuppen raus. Nicht ein einziger Balken war mehr auf dem Display seines Handys zu sehen gewesen. Er musste es riskieren. Er hatte einen Plan.
Behutsam versuchte er den Türgriff nach unten zu drücken.
Vergeblich. Es ging nicht. Keinen Millimeter. Sein Angreifer hatte den Türgriff blockiert. Das also waren die komischen Geräusche gewesen, als sich jemand an der Tür zu schaffen gemacht hatte. Von außen war etwas unter den Griff geklemmt. Dupin rüttelte, so heftig er konnte, an der Klinke. Nichts bewegte sich.
Er saß fest. Und sein Angreifer war vermutlich über alle Berge.
Dupin sank in sich zusammen. Er robbte ein wenig nach rechts und streckte sich auf dem Boden des Verschlages aus. Deprimiert über die Situation, aber auch, das spürte er jetzt, erleichtert, dass die unmittelbare Bedrohung vorüber zu sein schien.
Er hatte vielleicht eine Minute gelegen, dabei die eingeschlafenen Arme und Beine wieder zu beleben versucht und darüber nachgedacht, was er nun tun sollte, als er ein Knacken hörte. Einigermaßen laut. Eindeutig. Er war sich sicher, dass das kein Tier gewesen war.
Da draußen war jemand. Blitzschnell bewegte Dupin sich in die alte Haltung zurück, die Tür sichernd. Er hörte leises Gemurmel. Er presste sein Ohr an das Blech. Mit äußerster Anstrengung versuchte er zu lauschen, was draußen vor sich ging.
Ein, zwei Minuten blieb alles ruhig. Dann auf einmal – Dupin zuckte zusammen – hallte es sehr laut durch die Nacht:
»Hier spricht die Polizei. Wir haben das Gelände umstellt. Wir fordern Sie auf, sich auf der Stelle zu ergeben. Wir werden nicht zögern, von unseren Schusswaffen Gebrauch zu machen.«
Dupin sprang auf. Und wäre dabei fast gestolpert.
»Ich bin hier. In diesem Schuppen.«
Er hatte geschrien und danach ein paarmal gegen die Tür gehauen.
»Commissaire Georges Dupin – Commissariat de Police Concarneau. Ich bin in diesem Schuppen. Allein. Es besteht keine Bedrohungssituation mehr.«
Dupin wollte gerade noch einmal rufen, als er innehielt. Und wenn das eine Finte war? Wer sollte überhaupt die Polizei verständigt haben? Ein Megafon bewies noch gar nichts. Warum hatte ihm niemand geantwortet? Andererseits mussten – wäre es wirklich die Polizei – die Kollegen erst einmal die Situation sondieren. Sie mussten sichergehen, dass wirklich keine Gefahr bestand.
Im nächsten Moment gab es einen gewaltigen Ruck am Türgriff.
»Wir haben die Blockierung der Tür gelöst. Kommen Sie mit erhobenen und vollständig geöffneten Händen heraus. Ich will die Handflächen sehen. Und schön langsam.«
Die blecherne Stimme war während der Bewegung an der Tür aus einiger Entfernung gekommen, es mussten also mindestens zwei Personen sein.
Dupin überlegte kurz, dann rief er: »Identifizieren Sie sich. Ich muss sicher sein, dass Sie zur Polizei gehören.«
Die Antwort kam unverzüglich.
»Gar nichts werde ich tun. Sie kommen jetzt raus.«
Diese Reaktion war wahrscheinlich der beste Beweis.
»Gut, ich komme.«
»Wie gesagt: erhobene Hände und ganz, ganz langsam.«
»Ich bin Commissaire Georges Dupin, Commissariat Concarneau.«
»Los jetzt.«
Der Ton war eisern.
Dupin öffnete die Tür. Ein greller, scharf umrandeter Lichtkegel fiel in den Verschlag, sicher eine dieser neuen Power-LED-Lampen. Er blieb kurz stehen, um sicher zu sein, dass er wieder einen festen Stand hatte. Im nächsten Moment trat er ohne Umstände aus dem Schuppen, die rechte Hand vor den Augen, mit der linken das Handy haltend.
»Ich brauche ein funktionierendes Telefon. Ich muss auf der Stelle telefonieren.«
Er musste Lilou Breval sprechen. Umgehend.
»Ich hatte gesagt: mit erhobenen Händen. Ich …«, die Stimme brach ab. Im nächsten Moment näherte sich von rechts eine Person.
»Was haben Sie hier zu suchen? Was zum Teufel soll das?«, es war eine weibliche, etwas raue Stimme. Angriffslustig, aber dennoch vollkommen beherrscht, nicht einmal sehr laut: »Was ist hier geschehen?«.
Jemand verstellte die Lichtstreuung der Taschenlampe von fokussiert auf diffus, und Dupin konnte seine Hand von den Augen nehmen.
Vor ihm stand eine gut aussehende Frau, ungefähr eins fünfundsiebzig groß, mit schulterlangen, dunklen, gewellten Haaren, in einem hellgrauen Hosenanzug, einer dunklen Bluse, eleganten schwarzen Stiefeletten mit nicht unerheblichen Absätzen. In der rechten Hand eine halb gezogene Sig Sauer.
»Commissaire Sylvaine Rose. Commissariat de Police Guérande«, eine kleine Pause, dann, jede Silbe betont: »Département Loire-Atlantique.«
»Ich muss telefonieren. Haben Sie ein Satellitentelefon?«
»Anders als das Commissariat Concarneau führen wir bei unseren Einsätzen die erforderliche Ausrüstung mit uns. – Was haben Sie hier zu suchen? Was war das für eine unprofessionelle Aktion?«
Im letzten Moment, bevor ihm ein paar unwirsche Worte herausgerutscht wären, riss Dupin sich zusammen.
»Ich – wer hat Sie informiert, dass ich«, er setzte kurz ab, »dass ich mich hier befinde?«
»Sie verdanken Ihre Rettung einem Kellner aus Paris. Der Sie angerufen hatte wegen Ihrer Reservierung morgen Abend. Er hat Sie zwar nicht verstehen können, glaubte aber, das Wort ›beschossen‹ gehört zu haben, und hat vorsichtshalber bei der Polizei im Sechsten angerufen. Und die haben sich vorsichtshalber bei uns gemeldet. Man hat sich offenbar noch an Sie erinnert, Ihr Abgang muss spektakulär gewesen sein. Und wir sind dann auch vorsichtshalber einmal vorbeigekommen«, jäh wechselte sie den Tonfall: »Was machen Sie in den Salinen? Wie sind Sie in diesen Verschlag geraten? Worum geht es hier? Sie werden mir jetzt alles haarklein erzählen. Davor werden Sie kein Telefonat führen. Gar nichts werden Sie davor tun.«
Dupin wäre beeindruckt gewesen, wenn in ihm nicht während der letzten Stunde ein enormer Zorn aufgekommen wäre, der schon eben alle anderen Gefühle, sogar das der Ohnmacht, überlagert hatte, auch die Schmerzen in Armen und Beinen und der Schulter. Er war wütend – auf seinen Peiniger, auf die ganze Situation, vor allem aber: auf sich selbst. Er wusste, dass er ein bemerkenswerter Idiot gewesen war. Er wollte wissen, wer auf ihn geschossen hatte! Was es mit alldem auf sich hatte! Er hatte dieselben Fragen wie die Kommissarin. Aber bis auf einen Bericht zum Geschehen würde er keinerlei Antworten geben können. Er musste umgehend in Erfahrung bringen, was Lilou Breval wusste – was sie ihm gestern verschwiegen hatte.
»Geben Sie mir das Satellitentelefon«, presste er hervor.
»Ich werde gar nichts tun, bevor Sie mir nicht alles erzählt haben.«
Ruhiger hätte man diesen Satz nicht aussprechen können.
»Ich«, Dupin brach ab. Er verstand seine Kollegin – er würde sich nicht anders verhalten –, aber er hatte keine Zeit für all das.
»Was wollen Sie tun, mich hier festhalten?«
»Das kann ich leider nicht. Aber ich werde Sie jetzt auf der Stelle ins Krankenhaus nach Guérande-Stadt fahren. Und keinen Millimeter von Ihrer Seite weichen, bis ich alles weiß. Ich habe etwas gegen Schießereien in meinem Gebiet. Wir haben eine große Anzahl von Hülsen gesehen, das muss eine hübsche Aktion gewesen sein. Die Spurensicherung wird sich alles ansehen. – Ich hoffe, Sie entschließen sich nicht, meine Ermittlungen zu verzögern. Die Dienstaufsicht wird Sie ohnehin schon lieben.«
Mittlerweile waren ein Dutzend Polizisten zu sehen, alle mit schweren Taschenlampen bewaffnet. Es war längst stockdunkel. Zwei Polizeiwagen kamen dicht hintereinander den Weg entlanggefahren und hatten den Schuppen fast erreicht. Ihre aufgeblendeten Fernlichter erhellten die Szene grell.
Dupin dachte nach. Vielleicht sollte er kooperieren. Das hier war nicht sein Terrain. Niemand hörte auf ihn. Er allein konnte hier gar nichts ausrichten, er war erst einmal auf die Kommissarin angewiesen. So schwer es ihm auch fiel.
»Es ging um verdächtige Fässer, hier in der Saline. Ich bin dem Hinweis einer Journalistin gefolgt. Lilou Breval vom Ouest-France. Als ich ankam, hat jemand das Feuer eröffnet. Ich habe niemanden erkennen können, ich weiß nicht, wie viele Personen es waren, ob es mehr als eine war. Ich konnte mich in diesen Verschlag retten. Der oder die Angreifer haben den Tatort wahrscheinlich gegen einundzwanzig Uhr fünfunddreißig verlassen.«
»Was für Fässer?«
»Ich weiß es nicht. Blaue Plastikfässer. Deswegen muss ich sofort mit dieser Jounalistin sprechen, sie allein kann uns …«
»Sie wissen es nicht? Sie haben sich grob fahrlässig in diese Situation gebracht, weil Ihnen jemand gesagt hat, Sie sollen sich einmal ein paar Fässer ansehen? Ohne im Geringsten zu wissen, worum es gehen könnte? In einem Département, in dem Sie nichts verloren haben?«
»Ich muss telefonieren.«
»Sie müssen ins Krankenhaus.«
»Was soll das mit dem Krankenhaus?«, Dupins Wut kam zurück.
Commissaire Rose blickte ihn einen Augenblick unschlüssig an, dann drehte sie sich zur Seite und rief in die Richtung einer Polizistin, die sich gerade an dem Verschlag zu schaffen machte: »Chadron. Für die Fahndung: eine Person. Vielleicht mehrere. Keinerlei Hinweis auf ihre Identität. Wir kennen auch ihren Wagen nicht. Das Einzige, was wir wissen: Aus der Saline ist gegen einundzwanzig Uhr fünfundreißig ein Wagen weggefahren, Richtung und Ziel unbekannt. – Eigentlich sinnlos, aber setzen Sie die Meldung trotzdem ab.«
Die angesprochene Polizistin zückte das Funkgerät. Die Kommissarin wandte sich wieder Dupin zu. Eindeutig genervt.
»Fahren wir. Ich meinerseits unterlaufe nur ungern wichtige Dienstvorschriften. Sie sind angeschossen worden, und ich sorge dafür, dass Sie zu einem Arzt kommen. – Sorgfaltspflicht.«
»Angeschossen?«
»Sie bluten an der linken Schulter.«
Dupin fasste sich an die linke Seite und drehte den Kopf. Das Polohemd war nass von Schweiß und Salinenwasser. Es war in dem Scheinwerferlicht nicht leicht auszumachen, aber wenn man genau hinsah, konnte man es trotzdem erkennen: Auf der linken Seite war es noch dunkler eingefärbt als rechts. Und er hatte manchmal – nur manchmal, das Adrenalin hatte ihn aufs Äußerste aufgeputscht – diesen spitzen Schmerz verspürt, auch wenn er nicht weiter darüber nachgedacht und ihn auf die verkrampfte Haltung zurückgeführt hatte. Er konnte erkennen, dass das Polohemd zwischen Oberarm und Schulter kaputt war. Er fasste dorthin. Der Schmerz trat mit einem Mal deutlich hervor. Stechend.
»Absurd«, es kam aus tiefster Seele.
Die Kommissarin lächelte ihn für einen Moment an, Dupin hätte nicht zu sagen gewusst, mit welcher Botschaft. Sie sprach sehr leise, ruhig und blickte ihm dabei direkt in die Augen.
»Sie sind hier in meiner Welt, Monsieur le Commissaire. Und hier sind Sie entweder einer, der mir das Leben leichter macht – oder einer, der es mir schwerer macht. Und ich versichere Ihnen, Sie möchten nicht einer sein, der es mir schwerer macht.«
Sie fuhr in normaler Lautstärke fort:
»Kommen Sie.«
Dupin wollte protestieren.
Commissaire Rose schaute zum Himmel, murmelte »müsste gehen« und wandte sich an die Kollegin von eben:
»Ich brauche ein Satellitentelefon. Sie übernehmen hier, wenn ich weg bin. Ich begleite Kommissar Dupin ins Krankenhaus. Melden Sie sich bei jeder Neuigkeit. Egal was es ist. Ich will alles wissen. Alles.«
Dupin rieb sich die rechte Schläfe – die letzten Sätze hatten befremdlich nach ihm selbst geklungen.
Die Kommissarin schritt auf den hinteren Wagen zu.
»Wir fahren.«
Sie hatte die linke Hand in die Tasche ihres Jacketts geschoben, nur der Daumen schaute hervor.
Inspektorin Chadron kam mit einem Telefon, das mit seiner massiv verkleideten Antenne aussah wie ein Handy vor fünfzehn Jahren, und hielt es Dupin hin.
»Sie sprechen unterwegs mit Ihrer Journalistin und dann erzählen Sie mir noch einmal alles im Detail«, instruierte ihn Commissaire Rose.
Dupin stieg zu ihr in den Wagen. Die Salinen unter dem klaren schwarzblauen Himmel; die Salzberge, die von den Scheinwerfern der Polizeiautos angestrahlt wurden; die zuckenden Lichtkegel der umherlaufenden Polizisten – all das gab ein surreales Bild ab.
Es war viel passiert, seit er hier angekommen war. Und aus der Seezunge war nichts geworden.
»Ich brauche einen café. Einen doppelten. Und ein Telefon. Und Sie müssen meinen Inspektor zu mir lassen.«
»97 zu 62. Ihr Blutdruck ist immer noch sehr niedrig. Ihr Puls dabei fortwährend um die 140. Symptome eines Schockzustandes. Und Folgen des Blutverlustes. Kein lebensbedrohlicher Zustand, dennoch müssen …«
»Ich habe keinen Schock. Ich habe grundsätzlich niedrigen Blutdruck. Von meinem Vater geerbt. Ich brauche Koffein, dann ist alles gut. Ist die Wunde so verbunden, dass ich mich frei bewegen kann?«
»Sie sollten sich erst einmal gar nicht bewegen.«
Der junge, demonstrativ wenig einfühlsame Arzt, mit dem Dupin gerade ein zweites Mal sprach, hatte ihn untersucht, als sie angekommen waren – nach über zwanzig Minuten nervender Wartezeit in der Ambulanz. Commissaire Rose war zum Telefonieren draußen geblieben. Irgendwann war eine, schien es Dupin, noch jüngere, nicht minder gleichgültig wirkende Ärztin hinzugekommen, hatte sich die allernötigsten Informationen geben lassen und ihn in ein kleines Zimmer ein paar Gänge weiter gebracht. Es war ein Streifschuss, er hatte oberflächlich die Muskelfasern erwischt, an sich harmlos, aber er hatte tatsächlich stark geblutet. Die Ärztin hatte ihn lokal betäubt – eine Beruhigungspritze hatte er heftig abgelehnt –, die Wunde gründlich desinfiziert, mit fünf Stichen genäht und verbunden.
Es war jetzt Mitternacht. Schon auf der Fahrt in die Klinik hatte Dupin mit dem Satellitentelefon versucht, Lilou Breval zu erreichen, immer war er nur an den Anrufbeantworter geraten, bei ihrer Festnetznummer und auch auf ihrem Handy. Er hasste Satellitentelefone, die ausgefahrene Antenne hatte exakt nach oben zu zeigen – sodass er zu Beginn der Fahrt in unnatürlicher Verkrampfung hatte sitzen müssen, und dies bei einer imposant rasanten Fahrweise der Kommissarin, die extra betont hatte, mit Rücksicht auf die Verletzung vorsichtig zu fahren. Zudem musste man x Vorwahlen wählen (er vergaß immer, welche, abgesehen davon, dass der Himmel nicht bewölkt sein durfte). Zwischen den wiederholten Flüchen über Satellitentelefone und Anrufbeantworter hatte er Commissaire Rose schließlich alles erzählt, was er wusste. Was hieß: eigentlich gar nichts. Sie hatte keinen Hehl daraus gemacht, Dupin weiterhin nicht über den Weg zu trauen. Und schien immer noch davon auszugehen, dass er Informationen zurückhielt. Seine ganze Geschichte klang ja auch, gelinde gesagt, nicht sehr plausibel.
Inspektor Riwal, einer seiner beiden Inspektoren, war sofort in Concarneau aufgebrochen, als ihn die Nachricht von den Ereignissen erreicht hatte. Dupin mochte ihn sehr, auch wenn er ab und an skurrile Anwandlungen hatte. Riwal hatte dem Kommissar sein Eintreffen über einen diensteifrigen Pfleger mitteilen lassen. Der Arzt hatte diesen unter dem Hinweis auf »klare und strikte Vorschriften« barsch angewiesen, den Inspektor keinesfalls zu dem »Verletzten« vorzulassen, schon gar nicht während der »Anamnese«.
»Sie sollten nach dem Schock und Blutverlust viel Flüssigkeit zu sich nehmen. Am besten Wasser oder Kräutertee. Keinen Kaffee oder Alkohol.«
Dupins Gefühle schwankten zwischen Verzweiflung und Tobsuchtsanfall.
»Ich sage Ihnen doch, es ist alles in Ordnung. Lassen Sie den Inspektor zu mir. Es geht um wichtige polizeiliche Ermittlungen. Ich …«
Im Flur vor dem Behandlungszimmer war eine rabiate Stimme zu hören.
»Das reicht! Er ist mein einziger Zeuge. Er ist behandelt worden, nicht lebensgefährlich verletzt, bei Bewusstsein. Ich werde jetzt zu ihm gehen.«
Die Tür flog auf, Commissaire Rose trat ein, hinter ihr ein resigniert dreinblickender Krankenpfleger. Die Kommissarin blieb in der Mitte des Raumes stehen.
»Wir haben den gesamten Abschnitt der Saline durchsucht. Und keine Fässer gefunden. Keine blauen, keine gelben, keine roten. Kein einziges. Nicht draußen, nicht in dem Schuppen, nicht in den Verschlägen. Wir haben überhaupt nichts Verdächtiges gefunden. – Die Spurensicherung sucht nach Abdrücken, die größere Fässer hinterlassen haben könnten. Nach Schuhabdrücken, Reifenspuren etc. – Ich habe es auch weiter bei Ihrer Journalistin versucht, sie aber nicht erreicht. Vermutlich liegt sie einfach längst im Bett.«
Dupin wollte protestieren. Er musste unbedingt selbst mit Lilou reden. Sie mussten sie so schnell wie möglich erreichen. Commissaire Rose kam ihm zuvor, sie sprach, als wäre er nicht im Raum:
»Wir haben verdammt noch mal nicht den blassesten Schimmer, worum es hier geht. Wie leichtsinnig selbst verschuldet auch immer – um ein Haar wurde ein Polizeibeamter erschossen. Mitten in unseren Salzgärten.« Plötzlich sah sie ihn scharf an. »Sie müssen doch irgendetwas wissen oder geargwöhnt haben! Sie fahren nicht einfach los und riskieren ernste Dienstaufsichtsverfahren, weil eine Freundin irgendwo irgendetwas als verdächtig empfindet. Das kaufe ich Ihnen nicht ab!«
Man konnte nicht sagen, dass Commissaire Rose aufgebracht gesprochen hätte. Aber schnell und sehr bestimmt.
»Es muss um eine größere Sache gehen«, der Satz war keine richtige Antwort gewesen, Dupin hatte ihn grüblerisch vor sich hin gesprochen.
»Was immer es ist. Ich werde es nicht zulassen. Nicht auf meinem Terrain. – Es hätte auch einen Unschuldigen erwischen können.«
Dupin wollte nun doch etwas entgegnen – scharf entgegnen –, aber im letzten Augenblick ließ er es. Und war froh darüber. Eigentlich verstand er die Kommissarin. Zu gut.
Zudem fühlte er sich jetzt doch ein wenig unbehaglich, mit nacktem Oberkörper, verdreckt und verklebt auf einer Krankenhausliege sitzend, mit einem Verband um die linke Schulter, die Manschette des Blutdruckmessgerätes noch am Oberarm.
»Wissen wir schon, wem die Saline gehört?«
Dupin hatte sich um einen kooperativen Klang bemüht, der ein wenig Wirkung zu zeigen schien.
»Natürlich wissen wir längst, wem die Saline gehört, in der sich Ihr aufregendes Abenteuer abgespielt hat. Meine Kollegen versuchen, den Besitzer zu erreichen. Und mit dem Chef einer der Kooperativen in den Salzgärten zu sprechen – die Salinen direkt nebenan gehören ihm. Ebenso mit der Leiterin des Centre du Sel. Sie kennt jeden Paludier. Und jedes Becken.«
Was Dupin eben schon aufgefallen war und was eigentlich nicht das Geringste zur Sache tat: Das Haar der Kommissarin war ständig in Bewegung, selbst wenn sie regungslos dastand. Und auch wenn es im Augenblick schwer war, es sich vorzustellen, verrieten ausgeprägte Lachfältchen, dass sie richtig lachen konnte – und es, theoretisch, häufig tun musste.
»Sie haben die Kommissarin zu ihm gelassen, ich werde nun ebenfalls hineingehen.«
Wieder war vom Gang her ein Tumult zu hören. Dupin erkannte Riwals Stimme. Er hatte sehr energisch geklungen.
»Ich habe niemanden zu dem Patienten gelassen, die Dame ist vorhin einfach reingestürmt«, wimmerte eine entmutigte Stimme. Im nächsten Moment stand auch Riwal im Zimmer. In der rechten Hand einen Plastikbecher.
»Chef, ich habe Ihnen einen café mitgebracht. Doppelter Espresso. So stand es zumindest auf der Taste. Im Aufenthaltsraum ist ein Automat.«
Dupin hätte seinen Inspektor umarmen können, was er natürlich nie wirklich getan hätte. So froh war er, ihn zu sehen. Und den Kaffeebecher. Das war ein Lichtblick.
»Gut gemacht, Riwal.«
Riwal kam auf ihn zu und überreichte Dupin den Becher mit einer fast zeremoniellen Geste.
Commissaire Rose bedachte Riwal mit einer Kopfbewegung, minimal, aber freundlich-kollegial.
»Inspektor Riwal, Commissariat de Police Concarneau. – Eine beunruhigende Sache.«
Riwal hatte ungewohnt cool gesprochen. Das musste die Wirkung der Kommissarin sein.
»Allerdings. Sie können auch kein Licht in das Dunkel bringen, nehme ich an?«
»Nein. Wir haben lediglich die Information erhalten, dass unser Commissaire in eine Schießerei verwickelt war und angeschossen wurde.«
Dupin nahm einen Schluck des lauwarmen Kaffees, der schrecklich schmeckte. Und auch noch nach Plastik. Egal. Er fühlte sich augenblicklich besser. Seit sie in der Klinik angekommen waren, hatte er deutlich die Strapazen der letzten Stunden gespürt. Eine bleierne Erschöpfung, die tief in den Knochen steckte. Auch wenn er heftig dagegen ankämpfte, er fühlte sich angeschlagen – was er nie zugeben würde. Er hatte schon Schießereien erlebt, ja, in Paris, auch eine viel wildere noch – unter einer der Brücken, stadtauswärts, Autodiebstähle im großen Stil –, und er war auch schon einmal angeschossen worden, bei einer Festnahme am Gare du Nord, schlimmer als heute, am Unteram, aber es war trotzdem hart.
»Kennen Sie die Privatadresse von Madame Breval, wissen Sie, wo sie wohnt?«, Commissaire Rose hatte die rechte Hand in die Hüfte gestützt, die linke wieder in der Jacketttasche.
»Ja, ich weiß, wo Lilou Breval wohnt. Am Golf. Bei Sarzeau.«
Er hatte sie dort einmal besucht, als es um den Fall des ermordeten Hoteliers ging.
Dupin trank den letzten Schluck Kaffee, streifte die Manschette des Blutdruckmessgerätes ab und stand auf. Im ersten Moment war ihm schwindelig, die Welt schwankte. Trotz des cafés. Er nahm das klinikweiße Arzt-T-Shirt, das der Pfleger ihm hingelegt hatte. Die Schulter beeinträchtigte erheblich das Anziehen, zudem schien die Betäubung nachzulassen. Das T-Shirt war mindestens zwei Nummern zu groß, Dupin war sich bewusst, dass es lächerlich aussehen musste. Auch seine Jeans machte einen fürchterlichen Eindruck, voller Schmutz und Blutflecken, aber auch das war egal.
»Ungefähr eine Stunde von hier. Fahren wir. – Jetzt, wo Sie etwas anhaben«, Commissaire Rose konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen.
»Riwal. Können Sie mir etwas Essbares aus dem Automaten holen? Irgendwas, Kekse, einen Schokoriegel, egal.«
»Gut, Chef.«
Dupin hatte seit heute Mittag nichts mehr gegessen. Er war völlig unterzuckert.
»Und noch einen café. Wir treffen uns am Wagen der Kommissarin.«
Riwal war mit Dupins letzten Worten schon aus der Tür.
»Wissen Sie, wo Lilou Breval arbeitet? In welcher Redaktion?«, wie schon zuvor lag in Commissaire Roses Fragen und Sätzen etwas Treibendes.
»Sie gehört offiziell zur Redaktion in Vannes. Aber sie arbeitet größtenteils von zu Hause, denke ich.«
Der Ouest-France war die größte Tageszeitung Frankreichs – und zusammen mit Le Télégramme, sowie Le Monde, Dupins streng ritualisierte tägliche Lektüre. Eigentlich war Ouest-France die atlantische Zeitung schlechthin: Sie erschien von La Rochelle die Küste hinauf, in der gesamten Bretagne, dem Pays de la Loire und auch noch in der Normandie und verfügte über lokale Redaktionen in jeder größeren Stadt.
»Vielleicht weiß ein Kollege, an welcher Sache Ihre Freundin da dran ist.«
Commissaire Rose hatte »Freundin« forciert vielsagend betont.
»Das halte ich für unwahrscheinlich.«
Lilou war nicht der Typ, der im Team recherchierte.
»Sie müssen mir unterschreiben, dass Sie das Krankenhaus auf eigene Gefahr verlassen«, der desinteressierte Arzt hatte sich die letzten Minuten im Hintergrund gehalten und irgendwelche Formulare ausgefüllt, »zur Standardbehandlung gehören Schmerzmittel und zur Prophylaxe Antibiotika«, er hielt Dupin zwei Packungen hin, »die Schmerzmittel benebeln Sie vielleicht ein bisschen. Auch deswegen keinen Alkohol.«
Dupin nahm die beiden Schachteln, steckte sie in die Jeans und war im nächsten Augenblick aus dem Raum. Commissaire Rose tat es ihm nach.
Auf dem langen Flur hatte sie Dupin im Nu überholt und steuerte zielsicher auf den Ausgang zu. Sie hatte direkt vor der Notfallambulanz geparkt.
Dupin blieb kurz stehen und atmete in der sanften Sommernacht ein paarmal tief ein und aus. Das Krankenhaus lag auf einer kleinen Anhöhe direkt vor der Stadt, man hatte einen perfekten Blick auf das mittelalterliche stimmungsvolle Guérande – drastischer konnte der Kontrast zum sterilen grellen Licht und der funktionellen Neubau-Architektur der Klinik nicht sein. Dupin fühlte sich an die Ville close in Concarneau erinnert, es hatte etwas Tröstliches, wie die gewaltigen Stadtmauern und Türme in warmem Licht erstrahlten.
Commissaire Rose war schon bei ihrem Wagen. Ein großer, neuer Renault Laguna. Dunkelblau. Dupin ging zur Beifahrertür.
»Das war das einzig Akzeptable im Automaten.«
Riwal war wie aus dem Nichts neben dem Wagen der Kommissarin aufgetaucht und hielt Dupin ein Päckchen Bonbons caramel à la fleur de Sel und einen weiteren Plastikbecher entgegen.
Dupin nahm beides dankbar entgegen. Salzkaramellbonbons waren nicht das, was er in einem Krankenhaus erwartet hätte, aber die regionale Identifikation mit dem Salzland war offenbar groß. Zudem liebte er zugegebenermaßen diese Karamellbonbons, das Herbsüße mit den Salzstückchen.
»Keine Seezunge, aber immerhin.«
Riwal blickte Dupin mit gerunzelter Stirn an, er wirkte fast besorgt. Commissaire Rose saß bereits auf dem Fahrersitz und beobachtete sie ungeduldig. Die Luft tat Dupin gut, auch die Aussicht auf das weitere Koffein.
»Riwal, Sie versuchen es in Vannes bei der Redaktion. Sicherheitshalber bei Kolleginnen und Kollegen. Sie werden auch jetzt noch Mitarbeiter der Zeitung erreichen«, auch das Auftrag-Erteilen half, merkte Dupin, es fühlte sich alles schon wieder etwas normaler an. »Lassen Sie sich die Namen und Nummern der Kollegen geben, mit denen Lilou Breval arbeitet. Auch vom Leiter der Redaktion. Rufen Sie alle umgehend an. – Und kontaktieren Sie Kadeg, er soll morgen früh kommen und«, Dupin überlegte kurz, »davor im Büro vorbeifahren. Neben meinem Schreibtisch steht eine große blaue Tüte. Die soll er unbedingt mitbringen.«
Riwal kannte den Kommissar zu gut, um bei solchen Instruktionen Fragen zu stellen. Während Dupin in tatkräftiger Manier seine Aufträge formuliert hatte, war er – aufgrund der lädierten Schulter und des cafés in der Hand – etwas umständlich in den Wagen geklettert.
Als er saß, lehnte sich Commissaire Rose weit zu ihm herüber, so weit es ging:
»Wir werden jetzt, so rasch es irgendwie geht, das Gespräch mit der Journalistin führen. Da werden Sie dabei sein – und danach – danach sind Sie raus. Hören Sie mich? Danach sind Sie ein Zeuge in meinem Fall. Genau das und nicht mehr. Ich allein ermittle. Ich meine das selbstverständlich freundlich und kollegial.«
Sie hatte mit souveräner Ironie gesprochen, süßlich, aber nicht sarkastisch. Es machte Dupin rasend. Aber objektiv gesehen hatte sie auch in diesem Punkt alles auf ihrer Seite, die Polizeibestimmungen und die Gesetze sowieso.
Es war das Klügste, zu schweigen.
Mit einer resoluten Bewegung startete Commissaire Rose den Motor und trat im nächsten Moment kräftig auf das Gaspedal.
Sie hatten vierzig Minuten gebraucht, mit Blaulicht und Sirene und Geschwindigkeiten jenseits sämtlicher Begrenzungen innerhalb und außerhalb geschlossener Ortschaften, auch auf den kleinsten Landstraßen. Sie hatten zu Dupins Erleichterung nicht viel gesprochen. Die Wirkung der Betäubung hatte nachgelassen, die Schmerzen an der Schulter zugenommen. Dupin hatte eine der Schmerztabletten genommen, er konnte sich keine Schwäche erlauben. Und fünf der Salzkaramells gegessen, was immerhin sehr gutgetan hatte.
Er hatte während der Fahrt viele Male versucht, Lilou Breval zu erreichen, jetzt wieder mit seinem Handy, das auf dieser Strecke endlich Empfang hatte. Vergeblich. Commissaire Rose hatte ein paarmal merkwürdig beunruhigt geguckt, viel beunruhigter als eben in den Salinen.
Lilou Breval wohnte in der Nähe von Brillac, ein paar Kilometer von Sarzeau entfernt, direkt am Golfe du Morbihan, einem der magischsten Landstriche der Bretagne – einem, fand auch Dupin, ganz ohne bretonische Übertreibung, veritablen Wunder der Natur. Mor bihan bedeutete »kleines Meer« auf Bretonisch: ein Binnenmeer, lediglich durch eine schmale »Passage« mit dem »Großen Meer« – dem Mor braz – verbunden, durch die der Ozean täglich mit Macht ein- und ausströmte. Durchsetzt von Hunderten Inseln und Inselchen – je nach Tidenstand – in den fantasievollsten Formen, lediglich zwanzig davon bewohnt. Ein flaches Meer, ein paar Meter tief nur bei Flut. Bei Ebbe war es in großen Teilen bloß noch Zentimeter tief oder gänzlich verschwunden. Dann gab das Meer kilometerweit sandigen, schlickigen oder steinigen Meeresboden frei, mit großen und kleinen Prielen, lang gezogenen, blendend weißen Sandbänken sowie Austern- und Muschelbänken. Bei Flut sah es aus, als trieben die vielen flachen, dicht bewaldeten Inseln auf dem Meer, als hätte man sie behutsam wie Boote zu Wasser gelassen. Romantische Wäldchen mit romantischen Namen: Wald der Seufzer, der Liebenden, der Traurigkeit, der Sehnsucht. Eine anmutige Mischung aus Grün in allen Nuancierungen und dem Blau der Fluten, des Himmels in ebenso vielen Nuancierungen.
Dupins Freund Henri, auch ein »Exilpariser« – der aber immerhin eine Bretonin geheiratet hatte –, besaß ein Haus am Golfe du Morbihan, in der Nähe von Port Saint-Goustan. Dupin hatte ihn im letzten Juni dort besucht, sieben Tage war er dort gewesen, die allerersten offiziellen Ferientage seit Langem – und er hatte es geliebt. Von dort aus waren sie auch nach Le Croisic gefahren. Der Golf war eine eigene Welt. Der Atlantik verlor hier seinen Schrecken, alles Raue, Ungestüme und Gewaltige, und wurde zum beschaulichen Stillleben. Das sanfte Land, das ihn umarmte, schien ihn ruhig werden zu lassen. Dennoch war das Meer ganz da. Und bestimmte alles. Es herrschte ein besonderes Klima, »mediterran« oder »subtropisch« nannten die Bretonen es stolz. Viel Sonne, eine reiche Flora und Fauna, mild, fruchtbar. Dupin hatte besonders geliebt, dass es ein großes Reservoir für Seepferdchen war (die er verehrte, fast wie Pinguine); das Seepferdchen war auch das Wappen des Nationalparks und Bioreservates, als das der Golf seit Jahren geschützt wurde.
Eine der ersten bretonischen Lektionen, die Nolwenn Dupin beigebracht hatte, lautete: »Die Bretagne gibt es nicht! Es gibt viele Bretagnen.« So divers waren die bretonischen Landschaften, so groß die Unterschiede, Kontraste, Eigenheiten, die Widersprüche. Und es stimmte, hatte Dupin gelernt. In diesem Satz lag vielleicht überhaupt das letzte und größte Geheimnis der Bretagne. Und der Golf, das war für ihn die Bretagne der Sommersonne, der Nonchalance, der prächtigen Regatten, des angenehmen Badens, des Müßigganges, den sogar das Meer übte. Ein »Königreich des Müßiggangs« nannte man den Golf liebevoll.
Dupin hatte während der Fahrt aber auch an die melancholische Legende über die Geburt des Golfs denken müssen, die Henri ihm erzählt hatte. Einst hatte hier der heilige Wald von Rhuys gestanden – wie die ganze Bretagne von heiligen Wäldern durchzogen war –, die Heimat eines der wundersamsten Feenvölker, von denen bis heute Dutzende Namen und Geschichten überliefert waren. In ruchloser Weise begann der Mensch, den magischen Wald abzuholzen, das einzigartige Zauberreich zu zerstören. Und vertrieb so die Feen. Fliegend suchten sie das Weite. Sie weinten bitterlich. Die Tränen fielen hinab, unendlich viele, und überschwemmten alles. In ihrer tiefen Trauer warfen die Feen auch ihre Haarkränze weg, und aus jenen, mit goldenem Staub übersät, wurden die wunderschönen Inseln. So viele, dass es für jeden Tag des Jahres eine gab. Der Golf, er war ein Meer aus Tränen.

























